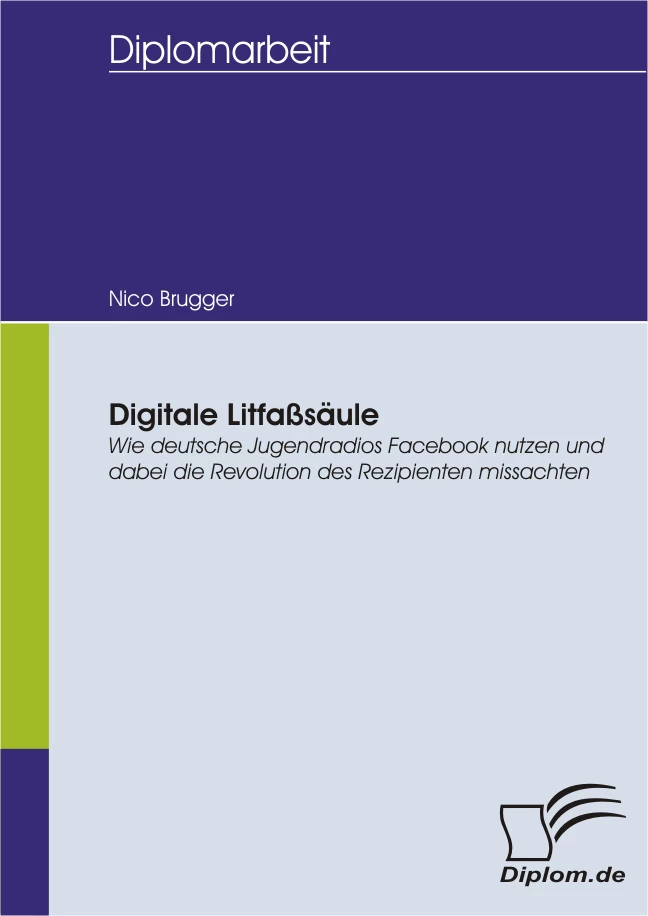Digitale Litfaßsäule: Wie deutsche Jugendradios Facebook nutzen und dabei die Revolution des Rezipienten missachten
Zusammenfassung
Knapp zwei Drittel der Deutschen, also 52,7 Millionen, sind online (TNS Infratest: o.S.). Ganz klar: Das Internet ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Ebenso wenig wie sein erfolgreichstes Kind namens Facebook, das inzwischen sogar Google in der Verweildauer überholt hat (sueddeutsche.de 2011: 1). Rund ein Viertel der deutschen Bevölkerung sind bereits aktive Mitglieder in diesem sozialen Netzwerk (Fittkau & Maaß 2011: o.S.). Auf keiner anderen Seite des Internets verbringen die Deutschen mehr Zeit, beteiligen sich aktiver am Inhalt oder nutzen es häufiger über ihr Smartphone. Ein Ende des Wachstums ist noch nicht in Sicht. So hat Facebook nach eigenen Angaben bereits über 800 Millionen aktive Nutzer zu Beginn dieser Arbeit im März 2011 waren es noch 100 Millionen weniger (vgl. facebook.com a): o.S.). Facebook ist damit bereits sieben Jahre nach seiner Gründung weltweit zur wichtigsten Kommunikationsplattform im Internet geworden. Wie stark die Auswirkungen das Leben der Menschen beeinflusst, zeigen folgende Beispiele:
Im Zuge derRevolutionen in den arabischen Ländern galt Facebook als eines der wichtigsten Werkzeuge der Aufständischen. Es half bei der Koordination und Kommunikation der Aktionen und ermöglichte so den Zusammenschluss der Bewegung.
Als der ehemalige Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg am 1. März 2011 wegen seiner Plagiatsaffäre von seinem Amt als Verteidigungsminister zurücktreten musste, schlossen sich seine Anhänger in einer Facebook-Bewegung zusammen. Noch acht Monate später hat die Gruppe Gegen die Jagd auf Karl-Theodor zu Guttenberg über 337.000 Anhänger. Angela Merkel kommt im Vergleich gerade einmal auf 115.000 (Stand: 14.11.2011).
Wie schnell sich Nachrichten über Facebook verbreiten, musste auch die 16-jährige Thessa aus Hamburg miterleben. Sie hatte zu ihrem 16. Geburtstag auf Facebook aus Versehen öffentlich eingeladen. Die Folge: Über 1.000 fremde Personen kamen zum Wohnhaus ihrer Eltern, Scharen von Journalisten und ein Großaufgebot der Polizei inklusive (stern.de 2011: 1).
Die Beispiele zeigen, wie schnell und unmittelbar Bewegungen sich über Facebook vernetzen und ihre Nachrichten verbreiten. Diese Entwicklung spielt für die Medien eine große Rolle. Über Jahrzehnte hinweg waren es die Massenmedien, die über die Auswahl der Nachrichten entschieden und sie verbreiteten. Diese Rolle haben sie nicht gänzlich verloren. Aber die Spielregeln in der digitalen Weltsind andere […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Entwicklung und Theorieansätze zu Social Media
2.1 Social Media
2.1.1 Was ist Social Media - Begriffsklärung
2.1.2 Social Media ist anders
2.1.3 Das Prinzip der Zeigespirale
2.2 Geschichte – Von der Entstehung des Internets bis Facebook
2.2.1 Geschichte von Internet und Social Media
2.2.2 Entwicklung von Facebook
2.2.3 Alles Facebook oder was? Die Konkurrenz oder was davon noch übrig ist
2.3 Social Media Theorien
2.3.1 Medien im Wandel
2.3.2 Das Cluetrain-Manifest
2.3.3 Von Blogs lernen
2.3.4 Crowdsourcing
2.3.5 Social Media Modelle – Das Drei-Ebenen-Modell
2.4 Social Media Marketing
2.4.1 Grundzüge des Social Media Marketing
2.4.2 Grundüberlegungen für einen Social-Media-Auftritt
2.4.3 Überlegungen für Medienbetriebe: Wie und was wollen wir kommunizieren?
2.5 Virales Marketing
2.5.1 Was ist Virales Marketing?
2.5.2 Memetik
2.5.3 The Tipping Point
2.5.4 Memetische Trigger
3 Der Markt der (Jugend-) Radios und Mediennutzung
3.1 Die deutsche Radiolandschaft
3.2 Das Jugendradio
3.3 Mediennutzung von Jugendlichen
3.4 Typologie des Digital Natives
3.5 Nutzung von Facebook-Fanseiten
4 Nachrichtenwertforschung
4.1 Die Geschichte der Nachrichtenwertforschung
4.2 Nachrichtenfaktoren heute
5 Methodik und Aufbau der Untersuchung
5.1 Wahl der Methode
5.2 Die Inhaltsanalyse
5.3 Das Leitfadengespräch
5.4 Forschungsfrage und Annahmen
5.5 Untersuchungsgegenstand
5.5.1 bigFM (Privat)
5.5.2 JAM FM (Privat)
5.5.3 Sunshine Live (Privat)
5.5.4 1LIVE (WDR)
5.5.5 DASDING (SWR)
5.5.6 MDR Jump
5.6 Analyseeinheit und Erhebungszeitraum
5.7 Anlage der Untersuchung
5.8 Pretest
6 Ergebnisse der Analysen
6.1 Grundlagen
6.1.1 Häufigkeit der Postings
6.2 Das ideale Posting – Gibt es das überhaupt?
6.2.1 Länge
6.2.2 Wochentage
6.2.3 Vergangene Zeit seit dem vorangegangenen Posting
6.2.4 Form
6.2.5 Thema
6.2.6 Darstellungsform
6.3 Nachrichtenfaktoren
6.4 Meme
6.5 Weitere Faktoren
6.6 Mit gutem Beispiel voran: Postings mit besonders vielen Kommentaren
6.6.1 Das Prinzip Henne oder Ei
6.7 Mit gutem Beispiel voran: Postings mit besonders vielen „Gefällt mir“-Klicks
6.7.1 Zuhören, Aufnehmen, Mitreden
6.7.2 Die Zukunft von Facebook und Social Media
7 Schlussbetrachtung
7.1 Jetzt mal ganz grundsätzlich: Ziele definieren
7.2 Jetzt mal ganz konkret: Zusammenfassung der Ergebnisse
7.3 Jetzt mal ganz zum Schluss: Der Rezipient ist der Souverän
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Anhang
1 Einleitung
Knapp zwei Drittel der Deutschen, also 52,7 Millionen, sind online (TNS Infratest: o.S.). Ganz klar: Das Internet ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Ebenso wenig wie sein erfolgreichstes Kind namens Facebook, das inzwischen sogar Google in der Verweildauer überholt hat (sueddeutsche.de 2011: 1). Rund ein Viertel der deutschen Bevölkerung sind bereits aktive Mitglieder in diesem sozialen Netzwerk (Fittkau Maaß 2011: o.S.). Auf keiner anderen Seite des Internets verbringen die Deutschen mehr Zeit, beteiligen sich aktiver am Inhalt oder nutzen es häufiger über ihr Smartphone. Ein Ende des Wachstums ist noch nicht in Sicht. So hat Facebook nach eigenen Angaben bereits über 800 Millionen aktive Nutzer – zu Beginn dieser Arbeit im März 2011 waren es noch 100 Millionen weniger (vgl. facebook.com a): o.S.). Facebook ist damit bereits sieben Jahre nach seiner Gründung weltweit zur wichtigsten Kommunikationsplattform im Internet geworden. Wie stark die Auswirkungen das Leben der Menschen beeinflusst, zeigen folgende Beispiele:
Im Zuge der Revolutionen in den arabischen Ländern galt Facebook als eines der wichtigsten Werkzeuge der Aufständischen. Es half bei der Koordination und Kommunikation der Aktionen und ermöglichte so den Zusammenschluss der Bewegung.
Als der ehemalige Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg am 1. März 2011 wegen seiner Plagiatsaffäre von seinem Amt als Verteidigungsminister zurücktreten musste, schlossen sich seine Anhänger in einer Facebook-Bewegung zusammen. Noch acht Monate später hat die Gruppe „Gegen die Jagd auf Karl-Theodor zu Guttenberg“ über 337.000 Anhänger. Angela Merkel kommt im Vergleich gerade einmal auf 115.000 (Stand: 14.11.2011).
Wie schnell sich Nachrichten über Facebook verbreiten, musste auch die 16-jährige Thessa aus Hamburg miterleben. Sie hatte zu ihrem 16. Geburtstag auf Facebook aus Versehen „öffentlich“ eingeladen. Die Folge: Über 1.000 fremde Personen kamen zum Wohnhaus ihrer Eltern, Scharen von Journalisten und ein Großaufgebot der Polizei inklusive (stern.de 2011: 1).
Die Beispiele zeigen, wie schnell und unmittelbar Bewegungen sich über Facebook vernetzen und ihre Nachrichten verbreiten. Diese Entwicklung spielt für die Medien eine große Rolle. Über Jahrzehnte hinweg waren es die Massenmedien, die über die Auswahl der Nachrichten entschieden und sie verbreiteten. Diese Rolle haben sie nicht gänzlich verloren. Aber die Spielregeln in der digitalen Welt sind andere geworden. Auf Facebook entscheidet nicht der Kommunikator darüber, wie oft seine Nachricht als Hauptmeldungen auf der Startseite der User angezeigt wird, sondern die Masse der User selbst. Was im Punkt 2.1.3 unter dem „Prinzip der Zeigespirale“ aufgezeigt wird, beschreibt die Verlagerung der Gatekeeper-Funktion zugunsten der Rezipienten. Aus medialer Perspektive hat diese Verschiebung auch einen positiven Effekt: Die Verbreitung einer Nachricht kann durch Teilen, Kommentieren und Klicken des „Gefällt mir“-Buttons von tausenden Usern unterstützt werden und sich damit viel schneller verbreiten. Um die User mit Informationen erreichen zu können, haben deshalb fast alle Medien so genannte Fanpages. Die User können durch einen Klick zum Fan dieser Seiten werden und bekommen ab dann die veröffentlichten Nachrichten dieses Mediums angezeigt. Wie die Medienunternehmen mit diesen veränderten Strukturen umgehen sollen, wird von ihnen seit einiger Zeit stark diskutiert. Noch wissen viele Verlage und Sender nicht, mit welcher Strategie sie sich am besten in den Social Media positionieren. Deshalb lautet die Forschungsfrage dieser Arbeit, welche Faktoren bei den Postings der untersuchten Jugendradiosender auf Facebook eine Steigerung der Beteiligung ihrer Fans auslösen.
Dazu wurden die Fanseiten von sechs Jugendradiosendern in Deutschland untersucht, denen zwischen 30.000 und knapp 200.000 Fans folgen. Als theoretische Grundlage wurde dabei zuerst der Charakter von Social Media näher beleuchtet. Er zeigt, dass sich durch das Web 2.0 mediale Monologe (einer zu vielen) in sozial-mediale Dialoge (viele zu vielen) gewandelt haben und sich dadurch die Rolle des Rezipienten von einer passiven in eine aktive Rolle verändert hat. Die Geschichte des Internets und die Entwicklung von Facebook, die im nächsten Abschnitt zusammengefasst dargestellt werden, zeigen, mit welcher Geschwindigkeit sich die Kommunikation in den vergangenen Jahren grundlegend verändert hat. Die Entwicklungen sind noch so jung, dass die Kommunikationswissenschaft bisher erst wenig darüber weiß. Erste theoretische Ansätze zu Social Media wie das „Drei-Ebenen-Modell“ von Michelis versuchen, die neuen Phänomene einzuordnen und zeigen, dass die „individuelle Ebene“ des Nutzers dabei im Mittelpunkt steht. Um weitere theoretische Grundlagen zu finden, hilft der Blick in den Bereich des Social Media Marketing. Hier gibt es eine ganze Reihe von Ratgebern, die anhand praktischer Tipps erklären, an welche Regeln sich Unternehmen im Social Web halten sollten, um ihre Ziele zu erreichen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den Mechanismen des viralen Marketings geschenkt. Es beschreibt das „gezielte Auslösen und Kontrollieren von Mund-zu-Mund-Propaganda zum Zwecke der Vermarktung der Unternehmen und deren Leistungen“ (Langner 2006: 25). Welche Themen dafür besonders geeignet sind, beschreibt der Ansatz der Memetik. Markus Roder hat dazu eine Reihe von memetischen Triggern definiert, deren Wirksamkeit in der Inhaltsanalyse anhand der Anzahl der Reaktionen seitens der User überprüft wird.
In Kapitel 3 wird näher auf den Markt der Jugendradios und die Mediennutzung der Zielgruppe eingegangen, denn das junge Publikum nutzt das Internet und Facebook von allen Altersgruppen mit Abstand am stärksten. Deshalb ist für diese Sender eine erfolgreiche Arbeit auf Facebook besonders wichtig. Das Mediennutzungsverhalten der 14- bis 29-Jährigen zeigt, dass sich die Social Media bei ihnen bereits zu persönlichen Dauerplattformen etabliert haben – damit sind sie oft der entscheidende Impulsgeber beim Medienkonsum . Eine Untersuchung zur Nutzung von Fanseiten gibt darüber hinaus Aufschluss über die Erwartungen und Wünsche der User.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Forschung zu Nachrichtenfaktoren klassischer Medien. Sie geht davon aus, dass die ausgewählten Ereignisse bestimmte Merkmale aufweisen, die ihren Nachrichtenwert und damit ihre Publikationswürdigkeit bestimmen. Neben der Entwicklung dieser Faktoren wird ein besonderes Augenmerk auf die jüngste Studie in diesem Feld von Ruhrmann Göbbel (2007) gelegt. Die zehn wichtigsten Faktoren, die darin von Journalisten aus allen Mediensparten definiert wurden, wurden um die vier stärksten Online-Klick-Faktoren nach Seibold (2002: 52) ergänzt. Diese insgesamt 14 Nachrichtenfaktoren werden in der Inhaltsanalyse auf ihr Vorkommen und die Anzahl der damit verbundenen Reaktionen untersucht.
Kapitel 5 und 6 beschreiben die Anlage und Auswertung der Untersuchung. Da es bisher keine ähnlich angelegte Forschung in diesem Untersuchungsfeld gab, wurden zunächst Leitfadengespräche geführt. Die sechs, nach Hörerzahl und Facebook-Fans ausgewählten Sender sind 1LIVE, MDR JUMP, DASDING, bigFM, JAMFM und sunshine live. Sie geben Aufschluss über Ziele, Strategie und Arbeitsweise auf Facebook. Auf dieser Grundlage wurden 18 Hypothesen gebildet, die über eine Inhaltsanalyse überprüft wurden. Von jedem der sechs Sender wurden dazu 100 Postings analysiert und mit der Zahl der Reaktionen ihrer User verglichen. Das Resultat beweist, dass sich die Wichtigkeit der Nachrichtenfaktoren bei Facebook deutlich von anderen Medien unterscheidet und etablierte Annahmen, wie die Additivitätshypothese von Galtung Ruge (1965: 71 ff.) für die sozialen Netzwerke kaum noch Gültigkeit besitzen. Darüber hinaus kann für eine ganze Reihe von Faktoren wie Zeit, Länge, Thema und Darstellungsform festgestellt werden, dass sie die Zahl der Reaktionen beeinflussen. Diese Kennzahlen und liefern ein wertvolles Feedback für die Sender.
Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist es, einen Mehrwert für Medienunternehmen zu bieten. Dennoch sind die Analysen und Ergebnisse nicht als in Stein gemeißelte Anleitungen zu verstehen. Sie sollen mehr ein Gefühl dafür geben, wie weit die Vorstellungen von Usern und Sendern teilweise auseinander gehen und was man tun kann, um sich besser auf die Wünsche seiner Fans einzustellen. Die Arbeit erhebt in Bezug auf die Faktoren, die die Zahl der Reaktionen beeinflussen, keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Denn eine gute Social-Media-Strategie hängt im Wesentlichen von den eigenen Zielen und der damit verbundenen Zielgruppe ab. Beide Determinanten müssen für jeden Facebook-Auftritt neu definiert werden und erst daraus können konkrete Strategien ermittelt werden.
Die Untersuchung soll aber helfen, die Mechanismen der Social Media besser zu verstehen, um am Beispiel der untersuchten Sender die Faktoren für erfolgreiche Postings zu begreifen und damit die Kommunikation mit der eigenen Zielgruppe zu verbessern. Kailash Ambwani, Präsident von FaceTime Communications[1], bringt es auf den Punkt (socialmediatoday.com 2011: 1):
„Google is all about content; Facebook is all about communication.“
2 Entwicklung und Theorieansätze zu Social Media
2.1 Social Media
2.1.1 Was ist Social Media - Begriffsklärung
Soziale Netzwerke, Chats, Foren, Wikis: Das alles ist Social Media. Ebenfalls gehören zu dieser Gruppe Blogs, SMS, Links, Fotos, Videos und Online-Medien. Nachrichten, Meinungen, Daten und Informationen werden gesendet und empfangen, und zwar von einer einzelnen Person, die Journalist oder Rezipient sein kann. (vgl. Bernet 2010a: 9). Damit ist dem klassischen Modell von Sender und Empfänger kaum bis keine Bedeutung mehr beizumessen. Soziale Interaktionen und Zusammenarbeit werden immer wichtiger und wandeln mediale Monologe (einer zu vielen) in sozial-mediale Dialoge (viele zu vielen) um. Das Web 2.0, auf dessen Basis Social Media funktionieren, bietet die Möglichkeit, „Internetauftritte so zu gestalten, dass ihre Erscheinungsweise in einem wesentlichen Sinn durch die Partizipation ihrer Nutzer (mit-) bestimmt wird“ (Münker 2010: 31). Ein Beispiel für eine einfache Form der Partizipation durch Kommentierung und Bewertung ist Spiegel Online. Auf der anderen Seite der Skala steht eines der radikalsten Angebote, das ausschließlich von Nutzern generiert wird (User Generated Content): die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Die Möglichkeit zur Kommunikation, Interaktion und Partizipation sind auch die Gründe, warum Soziale Netzwerke wie Facebook von vielen Nutzern „bewusst als Alternative zu den konventionellen Angeboten der traditionellen Massenmedien verstanden werden“.
2.1.2 Social Media ist anders
Um den Charakter von Social Media richtig einordnen zu können, hilft ein Blick auf eine klassische Definition der Massenmedien nach Maletzke (1998: 45f.):
„Unter Massenkommunikation verstehen wir jene Form der Kommunikation, bei der Aussagen öffentlich (also ohne begrenzte und personell definierte Empfängerschaft) durch technische Verbreitungsmittel (Medien) indirekt (also bei räumlicher oder zeitlicher oder raumzeitlicher Distanz zwischen den Kommunikationspartnern) und einseitig (also ohne Rollenwechsel zw. Aussagenden und Aufnehmenden) an ein disperses Publikum vermittelt werden."
Das Internet und speziell das Web 2.0 ist damit kein Massenmedium, denn es ist weder indirekt noch einseitig (vgl. Münker 2010: 34ff.). Streng genommen ist das Internet nicht einmal ein Medium, sondern nur die technische Infrastruktur zur Generierung von Medien. Das Web 2.0 lebt von der Partizipation und Interaktion der Nutzer und entspricht dadurch keiner Definition der Medialität von Massenmedien. Yochai Benkler (2006: 219) schreibt, die vernetzte öffentliche Sphäre sei „nicht aus Werkzeugen gemacht, sondern aus sozialen Praktiken, welche durch diese Netzwerke ermöglicht wurden“. Demnach steht diese Definition im Gegensatz zu klassischen Annahmen der Kultur- und Medienwissenschaft (Münker 2010: 34ff.), die besagen, dass die „(technische) Materialität von Medien ihren Gebrauch determinieren und damit zumindest mittelbar auch die mit ihnen erzeugte Bedeutung“. Für den Bereich von Social Media gelten für Münker jedoch andere Gesetze: „Digitale Medien determinieren ihren Gebrauch nicht; digitale Medien entstehen erst durch ihren Gebrauch!“ Er argumentiert, dass man natürlich auch alleine die Weiten der Netzwelt erkunden könne. Dennoch: „Wir können aber soziale Netzwerke nur nutzen, weil andere das auch tun – versuchen Sie einmal mit sich selber zu twittern!“ (ebd.: 34ff.) So ist die Entstehung der Öffentlichkeit ein emergentes Phänomen, für das es verschiedene Ursachen und in dessen Folge es unvorhersehbare und unerwartete Effekte gibt. Social Media sind damit, anders als die elektronischen Massenmedien, immer immersiv. Als Nutzer von Facebook ist man Teil des Webs. Durch Einschalten von Radio oder Fernsehen hingegen wird man genauso wenig Teil des Mediums wie beim Lesen der Zeitung. „Gleichwohl gilt, dass die Dynamik des Web 2.0 das digitale Netz mit seinen mittlerweile weltweit ungefähr 1,25 Milliarden Nutzern endgültig zu einem, ja zu dem Medium der Massen für das 21. Jahrhundert hat werden lassen.“ (Münker 2010: 34).
Durch den Facebook-Aufritt, ganz gleich ob von Printmedien , Radio- oder Fernsehsendern wird also aus einem Massenmedium, das seinen Nutzern eine Nachricht kommuniziert, eine immersive, interaktive Plattform. Es kommt zu einer Vermischung von Rezeption und Partizipation der Angebote. Die Zukunft der Massenmedien hängt davon ab, ob ihnen „nach der technisch vollzogenen Digitalisierung auch die mediale Transformation von Massenmedien zu massenhaft genutzten Netzmedien gelingt“ (Elektrischer Reporter 2010). Dabei spielt auch eine weitere wichtige Charaktereigenschaft des Internets eine Rolle.
„Anders als etwa bei einer Livefernsehübertragung, versendet sich nichts. Die Inhalte bleiben auffindbar und rutschen lediglich auf dem Zeitstrahl in die Vergangenheit. So ist das Echtzeit Web eine Mischung aus einem Ticker für persönliche Nachrichten und einem öffentlichen Chat. Jeder kann mitreden, aber die Mechanismen sind neu. Ob eine Nachricht nur eine Handvoll oder ein ganze Menschenmasse erreicht, hängt weniger vom Absender ab als mehr von den Empfängern.“ (Elektrischer Reporter 2010)
2.1.3 Das Prinzip der Zeigespirale
Der Einfluss des Rezipienten im Social Web lässt sich durch folgendes Denkmodell beschreiben: Die Nutzer entscheiden, ob eine Nachricht als empfehlenswert gesehen wird oder nicht. Wenn ja, wird sie weitergeleitet, geteilt, selbst gepostet, kommentiert oder mit dem Prädikat „Gefällt mir“ versehen. Das wiederum verschafft ihr auf den Startseiten der Freunde eine höhere Wichtigkeit, wodurch sie häufiger und prominenter angezeigt wird. Dadurch steigt wiederum die Wahrscheinlichkeit, gelesen, geteilt und kommentiert zu werden. Es tritt eine Art Zeigespirale in Kraft. Je mehr Menschen ein Thema gefällt, desto mehr Menschen bekommen es angezeigt. Die Verantwortung der Gatekeeper-Funktion, die ehemals explizit den Journalisten oblag, wird bei Facebook neu definiert. Zwar wählt die Nachricht selbst im Fall eines professionellen Social-Web-Auftrittes immer noch ein Redakteur oder Angestellter des Senders aus. Erst die Nutzer aber entscheiden durch ihre Möglichkeit zur Partizipation, wie viele Menschen diese Nachricht lesen werden. In den Medien herrschte bislang aufgrund von Sendezeiten und Zeilenvorgaben Knappheit. Dadurch gab es das Prinzip: „Erst filtern, dann veröffentlichen.“ Doch in Facebook steht für Jedermann unbegrenzt Kapazität zur Verfügung. Jeder kann jederzeit senden, was er will. Dadurch dreht sich das System um: „Zuerst veröffentlichen, dann filtern.“ Das Prinzip läuft folgendermaßen: Facebook unterscheidet zwischen „Neueste Meldungen“ und „Hauptmeldungen“. Die kaum beachteten „Neuesten Meldungen“ zeigen alle Handlungen ungefiltert in Echtzeit an, die von Freunden durchführt werden. Als Hauptmeldungen wird hingegen nur ein gewisser Ausschnitt der gesamten Meldungen angezeigt. Der „Neuigkeiten“-Algorithmus nimmt dazu verschiedene Faktoren als Grundlage: Wie viele Freunde haben einen bestimmten Inhalt kommentiert, wer hat den Inhalt gepostet und um welche Art Inhalt handelt es sich (z.B. Foto, Video oder Statusmeldung)? (vgl. facebook.com 2011) Was als Hauptmeldung gefällt, wird weiter gezeigt oder in eine eigene Nachricht eingebaut.
Die Anzahl der Kommentare und „Gefällt mir“-Klicks spielt also eine wichtige Rolle bei der Bewertung des Erfolgs eines Postings. Denn der Facebook-Algorithmus lässt sich durch viele Kommentare und „Gefällt mir“-Klicks beeinflussen. Das heißt: Je mehr User sich an einem Posting beteiligen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Posting auch anderen Usern angezeigt wird.
2.2 Geschichte – Von der Entstehung des Internets bis Facebook
2.2.1 Geschichte von Internet und Social Media
Um zu verstehen, warum Social Media und im speziellen Facebook einen so hohen Stellenwert in der aktuellen Medienentwicklung inne haben, soll in diesem Kapitel die noch junge Entwicklung dieses Feldes dargelegt werden. Will man die Geschichte von Facebook und Social Media betrachten, so kann man sie nur im Kontext der Entwicklungen des Internets im Allgemeinen sehen. Wer das Internet erfunden hat und welche Bewegungen als Vorläufer betrachtet werden können, darüber sind sich auch die Experten nicht einig. Ein Meilenstein in der Entwicklung ist das 1969 in Kalifornien startende Arpanet mit dem zum ersten Mal der Begriff des Internets Verwendung findet. Mit dem Arpanet war es erstmalig gelungen, Rechner verschiedener Art miteinander zu vernetzen. Universitäten und das Militär in den USA nutzten diese Technik zur besseren Kommunikation. Auch in den 70-er und 80-er Jahren gab es Strömungen wie zum Beispiel die Open-Source-Bewegung, die eine neue Praxis der Softwareprogrammierung einführten und damit das heutige Social Web mitprägten. Die Geburtsstunde des Internets wird jedoch häufig erst auf das Jahr 1991 datiert, als das World Wide Web auf der Basis von Tim-Berners Lees implementierten Hypertext Markup Language (HTML) graphisch, und damit für eine breite Masse zugänglich wurde (vgl. Lischka 2011: 1). Bis 2004 war es jedoch nicht viel mehr als eine Art „Litfaßsäule (...) ein Medium der Verlautbarung und Veröffentlichung von Informationen, die von Anbietern an Interessenten weitergeben wurden“ (Münker 2010: 31). Neu war seit 1991 schon die Möglichkeit, Inhalte zeit- und raumübergreifend nutzbar zu machen. Doch erst die Dynamisierung von Webseiten im Jahr 2004 und die damit einhergehende Implementierung offener Schnittstellen ermöglichten es, das Internet beschreibbar zu machen und ebneten den Weg für ein „Medium der spontanen Interaktion mit vernetzten Informationen“ (ebd.: 31). Die offenen Schnittstellen ermöglichen Transparenz, Partizipation und Kollaboration und sind damit einer der Grundpfeiler für das Web 2.0, das 2004 erstmals vorgestellt wurde. Durch das Web 2.0 entwickelte sich das Internet mit seiner „statischen Angebotsstruktur zu einer dynamischen Plattform“ (ebd. :31) und legte den Grundstein für die rasante Entwicklung der Social Media, die noch immer am Anfang steht. Im Oktober 2004 fand in San Francisco die erste der noch heute jährlich stattfinden Web 2.0-Konferenzen statt. Tim O-Reilly (2005) verschaffte dem Thema und dem Begriff kurz darauf große mediale Aufmerksamkeit, als er mit seiner Publikation „What ist Web 2.0“ bis heute gültige Eigenschaften dieser neuen Form definierte. Das Netz wird demnach von einer Angebotsfläche zu einer Anwendungsumgebung, was die Voraussetzung dafür ist, „dass das Surfen über Bildschirmfenster eines Tages der Vergangenheit angehört und das Netz sich auf Bereiche jenseits des Browsers ausweiten kann“ (Münker 2010: 35). Dass es durch das Web 2.0 zu einem, von der Terminologie her zu erwartenden Softwaresprung gekommen wäre, ist hingegen nicht der Fall. Das Internet besteht nicht aus einer einzelnen Software und deshalb kann es auch keinen Versionssprung geben. Vielmehr sind es eine Vielzahl von Programmen und Techniken die gemeinsam die Struktur des Netzes bilden. Das Netz kann sich kontinuierlich erweitern, weil viele Techniker und Programmierer voneinander unabhängig forschen und entwickeln können. Ein weiterer häufiger Fehler ist, das Internet mit dem WWW, dem World Wide Web, gleichzusetzen. Denn neben dem WWW stellt das Internet unter anderem Funktionen wie E-Mail, "File Transfer Protocol" (FTP) zur Übermittlung von großen Datenmengen sowie das "Telecommunications Network" (Telnet) zur Fernsteuerung von Rechnern bereit. Die Entwicklung von Social Media als neueste Entwicklung im Web steht derweil noch ganz am Anfang. „Social Media ist heute dort, wo das Radio 1912 war, das Fernsehen 1950 oder das Internet 1995.“ (Bernet 2010: 9).
2.2.2 Entwicklung von Facebook
Die Geschichte von Facebook ist die Geschichte von Marc Zuckerberg. Geboren am 14. Mai 1984 in New York, bekam er im Alter von zehn Jahren den ersten eigenen PC und widmete sich seither der Softwareprogrammierung. Als Abschlussprojekt der High School entwickelte er einen MP3-Player, der am Nutzungsverhalten des Hörers seine Neigung erkennt und ihm automatisch eine passende Wiedergabeliste vorschlägt. Zum Vergleich: Apple brauchte dazu mit der I-Tunes Funktion Genius mehr als 15 Jahre länger. Bereits damals hätten Mark Zuckerberg und sein Schulfreund Adam D’Angelo Millionäre werden können, wenn sie auf entsprechende Angebote von Wirtschaftsgrößen wie Microsoft oder AOL eingegangen wären. Doch verkauft wurde nicht. Schon damals offenbarte sich Zuckerbergs Devise, seine Entwicklungen nicht durch Verkauf aus der Hand zu geben. Lieber entschloss er sich, Psychologie in Harvard zu studieren. (Vgl. Bulga 2010: 1)
Am 28. Oktober 2003 wurde aus einer Trinklaune von Zuckerberg der erste Vorläufer des heutigen Facebook, genannt Facemash, programmiert. Die Seite beinhaltete Fotos von Zuckerbergs Kommilitoninnen, stellte sie paarweise gegenüber und ließ den User darüber entscheiden, welche Kommilitonin attraktiver sei.Da die Fotos allerdings ohne Zustimmung der betroffenen Frauen verwendet wurde, musste die Seite trotz der 22.000 Bewertungen schnell wieder vom Netz genommen werden, Anhörung vor dem Verwaltungskomitee der Universität für Zuckerberg inklusive.
Facemash fungierte jedoch als Inspiration für die Erfolgsgeschichte von TheFacebook, mit dessen Entwicklung er im Dezember 2003 begann und die unter Thefacebook.com zwei Monate später erstmals online ging. 650 Harvard Studenten, für die es zunächst ausschließlich gedacht war, meldeten sich noch am ersten Tag an.
Als Mitbegründer im Impressum waren Eduardo Saverin, (damaliger bester Freund Zuckerbergs und Finanzchef des Unternehmens) und Dustin Moskovitz (Zimmergenosse Zuckerbergs und Programmierer) genannt. Schon einen Monat später begann die Expansion und TheFacebook nahm die Unis Stanford, Columbia und Yale mit auf. Im Juli 2004 stieg der Pay-Pal-Gründer Peter Thiel mit 500.000 Dollar in das Unternehmen ein und erhielt neben Mark Zuckerbergs 51 Prozent, Eduardo Saverins 25 Prozent genau wie Sean Parker und Dustin Moskovitz 7 Prozent des Unternehmens.
Im Dezember 2004, also genau ein Jahr nach den ersten Arbeiten an TheFacebook, hatte die Seite bereits eine Million aktive Nutzer. Und so nahm die Expansion ihren Lauf. Immer mehr Colleges konnten sich für das Netzwerk registrieren, Investmentfirmen stiegen im zweistelligen Millionenbereich in die Firma ein. Im August 2005 folgte die Umbenennung zum heutigen Facebook.com.
Im September 2006 öffnete sich Facebook für die Öffentlichkeit. Neben der Pinnwand gab es nun auch die Möglichkeit, Inhalte mit seinen Freunden zu teilen (sharen), ein wichtiges Element des Web 2.0. Es folgten die personalisierte Werbung, die Erweiterung um neue Sprachen, der Facebook-Chat und der „Gefällt-mir“-Button. Auch die Zahl der Inverstoren stieg weiter: Der Geschäftsmann Li Ka-Shing aus Hongkong stieg mit 60 Millionen US-Dollar ein, Microsoft mit 240 Millionen US-Dollar und die Mail.ru-Group, ein russisches Investmentunternehmen, investierte insgesamt 400 Millionen US-Dollar (Bulga 2010: 1).
Nach und nach spannt Facebook sein Netzwerk um die gesamte Welt. 2011 ist Facebook in über 70 Sprachen in mehr als 190 Ländern der Welt verfügbar. Die Zahl der aktiven Nutzer stieg bis zum Juli 2011 auf über 750 Millionen, 70 Prozent davon leben außerhalb der Vereinigten Staaten (vgl. Abbildung 2-1). (Facebook.com 2011 a): o.S.)
Heute soll Facebook im Falle eines Börsengangs auf bis zu 100 Milliarden Dollar taxiert werden (Bernau Slavik 2011: 17). Die Süddeutsche Zeitung stützt sich damit auf einen Bericht des US-Senders CNBC. Demnach machte Facebook in den ersten 9 Monaten des vergangenen Jahres einen Gewinn von 355 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Die anberaumten 100 Milliarden Dollar wären ein 281-fach höherer Unternehmenswert, als das Unternehmen Gewinn erwirtschaftet. Ein solches Kurs-Gewinn-Verhältnis ist utopisch. „Bei keinem Dax-Konzern liegt die Maßzahl über 30.“ (ebd.: 17). Glaubt man jedoch Zahlen einer US-Marktforschungsstudie (Kirchberg 2011: 13), so ist jeder einzelne Facebook-Fan für eine Firma 103 Euro wert. Bei McDonalds beispielsweise geben diejenigen, die das Fastfood-Unternehmen als Favorit gespeichert haben etwa 120 Euro mehr als Nicht-Fans aus. Bei mehr als 750 Millionen weltweiten Facebook-Nutzern ist die Zahl der potenziellen, wertvollen Fans damit enorm groß.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Egal ob Myspace, LinkedIn, Xing oder die VZ-Netzwerke: Sie alle bieten eine kostenlose Möglichkeit, sich mit Menschen zu verbinden, die ähnliche Interessen, politische Ansichten, familiäre Hintergründe oder gleiche Hobbies haben. Der Grundgedanke ist immer, Informationen über sich an Freunde und Kollegen weiterzugeben. Soziale Netzwerke setzen voraus, dass sich jeder Nutzer ein eigenes Profil erstellt, auf dessen Basis eine Vernetzung mit anderen möglich wird. Dazu gehört neben den üblichen Daten des Steckbriefs auch die Möglichkeit, Fotos und Videos hochzuladen. Die Profile sind individuell anpassbar und interaktiv, das heißt, Freunde können Inhalte kommentieren oder weitergeben. In diesen Funktionen sind sich die oben genannten Netzwerke weitestgehend ähnlich. Im Unterschied zu Facebook haben sich Myspace und Xing jedoch spezialisiert. So ist Myspace vor allem als Plattform für Musiker gedacht, um sich mit ihrer Musik zu präsentieren und so neue Kontakte mit anderen Bands oder zu Veranstaltern zu knüpfen. Bis Myspace 2008 von Facebook überholt wurde, war es die beliebteste Social-Media-Plattform im Internet. Seither sinken die Nutzerzahlen drastisch, zuletzt innerhalb von drei Monaten (Januar - März 2011) von 83 auf 63 Millionen Nutzer (vgl. DiePresse.com 2011: o.S.).
Die Plattform Xing ist besonders für Geschäftskontakte gedacht. Sie bietet Kontaktseiten, Suche nach Interessengebieten, Unternehmens-Webseiten und etwa 40.000 verschiedene Gruppen. Die Suchfunktion nach anderen Unternehmen und Personen steht nur dem Premium-Nutzer, der für seinen Account bezahlt, zur Verfügung. Xing bietet außerdem eine Jobbörse, allerdings ebenfalls kostenpflichtig. Gemäß der Grafik hat Xing im Vergleich von 2009 zu 2010 zwar noch leichte Zuwächse. Alleine im zweiten Halbjahr 2010 schrumpfte die Zahl der Nutzer jedoch wieder auf 2,4 Millionen (vgl. Schmitt 2011: o.S.). Beide, Xing und Myspace, sind Plattformen für Teilmärkte und leiden zunehmend unter dem Allrounder Facebook. Denn Facebook bietet all diese Funktionen auch und darüber hinaus noch Einiges mehr. Neben einem Chat gibt es die Funktion „Was machst du gerade?“. Damit lassen sich Meldungen zu momentanen Aktivitäten verbreiten, teilen und kommentieren. Die VZ-Netzwerke haben zwar ähnliche Möglichkeiten, doch in der technischen Umsetzung hinken sie immer wieder hinterher. Was Facebook außerdem attraktiv macht, sind die unzähligen Spiele und Applikationen, die von externen Anbietern programmiert und von allen Usern genutzt werden können. Der künstliche Garten in Farmville oder die mafiösen Machenschaften von Mafia Wars begeistern Millionen von Menschen. Der wohl wichtigste Pluspunkt für Facebook ist die Internationalität und Offenheit für Jedermann. Denn das SchülerVZ ist auf Schüler, das StudiVZ auf Studenten und beide auf Deutschland beschränkt. Ähnlich verhält es sich mit wer-kennt-wen.de und meinvz.de. Wer Freunde im Ausland hat, stößt damit schnell an seine Grenzen. (welt.de 2009: o.S.) Die Spirale dreht sich weiter nach oben, denn je mehr Menschen Teil eines Netzwerks sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, die eigenen Freunde dort zu finden und desto höher ist damit der Nutzwert für jeden einzelnen. Doch die Zahlen können sich sehr schnell ändern, wie man auch am rasanten Erfolg von Facebook und dem damit verbundenen Niedergang der anderen Netzwerke gesehen hat. Was fehlt, ist ein Konkurrenzangebot, das Facebook ernsthaft in Bedrängnis bringen kann. Google+ ist ein solcher Versuch, die Schwächen von Facebook zu korrigieren und die vorhandene Marktmacht im Internet für das Netzwerk zu nutzen. Google+ verspricht unter anderem transparentere Datenschutzregelungen und ein verbessertes Filtersystem für Nachrichten. Ob es gelingen wird, den Platzhirsch Facebook damit zu vertreiben, darüber wird seit der Einführung in Blogs und Foren diskutiert. (netzwelt.de 2011: o.S.) Nicht wenige trauen Google+ zu, ein ernstzunehmender Konkurrent für Facebook zu werden. Der Kampf um die Vorherrschaft ist eröffnet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.3 Social Media Theorien
2.3.1 Medien im Wandel
Da der Bereich der Social Media gewissermaßen noch in den Kinderschuhen steckt, ist die wissenschaftlich fundierte Literatur noch sehr überschaubar. Medienressorts und Marketingexperten beschreiben eher Trends und Thesen. Die Literatur zum Marketing im Social Web hat eher den Charakter eines praktischen Ratgebers.
Das über Jahrzehnte hinweg geschlossene Modell der Mediensysteme löst sich langsam auf. Das heißt, dass immer mehr Menschen selbst die Rolle des Kommunikators übernehmen können und wollen. (vgl. Bernet 2010: 11f). Was einst den Medienunternehmen exklusiv oblag, nämlich mit ihren Inhalten eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, kann heute jedem durch einen Blogeintrag, eine Twitter-Nachricht oder eine Produktrezension gelingen. Digitale Inhalte können günstig hergestellt, kopiert und in rasender Geschwindigkeit verbreitet werden. Der Medienwissenschaftler Stephan Ruß-Mohl (2009: 32) ist sogar der Meinung: „Ein Prozess der schöpferischen Zerstörung hat die Medienwelt erfasst und macht vor nichts und niemandem Halt.“ Durch die enorm gestiegene Zahl der Internetzugänge, allein in Deutschland von 37 Prozent (2001) auf 74,7 Prozent (2011) (vgl. (N)Onliner Altlas 2011: 11) ist der Anteil der Menschen, die online schreiben, kritisieren und empfehlen können auf knapp drei Viertel der Deutschen gestiegen.
2.3.2 Das Cluetrain-Manifest
Das Internet ist eine riesige Gesprächsplattform, auf der Menschen ihr Wissen und ihre Ansichten teilen können. Durch diesen freien und schnellen Austausch haben die Märkte den Unternehmen einiges voraus – sie sind teilweise intelligenter als die Unternehmen und setzen ihre Überlegenheit aktiv ein (vgl. Korbien 2010: 67). Diese Beschreibung trifft das bereits 1999 verfasste Cluetrain-Manifest im Kern. Die Übersetzung des Wortes Cluetrain steht methaphorisch gesprochen für einen Zug, auf den ahnungslose Menschen steigen müssen, um Weisheit zu erlangen. In 95 Thesen beschrieben die vier Autoren Rick Levine, Christopher Locke, Dock Searls und David Weinberg die Veränderungen des Marktes und des Marketings durch das Internet. Trotz des frühen Verfasserdatums, noch vor dem Web 2.0, haben die Autoren einen noch immer gültigen Beitrag zu den Veränderungen der Märkte geleistet. Ein Auszug aus den 95 Thesen zeigt, welche Rolle der Kommunikation auf den neuen Märkten zugesprochen wird.
„1. Märkte sind Gespräche. (...)
10. Als Resultat dieser Entwicklung werden Märkte intelligenter und besser informiert. (...)
12. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Die vernetzten Märkte wissen über die Produkte der Unternehmen mehr, als die Unternehmen selbst. Ob die Nachricht gut oder schlecht ist, sie wird weitergegeben. (...)
19. Unternehmen können zum ersten Mal mit ihren Märkten direkt kommunizieren. Wenn sie bei diesen Gesprächen versagen, könnte das ihre letzte Chance gewesen sein. (...)
34. Um mit menschlicher Stimme zu sprechen, müssen die Unternehmen die Anliegen und Besorgnisse ihrer Communities - der Gemeinschaft ihrer Marktteilnehmer - teilen. (...)
62. Die Märkte möchten sich nicht mit Phrasendreschern unterhalten. Sie möchten an Gesprächen teilnehmen, die sich hinter den Firewalls der Unternehmen abspielen. (...)
95. Wir wachen auf und verbinden uns miteinander. Wir beobachten. Aber wir werden nicht warten.“ (Cluetrain.com 1999: o.S.)
In den etwas reißerisch formulierten Thesen geht es um die Forderung an die Unternehmen, sich an den Gesprächen im Netz mit authentischer und ehrlicher Stimme zu beteiligen. Dazu dient auch der Vergleich mit historischen Märkten (vgl. Korbien 2010: 69ff.). Das Internet „ist ein Platz auf dem Kunden nach Waren suchen, Verkäufer ihre Produkte präsentieren und Menschen sich um Themen scharen (...). Gespräche finden wieder statt, wie damals auf den historischen Märkten“. (ebd.).
Dazu müssen Unternehmen bereit sein, sich zu öffnen und ihre Mitarbeiter für das Unternehmen sprechen zu lassen, nicht nur die Pressestelle. Auch wenn Facebook zur Zeit der Formulierung dieser Thesen noch nicht einmal in Arbeit war, lassen sich daraus Handlungsempfehlungen ableiten. Angewendet auf den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, die Jugendradiowellen, bedeutet das, dass durch eigene Profile der Mitarbeiter mit Vornamen und Senderkennung, dieser Forderung Folge geleistet wird. Bei BigFM beispielweise kann nicht nur die Onlineredaktion, sondern können sich auch Moderatoren und Redakteure an Facebook-Diskussionen beteiligen und beispielsweise als „Anna_BigFM“ persönlich und trotzdem mit klarer Senderzugehörigkeit posten. So gelingt es auch einfacher, in einer verständlichen Sprache mit dem Markt zu kommunizieren. Damit diese Kommunikation gelingt, stellen die Autoren vier Regeln auf (vgl. ebd.):
1. Aufgeschlossen bleiben. Unternehmen sollen unverkrampft und aufgeschlossen in das Gespräch gehen, ohne sich vorher etwas zurecht gelegt zu haben.
2. Anstecken lassen. Unternehmen sollen mitmachen und sich anstecken lassen vom Gespräch. Sie sollen Gespräche selbst eröffnen und nicht nur reagieren.
3. Zuhören können. Wie bei einem guten Gespräch müssen unternehmen zuhören, auch mal ruhig sein und abwarten.
4. Veränderung zulassen. Bei einer guten Gesprächsführung können Unternehmen erkennen, wie Gesprächspartner von ihren festgefahrenen Ansichten abrücken und Kompromisse suchen.
2.3.3 Von Blogs lernen
Auch die beiden Blog-Experten Robert Scoble und Shel Israel (2007) fordern für die Arbeit im Web 2.0 in ihrem Buch „Naked Conversation“ vor allem zwei Dinge: Offenheit und Authentizität. „Komm, wie du bist. Rede, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Lass Leute, die dir wichtig sind, dich im Blog kennenlernen und höre gut zu, was sie dir erzählen.“ (ebd.: 94). Auch wenn eine Facebook-Seite kein klassisches Blog ist, so lassen sich die kurzen Postings doch dem Prinzip von Microblogging, ähnlich wie bei Twitter, zuordnen.
Dieser oben gegebene Rat erfordert jedoch eine komplette Neuorientierung von wohl geschliffenen PR-Texten hin zur persönlichen Kommunikation. On Air ist es bei den Jugendsender ohnehin klar, dass Beiträge und Moderationen in Sprechsprache und jugendlichem Stil sind. Bei den meisten Sendern wird sogar geduzt. Demnach sollte zu erwarten sein, dass Gleiches auch für ihre Facebookpostings gilt. Doch vor allem bei Werbepostings, sei es wie bei den Öffentlich-rechtlichen für das eigene Programm oder teilweise wie bei den Privaten für Produkte, ist höchste Vorsicht geboten. Denn Authentizität verlangt ehrliche und interessante Postings und keine Werbebotschaften (vgl. Schlüter 2010: 78).
„Bloggen kann Kunden zu einem aktiven Teil des Unternehmens machen. Dieser Paradigmenwechsel, offen und ehrlich zu schreiben und auch Antworten – positive wie negative – stehen zu lassen, aufzunehmen und zu integrieren, ist das, was Scobles und Israel als Revolution in der Kommunikation beschreiben.“ (ebd.: 80).
2.3.4 Crowdsourcing
„Wikipedia“ ist das erste Stichwort, das meist zum Thema Crowdsourcing fällt. Nicht ohne Grund, denn die Online-Enzyklopädie ist eine Paradebeispiel dafür, was mit Hilfe von Usermassen im Internet erreicht werden kann. Inzwischen gibt es das Online-Lexikon in 260 Sprachen mit über 10 Millionen Artikeln (vgl. Wikipedia Statistics 2011: o.S). Dennoch nutzt Wikipedia nur einen Teil der verschiedenen Crowdsourcing-Möglichkeiten, die das Internet ermöglicht. Da diese Mechanismen auch für die Arbeit auf Facebook ein nützliches Instrument sein können, werden die Potenziale und Bedingungen im Folgenden vorgestellt und erläutert.
Aufgrund von technischem Fortschritt sind Transaktions- und Produktionskosten so weit gesunken, dass viele Amateure Zugang zu professionellen Produktionstechnologien erhalten. Damit können Amateure günstig und durch das Internet für alle verfügbar produzieren. Diese Tatsache schaffte die Grundlage für das Crowdsourcing (Im Folgenden: Howe 2010: o.S, eigene Übersetzung).
„Crowdsourcing ist der Prozess, einen Job, der traditionell von internen Angestellten gelöst wird, zu übernehmen, und ihn nach draußen an eine undefinierte, normalerweise große, Gruppe von Menschen in Form einer offenen Anfrage zu richten.“
Es bietet damit die Möglichkeit, seine Kunden nicht länger nur als Konsumenten zu sehen, sondern sie in die Wertschöpfungskette einzugliedern. Dadurch kann die Innovationskraft erhöht werden. Es entsteht ein Geschwindigkeitsvorteil im Wettbewerb und Kosten können gespart werden. Bleibt die Frage: Was kann den Konsumenten dazu bewegen, diese Arbeit zu übernehmen? Für viele Kunden schafft Crowdsourcing die Möglichkeit, mehr Einfluss auf Trends und Entscheidungen der Unternehmen ausüben zu können (vgl. Janke Prilla 2008: 132). Die Grundlage des Crowdsourcing bildet die Theorie der „Weisheit der Vielen“ von James Surowiecki. Sie besagt, dass „eine heterogene Gruppe individuell entscheidender Menschen die Gesamtheit aller möglichen Ausgänge eines Ereignisses eher repräsentieren kann, als einzelne Experten“ (Unterberg 2010: 125). Gruppen sind damit unter bestimmten Bedingungen besser in der Lage, Voraussagen für die Zukunft zu treffen. Als Beispiel dafür führt Surowiecki eine Geschichte von einem englischen Markt an. Dort galt es, das Gewicht eines Bullen zu schätzen. Wer mit seiner Schätzung am Ende des Tages am nächsten am tatsächlichen Gewicht des Bullen lag, hatte gewonnen. Überraschenderweise zeigte sich, dass der Durchschnitt aller Schätzungen fast exakt das richtige Gewicht ergab während keine der Einzeleinschätzungen, auch nicht die von Experten, dazu in der Lage war (vgl. ebd.:125 f.).
„Eine Gruppe von Menschen arbeitet (jedoch) nur dann erfolgreich als Crowd, wenn es viele unterschiedliche Meinungen in der Gruppe gibt, jedes Gruppenmitglied seine Meinung unabhängig von den anderen einbringen kann, dabei unterschiedliche Erfahrungen und Wissensquellen herangezogen werden können und die Einzelmeinungen zu einer kollektiven Entscheidung zusammen gefügt werden.“ (Unterberg 2010: 125f.)
Die Motivation zur Teilnahme an Crowdsourcing-Projekten kann viele Gründe haben. Bei manchen ist es der reine Spaß, andere Projekte locken mit materiellen Vergütungen für die Gewinner. Es kann auch soziale Anerkennung sein oder der Wunsch, sich für einen guten Zweck einsetzen zu wollen. Crowdsourcing kann dabei in verschiedenen Funktionen eingesetzt werden, wie die folgenden drei Beispiele zeigen.
Crowd Wisdom
Crowd Wisdom basiert auf dem einfachen Prinzip, dass die Summe der Informationen, die in einer Gruppe vorhanden sind, zu besseren Lösungen in Gruppen führt als Lösungsansätze einzelner Teilnehmer. Der Journalist und Autor des Buches „Die Weisheit der Vielen“ (Originaltitel „The Wisdom of Crowds“) James Surowiecki betont zwar immer, dass dies nur für bestimmte Aufgabenstellungen funktioniert. Angemerkt sei aber, dass die aus der Sozialpsychologie bekannten Schwächen, die bei Gruppenarbeiten eine Rolle spielen (wie z.B. Koordinations- und Motivationsprobleme), bei Surowiecki keine Beachtung finden.
Crowd-Wisdom-Modelle sind Anwendungen, deren Ziel es ist, Entscheidungsprozesse durch die Einbeziehung großer Gruppen, durch Abstimmungs- oder Bewertungsprozesse zu organisieren. Eine weitere Möglichkeit ist es, den Erkenntnisgewinn auf Basis der Verhaltensauswertungen großer Gruppen zu strukturieren oder einfach die Meinung und das Wissen großer Gruppen anzuzapfen.
Crowd Creation
Ein T-Shirt designen, eine neue Eissorte erfinden oder die Titelmelodie einer Fernsehsendung komponieren. Bei Crowd Creation überlässt man die Entwicklung von Ideen und Konzepten ganz einfach der Masse. Gelockt wird mit tollen Preisen für die Gewinner und der Möglichkeit für jeden einzelnen, seine Kreativität auszuleben. Eines der erfolgreichsten Beispiele in der jüngsten Vergangenheit war sicherlich die McDonalds-Kampagne. Bei der Aktion „Mein Burger“ sollte man einen Burger für McDonalds nach den eigenen Geschmackswünschen zusammenstellen. Per Internetabstimmung wurde dann entschieden, welche Burger es bis in den Verkauf schaffen sollte. Über 115.000 Burger wurden innerhalb von 5 Wochen kreiert. So bekam McDonalds neben der riesigen Vermarktungsmöglichkeit auch noch die Gelegenheitt, aktuelle Geschmackspräferenzen seiner Kunden zu erfahren (vgl. McDonalds 2011: o.S.).
Crowdfunding
Über den Einsatz von großen Gruppen können nicht nur Ausgaben gespart, sondern auch Einnahmen generiert werden. So gibt es beispielsweise die Plattform SellaBand, die auf ihrer Webseite Musiker und deren Songs bekannt macht. Die Crowd kauft bei Gefallen Anteile an diesen Bands und wenn genügend Anteile zusammen kommen, wird eine Platte produziert. Der Unterschied zu den herkömmlichen Modellen der Spendenfinanzierung ist, dass die Geber über die Plattform direkt mit ihren Nehmern in Verbindung treten können.
Das Crowdsourcing bietet verschiedene Möglichkeiten der Arbeit. Bei manchen Plattformen wie beispielsweise der Fotoplattform Flickr werden lediglich Inhalte bereitgestellt, die dann auch geteilt werden können. Bei Facebook kommt der Crowd eine deutlich größere Bedeutung zu. Dies lässt sich am Stugeon-Gesetz verdeutlichen. Darin geht es um die Frage, was zu tun ist, wenn 90 Prozent aller Beiträge schlecht sind. Wie ist es dann möglich die relevanten 10 Prozent aufzuspüren? Ganz einfach: Indem man die Crowd die Auswahl treffen lässt (vgl. Howe 2008: 222). Dadurch entsteht ein echter Mehrwert, denn die Crowd filtert nicht nur, sie sortiert und kommentiert auch, wodurch etwas Neues, potenziell Besseres entstehen kann. Immer vorausgesetzt, die technischen Möglichkeiten werden durch die Plattform zur Verfügung gestellt.
Für die untersuchten Radiosender bietet das Prinzip Crowdsourcing vielfältige Möglichkeiten, die bisher weitestgehend ungenutzt bleiben. So könnten sie, ähnlich wie bei der „Mein Burger“-Kampagne von McDonalds die Wünsche der Crowd nutzen und beispielweise eine eigene Musikauswahl zusammenstellen lassen. Dass Musiktitel zuvor von Testhörern bewertet werden, geschieht schon seit langer Zeit. Was aber bisher über teure Markforschungsinstrumente geschieht, könnte so zum Teil ganz einfach selbst herausgefunden werden. Auch für die redaktionelle Arbeit gibt es Chancen, die Hörerschaft einzubinden. Fragen, die sich Redaktionen fast täglich stellen, wie „Welche Themen interessieren meine Hörer?“ oder „Gefällt meinen Hörern unser neues Konzept?“ können direkt und unmittelbar abgefragt werden. Facebook bietet dafür neben den herkömmlichen Postings ein spezielles Werkzeug, mit dem ganz einfach Umfragen erstellt werden können. Erfahrungsgemäß ist die Beteiligung an diesen Umfragen um ein Vielfaches höher als die Partizipation bei herkömmlichen Postings. Das Crowdfunding bietet Möglichkeiten für neue Erlösmodelle, um – speziell für die privaten Sender – unabhängiger von den Werbeeinnahmen zu werden. Eine daraus abgeleitete Idee für die Sender könnte sein, dass sie den Hörern Reportagethemen vorschlagen, in einem Voting darüber abstimmen lassen und sie dann über kleine Beträge an den Kosten der Produktion beteiligen.
2.3.5 Social Media Modelle – Das Drei-Ebenen-Modell
Um die komplexen Zusammenhänge der Social Media besser zu strukturieren und darzustellen, hat Daniel Michelis ein Drei-Ebenen-Modell entwickelt. Michelis ist Autor des Sammelwerkes „Social Media Handbuch, Theorien, Methoden und Modelle“. Seine Modelle werden an dieser Stelle ausführlich dargestellt, da sie zum Zeitpunkt dieser Arbeit die einzigen modellbasierten Annahmen zu Social Media sind. (vgl. Michelis 2010: 301-313)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ausgangspunkt für alle Entwicklungen zum Thema Social Media ist die individuelle Ebene. Sie ist umgeben von der technologischen Ebene, die in Verbindung mit der individuellen Ebene eine dritte Komponente schafft: die sozio-ökonomische Ebene. Sie entsteht dadurch, dass Individuen über soziale Medien neue Wege gefunden haben, sich zu Gruppen unterschiedlicher Größen zusammenzuschließen. Als Motor, als aktives oder passives Mitglied von Communities oder als Konsument und
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Produzent steht die individuelle Ebene im Mittelpunkt dessen, was allgemein als Social Media umschrieben wird. „Das Verhalten des
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Individuums, seine Rollen, Wünsche, Erfahrungen, seine Fähigkeiten und Gewohnheiten sowie die Veränderung dieser individuellen Dispositionen sind die wesentlichen Determinanten dessen, was in den sozialen Medien, technologisch möglich ist.“ (ebd.: 302). Dabei ist es nicht die Technologie, die die Nutzung determiniert, sondern die Bereitschaft des Individuums, diese zur Erfüllung der eigenen Ziele zu nutzen. Die unterschiedlichen Rollen, die das Individuum dabei immer wieder einnimmt, und der damit verbundene Part der Partizipation lassen sich jedoch nicht als
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
permanente Identität verstehen, sondern vielmehr als vorübergehendes Verhalten. Anders als bei klassischen Medien nehmen die Nutzer direkten Einfluss auf die Ausgestaltung. Dadurch findet eine starke Transkodierung, also ein intensiver wechselseitiger Austausch zwischen der individuellen und der technologischen Ebene, statt. (vgl. Michelis 2010: 303)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die wesentlichen Eigenschaften für die Funktionsweise der Social Media sind dynamische Webseiten und offene Schnittstellen, die das Internet für seine Nutzer beschreibbar machen, und dadurch die Interaktion mit vernetzten Informationen ermöglichen. Dazu wird das Internet gerne mit den Bausätzen von Lego verglichen (vgl. Münker 2010: 32). Diese modularen Bausteine, die nach Belieben zusammengesetzt werden können, sind die Basis für Kommunikation, Interaktion und Partizipation. Die technologische Ebene wird im Modell mit vier Prinzipien dargestellt. Das erste Prinzip ist die Modularität. Sie bezieht sich auf Inhalte und auf die Software. Filme, Bilder oder Dateien bestehen aus Modulen wie Pixel, Tönen, Formen oder Verhalten und sind die Grundlage dafür, dass Angebote nach dem Legoprinzip miteinander verbunden und verknüpft werden können. Das zweite Prinzip der Automatisierung ist ebenfalls Grundvoraussetzung für das Funktionieren von Social Media. Denn trotz der Fokussierung auf die individuellen Aktivitäten der Nutzer könnte die Fülle an Anwendungen und Verknüpfungen nicht ohne ein hohes Maß an Automatisierung existieren. Das Prinzip der Variabilität ist die Möglichkeit zur Individualisierung von inhaltlichen und funktionalen Parametern. Das letzte, etwas versteckte Prinzip, ist das der Transkodierung, das wie bereits beschrieben für den Austausch und Transfer aller drei Ebene zuständig ist. (vgl. Michelis 2010: 304f.)
Die Freiheit eines jeden Nutzers, sich in unterschiedlichen Rollen Gehör zu verschaffen und zu beteiligen, hat Auswirkungen auf die ökonomischen Strukturen, Kommunikationsformen und Verhaltensweisen. Vor allem dadurch, dass die Anwendungen von Social-Media-Angeboten von einer sehr großen Zahl von Individuen gemeinsam genutzt werden, ergeben sich große Auswirkungen auf die sozio-ökonomischen Strukturen . Die Unterscheidung in „Hier sind die Medien, dort die Menschen“ lässt sich nicht mehr vollziehen, weil Social Media erst durch die Beteiligung der Menschen entsteht. Ausgelöst durch dieses Phänomen entstanden in der sozio-ökonomischen Ebene eine Reihe von Trends (vgl. Abbildung), die im Folgenden kurz beschrieben werden und auch als Appell an die Unternehmen zu verstehen sind. (vgl. Michelis 2010: 306ff.)
Authentische Gespräche
Unternehmen müssen lernen, engagierte, ehrliche und offene Gespräche zu führen und mit der selben authentischen Stimme zu sprechen, in der auch die Gespräche auf diesen neuen Märkten stattfinden (vgl. Cluetrain.com 1999: o.S.).
Symmetrische Beziehungen zwischen Anbieter und Nachfrage
Durch die zunehmende Vernetzung entwickeln die Kunden eine starke Gegenkraft zu den Unternehmen, die anstelle von asymmetrischen, gefilterten Informationen eine symmetrische Teilhabe auf Augenhöhe erfordert.
Selbstorganisierte Gruppenaktivitäten
Die Leichtigkeit, Gruppen beispielsweise bei Facebook zu gründen und dadurch zu kommunizieren stellt alte, hierarchische Formen in den Schatten. Die Organisation der Gruppe lässt sich auf viele Schultern verteilen und es wird dadurch einfacher, sich mit anderen zusammenzuschließen und ein gemeinsames Vorhaben zu realisieren.
Emergente Märkte
Der weltweite Charakter des Internets, durch den viele geografische Barrieren fallen, und die immer höhere Bereitschaft, sich an der Erstellung von Leistungen zu beteiligen, steigern gleichzeitig Angebot und Nachfrage. Unternehmen sollten ihren Kunden folgen und das Gespräch dort suchen, wo sich ihre Kunden bereits aufhalten.
Nicht-marktliche Produktion
Crowdsourcing am Paradebeispiel Wikipedia zeigt, wie stark eine Vielzahl von Individuen schon heute bereit ist, sich ohne extrinsische Belohnung an der Produktion eines gemeinsamen Projekts zu beteiligen, um als Gruppe gemeinsam eine Leistung zu erbringen. (vgl. Michelis 2010: 308ff.)
2.4 Social Media Marketing
2.4.1 Grundzüge des Social Media Marketing
Um der eben beschriebenen Entwicklung gerecht zu werden, gilt es auch für Medienunternehmen, die Vorteile von Web 2.0 und Social Media zu nutzen. „Social Media Marketing ist ein Prozess, der es Menschen ermöglicht, für ihre Websites, Produkte oder Services in sozialen Netzwerken zu werben und eine breite Community anzusprechen, die über traditionelle Werbekanäle nicht zu erreichen gewesen wären.“ (Weinberg 2010: 4). Dabei geht es nicht um die Einzelperson, sondern um das Kollektiv. Wichtige Eckpfeiler sind: der Community zuhören, angemessen darauf reagieren, besonders nützliche Inhalte finden und diese in den riesigen sozialen Sphären des Internets bekannt machen. (ebd.: 4)
Egal ob für einen Radiosender mit jungem Zielpublikum, eine Aktiengesellschaft oder einen Handwerksbetrieb: Will ein Unternehmen auf Facebook präsent sein, muss eine Fanseite gegründet werden. Per Mausklick können sich die Hörer oder Kunden dann dieser Seite anschließen und so mit der Firma kommunizieren und interagieren. Es können Nachrichten verbreitet, zu Veranstaltungen eingeladen oder über Inhalte diskutiert werden. Die Nutzer bekommen diese Meldungen auf ihrer Startseite angezeigt und können dann direkt über die Kommentar- oder „Gefällt-mir“-Funktion ihre Meinung äußern. 38 Prozent der 14- bis 19-Jährigen und knapp ein Drittel der 20- bis 29-Jährigen haben diese Fanseiten schon einmal genutzt. (Vgl. Frees Fisch, 2011: 158)
Eines der möglichen Ziele, nämlich mehr Besucher auf die eigene Webseite zu bringen, kann durch eine solche Fanseite erreicht werden. Empfehlen Nutzer Inhalte, die sie (auf dieser Seite) gut finden, verbreitet sich die Verlinkung und es tritt die Mundpropaganda in Kraft, die auch gerne als virale Ausbreitung bezeichnet wird. (vgl. Roder 2011: 1) Dadurch wird eine Spirale ausgelöst: Je mehr Links auf die eigene Seite verweisen, desto besser stehen auch die Chancen, von Suchmaschinen gefunden zu werden. Weitere Ziele können sein, das Markenbewusstsein der Verbraucher zu stärken, sie zu einem positiven Sinneswandel dem eigenen Produkt gegenüber zu bewegen und Gesprächsstoff zu bieten (vgl. Weinberg 2010: 6). Der große Vorteil: Anders als bei den traditionellen Marketingkanälen kostet eine Facebook-Seite zwar Zeit und Mühe, jedoch keine Gebühren und kann dennoch viel erreichen. Für Hünnekens (2010: 31) ist klar: „Beim Social Media Marketing geht es letztlich um gutes Image. [...] In der Online-Welt steht ihre Marke im Rampenlicht. Was sie tun, wie sie interagieren und wie sie reagieren (ganz zu schweigen von dem, was sie nicht tun) wird beobachtet, kritisiert – und bei Google verewigt!“ Ob gutes Image tatsächlich das einzige und über allem stehende Ziel sein sollte, ist anzuzweifeln. Dennoch spielt es im Marketing immer eine wichtige Rolle für den Erfolg der Kampagnen.
2.4.2 Grundüberlegungen für einen Social-Media-Auftritt
Für ein erfolgreiches Social Media Marketing bedarf es einer Strategie. Je nachdem, welche Quellen man heranzieht, bekommt man dazu unterschiedliche Empfehlungen. Wichtige Grundpfeiler für das Gelingen eines Social-Media-Auftritts sind:
1. Ziele definieren. Was, wen und mit welchem Zweck will ich Menschen über Social Media erreichen? Mit wem will ich sprechen und über was? Wie kann der Dialog funktionieren? Die Ziele müssen dabei konkret, messbar, erreichbar, realistisch und zeitlich klar definiert sein (vgl. Weinberg 2010: 39ff.).
2. Erforschung der Social Media Community. Wer seine Ziele erreichen will, muss wissen, von welchem Status Quo er ausgeht. Wer ist an meinem Produkt interessiert? Wo und wie finde ich diese Zielgruppe? Was sagen die Leute bisher über mich? Welche Tools und Services werden von meinem Zielpublikum regelmäßig verwendet? Hilfreiche Informationen finden sich dazu in der Mediennutzungsforschung. Sollten sich darin keine ausreichenden Antworten finden, so sei an dieser Stelle empfohlen, eigene Erhebungen und Erfahrungswerte miteinzubeziehen.
3. Regeln festlegen. Wer Social Media für sich nutzen möchte, braucht Regeln, damit die Mitarbeiter wissen, wie sie sich verhalten sollen. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW 2011: o.S.) empfiehlt dafür folgende Vorgaben:
1. Geheimnisse sind geheim und Interna bleiben intern.
2. Mitarbeiter müssen authentisch sein. Bedeutet konkret: Sie sollen sich als das zu erkennen geben, was sie sind (Name und Funktion im Unternehmen) und sich nicht hinter Pseudonymen verschleiern.
3. Wer veröffentlicht, übernimmt Verantwortung. Mitarbeiter müssen sich der Folgen, Konsequenzen und Reaktionen bewusst sein.
4. Interne Kritik ist erlaubt, bleibt aber intern . Öffentlich geäußerte Kritik lässt das Unternehmen vor Geschäftspartnern, Kunden und Journalisten in schlechtem Licht erscheinen. Auch sollte öffentliche Kritik an Geschäftspartnern gemieden werden.
5. Mit Fehlern offen umgehen. Wenn Fehler passieren, sollten sie in Blogs, Foren und Kommentaren proaktiv und konstruktiv erörtert werden.
6. Es gilt das geltende Recht. Insbesondere Urheber- und Persönlichkeitsrechte Dritter müssen geachtet werden.
4. Mitmachen. Social Media heißt beteiligen. Zuhören, um zu verstehen, worüber die Kunden reden. Mitteilen, um Nachrichten effizient zu verbreiten - am besten mit interaktiven Komponenten, damit sich auch die Nutzer beteiligen können. Anregen, denn Identifikation begeistert Kunden. Mit einer viralen Kampagne, also einer Kampagne, deren Botschaft sich wie ein Virus im Netz ausbreitet, können die Kunden zum Werbeträger der Botschaft werden. Unterstützen, denn durch den Einsatz von sozialen Technologien kann die Kollaboration der Kunden untereinander gefördert werden. Beteiligen durch die Integration von Kunden in interne Prozesse bis hin zur gemeinsamen Gestaltung von Produkten.
2.4.3 Überlegungen für Medienbetriebe: Wie und was wollen wir kommunizieren?
Für einen erfolgreichen Social-Media-Auftritt stellt Marcel Bernet (vgl. Im Folgenden 2010: 19 ff.) Grundregeln zu Inhalt, Übermittlung und Dialog auf. Bezüglich des Inhalts folgt er der Nachrichtenwerttheorie. Geschichten müssen demnach vor allem aktuell sein. „Der Wert einer Geschichte richtet sich nach Neuigkeit und Relevanz.“ Klingt einfach, doch relevant ist für jeden etwas anderes. Frédérik Filloux, ehemaliger Chefredakteur von Libération Paris, sieht in Zeiten von Social Media nur noch drei Arten von News: „Standardnews, Gemeinschaftsklatsch und Qualitätsnischen.“ (Bernet 2010: o.S b)[2]. Für alle drei Gattungen nennt Bernet weitere Voraussetzungen.
Der Inhalt der Meldungen muss...
1. ...kurz sein – konzise, leicht verständliche, auf Medien und Leser zugeschnittene Informationen.
2. ...wahr sein – auch wenn man lieber Gutes als Schlechtes über sich verkündet: Nur mit ehrlichen Aussagen hat Medienarbeit langfristig Erfolg, besonders in schwierigen Zeiten.
3. ...verlinkt sein – Suchmaschinen fungieren als Schiedsrichter darüber, ob man einfach gefunden werden kann oder nicht. Suchoptimierte Titel, wiederholte Kernaussagen und aussagekräftige Internetadressen sind daher Pflicht. Dazu Verlinkungen zu weiteren interessanten Themen und Darstellungsformen.
4. ...individuell – Einstimmung auf Leserschaft und Medium ist geboten. Mitlesen und Zuhören hilft dabei, die Bedürfnisse herauszufinden.
Aus Mediensicht sind Social Media mehr als eine reine Plattform. Denn neben der Vermarktung ihres Produkts haben Medienunternehmen eigentlich noch eine ganz andere Aufgabe - auch wenn diese anhand dessen, was sie im Netz publizieren, gerne in Vergessenheit gerät. Sie sind ein publizistisches Organ, das seinen Lesern, Hörern und Zuschauern Information, Einordnung und Unterhaltung bieten möchte und vor allem sollte. Auch in Bezug auf ihre gesellschaftliche Funktion bieten Social Media den Medienunternehmen vielfältige Möglichkeiten, seine Technologie für diese Aufgabe einzusetzen. Viele Journalisten suchen bei den Social Media vorwiegend (vgl. Im Folgenden Bernet 2010: 78):
- Zusatzinformationen im Rahmen von Recherchen
- Angaben zu thematischen Trends
- Ideen für Artikel
- neue Perspektiven für Geschichten
Des Weiteren stehen auf Twitter, Facebook Co ebenfalls die Vernetzung mit möglichen Informationsquellen, die Suche von Antworten und Fallbeispielen und das Verbreiten von Geschichten im Vordergrund. In vielen Redaktionen, wie zum Beispiel bei der BBC World News, wird von den Mitarbeitern sogar der Einsatz von Social Media für Recherchen verlangt (vgl. Bunz, 2010: o.S.). Peter Horrocks, Leiter von BBC World Service, wird dazu im Guardian wie folgt zitiert:
„Das ist nicht einfach die Laune eines Technologie-Freaks. Ich befürchte, dass wir unsere Arbeit nicht machen, wenn wir diese Dinge nicht beherrschen. Das ist keine Ermessensfrage. Wer es nicht mag oder wer denkt, dass diese Veränderung oder diese neue Arbeitsweise für ihn zu groß sei, der soll gehen und etwas anderes tun – weil es einfach passieren wird. Niemand kann es aufhalten.“ (ebd: o.S.)
Nicht nur die BBC hat begriffen, welch wichtige Funktion Social Media zukommt. Bei Associated Press wird Facebook für laufende Recherchen rund um Geschichten genutzt, die auf diesen Plattformen stark diskutiert und weitergereicht werden. Twitter-Dialoge dienen bei USA Today dazu, aktuelle Themen zu entdecken. Viele Journalisten nutzen Blogs, Twitter und Facebook, um Artikel vorzubereiten und in Interviews die richtigen Fragen zu stellen.
2.5 Virales Marketing
2.5.1 Was ist Virales Marketing?
(Vgl. zum Absatz Langner 2009: 25ff.)
Als eine der effizientesten Formen des Marketings hat sich die Mund-zu-Mund-Propaganda (MZMP) bewährt. Sie kostet nichts und läuft von selbst ab. „Virales Marketing umfasst das gezielte Auslösen und Kontrollieren von Mund-zu-Mund-Propaganda zum Zwecke der Vermarktung der Unternehmen und deren Leistungen.“ (Langner 2006: 25) Erstmals näher spezifiziert wurde der Begriff des Viralen Marketings im Artikel „The Virus of Marketing“ von Jaffrey Rayport im Jahr 1996. Er beschreibt darin die Idee, Marketingkonzepte sinnbildlich als Viruserkrankungen zu begreifen, die sich unbemerkt bei den Wirten (Menschen) einnisten sollen, und so innerhalb kürzester Zeit übertragen werden. (vgl. Langner 2009: 25ff.) Virales Marketing setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen (vgl. Abbildung 2-9 Oetting 2008, 67ff.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im englischen und US-amerikanischen Raum wird schwerpunktmäßig auf die „werbe-basierte“ Anregung von Mund-zu-Mund-Propaganda gesetzt. Abzielend auf die virale Verbreitung der Werbung wird nach der Fertigstellung eines Produktes versucht, eine virale Werbeidee zu konzipieren. Ziel ist es, dass sich diese Idee eigendynamisch verbreitet und dadurch die Bekanntheit der Marke erhöht.
Die zweite Variante setzt in ihren Überlegungen noch viel früher an. Schon während der Entwicklung eines Produktes wird versucht, einen viralen Effekt einzubauen. Dadurch kann sich das Produkt durch dessen Nutzung selbst verbreiten. Beispiele hierfür sind Youtube, Skype, Soziale Netzwerke oder Apple. Bei Apple besipielsweise entsteht durch das außergewöhnliche Design ein Wow-Effekt, der wiederum zum Kauf anregt.
Als dritte Möglichkeit gilt die „beziehungs-basierte“ Anregung. Ziel ist es, einen authentischen Dialog zwischen dem Unternehmen und den Kunden zu ermöglichen. Facebook oder Blogs sind dafür die ideale Plattform. An den sich gegenseitig überlagernden Bereichen (vgl. Abbildung 2-9) ist zu erkennen, dass es durchaus Mischformen geben kann. In einer Kampagne, in der die Kunden aufgefordert werden, selbst Werbung zu produzieren, beispielweise in Form eines Videoclips, überschneiden sich werbe- und beziehungs-basierte Anregung. Dadurch entsteht ein Dialog, dessen Resultat Werbung ist, die ihre Kunden in besonderem Maße anspricht (vgl. Oetting, 2008: 67ff.).
Die Frage ist aber, wie man es überhaupt schafft, eine virale Marketinkampagne anzustoßen. Lassen sich Gerüchte, soziale Verhaltensnormen, Trends oder Moden bewusst auszulösen? Wenn ja, wie können diese Prinzipien für das Marketing nutzbar gemacht werden?
Um die Gesetze des Viralen Marketings besser verstehen zu können, muss auf verschiedene Wissenschaftsfelder zurückgegriffen und interdisziplinär gedacht werden. Die, wenn man so will, Evolutionstheorie der Psychologie führt zum Feld der Memetik. „Das Virale Marketing baut auf den evolutionären Grundlagen der Memetik auf und integriert systematisch Strategien, Taktiken und Maßnahmen, um gezielt Mundpropaganda auszulösen und zu kontrollieren.“ (Langner 2009: 24)
2.5.2 Memetik
Als Analogie zu Darwins Theorie der Evolution schuf Richard Dawkins 1976 den Ausdruck „Meme“. Die Memetik ist die Theorie zur Verbreitung und Replikation von (Markting-) Botschaften. Meme verbreiten sich beim Übergang von der psychologischen auf die kommunikative Ebene von Gehirn zu Gehirn. Meme sind kleine Informationseinheiten wie zum Beispiel Ideen, Moden oder Schlagworte und sie nutzen das Individuum als Wirt, um sich effektiv zu verbreiten. Dabei zwingt das Mem seinen Träger, also den Menschen, bestehende Kommunikationswege zu nutzen, um weitere Wirte zu erreichen.
„Wichtig für das Verständnis von Dawkins Theorie ist, dass ein Mem die eigenständige Fähigkeit besitzt, das Verhalten des Individuums so zu verändern, dass es Informationsmuster weiter propagiert. Die Vermehrung und die Verbreitung der Meme wird zudem dadurch intensiviert, dass diese zwischen beliebigen Individuen ausgetauscht werden können, während Gene nur von den Eltern zur nächsten Generation vererbt werden können.“ (Langner 2009: 21)
Der entscheidende Mechanismus ist die menschliche Fähigkeit zur Imitation (ebd.:21). Wenn wir einen Witz hören, werden wir ihn zwar nicht exakt gleich wiedergeben können, aber wir schaffen es in der Regel, die wichtigsten Bestandteile inklusive der Pointe nachzuerzählen und damit nachzuahmen. Doch nicht nur Witze, auch Verhaltensmuster, Normen, Ideen, Werte, religiöse Motive, Melodien, Moden und Sprichwörter werden weitergegeben und entwickeln ein Eigenleben. Weil es unmöglich ist, alle Zusammenhänge im Alltag ständig zu hinterfragen, zu kopieren und zu imitieren, übernehmen wir gerne Erklärungen und Bestätigungen für unser Denkmodel von anderen Menschen. Aber nicht alle Melodien, die wir hören, werden zum Ohrwurm und nicht jede Werbeidee schafft es zum Viralen Megaerfolg. Was also muss ein Mem besitzen, damit es sich verbreitet wie eine Epidemie?
2.5.3 The Tipping Point
Malcom Gladwell (2000) beschreibt in seinem Buch „The Tipping Point: How Little Things Can Make A Big Difference“, dass es Parameter gibt, unter denen sich Kampagnen wie soziale Epidemien ausbreiten. Die Verbreitung von Trends, Ideen und sozialen Verhaltensweisen vergleicht er mit dem Verlauf einer Virusinfektion. Sie kann sehr schnell entstehen, von einem Moment auf den anderen exponentiell steigen, aber genauso schnell wieder verschwinden. Dabei gibt es nach Gladwell drei Stufen. (vgl. im Folgenden Gladwell 2002: 16ff.)
1. Die Ansteckung – am Beispiel des Gähnens. Es reicht das Wort Gähnen zu lesen, jemanden anderen gähnen zu sehen oder lediglich das zugehörige Geräusch zu hören, um selbst angesteckt zu sein und gähnen zu müssen.
2. Kleine Veränderungen haben große Auswirkungen – am Beispiel eines Blatt Papiers. Man soll sich vorstellen, dieses 50 Mal zu falten und zu schätzen wie dick es dann ist. Das Blatt würde von der Erde bis zur Sonne reichen. Denn mit jedem Falten gewinnt das Papier doppelt an Stärke. Ähnlich ist es mit viralen Ansteckungen. Wenn jeder Infizierte einen anderen ansteckt, dauert es nicht lange, bis eine Epidemie daraus wird.
3. Veränderungen treten manchmal sehr schnell ein. Dieses Prinzip beschreibt auch den Kern des Tipping Points. „Der Tipping Point (vgl. Abbildung 5) ist der Moment der kritischen Masse, die Schwelle, der Hitzegrad, bei dem das Wasser zu kochen beginnt.“ (Gladwell 2002: 18). An diesem Punkt tritt innerhalb kürzester Zeit eine große Veränderung ein.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Meist sind eine Zeit lang nur wenige von einem Virus, also einem Trend oder einer Idee, infiziert bzw. überzeugt. Am „Tipping Point“ (hier rot) kommt es dazu, dass der Trend unaufhaltsam eine Massenansteckung hervorruft. Vergleicht man das Schaubild der Nutzungszahlen von Facebook mit dem Tipping Point, so fällt auf, dass die Kurve ähnlich steil verläuft. Um eine Epidemie zum Ausbruch zu bringen, müssen nach Gladwell drei Bedingungen erfüllt werden.
1. Das Gesetz der Wenigen
Es braucht nicht Tausende von Menschen, um eine soziale Epidemie anwachsen zu lassen. Vielmehr werden große Veränderungen nach Gladwell meist nur durch eine Handvoll Menschen ausgelöst, die seltene gesellschaftliche Fähigkeiten besitzen. Durch ihr Verhalten schaffen sie es, Menschen in ihrer Umgebung anzustecken und damit eine Mundpropaganda loszutreten. Nötig dazu sind nach Gladwell drei unterschiedliche Charaktertypen: der Vermittler, der Kenner und der Verkäufer.
Vermittler erfahren meist als Erstes von Neuigkeiten. Sie sind sehr gesellige Menschen und äußerst gut vernetzt. Schafft es eine Information, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, wissen sie genau, an welche Türen sie klopfen müssen, um die richtigen Empfänger für die Nachricht zu erreichen.
Kenner sind eine Art Datenbank mit einem überdurchschnittlich breiten Wissen. Sie sind für die Inhalte der Botschaften zuständig, die von den Vermittlern verbreitet werden. Im Vergleich zu normalen Experten lieben Kenner es, ihr Wissen anderen mitzuteilen. Kommen Kenner und Vermittler miteinander in Kontakt, kann sich eine Nachricht in kürzester Zeit verbreiten.
Verkäufer sind laut Gladwell „eine Gruppe von Menschen, die die Fähigkeit besitzen, uns zu überreden, wenn wir von dem, was wir gehört haben, nicht überzeugt sind“ (2002: 85).
Dabei kommt es nicht unbedingt darauf an, was sie sagen, sondern wie sie es sagen. Sie schaffen es in kürzester Zeit, Nähe und Vertrauen aufzubauen und es fällt schwer, Verkäufern mit solch starken Persönlichkeiten zu widerstehen.
Zusammengefasst verbindet der Vermittler die Menschen miteinander. Der Kenner verbindet die Menschen dadurch, dass er sein Wissen mit ihnen teilt. Und der Verkäufer nutzt dieses Wissen, um andere davon zu überzeugen.
2. Der Verankerungsfaktor
Während es beim Gesetz der Wenigen auf die Boten ankommt, zählt beim Verankerungsfaktor der Inhalt. Eine Botschaft muss demnach die spezifische Eigenschaft haben, sich beim Empfänger im Gedächtnis zu verankern. Egal ob ein Film, Essen oder ein Produkt – es muss einprägsam und unvergesslich sein. Wie man eine solche Wirkung erzielt, dafür hat Gladwell kein Patentrezept. Als gelungenes Beispiel nennt er die Kinder-TV-Sendung „Blue’s Clues“ aus den USA. Sie wurde ausschließlich für Kinder konzipiert und hat das Ziel, Inhalte möglichst einprägsam zu vermitteln. Über viele Versuche haben die Macher herausgefunden, dass lange Pausen und ein geringes Tempo bei Kindern (im Gegenteil zu Erwachsenen) zu einer erhöhten Aufmerksamkeit führt. Sie gingen sogar soweit, dass sie dieselbe Episode von Montag bis Freitag ausstrahlten und erst in der Woche darauf die nächste Folge zeigten. Verblüffenderweise stieg die Aufmerksamkeit der Kinder je öfter diese eine Episode gezeigt wurde. Gladwell will damit zeigen, dass es für jede Nachricht eine Methode gibt, sie so zu verpacken, dass sie unwiderstehlich wird. Man muss sie nur finden.
3. Die Macht der Umstände
Dass sich ein Trend in eine Massenbewegung verwandeln lässt, hängt auch von den Bedingungen und Umständen der Zeit und des Ortes ihres Geschehens ab. Als Beispiel führt Gladwell die Zerbrochene-Fenster-Theorie der Kriminologen James Q. Wilson und Geroge Kelling (1996: 20) an. Der Theorie zufolge ist Kriminalität die unvermeidliche Folge von Unordnung (Gladwell 2002: 165f.):
„Wenn ein Fenster zerbrochen ist und nicht repariert wird, werden die Leute in der Umgebung daraus schließen, dass sich niemand darum kümmert und niemand aufpasst. Bald werden weitere Fenster zerbrochen sein, und ein Gefühl der Anarchie wird von dem Gebäude auf die Straße ausstrahlen, ein Signal dafür, dass man hier machen kann, was man will.“
Es sind demnach die vorherrschenden Bedingungen der Umwelt, die die Menschen dazu anstecken und sie verleiten, Verbrechen zu begehen. 1990 war die Kriminalstatistik in New York auf ihrem Höhepunkt und die meisten normalen Bürger trauten sich aus Angst nicht mehr, mit der verschmutzten U-Bahn zu fahren. Um diese verheerenden Zustände radikal zu verändern, reichten in diesem Fall schon kleinere Veränderungen der Umgebung. Die Graffitis wurden von den Zügen entfernt, Schwarzfahrer rigoros verhaftet - es trat eine Wende ein, hin zu deutlich weniger Fällen von Kriminalität.
Als weiteres Beispiel für die Macht der Umstände führt Gladwell ein Experiment aus der Sozialpsychologie an. Das Gefängnis-Experiment (Zimbardo 2005: 1ff.) wurde mit einer Gruppe von 21 freiwilligen, psychisch normalen und gesunden Männern an der Stanford University durchgeführt. Für eine Dauer von zwei Wochen wurden sie in Wärter und Gefangene aufgeteilt und in einem Pseudo-Gefängnis untergebracht. Ziel des Experiments war es, herauszufinden, woran es liegt, dass Gefängnisse so abscheuliche Orte sind. Ist es das Gefängnis, das die Gefangenen zu abscheulichen Menschen macht oder ist das Gefängnis an sich voll mit abscheulichen Gefangenen?
[...]
[1] FaceTime Communications ist das führende Unternehmen in den USA für „Security Compliance for Unified Communications, Web 2.0 and Social Media.
[2] Für die Untersuchung dieser Arbeit wird zwar eine breitere Auswahl an Faktoren herangezogen, dennoch ist die Zusammenfassung in diese drei Kerngebiete zum Zwecke der Vereinfachung legitim.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (eBook)
- 9783842830004
- DOI
- 10.3239/9783842830004
- Dateigröße
- 4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt – Sozialwissenschaftliche Fakultät, Studiengang Journalistik
- Erscheinungsdatum
- 2012 (März)
- Note
- 1,6
- Schlagworte
- facebook social media radio jugendradio
- Produktsicherheit
- Diplom.de