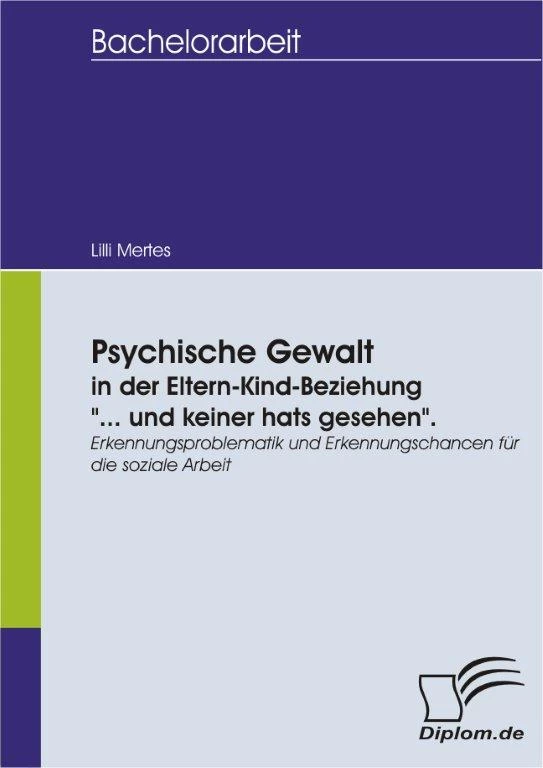Psychische Gewalt in der Eltern-Kind-Beziehung "... und keiner hats gesehen". Erkennungsproblematik und Erkennungschancen für die soziale Arbeit
©2010
Bachelorarbeit
90 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Gewalt gegen Kinder ist ein viel diskutiertes Thema und weckt vor allem bei aktuellen Pressemeldungen über Kindesmisshandlungen-, missbrauch und tötungen Entsetzen, Wut und Trauer in der Bevölkerung aus. Nicht nur in den Medien, sondern auch in der wissenschaftlichen Literatur rückt die psychische Gewalt dabei jedoch nur sehr selten in den Mittelpunkt der Betrachtungen und in nur wenigen Ausnahmefällen beschäftigen sich Autoren gezielt mit dem Thema der psychischen Gewalt in der Eltern-Kind-Beziehung.
Psychische Gewalt ist schwer fassbar, hinterlässt keine äußerlichen Spuren und die Grenzen zwischen Erziehungspraktiken, die sich des Prinzips der Strafe bedienen und der psychischen Gewalt, sind oftmals fließend (Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen: 8). Die Auseinandersetzung mit dem Thema der psychischen Gewalt ist nicht nur für die Medien, sondern auch für die Wissenschaft auf Grund dessen problematisch.
Psychische Gewalt ist jedoch allgegenwärtig und vor allem in der Eltern-Kind-Beziehung weiter verbreitet als geglaubt. Viele Kinder sind und waren psychischer Gewalt durch ihre Eltern ausgesetzt und keiner hats gesehen. Meine Titelauswahl soll auf der einen Seite auf die Machtlosigkeit und Ausgeliefertheit von Kindern aufmerksam machen, die der psychischen Gewalt durch ihre Eltern ausgesetzt sind und auf der anderen Seite die Erkennungsproblematik psychischer Gewalt in der Eltern-Kind-Beziehung durch professionelle Helfer verdeutlichen.
Hierzu betrachte ich inhaltlich die Familie als (früh)kindliche Lebenswelt und verdeutliche die Bedeutung dieser für die Kinder. Weiter betrachte ich die Eltern-Kind-Bindung als erste frühkindliche Beziehung. Die Entstehung dieser beschreibe ich und erläutere, in welchen Bindungsmustern sie bestehen kann. Abschließend gehe ich auf die Bedeutungen der verschiedenen Bindungsmuster für das Leben und die Entwicklung des Kindes, sowie auf die Eltern-Kind-Beziehung ein.
Um die psychische Gewalt speziell zu betrachten, definiere ich den Gewaltbegriff, die gesetzlichen Bestimmungen zur Gewalt an Kindern und komme auf die möglichen Formen von Gewalt zu sprechen. Anschließend definiere ich die psychische Gewalt. Erscheinungsformen psychischer Gewalt in der Eltern-Kind-Beziehung, Verhaltensweisen, Handlungen und Äußerungen der Eltern, die dem Begriff der psychischen Gewalt zuzuordnen sind, benenne ich. Im Weiteren Verlauf beleuchte ich mögliche Ursachen und einzelne […]
Gewalt gegen Kinder ist ein viel diskutiertes Thema und weckt vor allem bei aktuellen Pressemeldungen über Kindesmisshandlungen-, missbrauch und tötungen Entsetzen, Wut und Trauer in der Bevölkerung aus. Nicht nur in den Medien, sondern auch in der wissenschaftlichen Literatur rückt die psychische Gewalt dabei jedoch nur sehr selten in den Mittelpunkt der Betrachtungen und in nur wenigen Ausnahmefällen beschäftigen sich Autoren gezielt mit dem Thema der psychischen Gewalt in der Eltern-Kind-Beziehung.
Psychische Gewalt ist schwer fassbar, hinterlässt keine äußerlichen Spuren und die Grenzen zwischen Erziehungspraktiken, die sich des Prinzips der Strafe bedienen und der psychischen Gewalt, sind oftmals fließend (Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen: 8). Die Auseinandersetzung mit dem Thema der psychischen Gewalt ist nicht nur für die Medien, sondern auch für die Wissenschaft auf Grund dessen problematisch.
Psychische Gewalt ist jedoch allgegenwärtig und vor allem in der Eltern-Kind-Beziehung weiter verbreitet als geglaubt. Viele Kinder sind und waren psychischer Gewalt durch ihre Eltern ausgesetzt und keiner hats gesehen. Meine Titelauswahl soll auf der einen Seite auf die Machtlosigkeit und Ausgeliefertheit von Kindern aufmerksam machen, die der psychischen Gewalt durch ihre Eltern ausgesetzt sind und auf der anderen Seite die Erkennungsproblematik psychischer Gewalt in der Eltern-Kind-Beziehung durch professionelle Helfer verdeutlichen.
Hierzu betrachte ich inhaltlich die Familie als (früh)kindliche Lebenswelt und verdeutliche die Bedeutung dieser für die Kinder. Weiter betrachte ich die Eltern-Kind-Bindung als erste frühkindliche Beziehung. Die Entstehung dieser beschreibe ich und erläutere, in welchen Bindungsmustern sie bestehen kann. Abschließend gehe ich auf die Bedeutungen der verschiedenen Bindungsmuster für das Leben und die Entwicklung des Kindes, sowie auf die Eltern-Kind-Beziehung ein.
Um die psychische Gewalt speziell zu betrachten, definiere ich den Gewaltbegriff, die gesetzlichen Bestimmungen zur Gewalt an Kindern und komme auf die möglichen Formen von Gewalt zu sprechen. Anschließend definiere ich die psychische Gewalt. Erscheinungsformen psychischer Gewalt in der Eltern-Kind-Beziehung, Verhaltensweisen, Handlungen und Äußerungen der Eltern, die dem Begriff der psychischen Gewalt zuzuordnen sind, benenne ich. Im Weiteren Verlauf beleuchte ich mögliche Ursachen und einzelne […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Lilli Mertes
Psychische Gewalt in der Eltern-Kind-Beziehung "... und keiner hats gesehen".
Erkennungsproblematik und Erkennungschancen für die soziale Arbeit
ISBN: 978-3-8428-2921-3
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2012
Zugl. Leuphana Universität Lüneburg, Lüneburg, Deutschland, Bachelorarbeit, 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2012
Kinder
Sind so kleine Hände, winzge Finger dran
darf man nicht drauf schlagen, die zerbrechen dann
sind so kleine Füße, mit so kleinen Zehn
darf man nie drauf treten, könn sie sonst nicht gehn
sind so kleine Ohren, scharf, und ihr erlaubt
darf man nie zerbrüllen, werden davon taub
sind so schöne Münder, sprechen alles aus
darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus
sind so klare Augen, die noch alles sehn
darf man nie verbinden, könn sie nichts verstehn
sind so kleine Seelen, offen und ganz frei
darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei
ist so´n kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht
darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht
gerade klare Menschen, wär´n ein schönes Ziel
Leute ohne Rückgrat, hab´n wir schon zu viel.
Liedtext von Bettina Wegener
Inhalt
- 3 -
Inhalt
Inhalt
3
Einleitung
6
1 Die (früh)kindliche Lebenswelt Familie
8
2 Die Eltern-Kind-Bindung
11
2.1 Die Entstehung der Eltern-Kind-Bindung
13
2.2 Die Bindungsmuster
17
2.2.1 Die sichere Bindung
17
2.2.2 Die unsicher-ambivalente Bindung
18
2.2.3 Die unsicher-vermeidende Bindung
18
2.2.4 Zusatzkategorie: desorganisierte Bindung
19
3 Bedeutung der verschiedenen Bindungsmuster für die Entwicklung des
Kindes
20
3.1 Bedeutung der sicheren Bindung
20
3.2 Bedeutung der unsicheren Bindung
22
3.2.1 Bedeutung der unsicher-ambivalenten Bindung
24
3.2.2 Bedeutung der unsicher-vermeidenden Bindung
24
3.2.3 Bedeutung der desorganisierten Bindung
25
4 Gesetzliche Bestimmungen zur Gewalt in der Eltern-Kind-Beziehung
26
5 Gewalt an Kindern
28
5.1 Die Gewaltformen
29
5.1.1 Die körperliche Gewalt
29
5.1.2 Der sexuelle Missbrauch
29
5.1.3 Die Vernachlässigung
30
5.1.4 Die psychische Gewalt
31
Inhalt
- 4 -
6 Mögliche Auswirkungen von psychischer Gewalt auf die Entwicklung eines
Kindes
37
6.1 Auswirkungen auf die körperliche Entwicklung
38
6.2 Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung
38
6.3 Auswirkungen auf das Selbstkonzept, die Persönlichkeitsentwicklung und den
Charakter
39
6.4 Auswirkungen auf die sozial- emotionale Entwicklung
40
6.5 Psychische Störungen und Erkrankungen
42
7 Mögliche Ursachen und Risikofaktoren für psychische Gewalt in der
Eltern-Kind-Beziehung
43
7.1 Elterliche und familiäre Ursachen und Risikofaktoren
45
7.1.1 Erfahrungen in der eigenen Kindheit
45
7.1.2 Fehlende Einsicht und Kooperationsbereitschaft
46
7.1.3 Innere Ablehnung des Kindes
47
7.1.4 Psychische Erkrankungen, Behinderungen, Sucht der Eltern
48
7.1.5 Elterliche Kompetenzen und Kenntnisse
48
7.1.6 Elterliche Persönlichkeitsmerkmale und -defizite
49
7.1.7 Die narzisstische Bedürftigkeit der Eltern
50
7.1.8 Gewalt als Erziehungsmittel
51
7.1.9 Elterliche Konflikte
52
7.1.10 Alter der Eltern, Familiengröße
52
7.1.11 Herrschaftsansprüche der Eltern
53
7.1.12 Unsichere Eltern-Kind-Bindung
54
7.2 Außerfamiliäre und soziale Ursachen und Risikofaktoren
55
7.2.1 Armut und soziale Not
55
7.2.2 Soziale Isolation
56
7.3 Risikofaktoren beim Kind
57
7.3.1 Alter
57
7.3.2 Frühgeburtlichkeit, Erkrankungen und Behinderungen
57
7.3.3 Kindliches Verhalten und Temperament
58
Inhalt
- 5 -
7.4 Schlussbemerkung zu den möglichen Ursachen und Risikofaktoren für
psychische Gewalt in der Eltern-Kind-Beziehung
60
8 Erkennungsproblematik der psychischen Gewalt
61
9 Erkennungschancen psychischer Gewalt in der Eltern-Kind-Beziehung
65
9.1 Die Eltern-Kind-Bindung
65
9.2 Die Familienanamnese
67
9.3 Die Eltern-Kind-Interaktion
68
9.4 Die Folgen am Kind
70
9.5 Die Empathie des professionellen Helfers
70
9.6 Schlussbemerkung zu den Erkennungschancen psychischer Gewalt in der
Eltern-Kind-Beziehung
71
10 Fazit
74
11 Abschluss
79
Literaturverzeichnis
80
Tabellenverzeichnis
88
________________________________________________ ___ __ Einleitung
- 6 -
Einleitung
Gewalt gegen Kinder ist ein viel diskutiertes Thema und weckt vor allem bei
aktuellen Pressemeldungen über Kindesmisshandlungen-, missbrauch und
tötungen Entsetzen, Wut und Trauer in der Bevölkerung aus.
Nicht nur in den Medien, sondern auch in der wissenschaftlichen Literatur rückt
die psychische Gewalt dabei jedoch nur sehr selten in den Mittelpunkt der
Betrachtungen und in nur wenigen Ausnahmefällen beschäftigen sich Autoren
gezielt mit dem Thema der psychischen Gewalt in der Eltern-Kind-Beziehung.
Psychische Gewalt ist schwer fassbar, hinterlässt keine äußerlichen Spuren und
die Grenzen zwischen Erziehungspraktiken, die sich des Prinzips der Strafe
bedienen und der psychischen Gewalt, sind oftmals fließend (Bundesministerium
für soziale Sicherheit und Generationen: 8). Die Auseinandersetzung mit dem
Thema der psychischen Gewalt ist nicht nur für die Medien, sondern auch für die
Wissenschaft auf Grund dessen problematisch.
Psychische Gewalt ist jedoch allgegenwärtig und vor allem in der Eltern-Kind-
Beziehung weiter verbreitet als geglaubt. Viele Kinder sind und waren psychischer
Gewalt durch ihre Eltern ausgesetzt ,,...und keiner hat´s gesehen."
Meine Titelauswahl soll auf der einen Seite auf die Machtlosigkeit und
Ausgeliefertheit von Kindern aufmerksam machen, die der psychischen Gewalt
durch ihre Eltern ausgesetzt sind und auf der anderen Seite die
Erkennungsproblematik psychischer Gewalt in der Eltern-Kind-Beziehung durch
professionelle Helfer verdeutlichen.
Hierzu betrachte ich inhaltlich die Familie als (früh)kindliche Lebenswelt und
verdeutliche die Bedeutung dieser für die Kinder. Weiter betrachte ich die Eltern-
Kind-Bindung als erste frühkindliche Beziehung. Die Entstehung dieser
beschreibe ich und erläutere, in welchen Bindungsmustern sie bestehen kann.
Abschließend gehe ich auf die Bedeutungen der verschiedenen Bindungsmuster
für das Leben und die Entwicklung des Kindes, sowie auf die Eltern-Kind-
Beziehung ein.
________________________________________________ ___ __ Einleitung
- 7 -
Um die psychische Gewalt speziell zu betrachten, definiere ich den Gewaltbegriff,
die gesetzlichen Bestimmungen zur Gewalt an Kindern und komme auf die
möglichen Formen von Gewalt zu sprechen. Anschließend definiere ich die
psychische Gewalt. Erscheinungsformen psychischer Gewalt in der Eltern-Kind-
Beziehung, Verhaltensweisen, Handlungen und Äußerungen der Eltern, die dem
Begriff der psychischen Gewalt zuzuordnen sind, benenne ich. Im weiteren
Verlauf beleuchte ich mögliche Ursachen und einzelne elterliche und
außerfamiliäre Risikofaktoren, als auch Risikofaktoren am Kind.
Auf Grundlage dieser Betrachtungen mache ich auf die besondere
Erkennungsproblematik der psychischen Gewalt in der Eltern-Kind-Beziehung
aufmerksam und arbeite als Ziel meiner Arbeit, Erkennungsmöglichkeiten für die
psychische Gewalt in der Eltern-Kind-Beziehung heraus, die für die Erkennung
und Einschätzung psychischer Gewalt durch professionelle Helfer hilfreich sein
können.
Als Grundlage für die Herausarbeitung von Erkennungsmöglichkeiten psychischer
Gewalt ziehe ich, wie bereits beschrieben, die grundlegenden Informationen und
Definitionen zur (früh)kindlichen Lebenswelt, der Eltern-Kind-Bindung und der
psychischen Gewalt hinzu, weshalb ich nun mit der Betrachtung dieser Elemente
meiner Arbeit beginnen möchte.
Die (früh)kindliche Lebenswelt Familie
- 8 -
1 Die (früh)kindliche Lebenswelt Familie
Die Entwicklung des Kindes als Individuum beginnt bereits mit der Zeugung. Im
Mutterleib entwickelt es sich unter Bedingungen maximaler Geborgenheit und
wird rundum versorgt. Die grundlegenden Lebensfunktionen des Ungeborenen
können sich in einer Umgebung von Sicherheit, Schutz und Wärme differenzieren.
Außerhalb des Mutterleibs gerät das Neugeborene in eine Lebenswelt mit völlig
neuen Qualitäten (Seibert, Norbert 1999: 114). Als ,,physiologische Frühgeburt"
(Portmann 1951: 114) ist es auf seine Außenwelt und somit auf seine
Bezugspersonen
1
angewiesen, um die Atmosphäre von Geborgenheit, Sicherheit,
Schutz und Wärme aufrechterhalten zu können. Es ist angewiesen auf die Pflege,
Versorgung und die körperliche und emotionale Zuwendung durch das
Familiensystem, in das es hineingeboren wurde (Seibert, Norbert 1999: 114).
Das Neugeborene verfügt über angeborene Mechanismen, die es vor
Ungeborgenheit und Unterversorgung schützen sollen. Es kann durch das
Weinen signalisieren, ob es Hunger oder Durst hat, trocken gelegt werden
möchte, Zuwendung braucht oder Schmerzen hat. Auch seine Reflexe, wie der
Saugreflex oder Klammerreflex, können als Schutzmechanismus angesehen
werden (Bruschweiler-Stern, Nadia 2008: 220), denn ,,ohne die
überlebenssichernde Präsenz und pflegende Aktivität der ersten
Bezugsperson(en) würde der Säugling sterben" (Seibert, Norbert 1999: 116).
Erst wenn die Mechanismen funktionieren, kann das Kind beginnen die Welt zu
erfassen und Bindung aufzubauen. Der Aufbau der kindlichen Lebenswelt wird in
der frühen Entwicklung vorrangig durch die Entwicklung von Beziehung und
Bindung zwischen Eltern und Kind bestimmt.
1
Als Bezugspersonen werden im weiteren Verlauf die Eltern benannt, die im individuellen Fall auch
Pflegeeltern, Adoptiveltern, Großeltern und andere Personen sein können, die in der frühen Kindheit
die Versorgung und Erziehung des Kindes übernehmen.
Die (früh)kindliche Lebenswelt Familie
- 9 -
Die hieraus entstehende Geborgenheit ist rückblickend eines der wichtigsten
Kriterien für das Glücklichsein in der ehemaligen Kindheit und fundamental
wichtig um ein Urvertrauen zu gewinnen und die frühe kindliche Lebenswelt als
förderlich zu erleben (Seibert, Norbert 1999: 116, 135).
Weiter ist das Selbstwertgefühl wichtig, welches von Anfang an und im Zuge der
Entwicklung wesentlich mit den Bewertungen durch die Eltern verbunden ist.
Bewertungen der Eltern wie ,,böses Kind", ,,liebes Kind", ,,dummes Kind" usw.
prägen, egal ob sie ausgesprochen oder nur emotional vermittelt werden, das
Selbstwertgefühl des Kindes. Das Selbstwertgefühl ist ein steuerndes Element für
das Lebensgefühl und somit für die Lebenswelt der Kinder (Seibert, Norbert 1999:
117).
Die ,,Lebenswelt des Geborgenseins" (Seibert, Norbert 1999: 116) ist besonders
in der frühen Kindheit äußerst wichtig. Dies ergibt sich aus der geringen
Möglichkeit von Kleinstkindern und Kleinkindern sich gegen Ungeborgenheit zu
wehren. Sie sind körperlich, als auch psychisch, nicht in der Lage sich
Geborgenheit im Sinne von Sicherheit, Wärme, Schutz und Wohlbefinden selbst
zu verschaffen, wobei es auch älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
häufig nicht leicht fällt eine Ungeborgenheit zu vermeiden oder einer solchen zu
entfliehen (Seibert, Norbert 1999: 116).
Das Kind wird hineingeboren in ein soziales Mikrosystem
2
, aus dem es sich
zunächst nicht lösen kann. Es muss sich mit den gegebenen Strukturen abfinden,
ist abhängig von ihnen und ihnen schutzlos ausgeliefert.
Im Rahmen des Bindungsaufbaues entsteht das Vertrauen, wenn die Bindung
,,eine zuverlässige, auf Vertrauen und Verläßlichkeit gründende, Sicherheit und
Geborgenheit spendende emotionale Bindung zu einer entscheidenden
Bezugsperson" ist. (Eggers, C. 1984: 10-11)
2
mit dem sozialen Mikrosystem ist in diesem Fall die Familie gemeint. Es sind alle Familienformen
denkbar.
Die (früh)kindliche Lebenswelt Familie
- 10 -
Werden seine vielfältigen Bedürfnisse durch seine Eltern befriedigt und ist seine
Lebenswelt förderlich für seine Entwicklung, so kann diese Anhängigkeit und das
Ausgeliefertsein bis in die späte Kindheit oder Jugend durch eine gute Bindung
und Beziehung verkraftet werden und sogar nützlich für das Kind sein.
Ist dies aber nicht der Fall, so kann keine sichere Eltern-Kind-Bindung entstehen
und die Lebenswelt keine Förderliche sein. Aus dem Ausgeliefertsein und der
Abhängigkeit von den Eltern resultiert die besondere Schwere der Misshandlung,
Vernachlässigung oder Gewalt an Kindern, gleich ob diese körperlicher- oder
seelischer Natur ist.
Genau hieraus resultiert die Relevanz sich genauer mit dem Thema Gewalt an
Kindern zu befassen.
Im weiteren Verlauf thematisiere ich in Hinblick hierauf zunächst die Entstehung
und Bedeutung der Eltern-Kind-Bindung und anschließend die Folgen von
mangelnder Eltern-Kind-Bindung.
Die Eltern-Kind-Bindung
- 11 -
2 Die Eltern-Kind-Bindung
,,Unter Bindung versteht man eine lang andauernde, enge emotionale Beziehung
zu bestimmten Personen, die Schutz oder Unterstützung bieten können. Diese
Bindungspersonen, die auf Bedürfnisse eines Kindes (...) nach Nähe und
Zuneigung reagieren, sind nicht ohne weiteres auswechselbar, da die Art der
Bindungsbeziehung individuell an diese Personen angepasst ist"
(Grossmann&Grossmann: 302).
Die Bindungstheorie, die in den 50er Jahren von dem englischen Psychiater und
Psychoanalytiker John Bowlby entwickelt wurde, geht davon aus, dass es ein
angeborenes Bindungssystem gibt und dass ein Kind ,,(...) im Laufe des ersten
Lebensjahres auf der Grundlage eines biologisch angelegten Verhaltenssystems
eine starke emotionale Bindung zu einer Hauptbezugsperson entwickelt, die er bei
Schmerz oder Gefahr aufsucht" (Brisch, Karl Heinz 2003: 51).
Das bei Schmerz, Gefahr, aber auch bei Müdigkeit, Kummer, Furcht oder
Krankheit ausgelöste Bindungsverhalten zielt auf die Erreichung oder
Aufrechterhaltung von physischer und psychischer Nähe ab und damit zu einem
Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Das Bindungsverhalten beim Kind
äußert sich durch direktes Nähesuchen, wie beispielsweise durch das
Festklammern oder die gezielte Kommunikation durch das Weinen.
Bindung wird als ein Muster sozialer Emotionsregulation verstanden, welches sich
in Bindungsverhalten äußert. Mit zunehmendem Alter genügt es dem Kind, an die
Bezugsperson zu denken, um seine Emotionen zu regulieren (Zimmermann,
Peter u.a. 2000: 302).
Weiter führen Erfahrungen von Unterstützung und emotionaler Verfügbarkeit von
den Eltern zum Aufbau internaler Arbeitsmodelle, welche die Regulierung eigener
Gefühle zunächst in der Interaktion zu den Eltern und später in allen Beziehungen
steuern (Zimmermann, Peter u.a. 2000: 302-303).
Die Eltern-Kind-Bindung
- 12 -
Im negativen Fall entstehen die internalen Arbeitsmodelle aus Erfahrungen der
Zurückweisung und nicht Erfüllung der kindlichen Bedürfnisse. Aus den vielen
Interaktionserlebnissen zwischen Kind und Eltern kann es innere Arbeitsmodelle
herausbilden, die Erfahrungswissen, Erwartungen und Vorstellungen hinsichtlich
der Bindungspersonen und sich selbst beinhalten. Diese Arbeitsmodelle
ermöglichen es den Kindern das Verhalten der Bezugspersonen vorhersehbar zu
machen, zu interpretieren und dementsprechend zu planen (Zimmermann, Peter
u.a. 2000: 302-303).
Die inneren Arbeitsmodelle sind zunächst flexibel, werden jedoch im Verlauf der
Entwicklung und durch weitere Erfahrungen immer stabiler (Brisch, Karl Heinz
2005: 37).
Die internalen Arbeitsmodelle, die das Kind letztlich aufbauen konnte, bleiben im
Kern häufig ein Leben lang bestehen, können allerdings durch Erfahrungen im
weiteren Lebensverlauf noch modifiziert werden.
Somit steuern die frühen Erfahrungen aus der ursprünglichen Eltern-Kind-Bindung
unbewusst alle späteren zwischenmenschlichen Beziehungen, Erfahrungen und
sozialen Interaktionen. Sie sind der Ausgangspunkt für alle späteren emotionalen
Bindungen in Freundschaften und Partnerschaften (Kennell, John H./ Klaus,
Marshall H. 1983: 18).
Die Mutter soll das Kind als Teil und Erweiterung ihrer eigenen Person empfinden,
denn Mutter und Kind benötigen dieses Gefühl, um eine enge Bindung zu
entwickeln. Die Mutter benötigt das Gefühl eng mit dem Kind verbunden zu sein,
um sich umfassend um ihr Kind zu kümmern und Befriedigung zu empfinden,
wenn sie die Entwicklung ihres Kindes verfolgt und weiß, dass sie diese durch
ihre Versorgung ermöglicht hat (Bowlby, John 1973: 95-96).
Eine herzliche, dauerhafte und innige Beziehung zu der Mutter ist unerlässliche
Vorraussetzung für die geistige Gesundheit, Glück und Zufriedenheit eines
Menschen (Bowlby, John 1973: 15). Aber auch die Gefühlswärme in der Vater-
Kind-Beziehung spielt eine wichtige Rolle für die kindliche Entwicklung (Rutter,
Michael 1978: 20).
Die Entstehung der Eltern-Kind-Bindung
- 13 -
Die Eltern-Kind-Bindung ist nichts, was kontinuierlich fortschreitend wächst,
sondern in einem nichtkontinuierlichem Prozess aus Begegnungen entsteht
(Bruschweiler-Stern, Nadia 2008: 226).
Die Entstehung der Eltern-Kind-Bindung beschreibe ich im weiteren Verlauf
genauer.
2.1 Die Entstehung der Eltern-Kind-Bindung
Die Entstehung der Bindung beginnt bei Mutter und Kind bereits vor der Geburt.
,,Aus psychologischer Sicht wird die Entwicklung der Bindung (...) vor und
während der Schwangerschaft durch die Vorstellungen der Mutter, wie ihr Baby
sein und welchen Platz es in der Familie einnehmen wird, vorbereitet
(Bruschweiler-Stern, Nadia 2008: 221)." Der Beginn der Bindung erfolgt somit
bereits vor und während der Schwangerschaft.
Auch die Bindung des Ungeborenen beginnt bereits pränatal. Es lernt während
der Schwangerschaft bereits die Sprache, den Tonfall, die Sprechweise, den
Geruch und Geschmack, sowie bestimmte Rhythmen der Mutter kennen
(Bruschweiler-Stern, Nadia 2008: 221).
Nach der Geburt erlebt das Neugeborene seine Mutter durch die vielen Eindrücke
und Erfahrungen aus dem Mutterleib als vertraut. Das visuelle System ist so
angelegt, dass die Mutter sich natürlicherweise, beispielsweise beim Wickeln,
Stillen oder Schmusen im Gesichtsfeld des Neugeborenen befindet, da es
zunächst Vorgänge am besten auf kurze Distanz sieht. Das Neugeborene lernt,
die bereits bekannte Stimme mit einem Gesicht, einer Berührung und einem
Rhythmus in Verbindung zu bringen (Bruschweiler-Stern, Nadia 2008: 221).
Die Entstehung der Eltern-Kind-Bindung
- 14 -
Das konzentrierte Fixieren der Mutter spricht dafür, dass das Kind im Gesicht der
Mutter etwas wieder erkennt und beispielsweise die bekannte Stimme dem
Gesicht der Mutter zuordnet (von Lüpke, Hans 2003: 136-137).
Das Neugeborene ist dafür ausgerüstet, sich für seine Mutter zu interessieren und
sich auf sie zu konzentrieren. Es hat die starke Neigung, eine Bindung zu den
Erwachsenen einzugehen, die es in seinem ersten Lebensjahr betreuen
(Bruschweiler-Stern, Nadia 2008: 221).
Kinder aber auch Eltern bringen angelegte, intuitive Vorraussetzungen für die
gegenseitige Abstimmung des Beziehungssystems und die Entwicklung ihrer
Beziehung mit (Sarimski, Klaus/ Papousek, Mechthild 2000: 200).
Säuglinge verfügen über ein Repertoire an angeborenen Fähigkeiten, die dem
Prozess der Beziehungsentwicklung dienen. Das Repertoire ist ausgestattet mit
Blickverhalten, Mimik, Vokalisation, Motorik und Wahrnehmungs- und
Lernvermögen. Aber auch Eltern zeigen ein intuitives Repertoire an
Verhaltensmustern, wie die Ammensprache, die Nachahmung und einfache
Anregungsmuster, die sensibel auf die kindlichen Verhaltenssignale abgestimmt
sind. Die elterlichen Verhaltensweisen sind angelegt und werden intuitiv
gesteuert. Sie dienen zur Kompensation der anfänglichen Unreife der Kinder und
unterstützen den Reifungs- und Anpassungsprozess dieser (Sarimski, Klaus/
Papousek, Mechthild 2000: 200-201).
Die zu meisternden Reifungs- und Anpassungsaufgaben der Neugeborenen in
den ersten beiden Lebensjahren sind viele. Es muss die Nahrungsaufnahme
erlernen, sein Verhalten und Schlaf-Wachrhythmus regulieren und seine
Aufmerksamkeit fokussieren lernen. Es muss weiter ein Gleichgewicht zwischen
Bindung und Exploration der Umwelt und Autonomie und Abhängigkeit suchen.
Diese Entwicklungsaufgaben kann ein Kind nur gemeinsam mit seinen Eltern
meistern, durch die gegenseitige Abstimmung in der frühen Eltern-Kind-
Beziehung.
Die Entstehung der Eltern-Kind-Bindung
- 15 -
Gelingt die gemeinsame Regulation der Entwicklungsaufgaben nicht, so kommt
es zu Regulationsstörungen beim Kind. Fütter- oder Schlafstörungen, motorische
Unruhe oder Trennungsängste können solche Regulationsstörungen sein
(Sarimski, Klaus/ Papousek, Mechthild 2000: 200).
Die Eltern-Kind-Bindung hat somit eine Reihe von biologischen Funktionen. Sie
dient dazu, das Kind bei Gefahr zu schützen, indem das Bindungsverhalten
ausgelöst und die Nähe zum Erwachsenen aktiv durch das Kind hergestellt wird.
Weiter fördert es die Integration von Erfahrungen bezüglich des Vertrauens und
somit die Kompetenz und den Wissenserwerb beim Kind. Als letzte Funktion kann
die Unterstützung bei der Bewältigung von den zumeisternden Entwicklungs- und
Anpassungsaufgaben benannt werden (Sarimski, Klaus/ Papousek, Mechthild
2000: 200).
Die Eltern-Kind-Bindung entwickelt sich allmählich und ist normalerweise relativ
fest begründet, wenn das Kind etwa ein Jahr alt ist.
Nahezu alle Säuglinge bauen Bindungen auf, außer Kinder mit schweren
Behinderungen oder Kinder, die keine Gelegenheit zu länger anhaltenden
Interaktionen zu Bezugspersonen haben. Dennoch ist die Qualität der
entstandenen Eltern-Kind-Bindungen unterschiedlich (Erickson, Martha Farrell/
Egeland, Byron 2006: 33).
Forschungsergebnisse zeigen, dass die Bindungsqualität stark von der
Feinfühligkeit der Eltern abhängt, auf Signale und Zeichen des Kindes zu
reagieren (Bruschweiler-Stern, Nadia 2008: 221).
Um die Qualität von Eltern-Kind-Bindungen zu erfassen, entwickelte Mary
Ainsworth ausgehend von John Bowlbys Erkenntnissen und eigenen
Beobachtungen die wirkungsvolle Methode der ,,Fremden Situation" (Erickson,
Martha Farrell/ Egeland, Byron 2006: 32).
Die Entstehung der Eltern-Kind-Bindung
- 16 -
Bei der ,,Fremden Situation" wird auf Video aufgezeichnet, inwieweit Kleinstkinder
im Alter von 8-22 Monaten in Anwesenheit ihrer Bezugsperson in einer
unbekannten Umgebung spielen und explorieren, wie sie mit zwei kurzen
Trennungen von ihrer Bezugsperson umgehen und wie sie auf Trost und
Beruhigung durch die Bezugsperson reagieren, wenn diese wieder ins Zimmer
kommt. Auch eine fremde Person ist als Vergleichsperson involviert
(Zimmermann, Peter u.a. 2000: 303).
Im folgenden Verlauf stelle ich zusammengefasst den Ablauf der ,,fremden
Situation" dar.
Ablauf der Fremden Situation
1. Elternteil und Kind betreten einen unbekannten Raum mit Spielsachen.
2. Elternteil und Kind sind alleine, das Kind kann den Raum untersuchen.
3. Fremde Person betritt den Raum, setzt sich, spricht erst mit dem Elternteil und
nimmt dann Kontakt zum Kind auf.
4. Elternteil verlässt den Raum; fremde Person und Kind bleiben zurück.
5. Erste Wiedervereinigung; Elternteil kommt zurück, beruhigt das Kind -- falls
notwendig -- und lässt dann das Kind explorieren; fremde Person verlässt den
Raum.
6. Elternteil verlässt den Raum; Kind bleibt alleine zurück.
7. Fremde Person betritt den Raum, beruhigt das Kind -- falls notwendig -- und
lässt das Kind dann explorieren.
8. Zweite Wiedervereinigung; Elternteil kehrt zurück, beruhigt das Kind -- falls
notwendig -- und lässt es dann explorieren; die fremde Person verlässt den
Raum.
Die Bindungsmuster
- 17 -
Mit Hilfe dieser Methode konnten verschiedene Bindungsmuster eröffnet werden,
die in die drei Hauptklassifikationen sicher, unsicher-vermeidend und unsicher-
ambivalent und in die Zusatzkategorie desorganisiert eingeteilt werden. Die
desorganisierte Bindung kann zusätzlich zu den drei Hauptmustern auftreten
(Erickson, Martha Farrell/ Egeland, Byron 2006: 32; Zimmermann, Peter u.a.
2000: 303).
Im weiteren Verlauf beschreibe ich die unterschiedlichen Bindungsmuster und
gehe auf die Bedeutung und die Folgen der verschieden Bindungsqualitäten ein.
2.2 Die Bindungsmuster
2.2.1 Die sichere Bindung
Ein sicher gebundenes Kind spielt und forscht begeistert und vertrauensvoll in
Anwesenheit seiner Bezugsperson. Es stellt immer wieder den Kontakt zur
Bezugsperson her, durch Blicke, Lautäußerungen, Lächeln oder indem es ihr
Spielzeug zeigt. Ein sicher gebundenes Kind sucht und akzeptiert bereitwillig
Trost der Bezugsperson nach der Trennung und hat bei Wiedervereinigung mit
dieser einen offenen emotionalen Ausdruck (Erickson, Martha Farrell/ Egeland,
Byron 2006: 32).
Ein sicher gebundenes Kind besitzt eine wirkungsvolle soziale Emotionsregulation
und sucht hierdurch die Nähe und Kommunikation mit der Bezugsperson, sobald
diese den Raum wieder betritt.
Das Verhältnis zwischen Forschungs- und Spieldrang und dem
Sicherheitsbedürfnis des Kindes ist ausgeglichen, so dass sich das Kind bei
Wiedervereinigung mit der Bezugsperson rasch beruhigen lässt und weiter
explorieren kann (Zimmermann, Peter u.a. 2000: 304; Brisch, Karl Heinz 2003:
58).
Die Bindungsmuster
- 18 -
2.2.2 Die unsicher-ambivalente Bindung
Ein unsicher-ambivalent gebundenes Kind ist die gesamte Zeit damit beschäftigt,
den Kontakt zur Bezugsperson aufrechtzuerhalten. Es traut sich nicht zu spielen
oder seine Umgebung zu erkunden (Zimmermann, Peter u.a. 2000: 304).
Das Kind ist sehr bestürzt über die Trennung zur Bezugsperson, reagieren jedoch
ambivalent auf die Rückkehr dieser. Das Kind sucht in einem Augenblick die
Nähe des Elternteils, weist die Nähe jedoch im nächsten Augenblick zurück.
Die Reaktionen wechseln zwischen verzweifelter Anklammerung an die
Bezugsperson, Nähesuchen und aktivem, ärgerlichem Kontaktwiderstand bis hin
zur Aggressivität, wenn die Bezugsperson Trost spenden will (Erickson, Martha
Farrell/ Egeland, Byron 2006: 34).
Bei einer Wiedervereinigung zeigt das Kind eine starke emotionale Erregung und
lässt sich nur schwer beruhigen. Das Kind wirkt passiv und die Nähe der
Bezugsperson gibt ihm nicht genügend Sicherheit um explorieren zu können
(Zimmermann, Peter u.a. 2000: 304).
2.2.3 Die unsicher-vermeidende Bindung
Ein unsicher-vermeidend gebundenes Kind zeigt keinen sichtbaren Kummer
darüber, dass die Bezugsperson den Raum verlässt und vermeidet aktiv die
Kontaktaufnahme und Interaktion, wenn diese nach der Trennung wieder den
Raum betritt (Erickson, Martha Farrell/ Egeland, Byron 2006: 34).
Bei der Wiedervereinigung des Kindes mit der Bezugsperson vermeidet das Kind
den Kontakt und die Nähe zum Elternteil. Es zeigt durch die Trennung kaum einen
Ausdruck emotionaler Belastung und beschäftigt sich weiter mit dem Spielmaterial
(Zimmermann, Peter u.a. 2000: 304).
Die Bindungsmuster
- 19 -
2.2.4 Zusatzkategorie: desorganisierte Bindung
Das desorganisiert gebundene Kind zeigt im Kontakt zu seiner Bezugsperson
häufig mehrere widersprüchliche, wechselhafte Verhaltensweisen gleichzeitig. Es
streckt beispielsweise die Arme nach seiner Bezugsperson aus, verzieht dabei
aber sein Gesicht oder läuft zur Bezugsperson hin, bleibt stehen und kehrt um
(Erickson, Martha Farrell/ Egeland, Byron 2006: 34-35).
Bei Wiedervereinigung nach der Trennung zeigt das Kind kurze, bizarre
Verhaltensweisen, wie das Einfrieren des Gesichtsausdrucks oder des Körpers
und heftiger Impulsivität (Zimmermann, Peter u.a. 2000: 304; Zimmermann, Peter/
Spangler, Gottfried 2008: 692-693). Die kindlichen Bewegungen wirken
psychomotorisch gestört (Brisch, Karl Heinz 2005: 78).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842829213
- DOI
- 10.3239/9783842829213
- Dateigröße
- 480 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Leuphana Universität Lüneburg – Fakultät für Bildungs-, Kultur- und Sozialwissenschaften, Soziale Arbeit/Sozialpädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2012 (Februar)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- psychische gewalt arbeit eltern-kind-beziehung erkennungsproblematik bindungsmuster
- Produktsicherheit
- Diplom.de