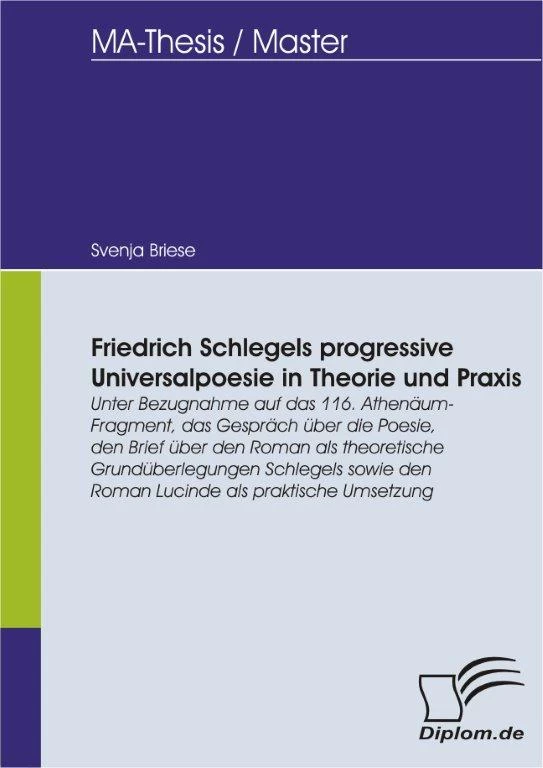Friedrich Schlegels progressive Universalpoesie in Theorie und Praxis
Unter Bezugnahme auf das 116. Athenäum-Fragment, das Gespräch über die Poesie, den Brief über den Roman als theoretische Grundüberlegungen Schlegels sowie den Roman Lucinde als praktische Umsetzung
Zusammenfassung
FRIEDRICH SCHLEGEL kann als bedeutende Persönlichkeit der Frühromantik bezeichnet werden, die inspiriert durch den Jenaer Frühromantiker Kreis nicht nur der Dichtkunst, sondern auch der Kunst insgesamt sowie der Auffassung von der Welt eine neue, nämlich die romantische Anschauung verliehen hat, welche sich hinter dem Namen progressive Universalpoesie verbirgt.
SCHLEGEL legt sein Programm der Universalpoesie nicht in einem poetischen Werk, sondern in zahlreichen einzelnen Schriften und Fragmenten dar. Diese Art und Weise der Dokumentation spiegelt den Charakter der Universalpoesie wider. Das Fragment als unabgeschlossenes Textdokument repräsentiert demnach das progressive Wesen der Universalität. Die Tatsache, dass er nicht nur Fragmente, sondern auch andere Textsorten wählt, wie beispielsweise den Brief, deutet auf ein weiteres die Universalität kennzeichnendes Element hin, nämlich die Vielfalt, die einerseits dem Poeten gegeben ist, andererseits der Kunst insgesamt sowie dem Leben immanent ist. Diese Vielfalt soll nicht isoliert, sondern ganzheitlich betrachtet werden. Gemeinsam ist SCHLEGELS diversen Texten vor allem eines; die enorme Fülle an Ideen. Aufgrund dieser Tatsache und des Umfangs der Arbeit basiert diese Ausarbeitung auf einer kleinen Auswahl aus SCHLEGELS Texten, nämlich dem 116. Athenäum-Fragment, dem Gespräch über die Poesie, hier wird die Einleitung und der dritte Teil Brief über den Roman berücksichtigt, sowie der Roman Lucinde.
Das 116. Athenäum-Fragment, welches 1798 in der von den Brüdern August Wilhelm und Friedrich Schlegel begründeten Zeitschrift Athenäum veröffentlicht wurde, ist das älteste der Arbeit zugrunde liegende Textdokument beziehungsweise Fragment. Kennzeichnend für das 116. Athenäum-Fragment ist die Idee der Universalität, also die ganzheitliche Be-trachtungsweise von der Dichtkunst, der Kunst insgesamt und dem Leben, die zentral für SCHLEGELS progressive Universalpoesie ist.
Das Gespräch über die Poesie, das 1799 von SCHLEGEL verfasst und 1800 veröffentlicht wurde, wird von MENNEMEIER als das wichtigste Dokument der frühromantischen Literaturauffassung deklariert. Kennzeichnend für das Gespräch über die Poesie ist MENNEMEIER zufolge die Intention, vor allem die Poesie, aber auch andere Bereiche, zu verändern. Die permanente Veränderung und Weiterentwicklung, die in dieser Arbeit unter dem Begriff Dynamik gefasst werden, sind überhaupt kennzeichnende Prinzipien von SCHLEGELS […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Thematik
1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
2 Darstellung der Theorie der progressiven Universalpoesie
2.1 Dynamik und Unendlichkeit
2.1.1 Freie Reflexion
2.1.2 Ironie
2.1.3 Schlegels dynamische Metaphern
2.2 Universalität
2.2.1 Zusammenführung der Gattungen
2.2.2 Vereinigung von Gegensätzen
2.2.2.1 Genialität und Kritik
2.2.2.2 Kunst- und Naturpoesie
2.2.3 Wechselseitiges Durchdringen
2.2.4 Pars pro toto und Subjekt-Objekt-Synthese
2.2.5 Dialektik
2.3 Der Künstler im Spannungsfeld zwischen Individualität und Sozialität
2.3.1 Individualität des Dichters
2.3.2 Sozialität des Dichters
2.4 Vorbild- und Analogiecharakter der Natur
2.4.1 Naturpoesie als ursprüngliche Poesie
2.4.2 Analogie von Poesie und Natur
2.5 Das „Romantische“ im Roman
2.5.1 Formfreiheit und Struktur des Romans
2.5.2 Sentimentalität
2.5.2.1 Definition der Sentimentalität
2.5.2.2 Antike und Moderne
2.5.2.3 Musik und Poesie
2.5.2.4 Bedeutung der Sentimentalität
2.5.3 Fantasie
2.5.4 Arabeske
2.5.4.1 Definition der Arabeske
2.5.4.2 Naturprodukt und Kunstwerk
2.5.4.3 Bedeutung der Arabeske
2.5.5 Bekenntnisse
2.5.6 Romantische Lesart
3 Das Verhältnis von Theorie und Praxis
4 Darstellung der Praxis der progressiven Universalpoesie im Roman Lucinde
4.1 Dynamik und Unendlichkeit
4.1.1 Freie Reflexion
4.1.2 Ironie
4.2 Universalität
4.2.1 Vereinigung von Gegensätzen
4.2.2 Wechselseitiges Durchdringen
4.2.3 Pars pro toto und Subjekt-Objekt-Synthese
4.3 Der Künstler im Spannungsfeld zwischen Individualität und Sozialität
4.3.1 Individualität
4.3.2 Sozialität
4.4 Vorbild- und Analogiecharakter der Natur
4.4.1 Naturpoesie als ursprüngliches Poesie
4.4.2 Analogie von Poesie und Natur
4.5 Das „Romantische“ im Roman
4.5.1 Formfreiheit und Struktur des Romans
4.5.2 Sentimentalität und Fantasie
4.5.3 Arabeske
4.5.4 Bekenntnisse
4.5.5 Romantische Lesart
5 Schlussbetrachtung
6 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Thematik
Friedrich Schlegel kann als bedeutende Persönlichkeit der Frühromantik bezeichnet werden, die inspiriert durch den Jenaer Frühromantiker Kreis nicht nur der Dichtkunst, sondern auch der Kunst insgesamt sowie der Auffassung von der Welt eine neue, nämlich die romantische Anschauung verliehen hat, welche sich hinter dem Namen progressive Universalpoesie verbirgt.
Schlegel legt sein Programm der Universalpoesie nicht in einem poetischen Werk, sondern in zahlreichen einzelnen Schriften und Fragmenten dar. Diese Art und Weise der Dokumentation spiegelt den Charakter der Universalpoesie wider. Das Fragment als unabgeschlossenes Textdokument repräsentiert demnach das progressive Wesen der Uni-versalität. Die Tatsache, dass er nicht nur Fragmente, sondern auch andere Textsorten wählt, wie beispielsweise den Brief, deutet auf ein weiteres die Universalität kennzeich-nendes Element hin, nämlich die Vielfalt, die einerseits dem Poeten gegeben ist, anderer-seits der Kunst insgesamt sowie dem Leben immanent ist. Diese Vielfalt soll nicht isoliert, sondern ganzheitlich betrachtet werden. Gemeinsam ist Schlegels diversen Texten vor allem eines; die enorme Fülle an Ideen. Aufgrund dieser Tatsache und des Umfangs der Arbeit basiert diese Ausarbeitung auf einer kleinen Auswahl aus Schlegels Texten, nämlich dem 116. Athenäum-Fragment, dem Gespräch über die Poesie, hier wird die Ein-leitung und der dritte Teil Brief über den Roman berücksichtigt, sowie der Roman Lucinde.
Das 116. Athenäum-Fragment, welches 1798 in der von den Brüdern August Wilhelm und Friedrich Schlegel begründeten Zeitschrift Athenäum veröffentlicht wurde, ist das älteste der Arbeit zugrunde liegende Textdokument beziehungsweise Fragment.[1] Kennzeichnend für das 116. Athenäum-Fragment ist die Idee der Universalität, also die ganzheitliche Be-trachtungsweise von der Dichtkunst, der Kunst insgesamt und dem Leben, die zentral für Schlegels progressive Universalpoesie ist.[2]
Das Gespräch über die Poesie, das 1799 von Schlegel verfasst und 1800 veröffentlicht wurde, wird von Mennemeier als „das wichtigste Dokument der frühromantischen Lite-raturauffassung“ deklariert.[3] Kennzeichnend für das Gespräch über die Poesie ist Mennemeier zufolge die Intention, vor allem die Poesie, aber auch andere Bereiche, zu verändern.[4] Die permanente Veränderung und Weiterentwicklung, die in dieser Arbeit unter dem Begriff Dynamik gefasst werden, sind überhaupt kennzeichnende Prinzipien von Schlegels progressiver Universalpoesie. Bezeichnend für die Einleitung des Gesprächs über die Poesie ist auch die Analogie zwischen Natur und Poesie. Die Natur, insbesondere die pflanzliche Natur, nimmt in Schlegels Poesie eine bedeutende Rolle ein, da sie Vorbild seiner Universalpoesie ist. Dies äußert sich durch zahlreiche Vergleiche sowie durch die Naturmetaphorik, die nicht nur im Gespräch über die Poesie, sondern auch im Roman Lucinde zu finden ist.
Das dritte Hauptstück des Gesprächs über die Poesie, Brief über den Roman, wird ge-wählt, da Schlegel in diesem seine Vorstellungen von einem romantischen Roman dar-stellt.[5] In Form eines Belehrungsbriefes an einen weiblichen Adressaten entwickelt er das, was er unter dem „Romantischen“ versteht. Dabei geht er hauptsächlich auf den Inhalt des Romans, dessen Form und Struktur ein. Seine Ansichten über einen idealen romantischen Roman finden sich auch im Roman Lucinde, der von der Öffentlichkeit als skandalös empfunden wurde, da dessen Inhalt, das Liebesverhältnis zwischen Julius und Lucinde, facettenreich von Schlegel betrachtet wird, wobei eben die emanzipatorische und sinn-liche Facette dieses Liebesbundes die Gemüter zur Erregung gebracht haben dürfte.[6]
Schlegel kommt in der Einleitung seines Gesprächs über die Poesie rasch zu der Er-kenntnis: „[U]nd so läßt sich auch eigentlich nicht reden von der Poesie als nur in Poesie.“[7] Trotz dieses Schlegelschen Schlusses soll in dieser Arbeit der Versuch gewagt werden, Schlegels progressive Universalpoesie wissenschaftlich darzustellen. Bevor dies ge-schieht, wird im Folgenden auf das Ziel der Arbeit und die Vorgehensweise eingegangen.
1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
Die hauptsächliche Intention der Arbeit ist die detaillierte Darstellung von Schlegels Leitideen seiner progressiven Universalpoesie. Weiteres Ziel der Arbeit ist deren prak-tische Umsetzungen aufzuzeigen. Was in dieser Arbeit unter der praktischen Darstellung verstanden wird, soll im dritten Kapitel geklärt werden, welches vom Theorieteil in den Praxisteil überleitet.
Um diese Ziele zu erreichen, werden unter dem zweiten Gliederungspunkt die Grund-prinzipien von Schlegels progressiver Universalpoesie auf Grundlage der oben kurz thematisierten Texte aufgezeigt. Dieser erste theoretische Teil der Arbeit ist gleichzeitig Fundament für den vierten Gliederungspunkt, unter dem untersucht werden soll, inwiefern sich die im Theorieteil herausgearbeiteten Leitideen in der Lucinde finden. Diese Unter-suchung erfolgt aufgrund des Umfangs der Arbeit an exemplarischen Textstellen der Lucinde. In der Schlussbetrachtung werden die Prinzipien der progressiven Universal-poesie komprimiert dargestellt. Zum Zweck der Erfüllung des Konzeptes dieser Arbeit sowie um der wissenschaftlich geforderten Konsistenz gerecht zu werden, sind die Be-zeichnungen der unter dem zweiten und vierten Gliederungspunkt angesiedelten Aspekte nahezu identisch.
2 Darstellung der Theorie der progressiven Universalpoesie
2.1 Dynamik und Unendlichkeit
„Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie“.[8] Mit dieser Gleichsetzung eröffnet Schlegel das 116. Athenäum-Fragment, die Poesie in Schlegels Verständnis als eine Dichtkunst definiert, die dynamisch und allumfassend ist. Er möchte also seine Poesie als dynamische, keinesfalls als statische verstanden wissen. Seine Idee der dynamischen Poesie kommt in folgendem Zitat zum Ausdruck. „Die romantische Dichtart ist noch im Werden; ja, das ist ihr eigentliches Wesen, daß sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann.“[9] Wie bedeutend die Dynamik für Schlegels Universalpoesie ist, wird deutlich, wenn er dieser die permanente Entwicklung als eigentlichen Wesenszug zuschreibt. Der Gedanke der Unendlichkeit, die Universalpoesie kann nie abgeschlossen werden, ist ein weiteres Element in Schlegels Programm der Universalpoesie. Fast am Ende des 116. Athenäum-Fragments definiert er seine Poesie selbst als unendlich: „Sie allein ist unendlich […]“.[10]
2.1.1 Freie Reflexion
Den dynamischen und endlosen Charakter der progressiven Universalpoesie stellt Schlegel wohl sprachlich am eindringlichsten in seiner berühmten Metapher „[Flügel] der poetischen Reflexion“ dar, die im Kontext des folgenden Zitates näher analysiert werden soll.
„Und doch kann auch [die romantische Poesie] am meisten zwischen dem Dar-gestellten und dem Darstellenden, frei von allem realen und idealen Interesse, auf den Flügeln der poetischen Reflexion in der Mitte schweben, diese Reflexion immer wieder potenzieren und wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen.“[11]
Schlegel spricht zunächst seiner Universalpoesie die Fähigkeit zu, „zwischen dem Darge-stellten und dem Darstellenden“ zu vermitteln. Schlegel könnte mit dem „Dargestellten“ das bezeichnen, was das Kunstwerk aus der Realität abbildet und mit dem „Darstellenden“ das Kunstwerk. Um Schlegels Termini besser zu verstehen, soll hier auf die Inter-pretation Huges zurückgegriffen werden. Er bestimmt das Kunstwerk unter Berück-sichtigung der Aspekte von Endlichkeit und Unendlichkeit als ein Werk, das „zwischen der Endlichkeit seines >gebildeten< Umrisses und der Unendlichkeit der >Bildung< des Universums, die es nachbildet“, steht.[12] Demnach soll unter dem „Dargestellten“ das, was das Kunstwerk nachbildet und unter dem „Darstellenden“, das (endlich begrenzte) Kunst-werk selbst verstanden werden. Auf einen wichtigen Aspekt deutet Huge in diesem Zu-sammenhang hin, nämlich die Tatsache, dass die poetische Reflexion die Beziehung von Subjekt und Objekt herstellt.[13] Huge klärt nicht eindeutig, was unter Subjekt und Objekt zu verstehen ist, angenommen werden kann, aufgrund seiner vorherigen Ausführungen, dass er damit auf das „Dargestellt[e]“ sowie auf das „Darstellend[e]“ verweist.[14] Dieser Aspekt soll jedoch unter dem Gliederungspunkt 2.2.4 betrachtet werden, da Engel den philosophischen Hintergrund zum Verständnis der Beziehung von Subjekt und Objekt liefert. Des Weiteren bezeichnet Huge das Kunstwerk als Fragment.[15] Dies erscheint plausibel, da das Kunstwerk immer nur einen Ausschnitt des Universums abbilden kann.
Wie die Vermittlung aussieht, wird klar, wenn man Schlegels metaphorisches Bild näher betrachtet. Dadurch, dass er die romantische Poesie auf Flügel positioniert, unterstreicht er hier bildlich, was er sprachlich vorlagert, nämlich das absolut freie, von Bedingungen losgelöste Reflektieren, oder wie Schlegel es nennt, „frei von allem realen und idealen Interesse“. Flügel haben in technischer und natürlicher Hinsicht die Fähigkeit etwas durch den Luftraum zu befördern, in natürlicher Hinsicht geschieht dies oftmals durch eine hohe Bewegungsfrequenz. Wenn nun Schlegel die Flügel näher als „[Flügel] der poetischen Reflexion“ definiert, auf denen die Universalpoesie zwischen „Dargestellte[m]“ und „Darstellenden“ mittig „[schwebt]“, ist es die natürliche Bewegungsfrequenz der Flügel, die sich Schlegel für die Reflexion wünscht. Der Aspekt der Dynamik zeichnet sich ab. Das Verb „schweben“ spezifiziert, wie die Flügel, die Reflexion als unbeschwert und unabhängig. Die Bestimmung „in der Mitte“ deutet auf eine Reflexion hin, die nicht einseitig sein soll, sondern unparteiisch. Die Dynamik der Reflexion, die zuvor bildlich durch den Flügelschlag angedeutet wurde, verstärkt Schlegel nun, indem er sich eines mathematischen Vokabulars, nämlich „potenzieren“ sowie „in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen“, bedient.
Zusätzlich zur Dynamik erwähnt Schlegel die Unendlichkeit, die ebenso das Reflektieren im Sinne seiner Universalpoesie definiert wie die Dynamik. Barth betont den unendlichen Charakter der Reflexion, denn ihm zufolge reflektiert die poetische Reflexion das Reflektierte immer weiter. Wie Schlegel formuliert er dieses Phänomen mathematisch, indem die poetische Reflexion „das Reflektierte – abermals reflektiert – in das unendliche Potenzierungsverhältnis reflektierender Spiegelbilder multipliziert.“[16] Unter der „Reihe von Spiegeln“ ist demnach keine große Anzahl von Spiegeln zu verstehen, sondern eine Vielzahl von Spiegelbildern, die sich gegenseitig reflektieren.[17] Dass die Unendlichkeit aus der dynamischen Reflexion resultiert, zeigt Barth, indem er „dem Spiegel poetischer Reflexion“ den Spiegel der Ironie gegenüberstellt, sodass „die Spiegelungen sich unend-lich aneinander brechen, zur Spiegelung des bereits Widergespiegelten werden und so ad infinitum.“[18]
2.1.2 Ironie
Im Folgenden wird auf die Ironie eingegangen, die in Schlegels Texten, wenn auch in den vorliegenden Primärtexten nur indirekt feststellbar, eine bedeutende Rolle einnimmt. Sowohl Barth als auch Huge verstehen unter Ironie bei Schlegel die Synthesenbildung, wie im Folgenden ersichtlich wird. Hinter poetischer Reflexion verbirgt sich Huge zufolge die intellektuelle Leistung in der Dichtkunst, die bei Schlegel mit Ironie bezeichnet werden kann.[19] So ist es nach Huge die poetische Reflexion des Kunstwerks, die zur „postulierte[n] Selbstthematisierung“ der Dichtkunst führt, welche Schlegel von seiner Transzendentalpoesie fordert.[20] Zum Zweck der Vollständigkeit sei an dieser Stelle Uerlings zitiert, der die Transzendentalpoesie mit der romantischen Poesie identifiziert, „insofern sie auf die eigene Hervorbringung reflektiert“, inhaltlich definiert er die trans-zendente Poesie als „Produkt und Produzierendes, Subjekt und Objekt in einem.“[21] So liegt Uerlings zufolge in dem „Romantischen“ bei Schlegel die Ironie, die aus der oben angedeuteten „durchgebildete[n] Selbstreflexivität“ resultiert.[22] Barth ist es, der in diesem Zusammenhang von „Selbstschöpfung und Selbstvernichtung“ spricht, also vom Span-nungsfeld, welches die Synthesis, in einem dynamischen Prozess, lösen muss.[23] Frank bezeichnet diesen prozesshaften Gegensatz als „Modell der Schlegelschen Ironie“ und erläutert diesen, indem er ihn als ein „unendlich negative[s] Sich-hinweg-setzen über alle selbstgesetzten Schranken“ definiert.[24]
Strohschneider-Kohrs definiert Ironie folgendermaßen: „Ironie ist Mittel der Selbst-repräsentation von Kunst.“[25] Hier ist es wieder der Gedanke der Dynamik der aufgegriffen wird, in Form des „Repräsentierens“, der das Kunstwerk nie ganz abschließen lässt. Wäh-rend bei Barth und Huge die Ironie mit Synthesis übersetzt wurde, wird sie bei Strohschneider-Kohrs als ein Mittel bezeichnet. Zum einen als ein Mittel, welches in der Kunst die Beziehung zum Unendlichen herstellt und zum anderen als ein Mittel, das die Kunst in rein ästhetischem Sinne als ein Eigenständiges darstellt.[26] Werden obige Ansichten und Ergebnisse von Barth, Huge, Strohschneider-Kohrs und Frank zusammengefasst, kann die Ironie als Mittler bezeichnet werden, der im Prozess der Selbstschöpfung und -vernichtung das Kunstwerk im darstellenden und dargestellten Sinne zur Synthese bringt. Die Ironie wird somit als Teil oder Vermittlungskomponente der poetischen Reflexion bezeichnet, die zwischen „dem Dargestellten und dem Darstellen-den“ völlig unabhängig, wie es aus der eigenen Analyse hervorging, vermittelt oder wie es Huge und Barth bezeichnen, synthetisiert.
Bisher wurde die Dynamik hauptsächlich unter dem Inhaltsaspekt betrachtet, im folgenden Gliederungspunkt soll diese ausschließlich unter dem sprachlichen Aspekt untersucht werden. In Schlegels Texten finden sich nämlich einige Metaphern, die den progressiven Charakter der Universalpoesie unterstreichen.
2.1.3 Schlegels dynamische Metaphern
Anhand der Metapher „[Flügel] der poetischen Reflexion“ wurde die Dynamik bereits sprachlich untersucht. An dieser Stelle werden Metaphern, die auch den Gedanken des Fließenden, des ständigen Weiterentwickelns beinhalten, hinsichtlich ihres progressiven Charakters kurz erläutert. Ausführlich werden die Metaphern in ihrem eigentlichen Kontext betrachtet.
Die Metapher „Ströme der Poesie“ beinhaltet den Gedanken der Dynamik.[27] Das Fließen-de, das charakteristisch für Ströme ist, schreibt Schlegel seiner Poesie zu. Die Metapher „Spiel der Mitteilung“ lässt sich auch unter den Gedanken der Dynamik fassen, dabei kann hier die Dynamik im Gegensatz zu der vorherig eindimensionalen Dynamik als zwei- oder auch mehrdimensional verstanden werden, da sie sich durch Interaktion auszeichnet.[28] Dabei beinhalten die Metaphern eine flexible Dynamik. So kann der (Fluss-) Strom mal schneller mal langsamer fließen. Das „Spiel der Mitteilung“ wird durch eine größere Anzahl an beteiligten Personen dynamischer.
An dieser Stelle sei erwähnt, wenn Schlegel sich der Bildersprache bedient, um seine Universalpoesie darzustellen, so definiert er nicht nur inhaltlich seine progressive Univer-salpoesie, sondern setzt diese parallel um. So sind Schlegels Metaphern inhaltlich nicht eindeutig und vollständig zu fassen, aufgrund ihrer Mehrdeutigkeit, die zu einem weit gefassten Deutungsspielraum führen. Gerade das, was er stilistisch durch die Metaphern darstellt, räumt er inhaltlich seiner progressiven Universalpoesie ein, nämlich einen unend-lich weiten Daseinsspielraum.
2.2 Universalität
Schlegel bestimmt seine Poesie als Universalpoesie. So vermag die Poesie alles zu um-fassen, indem sie das zusammenführt, was getrennt ist und auf den ersten Blick, aufgrund der Gegensätzlichkeit, nicht zusammengehört. Oder wie Immerwahr es formuliert, strebt sie „nach einer Synthese aller Formen und Stilarten“.[29] Die Universalpoesie beabsichtigt jedoch noch weitaus mehr zu vereinigen als „Formen und Stilarten“, wie im Folgenden klar wird:
„Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen […].“[30]
In diesem Zitat finden sich verschiedene Prinzipien, die alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich die Erzeugung der Ganzheit, um der Idee der Universalität gerecht zu werden. Huge erklärt, warum überhaupt die Absicht alles zu vereinen, entstanden ist. Er sieht den Grund in der modernen zerrissenen Welt, die durch in allen Bereichen auftretende Wider-sprüchlichkeiten, wie zum Beispiel in Natur und Idee oder Religion und Erkenntnis, nicht mehr akzeptabel war.[31] Im Folgenden werden die einzelnen Prinzipien zur Generierung der Universalität aufgezeigt.
2.2.1 Zusammenführung der Gattungen
Schlegel fordert zuerst in der Dichtkunst selbst die Einheit, indem er Lyrik, Drama und Epik nicht separiert wissen möchte. Die hohe Bedeutung der Zusammenführung der Gattungen kommt insofern zum Ausdruck, als Schlegel auch im Brief über den Roman diesen Gedanken der Einheit aufgreift, wenn er den idealen romantischen Roman be-stimmt: „Ja ich kann mir einen Roman kaum anders denken, als gemischt aus Erzählung, Gesang und andern Formen.“[32] Mit der Zusammenführung der verschiedenen „Gattungen“ und Formen legt Schlegel zugleich ein poetisches universales Fundament fest, das die Vielfalt in der Dichtung zunächst vereinheitlicht. Die Einheit der Dichtungsformen kann als ideale Grundlage für alle weiteren zu vereinenden Dinge angesehen werden, denn schließlich ist es konsequent und adäquat, wenn eine universelle Poesie die Universalität thematisiert und durch die Thematisierung erzeugt.
Nach der Einheit in der Dichtung zieht die Universalität immer weitere Kreise, denn als nächstes möchte Schlegel die Poesie mit ihren benachbarten Disziplinen, „Philosophie und Rhetorik“, verbinden und zuletzt schließlich das Leben selbst und die Poesie vereinen.
2.2.2 Vereinigung von Gegensätzen
Die Gegensätze, „Poesie und Prosa“, „Genialität und Kritik“ sowie „Kunstpoesie und Naturpoesie“ möchte Schlegel in einem Prozess zur Vereinigung bringen, denn erst möchte er diese mischen, dann verschmelzen, also nicht abrupt zusammenfügen. Im Fol-genden werden die Gegensatzpaare, die Schlegel zur Vereinigung bringen möchte, detail-liert betrachtet, wobei Poesie und Prosa nicht berücksichtigt werden.
2.2.2.1 Genialität und Kritik
Mit „Genialität und Kritik“ könnte Schlegel auf zwei Epochen, die in ihrer Art absolut gegensätzlich sind, verweisen sowie diese zur Synthese bringen wollen. Während Genialität die Epoche des Sturm und Drang repräsentiert, steht stellvertretend für die Aufklärung die Kritik. Das Individuelle sowie das Naturhafte sind im Sturm und Drang besonders bedeutend.[33] Das Genie stellt nämlich die höchste Steigerung des Individuellen sowie des Naturhaften dar, denn der geniale Künstler trägt alle Regeln in sich, außerdem besitzt er eine eigene in ihm wohnende schöpferische Kraft. Shakespeare kann dabei als Prototyp des Genies betrachtet werden.[34]
Konträr zu dem Naturhaften, der nicht genau bestimmbaren im Menschen wohnenden Kraft, steht das Rationale, das charakteristisch für die Aufklärung ist. In der Epoche der Aufklärung soll die Wirklichkeit durch Einsatz des Verstandes erfasst werden, generell ist der Appell zum kritischen Gebrauch der Vernunft allgegenwärtig.[35]
2.2.2.2 Kunst- und Naturpoesie
Mit Kunst- und Naturpoesie spricht Schlegel zwei gegensätzliche Begriffe an, die in seiner Universalpoesie eine bedeutende Rolle spielen und unter Gliederungspunkt 2.4 detailliert untersucht werden. An dieser Stelle sei gesagt, wenn Schlegel im 116. Athenäum-Fragment die Skala aufzeigt, „[Die progressive Universalpoesie] umfaßt alles, was nur poetisch ist, vom größten, wieder mehrere Systeme in sich enthaltenden Systeme der Kunst, bis zu dem Seufzer, dem Kuß, den das dichtende Kind aushaucht in kunstlosen Gesang.“, er zugleich die Natur- und Kunstpoesie, die von der Universalpoesie umfasst wird, definiert.[36] Der vom Kind ausgehauchte Kuss kann nämlich der Naturpoesie zugeordnet werden, da ein Kuss als etwas Natürliches, Emotionales, nicht Intentionales bezeichnet werden kann. Mit den Systemen der Kunst verweist Schlegel sicherlich auf die Kunstpoesie, die zunächst als intentional charakterisiert werden soll. Dabei ist für Schlegel sowohl die Naturpoesie als auch die Kunstpoesie poetisch.
2.2.3 Wechselseitiges Durchdringen
Schlegels Idee der Universalität, bisher Separiertes zu verbinden und vereinen, kommt insbesondere durch das gegenseitige Durchdringen der Poesie und des Lebens zum Aus-druck: „Die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen.“ Schlegel schreibt der Poesie Eigenschaften des Lebens zu, und dem Leben Eigenschaften der Poesie, er sieht die Poesie nicht nur als Äquivalent zum Leben, sondern sogar als Einheit mit dem Leben.
Im Gespräch über die Poesie findet sich ebenso das Prinzip der wechselseitigen Durch-dringung, aber in weniger offensichtlicher Form, denn Schlegel schreibt: „Die Liebe bedarf der Gegenliebe.“[37] Der Kontext des Zitates handelt von der Kommunikation der Dichter untereinander. Folglich ist alles Leben so ausgelegt, falls es nicht für sich allein existent sein möchte, sondern nach der Universalität strebt, dass es, wie die Liebe und die Kommunikation, einer Erwiderung bedürfen.
2.2.4 Pars pro toto und Subjekt-Objekt-Synthese
Der universale Charakter der Universalpoesie kommt auch durch folgendes Zitat zum Ausdruck:
„Sie ist der höchsten und der allseitigsten Bildung fähig; nicht bloß von innen heraus, sondern auch von außen hinein; indem sie jedem, was ein Ganzes in ihren Produkten sein soll, alle Teile ähnlich organisiert, wodurch ihr die Aussicht auf eine grenzenlos wachsende Klassizität eröffnet wird.“[38]
Nach Engel stellt Schlegel hiermit sein Grundprinzip der organischen Form am klarsten dar. Er begründet dies durch einen philosophischen Exkurs, der besagt, dass:
„im Nach-Fichteschen Idealismus der Organismus mit seiner – subjektanalogen – Doppelfigur von Ergreifen des äußeren Weltstoffs und seiner Bildung nach inneren (>subjektiven<) Bauprinzipien ein Beweis für die Verwandtschaft von Subjekt und Objekt und ihre gemeinsame Fundierung in einem Absoluten [ist].“[39]
Dies wird dann von der Frühromantik in Verbindung mit dem Strukturgesetz des Organis-mus gebracht, welches jedem Teil das Prinzip des Ganzen zuspricht. Auf dieser Basis fährt nun Engel fort und erklärt, was hinter der Ähnlichkeit der Organisation steht. Die Teile eines Kunstwerkes müssen zum einen einheitsbildend und zum anderen zu den gemein-samen Strukturen von „Subjekt und Objekt“ kongruent sein.[40]
Schlegels Grundprinzip der organischen Form, die Synthese von „Subjekt und Objekt“, könnte praktisch folgendermaßen aussehen. Das Subjekt, die Kunst beispielsweise der Roman, ergreift das Objekt, den „äußeren Weltstoff“, indem es diesen schriftlich themati-siert, ihn also verwandelt, auch idealisiert und ihn erst durch seine künstlerische Darstellung zur Geltung bringt. Das Subjekt kann demnach als aktive Partei bezeichnet werden, da sie das Objekt aufgreift und verwandelt, welches somit die passive Partei dar-stellt. Grundsätzlich ist das Verhältnis von „Subjekt und Objekt“ relational, sodass das Subjekt zum Objekt werden kann, es ist also ein dynamisches Verhältnis.
Festgehalten werden kann, dass die romantische Poesie dann der „höchsten und der allseitigsten Bildung“ fähig ist, wenn einerseits diese Subjekt-Objekt-Synthese in Ver-bindung mit dem Strukturgesetz, pars pro toto, gebracht wird und andererseits noch eine zweite Bedingung erfüllt ist, die im folgenden Gliederungspunkts aufgezeigt werden soll.
2.2.5 Dialektik
Das „von innen heraus“ und „von außen hinein“ definiert Engel sicherlich näher, wenn er in diesem Zusammenhang von Schlegels Rezension der Wilhelm Meisters Lehrjahre spricht und die Einheit dort im Geist des Werkes begründet sieht.[41] Er spricht von einem „Dichtergeist“, der sich hinter Schlegels Terminus „von innen heraus“ verbergen könnte, und von der „produktive[n] Aufnahme durch den Leser“, den das „von außen hinein“ Kommende bezeichnen könnte.[42] Das „von außen hinein“ Kommende kann jedoch nicht nur den Rezipienten bezeichnen, sondern ebenso die Ideen, die der Dichter durch den Austausch mit anderen Dichtern entwickelt, denn wie sich im folgenden Gliederungspunkt herausstellen wird, ist der Austausch unter den Dichtern nicht unbedeutend für Schlegels Universalpoesie. Dabei betont Engel, dass diese Dialektik sowohl in der Werkstruktur, der Produktion als auch in der Rezeption existiert.[43] Nicht ganz klar wird bei Engel, ob die Teile in dem Sinne ähnlich organisiert sind, weil sie vom Dichter inhaltlich so angelegt werden, oder es der Leser ist, der die Teile des dichterischen Werks durch seine Rezeption zu einer Einheit macht. In seinen weiteren Ausführungen scheint es, also ob beide sowohl der Dichter als auch der Leser für die Einheit verantwortlich sind, aber noch mehr der Leser als der Dichter, denn im Fußnotenapparat verweist er darauf, dass in „Schlegels Rezension der Leser im Mittelpunkt steht“.[44] Schlegel schreibt im Brief über den Roman: „[…] welche Selbstgeschichte wäre nicht für den, der sie in einem romantischen Sinne liest, ein besserer Roman als der beste von jenen?“[45] Aus diesem Zitat soll lediglich die Erkenntnis gezogen werden, dass Schlegel durchaus einen aktiven Leser fordert, der den Roman inhaltlich vollendet.
Die zweite Bedingung ist nun erarbeitet. Es bedarf einer funktionierenden Dialektik, die sich nicht nur auf Dichter und Rezipient bezieht, sondern auf jeglichen Kontakt zwischen Poet und Außenwelt, also auch auf den Kontakt der Künstler untereinander. Schlegel sieht den Dichter keinesfalls von der Außenwelt und anderen Dichtern isoliert, denn er schreibt seiner Universalpoesie die Fähigkeit zu, auch unter den Künstlern eine Einheit zu erzeugen. „Alle Gemüter, die sie lieben, befreundet und bindet Poesie mit unauflöslichen Banden.“[46] Die Rolle des Dichters in Schlegels Universalpoesie ist jedoch subtil gestaltet und soll im nächsten Gliederungspunkt aufgedeckt werden.
2.3 Der Künstler im Spannungsfeld zwischen Individualität und Sozialität
Grundsätzlich befindet sich der Dichter bei Schlegel in einem Spannungsfeld zwischen der Konzentration auf seine eigene Poesie und dem Austausch mit anderen Künstlern, wobei der Gedanke der Meinungsvielfalt unter den Künstlern dominiert. Folgendes Zitat verdeutlicht diese Tatsache. „Jede Muse sucht und findet die andre, und alle Ströme der Poesie fließen zusammen in das allgemeine große Meer.“[47] Die Metapher „Ströme der Poesie“ veranschaulicht bildlich die individuellen Dichter, die Übersetzung im Fußnoten-apparat für die Metapher „ewigen Fantasie“ bestätigt diese Auffassung. Das „allgemeine große Meer“ steht für Weite, Tiefgründigkeit und Unergründlichkeit, sodass das Meer die Gemeinschaft der Dichter bildlich darstellt. Die Eigenschaften des Meeres deuten darauf hin, dass der „Dichterpool“ die Vielfalt in der Einheit darstellt, da er aus vielen Individuen besteht.
2.3.1 Individualität des Dichters
In seinen Schriften über die Universalpoesie zeichnet Schlegel das Idealbild eines Dichters, insbesondere betont er die Individualität desselben, die er als wichtiges Element der Universalpoesie ansieht. Im 116. Athenäums-Fragment ist ein erster Hinweis auf die Individualität des Dichters zu finden, den Schlegel als Gesetz formuliert. „[…] und das als ihr erstes Gesetz anerkennt, daß die Willkür des Dichters kein Gesetz über sich leide.“[48] Das erste Gesetz der Universalpoesie ist demnach die „Willkür des Dichters“. Das von Schlegel metaphorisch gestaltete Gesetz räumt dem Dichter sogar mehr als Individualität ein, denn Willkür bedeutet seinen eigenen Interessen zu folgen, ohne jegliche Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen. Man könnte auch sagen, er fordert für die Universalpoesie Dichter, die sich ihren Launen hingeben.
Im Gespräch über die Poesie betont Schlegel, dass die Poesie in jedem Menschen indivi-duell verankert ist. Dies veranschaulicht er in folgendem Vergleich: „Die Vernunft ist nur eine und in allen dieselbe: wie aber jeder Mensch seine eigne Natur hat und seine eigne Liebe, so trägt auch jeder seine eigne Poesie in sich.“[49] Die menschliche Natur und die Po-esie des Menschen sind hier äquivalent. Diese Äquivalenz wird im folgenden Gliede-rungspunkt detailliert betrachtet. Die Wichtigkeit dieser „eigne[n] Poesie“ bringt er durch die anschließenden Wiederholungsfiguren „muß ihm bleiben und soll ihm bleiben“ zum Ausdruck.[50] Er erachtet die individuelle Poesie als ein Muss für den Dichter, damit dieser nicht zu einem „allgemeinen Bilde ohne Geist und ohne Sinn“ wird.[51] Für Schlegel ist also alles Allgemeine tot, da es weder von Sinn noch von Geist erfüllt ist. An anderer Stelle im Gespräch über die Poesie spricht er selbst von der „tötende[n] Verallgemeine-rung“.[52] Damit der Mensch sich seine individuelle Poesie oder sein „eigenstes Wesen“ wahren kann, muss er Schlegel zufolge kritikresistent sein.[53] Die Individualität des Dich-ters ist für ihn von großer Bedeutung, dies zeigt sich zum einen darin, dass er die „Willkür des Dichters“ als erstes Gesetz für die Universalpoesie bestimmt, und zum anderen, indem er Kritikresistenz vom Künstler fordert, um dessen individuelle Poesie zu schützen.
2.3.2 Sozialität des Dichters
Die Individualität des Dichters erfährt bei Schlegel jedoch eine Modifikation. Während in obigen Darstellungen ausdrücklich die Wahrung seiner Individualität gefordert wurde, fordert Schlegel nun vom Dichter die Offenheit gegenüber der „hohe[n] Wissenschaft echter Kritik“.[54] Diese soll insbesondere „ihn lehren, auch jede andre selbständige Gestalt der Poesie in ihrer klassischen Kraft und Fülle zu fassen, daß die Blüte und der Kern fremder Geister Nahrung und Same werde für seine eigne Fantasie“.[55] Schlegel erklärt die Offenheit der Dichter gegenüber anderen Dichtern für notwendig, da der Dichter durch die äußeren Impulse Inspirationen für das eigene Dichten erhält. Er bedient sich einer biologisch-schöpferischen Sprache, sicherlich um den Prozess der Dichtung mit dem Prozess des Wachstums der Natur analog erscheinen zu lassen.
[...]
[1] Vgl. Berbeli Wanning: Friedrich Schlegel zur Einführung, Hamburg 1999, S. 47.
[2] Vgl. Friedrich Schlegel: (116), in: Schriften und Fragmente, Ein Gesamtwerk seines Geistes, Aus den Werken und dem handschriftlichen Nachlaß zusammengestellt und eingeleitet von Ernst Behler, Stuttgart 1956, S. 93-94, hier S. 93.
[3] Franz Norbert Mennemeier: Friedrich Schlegels Poesiebegriff dargestellt anhand der Literaturkritischen Schriften. Die romantische Konzeption einer objektiven Poesie, München 1971, S. 313.
[4] Vgl. Mennemeier 1971, S. 313.
[5] Vgl. Manfred Engel: Der Roman der Goethezeit, Stuttgart 1993, S. 389.
[6] Vgl. Wanning 1999, S. 54-55.
[7] Friedrich Schlegel: Gespräch über die Poesie, in: Athenaeum. Eine Zeitschrift von August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel, Dritten Bandes Erstes Stück, Berlin 1800, S. 284-362, hier S. 285.
[8] Schlegel 1956, S. 93.
[9] Schlegel 1956, S. 94.
[10] Schlegel 1956, S. 94.
[11] Schlegel 1956, S. 93-94.
[12] Eberhard Huge: Poesie und Reflexion in der Ästhetik des frühen Friedrich Schlegel, Stuttgart 1971, S. 118.
[13] Vgl. Huge 1971, S. 119.
[14] Vgl. Huge 1971, S. 119.
[15] Vgl. Huge 1971, S. 118.
[16] Andreas Barth: Inverse Verkehrung der Reflexion. Ironische Textverfahren bei Friedrich Schlegel und Novalis, Heidelberg 2001, S. 148.
[17] Vgl. Barth 2001, S. 148.
[18] Barth 2001, S. 148.
[19] Vgl. Huge 1971, S. 118.
[20] Huge 1971, S. 119.
[21] Herbert Uerlings: Einleitung, in: Theorie der Romantik, hrsg. v. Herbert Uerlings, Stuttgart 2009, S. 9-42, hier S. 28.
[22] Uerlings 2009, S. 28.
[23] Barth 2001, S. 148.
[24] Manfred Frank: Allegorie, Witz, Fragment, Ironie. Friedrich Schlegel und die Idee des zerrissenen Selbst, in: Allegorie und Melancholie, hrsg. v. Willem van Reijen, Frankfurt am Main 1992, S. 124-143, hier S. 140.
[25] Ingrid Strohschneider-Kohrs: Die romantische Ironie in Theorie und Gestaltung, 3. Aufl., Tübingen 2002, S. 70.
[26] Vgl. Strohschneider-Kohrs 2002, S. 70.
[27] Schlegel 1800, S. 284.
[28] Schlegel 1800, S. 286.
[29] Raymond Immerwahr: Romantisch. Genese und Tradition einer Denkform, Frankfurt am Main 1972, S. 174.
[30] Schlegel 1956, S. 93.
[31] Vgl. Huge 1971, S. 1.
[32] Schlegel 1800, S. 336.
[33] Vgl. Gisela Henckmann: ,Sturm und Drang’, in: Metzler Lexikon Literatur. Begriffe und Definitionen, hrsg. v. Dieter Burdorf, Christoph Fasbender, Burkhard Moennighoff, 3., völlig neu bearbeitete Auflage, Stuttgart 2007, S. 740-742, hier, S. 741.
[34] Vgl. Henckmann 2007, S. 741.
[35] Vgl. Jutta Heinz: ,Aufklärung’, in: Metzler Lexikon Literatur. Begriffe und Definitionen, hrsg. v. Dieter Burdorf, Christoph Fasbender, Burkhard Moennighoff, 3., völlig neu bearbeitete Auflage, Stuttgart 2007, S. 53-55, hier S. 53.
[36] Schlegel 1956, S. 93.
[37] Schlegel 1800, S. 286.
[38] Schlegel 1956, S. 94.
[39] Engel 1993, S. 384.
[40] Vgl. Engel 1993, S. 385.
[41] Vgl. Engel 1993, S. 385.
[42] Engel 1993, S. 385.
[43] Vgl. Engel 1993, S. 385.
[44] Engel 1993, S. 385-386.
[45] Schlegel 1800, S. 338.
[46] Schlegel 1800, S. 284.
[47] Schlegel 1800, S. 284.
[48] Schlegel 1956, S. 94.
[49] Schlegel 1800, S. 284.
[50] Schlegel 1800, S. 284.
[51] Schlegel 1800, S. 284.
[52] Schlegel 1800, S. 286.
[53] Schlegel 1800, S. 284.
[54] Schlegel 1800, S. 284.
[55] Schlegel 1800, S. 284.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (eBook)
- 9783842828322
- DOI
- 10.3239/9783842828322
- Dateigröße
- 523 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Stuttgart – Philosophisch-historische Fakultät, Studiengang Literaturwissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2012 (Januar)
- Note
- 1,6
- Schlagworte
- universalpoesie universalität friedrich schlegel romantische roman naturpoesie
- Produktsicherheit
- Diplom.de