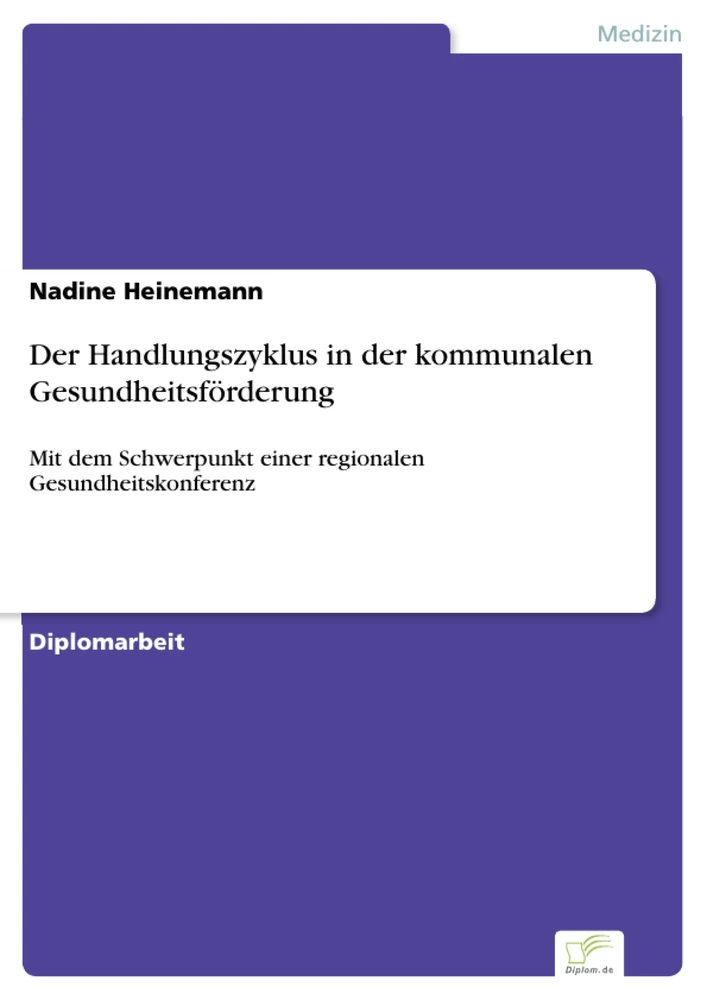Der Handlungszyklus in der kommunalen Gesundheitsförderung
Mit dem Schwerpunkt einer regionalen Gesundheitskonferenz
©2007
Diplomarbeit
74 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Gesundheitsförderung und Prävention fanden lange Zeit kaum Beachtung in der Gesundheitspolitik. Ein Fortschritt schien dann der Entwurf eines Präventionsgesetzes zu sein. Durch das Scheitern des Präventionsgesetzes, das diesen Umstand wesentlich verbessern sollte, gibt es bis heute keine gesetzliche Grundlage für die Arbeit in der Prävention und Gesundheitsförderung. Aber in Zeiten des demographischen Wandels und des Anstiegs an chronischen Erkrankungen werden Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung besonders benötigt. Dabei spielt die kommunale Gesundheitsförderung eine große Rolle. Die Anzahl an Gesundheitsförderungsmaßnahmen in der Kommune nimmt stetig zu. Denn inzwischen ist klar: Gesundheit wird dort geschaffen, wo Menschen leben, wohnen und arbeiten.
Das Thema der Arbeit ist ein sehr gegenwärtiges und diskussionswürdiges Thema. Jährlich findet in Berlin beispielsweise eine Landesgesundheitskonferenz statt und auch der Kongress Armut und Gesundheit gilt seit Jahren als fest etablierte Veranstaltung. Daher nimmt das Eventmanagement in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung zu, da die Menschen nicht mehr nur Informationsmaterialen lesen wollen. Sie möchten sich mit anderen fachlich versierten Leuten zu bestimmten Gesundheitsthemen beraten, austauschen, auf das gleiche Level bringen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Aber auch als Instrument zur Übermittlung von Informationen und als Sprachrohr für den an Gesundheit interessierten Menschen werden solche Konferenzen heute genutzt.
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich zunächst mit der Bearbeitung des Settings Kommune. Hier wird die Bedeutung der kommunalen Gesundheitsförderung dargestellt. Des Weiteren werden die Entwicklungen in der kommunalen Gesundheitsförderung, wie das Gesunde Städte Netzwerk, die Lokale Agenda 21, und andere Entwicklungsbeispiele näher erörtert. Auch die Bedeutung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes für die kommunale Gesundheitsförderung tritt in den Fokus der Bearbeitung.
Außerdem hat die Autorin das Modell eines idealtypischen Handlungszyklus` der kommunalen Gesundheitsförderung erarbeitet, wobei jede Phase des Zyklus im Einzelnen aufgezeigt und vertieft wird. Außerdem werden die spezifischen Instrumente jeder Projektphase dargestellt und zur Anwendung gebracht. Ferner finden die Prinzipien und Kriterien einer guten Praxis der Gesundheitsförderung Beachtung. Wichtig war der Autorin hierbei, dass der […]
Gesundheitsförderung und Prävention fanden lange Zeit kaum Beachtung in der Gesundheitspolitik. Ein Fortschritt schien dann der Entwurf eines Präventionsgesetzes zu sein. Durch das Scheitern des Präventionsgesetzes, das diesen Umstand wesentlich verbessern sollte, gibt es bis heute keine gesetzliche Grundlage für die Arbeit in der Prävention und Gesundheitsförderung. Aber in Zeiten des demographischen Wandels und des Anstiegs an chronischen Erkrankungen werden Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung besonders benötigt. Dabei spielt die kommunale Gesundheitsförderung eine große Rolle. Die Anzahl an Gesundheitsförderungsmaßnahmen in der Kommune nimmt stetig zu. Denn inzwischen ist klar: Gesundheit wird dort geschaffen, wo Menschen leben, wohnen und arbeiten.
Das Thema der Arbeit ist ein sehr gegenwärtiges und diskussionswürdiges Thema. Jährlich findet in Berlin beispielsweise eine Landesgesundheitskonferenz statt und auch der Kongress Armut und Gesundheit gilt seit Jahren als fest etablierte Veranstaltung. Daher nimmt das Eventmanagement in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung zu, da die Menschen nicht mehr nur Informationsmaterialen lesen wollen. Sie möchten sich mit anderen fachlich versierten Leuten zu bestimmten Gesundheitsthemen beraten, austauschen, auf das gleiche Level bringen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Aber auch als Instrument zur Übermittlung von Informationen und als Sprachrohr für den an Gesundheit interessierten Menschen werden solche Konferenzen heute genutzt.
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich zunächst mit der Bearbeitung des Settings Kommune. Hier wird die Bedeutung der kommunalen Gesundheitsförderung dargestellt. Des Weiteren werden die Entwicklungen in der kommunalen Gesundheitsförderung, wie das Gesunde Städte Netzwerk, die Lokale Agenda 21, und andere Entwicklungsbeispiele näher erörtert. Auch die Bedeutung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes für die kommunale Gesundheitsförderung tritt in den Fokus der Bearbeitung.
Außerdem hat die Autorin das Modell eines idealtypischen Handlungszyklus` der kommunalen Gesundheitsförderung erarbeitet, wobei jede Phase des Zyklus im Einzelnen aufgezeigt und vertieft wird. Außerdem werden die spezifischen Instrumente jeder Projektphase dargestellt und zur Anwendung gebracht. Ferner finden die Prinzipien und Kriterien einer guten Praxis der Gesundheitsförderung Beachtung. Wichtig war der Autorin hierbei, dass der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Nadine Heinemann
Der Handlungszyklus in der kommunalen Gesundheitsförderung
Mit dem Schwerpunkt einer regionalen Gesundheitskonferenz
ISBN: 978-3-8366-0982-1
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Zugl. Fachhochschule Magdeburg, Magdeburg, Deutschland, Diplomarbeit, 2007
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
1.
Einleitung
1
2.
Die gesundheitsfördernde Kommune
4
2.1 Die Bedeutung des Settings in der Gesundheitsförderung
4
2.2 Die Entwicklungen in der gesundheitsfördernden Kommune
6
2.2.1 Das Gesunde Städte Netzwerk
6
2.2.2
Die
Lokale
Agenda
21
6
2.2.3
Die
Soziale
Stadt
7
2.2.4 Weitere Entwicklungsbeispiele in der
gesundheitsfördernden Kommune
7
2.3 Die Rolle des Öffentlichen Gesundheitsdienstes
9
2.4 Zwischenresümee
11
3.
Das Modell des Handlungszyklus in der kommunalen
Gesundheitsförderung
12
3.1
Allgemeine
Bemerkungen
12
3.2
Die
Vorlaufphase
14
3.3
Die
Analysephase
21
3.4
Die
Planungsphase
26
3.5
Die
Umsetzungsphase
33
3.6
Die
Evaluationsphase
34
3.7
Zwischenresümee
37
4. Praxisgegenstand: Die Lichtenberger Gesundheitskonferenz
39
4.1 Das Instrument und seine Bedeutung für die
gesundheitsfördernde
Kommune
39
4.2
Das Konferenzthema und deren Ergebnisse
42
4.2.1 Allgemeine Information zur ambulanten
ärztlichen Versorgung
43
4.2.2
Zahlen
und
Fakten
44
4.2.3 Gründe für die Ärzteabwanderungen aus den Ostbezirken 53
4.2.4 Stellungsnahmen der Fachbereiche des Amtes für
Gesundheit und Verbraucherschutz
54
4.2.5 Ergebnisse der Lichtenberger
Gesundheitskonferenz 2006
55
4.2.6 Empfehlungen der Lichtenberger
Gesundheitskonferenz 2006
56
4.3 Die schriftliche Befragung als Untersuchungsmethode zur
Evaluierung
56
4.3.1
Vorbereitung
56
4.3.2
Durchführung
57
4.3.3 Ergebnisse und Auswertung
58
4.4 Kompetenzkatalog für die Praxis
71
4.5
Zwischenresümee
73
5.
Reflexion
der
Ergebnisse
74
6.
Schlussfolgerungen
und
Ausblicke
75
Abbildungsverzeichnis
Abbildung
Bezeichnung
Seite
Abb. 1
Niedergelassene tätige Ärzte und Zahnärzte im Bezirk
Lichtenberg
2001-
2005
44
Abb. 2
Niedergelassene tätige Ärzte und Zahnärzte in Berlin
2001-
2005
45
Abb. 3
Ärztlicher Versorgungsgrad (Einwohner je niedergelassen
tätigen Arzt) in Berlin und den Bezirken 2005
50
Abb. 4
Zahnärztlicher Versorgungsgrad (Einwohner je niedergelassen
tätigen Zahnarzt) in Berlin und den Bezirken 2005
51
Abb.
5
Frage
1:
Bezirk
59
Abb.
6
Frage
2
60
Abb.
7
Frage
3
61
Abb.
8
Frage
4
62
Abb.
9
Frage
5
a)
63
Abb.
10
Frage
5
b)
64
Abb. 11
Frage 5 c)
65
Abb.
12
Frage
5
d)
66
Abb.
13
Frage
5
e)
66
Abb.
14
Frage
5
f)
67
Abb.
15 Frage
5
g)
67
Abb.
16 Frage
6
68
Abb.
17 Frage
6-
Zusatz
68
Abb.
18 Frage
7
b)
69
Abb. 19
Frage 8: Anregungen und Bemerkungen
70
Abkürzungsverzeichnis
ÖGD
Öffentlicher Gesundheitsdienst
SGB V
Gesetzliche Krankenversicherung
SGB VII
Gesetzliche
Unfallversicherung
Tabellenverzeichnis
Tabelle
Bezeichnung
Seite
Tab. 1
Niedergelassene tätige Ärzte
in
Berlin
am 31.12. 2001 2005 nach Bezirken
46
Tab. 2
Niedergelassene tätige Zahnärzte in Berlin
am 31.12. 2001 2005 nach Bezirken
47
Tab. 3
Einwohner je niedergelassen tätigen Arzt in Berlin
am 31.12. 2001 bis 2005 nach Bezirken
48
Tab. 4
Einwohner je niedergelassen tätigen Zahnarzt in Berlin
am 31.12. 20012005 nach Bezirken
49
1
,,Gesundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist alles nichts"
(Arthur Schopenhauer, 1788- 1860)
1.
Einleitung
Gesundheitsförderung und Prävention fanden lange Zeit kaum Beachtung in der
Gesundheitspolitik. Ein Fortschritt schien dann der Entwurf eines
Präventionsgesetzes zu sein. Durch das Scheitern des Präventionsgesetzes, das
diesen Umstand wesentlich verbessern sollte, gibt es bis heute keine gesetzliche
Grundlage für die Arbeit in der Prävention und Gesundheitsförderung. Aber in Zeiten
des demographischen Wandels und des Anstiegs an chronischen Erkrankungen
werden Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung besonders benötigt.
Dabei spielt die kommunale Gesundheitsförderung eine große Rolle. Die Anzahl an
Gesundheitsförderungsmaßnahmen in der Kommune nimmt stetig zu. Denn
inzwischen ist klar: Gesundheit wird dort geschaffen, wo Menschen leben, wohnen
und arbeiten.
Das Thema der Arbeit ist ein sehr gegenwärtiges und diskussionswürdiges Thema.
Jährlich findet in Berlin beispielsweise eine Landesgesundheitskonferenz statt und
auch der Kongress ,,Armut und Gesundheit" gilt seit Jahren als fest etablierte
Veranstaltung. Daher nimmt das Eventmanagement in der heutigen Zeit immer mehr
an Bedeutung zu, da die Menschen nicht mehr nur Informationsmaterialen lesen
wollen. Sie möchten sich mit anderen fachlich versierten Leuten zu bestimmten
Gesundheitsthemen beraten, austauschen, auf das gleiche Level bringen und
gemeinsam nach Lösungen suchen. Aber auch als Instrument zur Übermittlung von
Informationen und als Sprachrohr für den an Gesundheit interessierten Menschen
werden solche Konferenzen heute genutzt.
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich zunächst mit der
Bearbeitung des Settings ,,Kommune". Hier wird die Bedeutung der kommunalen
Gesundheitsförderung dargestellt. Des Weiteren werden die Entwicklungen in der
kommunalen Gesundheitsförderung, wie das Gesunde Städte Netzwerk, die Lokale
Agenda 21, und andere Entwicklungsbeispiele näher erörtert. Auch die Bedeutung
2
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes für die kommunale Gesundheitsförderung tritt
in den Fokus der Bearbeitung.
Außerdem hat die Autorin das Modell eines idealtypischen Handlungszyklus` der
kommunalen Gesundheitsförderung erarbeitet, wobei jede Phase des Zyklus im
Einzelnen aufgezeigt und vertieft wird. Außerdem werden die spezifischen
Instrumente jeder Projektphase dargestellt und zur Anwendung gebracht. Ferner
finden die Prinzipien und Kriterien einer guten Praxis der Gesundheitsförderung
Beachtung. Wichtig war der Autorin hierbei, dass der Handlungszyklus praxisnah
dargestellt wird und dementsprechend als Handlungsleitfaden für Projekte der
kommunalen Gesundheitsförderung dienen kann.
Schwerpunkt der Diplomarbeit ist die regionale Gesundheitskonferenz am Beispiel
der bezirklichen Gesundheitskonferenz in Berlin- Lichtenberg im Jahr 2006. Dabei
wird zunächst das Instrument der Gesundheitskonferenz erörtert und reflektiert. Im
Anschluss daran geht die Autorin näher auf das Thema der Lichtenberger
Gesundheitskonferenz näher ein, stellt erarbeitete Daten dar und interpretiert sie. Die
durchgeführte Evaluation zur Qualitätssicherung dieser Konferenz in Form eines
Fragebogens wird vorgestellt, die Ergebnisse ausgewertet und grafisch abgebildet.
Als Resultat entsteht daraus ein Kompetenzkatalog für die Praxis, für Personen, die
mit der Organisation und Durchführung von Gesundheitskonferenzen betraut
werden.
Zur Datenerhebung wurden in den Vorbereitungen auf die Gesundheitskonferenz
u. a. leitfadengestützte telefonische Interviews mit den Fachbereichen des
Gesundheitsamtes durchgeführt.
Diese wissenschaftliche Arbeit möchte Antworten auf folgende Fragen erhalten:
Welche Bedeutung haben Gesundheitskonferenzen für die kommunale
Gesundheitsförderung heute und perspektivisch?
Was bewirken Gesundheitskonferenzen in der kommunalen Gesundheitsförderung?
Welche Kompetenzen sollten Personen aufweisen, die mit der Organisation,
Durchführung und Nachbearbeitung von Gesundheitskonferenzen betraut werden?
3
Wie wird die Lichtenberger Gesundheitskonferenz von den Bürgern Berlin
Lichtenbergs angenommen? Wer nimmt an dieser Gesundheitskonferenz teil? Und
was bewirkt sie?
Die Rolle der Gesundheitspolitik in der Gemeinde ist kein Bestandteil dieser Arbeit.
Der Einfluss der Politik auf die kommunale Gesundheitsförderung ist sehr komplex,
hat viele Ursachen und Auswirkungen. Dies bedarf langfristiger Analysen. Aus
diesem Grund soll die Gesundheitspolitik in diesem Kontext keine Berücksichtigung
finden.
Vielmehr wird die zunehmende Bedeutung der kommunalen Gesundheitsförderung
anhand von Beispielen und wissenschaftlichen Analysen verdeutlicht. Zudem werden
Initiativen, die den Trend der kommunalen Gesundheitsförderung unterstützen,
vorgestellt und vertiefend analysiert. Der Öffentliche Gesundheitsdienst tritt ebenso
in den Blickpunkt der Betrachtungen wie die intersektorale Zusammenarbeit in der
kommunalen Gesundheitsförderung.
2.
Die gesundheitsfördernde Kommune
2.1 Die Bedeutung des Settings in der Gesundheitsförderung
Dem Thema kommunale Gesundheitsförderung kommt eine immer größere
Bedeutung zu, da die Lebensverhältnisse in der Kommune auf die Gesundheit der
dort lebenden Bürgerinnen und Bürger Auswirkungen hat (vgl. Arbeitsgemeinschaft
der Spitzenverbände der Krankenkassen 2006).
Kommunale Gesundheitsförderung stellt ein wichtiges Setting
1
im Rahmen des
Gesamtkonzepts der Gesundheitsförderung dar. Sie bezieht sich auf gesundheitliche
Probleme, die auf der Grundlage von kommunaler Gesundheitsberichterstattung
ermittelt werden (vgl. Abel 1998).
1
Als Setting wird ein Ort oder Kontext bezeichnet, in dem Menschen die Umwelt aktiv nutzen und
gestalten und auf diese Weise gesundheitsbezogene Probleme verursachen oder
Lösungsmöglichkeiten dafür finden (vgl. Weltgesundheitsorganisation 1998)
4
Damit die Menschen gesund wohnen, arbeiten und leben können, haben die
Kommunen entsprechende Voraussetzungen zu schaffen (vgl. Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung 2003).
Laut Grundgesetz Art. 28 (2) [,,Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein,
alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener
Verantwortung zu regeln."] (GG Art. 28 Abs. 2) gehört auch Gesundheit zu diesen
Angelegenheiten (vgl. Stender 2003). Dies ist aber keine primär verpflichtende,
sondern nur eine subsidiäre Gewährleistungspflicht (vgl. Zenker 2006).
Städte können einen wesentlichen Anteil zu gesundheitsfördernden Lebenswelten
leisten, denn für einen Großteil der Bevölkerung stellen sie den zentralen
Lebensraum dar. Auf diese Weise können Kommunen als Akteure der
Gesundheitsförderung verstanden werden. Vor dem Hintergrund der
Landesgesundheitsgesetze übernehmen sie Aufgaben für die Förderung und
Erhaltung der Gesundheit in der Bevölkerung. Diese Aufgaben werden dann von
verschiedenen Gesundheitseinrichtungen, u. a. auch vom Gesundheitsamt,
ausgeführt (vgl. Stender 2003).
In seinem Anfang 2001 veröffentlichten Gutachten ,,Bedarfsgerechtigkeit und
Wirtschaftlichkeit" drängt der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im
Gesundheitswesen auf eine intersektorale präventive Gesundheitspolitik, die über
das Gesundheitswesen hinaus auf Bildungs-, Arbeits-, Verkehrs-, Stadtentwicklungs-
und Umweltpolitik einwirkt (vgl.
Sachverständigenrat zur Begutachtung der
Entwicklung im Gesundheitswesen 2001), denn der Gesundheitszustand in der
Bevölkerung ist auch wesentlich von Planungen und Entscheidungen in allen
Bereichen der Politik abhängig (vgl. Stender 2003).
Auch die Weltgesundheitsorganisation weist seit Mitte der 80er Jahre immer wieder
darauf hin, dass Gesundheit als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe anzusehen ist
(vgl. Stender 2003).
In den Städten und Kommunen werden die Folgeerscheinungen, des
gesellschaftlichen Wandels durch fehlerhafte Entwicklungen im Bereich der
Ökonomie und des Nichtvorhandenseins einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik
5
besonders spürbar (vgl. Arbeitsgruppe Gesundheitsfördernde Stadt- und
Gemeindeentwicklung 2003).
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung verstärken sich seit Mitte der achtziger Jahre
auf der kommunalen Ebene. Die Kommune, in der die Menschen leben [,,schreibt die
Rahmenbedingungen für die Maßnahmen vor und ist gleichzeitig das Ziel der
Veränderungen"] (Abel 1998, S. 471). Die Kommune ist ein Ort, wo Gesundheit
entstehen kann und soll. Denn es sind die in der Stadt vorliegenden Umwelt- und
Lebensbedingungen, die die Gesundheit der dort lebenden Menschen bestimmen.
Dazu zählen neben den Präventions- und Selbsthilfeangeboten auch das kulturelle
und soziale Leben der Menschen. Die regionalen Kommunikationswege, die
Vernetzungen einzelner Einrichtungen untereinander und die Strukturen lokaler
Einrichtungen stellen eine wesentliche Voraussetzung für die gesundheitliche Lage
der Bevölkerung dar (vgl. Abel 1998).
Ergebnisse gemeindebezogener Präventionen, wie beispielsweise der Deutschen
Herz- Kreislauf- Präventionsstudie, belegen einen positiven Einfluss durch
Interventionsstrategien zur Gesundheitsförderung (vgl. von Troschke, Klaes und
Maschewsky-Schneider 1991).
2.2 Die Entwicklungen in der gesundheitsfördernden Kommune
2.2.1 Das Gesunde Städte- Netzwerk
Zu der Verabschiedung der Ottawa- Charta zur Gesundheitsförderung im Jahr 1986
sind im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation die nationalen Gesunde Städte-
Projekte entstanden (vgl. Weth 2005). Elf Kommunen haben 1989 das
bundesdeutsche Gesunde Städte- Netzwerk gegründet. Heute sind weit über 50
Städte und Kreise, und somit ca. 20 Prozent der Bevölkerung, in diesem Netzwerk
involviert (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2003).
Als Beitrittsvoraussetzung gilt die Verpflichtung für das Neun- Punkte- Programm, in
Form einer Selbstverpflichtung. Darin enthalten sind u. a. das Einverständnis mit den
Zielen und Inhalten der Ottawa- Charta zur Gesundheitsförderung aus dem Jahr
6
1986, die Benennung einer verantwortlichen Person und die Bereitschaft zur
Gesundheits- und Sozialberichterstattung (vgl. Gesunde Städte- Netzwerk 2006). Auf
der im Oktober 2005 in Münster stattgefundenen Veranstaltung, auf der die Vertreter
der Kompetenzzentren mit Mitgliedern des Sekretariats und des Sprecherrates
zusammenkamen, waren sich die Akteure einig, dass eine höhere Verbindlichkeit
und Qualität bei der Umsetzung des Neun- Punkte- Programms notwenig ist (vgl.
Gesunde Städte Nachrichten 2005).
Die Gesunden Städte gewinnen untereinander vom Erfahrungsaustausch und der
Kooperationen (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2003).
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind es in Europa inzwischen über
1300 Städte und Gemeinden, die in dem nationalen Gesunde Städte- Netzwerken
organisiert sind (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2003).
2.2.2 Die Lokale Agenda 21
Die Lokale Agenda 21 wurde 1992 in Rio de Janeiro ins Leben gerufen. Damals
wurde ein Arbeitsprogramm für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
festlegten (vgl. Pierk 2005).
Das Besondere an der Lokalen Agenda 21 ist das Verständnis, dass
aussichtsreichste Aktivitäten aus der Wechselwirkung ökologischer, wirtschaftlicher
und sozialer Bedingungen hervorgehen. Auch auf die Gesundheit der Menschen wird
in diesem Programm eingegangen (vgl. Pierk und Wulf 2004).
Mittlerweile haben sich in Deutschland mehr als 2400 Kommunen zur Aufstellung
einer Lokalen Agenda 21 entschieden (vgl. Pierk 2005).
2.2.3 Die Soziale Stadt
1999 wurde das Bund- Länder- Programm ,,Stadtteile mit besonderem
Entwicklungsbedarf- die Soziale Stadt" gegründet. Ziel des Programms ist die
Entwicklung der benachteiligten Stadtteile zu selbstständigen und lebensfähigen
Quartieren sowie die Schaffung von Zukunftsaussichten für die in diesen
Stadtvierteln lebenden Personen. Dabei wird eine Koordination von Politik,
7
Verwaltung, Bewohner, Wirtschaft und anderen regional bedeutsamen Akteuren
angestrebt (vgl. Verein für Kommunalwissenschaften 2004). Mit diesem Programm
sollen, durch Partizipation der Bürgerinnen und Bürger, verhaltens- und
verhältnisorientierte Maßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege zur
Verbesserung der Situation beitragen. Heute werden im Rahmen des Programms
Soziale Stadt Maßnahmen in über 200 Kommunen in ganz Deutschland erprobt und
durchgeführt. Darunter sind über 300 ,,Stadtteile mit besonderem
Entwicklungsbedarf" involviert (vgl. Böhme, Löhr und Schuleri- Hartje 2004).
2.2.4 Weitere Entwicklungsbeispiele in der gesundheitsfördernden Kommune
Im Folgenden werden weitere Beispiele für Entwicklungen in der
gesundheitsfördernden Kommune kurz angesprochen.
Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit:
Das Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit wurde 1999 durch das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und durch das
Bundesministerium für Gesundheit in der Öffentlichkeit bekannt. Seit 2002 ist auch
das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz an
diesem Programm beteiligt. Zudem sind das Bundesamt für Strahlenschutz, das
Bundesinstitut für Risikobewertung, das Robert Koch- Institut und das
Umweltbundesamt, als Bundesoberbehörden, involviert. Die Botschaft des
Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit lautet: ,,Umwelt und Gesundheit gehören
zusammen- Umweltschutz ist nachhaltige Gesundheitsvorsorge!" (Aktionsprogramm
Umwelt und Gesundheit 2006). Im Fokus des Aktionsprogramms steht die
Aufklärung und Information der Bevölkerung sowie Forschungsprojekte mit der
Zielgruppe Kinder und Jugendlichen (vgl. Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit
2006).
Deutsches Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung:
Gegründet wurde dieses Netzwerk auf der Grundlage einer Initiative des
Europäischen Netzwerks für betriebliche Gesundheitsförderung. Unterstützung erhält
das Netzwerk vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie vom
8
Bundesministerium für Gesundheit. Ziel des Netzwerks ist die stärkere
Zusammenarbeit zwischen allen nationalen Akteuren in diesem Bereich (vgl.
Deutsches Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung 2006).
Deutsches Netzwerk Gesundheitsfördernder Krankenhäuser gem. e. V.:
Gegründet wurde dieses Netzwerk auf der Grundlage der Ottawa Charta der
Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 1986. Das Deutsche Netzwerk
Gesundheitsfördernder Krankenhäuser gestaltet sich auf der Basis einer im Jahr
1993 ins Leben gerufenen Initiative der Weltgesundheitsorganisation, dem
Pilotprojekt ,,Gesundheitsförderndes Krankenhaus". Damals waren 20
Krankenhäuser aus elf europäischen Ländern, davon auch fünf deutsche
Krankenhäuser, in dieses Projekt involviert. Das Netzwerk steht allen
Krankenhäusern offen, ungeachtet vom jeweiligen Träger. Derzeit sind über 800
Krankenhäuser in 23 europäischen Ländern im Deutschen Netzwerk
Gesundheitsfördernder Krankenhäuser organisiert (vgl. Deutsches Netzwerk
Gesundheitsfördernder Krankenhäuser 2006).
9
2.3 Die Rolle des Öffentlichen Gesundheitsdienstes
Im Gesundheitswesen
2
werden dem Bund und den Ländern unterschiedliche
Tätigkeiten zugewiesen. Zu den Aufgabenbereichen der Bundesländer zählen der
Gesundheitsschutz, die Gesundheitshilfe und die Aufsicht über Berufe und
Institutionen des Gesundheitswesens. Als Öffentlicher Gesundheitsdienst
3
werden
alle Institutionen des öffentlichen Dienstes zusammengefasst, die diesen u. ä.
Tätigkeiten nachgehen. Zur Gestaltung dieses Bereichs können die einzelnen Länder
eigene Gesundheitsdienstgesetze beschließen. Allgemein gültig ist das Gesetz über
die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens (vgl. Carels und Pirk 2005).
Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit überprüft auf der
Ebene des Bundes u. a. die Gesundheitsberichterstattung, in der Zuständigkeit des
Robert Koch- Instituts, die medizinische Information und Dokumentation, die in der
Zuständigkeit des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation liegt sowie die
gesundheitliche Aufklärung für die sich die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung verantwortlich zeichnet (vgl. von Troschke und Mühlbacher 2005).
Auf der Ebene der Länder ist der öffentliche Gesundheitssektor dem
Sozialministerium zugehörig (vgl. von Troschke und Mühlbacher 2005).
Im Mittelpunkt der kommunalen Gesundheitsförderung steht der ÖGD und
gegenwärtig speziell das Gesundheitsamt (vgl. Trojan, Stumm, Süß und
Zimmermann 1999).
Die Aufgaben des ÖGD können in jedem Bundesland etwas variieren, im
Wesentlichen sind es aber die Gesundheitsberichterstattung, der Gesundheitsschutz,
die Hygieneaufsicht in Krankenhäusern, Arztpraxen und im Bereich der
Nahrungsmittel, Arzneimittel und Drogen sowie in anderen Einrichtungen. Zudem
gehören die ärztlichen Untersuchungen, die Diagnostik spezifischer
Infektionskrankheiten, die Zusammenarbeit und Beratung von anderen öffentlichen
Einrichtungen und die Gesundheitserziehung, -beratung und förderung ebenfalls in
2
Als Gesundheitswesen werden alle Institutionen und Personen zusammengefasst, die die
Gesundheit der Bevölkerung erhalten, fördern oder wiederherstellen. Darunter sind sowohl staatliche
als auch nichtstaatliche Einrichtungen, beispielsweise Krankenkassen, Arztpraxen, Krankenhäuser,
Wohlfahrtsverbände, der Öffentliche Gesundheitsdienst (vgl. Carels und Pirk 2005).
3
im Folgenden ÖGD abgekürzt
10
den Tätigkeitsbereich des ÖGD (vgl. Busse und Riesberg 2005). Gegenwärtig
überwiegen allerdings die Tätigkeiten im Bereich der Aufsicht und der Kontrolle (vgl.
Trojan, Stumm, Süß und Zimmermann 1999).
Den unmittelbaren Aufgaben der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gehen die
ungefähr 300 Gesundheitsämter
4
nach. Diese sind auf kommunaler Ebene häufig
den Kreisverwaltungen zugehörig (vgl. von Troschke und Mühlbacher 2005).
Zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem ÖGD, den Vertragsärzten,
politischen Entscheidungsträgern und anderen Akteuren in diesem Bereich wurde
auf der Ebene des Bundes eine weitere Kommission etabliert. Das 2002 gegründete
Deutsche Forum für Prävention und Gesundheitsförderung hat die Weiterentwicklung
der Ergebnisse der zwei seit 2002 tagenden Kommissionen zur Aufgabe. Dabei
handelt es sich um die Initiative zur Formulierung von bundesweiten
Gesundheitszielen (Gesundheitsziele.de) und die Runde- Tisch- Gespräche zur
Stärkung der Prävention in Deutschland. Diese neue Kommission hat sich die
Förderung der Entwicklung umfassender Präventionsprogramme und die Etablierung
einer Informationsplattform über präventive Aktivitäten und nachhaltige
Organisationsstrukturen zum Ziel gesetzt. Dabei wurden als wichtige Tätigkeitsfelder
die Gesundheitsförderung in Kindergärten, Schulen und Betrieben, die Prävention im
Alter sowie die Einführung eines komplexen Programms zur Vorbeugung von Herz-
Kreislauf- Krankheiten angegeben (vgl. Busse und Riesberg 2005).
Im aktuellen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst für das Land Berlin
vom 25. Mai 2006 sind u. a. die Aufgabenstellung, die Zuständigkeiten, die
Organisation und die Steuerung genau geregelt. Dementsprechend zählen zu den
Kernaufgaben des ÖGD Qualitätsentwicklung, Prävention, Gesundheitsförderung,
Gesundheitshilfe und Schutz der Gesundheit für Kinder und Jugendliche und für
Erwachsene etc. Zudem stellt sich der ÖGD des Landes Berlin [,,...den
großstadttypischen gesundheitlichen und sozialen Problemlagen und reagiert flexibel
auf sich verändernde Rahmenbedingungen."] (Gesundheitsreformgesetz 2006, 450).
4
Gesundheitsämter stellen staatliche Behörden auf der Ebene der Länder und Kommunen dar.
Geleitet werden sie durch einen Amtsarzt (vgl. Carels und Pirk 2005).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836609821
- DOI
- 10.3239/9783836609821
- Dateigröße
- 713 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Magdeburg-Stendal; Standort Magdeburg – Gesundheits- und Sozialwesen, Studiengang Gesundheitsföderung und-management
- Erscheinungsdatum
- 2008 (Februar)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- kommunale gesundheitsförderung regionale gesundheitskonferenz handlungszyklus evaluation handlungskatalog
- Produktsicherheit
- Diplom.de