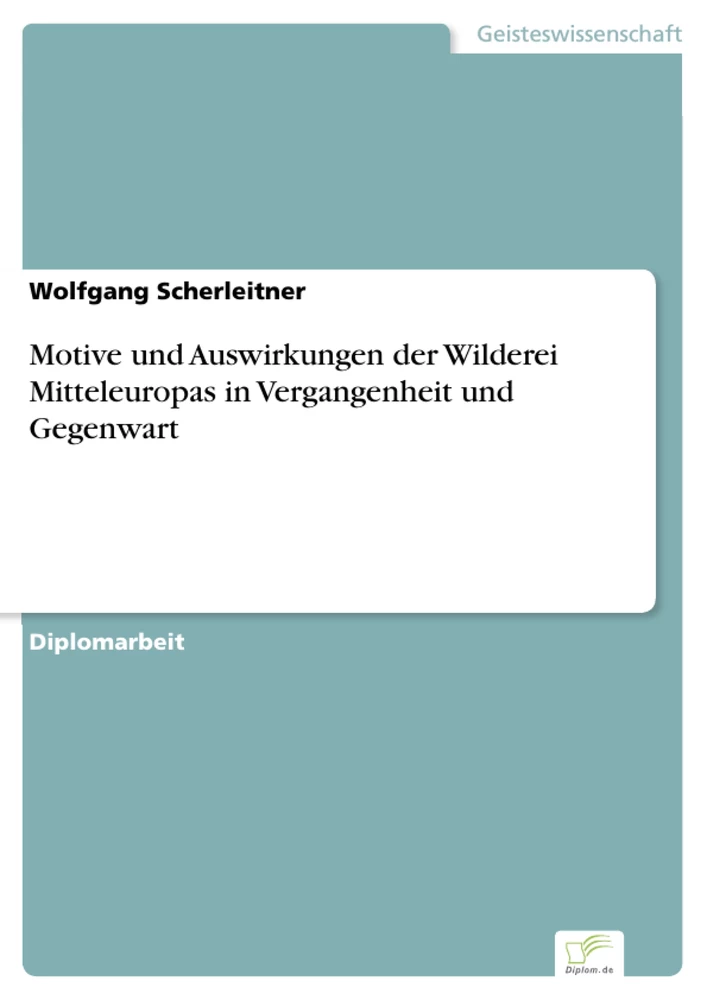Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
©2002
Diplomarbeit
134 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Auch in der heutigen Zeit, in der die Wilderei in Österreich nicht mehr der Nahrungsbeschaffung dient, in einer Zeit, in der Begegnungen zwischen Jägern und Wilderern zur Seltenheit geworden sind, ist das Thema Wilderei emotionsgeladen. Gelegentlich stößt man auf Artikel in Jagdzeitschriften, die dieses Thema behandeln. Die Art und Weise, wie diese Artikel geschrieben wurden, gleicht jener vor fünfzig oder sechzig Jahren. Die Emotionen sind verständlich, wenn man bedenkt, daß es auf beiden Seiten wiederholt zu Toten bei Konfrontationen kam. Es gab aber auch Tote bei anderen Straftaten. Warum schlugen solche Begebenheiten nicht die gleichen Wogen?
Bei Wilderei handelt es sich im Grunde um Diebstahl. Warum ist gerade diese Straftat so interessant? Wird ein Verbrechen begangen, so wird sofort nach dem Motiv gefragt. Welche Beweggründe hat ein Wilderer? War die Nahrungsbeschaffung, die Jagdleidenschaft oder die Trophäe Ziel seiner Bestrebungen? Hat sich die Vorgehensweise der Wilderer im Laufe der Geschichte verändert? Gibt es in Österreich heute noch die Wilderei, wie sieht diese aus? Welche Formen der Wilderei gibt es? Womit wird gewildert? Welche Fertigkeiten benötigt ein Wilderer? Wie kann man der Wilderei begegnen?
Es soll aufgezeigt werden, welche Auswirkungen die Wilderei auf die Wildpopulationen, auf die Gesellschaft oder auf die Volkskultur hatte und heute noch hat. Sind diese Auswirkungen ausschließlich negativ, oder gibt es möglicherweise auch positive Aspekte?
Es existieren viele Lieder über die Jagd, es existieren auch viele Lieder über die Wilderei. Warum ist die Wilderei so interessant, daß darüber Lieder gesungen werden? Gibt es andere Straftaten, die ebenso häufig besungen werden?
Gang der Untersuchung:
Eine Form der Informationsbeschaffung für meine Arbeit war die direkte Befragung. Natürlich bietet sich dafür ein Fragebogen an. Schon bald bemerkte ich, daß selbst mein kleines Notizbuch, in das ich immer meine Aufzeichnungen machte, sehr oft nicht gern gesehen wurde. Manchmal mußte ich sogar auf dieses Buch verzichten. Würde ich nun mit einem, vielleicht mehrseitigen, Fragebogen in solche Gespräche gehen, wären die Informationen sicher sehr spärlich ausgefallen und so manches: Des host net vo mir! hätte es nicht gegeben. Ich mußte sehr feinfühlig vorgehen, damit ich überhaupt an Informationen kam. Befragt man nun Personen, so hält sich anfangs jeder bedeckt und es wird nur festgestellt, daß es keine […]
Auch in der heutigen Zeit, in der die Wilderei in Österreich nicht mehr der Nahrungsbeschaffung dient, in einer Zeit, in der Begegnungen zwischen Jägern und Wilderern zur Seltenheit geworden sind, ist das Thema Wilderei emotionsgeladen. Gelegentlich stößt man auf Artikel in Jagdzeitschriften, die dieses Thema behandeln. Die Art und Weise, wie diese Artikel geschrieben wurden, gleicht jener vor fünfzig oder sechzig Jahren. Die Emotionen sind verständlich, wenn man bedenkt, daß es auf beiden Seiten wiederholt zu Toten bei Konfrontationen kam. Es gab aber auch Tote bei anderen Straftaten. Warum schlugen solche Begebenheiten nicht die gleichen Wogen?
Bei Wilderei handelt es sich im Grunde um Diebstahl. Warum ist gerade diese Straftat so interessant? Wird ein Verbrechen begangen, so wird sofort nach dem Motiv gefragt. Welche Beweggründe hat ein Wilderer? War die Nahrungsbeschaffung, die Jagdleidenschaft oder die Trophäe Ziel seiner Bestrebungen? Hat sich die Vorgehensweise der Wilderer im Laufe der Geschichte verändert? Gibt es in Österreich heute noch die Wilderei, wie sieht diese aus? Welche Formen der Wilderei gibt es? Womit wird gewildert? Welche Fertigkeiten benötigt ein Wilderer? Wie kann man der Wilderei begegnen?
Es soll aufgezeigt werden, welche Auswirkungen die Wilderei auf die Wildpopulationen, auf die Gesellschaft oder auf die Volkskultur hatte und heute noch hat. Sind diese Auswirkungen ausschließlich negativ, oder gibt es möglicherweise auch positive Aspekte?
Es existieren viele Lieder über die Jagd, es existieren auch viele Lieder über die Wilderei. Warum ist die Wilderei so interessant, daß darüber Lieder gesungen werden? Gibt es andere Straftaten, die ebenso häufig besungen werden?
Gang der Untersuchung:
Eine Form der Informationsbeschaffung für meine Arbeit war die direkte Befragung. Natürlich bietet sich dafür ein Fragebogen an. Schon bald bemerkte ich, daß selbst mein kleines Notizbuch, in das ich immer meine Aufzeichnungen machte, sehr oft nicht gern gesehen wurde. Manchmal mußte ich sogar auf dieses Buch verzichten. Würde ich nun mit einem, vielleicht mehrseitigen, Fragebogen in solche Gespräche gehen, wären die Informationen sicher sehr spärlich ausgefallen und so manches: Des host net vo mir! hätte es nicht gegeben. Ich mußte sehr feinfühlig vorgehen, damit ich überhaupt an Informationen kam. Befragt man nun Personen, so hält sich anfangs jeder bedeckt und es wird nur festgestellt, daß es keine […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Wolfgang Scherleitner
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
ISBN: 978-3-8366-0741-4
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Zugl. Universität für Bodenkultur Wien, Wien, Österreich, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
1
Inhaltsverzeichnis
Vorwort ... 2
1 Einführung... 5
1.1 Zielsetzung
und
Fragestellung... 5
1.2 Methodik ... 6
2
Die Bezeichnung ,,Wilderer" ... 8
2.1 Gesetzliche Bestimmungen in Österreich... 8
2.2 Gesetzliche Bestimmungen in Deutschland ... 11
2.3 Sonstige Bezeichnungen für Wilderer ... 12
3
Entwicklung der Wilderei ... 14
3.1 Wilderei vor 1848... 14
3.2 Wilderei von 1848 bis zum Ersten Weltkrieg ... 18
3.3 Wilderei in der Zwischenkriegszeit ... 20
3.4 Wilderei im Dritten Reich und während des Zweiten Weltkrieges ... 22
3.5 Wilderei in der Nachkriegszeit ... 23
3.6 Welchen Stellenwert hat die Wilderei heute? ... 24
4
Die Motivation zum Wildern... 26
4.1 Einteilung der Wilddiebe... 28
4.2 Der Einfluß der Jahreszeiten auf die Häufigkeit des Wilderns... 29
4.3 Die Motivation in Abhängigkeit vom Beruf ... 33
4.4 Die Motivation der Wilderer im Laufe der Geschichte ... 36
4.4.1 Warum wurde einst gewildert?... 36
4.4.2 Warum wird heute gewildert?... 38
4.5 Geographische Analyse der Wilderei ... 38
5
Edle und unedle Wilderei ... 41
5.1 Wildschütz - Raubschütz ... 41
5.2 Vom Volkshelden zum Schwerverbrecher... 41
6 Werkzeuge
der
Wilderei ... 44
6.1 Wilderei mit der Schußwaffe... 45
6.1.1 Die herkömmliche Feuerwaffe ... 45
6.1.2 Umgebaute und getarnte Feuerwaffen ... 46
6.1.3 Andere Schußwaffen... 48
6.2 Wilderei mit der Schlinge... 49
6.2.1 Schlingentechniken und Schlingenarten ... 50
6.2.2 Die Maxler ... 55
6.3 Wilderei mit anderen Hilfsmitteln ... 56
7 Organisierte
Wilderei... 58
7.1 Bandenwilderei ... 58
7.2 Wilderei von einem Fahrzeug aus ... 59
7.3 Unbewußte
Wilderei ... 60
8 Fertigkeiten
des
Wilderers... 61
8.1 Wissen
und
Erfahrung ... 61
8.2 Kleidung... 62
8.3 Verbündete ... 64
8.4 Magie und Aberglaube ... 65
8.4.1 Magie für den Schützen selbst... 65
8.4.2 Magie für die Waffe ... 68
8.4.3 Der Wilderer als ,,Medizinmann"... 69
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
2
9
Bekämpfung der Wilderei... 70
9.1 Vorbeugung... 70
9.2 Verhalten vor entdeckter Tat... 71
9.3 Verhalten nach begangener Tat... 72
9.3.1 Beschreibung des Tatherganges und der verdächtigen Person... 72
9.3.2 Spurensicherung... 73
9.3.3 Die Aufklärung ... 74
9.4 Bekämpfung der Schlingenstellerei... 75
9.4.1 Die Schlingensuche ... 75
9.4.2 Unbrauchbarmachen von aufgefunden Schlingen... 76
9.4.3 Einschreiten vom Vorpaß aus... 77
9.4.4 Ermittlung der Berufsgruppe durch die Stelltechnik... 78
9.5 Die
Konfrontation ... 79
10 Die Auswirkungen der Wilderei... 81
10.1 Ökologische Aspekte ... 81
10.2 Ökonomische Aspekte ... 85
10.3 Soziologische Aspekte ... 91
10.4 Kulturelle Aspekte ... 94
10.4.1 Lieder und Gedichte über Wilderer und Wilderei... 94
10.4.1.1 Lieder in denen Wilderer zu Schaden kommen... 95
An einem Sonntagmorgen ... 95
Das Lied vom Jennerwein ... 96
Erstes Klackl Lied ... 97
Zweites Klackl Lied ... 98
Drittes Klackl Lied ... 98
Das war Pius... 99
Gute Nacht... 99
10.4.1.2 Zusammenfassung ... 100
10.4.1.3 Lieder in denen die Wilderei angeprangert wird ... 101
Daß i a Wildschütz bin ... 101
Wia schön san die Gamserl... 101
Der Wild´rer Lenz... 101
10.4.1.4 Zusammenfassung ... 102
10.4.1.5 Lieder, in denen Jäger zu Schaden kommen oder verhöhnt werden ... 103
Das Wildschützenlied aus Windischgarsten ... 103
Wildschützlied... 104
Auf´s Kapuzinerbergl ... 104
Willst an Gamsbock schieaßn ... 105
Koa dahoamtigs Dirndl ... 106
Da Franzl ... 106
Bin a lustiger Wildschütz... 107
Ei, du mei liabe Schwoagrin ... 107
10.4.1.6 Zusammenfassung ... 107
10.4.1.7 Lieder, die den Respekt beider Seiten zum Ausdruck bringen... 109
Wilddieb ... 109
10.4.1.8 Lieder mit Magie ... 109
Im Gamsgebirg ... 109
10.4.1.9 Lieder mit Gehilfen... 110
Almerspitz ... 110
Auf´m Gamsberg ... 110
Zeitvertreib... 111
Das Lied vom bayrischen Hiasl ... 112
Vasehgns... 112
I trau dir nit... 113
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
3
10.4.1.10 Zusammenfassung ... 113
10.4.2 Auswertung der Lieder und Gedichte... 113
10.5 Rituale ... 115
11 Vom Wilderer zum Jäger... 116
12 Diskussion... 118
13 Zusammenfassung... 124
14 Literatur und Abbildungen ... 126
14.1 Literaturverzeichnis ... 126
14.2 Abbildungsverzeichnis... 129
14.3 Tabellenverzeichnis... 130
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
4
Vorwort:
Jeder kennt ihn, den Wilderer vom Silberwald. Viele Geschich-
ten ranken sich um Männer in langen Mänteln und geschwärz-
tem Gesicht. Die romantische Seite der Gesellschaft stellt sie
als verwegene Haudegen dar, die andere schlichtweg als Diebe
und Verbrecher.
Wer waren diese Menschen wirklich, was trieb sie dazu illegal
dem Wild nachzustellen und aus diesem Grund mit dem Gesetz
in Konflikt zu kommen? Waren sich viele Menschen überhaupt
bewußt, daß ihre Handlungen Wilderei und damit strafbar sind?
Gibt es die Wilderei noch heute? Wenn ja, in welcher Form?
Als ich mit der Recherche zu meiner Diplomarbeit begann, war ich über die Reak-
tionen der Befragten äußerst erstaunt. Viele von ihnen waren zunächst gar nicht
bereit darüber zu reden. ,,Es gibt keine Unterlagen über Wilderei, denn seit
Menschengedenken wird hier nicht mehr gewildert", war der Satz den ich am häu-
figsten zur Antwort bekam.
Erst nach und nach faßten die Befragten Vertrauen und so konnte ich doch einiges
aus Gesprächen erfahren. Überrascht war ich, als ich feststellte, daß es unter mei-
nen Vorfahren zumindest zwei Menschen gab, die wegen Wilderei verurteilt wur-
den. 1922 berichtete der ,,Sonntagsbote" über einen meiner Vorfahren. Auch ich
dachte immer, Wilderer sind andere, doch als ich bemerkte, daß sogar Verwandte
von mir dieser Tätigkeit nachgingen, begann ich nachzudenken. Nachzudenken
über Aussagen wie: ,,In meinem Revier wurde niemals und wird auch heute nicht
gewildert!" Ich dachte aber auch darüber nach, welche Seite nun die ,,richtige" ist.
Die des Jagdberechtigten, der den Wilderer ohne Skrupel als Meuchelmörder dar-
stellt, oder die des Wilderers, der vielleicht Familienvater ist und auf diesem Wege
Nahrung für sich und seine Kinder beschafft.
Die Neuerscheinung von SCHINDLER N. wurde mir erst nach Fertigstellung mei-
ner Arbeit bekannt und konnte daher nicht berücksichtigt werden.
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
5
1 Einführung
1.1 Zielsetzung und Fragestellung
Auch in der heutigen Zeit, in der die Wilderei in Österreich nicht mehr der Nah-
rungsbeschaffung dient, in einer Zeit, in der Begegnungen zwischen Jägern und
Wilderern zur Seltenheit geworden sind, ist das Thema Wilderei emotionsgeladen.
Gelegentlich stößt man auf Artikel in Jagdzeitschriften, die dieses Thema behan-
deln. Die Art und Weise, wie diese Artikel geschrieben wurden, gleicht jener vor
fünfzig oder sechzig Jahren. Die Emotionen sind verständlich, wenn man bedenkt,
daß es auf beiden Seiten wiederholt zu Toten bei Konfrontationen kam. Es gab
aber auch Tote bei anderen Straftaten. Warum schlugen solche Begebenheiten
nicht die gleichen Wogen?
Bei Wilderei handelt es sich im Grunde um Diebstahl. Warum ist gerade diese
Straftat so interessant? Wird ein Verbrechen begangen, so wird sofort nach dem
Motiv gefragt. Welche Beweggründe hat ein Wilderer? War die Nahrungsbeschaf-
fung, die Jagdleidenschaft oder die Trophäe Ziel seiner Bestrebungen? Hat sich
die Vorgehensweise der Wilderer im Laufe der Geschichte verändert? Gibt es in
Österreich heute noch die Wilderei, wie sieht diese aus? Welche Formen der Wil-
derei gibt es? Womit wird gewildert? Welche Fertigkeiten benötigt ein Wilderer?
Wie kann man der Wilderei begegnen?
Es soll aufgezeigt werden, welche Auswirkungen die Wilderei auf die Wildpopulati-
onen, auf die Gesellschaft oder auf die Volkskultur hatte und heute noch hat. Sind
diese Auswirkungen ausschließlich negativ, oder gibt es möglicherweise auch po-
sitive Aspekte?
Es existieren viele Lieder über die Jagd, es existieren auch viele Lieder über die
Wilderei. Warum ist die Wilderei so interessant, daß darüber Lieder gesungen
werden? Gibt es andere Straftaten, die ebenso häufig besungen werden?
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
6
1.2 Methodik
Eine Form der Informationsbeschaffung für meine Arbeit war die direkte Befra-
gung. Natürlich bietet sich dafür ein Fragebogen an. Schon bald bemerkte ich, daß
selbst mein kleines Notizbuch, in das ich immer meine Aufzeichnungen machte,
sehr oft nicht gern gesehen wurde. Manchmal mußte ich sogar auf dieses Buch
verzichten. Würde ich nun mit einem, vielleicht mehrseitigen, Fragebogen in solche
Gespräche gehen, wären die Informationen sicher sehr spärlich ausgefallen und so
manches: ,,Des host net vo mir!" hätte es nicht gegeben. Ich mußte sehr feinfühlig
vorgehen, damit ich überhaupt an Informationen kam. Befragt man nun Personen,
so hält sich anfangs jeder bedeckt und es wird nur festgestellt, daß es keine Wilde-
rei in der jeweiligen Region gibt oder gegeben hat. Erst wenn das Eis gebrochen
ist, merkt man, daß es Wilderei nicht nur gegeben hat, sondern auch heute noch
immer gibt. Je mehr Menschen ich befragte, desto deutlicher wurde die Angst der
Befragten vielleicht doch noch entdeckt und für eine Tat bestraft zu werden, die
meist schon Jahrzehnte zurücklag.
Nun stellte sich ein weiteres Problem: Wie komme ich zu Informationen, die objek-
tiv sind, also nicht aus der Erinnerung eines Einzelnen, aus Erzählungen von Drit-
ten oder überhaupt aus Mutmaßungen stammen? Zahlen über Straftaten aus ers-
ter Hand bekommt man am Gericht. Ich wandte mich an die Gerichte Wiener Neu-
stadt, Neunkirchen, Aspang, Gloggnitz, Bad Ischl, Bad Aussee und Salzburg. Ich
wurde freundlich aber bestimmt darauf hingewiesen, daß ich kein Jurist sei und mir
deshalb der Zutritt zu den Gerichtsakten nicht gewährt werden könne. Mir blieb
daher wieder nur die Befragung. Langjährige Bedienstete gaben mir im Rahmen
ihrer Möglichkeiten Auskunft zu meinem Thema.
Da ,,Österreichs Weidwerk" die auflagenstärkste Jagdzeitung Österreichs ist, habe
ich diese Zeitschrift ergänzend zur Literatur und den Befragungen gewählt. ,,Öster-
reichs Weidwerk" erschien 1928 zum ersten Mal. In den Jahren des Dritten Rei-
ches, also 1938 bis 1945, existierte diese Jagdzeitung nicht. Ich untersuchte alle
Ausgaben bis zur Dezemberausgabe 1999 nach Artikeln über Wilderei und notierte
das Jahr in dem die Tat begangen wurde, den Ort, die Art wie das Wild zur Strecke
gebracht wurde, die Wildart und Stückzahl. Vom Wilderer notierte ich den Beruf,
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
7
soweit bekannt, um von der sozialen Stellung auf die Motivation Rückschlüsse zie-
hen zu können. Waren mehrere Wilderer involviert, die Anzahl und die Organisati-
on. Ebenfalls wurde das Erscheinungsjahr, der Titel und der Autor des Artikels
festgehalten.
Ich durchsuchte die Literatur nach Liedern über Wilderei. Bei meinen Befragungen
lernte ich Herrn REISENBAUER kennen. Herr REISENBAUER ist begeisterter Mu-
siker, er hat sich zur Aufgabe gemacht, Lieder, die nur gesungen und nicht nieder-
geschrieben sind für die Nachwelt festzuhalten. Von ihm erhielt ich Texte, die er
selbst gesammelt hatte und auch den Hinweis auf Liederbücher in denen Lieder
über Wilderei niedergeschrieben sind. Nachdem alle gefundenen Lieder niederge-
schrieben waren, wurden sie in Kategorien geteilt. Danach wurde überlegt, in wel-
cher Kategorie die meisten Lieder zu finden sind, und ob man daraus Schlüsse
ziehen kann.
Wilderei wird in vielen Liedern besungen. Nun stellte sich die Frage, ob es noch
andere Straftaten gibt, die in der Volksmusik besungen werden, vielleicht existieren
darüber Statistiken. Ich wandte mich mit dieser Frage an das Institut für Volksmu-
sikforschung.
Interessant zu Untersuchen wäre noch, wie die Altersverteilung der erwilderten
Stücke ist. Anzunehmen ist, daß Menschen, die aus Not wildern eher junges Wild
erlegen. Wogegen älteres Wild vermutlich von jenen zur Strecke gebracht wird, die
wegen der Trophäe dem Wild nachstellen. Solche Untersuchungen waren aber
nicht möglich, da bei den Zeitungsberichten nur vereinzelt Aussagen darüber ge-
macht wurden zu welcher Altersklasse das erlegte Wild zu zählen ist.
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
8
2 Die Bezeichnung ,,Wilderer"
2.1 Gesetzliche Bestimmungen in Österreich
Um feststellen zu können was Jagd und damit Wilderei eigentlich ist, muß man
sich den Begriff des Jagdrechtes näher betrachten. Jedes Bundesland Österreichs
verfügt über sein eigenes Jagdrecht und so wird im folgenden die Sachlage aus
dem niederösterreichischen Jagdrecht behandelt.
§ 1. (1) Jagdgesetz: ,,Das Jagdrecht besteht in der ausschließlichen Befugnis, in-
nerhalb eines bestimmten Jagdgebietes den jagdbaren Tieren nachzustellen, sie
zu fangen, zu erlegen und sich anzueignen, es umfaßt ferner die ausschließliche
Befugnis, sich verendetes Wild, Fallwild, Abwurfstangen sowie die Eier des Feder-
wildes anzueignen." (GÜRTLER et al. 1994)
In § 1 des niederösterreichischen Jagdgesetzes wird ausschließlich das Recht zur
Jagd festgelegt. Das Jagdrecht ist in Österreich an das Grundeigentum gebunden.
Das bedeutet, daß der Grundeigentümer auch der Jagdberechtigte ist. Übt der
Grundeigentümer die Jagd nicht aus, wessen Eigentum ist nun das Wild? Das des
Grundeigentümers oder das des Jagdausübungsberechtigten? Hiezu muß man
das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch näher betrachten.
§ 295 ABGB: ,,Gras, Bäume, Früchte und alle brauchbare Dinge, welche die Erde
auf ihrer Oberfläche hervorbringt, bleiben so lange ein unbewegliches Vermögen,
als sie nicht von Grund und Boden abgesondert worden sind. Selbst die Fische in
einem Teiche, und das Wild in einem Walde werden erst dann ein bewegliches
Gut, wenn der Teich gefischt, und das Wild gefangen oder erlegt worden ist."
(DORALT 1991)
Der Bund ist für die Regelung des Eigentums an Wildtieren zuständig. Diese Rege-
lung fällt nach dem Zivilrechtswesens in die Kompetenz des Bundes, da das Ei-
gentum Gegenstand des Zivilrechtes ist. Das potentielle Eigentum an Wildtieren,
das durch das ausschließliche Aneignungsrecht aktualisiert wird, wurde im Staats-
grundgesetz von 1867 festgeschrieben. (VÖLK 1996)
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
9
Obwohl das Wild herrenlos ist, sind nur bestimmte Personen berechtigt sich Wild
anzueignen. ,,Erst durch die Landesgesetze würde das Wild zu einer ansprüchigen
Sache." (BINDER 1992)
Im Dritten Hauptstück des ABGB Von der Erwerbung des Eigentumes durch Zu-
eignung werden die Bedingungen, die für eine Erwerbung notwendig sind, erläu-
tert: § 380 ABGB: ,,Ohne Titel und ohne rechtliche Erwerbungsart kann kein Eigen-
tum erlangt werden." (DORALT 1991)
§ 382 ABGB: ,, Freistehende Sachen können von allen Mitgliedern des Staates
durch die Zueignung erworben werden, insofern diese Befugnis nicht durch politi-
sche Gesetze eingeschränkt ist, oder einigen Mitgliedern das Vorrecht der Zueig-
nung zusteht." (DORALT 1991)
§ 383 ABGB: ,, Dieses gilt insbesondere von dem Tierfange. Wem das Recht zu
jagen oder zu fischen gebühre; wie der übermäßige Anwachs des Wildes ge-
hemmt, und der vom Wilde verursachte Schaden ersetzt werde; wie der Honig-
raub, der durch fremde Bienen geschieht, zu verhindern sei; ist in den politischen
Gesetzen festgesetzt. Wie Wilddiebe zu bestrafen seien, wird in den Strafgesetzen
bestimmt." (DORALT 1991)
Greift nun jemand in fremdes Jagd- oder Fischereirecht ein, so kommt laut § 383
ABGB das Strafgesetz zur Geltung: § 137 Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974:
,,Wer unter Verletzung fremden Jagd- oder Fischereirechts dem Wild nachstellt
1
,
fischt, Wild oder Fische tötet
2
, verletzt oder sich oder einem Dritten zueignet oder
sonst eine Sache
3
, die dem Jagd- oder Fischereirecht eines anderen unterliegt,
zerstört, beschädigt oder sich oder einem Dritten zueignet, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagesätzen zu bestrafen."
1
,,Nachstellen ist jede Tätigkeit, die nach dem Willen des Täters unmittelbar in das Töten und Fangen von Wild
übergehen soll;"
2
,,Auf welche Weise der Täter die Tiere tötet, ob durch weidgerechten Abschuß oder indem er auf der Straße
laufendes Wild vorsätzlich überfährt, macht keinen Unterschied."
3
,,Darunter fallen insbesondere die in § 1 JG angeführten Abwurfstangen und Eier des Federwildes."
(GÜRTLER 1994)
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
10
Das Gesetz unterscheidet zwischen Eingriff in fremdes Jagd- und Fischereirecht
und schwerem Eingriff in fremdes Jagd- und Fischereirecht. Schwerer Eingriff in
fremdes Jagd- und Fischereirecht:
§ 138 Strafgesetzbuch: ,,Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer
die Tat
1. an Wild, an Fischen oder an anderen dem fremden Jagd- oder Fischereirecht
unterliegenden Sachen in einem S 25.000,- übersteigenden Wert,
2. in der Schonzeit oder unter Anwendung von Eisen, von Giftködern, einer elekt-
rischen Fanganlage, eines Sprengstoffes, in einer den Wild- oder Fischbestand
gefährdenden Weise oder an Will unter Anwendung von Schlingen,
3. in Begleitung eines Beteiligten begeht und dabei entweder selbst eine Schuß-
waffe bei sich führt oder weiß, daß der Beteiligte eine Schußwaffe bei sich führt
oder
4. gewerbsmäßig
begeht."
In § 139 ist die Verfolgungsvoraussetzung behandelt: ,,Begeht der Täter den Ein-
griff in fremdes Jagdrecht an einem Ort, wo er die Jagd, oder den Eingriff in frem-
des Fischereirecht an einem Ort, wo er die Fischerei in beschränktem Umfang
ausüben darf, so ist er wegen der nach den §§ 137 und 138 strafbaren Handlun-
gen nur mit Ermächtigung des Jagd- oder Fischereiberechtigten zu verfolgen."
(GÜRTLER 1994)
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
11
2.2 Gesetzliche Bestimmungen in Deutschland
Im Gegensatz zu Österreich, wo das Jagdrecht Landessache ist, fällt in Deutsch-
land das Jagdrecht in die Kompetenz des Bundes, wobei es sich um ein Rahmen-
gesetz handelt. Die einzelnen Bundesländer haben zusätzlich noch eigene Durch-
führungsgesetze.
Das Bundes Jagdgesetz vom 29. November 1952 in der Fassung der Bekannt-
machung vom 29. September 1976 schreibt über die Aneignung von Wild: ,,Zu den
jagdlichen Handlungen gehören gemäß § 1 Abs. 4 neben dem Erlegen und Fan-
gen von Wild auch die Vorbereitungen hierzu, nämlich das Aufsuchen und Nach-
stellen des Wildes, sodann das Aneignen der Jagdbeute. Bis zur Aneignung des
Wildes durch den Jagdberechtigen ist das in Freiheit lebende Wild herrenlos.
Durch die Besitzergreifung seitens des Jagdberechtigten erwirbt dieser das Eigen-
tum daran. Das Eigentum wird jedoch nicht erworben, wenn die Aneignung gesetz-
lich verboten ist, oder wenn durch die Besitzergreifung das Aneignungsrecht eines
anderen verletzt wird. Aus letzterem Grunde erwirbt der Wilddieb nicht das Eigen-
tum an dem erbeuteten Wilde. Jedoch erwirbt in diesem Falle auch der Jagdbe-
rechtigte kein Eigentum an dem erlegten Wilde, sondern es bleibt herrenlos, bis es
in den Besitz des Jagdberechtigten gelangt oder von einem Gutgläubigen erwor-
ben wird. Der Jagdberechtigte kann daher vom Wilderer oder dem bösgläubigen
Erwerber (Hehler) zwar nicht auf Grund seinen Aneignungsrechtes die Herausga-
be des Wilderergutes verlangen, wohl aber steht ihm auf Grund des § 823 Abs. 2
BGB ein Schadenersatz zu, da der Wilderer bzw. Hehler gegen ein den Schutz
eines anderen bezweckendes Gesetz verstoßen hat. Als Schadenersatz kann er
nach § 249 BGB Herausgabe des Wildes oder, falls dies unmöglich ist, Geldent-
schädigung beanspruchen. Gleicher Anspruch besteht gegen den, der als Nicht-
jagdberechtiger ein jagdbares Tier fängt und in Gefangenschaft hält."
Darüber hinaus besagt § 1 Abs. 5: ,,Das Recht zur Aneignung von Wild umfaßt
auch die ausschließliche Befugnis, krankes oder verendetes Wild, Fallwild und
Abwurfstangen sowie die Eier von Federwild sich anzueignen." (LINNENKOHL
1991)
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
12
§ 3 Abs. 1: Das Jagdrecht steht, wie in Österreich, dem Eigentümer auf seinen
Grund und Boden zu. Es ist untrennbar mit dem Eigentum am Grund und Boden
verbunden. Als selbständiges dingliches Recht kann es nicht begründet werden.
(LINNENKOHL 1991)
Im VI. Abschnitt, § 23 der Inhalt des Jagdschutzes ist festgelegt, daß der Jagd-
schutz sich mit dem Schutz des Wildes gegen Wilderer zu befassen hat. ,,Der
Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des
Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuche, vor wildernden Hunden
und Katzen sowie die Sorge für die Erhaltung der zum Schutz des Wildes und der
Jagd erlassenen Vorschriften." (LINNENKOHL 1991)
2.3 Sonstige Bezeichnungen für Wilderer
Wie in der Einleitung angesprochen, ist das Thema Wilderei sehr emotionsgela-
den. Vor dem Gesetz gilt Wilderei einfach als Straftat. Die direkt davon betroffenen
Personen, wie der Jagdschutzbeauftragte, der Wilderer oder Personen, die davon
anderweitig profitieren, sehen das anders. Der Wilderer selbst empfindet diese Be-
zeichnung als Beleidigung. Er selbst nennt sich Wildschütz oder nur Schütz. Das
Jagdpersonal hat andere Bezeichnungen, wie Raubschütz, Schwarzschütz,
Schwarzgeher oder einfach nur Lump. Grundsätzlich kann gesagt werden, daß ein
Mensch, der die Jagd unberechtigt ausübt, ein Wilderer ist.
,,Wildern ist also zusammenfassend eine wilde Leidenschaft, eine Quelle von Las-
tern und Verbrechen, ein Frevel, eine Grausamkeit und Feigheit. Vor allem aber ist
Wildern ein ganz niederträchtiger, gemeiner Diebstahl." (FUCHS 1938).
Manche Autoren, darunter auch OHMS (1937), bezeichnen den Wilderer schlicht-
weg als zweibeiniges Raubzeug.
Eine weitere Bezeichnung für Wilderer war ,,Freischütz". Diese Bezeichnung hatte
nichts mit seinem Freiheitsdrang zu tun. Der Begriff Freischütz stammt daher, daß
diese Personen mit Freikugeln meist aus einem Freigewehr schossen (ABERLE
1972). Was das Freigewehr oder die Freikugeln sind und wie diese hergestellt
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
13
wurden, wird im Kapitel 8.4 ,,Magie und Aberglaube" näher behandelt. Ein Frei-
schütz war also nicht unbedingt ein Wilderer. Jeder, der mit einem Freigewehr
schoß, war ein Freischütz.
Selbst zur Zeit des Dritten Reiches gab es unterschiedliche Anschauungen was die
Wilderer betraf. Reichsjägermeister Göring sah den Wilderer als ,,Schädling an der
Volksgemeinschaft", Hitler hingegen konnte eine gewisse Bewunderung gegen-
über diesen Personen nicht verbergen und betrachtete sie als ,,schneidige Bur-
schen, die sich was trauen".
Die gängisten Ausdrücke für Wilderer sind ,,Wildschütz" und ,,Raubschütz". Der ,,ed-
le Wildschütz" handelt nach weidmännischen Regeln, wogegen der ,,unedle Raub-
schütz" sich nicht an diese Regeln hält. Diese Unterscheidung schlägt sich auch im
Ansehen des Wilderers bei der Bevölkerung nieder.
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
14
3 Entwicklung der Wilderei
Die Motivation zur Wilderei änderte sich mit der Zeit. War in Notzeiten die Wilderei
schlichte Nahrungsbeschaffung, so hatte die Wilderei in Zeiten des Wohlstandes
ganz andere Bedeutung. Um die illegale Jagd verstehen zu können, muß man die
Entwicklung der Jagd und damit auch der Wilderei betrachten. Viele Autoren ha-
ben sich mit der Geschichte der Jagd und damit auch mit der Geschichte der Wil-
derei beschäftigt. Die folgenden Seiten sollen einen Überblick über die Geschichte
der Jagd und damit auch der Wilderei verschaffen.
3.1 Wilderei vor 1848
Vor der Einführung der Jagdgesetze durfte jeder jagen, daher gab es damals auch
keine Wilderei, das Wild gehörte niemanden. Später, als das Römische Recht galt,
herrschte der Grundsatz der Jagdfreiheit. Jeder konnte sich das Eigentum an Wild-
tieren erwerben. Der Grundeigentümer konnte die Jagd auf seinem Grund und Bo-
den nur dadurch verhindern, indem er das Betreten seines Grundes untersagte.
Den Tatbestand ,,Wilderei" gibt es daher erst seit der Einführung der ersten Jagd-
gesetze in Mitteleuropa. Nach altem Deutschen Recht stand das Recht zur Jagd
dem Grundeigentümer zu, bei Gemeinschaftsbesitz allen Mitgliedern der Gemein-
de. Auf Gebieten, die in niemandes Besitz standen, durfte jeder Freie jagen gehen,
Unfreie und Schutzbefohlene waren von der Erlaubnis des Herren abhängig. Der
König hatte das Recht auf materielle und nützliche Dinge sowie auf kostbare Tätig-
keiten. Die Jagd wurde als eine solche kostbare Tätigkeit angesehen. Darum durf-
te die Jagd vom gemeinen Mann nicht ausgeübt werden. Zunächst wurde den ers-
ten Jagdgesetzen kaum Beachtung geschenkt, da der König und damit das Gesetz
weit war. Allmählich eigneten sich die königlichen Beamten immer mehr Macht an,
und so wurden auch die Freiheiten, die sich der kleine Mann nahm, geringer. Der
Adel begann Wild zu hegen, welches immer mehr Schaden an den Feldern anrich-
tete. Dem Bauern war es untersagt zu jagen, und so entging ihm nicht nur das Wild
als Nahrungsgrundlage, sondern auch die Frucht seiner Felder, die durch das Wild
vernichtet wurde. Es ging sogar so weit, daß die Bauern Treiberdienste leisten
mußten und so die eigenen Felder zerstörten.
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
15
Die Bauern wollten aber weiterhin an der Jagd teilhaben. Menschen, die sich über
diese Gesetze hinwegsetzten waren bei der Bevölkerungen sehr beliebt. Da der
Adel der Meinung war, daß der einfache Mann zu arbeiten und nicht zu jagen ha-
be, wurden Gesetze erlassen und Strafen eingeführt, die die Wilderei einschränken
sollten.
Im Schwabenspiegel heißt es: ,,Kein Richter soll einem seinen Leib nehmen, weder
um Gewild, noch Vogel, noch um Fisch". So standen auf Wilderei 60 Solidi Geld-
strafe. Diese 60 Solidi waren zwar eine milde Strafe, und dennoch konnten die
meisten diese Strafe nicht zahlen. (ABERLE 1972; BINDER 1992)
Waren zu Beginn des Mittelalters die Strafen für Wilderei mild, so wurden die Stra-
fen gegen Ende des Mittelalters immer härter. Ein Wildfrevler wurde meist einige
Tage bei Wasser und Brot eingekerkert, außerdem mußte er schwören, nicht mehr
zu wildern. Ein zweites Mal bei der Wilderei erwischt zu werden, hatte meist zur
Folge, daß die Schwurhand abgehackt wurde. In Württemberg unter Herzog Ulrich
(1517) wurden einem Wildfrevler die Augen ausgestochen. In Bayern kam man mit
Löchern in den Ohren davon.
Nach dem Tod von Kaiser Maximilian im Jahr 1519 wurde angenommen, daß das
Wild wieder frei sei. Die Bevölkerung stellte dem Wild mit Knüppeln und mit der
Lanze nach. Als klar wurde, daß die Jagd doch nicht frei ist, forderten die Bauern
ein Gesetz, das die Jagd wieder für jedermann möglich machte. Dies wurde aber
nicht gewährt.
Erzbischof Guidobald von Salzburg erließ 1657, daß jemand, der bei ,,heimlicher
Fällung oder Schießung eines Wildbrets" betreten wurde, ein Hirschgeweih aufge-
setzt bekommen sollte und er den Schaden bei Bau- und Schanzarbeit abzubüßen
hatte. Die Wildererkappe war das gängigste Bestrafungsmittel für Wilderer. Dabei
wurde am Missetäter ein Stirnring mit ,,Tiergehörn" befestigt (ABERLE 1972).
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
16
Abb. 1: Wildererkappe (Schaustück im Wilderermuseum St. Pankraz)
1684 wurde es dem Adel in Kärnten untersagt, Jagden zu verpachten. Bauern,
Gewerke und die Ferlacher Büchsenmacher konnten Wild zu einem festgesetzten
Preis schießen. Zu dieser Zeit waren Trophäen und Schonzeiten kein Thema,
wichtig für den ,,einfachen Mann" war lediglich das Wildpret (MALLE 1997).
Um den Wilderer stellen zu können, wurde es am 7. 11. 1699 den österreichischen
Jägern gestattet, Wildschützen auf die Beine zu schießen.
Erzbischof Johann Ernest Graf von Thun (1687 1709), der als großer Liebhaber
der Jagd galt, wollte der Wilderei auf eine andere Art begegnen. Er verordnete,
daß alle Schießgewehre bei den Ämtern verzeichnet werden müssen. Wer den
Besitz des Gewehres verheimlichte, wurde ,,in Eisen und Banden" nach Salzburg
eingeliefert. Die Motivation, diese Verordnung zu erlassen, war vermutlich nicht in
erster Linie um der Wilderei zu begegnen. Vielmehr war man in der Lage die Be-
waffnung des Volkes festzustellen und somit diese zu kontrollieren, denn ein un-
bewaffnetes Volk ist weniger in der Lage sich aufzulehnen als ein bewaffnetes.
1701 wurde eine Belohnung von 18 Gulden für die Anzeige gegen einen Wilddieb
ausgesetzt. Für zehn Jahre außer Landes wurden diejenigen verwiesen, die Wild-
dieben Unterschlupf gewährten. Jäger, die Wilderer duldeten, wurden an den
Pranger gestellt. Auf die Galeere mußte ein Jäger, wenn er von der Erlegung eines
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
17
Wildes Kenntnis hatte und das nicht meldete. Die Galeerenstrafe kam meist einem
Todesurteil gleich, sie wurde zunächst in eine Leibesstrafe und 1709 in Militär-
dienst umgewandelt. Vermummte Wilderer waren zu dieser Zeit vogelfrei. Wilderer,
die Fasane einfingen oder töteten und dabei zum dritten Male erwischt wurden,
kamen lebenslänglich auf die Galeere. Der Fasan war damals Wild der Hohen
Jagd, die Haltung der Fasane zu Jagdzwecken war teuer. Steinbockwilderer wur-
den für vogelfrei erklärt und ihre Ergreifung mit 50 Gulden belohnt. Zum Teil waren
die Gesetze gegen Wilder zu dieser Zeit sehr streng. Sie wurden aber selten exe-
kutiert, daher waren sie fast immer wirkungslos. (WALDT 1928
;
ABERLE 1972;
PROSSINAGG 2001)
In der Jagd- und Fischereiordnung für Kärnten von 1732 wurden die Bestimmun-
gen über Schonzeiten festgesetzt. Maria Theresia versuchte die Wilderei mit einer
verschärften Verordnung (22. November 1752) einzuschränken. Sie machte einen
Unterschied in der Art des Vergehens und auch der Bestrafung: Dem professionel-
len Wilderer drohte ein Landesverweis und lebenslängliche Zwangsarbeit an den
Befestigungen der östlichen Monarchiegrenze, den fallweise Wildernden mehrmo-
natige bis mehrjährige Arbeit in eisernen Banden. Hehlern, Wildbretkäufern und
jene, die vom Diebstahl wußten, drohte die selbe Bestrafung.
Im 18. Jahrhundert wurde in manchen Gegenden das Tragen von Trophäen, also
Gamsbärten und Spielhahnfedern, verboten. Diese Zeichen von Männlichkeit nicht
tragen zu dürfen, traf die männliche Bevölkerung schwerer als so manch andere
Strafe. 1785 erließ Erzbischof Hieronymus von Salzburg, daß nur ,,Jäger und was
zur Jägerei gehörig dergleichen von laufendem und fliegendem Tier abgenomme-
ne Zeichen auf den Hüten oder sonsten zu tragen gestattet". Ein Vergehen dage-
gen wurde mit Kerker oder einer Geldbuße bestraft. Aufgehoben wurde dieser Er-
laß erst 1848.
1786 veröffentlichte Joseph II. eine neue Jagdordnung, welche alle bisherigen au-
ßer Kraft setzte. Das oberste Gebot war das absolute Besitzrecht, was die Ab-
schaffung der Schonzeit bedeutete. Weiters wäre mit Wilderern und dessen Heh-
lern und Käufern genauso zu verfahren wie mit Dieben. Bei Verdacht konnten
Hausdurchsuchungen durchgeführt werden. Im Jagdpatent von 1786 wurde die
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
18
Jagd als so eine tiefgreifende Leidenschaft dargestellt, daß sie im Stande war,
Bürger und Bauern von der Arbeit abzuhalten. Daher durfte die Jagd nur vom Adel
ausgeübt werden. Selbst Domherren durften ab 1787 kein Hochwild schießen, dies
war nur Jägern gestattet (ABERLE 1972
;
BINDER 1992; MALLE 1997;
PROSSINAGG 2001; WALDT 1928).
Das Wild verwüstete oft die kleinen Gärten, die zur Ernährung der sehr armen Be-
völkerung dienten. Das Wild durfte aber nur vom Landesherren und seinem Hofe
gejagt werden. Die Bevölkerung verriet gegenüber den Behörden nichts, wenn ille-
gal Wild erlegt wurde, da ,,die Fluren von dem häufig so lästigen Wilde gesäubert
wurden". Außerdem wurde so mancher hin und wieder mit Wildbret versorgt
(SCHÖNBERG 1835).
Obgleich es eine Vielzahl von Strafen gab, so wurden doch sehr oft ,,menschliche"
Urteile gegen Wilddiebe verhängt (ABERLE 1972). Oft war es, bedingt durch die
Mittellosigkeit des Wilderers, nicht möglich die Strafe einzubringen, so genügte so
manchem Richter das Versprechen, daß nicht mehr gewildert würde.
3.2 Wilderei von 1848 bis zum Ersten Weltkrieg
Laut ABERLE (1972) wimmelte es vor 1848 in den Wäldern von Wild. Was dem
Wanderer ein interessanter Anblick war, war für den Bauern, dem das Wild die
Ernte zerstörte, ein Problem. So mancher Beamte rühmte sich, Entschädigungen
für Wildschäden den Bauern nicht zu zahlen, um dadurch ein wenig Geld für den
Staat zu retten. Die Bevölkerung ging gegen das verhaßte Wild vor. In manchen
Gebieten war die Wilderei so häufig, daß das Wild beinahe ausgerottet wurde. Als
Beispiel sei hier der Pächter Joseph Marx angeführt, der sich 1842 bei der Herr-
schaft über das ,,leere ferlacher Revier" beschwerte, das er 1839 übernommen hat-
te. In diesem Revier kam es immer wieder zu Wilderei. Die Revolution von 1848
brachte die ,,Bauernbefreiung". Aus den Grundherren wurden Großgrundbesitzer,
die Adeligen behielten aber das Prestige der ,,Herrschaft". Nach der Revolution
konnten die Bauern erstmals nach mehreren Jahrhunderten wieder jagen, was sie
auch voll ausnützten. Bis Mitte den 19. Jahrhunderts wurde in allen Hollenburger
Revieren das Großraubwild ausgerottet, aber auch das Rotwild war vor der Ausrot-
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
19
tung nicht gefeit. 1852 wurde der letzte Hirsch der Karawanken am Singerberg er-
legt.
In Deutschland entstanden 1850 und 1855 neue Jagdgesetze, in denen der
Grundbesitzer ab einer bestimmte Größe jagdberechtigt war. Nun gab es viele Jä-
ger und wenig Wild, das wiederum verleitete, ins Nachbarrevier wildern zu gehen.
In Österreich dämmte man die Ausrottung schon 1849 durch ein Jagdpatent vom
07.03.1849 etwas ein
.
Danach hatte nur der Grundeigentümer das Jagdrecht, der
mindestens 200 Joch (115 ha) zusammenhängenden Boden besaß. Kleinere Flä-
chen wurden zu Gemeinderevieren zusammengefaßt. Auch Schonzeiten und er-
laubte Jagdarten waren in diesem Patent enthalten. Mit der Einführung des Forst-
gesetzes und des Waffenpatents im Jahr 1852 war es nicht mehr gestattet, ohne
Jagdkarte zu Jagen (ABERLE 1972; MALLE 1997; SIRNIK 1997
;
PROSSINAGG
2001
;
ZÖLLNER 1970).
Während des Ersten Weltkrieges waren die Wälder unbeaufsichtigt, wodurch die
Wilderei wieder zunahm. Mit dem Einsetzen des Ersten Weltkrieges und dem da-
mit verbundenen Schlechterwerden der Versorgungslage kam es auch zu Zusam-
menschlüssen von Wilderern. So taten sich auch ,,Mürzzuschlager gerne zusam-
men, um in unseren Revieren etwas Nahrung zu erlegen." Im Revier Kampalm des
Fürsten Liechtenstein kam es 1916 zu einer Schießerei zwischen Wilderern und
Jägern (REISMANN 1997; SIRNIK 1997).
BUSDORF (1993) schreibt, daß in Teilen Deutschlands, in denen es zu vermehrter
Wilderei kam, Soldaten zur Wildererbekämpfung eingesetzt wurden. Diese ,,Kom-
mandojäger" waren während des Ersten Weltkrieges ausschließlich zum Jagd-
schutz eingesetzt.
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
20
3.3 Wilderei in der Zwischenkriegszeit
Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war besonders hart, und so holten sich die
Menschen aus dem Wald, was ihnen ihrer Meinung nach zustand, was ihnen aber
von Rechts wegen nicht gehörte. Es war durchaus üblich, daß die karge Nahrung
durch illegal erlegtes Wildbret aufgebessert wurde. Die Haftstrafen waren nicht ab-
schreckend, denn: ,,Deswegen sind sie oft eingesperrt worden. Im Winter hat ihnen
das nichts gemacht, denn im Gefängnis haben sie etwas zu fressen bekommen."
(GIRTLER 1988)
Zu ,,ungeahnter Blüte" kam die Wilderei nach DACHS (1998) im deutschen
Reichsgebiet nach dem Ersten Weltkrieg. Durch den Krieg hatten die Männer nicht
nur schießen gelernt, sondern auch die Scheu verloren, die Waffen gegen Men-
schen zu richten. Die Not dieser Zeit trieb die Menschen zur Nahrungsbeschaffung
oft in den Wald.
Auch BUSDORF (1993) bemerkt, daß die Wilderei nach dem Ersten Weltkrieg zu-
nahm. Gewehre und Pistolen standen vermehrt zur Verfügung, so verstärkte sich
nicht nur die Wilderei, sondern auch folgenschwere Zusammenstöße mehrten sich.
Trafen pflichtbewußte, um nicht zu sagen, übereifrige Jäger und unerschrockene,
manchmal auch skrupellose Wilderer aufeinander, so kam es oft zu regelrechten
Gefechten. Die bekanntesten beschreibt GIRTLER (1988) sehr ausführlich und
versucht beide Seiten darzustellen. Es handelt sich dabei um den ,,Kampf auf der
Mayralm" und die ,,Wildererschlacht in Molln". In beiden Geschichten weist
GIRTLER auf die Not der damaligen Zeit hin.
Die Geschichte um den Kampf auf der Mayralm beginnt 1923 mit einem Zusam-
menstoß zwischen einem Jäger und einem Wilderer, bei dem der Wilderer im Ge-
sicht verletzt wurde. Der Wilderer schwor Rache. Die Wilderer dieser Gegend wil-
derten nun immer häufiger und so auffällig, daß die Jäger davon erfahren mußten.
An einem Herbsttag, an dem die Wilderer den ganzen Tag wilderten, machten sich
die Ordnungshüter auf, um dem Treiben ein Ende zu setzten. An diesem Tag kam
es zum Schußwechsel, welcher auf beiden Seiten ein Todesopfer forderte. Um
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
21
wen es sich bei den anderen Wilderern gehandelt hat, weiß man bis heute nicht
mit Sicherheit.
Der wohl bekanntere Vorfall, die Wildererschlacht in Molln, ereignete sich im März
des Jahres 1919. Die oberösterreichische Landesregierung wollte den Hunger der
Bevölkerung lindern und hatte den Abschuß des ,,überschüssigen" Wildprets ange-
ordnet. Die meisten Jäger kamen dem aber nicht nach, und so sah sich so man-
cher Nichtjäger berechtigt zu wildern. Es kam immer wieder zu Zusammenstößen,
bei denen im Oktober 1918 ein Förster und im Jänner 1919 ein Wilderer sein Le-
ben lassen mußte. Die Wilderer hatten sich zu Gruppen zusammengetan und gal-
ten als verwegen. Die meisten Jäger mieden ein Zusammentreffen mit solchen
Gruppen. Am 13. März 1919 wurden fünf bekannte Wilderer im Auftrag der oberös-
terreichischen Landesregierung festgenommen und sollten per Zug von zwei Gen-
darmen ins Kreisgericht Steyr überstellt werden. Daraufhin machten sich andere
Wilderer auf, um ihre Gesinnungsgenossen zu befreien. Ein Telegramm, das als
Warnung für die Gendarmen gegolten hatte, wurde falsch gedeutet. Die Gendar-
men nahmen an, daß weitere Wilderer gefangengenommen worden waren. Für die
Wilderer war es daher ein leichtes, die Gefangenen zu befreien. Die Befreiung hat-
ten sie in einem Gasthaus ausgiebig gefeiert. Inzwischen machten sich Gendar-
men aus der Gegend mobil. Fünfzig Gendarmen umstellten das Wirtshaus, und
weitere sechzehn betraten selbiges. Im darauffolgenden Gemenge wurde ein
Gendarm von einem Glassplitter am Auge getroffen und verstarb am nächsten Ta-
ge daran. Der Gendarmeriemajor befahl ,,Waffengebrauch". Nach dieser Schlacht,
in der mit Aschenbechern, Tisch- und Sesselbeinen und allem, was zur Hand war,
gekämpft wurde, gab es zahlreiche Verletzte, und drei Menschen hatten ihr Leben
verloren. Einen weiteren Wilderer stöberte man in einem Bauernhof auf. Bei seiner
Verhaftung stürzte er sich angeblich in das Bajonett eines Gendarmen. Ein einzi-
ger Wilderer entkam, weil er sich während des Scharmützels in einem Ofen ver-
steckt hatte. Die Gendarmerie kam in Verruf, und es wurde von ,,Behördenwillkür"
gesprochen. Viele Arbeiter legten aus Protest ihre Arbeit nieder.
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
22
Gerade in der Zwischenkriegszeit waren die Begegnungen zwischen Jägern und
Wilderern von besonderer Brutalität gekennzeichnet. Dennoch wurden Ausnahmen
gemacht, wenn man gemeinsame Interessen hatte. Manche Förster und Jäger, die
zu dieser Zeit mit Nationalsozialisten sympathisierten, sicherten häufig Wilderern,
die ebenfalls illegale Nationalsozialisten waren, Hilfe zu (GIRTLER 1988).
3.4 Wilderei im Dritten Reich und während des Zweiten
Weltkrieges
1938 erlangte das Reichsjagdgesetz in Österreich Geltung. Hitler haßte die Jäger
und bezeichnete sie als ,,grüne Freimaurer" und so waren Angelegenheiten in Sa-
chen Jagd für Hitler nicht wichtig. Doch Reichsjägermeister Göring setzte seine
jagdlichen Anliegen selbst gegen Hitler durch. ,,Am 21. Februar 1938 hatten der
Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium Heinrich
Himmler und der Reichsjägermeister Hermann Göring, der spätere Reichsmar-
schall, in einem Erlaß Pol.S.Kr.1 Nr. 1640/37 und R 441
- den Wilderer folgen-
dermaßen definiert: ,Der Wilderer ist ein Schädling an der Volksgemeinschaft, der
gewerbs- und gewohnheitsmäßige Wilderer ein Verbrecher, der erfahrungsgemäß
auch auf Menschenleben keine Rücksicht nimmt und daher eine ständige Gefahr
für die Beamten der Forst- und Jagdbehörden und der Polizei bedeutet.`" Eine ver-
schärfte Gangart gegen die Wilderei war nun die Folge (DACHS 1998). Die Strafen
waren höher, und der Wilderer mußte damit rechnen, daß der Jäger wesentlich
härter vorging, denn er war zum Beispiel berechtigt, ohne Warnung auf den Wild-
dieb zu schießen (DREHER 2000; GIRTLER 1988).
BRÜTT (1987) stellt fest, daß selbst die Machthaber des Dritten Reiches machtlos
gegen die Wilderei waren.
,,Das Reichsjagdamt wies 1944 darauf hin, daß mit der
Dauer des Krieges die Wilderei aus verschiedenen Gründen laufend zunehme ... ."
Die Nationalsozialisten fürchteten nicht die Wilderei an und für sich, sondern die
Kontakte der Wilderer. Ein Hinweis dafür ist, daß sozialdemokratische Wilderer
verhaftet wurden und Wilderer, die mit den Nationalsozialisten sympathisierten, in
,,führende Positionen" aufrückten. Es war bekannt, daß die Wilderer oft über ein
sehr gut funktionierendes Untergrundnetz verfügten. Die Angst der Diktatoren war,
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
23
daß dieses Untergrundnetz nicht nur der Wilderei, sondern auch dem Widerstand
dienen könnte. Die ,,illegale Jagd" galt als ,,Verrat am deutschen Volke".
Zur Bekämpfung des Wildererunwesens wurde eine Geldbelohnung ausgesetzt.
Dies sollte dazu dienen, daß die Bevölkerung die Jagdschutzbeamten bei der Wil-
dererbekämpfung unterstützt (BRÜTT 1987).
Göring stellte die Todesstrafe auf Wilderei. Doch auch Göring hatte mit dieser
Maßnahme nicht den erhofften Erfolg. Die Wilderei gab es weiterhin. Wenn der
Jagdausübungsberechtigte von der Not des Wilderers überzeugt war, so ließ er ihn
meist laufen.
Ihren Fertigkeiten, die sie sich als Wilderer angeeignet hatten, verdankten zumin-
dest fünf Häftlinge aus Dachau, wo es eine eigene ,,Wildererbaracke gegeben ha-
ben soll, ihr Leben. Sie wurden mit ,,Himmelfahrtskommandos" betraut. Die Wilde-
rer aus Dachau mußten hinter den feindlichen Linien operieren. Sie hatten die
Wahl: Himmelfahrtskommando oder den Tod in Dachau (LIST 1986 Kap III).
3.5 Wilderei in der Nachkriegszeit
Während die heimische Bevölkerung wieder einmal zur Nahrungsbeschaffung ille-
gal dem Wild nachstellte, standen bei den Besatzungssoldaten Trophäen hoch im
Kurs. Meist benutzten sie nichteinmal Jagdwaffen, sondern schossen auf alles
Wild, das ihnen vor die Maschinenpistole kam. Im Gegensatz zur Zwischenkriegs-
zeit gab es nach dem Zweiten Weltkrieg sehr scharfe Bestimmungen über den
Waffenbesitz. Die Bevölkerung mußte alle Waffen abgeben, auf Waffenbesitz
stand während der Besatzungszeit die Todesstrafe. Nicht nur der Privatmann muß-
te seine Waffen abgeben, auch den Jagdbeamten war nur eine bestimmte Anzahl
von Waffen erlaubt. Die Folge war vermehrte Schlingenstellerei und das illegale
Fallenstellen. Die Zusammenstöße von Wilderern und Jagdaufsicht waren daher
auch weniger. Erst mit dem steigenden Wohlstand wurde wieder zur Büchse ge-
griffen, die Wilderei ebbte dann aber sehr rasch ab. Die Urteile, die nach dem
Zweiten Weltkrieg über Wilderer verhängt wurden, waren ähnlich mild wie vor dem
Krieg (BRÜTT 1987
;
BUSDORF 1993
;
DACHS 1998; GIRTLER 1988).
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
24
3.6 Welchen Stellenwert hat die Wilderei heute?
Bis in die fünfziger Jahre war die Not das Leitmotiv für die Wilderei. Die Wilderei
verliert gesamtgesellschaftlich in den späten fünfziger Jahren an Bedeutung
(GIRTLER 1988). Für DACHS (1998) hat die Wilderei heute noch einen Hauch von
Romantik und wird durch die ,,rosarote Brille gesehen". Die Wilderei heutzutage
dient meist nicht mehr der Nahrungsbeschaffung, auch ist sie nicht mehr als Auf-
lehnung gegen die Obrigkeit gedacht. Sehr oft sind die Wilderer von heute
Jagdausübungsberechtigte, die in einem fremden Revier jagen oder Wild schießen
und dieses nicht deklarieren. Manchmal sind es ehemalige Jäger, denen die Jagd-
karte entzogen wurde und die ihrer Jagdleidenschaft nicht widerstehen können.
Ein solcher Vorfall wurde im Kurier am 2. September 2000 beschrieben, wo ein
Jäger in das Nachbarrevier auf die Pirsch ging. Aber auch Wilddiebstahl im großen
Rahmen kommt noch vor. So konnte man ebenfalls im Kurier vom 10. November
2000 lesen, daß ungefähr 30 Rehe im Burgenland als gestohlen gelten.
Blutige Konfrontationen von Jägern und Wilderern kommen heutzutage glückli-
cherweise kaum noch vor. GIRTLER (1988) ist der Meinung, daß sich der ,,einfa-
che Mann" durch die Wilderei auf die gleiche Stufe mit dem Jagdherren stellte. Der
Jäger war nur der Untertan. Heute steht aber der Jäger auf der selben Stufe wie
Doktoren, Hofräte und Adelige, daher besteht eigentlich nicht mehr die Notwendig-
keit zu wilderen. Da heute jeder Jäger werden kann, hat der Wilderer die gesamte
Bevölkerung gegen sich.
Diese Ansicht kann ich nicht teilen. Bei Gesprächen mit Jägern, die ihrer Ansicht
nach einfache Leute, also Bauern und Arbeiter, sind, ließ man immer wieder
durchblicken, daß die oben angesprochenen Doktoren, Hofräte und Adelige doch
noch ,,eine Stufe höher stünden". Das Empfinden ist, daß der Jäger nur schießen
darf, was ihm erlaubt wird. Der Wilderer aber schießt was er schießen will.
Das heutige Wildern hat nichts mehr mit dem einstigen Wildern zu tun. Meist han-
delt es sich um Pirschen innerhalb der Schonzeit oder außerhalb der eigenen Re-
viergrenzen. Den legendären ,,Kick" holen sich die meisten jungen Burschen nun
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
25
nicht mehr in der Wilderei, sondern beim Klettern, als Schilehrer oder als wilde Au-
toraser (GIRTLER 1988).
Auch SIRNIK (1997) stellt fest, daß es in den Karawanken seit 1960 fast keine
Wilderei mehr gibt. Als Gründe werden ein höherer Lebensstandard, weniger Wild
und mehr Jagdaufsicht genannt. Er ist auch der Meinung, daß die Toleranz der
Bevölkerung gegenüber den Wilderern nicht mehr vorhanden ist.
DREHER (2000) ist, in seiner doch sehr emotional dargestellten Schilderung über
den Raubschützen, der Meinung, daß es der Raubschütz und der ,,Jäger als Wilde-
rer" ist, der den Personenkreis darstellt, der die Justiz heute beschäftigt, wenn es
sich um Wilderei handelt. Dem Jäger als Wilderer sind strafrechtliche Sanktionen,
also Geldstrafen, meist gleichgültig, da diese Personen sehr oft in ,,gutdotierten
Berufen" tätig sind. Ein Entzug der Jagdkarte wäre, seiner Meinung nach, wesent-
lich schmerzlicher.
Meine Untersuchungen über die Häufigkeit der Wilderei von 1928 bis 1999 (vgl.
Abb. 18) decken sich mit der Aussage von Frau HAIDEN vom Bezirksgericht
Neunkirchen (NÖ) und Frau PAWEL vom Landesgericht Wiener Neustadt (NÖ)
wonach nur noch sehr selten Wilderei auftritt. Frau HAIDEN ist in ihren 20 Dienst-
jahren kein Fall bekannt. Frau PAWEL weiß von einem Fall von Niederwildwilderei
seit 1960. Beide bestätigen aber mehrere Fälle von Fischwilderei. Die im Bezirks-
gericht Salzburg tätige Frau GASSNER weiß nur von einem illegalen Auerhahnab-
schuß in den letzten 10 Jahren.
Deutlich kann man in Abbildung 18 erkennen, daß die Wilderei seit ca. 1950 deut-
lich nachgelassen hat. ZEILER (1996) bemerkt, daß sich die Zahl der Jagdkarten-
besitzer ausgehend von 1948 verdoppelt hat. Das bedeutet, daß jeder, der gewillt
ist die Jagd auszuüben das auf legalem Wege kann. Es ist also nicht mehr not-
wendig wildern zu gehen, man kann sich offiziell eine Jagdkarte lösen.
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
26
4 Die Motivation zum Wildern
Die Frage der Motivation, warum konkret dieser oder jener gewildert hat oder noch
immer wildert, ist schwierig zu beantworten. Um zu verstehen, was Menschen wil-
dern läßt und damit in die Illegalität treibt, muß man die gesellschaftliche Stellung,
das Umfeld, die berufliche Ausbildung und auch die Bräuche der Herkunftsgebiete
dieser Menschen betrachten.
Aus zahlreichen Gesprächen mit Betroffenen konnte ich auf einige Motive schlie-
ßen, obwohl die Antworten der Befragten eher zurückhaltend und nicht ganz klar
waren. Die Motive der Wilderer sind somit Nahrungsbeschaffung, Geldbeschaf-
fung, Trophäen, Ansehen und Rache.
Das Motiv Nahrungsbeschaffung ist in der Vergangenheit begründet. In früheren
Zeiten sicherte so manch erwildertes Wildbret das Überleben der Familie. Heute
hat es kaum noch Bedeutung. In der Wohlstandsgesellschaft ist die direkte Nah-
rungsbeschaffung in den Hintergrund getreten.
Das Hauptmotiv des gewerbsmäßigen Wilderers ist die Geldbeschaffung. Er hat
kein Interesse daran Wildbret selbst zu verzehren oder sich Trophäen anzueignen.
Er will das Wild weiterverkaufen.
Trophäen, die ein Wilderer vorzeigen konnte, stellten diesen mit einem Jäger
gleich. Er demonstrierte damit auch seine soziale Position, obwohl er legal von der
Jagd ausgeschlossen war. Der Gamsbart war das Symbol für jemanden, der sich
holen kann was er will, auch wenn es ihm nicht zustand. Den Mut hatte ein junger
Mann erst unter Beweis gestellt, wenn er eine erwilderte Trophäe vorweisen konn-
te. Durch diese Tat stieg er im Ansehen der Bevölkerung.
Das Gefühl der Rache ist für viele Taten der Menschen Triebfeder gewesen
manchmal auch für den Wilderer. Wurde zum Beispiel ein Jäger entlassen, so kam
es vor, daß er seinem früheren Arbeitgeber, das ,,Revier leerschoß".
Motive und Auswirkungen der Wilderei Mitteleuropas in Vergangenheit und Gegenwart
27
KLEWIG (1937) unterstellt dem Menschen eine ,,angeborene Lust am Waidwerk"
und erklärt damit die Hauptmotivation des Wilderns. Er versucht seine Behauptung
an Hand von William Shakespeare zu untermauern. Ihn verleiteten ,,einige verwe-
gene Kumpane seiner Jugend des öfteren zum Wildern". Er ging seiner verbotenen
Jagdlust in den Besitzungen von Sir Thomas Lucy nach. Die Bevölkerung stand
mit Lucy, einem geizigen und stolzen Mann, auf Kriegsfuß. Shakespeare wurde
ertappt und verurteilt. Die Strafe war nach Shakespeares Meinung zu hoch und
so rächte er sich mit Spottgedichten, die er an das Tor von Lucys Landsitz heftete.
Um nicht gefaßt zu werden ging Shakespeare nach London.
Interessant zu bemerken ist, daß KLEWIG jedem Menschen diese Lust zuschreibt
und nicht, wie andere Autoren seiner Zeit, nur bestimmten Bevölkerungsgruppen.
Existiert dieser angeborene Jagdtrieb wirklich? Meiner Meinung nach gibt es den
angeborenen Jagdtrieb nicht, denn, wenn man sich überlegt, daß doch der Groß-
teil der Bevölkerung weder der Jagd nachgeht noch wildert, wohin ist dann dieser
Urinstinkt bei den meisten Menschen verschwunden? Naheliegend ist, daß der
sogenannte ,,Jagdtrieb des Menschen" nur als Ausrede für Jagd und Wilderei ver-
wendet wird, nicht aber eine wirkliche Erklärung dafür ist.
Es ist wichtig der Frage der Motivation nachzugehen, denn erst wenn man sich
bewußt ist, warum gewildert wird, kann der Wilderei konkret begegnet werden, und
zwar schon bevor die Tat begangen wird. Man kann sie schon dadurch verhindern,
indem man auf Motive, die oft schon vor der Tat erkennbar sind, sensibilisiert ist
und dadurch rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreift.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783836607414
- DOI
- 10.3239/9783836607414
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität für Bodenkultur Wien – unbekannt, Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2007 (Dezember)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- mitteleuropa wilderei geschichte wildschütz raubschütz freischütz jagd
- Produktsicherheit
- Diplom.de