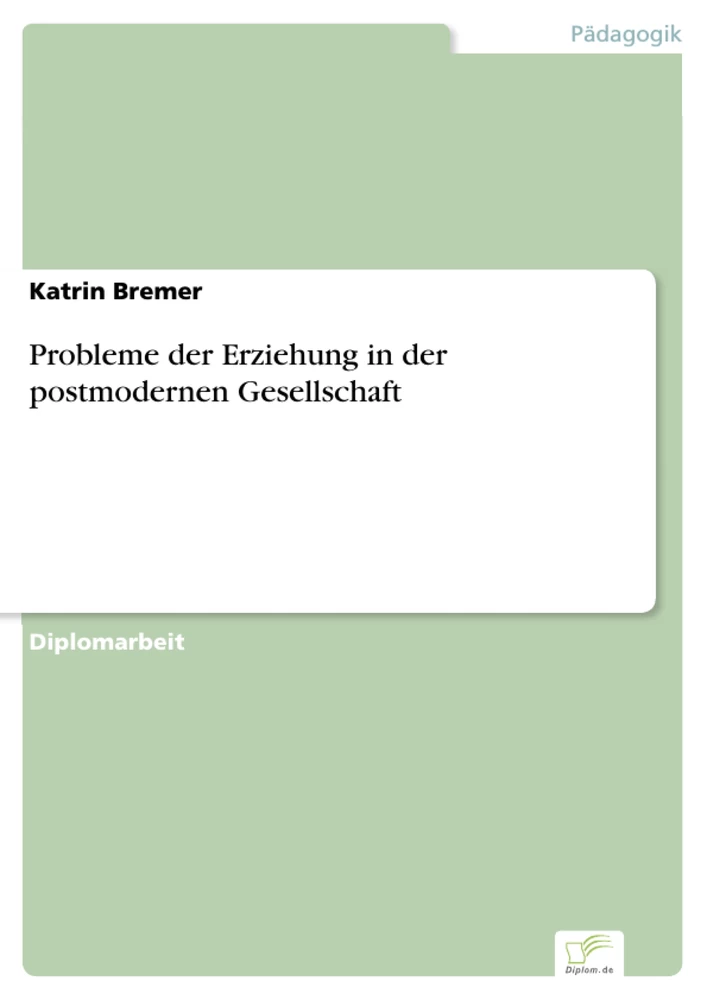Probleme der Erziehung in der postmodernen Gesellschaft
©2007
Diplomarbeit
95 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Aktuelle Problematiken in den Bereichen Erziehung, Bildung und der sozialen Arbeit werden uns tagtäglich in den Medien und im sozialen Miteinander aufgezeigt.
In meiner aktuellen Diplomarbeit bin ich auf ein breites Spektrum erzieherischer, soziologischer und sozialarbeiterischer Probleme eingegangen.
Diese Diplomarbeit versteht sich als ein Gedankenanstoß für Studenten und auch Unternehmen, welche hieraus weitere Arbeiten bzw. Projekte entwickeln können. Beispiele für Arbeitsbereiche, welche dringend benötigt werden sind in meiner Arbeit bereits enthalten. Hierzu zählen: Neue Ansätze der Schulsozialarbeit / Schulsozialpädagogig, Entwicklung neuer Projekte am Beispiel: "Resilienzförderung", Ganzheitliche Betrachtungsweise eines Problemfeldes am Beispiel: Alkoholsucht, Mediation und Empowerment als zentrale Methoden und Ernährungsberatung als neues Aufgabenfeld.
Eine ganzheitliche Betrachtung mit historischen Rückschlüssen und zukunftsorientierten Ansätzen war mir während der Bearbeitung von großer Bedeutung.
Durch mannigfaltige Auseinandersetzung in meinem Arbeitsbereich, soziale Arbeit, bemerkte ich das plötzliche Auftreten von Problemfeldern.
Jedoch erkannte ich schnell, dass die Hintergründe und der Zweck dieser plötzlichen Vielzahl an Problemfelder in der Öffentlichkeit nicht hinreichend diskutiert und aufgeklärt wurden. Um einen Bezug zu diesen defizitär orientierten Bild zu bekommen, wollte ich die historischen Hintergründe untersuchen. Hierdurch habe ich den Wandel in der Gesellschaft hervorgehoben und die Probleme anhand dessen begreiflich und handhabbar gemacht.
Mein Ziel ist und war es, die Problemfelder, welche durch den gesellschaftlichen Wandel über unsere Klienten auf die soziale Arbeit zukommen, zu verdeutlichen und Anregungen für die weitere Diskussion zu liefern.
Gang der Untersuchung:
Historisch beginne ich meine Arbeit mit der Moderne. Diesen Zeitpunkt habe ich gewählt, um den Prozess der Entwicklung zur postmodernen Gesellschaft zu beschreiben.
Als Zweites habe ich den Zeitraum ab dem Ende der 60er Jahre hinein betrachten, hier hat sich in unserer Gesellschaft grundlegendes verändert. Diese Veränderungen, auf die ich in der Diplomarbeit näher eingehen werde, waren die Wegbereiter für die Anfänge der postmodernen Gesellschaft.
Die Veränderungen in der postmodernen Gesellschaft spiegeln sich besonders in der Umformung und Neuorientierung der Pädagogik und der sozialen Arbeit wieder. Deshalb habe […]
Aktuelle Problematiken in den Bereichen Erziehung, Bildung und der sozialen Arbeit werden uns tagtäglich in den Medien und im sozialen Miteinander aufgezeigt.
In meiner aktuellen Diplomarbeit bin ich auf ein breites Spektrum erzieherischer, soziologischer und sozialarbeiterischer Probleme eingegangen.
Diese Diplomarbeit versteht sich als ein Gedankenanstoß für Studenten und auch Unternehmen, welche hieraus weitere Arbeiten bzw. Projekte entwickeln können. Beispiele für Arbeitsbereiche, welche dringend benötigt werden sind in meiner Arbeit bereits enthalten. Hierzu zählen: Neue Ansätze der Schulsozialarbeit / Schulsozialpädagogig, Entwicklung neuer Projekte am Beispiel: "Resilienzförderung", Ganzheitliche Betrachtungsweise eines Problemfeldes am Beispiel: Alkoholsucht, Mediation und Empowerment als zentrale Methoden und Ernährungsberatung als neues Aufgabenfeld.
Eine ganzheitliche Betrachtung mit historischen Rückschlüssen und zukunftsorientierten Ansätzen war mir während der Bearbeitung von großer Bedeutung.
Durch mannigfaltige Auseinandersetzung in meinem Arbeitsbereich, soziale Arbeit, bemerkte ich das plötzliche Auftreten von Problemfeldern.
Jedoch erkannte ich schnell, dass die Hintergründe und der Zweck dieser plötzlichen Vielzahl an Problemfelder in der Öffentlichkeit nicht hinreichend diskutiert und aufgeklärt wurden. Um einen Bezug zu diesen defizitär orientierten Bild zu bekommen, wollte ich die historischen Hintergründe untersuchen. Hierdurch habe ich den Wandel in der Gesellschaft hervorgehoben und die Probleme anhand dessen begreiflich und handhabbar gemacht.
Mein Ziel ist und war es, die Problemfelder, welche durch den gesellschaftlichen Wandel über unsere Klienten auf die soziale Arbeit zukommen, zu verdeutlichen und Anregungen für die weitere Diskussion zu liefern.
Gang der Untersuchung:
Historisch beginne ich meine Arbeit mit der Moderne. Diesen Zeitpunkt habe ich gewählt, um den Prozess der Entwicklung zur postmodernen Gesellschaft zu beschreiben.
Als Zweites habe ich den Zeitraum ab dem Ende der 60er Jahre hinein betrachten, hier hat sich in unserer Gesellschaft grundlegendes verändert. Diese Veränderungen, auf die ich in der Diplomarbeit näher eingehen werde, waren die Wegbereiter für die Anfänge der postmodernen Gesellschaft.
Die Veränderungen in der postmodernen Gesellschaft spiegeln sich besonders in der Umformung und Neuorientierung der Pädagogik und der sozialen Arbeit wieder. Deshalb habe […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Katrin Bremer
Probleme der Erziehung in der postmodernen Gesellschaft
ISBN: 978-3-8366-0508-3
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, Bochum, Deutschland,
Diplomarbeit, 2007
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
Widmung
Ich widme diese Diplomarbeit all denen, die mich unterstützt haben und an mich
glauben.
Besonderer Dank gilt meinen ehemaligen engagierten Professorinnen und Profes-
soren, meinem ehemaligen Deutschlehrer für das gewonnene Selbstvertrauen, mei-
nen Eltern für ihre Fürsorge und der Korrektur meiner Fehler, meiner kleinen klu-
gen Schwester Anna, meiner lieben Oma und ihrem Freund für ihre Unterstützung
in allen Lebenslagen, meiner Patentante Claudia, die mir Halt gegeben hat, meinen
Tanten und meinem Onkel, für die schöne gemeinsame Zeit, meinen Kommilito-
nen, ohne die ein Studium sinnlos wäre, meinen besten Freundinnen für das La-
chen, natürlich meinem lieben Freund und pädagogisch wertvollsten Kampfkunst-
trainer Martin Schmalenberg, seinen Eltern und Freunden, die immer zu mir gehal-
ten haben, dem Diplomica-Verlag, welcher diesen Druck erst möglich gemacht
hatte und den künftigen Lesern dieser Diplomarbeit, welche hoffentlich diesen
Worten Taten folgen lassen. Zuletzt möchte ich noch an diejenigen erinnern, wel-
che nicht mehr unter uns weilen und doch bis heute ein Vorbild für mich und ande-
re sind: ,,Ich danke euch!" All diejenigen die ich vergessen habe, sollen nun hier
Platz finden ,,Vielen herzlichen Dank"!
Ein Dank ist mehr als nur Worte.
Er muss aus dem Herzen kommen, um gehört zu werden!
Eure Kati
3
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis... 3
Einleitung... 7
1.
Die postmoderne Gesellschaft ... 11
1.1.
Einführung in den Begriff der Moderne ... 11
1.2.
Einführung in den Begriff der Postmoderne... 12
1.2.1. Unsere
Gesellschaft ... 14
1.2.2. >>Anything goes<< ... 15
1.2.3. Mobilisierung, Säkularisierung und die soziale
Differenzierung... 16
1.2.4. Individualisierung und soziale Ungleichheit ... 17
1.2.5. Bastelbiografien ... 19
1.2.6. Das universelle Expertentum ... 20
1.2.7. Glaubensfragen ... 21
1.2.8. Die
Familie ... 23
1.2.9. Die neue Mutter- / Vaterrolle... 25
1.2.10. Der demographische Wandel... 27
2.
Die Erziehung in der postmodernen Gesellschaft... 29
2.0.
Die Erziehung ... 29
2.1.
Erziehung in der Moderne ... 31
2.2.
Neue Anforderungen an die Erziehung durch die
postmoderne Gesellschaft ... 36
2.2.1. Anforderungen ... 37
2.2.2. Erziehungsziele... 38
2.2.3. Erziehung zur Autonomie... 40
4
2.2.4. Lebensräume... 42
2.2.4.1. Familienkindheit ... 44
2.2.4.2. Freizeitkindheit ... 46
2.2.4.3. Öffentliche bzw. Institutionen Kindheit ... 49
2.2.5. Erziehungsstile... 50
3.
Aktuelle Problemfelder... 53
3.0.
Problemanalyse ... 53
3.1.
Aktuelle Herausforderungen... 55
3.2.
Das Schulwesen ... 56
3.3.
Interkulturelle und ,,antirassistische" Pädagogik ... 59
3.4.
Neue Medien / Medienpädagogik... 62
3.4.1. Permissivkultur versus staatliche Verbote? ... 65
3.5.
Geschlechterverhältnis / Gender ... 66
3.6.
Gesundheitserziehung ... 67
3.6.1. Ernährung... 68
3.6.2. Bewegung ... 70
3.6.3. Prävention ... 71
3.7.
Zusammenarbeit der Generationen ... 72
4.
Folgen für die soziale Arbeit ... 75
4.0.
Die Entwicklung der soziale Arbeit... 75
4.1.
Neue Ansätze der Schulsozialarbeit /
Schulsozialpädagogik ... 77
4.2.
Entwicklung neuer Projekte, am Beispiel
,,Resiliensförderung"... 78
4.3.
Ganzheitliche Betrachtungsweise eines Problemfeldes
am Beispiel: Alkoholsucht... 79
4.4.
Mediation und Empowerment als zentrale Methoden ... 82
4.5.
Ernährungsberatung als neues Aufgabenfeld... 85
5.
Schlussbetrachtung ... 87
5
6.
Literaturverzeichnis... 91
7.
Sonstige Quellen:... 97
7.1.
Internet ... 97
7.2.
Zeitschriften ... 97
7.3.
Zeitungen ... 98
7
Einleitung
Aktuelle Problematiken in den Bereichen Erziehung, Bildung und der sozia-
len Arbeit werden uns tagtäglich in den Medien und im sozialen Miteinan-
der aufgezeigt. Auch in meiner Praxistätigkeit, im Rahmen meines Prakti-
kums im Jugendfreizeithaus und Projekten mit Kindern und Jugendlichen,
beobachtete ich die Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich, sei es
von Seiten der Eltern, die mit Fragen zu mir kamen oder auch durch die
Kinder und Jugendlichen selbst. Dadurch bemerkte ich, dass die Hinter-
gründe und der Zweck dieser plötzlichen Vielzahl an Problemfelder in der
Öffentlichkeit nicht hinreichend diskutiert werden. Um einen Bezug zu die-
sen defizitär orientierten Bild zu bekommen, möchte ich die historischen
Hintergründe untersuchen. Hierdurch werde ich den Wandel in der Gesell-
schaft hervorheben und die Probleme anhand dessen begreiflich und hand-
habbar machen.
Mein Ziel ist es, die Problemfelder, welche durch den gesellschaftlichen
Wandel über unsere Klienten auf die soziale Arbeit zukommen, zu verdeut-
lichen und Anregungungen für die weitere Diskussion zu liefern.
Historisch beginne ich meine Arbeit mit der Moderne. Diesen Zeitpunkt
habe ich gewählt, um den Prozess der Entwicklung zur postmodernen Ge-
sellschaft zu beschreiben.
Als Zweites werde ich den Zeitraum ab dem Ende der 60er Jahre hinein
betrachten, hier hat sich in unserer Gesellschaft Grundlegendes verändert.
Diese Veränderungen, auf die ich näher eingehen werde, waren die Wegbe-
reiter für die Anfänge der postmodernen Gesellschaft.
Die Veränderungen in der postmodernen Gesellschaft spiegeln sich beson-
ders in der Umformung und Neuorientierung der Pädagogik und der sozia-
len Arbeit wieder. Deshalb will ich mein Augenmerk auf sie richten und
auch ihre Prägung historisch von der Moderne bis in die Gegenwart hinein
beschreiben.
8
,,Nun lassen sich aber zwey verschiedene Arten denken, wie der
Mensch in der Zeit mit dem Menschen in der Idee zusammentreffen,
mithin eben so viele, wie
d
er Staat in den Individuen sich behaupten
kann: entweder dadurch, daß der reine Mensch den empirischen un-
terdrückt, daß der Staat die Individuuen aufhebt; oder dadurch, daß
das Individuum Staat wird, daß der Mensch in der Zeit zum Men-
schen in der Idee sich veredelt." (Schiller, 1793 / 15)
Meine Arbeit gliedert sich in vier Teile:
Im ersten Teil werde ich den Begriff der Moderne und der postmodernen
Gesellschaft erklären und die daraus resultierenden gesellschaftlichen Ver-
änderungen beleuchten. Die Gesellschaft im sozialem Wandel wird hier im
Focus stehen. Ich möchte herausfinden in welcher Gesellschaft wir leben
und welche Entwicklung diese beschreitet.
Zweitens möchte ich mit einer Betrachtung der Pädagogik bis in die 50er
Jahre hinein beginnen, um ihre Entwicklung zu verdeutlichen. Hierzu werde
ich das damalige Grundverständnis der Pädagogik skizzieren. Zudem werde
ich einen kurzen Rückblick auf die jeweiligen Gesellschaftsordnungen vor-
nehmen.
Danach werde ich den Zeitraum, ab Ende der 60er, Mitte der 70er Jahre bis
in die heutige Zeit hinein betrachten um hier einen Blick auf den grundle-
gendsten gesellschaftlichen Wandel zu werfen und daran die notwendigen
stattgefundenen Veränderungen in der Pädagogik zu beschreiben.
Um die Adressaten der pädagogischen Arbeit, hier gehe ich auf Kinder und
Jugendliche ein, zu verstehen, werde ich ihre aktuellen Lebensräume aus-
führlicher behandeln. Das Umfeld der Erziehung wird dadurch näher focu-
siert. Hier steht die Frage ,,Wo findet Erziehung statt?," im Mittelpunkt
meiner Ausführung
Mein Blickwinkel in den ersten beiden Teilen richtet sich auf die Macro-
perspektive, d.h. ich schaue auf die gesamtgesellschaftlichen Prozesse um
ein Gesamtbild zu erstellen. Mein Hauptaugenmerk richtet sich auf die eu-
ropäische Entwicklung und ganz speziell auf Deutschland.
9
Drittens werde ich die aktuelle Problemefelder beleuchten und die Auswir-
kung der gesellschaftlichen und erzieherischen Entwicklung auf unsere heu-
tige Gesellschaft thematisieren. Dazu werde ich auf die Punkte Schulwesen,
interkulturelle und ,,antirassistische" Pädagogik, Neue Medien / Medienpä-
dagogik, Geschlechterverhältnis / Gender, Gesundheitesrziehung und der
Zusammenarbeit der Generationen eingehen. Diese Punkte habe ich auf-
grund ihrer momentanen Aktualität ausgewählt und möchte sie in den Kon-
text der in Teil I. und II. beschriebenen historischen Entwicklung, von Ge-
sellschaft, Staat und Erziehung, stellen.
Viertens möchte ich die Auswirkungen, dieses gesellschaftlichen und erzie-
herischen Wandels auf die soziale Arbeit beschreiben. Zudem werde ich die
im dritten Teil herausgearbeiteten Punkte mit Methoden und Perspektiven
der sozialen Arbeit in Verbindung setzen, um den überprofessionnellen Zu-
sammenhang dieser zu verdeutlichen.
Zuletzt werde ich in meiner Schlußbetrachtung die wichtigsten Erkenntnisse
dieser Entwicklung präsentieren und ein Fazit ziehen.
,,Alles ist gut, wenn es aus den Händen des Schöpfers her-
vorgeht, alles entartet unter den Händen der Menschen".
(Rousseau, Emile)
11
1.
Die postmoderne Gesellschaft
Die Probleme der Erziehung in der postmodernen Gesellschaft, sind an die
grundlegenden Veränderungen in der Gesellschaft gekoppelt. Erst wenn
man diese wandelnden Formen und Arten des gesellschaftlichen Zusam-
menlebends greifbar macht, kann man die aktuelle Entwicklung der Erzie-
hungsproblematiken verstehbar und handhabbar machen.
Die aktuelle politische und medienwirksame Diskussion ,,Kinder brauchen
Zukunft"
1
, möchte ich mit diesem Diplomarbeitsthema ergänzend behan-
deln. Diesbezüglich werde ich mit einem Überblick über die gesellschaftli-
che Entwicklung beginnen, um anschließend diese mit der erzieherischen zu
vergleichen. Dadurch werde ich in den Punkten drei und vier eine Basis
haben, um die aktuelle Entwicklung und die daraus resultierenden Probleme
in der Erziehung, in Bezug auf die erzieherische und die soziale Arbeit, zu
betrachten und neue Lösungsstrategien vorstellen zu können.
Deshalb möchte ich nun im weiteren Verlauf die grundlegenden Verände-
rungen in der postmodernen Gesellschaft skizzieren und die Entwicklungen
und die daraus entstehenden Problematiken verdeutlichen.
1.1. Einführung in den Begriff der Moderne
Der Begriff Moderne kommt aus dem Spätlateinischen und bedeutet heutig /
neuzeitlich.
Er wird in der Soziologie für die einsetzende Umgestaltung traditioneller
Gesellschaften seit Beginn der Aufklärung und der Doppelrevolution
2
ge-
nutzt.
Die Schlagworte Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der französischen
Revolution wurden zum Wegbereiter einer neuen Zeit, der Moderne. Die
1
U.a. der ZDF Themenreihe: ,,Kinder brauchen Zukunft" entnommen.
2
Gemeint sind hier die französische und die industrielle Revolution.
12
Vernunft trat in den Vordergrund und mit ihr neue Welt- und Grundformen
der Lebensauffassung. Die alten Werte und Normen lösten sich zugunsten
dieser neuen Weltanschauung auf. Autonomie, Freiheit, Demokratie, Men-
schenrechte, Rationalität und Gesellschaftsplanung traten aus der Versen-
kung empor und konnten weiter gedacht werden. Ein neues Menschenbild
und der Glaube an immerwährenden Fortschritt wurden geprägt. Der mo-
derne Mensch durchlebte eine immer fortschreitendere Säkularisierung er
war nicht mehr von einem König oder Gott abhängig, sondern konnte ratio-
nal das Geschehen beeinflussen, er konnte nun aktiv die Welt mitgestalten
und hatte hierfür individuelle universale Freiheiten.
3
1.2. Einführung in den Begriff der Postmoderne
Der Begriff der Postmoderne entstand in den 60er Jahren in der Architektur
zur Bezeichnung eines neuen Stils, welcher verschiedene Elemente anderer
Stile vermischte. Dieser Begriff wurde dann in anderen Kulturbereichen, so
auch in der Soziologie, aufgegriffen.
4
Ende der 60er Jahren hatte die moderne Gesellschaft, nach zwei Weltkrie-
gen, dem Siegeszug des Kapitalismus und dem technologischen Fortschritt,
die Grenzen des Wachstums erreicht. Wirtschaftskrisen und eine ständige
Angst vor der Selbstzerstörung der Menschheit durch Wettrüstung und
Umweltzerstörung ließ sie langsam an dem ewig währenden Fortschritt
zweifeln.
5
Zugleich begannen in diesem Zeitraum verschiedene Prozesse, welche das
Gesellschaftsbild grundlegend verändern sollte. Der Trend zur Informalisie-
rung lockerte die Zwänge im Umgang miteinander. Hierdurch wurde das
Zugeständnis einer größeren individuellen Freiheit, eine Thematisierung
von Freiheitsspielräumen und einer wachsenden Toleranz möglich. Der
Bedeutungsverlust der traditionellen Berufs-, Leistungs- und Aufstiegsori-
3
Vgl:. Schäfers, Bernhard, Grundbegriffe der Soziologie 2005, a.a.O.
4
Vgl.: Feldmann, Klaus, Soziologie Kompakt, a.a.O., S. 324 f.
5
Vgl:. Schäfers, Bernhard, Grundbegriffe der Soziologie 2005, a.a.O.
13
entierung, sowie des traditionellen Rollenverständnisses der Geschlechter,
einer stärkeren Betonung egalitärer und partnerschaftlichen Werte sowie
einer neuen Kinder- und Jugendkultur, sind bezeichnend für die Verände-
rungen im Gesellschaftsbild.
6
Jedoch bleiben die Soziologen untereinander strittig, ob es sich nun um eine
neue Ära oder ,,nur" um Auswirkungen der Moderne handelte. Die Begriffe
,,reflexive Moderne", ,,Zweite Moderne", ,,Zeitenwende" und ähnliche wol-
len diese prozessualen Wandlungen in unserer Gesellschaft beschreiben,
haben jedoch verschiedene Ansatzpunkte.
7
So auch der Begriff Postmodern, er bezieht sich auf den Zeitraum nach der
Moderne. Er ist bezeichnend für den Zeitraum Ende der 60er Jahre bis in die
Gegenwart hinein.
,,Ihr Ursprung lag Ende der 60er , Mitte der 70er Jahre im
historischen Zusammenfall von drei miteinander unabhängi-
gen Prozessen: der informationstechnologischen Revolution,
der wirtschaftlichen Krise (...) und des Aufblühens kultureller
und sozialer Bewegungen wie der liberitären Bewegung, der
Bewegung für Menschenrechte, des Feminismus und der
Umweltbewegung."
8
Die sozialen Bewegungen, wie die Studenten-, Frauen- und Umweltbewe-
gung haben eine große Bevölkerungsgruppe, durch die Identifikation eines
gemeinsamen Problembereiches, aktiviert.
9
Ein Wertewandel konnte sich durch die große Bevölkerungsbeteiligung
schneller durchsetzen. Dazu kam Mitte der 70er Jahre die Wohlstandssteige-
rung, der Sozialstaatsausbaus und die Medien- und Bildungsrevolution.
In den angegliederten Punkten möchte ich auf wesentliche Prozesse, Verän-
derungen und Herausforderungen dieses Struktur- und Wertewandels, in der
postmodernen Gesellschaft, eingehen.
6
Vgl.: Feldmann, Klaus, Soziologie Kompakt, a.a.O., S. 332 f.
7
Vgl.: Schäfers, Grundbegriffe der sozialen Arbeit 2006, a.a.O., S. 346 f.
8
Vgl.: Dringenberg,Rainer, Zeit, zitiert Castells, a.a.O., S. 7.
9
Vgl.: Mogge Grotjahn, Hildegard, Soziologie, a.a.O., S. 92 ff.
14
1.2.1. Unsere Gesellschaft
Wenn man von Erziehung sprechen möchte, muss man sich zuerst die Rah-
menbedingungen anschauen in der diese stattfindet, um die Probleme in der
Erziehung überhaupt greifbar machen zu können. Nun werde ich mit einem
Blick auf verschieden geprägte Begrifflichkeiten von Gesellschaft beginnen,
danach werde ich auf einzelne Punkte des Strukturwandels in unserer Ge-
sellschaft eingehen.
Es gibt nicht die Gesellschaft. Verschiedene Soziologen haben aus diversen
Perspektiven versucht, die Gesellschaft und das Verhalten der einzelnen
Individuuen, in einen Begriff zu fassen. Herausgekommen sind Begriffe wie
Risikogesellschaft
10
, Bürgergesellschaft
11
, Multioptionsgesellschaft
12
, Wis-
senschaftsgesellschaft
13
, Arbeitsgesellschaft
14
usw. .
Jedoch ist die postmoderne Gesellschaft, unter der alle vorangegangenen
Begriffe sich einzuordnen versuchen eine, die sich nicht eindeutig zuorde-
nen lässt. Sie vermischt, wie in der Architektur, die verschiedenen Stile.
Durch die fortschreitende Individualisierungs- und Globalisierungsprozesse
unterliegt die nachindustrielle, hochdifferenzierte und pluralistische Gesell-
schaft einem tiefgreifenden Strukturwandel.
Die Sicherheit, die eine feste Struktur dem Menschen bietet, ist im laufe
dieses Strukturwandels auf der Strecke geblieben. Die Sicherheit, sich in
eine gesellschaftliche Position fest einzuleben, gibt es nicht mehr. Eine
weitgreifende Verhaltensunsicherheit lässt sich im gesamtgesellschaftlichen
Zusammenleben beobachten.
Die immer weiter greifenden Fortschritte auf dem Gebiet der Informations-
technik, der kommunikativen Massenmedien, das Aufkommen des Massen-
verkehrs, die Zunahme internationaler Verpflechtungen und die Herausbild-
ung globaler Märkte haben das Leben in unserer Gesellschaft unübersicht-
lich und nicht mehr greifbar gemacht. Zudem verlaufen diese Prozesse nicht
10
Begriff geprägt durch Ulrich Beck.
11
Begriff geprägt durch Ralf Dahrendorf.
12
Begriff geprägt durch Peter Cross.
13
Begriff geprägt durch Helmut Wilke.
14
Begriff geprägt durch Claus Offe.
15
gradlinig, sind nicht immer als Fortschritt zu erkennen und verfolgen kein
eindeutiges Ziel. Sie sind in sich widersprüchlich.
Darin besteht auch eins der größten Probleme für die Erziehung. Wohin soll
erzogen werden, wenn die Gesellschaft keine eindeutigen allgemeinen Sinn-
und Zielvorstellungen mehr hat?
15
1.2.2. >>Anything goes<<
>>Anything goes<<, eine Bezeichung die Paul Feyerabend treffend unserer
Gesellschaft zuschreibt. Ist jedoch eine Gesellschaft, in der alles möglich ist,
eine freie Gesellschaft?
Die Freiheit, das alles möglich sein kann, aber nichts muss, kann für den
Menschen Fluch und Segen zugleich sein. Da eine eindeutige Struktur in der
eine Gesellschaft, mit festen Normen, nach denen sich das Verhalten der
Einzelnen richtet und somit Sicherheit verspricht, sich weiter auflöst, wissen
immer mehr Menschen nicht mehr wie sie ihr Leben planen können, welche
Ziele als wertvoll zu erachtet sind. Selbst die Auswahl aus unendlichen
Möglichkeiten unserer heutigen Gesellschaft setzt eine ständige Auseinan-
dersetzung mit ihr voraus, aber ist das noch die gewünschte Freiheit?
Durch die Monotomie und Regelmäßigkeit empfohlener, durchgesetzter und
gedrillter Verhaltensweisen wissen die Menschen in den meisten Fällen,
was zu tun ist. Sie kommen selten in Situationen, in denen sie ohne Weg-
weiser stehen, in denen sie auf eigene Verantwortung entscheiden müssen,
ohne gesichertes Wissen über Konsequenzen und voller schwer kalkulierba-
rer Risiken. Das Fehlen oder schon die Unklarheit der Normen ist das
Schlimmste, was Menschen, die ihren Alltag bewältigen müssen, passieren
kann. Normen ermöglichen dieses nur durch Beschränkungen. Gibt es sie
nicht, sind die Menschen verhaltensunsicher und suchen nach neuen Nor-
men.
16
15
Vgl.: Pongs. Armin, In welcher Gesellschaft leben wir überhaupt?, a.a.O., S. 23 ff.
16
Vgl.: Baumann, Zygmunt, Flüchtige Moderne ,a.a.O., S 27 ff.
16
Ein weiteres Problem in der Erziehung ist es die ,,neue Freiheit" auch wirk-
lich nutzen zu können. Autonomie und Selbstbewusstsein muss vermitteln
werden, gleichzeitig rücken jedoch die Risiken und die eigene Verantwor-
tung ins Bewusstsein der Menschen. Viele Menschen sind dann mit dieser
Situation überfordert und trauen sich nicht zu, ein Kind richtig erziehen zu
können. Der Mensch muss heutzutage mündig sein und auch dahin erzogen
werden, um sich in einer Welt voller Möglichkeiten zurecht zufinden.
1.2.3. Mobilisierung, Säkularisierung und die soziale Differenzierung
Die Mobilisierung beschreibt unterschiedliche Arten der Bewegung. Eine
Art dieser Mobilisierung sind die Wanderbewegungen, zum Beispiel vom
Land in die Stadt durch die Industrialisierung. Eine weitere Art sind die
Auf- oder Abstiegsprozesse oder die Veränderung der Lebensformen. Die
Gesellschaft ist offener geworden, so dass sich die Positionen in der Gesell-
schaft veränderten. Bildung, Qualifikationen, die Chance den Beruf oder
den Wohnort zu wechseln, ermöglichen Auf- und Abstiege.
Zuletzt ist die Art der Mobilität von Gütern und Informationen durch besse-
re Handelswege, den Ausbau des Verkehrs und der Informationstechnologie
zu nennen.
Mit der Mobilisierung kam die zunehmende Arbeitsteilung. Hierzu gehören
die Unterscheidung von Berufsarten, die Zergliederung einzelner Tätigkei-
ten und die durch den technischen und sozialen Wandel
17
veränderte Gesell-
schaft. Die zunehmende Zergliederung und Spezialisierung einzelner Teil-
bereiche der Gesellschaft nennt man Differenzierung.
18
Soziale Differenzierung ist die Unterscheidung verschiedener Arten des
Zusammenlebens. Hier ist zwischen dem Prozess, in denen diese verschie-
denen Arten des Zusammenlebens entstehen und der sozialen Differenziert-
heit als Zustand zu unterscheiden. Wir leben in einer bereits ,,hochdifferen-
17
Unter sozialem Wandel sind langfristige Vorgänge eines gesamtgesellschaftlichen
Strukturwandels zu verstehen.
18
Vgl.: Mogge Grotjahn, Hildegard, Soziologie, a.a.O., S. 37 ff.
17
zierten" Gesellschaft, da es hier schon eine große Vielfalt an Arten des Zu-
sammenlebens gibt.
19
Die Säkularisierung beschreibt die Abgrenzung der Kirchen und Religions-
gemeinschaften durch die Ausdifferenzierung von Erziehung, Bildung,
Rechtssprechung, Regierung etc.. Durch diese entstand eine zunehmende
Trennung zwischen Kirche, Wissenschaft und Staat. Die Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften wurden ihrerseits zu abgegrenzten Subsystemen der
Gesellschaft, deren Normen und Orientierungsangebote nicht mehr allge-
meingültig sein konnten. Sie traten sie in Konkurrenz zu anderen Subsyste-
men und dadurch zu anderen Wert- und Sinnangeboten.
20
1.2.4. Individualisierung und soziale Ungleichheit
Die Mobilisierung, Differenzierung und Säkularisierung fördern die Frei-
setzung des Individuums.
Die Individuuen und die Gesellschaft sind nicht zu trennen. Jedoch gibt es
unterschiedliche historische Ausprägungen ihres Verhältnisses zueinander.
Diese ,,Wir - Ich - Balance"
21
verschiebt sich mit jeder Veränderung der
sozialen Struktur. Die postmoderne Gesellschaft ist stärker ,,Ich" zentriert
als andere Gesellschaftsformen zuvor.
22
Die Individualisierung betont die Auflösung und Ablösung industriegesell-
schaftlicher Lebensformen in Folge der ökonomischen, kulturellen und so-
zialen Entwicklung der Nachkriegszeit, durch solche, in denen der Einzelne
zum ,,Bastler" und ,,Entwickler" seiner eigenen Biographie wird.
Wo früher die Klassen, Schichten, Geschlechterrollen und das soziale
Milieau das gesellschaftliche Zusammenleben bestimmten, so sind es heute
die Gegebenheiten des Arbeitsmarktes, das Bildungssystems und der Sozial-
staats.
19
Vgl.: Schäfers Bernhard et al., Grundbegriffe der Soziologie, a.a.O., S. 47 ff.
20
Vgl.: Mogge Grotjahn, Hildegard, Soziologie, a.a.O., S. 37 ff.
21
Begriff von Norbert Elias geprägt.
22
Vgl.: Mogge Grotjahn, Hildegard, Soziologie, a.a.O., S. 39 ff.
18
Jedoch kann diese Entwicklung zweiseitig betrachtet werden. Einerseits
wird der Einzelne von Zwängen und Traditionen befreit, andererseits wird
er durch die Aufgabe existentielle Entscheidungen für sich und andere
treffen zu müssen, ohne einen sicheren Rückhalt zu haben, schlicht weg
überfordert.
23
Der Individualisierungsschub seit den sechziger Jahren, ist durch drei Di-
mensionen
24
gekennzeichnet, der Freisetzung aus traditionellen Bindun-
gen
25
, der Entzauberung
26
und die Reintegration in die Gesellschaft
27
.
28
Soziale Ungleichheit bringt zum Ausdruck, dass in der Gesellschaft soziale
Positionen, der soziale Status sowie Ressourcen ungleich verteilt sind.
Zudem werden die Zugangschancen zu wichtigen Sozialenbereichen
29
für
Einzelne oder Gruppen erschwert.
30
Soziale Ungleichheit lässt sich in der postmodernen Gesellschaft nicht mehr
allein auf die üblichen Dimensionen wie Beruf und Bildung zurückführen.
Heute zählen z.B. Freizeit, soziale Sicherheit oder Wohnen dazu. Die
Einbeziehung der Lebensverhältnisse ist eine wichtige Dimension der
Ungleichheitsforschung geworden.
31
Eine Frage, die sich aus der Individualisierungsthese ergibt, ist ob soziale
Ungleichheit ein selbstverschuldeter Zustand sei? Wenn jeder seines
eigenen Glückes Schmied ist, kann der Schuldige schnell ausgemacht
werden. Schuld ist immer der, der auf der Strecke bleibt.
Jedoch haben wir auch gehört, das Institutionen, das Bildungssystem und
der Sozialstaat die gesellschaftlichen Gegebenheiten bestimmen. So kann
23
Vgl.: Schäfers, Bernhard et al., Grundbegriffe der Soziologie, Zitat: Beck, a.a.O., S.
111 f.
24
Die Dimensionen wurden von Beck geprägt.
25
Traditionelle Bindungen sind Stände, soziale Klassen oder Geschlechtsrollen.
26
Die Entzauberung entsteht dadurch, dass es keine festen Handlungsorientierungen, die
von einem mystischen oder übergeordneten Wesen bestimmt werden, sondern es eine
gewisse Wahlfreiheit gibt.
27
Auch hier ist die Freiheit des Individuums nicht unendlich, Entscheidungen werden
durch Institutionen u.ä. begrenzt, deshalb muss es in die Gesellschaft integriert
werden.
28
Vgl.: Burzan, Soziale Ungleichheit, a.a.O., S. 165 ff.
29
Beispiele hierfür ist die starke Selektion in Bildung und Beruf.
30
Vgl.: Schäfers, Bernhard, Grundbegriffe der Soziologie, a.a.O., S. 329 f.
31
Vgl.: Burzan, Soziale Ungleichheit, a.a.O., S. 73 ff.
19
man daraus schlußfolgern das, wenn ein großer Anteil der Bevölkerung
arbeitslos ist und jedes sechste Kind
32
in Deutschland von Sozialhilfe lebt,
gerade diese Bereiche unterstützend tätig werden müssten. Der sozialen
Gerechtigkeit kann sich nur dann angenähert werden, wenn die sozialen
Gegebenheiten, d.h. die sozialen Strukturen und Möglichkeiten für alle
Bevölkerungsgruppen gleich wären.
Kinder und Jugendliche erfahren schon früh, was soziale Ungleichheit
bedeutet und dass die Institutionen, die Bildungseinrichtungen und der
Sozialstaat die sozialen Benachteiligungen dulden, wenn nicht sogar
fördern. Sozial schlechter gestellte Kinder und Jugendlichen haben nicht die
gleichen Chancen wie andere ihrer Altersklasse.
So verstärkt auch das Schulsystem die soziale Benachteiligung durch eine
frühe Auslese. Durch die Aufteilung in weiterführende Schulen wird ein
hoher Leistungsdruck auf Kinder, Eltern und Lehrer gelegt. Wenn die Eltern
die Unterstützung, die ein Kind braucht, nicht geben können und die
sozialen Institutionen diese nicht auffangen, hat das Kind kaum eine
Chance. die individuelle Förderung zu nutzen, die verschiedenen sozialen
Voraussetzungen zu erreichen und Erfahrungen sowie Talente heraus-
zuarbeiten. Die Basis zur Teilhabe an der individuellen Freiheit fehlt.
33
,,In keinem anderen Land ist die Verknüpfung von sozialer
Herkunft und Schulerfolg so eng wie in Deutschland."
34
1.2.5. Bastelbiografien
Durch die Individualisierung haben die Menschen die Möglichkeit ihr
Leben selbst zu gestalten. ,,Bastelbiografien" weisen mehr Varianten auf, als
32
Vgl.: WAZ, 24.04.07, a.a.O., Politik.
33
Vgl.: Ngo-online, 29.09.2004, a.a.O., Artikel: Deutsches Schulsystem; Soziale
Benachteiligung wird durch frühe Auslese verstärkt.
34
Ebenda.
20
die früheren ,,Normalbiographien". Jeder bastelt sich seinen eigenen
Lebenslauf aus den ihm gegebenen Möglichkeiten zusammen.
35
Es lassen sich Unterschiede der Lebensverläufe feststellen. Neben den durch
Ehe und Familie normierten Lebenszyklen sind Lebensverläufe getreten, die
durch Vereinzelung oder Singularisierung, Pluralisierung und Polarisiserung
nur unzureichend beschrieben werden können. Durch das veränderte
Erwerbsverhalten der Frauen, der Nähe zum Arbeitsplatz, mehr Zeit für
Erwerbsarbeit, der Enttraditionalisierung und durch die selbsgewählten
Biographieverläufe, werden ,,Normalbiographien" eher zur Ausnahme.
36
1.2.6. Das universelle Expertentum
Das universale Expertentum macht auch nicht vor den Familien halt. Was
früher noch als gegebene Eigenschaft einer Frau, in die sie durch Nach-
ahmung und Hilfe ihrer eigenen Eltern hineingewachsen ist, zugeschrieben
wurde nämlich, dass sie ihre Kinder in Eigenregie erziehen konnte, ist heute
zu einem Kampf der Experten verkommen. Die verunsicherten Eltern
37
greifen nach konkreten Ratgebern. Zeitschriften- und Bücherverlage bringen
zu Hunderten immer mehr auf die verschiedenen kindliche Lebensabschnit-
te spezialisierte Ratgeber heraus.
38
So sieht man die Zeitung ,,Eltern" mit
dem Titelthema: Mein Baby richtig fördern, neben dem ,,Focus"- Das Ma-
gazin für engagierte Eltern-Schule, mit dem Titelthema: Strategien für das
nächste Gespräch über ihr Kind. Die Zeitschrift ,,Kids life", das Magazin für
ein Leben mit Kindern, zeigt Eltern, wie sie in der Freizeit ihre Kinder
spielend fördern können. Dicke Wälzer betitelt zum Beispiel mit: ,,550
Erziehungstipps für alle Fälle", ,,Plötzlich sind sie 13, so begleiten sie ihr
Kind durch die Teenagerzeit" von diversen Autoren, füllen ganze Regale.
Und auch kinderspezielle Literatur sollte den Eltern nicht fremd sein, so gibt
35
Vgl.: Burzan, Soziale Ungleichheit, a.a.O., S. 167 f.
36
Vgl.: Frevel, Bernhard, et al., a.a.O., S. 20 ff.
37
Auch hier ist es zumeist die Mutter, für die Ratgeber spezifisch gestaltet werden.
38
Vgl.: Largo, Remo H., Kinderjahre, a.a.O., S. 14.
21
es Lexika für die verschiedenen Alterstufen und kindgerechtes Lernmaterial
für die ersten Lebensjahre, der Kindergartenzeit, die Vorschulzeit usw.
Auch hier stehen die Eltern vor einem fast unüberschaubaren Angebot von
Erziehungsstrategien und Möglichkeiten des Förderns.
Vor ein oder zwei Generationen war es gang und gäbe, ein Kind sehr streng
zu behandeln. Es gab bestimmte Vorschriften, wie man mit ihm umzugehen
hat und welche Pflichten es erfüllen musste.
39
Heute ist dies anders, das Kind als emotionalisiertes Objekt der Familie
wird den Erwartungen und Wünschen der Eltern ausgesetzt. Eigene Frei-
heitswünsche werden übertragen und Negatives von ihm ferngehalten.
Die Gesellschaft setzt voraus, dass die Eltern den Wunsch hegen, ihr Kind
mit allen Mitteln zu fördern und verlangen dieses auch dann noch, wenn die
Mittel der Eltern nicht ausreichen können. Die Verkleinerungen der
Hausgemeinschaften, die Differenzierungen der Familienstrukturen, und bei
allen Problemen die Chance, diese Selbstständig durch Ratgeber lösen zu
können, lassen Eltern vermehrt auf sich allein gestellt.
1.2.7. Glaubensfragen
,,Nun sag, wie hast du´s mit der Religion? Du bist ein
herzlich guter Mann, Allein ich glaub, du hälst nicht viel
davon." (Goethe, Zitat: Faust, S. 100)
Die Gretchenfrage findet in einer säkularisierten Gesellschaft immer mehr
Ablehnung. In früheren Generationen war die Religion sinngebend, ein fes-
ter Orientierungspunkt für das menschliche Zusammenleben. Die Religion
setzte Werte, Normen, Traditionen und Rituale ohne die eine Gemeinschaft
undenkbar gewesen wäre. Sie war der gesellschaftliche Treff- und Mittel-
punkt.
Die Loslösung von der Kirche und von der kirchlichen Bindung schreitet
heute weiter voran. Die Werte, Normen und Rituale der Kirche waren früher
39
Vgl.: Burck, Wells Frannces, Handbuch Baby, a.a.O., S. 463.
22
in der Gesellschaft anerkannt und setzte die Maßstabe gesellschaftlichen
Zusammenlebens, durch die fortschreitende Säkularisierung fallen nun diese
weg und auch die kommunikativen Prozesse in den Gemeinden verstummen
mehr und mehr.
,,Religion war´s, vom Morde sich zu enthalten, dem Schwa-
chen beizuspringen, dem Irrenden den rechten Weg zu zei-
gen, des Verwundeten zu pflegen, den Toten zu begraben. In
Religion wurden die Pflichten des Ehebundes, der Eltern ge-
gen die Kinder, die Kinder gegen die Eltern, des Einheimi-
schen gegen die Fremden eingehület, und allmählich dies
Erbamen auch auf Feinde verbreitet."
40
Kirchenschließungen führen dazu, dass Gläubige ihre Gemeinden verlieren,
bzw. bei Interesse kaum noch Ansprechpartner finden.
Längst wird von Seiten der Kirchen versucht, die Mitglieder wieder an sich
zu binden, ein richtiges Werben um sie ist entbrannt. Da ist es nicht ver-
wunderlich das die Bibel in ,,gerechter Sprache" geschrieben wird, um die
Menschen neu anzusprechen. Doch ob dies nicht auch eine weitere Enttradi-
tionalisierung der alten Werte und Normen ist, wenn selbst die Bibel sprach-
lich verändert werden darf, bleibt offen. Die Sinnfrage bleibt weiter unbe-
rührt.
41
Dies führt dazu, dass sich immer mehr Menschen die Fragen nach dem Sinn
und Ziel des Lebens stellen. Sie müssen sich nun selbst einen Sinn, eine
eigene individuelle Ethik, aufbauen, diese müssen sie mit der allgemein
vorgegeben Ethik in Übereinkunft bringen.
Die Erziehung der Kinder wird durch die Sinnfrage und den Überzeugungen
der Eltern mitgeprägt. Kinder benötigen diesen Sinnzusammenhang einer
übergeordneten Ethik, da dieser Sicherheit, Gruppenzugehörigkeit und Ori-
entierung bietet. Wenn dieser fehlt, kommt es häufig zu schnellen Über-
nahmen unüberprüfter angebotener Orientierungspunkte von außen.
Zudem kommt eine weitere Differenzierung von Glaubensgemeinschaften.
Zwar ist die christliche Kirche immer noch am weitesten verbreitet und
40
Was ist Aufklärung?, Zitat: Herder, a.a.O., S. 40.
41
Vgl.: WAZ, Eine Bibel zum Streiten, a.a.O., Politik, 10.04.2007.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836605083
- DOI
- 10.3239/9783836605083
- Dateigröße
- 492 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe – Sozialwesen, Studiengang Soziale Arbeit
- Erscheinungsdatum
- 2007 (August)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- erziehungsschwierigkeit postmoderne erziehung kinder jugendliche sucht migranten
- Produktsicherheit
- Diplom.de