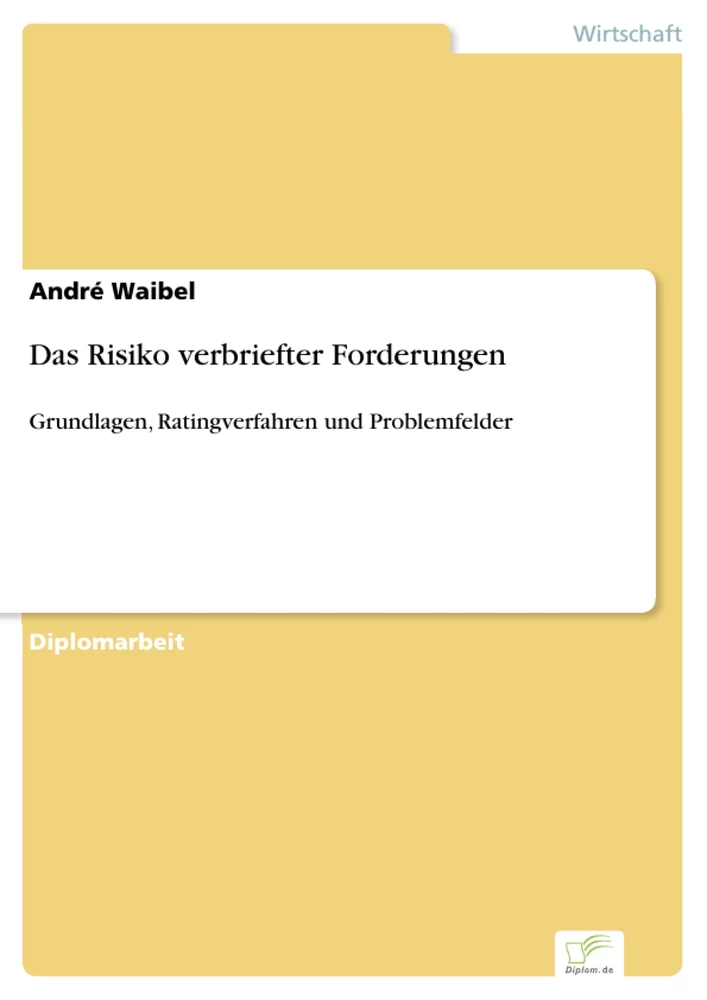Das Risiko verbriefter Forderungen
Grundlagen, Ratingverfahren und Problemfelder
©2006
Diplomarbeit
177 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
Die internationalen Kredit- und Kapitalmärkte waren in den letzten Jahren durch starke strukturelle Veränderungen geprägt. Die Verbriefung von Vermögenswerten (Asset Securitisation) als alternative Form der Unternehmensfinanzierung hat in großem Maße das Interesse der Marktteilnehmer auf sich gelenkt. Durch die Verbriefung des zugrundeliegenden Referenzportfolios (Pool) erfolgt ein direkter Transfer von Risiken zum Kapitalmarkt. Ursprünglich evtl. nicht handelbare Assets werden dadurch handelbar gemacht: Eine neue Dimension des Kapitalmarktes.
Die in jüngster Zeit entstandenen Collateralized Debt Obligations (CDOs) sind strukturierte Finanztransaktionen und bilden eine Unterkategorie der Asset Backed Securities (ABS), d.h. der mit bestimmten Vermögenswerten unterlegten Wertpapieren. Sie verbriefen unterschiedlich priorisierte Ansprüche auf die Vermögenswerte des Pools und erzeugen so unterschiedliche Tranchen mit spezifischen Risiko/Ertrags-Profilen. Das Wachstum dieses Marktsegments ist enorm: Betrug das weltweite CDO-Emissionsvolumen 2004 noch 157,4 Mrd. $, waren es bereits im 3. Quartal 2006 rund 322 Mrd. $, d.h. eine Steigerung von 104,6%. Zudem wurden Kreditderivat-Indizes wie iTraxx und CDX eingeführt und neue, exotische CDO-Strukturen entwickelt, deren Bewertung noch ein offenes Forschungsfeld darstellt.
Zur Einschätzung des Risikos der CDO-Strukturen werden von den weltweit führenden Ratingagenturen Moody´s Investors Service, Fitch Ratings und Standard and Poor´s Ratings vergeben. Ratingagenturen sind eine sehr wichtige Komponente des CDO-Marktes, da Investoren oft nur unzureichend über den als Sicherheit dienenden Referenzpool informiert sind und die Komplexität von CDO-Transaktionen nicht vollständig verstehen.
Allerdings unterscheiden sich sowohl der Aussagegehalt der Agentur-Ratings als auch deren zugrundeliegende Annahmen und methodische Erstellung fundamental. Marktteilnehmer sind somit einer Fehleinschätzung des tatsächlichen Risikos ausgesetzt. Zusätzlich verlangt die fehlende Markttransparenz und die Abhängigkeit von den Ratingagenturen nach alternativen Modellierungsansätzen zur CDO-Bewertung.
Die Bewertung strukturierter Finanzprodukte wie CDOs basiert meist auf einer Szenarientransformation von der Asset-Seite der Struktur zur Seite der Verbindlichkeiten (Liability-Side). Neben der Ausfallwahrscheinlichkeit jedes einzelnen Schuldners müssen dabei auch Annahmen über Rückflussquoten […]
Die internationalen Kredit- und Kapitalmärkte waren in den letzten Jahren durch starke strukturelle Veränderungen geprägt. Die Verbriefung von Vermögenswerten (Asset Securitisation) als alternative Form der Unternehmensfinanzierung hat in großem Maße das Interesse der Marktteilnehmer auf sich gelenkt. Durch die Verbriefung des zugrundeliegenden Referenzportfolios (Pool) erfolgt ein direkter Transfer von Risiken zum Kapitalmarkt. Ursprünglich evtl. nicht handelbare Assets werden dadurch handelbar gemacht: Eine neue Dimension des Kapitalmarktes.
Die in jüngster Zeit entstandenen Collateralized Debt Obligations (CDOs) sind strukturierte Finanztransaktionen und bilden eine Unterkategorie der Asset Backed Securities (ABS), d.h. der mit bestimmten Vermögenswerten unterlegten Wertpapieren. Sie verbriefen unterschiedlich priorisierte Ansprüche auf die Vermögenswerte des Pools und erzeugen so unterschiedliche Tranchen mit spezifischen Risiko/Ertrags-Profilen. Das Wachstum dieses Marktsegments ist enorm: Betrug das weltweite CDO-Emissionsvolumen 2004 noch 157,4 Mrd. $, waren es bereits im 3. Quartal 2006 rund 322 Mrd. $, d.h. eine Steigerung von 104,6%. Zudem wurden Kreditderivat-Indizes wie iTraxx und CDX eingeführt und neue, exotische CDO-Strukturen entwickelt, deren Bewertung noch ein offenes Forschungsfeld darstellt.
Zur Einschätzung des Risikos der CDO-Strukturen werden von den weltweit führenden Ratingagenturen Moody´s Investors Service, Fitch Ratings und Standard and Poor´s Ratings vergeben. Ratingagenturen sind eine sehr wichtige Komponente des CDO-Marktes, da Investoren oft nur unzureichend über den als Sicherheit dienenden Referenzpool informiert sind und die Komplexität von CDO-Transaktionen nicht vollständig verstehen.
Allerdings unterscheiden sich sowohl der Aussagegehalt der Agentur-Ratings als auch deren zugrundeliegende Annahmen und methodische Erstellung fundamental. Marktteilnehmer sind somit einer Fehleinschätzung des tatsächlichen Risikos ausgesetzt. Zusätzlich verlangt die fehlende Markttransparenz und die Abhängigkeit von den Ratingagenturen nach alternativen Modellierungsansätzen zur CDO-Bewertung.
Die Bewertung strukturierter Finanzprodukte wie CDOs basiert meist auf einer Szenarientransformation von der Asset-Seite der Struktur zur Seite der Verbindlichkeiten (Liability-Side). Neben der Ausfallwahrscheinlichkeit jedes einzelnen Schuldners müssen dabei auch Annahmen über Rückflussquoten […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
André Waibel
Das Risiko verbriefter Forderungen - Grundlagen, Ratingverfahren und Problemfelder
ISBN: 978-3-8366-0487-1
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Universität zu Köln, Köln, Deutschland, Diplomarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
Darstellungsverzeichnis...VI
Symbolverzeichnis...VII
Abkürzungsverzeichnis...XVIII
1.
Einleitung... 1
1.1
Problemstellung... 1
1.2
Gang der Untersuchung... 2
2.
CDO-Grundlagen... 2
2.1
Einordnung von CDOs in den Bereich der ,,Asset Backed" Produkte... 2
2.2
Ablauf einer CDO Transaktion... 3
2.2.1
Grundstruktur... 3
2.2.2
Beteiligte Parteien... 4
2.3
Drei Hauptgruppen von CDOs...4
2.4
Coverage Tests...5
2.4.1
O/C-Test... 5
2.4.2
I/C-Test... 6
2.5
Der Cash Flow Waterfall... 6
2.6
Ziele bei der Emission von CDOs...6
2.7
Die Entwicklung des Marktes für Kreditrisikotransfer...7
2.7.1
Historische Eckdaten...7
2.7.2
Marktindizes iTraxx und CDX...7
2.7.3
Neuere CDO-Formen... 7
2.7.4
Das PROMISE- und PROVIDE-Programm der KfW... 8
2.7.5
Der CDO-Sekundärmarkt... 8
2.7.6
Statistische Daten und aktuelle Situation. ... 8
2.8
Verbriefungstechnik...10
2.8.1
Der Transformationsvorgang... 10
2.8.2
Tranchierung als grundlegende Technik... 11
2.8.3
Optimale Strukturierung einer Kreditportfolioverbriefung...11
2.8.4
Ein einfaches Beispiel zur Erklärung des Verbriefungsvorgangs...12
III
3.
Rating-Grundlagen...13
3.1
Überblick über die Ratingagenturen... 13
3.2
Ablauf eines Ratingprozesses... 14
3.3
Ratingsymbole... 15
3.4
Charakterisierung von ,,Default"... 15
3.4.1
Definition nach Basel II und verwendete Notation...16
3.4.2
Definitionen der Ratingagenturen... 16
3.4.3
Vergleich... 17
3.4.4
Time-Until-Default... 17
3.4.4.a
Survival Funktion... 18
3.4.4.b
Hazard Rate Funktion... 18
3.5
Schlüsselelemente der Rating-Methodik für strukturierte Finanzprodukte. 19
3.5.1
Ausfallwahrscheinlichkeiten... 20
3.5.2
Recovery Rates...20
3.5.3
Ausfallkorrelationen...21
3.6
Die Bedeutung von Korrelationsannahmen... 21
3.7
Monte Carlo Simulationen... 22
3.8
Scoring-basierte und kausale Ratingsyteme... 23
3.9
Credit Enhancement...24
3.10 Das ,,Credit Spread Puzzle": Portfolio-Diversifikation und Risikoreduk-
tion... 24
3.11 Risikoanalyse strukturierter Kreditprodukte...26
3.11.1 Die Bedeutung des Modellrisikos... 26
3.11.2 Non-Default Risiken... 26
3.12 Konstruktion von Kreditkurven... 27
3.12.1 Historische Ausfallraten der Ratingagenturen... 27
3.12.2 Optionspreistheorie nach Merton... 28
3.12.3 Marktinformationen... 28
3.12.4 Typischer Verlauf...29
3.13 Copula Funktionen: Vom Einzelkredit zur Kreditportfolioanalyse...30
3.14 Asset- vs. Defaultkorrelation... 31
4.
Ratingverfahren und Analysemodelle... 32
4.1
Die Ratingansätze der großen Ratingagenturen...32
4.1.2
Moody´s BET ...32
IV
4.1.2.a
Weighted Average Rating Factor (WARF)... 32
4.1.2.b
Diversity Score (DS)... 34
4.1.2.c
Ratingerstellung...36
4.1.3
Moody´s CB Ansatz... 37
4.1.4
Moody´s Double BET und Multi BET...38
4.1.5
Moody´s Analysemodelle...38
4.1.6
Fitch´s VECTOR Modell... 39
4.1.6.a
Ausfallwahrscheinlichkeit... 39
4.1.6.b
Asset-Korrelation...40
4.1.6.c
Recovery Rate...41
4.1.6.d
Modell-Outputs und Cashflow-Modellierung... 42
4.1.7
Standard & Poor´s OSA-Ansatz und das EVALUATOR Modell... 43
4.1.8
Standard & Poor´s Actuarial Test... 43
4.1.9
Vergleich der Korrelationsannahmen der Ratingagenturen...44
4.1.10
Das Phänomen des ,,Ratings Shopping"... 45
4.1.11 Kritische Würdigung und die Notwendigkeit alternativer Modell-
ansätze ... 47
4.2
Theoretische Modelle... 48
4.2.1
Das Ein-Faktor-Firmenwert-Modell... 48
4.2.2
Copula-Modelle...50
4.2.2.a
Copula-basierte Abhängigkeits-Maße... 51
4.2.2.b
Ein-Faktor Gauß-Copula... 52
4.2.2.c
Stochastic Correlation Copula... 53
4.2.2.d
Student t Copula... 54
4.2.2.e
Weitere Copula Modelle im Überblick... 56
4.2.2.f
Ermittlung der bedingten und unbedingten Verlustver-
teilung des Portfolios... 57
4.2.2.g
Wahl der Copula und Schätzung der Parameter... 57
4.2.2.h
Kritische Würdigung... 58
4.2.3
Single-Step Modelle...59
4.2.4
Multi-Step Modelle... 60
4.2.4.a
Einfache CreditMetrics Erweiterung... 61
4.2.4.b
Diffusion-driven CreditMetrics Erweiterung... 61
4.2.4.c
Stochastic Default Intensity Ansatz...62
V
4.2.5
Vereinfachungen des Monte Carlo-Ansatzes... 64
4.2.5.a
Large Homogeneous Portfolio (LHP) Ansatz... 64
4.2.5.b
LH+ Ansatz...65
4.2.5.c
Central Limit Theorem (CLT) Methode...67
4.2.5.d
Moment Generation Function (MGF) Methode... 68
4.3
Alternative Modellansätze... 69
4.3.1
Erweiterungen der Ein-Faktor Gauß-Copula... 69
4.3.1.a
Stochastische Recovery Rates... 69
4.3.1.b
Stochastische Gewichtung des systematischen Faktors.. 71
4.3.1.c
Das Zwei-Faktoren Modell...73
4.3.1.d
Das Multifaktor Copula-Modell... 76
4.3.2
Homogeneous Pool Model+ (HPM+) Methode...77
4.3.3
Komonotone Ausfallpfade... 79
4.3.4
Das Frailty-Modell... 81
4.3.5
Modelle zur Bewertung exotischer CDO-Strukturen...84
4.3.5.a
Die perfekte Copula...84
4.3.5.b
Das Intensity-Gamma Modell... 86
5.
Zusammenfassung... 88
Anhangverzeichnis... 91
Anhang...93
Literaturverzeichnis... 140
Darstellungsverzeichnis
Darst. 1:
Charakteristiken verschiedener CDO-Typen... 3
Darst. 2:
Schematischer Überblick einer strukturierten Finanzierung... 4
Darst. 3:
Zugrundeliegende Sicherheiten weltweiter CDO-Emissionen 2006
(1.-3. Quartal)... 9
Darst. 4:
Weltweite CDO-Emissionen (in Mrd. $) pro Quartal nach CDO-
Typ... 10
Darst. 5:
Das CDO Modellierungs-Schema... 10
Darst. 6:
Beispielhafte Tranchierung einer CDO-Transaktion... 13
Darst. 7:
Ratingsymbole der Agenturen und ihre Bedeutung... 15
Darst. 8:
Verlustverteilung bei hoher und niedriger Ausfallkorrelation... 22
Darst. 9:
Standardabweichung der Verluste und Reduktionsfaktor
(in Klammern) bei unterschiedlicher Größe des Referenzportfolios... 25
Darst. 10:
Typischer Verlauf von Kreditkurven... 29
Darst. 11:
Moody´s Ratingfaktoren... 33
Darst. 12:
Moody´s Diversity Score-Tabelle... 35
Darst. 13:
Inputfaktoren der Monte Carlo Simulation... 39
Darst. 14:
Auszug aus Fitch´s Recovery Rate-Annahmen...42
Darst. 15:
Finanzierungskosten verschiedener CDO-Strukturen... 46
Darst. 16:
Copula-Dichten einer Gauß-Copula (links) und einer Student-t Copula
(rechts)...55
Darst. 17:
Transformation der gleichverteilten Werte in Realisierungen der
Randverteilungen für ausgewählte Copulas... 56
Symbolverzeichnis
it
Ungewichtete Komponente des Returns des Assets i in Periode t
ij
ij
,
Nichtnegative Konstanten
)
s
(
),
s
(
Koeffizienten der unbedingten Überlebenswahrscheinlichkeit
Korrelationsparameter
ik
Gewichtung des k-ten Faktors von Asset i
ik
Durchschnittliche Faktorgewichtung
Copula-spezifischer Parameter
i
Durchschnittliches idiosynkratisches Risiko
it
Idiosynkratisches Risko von Asset i in Periode t
n
Idiosynkratisches Risiko des Schuldners n
2
Bivariate Normalverteilungsfunktion
)
,
(
0
,
2
0
A
C
Dichte der bivariaten Normalverteilung mit
Korrelationskoeffizient
0
, bewertet bei
0
C und A
1
-
Inverse Normalverteilungsfunktion
Inter-Sektor-Korrelation
)
(k
,
)
(k
Anpassungen der HPM+ Methode
Parameter der stochastischen Differentialgleichung
Intensitätsprozess
j
Abhängigkeitsparameter des systematischen Faktors der Asset-
Teilmenge j
k
Parameter des Poisson-Prozesses mit zugehöriger
Wahrscheinlichkeit
k
L
Lower Dependence
U
Upper Dependence
2
1
,
Parameter des jeweiligen Poisson-Prozesses des Schuldners 1
bzw. 2
)
(t
Intensität des Ausfalls zum Zeitpunkt t
VIII
i
µ
Konstante der i-ten Recovery Rate
r
µ
r-ter Moment
Anzahl der Freiheitsgrade einer Student-t Verteilung
k
Wahrscheinlichkeit, dass der Prozeßparameter
den Wert
k
annimmt
Copula-spezifischer Parameter
Parameter der stochastischen Differentialgleichung
ij
Die Zwei-Punkt-Verteilung der Faktorgewichtungen definierende
reelle Zahl
Korrelationsparameter
LH+ Ansatz (Greenberg et al 2004): Korrelationskoeffizient des
Sub-Portfolios
)
i
(
k
Korrelation des Asset i zugeordneten Industriesektors
Sp
Spearman´s rho
0
Korrelationsparameter des einzelnen Assets
12
Paarweise Returnkorrelation
Standardabweichung
Parameter der stochastischen Differentialgleichung
2
Varianz
i
Ausfallzeit des Schuldners i
K
Kendall´s tau
n
:
k
Zeit bis zum k-ten Ausfall unter den n Schuldnern des Pools
bezüglich des Ausfallpfades L
n
:
k
~
Zeit bis zum k-ten Ausfall unter den n Schuldnern des Pools
bezüglich des Ausfallpfades L
~
i
i
m
,
Größen, die den Wert des Assets i
als standardnormalverteilten
Ausdruck definieren
Schranke des prozentualen Verlustes
2
1
,
Werte der Ergebnismenge
i
Standardnormalverteilte Zufallsvariable der i-ten Recovery Rate
)
u
(
Wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion
IX
i
l
Stetige Größe der Verlusthöhe des i-ten Schuldners
t
Zeitintervall
J
Parameter der stochastischen Differentialgleichung
i
Gamma-Prozess i
Wahrscheinlichkeitsmaß auf
Ereignisalgebra
Ergebnismenge
Logisches und
Modell der stochastischen Recovery Rates (Andersen und
Sidenius 2004): Diskrete Faltung
{}
1
Indikatorfunktion
a
Driftrate des Multigamma-Prozesses
i
i
b
,
a
Faktorgewichte
ij
a
j-te Faktorgewichtung des i-ten Schuldners
B
,
A
Schranken
k
A
Durchschnittlicher Verlust
b
Ober- bzw. Untergrenze des k-ten Intervalls
i
B
Unabhängige Bernoulli-verteilte Zufallsvariable
)
(
B
Binomialverteilung
)
(t
c
i
Ausfallrate des Schuldners i zum Zeitpunkt t
C
Schranke, die der Gesamtverlust überschreitet
)
(
C
i
Mappingfunktion des Assets i
)
(
C
Copula-Funktion
)
(
C
~
Upper Frechet Copula-Funktion
G
C
Gauß Copula
SC
C
Stochastic Correlation Copula
Cor
Korrelation
Cov
Kovarianz
d
Element des Definitionsbereichs D
D
Level, das der Portfoliowert unterschreitet
X
D
Modell der stochastischen Recovery Rates (Sidenius 2004):
Definitionsbereich
DD
Default Treshold (Ausfallschwelle), fallweise mit Superskript i
für Unternehmen i bzw. t für Periode t
x
DR
Auf x Jahre bezogene Default Rate
1
DR
Einjährige Default Rate
C
DS
Korrelierter Diversity Score
X
DS
Diversity Score des Pools X
Y
DS
Diversity Score des Pools Y
exp
Exponentieller Wert zur Basis e
)
(
E
V
Durch den Marktfaktor V bedingter Erwartungswert
)
(
E
Erwartungswert
j
EL
Erwarteter Verlust des j-ten Szenarios
rs
EL
Erwarteter Verlust bei r Ausfällen im Pool X und s Ausfällen im
Pool Y
TR
EL
Erwarteter Verlust der betrachteten Tranche
)
(
,
y
f
t
F
Y
Bedingte Dichte der Frailty Variable
)
(
f
Dichtefunktion
)
t
(
g
),
t
(
f
Beliebige Funktionen
)
(
)
(
t
g
t
f
Faltung
F
Identischer Nominalwert aller Assets im Pool
)
(
F
Randverteilungsfunktion
i
F
Nominalwert des Assets i
i
V
i
F
Kumulative Verteilung der
i
V
kt
F
Auf Periode t bezogener Faktor k
t
F
Zum Zeitpunkt t verfügbare Information
)
y
(
F
t
F
,
Y
Bedingte Verteilung der Frailty Variable
)
(
F
Verteilungsfunktion
)
(
F
V
Verteilungsfunktion von V
XI
)
(
G
),
(
G
q
1
t
t
Verteilungsfunktion der Ausfallquote des komonotonen
Ausfallpfades zum Zeitpunkt
1
t bzw.
q
t
2
1
h
,
h
Ausfallintensität des dem Schuldner 1 bzw. 2 zugeordneten
Poisson-Prozesses
)
t
(
h
Hazard Rate (Ausfallrate)
)
(
H
Kumulative Verteilung der
i
V
j
,
i
Betrachtetes Asset i bzw. j aus einer Menge von N Assets im Pool
{}
inf
Infimum (untere Grenze)
x
i
q
Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Sicherheit in den
nächsten i Jahren ausfallen wird, vorausgesetzt sie hat bereits x
Jahre ,,überlebt", fallweise mit
t
,
1
n
,
n
i
+
=
.
t
I
Wachsender stochastischer Prozeß der Business Time
i
Tranche
Ratio
C
I
-
/
Kennzahl des Interest Coverage-Tests für Tranche i
j
Element der Teilmenge J
J
Teilmenge aller im Portfolio befindlichen Assets
k
Anzahl der Ausfälle, fallweise mit Index i für i Ausfälle im
Portfolio
k
Betrachtete Periode bzw. Intervall
)
(i
k
Schuldner i zugeordneter Industriesektor
i
K
Ausfallschranke des Assets i
i
K
I/C-Test: Kupons der Tranche i
Pool
K
Kupon des Collateral Pools
senior
K
Summe
der Kupons aller übergeordneten Tranchen
i
l
Verlusthöhe des i-ten Schuldners
max
i
l
Maximale Verlusthöhe des i-ten Schuldners
L
Anzahl der Ausfälle im Portfolio
L
LH+ Ansatz (Greenberg et al 2004): Gesamtverlust
L
Komonotone Ausfallpfade (Bluhm und Overbeck 2005b):
Ursprünglicher Pfad der Ausfallquoten
j
L
Verlust im j-ten Szenario
XII
j
L
Multifaktor-Copula Modell (Hull und White 2004): LGD des j-
ten Schuldners
)
t
(
L
j
Sektorspezifischer Verlust zum Zeitpunkt t
ji
L
Verlust des j-ten Schuldners bei stochastischer Recovery Rate
rs
L
Verlust bei r Ausfällen im Pool X und s Ausfällen im Pool Y
t
L
Ausfallquote des Portfolios zum Zeitpunkt
t
q
i
t
t
L
,
L
Ausfallquoten des Portfolios zum Zeitpunkt
1
t bzw.
q
t
)
t
(
L
Kumulierte Verluste des Portfolios zum Zeitpunkt t
)
v
(
L
Bedingter prozentualer Verlust des Portfolios
hom
L
Verlust des homogenen Teils des Gesamtportfolios
L
~
Komonotoner Ausfallpfad
q
i
t
t
L
~
,
L
~
Ausfallquoten des komonotonen Ausfallpfades zum Zeitpunkt
1
t
bzw.
q
t
m
Anzahl der Faktoren
)
max(
Maximum
)
min(
Minimium
i
M
LGD des Schuldners i
)
t
(
MGF
W
Momenterzeugende Funktion von W zum Zeitpunkt t
n
Anzahl der Assets im Referenzpool
n
Historische Ausfallraten (Li 2000): Obere Grenze des
betrachteten Zeitintervalls
x
n
p
Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Sicherheit bis zum Ende
des Jahres n nicht ausfällt, vorausgesetzt sie hat bereits x Jahre
,,überlebt",
N
Nominalwert des Sub-Portfolios
)
t
(
N
i
Ausfallindikator des Schuldners i zum Zeitpunkt t
0
N
Nominalwert des einzelnen Assets
)
t
(
N
),
t
(
N
2
1
Frailty Modell (Schönbucher 2003): Dem Schuldner 1 bzw. 2
zugeordneter Poisson-Prozess
i
NW
Nominalwert der Tranche i
XIII
Pool
NW
Nominalwert des Collateral Pools
senior
NW
Summe der Nominalwerte aller übergeordneten Tranchen
i
Tranche
Ratio
C
O
-
/
Kennzahl des Overcollateralization-Tests für Tranche i
p
Ausfallwahrscheinlichkeit
p
LH+ Ansatz (Greenberg et al 2004): Durchschnittliche
Ausfallwahrscheinlichkeit des Sub-Portfolios
p
Durchschnittliche Ausfallwahrscheinlichkeit
A
p
Ausfallwahrscheinlichkeit von Schuldner A
T
AAA
p
Ausfallwahrscheinlichkeit für ein AAA geratetes Asset mit
Laufzeit T
AB
p
Gemeinsame Ausfallwahrscheinlichkeit der Schuldner A und B
B
|
A
p
Bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners A
B
p
Ausfallwahrscheinlichkeit von Schuldner B
A
|
B
p
Bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners B
j
i
p
,
p
Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners i bzw. j
ji
p
Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners i bei stochastischer
Recovery Rate
k
p
Wahrscheinlichkeit, dass der Verlust bis zum Zeitpunkt T im k-
ten ntervall auftritt
Tranche
Senior
p
-
Ausfallwahrscheinlichkeit der Senior Tranche
V
|
i
t
p
Bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners i zum
Zeitpunkt t (bedingt durch V)
j
W
i
t
p
|
Bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners i zum
Zeitpunkt t (bedingt durch
j
W )
k
,
t
p
Wahrscheinlichkeit für k Ausfälle im Portfolio zum Zeitpunkt t
)
(k
p
T
Wahrscheinlichkeit, dass der gesamte Verlust bis zum
Zeithorizont T im k-ten Intervall liegt
X
p
Ausfallwahrscheinlichkeit des Pools X
T
X
p
Ausfallwahrscheinlichkeit für eine Sicherheit mit Rating x und
Laufzeit T
XIV
Y
p
Ausfallwahrscheinlichkeit des Pools Y
0
p
Ausfallwahrscheinlichkeit des einzelnen Assets
2
,
2
p
Gemeinsame Wahrscheinlichkeit, dass zwei verschiedene Assets
in Periode 2 ausfallen
)
v
(
p
Bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit
)
v
(
p
Durchschnittliche bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit des
Portfolios
P
Nominalwert des Portfolios
j
P
Wahrscheinlichkeit für j Ausfälle im Pool
XY
P
Wahrscheinlichkeit, dass r Assets in Pool X und s Assets in Pool
Y ausfallen
)
(
P
Wahrscheinlichkeitsfunktional
)
,
( T
k
P
Wahrscheinlichkeit, dass der Verlust bis zum Zeitpunkt T im k-
ten Intervall oder höher liegt
[
]
(
)
2
1
T
,
T
,
k
P
Wahrscheinlichkeit, dass ein Verlust sich in der Mitte des
Intervalls k befindet und zwischen
1
T und
2
T auftritt
(
)
2
1
T
,
T
,
t
P
Bedingte gemeinsame Überlebenswahrscheinlichkeit beider
Schuldner (bedingt durch die zum Zeitpunkt t verfügbare
Information)
( )
t
Po
Poisson-Approximation mit Parameter
t
( )
V
P
i
|
)
(
Diskrete Verteilung für
i
l
*
P
Nominalwert des homogenen Portfolios
PV
Bedingter Erwartungswert des Portfoliowertes
q
Überlebenswahrscheinlichkeit
V
|
i
t
q
Bedingte Überlebenswahrscheinlichkeit des Schuldners i zum
Zeitpunkt t (bedingt durch V)
j
W
|
i
t
q
Bedingte Überlebenswahrscheinlichkeit des Schuldners i zum
Zeitpunkt t (bedingt durch
j
W )
n
:
k
,
t
q
Wahrscheinlichkeit, dass die Ausfallquote des Portfolios zum
Zeitpunkt t kleiner gleich
1
k
-
von n Ausfällen beträgt
XV
n
x
q
+
Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Sicherheit im nächsten
Jahr ausfällt, vorausgesetzt sie hat bereits
n
x
+
Jahre ,,überlebt"
Q
Ausfallkorrelation
AB
Q
Ausfallkorrelation zweier Schuldner A und B
)
(
Q
Risikoneutrales Maß
(
)
k
|
t
Q
Risikoneutrale bedingte kumulative Ausfallwahrscheinlichkeit
zum Zeitpunkt t
r
Anzahl der Ausfälle im Pool X
R
Recovery Rate
R
LH+ Ansatz (Greenberg et al 2004): Recovery Rate des Sub-
Portfolios
i
R
Recovery Rate des i-ten Schuldners
it
R
Return des Assets i über Periode t
0
R
Recovery Rate des einzelnen Assets
)
(
R
Recovery Rate-Funktion
d
R
Zum d-dimensionalen Vektor V zugehöriger Definitionsbereich
der reellen Zahlen
s
Anzahl der Ausfälle im Pool Y
)
(
S
Rand-Survivalfunktion
)
(
S
Survivalfunktion
t
Zeitpunkt
t
Survival-Funktion (Li 2000): Anzahl der Jahre
v
t
Verteilungsfunktion der Standardunivariaten Student t
T
Survival-Funktion (Li 2000): ,,Time-Until-Default"-
Zufallsvariable
T
Zeithorizont
A
T
,,Time-Until-Default"-Zufallsvariable des Schuldners A
B
T
,,Time-Until-Default"-Zufallsvariable des Schuldners B
u
Modell der stochastischen Recovery Rates (Sidenius 2004):
Beliebige positive Verlusteinheit
v
,
u
Realisation
XVI
i
u
i-tes Element der Copula-Funktion
)
(k
u
Den durchschnittlichen Verlust und den LGD des j-ten
Schuldners beinhaltendes Intervall
V
,
U
Zufallsvariablen
V
Wert der Assets eines Unternehmens, fallweise mit Index i bzw. n
V
Systematischer Risikofaktor
i
V
Schuldner i zugeordnete exponentialverteilte Zufallsvariable mit
Erwartungswert Eins
i
V
Unsystematischer Risikofaktor des Unternehmens i
( )
k
m
V
Wert des Marktindexes bzw. der Markttranchen in Abhängigkeit
des jeweiligen Wertes von
k
max
V
Summe der Einzelwerte für eine sehr hohe Hazard Rate
min
V
Summe der Einzelwerte für eine Hazard Rate gleich Null
)
(
V
Varianz
Var
Varianz
i
w
Prozentualer Anteil des Assets i am Gesamtexposure
k
w
Zum jeweiligen
k
zugehörige Gewichtung der
Linearkombination
W
Allen Schuldnern eines bestimmten Industriesektors zugeordneter
systematischer Risikofaktor
W
Student-t Copula (Burtschell et al 2005a): Gewichtungsfaktor der
latenten Variable
W
Idiosynkratischer Risikofaktor
i
W
Wert eines Assets im Portfolio
)
i
(
t
W
Asset i zugeordneter Wiener Prozess in der Periode t
)
t
(
W
Brownsche Bewegung
x
Survival-Funktion (Li 2000): Jahre, die die betrachtete Sicherheit
bereits überlebt hat
x
WARF (Heidorn und König 2003): Rating der betrachteten
Sicherheit
y
,
x
Realisation
XVII
i
x
Prozentualer Ausfall bei i Ausfällen im Portfolios
i
X
Wert des Assets i
i
X
Indikatorvariable für Asset i
X
v
Zafallsvariable
Y
,
X
Zufallsvariablen
Y
,
X
Moody´s Double BET: Referenzpool
Y
,
X
Komonotone Ausfallpfade (Bluhm und Overbeck 2005b): Risiken
des Wahrscheinlichkeitsraums
(
)
,
,
y
Anzahl der Jahre
Y
Systematisches Risiko
Y
Das Frailty Modell (Schönbucher 2003): Stetige, nichtnegative
Frailty-Zufallsvariable
2
1
Y
,
Y
Frailty-Zufallsvariable des Schuldners 1 bzw. 2
Z
d-dimensionaler Vektor aus unabhängigen Variablen
i
Z
Z
Komonotone Ausfallpfade (Bluhm und Overbeck 2005b): Auf
dem Einheitsintervall uniform verteilte Zufallsvariable
)
i
(
t
Z
Asset i zugeordnete standardnormalverteilte Zufallsvariable in
Periode t
Abkürzungsverzeichnis
ABS
Asset Backed Securities
Adj.
Adjustment
ADS
Alternativer Diversity Score
BET
Binomial Expansion Technique
BMA
Bond Market Association
bspw.
beispielsweise
CB Methode
Correlated Binomial Methode
CBO
Collateralized Bond Obligation
CDO
Collateralized Debt Obligation
CDS
Credit Default Swap
CLN
Credit Linked Notes
CLO
Collateralized Loan Obligation
CLT Methode
Central Limit Theorem Methode
CMBS
Commercial Mortgage Backed Securities
CML Method
Canonical Maximum Likelihood Method
CMSA
Commercial Mortgage Securities Association
Darst.
Darstellung
d.h.
das heißt
DS
Diversity Score
EAD
Exposure at Default (Erwarteter ausstehender Forderungsbetrag
bei Ausfall)
EL
Expected Loss (Erwarteter Verlust)
EURIBOR
Euro Interbank Offered Rate
evtl.
eventuell
FER
Financial Enhancement Rating
FFELP
Federal Family Education Loan Program
FLP
First Loss Piece
ggü.
gegenüber
GB
Great Britain
GOF Test
Goodness-of-fit Test
HEL
Home Equity Loan
XIX
HELOC
Home Equity Lines of Credit
HPM
Homogeneous Pool Model
IBAA
Investment Bankers Association of America
I/C-Test
Interest Coverage-Test
i.d.R.
in der Regel
IG
Investment Grade
IFM Method
Inference Functions for Margins Method
IHK
Industrie- und Handelskammer
IRP
Investor Reporting Package
Jg.
Jahrgang
Jr.
Junior
KfW
Kreditanstalt für Wiederaufbau
LADS
Latein Amerika Diversity Score
LGD
Loss Given Default (Verlust bei Ausfall)
LHP
Large Homogeneous Portfolio
Ltd.
Limited
LTV
Loan-To-Value
MBET
Multi Binomial Expansion Method
MBS
Mortgage Backed Securities
MC
Monte Carlo
MGF Methode
Moment Generating Function Methode
Mill.
Million
Mrd.
Milliarde
NRSRO
Nationally Recognised Statistical Rating Organisation
O/C-Test
Overcollateralization-Test
OSA
Obligator Specific Approach
PCL
Portfolio Correlation Level
PD
Probability of Default (Ausfallwahrscheinlichkeit)
PGF
Probability Generating Function (Wahrscheinlichkeitserzeugende
Funktion)
PROMISE
Promotional Mittelstands Loan Securitisation
PROVIDE
Provide-Residential Mortgage Securitisation
Q
Quartal
RDR
Rating Default Rate
XX
REIT
Real Estate Investment Trust
RF
Ratingfaktor
RLR
Rating Loss Rate
ROE
Return on Equity
RRR
Rating Recovery Rate
RV
Recreational Vehicle
S&P
Standard and Poor´s
SEC
Securities & Exchange Commission
SPV
Special Purpose Vehicle
STCDO
Standardized Synthetic Single-Tranche CDO
u.a.
unter anderem
UK
United Kingdom
U.S.
United States
USA
United States of America
Vgl.
Vergleiche
WARF
Weighted Average Rating Factor
z.B.
zum Beispiel
1.
Einleitung
1.1
Problemstellung
Die internationalen Kredit- und Kapitalmärkte waren in den letzten Jahren durch starke
strukturelle Veränderungen geprägt. Die Verbriefung von Vermögenswerten (Asset
Securitisation) als alternative Form der Unternehmensfinanzierung hat in großem Maße
das Interesse der Marktteilnehmer auf sich gelenkt. Durch die Verbriefung des zugrun-
deliegenden Referenzportfolios (Pool) erfolgt ein direkter Transfer von Risiken zum
Kapitalmarkt. Ursprünglich evtl. nicht handelbare Assets werden dadurch handelbar
gemacht: ,,Eine neue Dimension des Kapitalmarktes" (Krahnen 2005, S. 499).
Die in jüngster Zeit entstandenen Collateralized Debt Obligations (CDOs) sind struktu-
rierte Finanztransaktionen und bilden eine Unterkategorie der Asset Backed Securities
(ABS), d.h. der mit bestimmten Vermögenswerten unterlegten Wertpapieren. Sie
verbriefen unterschiedlich priorisierte Ansprüche auf die Vermögenswerte des Pools
und erzeugen so unterschiedliche Tranchen mit spezifischen Risiko/Ertrags-Profilen.
Das Wachstum dieses Marktsegments ist enorm: Betrug das weltweite CDO-
Emissionsvolumen 2004 noch 157,4 Mrd. $, waren es bereits im 3. Quartal 2006 rund
322 Mrd. $, d.h. eine Steigerung von 104,6% (vgl. BMA 2006). Zudem wurden Kredit-
derivat-Indizes wie iTraxx und CDX eingeführt und neue, exotische CDO-Strukturen
entwickelt, deren Bewertung noch ein offenes Forschungsfeld darstellt.
Zur Einschätzung des Risikos der CDO-Strukturen werden von den weltweit führenden
Ratingagenturen Moody´s Investors Service, Fitch Ratings und Standard and Poor´s
Ratings vergeben. Ratingagenturen sind eine sehr wichtige Komponente des CDO-
Marktes, da Investoren oft nur unzureichend über den als Sicherheit dienenden Refe-
renzpool informiert sind und die Komplexität von CDO-Transaktionen nicht vollständig
verstehen.
Allerdings unterscheiden sich sowohl der Aussagegehalt der Agentur-Ratings als auch
deren zugrundeliegende Annahmen und methodische Erstellung fundamental. Markt-
teilnehmer sind somit einer Fehleinschätzung des tatsächlichen Risikos ausgesetzt. Zu-
sätzlich verlangt die fehlende Markttransparenz und die Abhängigkeit von den Ratinga-
genturen nach alternativen Modellierungsansätzen zur CDO-Bewertung.
Die Bewertung strukturierter Finanzprodukte wie CDOs basiert meist auf einer Szena-
rientransformation von der Asset-Seite der Struktur zur Seite der Verbindlichkeiten (Li-
ability-Side) (siehe Bluhm und Overbeck 2005, S. 39). Neben der Ausfallwahrschein-
lichkeit jedes einzelnen Schuldners müssen dabei auch Annahmen über Rückflussquo-
2
ten (Recovery Rates), die zeitliche Struktur der Ausfälle und vor allem Ausfallkorrelati-
onen getroffen werden.
Die hohe Komplexität durch die nichtlineare und zeitabhängige Beziehung zwischen
Cash Flow und zugrundeliegender Sicherheit macht CDO-Ratings sowie die verwende-
ten Verfahren zur Erstellung solcher Ratings zu einem hochinteressanten und längst
noch nicht abgeschlossenem Forschungsgebiet.
1.2
Gang der Untersuchung
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Grundlagen einer CDO-Transaktion und einen Ü-
berblick der Marktentwicklung sowie Grundlagen der Ratingerstellung zu vermitteln
und die zugrundeliegenden Modelle der Agentur-Ratings sowie theoretische Modelle
aus der Literatur und alternative Modellansätze zu erläutern und zu analysieren.
Im zweiten Kapitel werden zuerst die Grundlagen von CDOs behandelt. Neben Grund-
struktur, Ausprägungen und Eigenschaften einer CDO werden zudem die Ziele des E-
mittenten, die Entwicklung des Marktes für Kreditrisikotransfer und die Verbriefungs-
technik beschrieben.
Kapitel 3 befasst sich mit den Rating-Grundlagen, die für das weitere Verständnis der
Arbeit elementar sind. Dabei werden wichtige Begriffe und Rating-Elemente sowie de-
ren Bedeutung für den Ratingprozess erläutert. Außerdem werden das Risiko struktu-
rierter Kreditprodukte, die Konstruktion von Kreditkurven und Copula-Funktionen er-
klärt.
In Kapitel 4 wird schließlich der Schwerpunkt der Arbeit behandelt: Die Beschreibung
und Analyse der Ratingverfahren und Bewertungsmodelle. Dazu zählen die Ratingver-
fahren der drei führenden Ratingagenturen und theoretische Modelle wie Copula-
Ansätze, Single- und Multi-Step-Modelle sowie Vereinfachungen des Monte Carlo-
Verfahrens. Schließlich werden noch aktuelle Modellansätze dargestellt, darunter auch
Modelle zur Bewertung exotischer CDO-Strukturen.
Kapitel 5 fasst die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt einen kurzen Überblick
über die Auswirkungen des Kreditrisikohandels auf die Finanzsystemstabilität.
2.
Grundlagen
2.1
Einordnung von CDOs in den Bereich der ,,Asset Backed" Produkte
Im Gegensatz zu traditionellen ABS-Transaktionen ist die Anzahl identischer Schuldner
in einer CDO sehr viel geringer, d.h. dem einzelnen Ausfall kommt eine höhere Be-
3
deutung zu. Im Oberbegriff werden Ansprüche aus der Verbriefung eines Portfolios von
Bankkrediten (Collateralized Loan Obligations bzw. CLOs) und jene von Unterneh-
mensanleihen (Collateralized Bond Obligations bzw. CBOs) oft als CDOs zusammen-
gefasst.
CDOs werden durch drei Kriterien klassifiziert: Art der zugrundeliegenden Assets, wirt-
schaftlicher Zweck und Risikotransfer (siehe Darst. 1).
Criteria
Characteristics
CDO Type
Asset Type
Bonds
Loans
Entities, Mixed Portfolios
Structured Finance Securities
Collateralized Bond Obligation (CBO)
Collateralized Loan Obligation (CLO)
Collateralized Debt Obligation (CDO)
CDO of ABS/MBS, CDO of CDO
Motivation
Arbitrage
Risk Management
Financing
Arbitrage CDO
Balance Sheet CDO
Cash Flow/Arbitrage CDO
Risk Transfer True Sale
Synthetic
True Sale + Synthetic
Cash Flow CDO
Synthetic CDO
Hybrid CDO
Darst. 1:
Charakteristiken verschiedener CDO Typen
Quelle: Fitch Ratings Ltd. (2006), S. 2
2.2
Ablauf einer CDO Transaktion
2.2.1
Grundstruktur
Eine CDO Transaktion beruht zunächst auf einer speziell für die Transaktion gegrün-
dete Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV), die in ein Portfolio verschie-
dener Referenzassets investiert. Zur Finanzierung veräußert sie dann Wertpapiere, wel-
che durch die übertragenen Forderungen besichert sind. Die Wertpapiere werden in Se-
nior-, Mezzanine- und Junior-Tranchen begeben, wobei die rangniedrigeren Tranchen
Verluste von ranghöheren Tranchen auffangen. Die Equity-Tranche, auch First Loss
Piece (FLP) genannt, dient dabei den höherrangigen Tranchen als erster ,,Puffer". Je
niedriger der Rang einer solchen Tranche, desto höher das Risiko und die in Aussicht
stehenden Zahlungen an die Investoren.
4
2.2.2
Beteiligte Parteien
Darst. 2 gibt einen allgemeinen Überblick über die Zusammenhänge und beteiligten
Akteure einer strukturierten Finanzierung. Es muss insbesondere die Konkurssicherheit
und eigenständige Corporate Identity des SPV gewährleistet sein sowie eine rechtliche
Trennung und wirtschaftliche Selbständigkeit vom Originator. Wichtigste Aufgaben der
Ratingagenturen sind die Überprüfung der rechtlichen Konstruktion der Transaktion mit
all ihren Beteiligten sowie die Vergabe von Ratings für die verschiedenen Tranchen.
Darst. 2:
Schematischer Überblick einer strukturierten Finanzierung
Quelle: Ausschuss für das weltweite Finanzsystem (2005), S. 6
2.3
Drei Hauptgruppen von CDOs
In der Literatur unterscheidet man zwischen den Hauptgruppen Cash Flow- /Market
Value- / und synthetische CDOs (vgl. . Standard & Poor´s 2002, S. 4-5 sowie Heidorn
und König 2003, S. 4-7).
Bei einer Cash Flow-CDO spielen Schwankungen im Marktwert der Sicherheiten nur
eine untergeordnete Rolle: Im Rahmen eines True Sales werden die Assets mitsamt den
Risiken verkauft, Zins- und Tilgungszahlungen aus den Assets werden über die gesamte
Laufzeit zur Befriedigung der Verbindlichkeiten der besicherten Wertpapiere verwen-
det.
Für Marktwert-CDOs hingegen ist die tägliche Marktperformance des Sicherheiten-
pools von großer Bedeutung: Der Marktwert bildet die eigentliche Sicherheit der Emis-
5
sion. Bei Marktwert-Transaktionen ist daher stets ein Portfoliomanager beteiligt, der
durch den Handel mit Vermögenswerten versucht, den Cash Flow des Referenzpools zu
erhöhen.
Bei synthetischen CDO-Transaktionen bleiben die Forderungen in der Bilanz des Risi-
koverkäufers und einzig das Ausfallrisiko des definierten Portfolios wird über einen
Basket-CDS (Credit Default Swap) an das SPV transferiert. Diese Form ist in den letz-
ten Jahren sehr populär geworden, da der Verkauf von Unternehmenskrediten i.d.R.
nicht ohne Zustimmung des Schuldners möglich ist. Über Credit Linked Notes (CLN)
ist es schließlich möglich, an der Performance eines Referenzportfolios teilzuhaben.
2.4
Coverage Tests
Als Frühwarnung für nicht ausreichende Zahlungsströme an die Investoren sind soge-
nannte Coverage Tests entwickelt worden, die für alle Tranchen außer der Equity Tran-
che durchgeführt werden (vgl. Lucas, Goodman und Fabozzi 2006, S.20-22 sowie
Bluhm, Overbeck und Wagner 2003, S.243-249). Die bekanntesten sind der Overcolla-
teralization-Test (O/C-Test) und der Interest Coverage-Test (I/C-Test). Die so berech-
neten Deckungsquoten für investiertes Kapital (principal) und Zinsen (interest) werden
mit einem entsprechenden Schwellenwert verglichen. Sind sie größer als dieser Wert, ist
der Test bestanden.
2.4.1
O/C-Test
Der Overcollateralization-Test berechnet die Principal-Deckungsquote der Tranche und
aller ihr übergeordneten Tranchen in Relation zum Volumen des Collateral Pools.
Sei
Pool
NW
der Nominalwert des Collateral Pools,
i
NW der Nominalwert der betrach-
teten Tranche und
senior
NW
die Summe der Nominalwerte aller ihr übergeordneten
Tranchen
1
, so ergibt sich:
(1)
senior
i
Pool
Tranche
NW
NW
NW
Ratio
C
O
i
+
=
-
/
.
1
Zum besseren Verständnis folgt in den Beschreibungen der Tests eine Abweichung der in der Literatur
verwendeten Notation.
6
2.4.2
I/C-Test
Der Interest Coverage-Test berechnet die Interest-Deckungsquote der Tranche und aller
ihr übergeordneten Tranchen in Relation zum Netto-Kupon des Pools.
Sei
Pool
K
der Kupon des Referenzpools,
i
K die Kupons der Tranche i und
senior
K
die
Summe aller Kupons der ihr übergeordneten Tranchen, so ergibt sich:
(2)
senior
i
Pool
Tranche
K
K
K
Ratio
C
I
i
+
=
-
/
.
2.5
Der Cash Flow Waterfall
Eine wichtige Rolle haben die erläuterten Coverage Tests im sogenannten ,,Waterfall"-
System, wobei unterschieden wird zwischen Interest- und Principal-Cash Flow Water-
fall.
Bevor die Zinszahlung an die oberste Tranche erfolgt, werden zunächst Gebühren,
Steuern usw. beglichen und anschließend die restlichen Tranchen, bei Bestehen der Co-
verage Tests, nach ihrer Rangordnung bedient. Wie bei einem Wasserfall ,,fließt" auch
das investierte Kapital am Ende der Anlagedauer, angefangen bei der Senior Tranche,
wieder zu den Anlegern zurück. Ausführlicher wird der Kapitalfluss in Anhang 1 erläu-
tert.
2.6
Ziele bei der Emission von CDOs
In einem Marktumfeld mit niedrigen Zinssätzen stehen bei den Investoren u.a. die att-
raktiven Risiko/Ertrags-Profile eines strukturierten Finanzinstruments im Blickpunkt.
Für die Emittenten von CDOs gibt es drei wesentliche Beweggründe (vgl. Bluhm und
Overbeck 2004, S.419-429
sowie Fender und Mitchell 2005, S.78-79).
Erstens die Freisetzung von aufsichtsrechtlichem bzw. ökonomischem Kapital: Die An-
zahl der unerwarteten Ausfälle reduziert sich auf nur die in der selber gehaltenen Tran-
che und somit sinkt die notwendige Eigenkapitalunterlegung. Zudem wird eine Steige-
rung des ROE (Return on Equity) erzielt. Zweitens Arbitragemöglichkeiten, die auf der
Hoffnung des FLP-haltenden Emittenten beruhen, durch den Excess Spread (Über-
schussmarge) überkompensiert zu werden. Und drittens der Zugang zu neuen Finanzie-
rungsquellen und der damit verbundene Risikotransfer vom Emittenten zum Markt. Zu-
dem profitieren spezialisierte Kreditinstitute vom eigenen spezifischen Bonitätsbeurtei-
7
lungswissen und erreichen eine Optimierung der Kreditportfoliostruktur trotz Fokussie-
rung der Kreditvergabe auf bestimmten Märkten
2
.
2.7
Der Markt für Kreditrisikotransfer
2.7.1
Historische Eckdaten
Mit Bürgschaften, Garantien und Kreditversicherungen gibt es schon lange Produkte
zum Transfer von Kreditrisiken, doch erst seit den 1970er Jahren hat sich ein eigenstän-
diger Markt entwickelt
3
, einer der am schnellsten wachsenden Finanzmärkte aller Zeiten
(vgl. Deutsche Bundesbank 2004). Die erste CDO-Transaktion wurde 1987 durchge-
führt, die ersten CBO´s kamen Ende der 1980er Jahre auf den Markt, CLOs Mitte der
1990er Jahre. Im Mai 2005 wurde durch Unternehmens-Downgrades (Ford und General
Motors) eine Welle von großen CDO-Verlusten unter Wall Street Händlern ausgelöst,
doch der Markt hat sich zu einem der bedeutendsten Finanzmarktsegmenten der letzten
Dekade entwickelt (vgl. Lucas, Goodman und Fabozzi 2006, S.5-7 und Longstaff und
Rajan 2006, S.1-4).
4
2.7.2
Marktindizes iTraxx und CDX
Ein wichtiger Grund für das schnelle Wachstum des CDO-Marktes war u.a. die Einfüh-
rung von Kreditderivat-Indizes und der damit verbundene aktive Handel mit standardi-
sierten Tranchen. So beschlossen die Betreiberbanken 2004, sämtliche Index-
Aktivitäten in die beiden Indizes iTraxx (Europa) und CDX (Nordamerika) zusammen-
zuführen, um der Nachfrage nach ,,maßgeschneiderten" Produkten gerecht zu werden
(vgl. Gruber und Schmid 2005, S. 5-7).
Poppel (2005) prognostiziert völlig neue Handels- und Risikomanagementstrategien, da
sich die Preise für standardisierte CDO-Tranchen nun aus Angebot und Nachfrage am
Markt bilden können.
2.7.3
Neuere CDO-Formen
Aus den Marktindizes resultierten liquide Märkte für Index-CDS (Credit Default
Swaps) und sogenannte STCDOs (Standardized Synthetic Single-Tranche CDOs), bei
2
Für eine ausführliche Darstellung sei auf den Beitrag von Gann und Hofmann (2005) verwiesen.
3
Gorton und Pennacchi (1995) erklären in ihrem Beitrag formal die Entstehung dieses Marktes.
4
Ergänzende Einblicke in die Entwicklung des CDO-Marktes liefern die Beiträge von Duffie und Gârle-
anu (2001) sowie Duffie und Singleton (2003).
8
denen nur eine einzige Tranche bzw. ein bestimmtes Level des Portfoliorisikos an die
Investoren übertragen wird.
Weitere exotischen CDO-Strukturen auf dem heutigen Markt sind z.B. CDOs of ABS,
mit Asset Backed Securities als Underlyings, oder auch
2
CDO (CDOs of CDO), bei
denen das Referenzportfolio wiederum aus CDO-Tranchen besteht und ein doppelter
Tranchierungseffekt erzielt wird. Neu sind auch sogenannte ,,hybride" CDOs, die so-
wohl synthetische als auch Cash Assets beinhalten.
2.7.4
Das PROMISE- und PROVIDE-Programm der KfW
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) trägt als deutsche Förderbank maßgeblich
zur Entwicklung des Verbriefungsmarktes bei. Mit dem Ziel der Verbriefung von Mit-
telstandskrediten hat die KfW im Jahr 2000 ihr Verbriefungsprogramm PROMISE
(Promotional Mittelstands Loan Securitisation) aufgelegt. 2001 folgte das Verbrie-
fungsprogramm PROVIDE (Provide-Residential Mortgage Securitisation), das auf die
Verbriefung von privaten Wohnungsbaukrediten abzielt. Die KfW fungiert dabei als
wettbewerbsneutraler Intermediär, stellt eine standardisierte Infrastruktur bereit, stärkt
somit den Sekundärmarkt und sorgt für eine regulatorische Eigenkapitalentlastung
(vgl. KfW 2006). Eine Darstellung der PROMISE/PROVIDE-Struktur ist in Anhang 2
zu finden.
2.7.5
Der CDO-Sekundärmarkt
Die Bedeutung des Sekundärmarktes (d.h. der Handel mit bereits emittierten CDOs) hat
in den letzten Jahren stark zugenommen. Gründe hierfür waren der signifikante Anstieg
an verfügbaren Informationsressourcen und Bewertungsmodellen für CDO-
Transaktionen. Bewertungsproblematik ergibt sich aufgrund hoher Informationskosten
und der Liquiditätsprämie, die durch den hohen Analyseaufwand entsteht.
5
2.7.6
Statistische Daten und aktuelle Situation
Die Bond Market Association (BMA)
6
veröffentlicht auf ihrer Homepage seit Anfang
2004 quartalsmäßig weltweite CDO-Emissionsdaten (siehe hierzu BMA 2006).
5
Für eine weiterführende Diskussion des Sekundärmarktes sei auf die Beiträge von Klug und Kurtas
(2003) sowie Douglas, Goodman und Fabozzi (2006), S.381-410 verwiesen.
6
1912 wurde die Investment Bankers Association of America (IBAA) gegründet, die 1997 ihren Namen
in Bond Market Association (BMA) änderte. Sie versteht sich als Plattform und Informationskanal für
Regulatoren und Öffentlichkeit und unterstützt die professionelle Entwicklung des Verbriefungsmarktes.
9
Daraus geht hervor, dass 2006 (1.-3. Quartal) hauptsächlich strukturierte Finanzierun-
gen (61,27%) und High Yield Loans (32,14%) als Sicherheiten der verbrieften Wertpa-
piere dienten (siehe Darst. 3).
Darst. 3:
Zugrundeliegende Sicherheiten weltweiter CDO-Emissionen 2006 (1.-3.
Quartal)
Quelle: Eigene Darstellung
Die gesamten weltweiten CDO-Emissionen stiegen 2005 um 58,38%, von 157,4185
Mrd. $ in 2004 auf 249,3183 Mrd. $. Im dritten Quartal 2006 betrug das Emissionsvo-
lumen 117,7691 Mrd. $, 131% mehr als zum selben Zeitpunkt in 2005. Das gesamte
Emissionsvolumen 2006 (1.-3. Quartal) betrug 322,0095 Mrd. $. Cash Flow-CDOs und
hybride Strukturen waren dabei mit 82,24%
der häufigste CDO-Typ, synthetische
CDOs hatten einen Anteil von 11,34% ,
Marktwert-CDOs nur 6,42% (vgl. Darst. 4).
89,13% aller Emissionen waren Arbitrage-CDOs und dominierende Währung der
Transaktionen war der US-Dollar (82,38%), gefolgt vom Euro (14,93%)
7
.
Aufgrund des weltweit starken Wachstums des CDO-Marktes hat z.B. die Commercial
Mortgage Securities Association (CMSA) mit Sitz in New York damit begonnen, Re-
porting Standards für CDOs zu entwickeln (vgl. CMSA 2006). Ein solches Investor
Reporting Package (IRP) gibt es bereits für den CMBS (Commercial Mortgage Backed
Securities) Markt und soll zur Transparenz und Stärkung des CDO-Marktes beitragen.
7
Siehe Anhang 3 für eine detaillierte Darstellung der Marktsituation.
Structured
Finance
61,27%
Investment
Grade Bonds
2,55%
High Yield
Bonds
0,54%
High Yield
Loans
32,14%
Other Swaps
0,17%
Mixed
Collateral
1,30%
Other
2,04%
10
0
20
40
60
80
100
120
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3
Cash Flow and Hybrid
Synthetic Funded
Market Value
2004 2005 2006
Darst. 4:
Weltweite CDO-Emissionen (in Mrd. $) pro Quartal nach CDO-Typ
Quelle: Eigene Darstellung
2.8
Verbriefungstechnik
2.8.1
Der Transformationsvorgang
Das grundsätzliche Bewertungsschema für Portfolio-referenzierte Kreditprodukte ist in
Darst. 5 verdeutlicht.
Darst. 5:
Das CDO Modellierungs-Schema
Quelle: Bluhm et al (2003), S. 265
11
Auf der linken Seite (Asset Side) befindet sich der dem Portfoliomodell zugrunde lie-
gende Wahrscheinlichkeitsraum, der die Unsicherheit der Assets erfasst. Mit Hilfe einer
Zufallsvariable, die durch die Transaktionsstruktur eindeutig festgelegt ist, werden Sze-
narien dieser Seite auf die rechte Seite (Liability Side) transformiert. Ein durch ,,Map-
ping" erstelltes Liability-Szenario kann dabei als Vektor verstanden werden, der alle
relevanten Performancefaktoren der ausgegebenen Wertpapiere beinhaltet. Unsicherheit
in der Performance auf der Liability Side entsteht also durch Unsicherheit in der Per-
formance der Asset Side (vgl. Blum und Overbeck 2004, S. 429-432).
2.8.2
Tranchierung als grundlegende Technik
Das Aufteilen der Verbindlichkeiten in Tranchen ist ein spezifisches Merkmal und ein
Hauptfaktor der Komplexität strukturierter Finanzprodukte. Durch die Tranchenbildung
können eine oder mehrere Wertpapierklassen geschaffen werden, deren Rating über
dem Durchschnittsrating der Assets des Referenzpools liegt. Das Risikoprofil einer
Tranche wird bestimmt durch ihren Rang (definiert durch die Untergrenze der Tranche)
und ihres Volumens (thickness). Je niedriger der Rang, desto risikoreicher ist die Tran-
che wegen der in 2.5 beschriebenen kaskadenartigen Bedienung der Wertpapierklassen.
Risikoreicher wird eine Tranche auch, je schmaler sie ist, da weniger Kreditausfälle
ausreichen, um einen Totalverlust zu verursachen (vgl. Gibson 2004, S.6-12 sowie Fen-
der und Mitchell 2005, S.88). Tranchierung schafft somit Wertpapiere mit unterschied-
lichen Risiko/Ertrags-Profilen für ein breites Feld von Anlegern.
2.8.3
Optimale Strukturierung einer Kreditportfolioverbriefung
Aufgrund von Informationsasymmetrie sehen Duffee und Zhou (2001) sowie Gorton
und Pennacchi (1995)
die Einbehaltung eines Teils der Forderungen als Voraussetzung
für eine erfolgreiche Verbriefung
8
. Die Rückzahlungserwartungen eines Kredites hän-
gen wegen des Relationship-Charakters der Kreditbeziehungen wesentlich von den Mo-
nitoring-Aktivitäten des Kreditgebers während der Kreditlaufzeit ab. Die Kreditbezie-
hung ist somit einem Moral Hazard ausgesetzt. Durch eine nicht-proportionale Auftei-
lung der Cash Flows aus dem Referenzportfolio (Tranchierung) lassen sich die Kosten
der externen Finanzierung reduzieren und es werden abgestufte Informationsbedürfnisse
zwischen den einzelnen Investorenklassen geschaffen. Die kreditgebende Bank wird das
FLP selbst übernehmen, um ein Signal der Selbstbindung gegenüber den Investoren zu
8
Die folgenden Ausführungen stützen sich weitgehend auf Krahnen (2005).
12
erzeugen
9
. Während der Besitz der Mezzanine und Junior Tranchen einen Überwa-
chungsaufwand und somit erhöhte Refinanzierungskosten erfordert, kann die Senior
Tranche ohne Erhöhung der Überwachungskosten auf beliebig viele Investoren verteilt
werden. Bei der Tranchierung sollte der Anteil der Emission maximal werden, der für
Außenstehende erkennbar frei von idiosynkratischem Risiko ist.
2.8.4
Ein einfaches Beispiel zur Erklärung des Verbriefungsvorgangs
Die folgende beispielhafte und stark vereinfachte CDO-Transaktion basiert auf dem
Beitrag von Longstaff und Rajan (2006).
Gegeben sei ein Portfolio bestehend aus 100 Unternehmensanleihen mit einem Markt-
wert von je 1 Million $ und einer Laufzeit von 5 Jahren. Jede Anleihe ist von einem
unterschiedlichen Unternehmen begeben worden, besitze ein Rating von BBB (mittlere
Qualität) und einen Kupon Spread (Aufschlag auf einen Referenzzinssatz, z.B. EURI-
BOR) von 1%.
Basierend auf diesem Referenzportfolio bildet der CDO-Emittent nun Tranchen mit
unterschiedlichem Risikogehalt. Die Equity Tranche habe eine Größe von 3% des Port-
folio-Gesamtwertes (3 Millionen $) und fange die ersten 3% der Ausfälle dieses Portfo-
lios auf. Dafür werde der Investor dieser Tranche mit einer Kuponprämie von 25% ent-
schädigt. Sollten also während der Laufzeit keine Ausfälle auftreten, erhält der Anleger
eine hohe Kuponprämie und sein investiertes Kapital von 3 Millionen $. Angenommen,
es ereignet sich ein Ausfall der 100 Firmen des Referenzportfolios und im Falle eines
Ausfalls ist die komplette Anleihe wertlos. In diesem Fall übernimmt die Equity Tran-
che den Verlust von 1 Million $ und ihr Wert reduziert sich somit auf 2 Millionen $.
Der Anleger erhält die 25% Prämie nun nur noch auf den reduzierten Wert von 2 Milli-
onen $ und hat zudem ein Drittel seines investierten Kapitals verloren. Fallen zwei
weitere Unternehmen aus, erleidet der Anleger einen Totalverlust (weder Zinszahlung
noch investiertes Kapital).
Der CDO-Emittent bilde nun eine Junior Mezzanine Tranche mit einer Größe von 4%
des Portfolio-Gesamtwertes (4 Millionen $), die bis zu 4% der Ausfälle übernimmt,
nachdem die ersten 3% der Ausfälle auf die Equity Tranche übertragen worden sind.
Diese Tranche ist also die 3-7% Tranche und erhalte eine Kuponprämie von nur noch
9
Vgl. hierzu Spence und Zeckhauser (1971), die die Optimalität des Selbstbehalts in Versicherungsver-
trägen mit moralischem Risiko beweisen.
13
3% wegen des verringerten Risikos. Beziffern sich die Ausfälle während der Laufzeit
also auf maximal 3%, erhält der Investor dieser Tranche seine Kuponprämie von 4%
und sein investiertes Kapital.
Die weitere Strukturierung der Tranchen könnte wie folgt aussehen (Darst. 6):
Tranche
Größe im Verhältnis
zum
Gesamtportfolio
Übertragener Verlust
Kuponprämie
Equity
3% (3 Mill. $)
0-3%
25%
Mezzanine
4% (4 Mill. $)
3-7%
3%
Mezzanine
3% (3 Mill. $)
7-10%
0,5%
Mezzanine
5% (5 Mill. $)
10-15%
0,3%
Mezzanine
15% (15 Mill. $)
15-30%
0,2%
Senior
70% (70 Mill. $)
30-100%
0,1%
Gesamt
100% (100 Mill. $)
100%
1%
10
Darst. 6:
Beispielhafte Tranchierung einer CDO-Transaktion
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Longstaff und Rajan (2006)
Dadurch wird eine der wichtigsten Funktionen von CDO-Transaktionen offensichtlich.
Das Spektrum von AAA oder AA (sehr gute Qualität) gerateten Unternehmensanleihen
am Markt ist gering, die Nachfrage der Investoren danach jedoch hoch. Durch die Emis-
sion von CDOs, basierend auf einem Referenzportfolio von BBB gerateten Anleihen,
kann jedoch ein großer Pool von Wertpapieren mit höherem Rating geschaffen werden.
In dem Beispiel könnte die Senior Tranche ein AAA Rating und die obersten Mezzani-
ne Tranchen (von 7-10% bis 15-30% übertragenem Verlust) ein AA Rating erhalten.
Somit werden Wertpapiere und Anlagemöglichkeiten geschaffen, die so am Markt gar
nicht existiert hätten.
3.
Rating-Grundlagen
3.1
Überblick über die Ratingagenturen
Wachsender Umfang und Komplexität der Kapitalmärkte waren die treibenden Kräfte
für das Entstehen von Anbietern unabhängiger Ratings, Risiko-, Forschungs- und
10
1%=0,03x25%+0,04x3%+0,03x0,5%+0,05x0,3%+0,15x0,2%+0,7x0,1%. Dies entspricht dem Kupon
Spread des Referenzportfolios.
14
Marktanalysen: die Ratingagenturen. Sie dienen registrierten Interessenten auf ihren
Homepages
11
zudem als umfassende Informations- und Forschungsplattformen.
Die drei weltweit führenden Ratingagenturen sind: Standard & Poor´s (1941 durch eine
Fusion von Standard Statistics und Poor´s Publishing Company in den USA entstanden,
Eigentümer: MCGraw-Hill Companies, Firmensitz: New York), Moody´s Investors
Service (1900 in den USA gegründet, Eigentümer: Moody´s Corporation, Firmensitz:
New York), und Fitch Ratings (1913 als Fitch Publishing Company in den USA ge-
gründet, Eigentümer: Fitch Group, Firmensitz: New York und London).
Die Rating-Vergabe für strukturelle Finanzierungen stellt eine der Haupteinnahmequel-
len der Ratingagenturen dar und ist eines ihrer am schnellsten wachsenden Geschäfts-
felder.
3.2
Ablauf eines Ratingprozesses
Ein typischer Ratingprozess umfasst mehrere Stufen (vgl. Fitch Ratings Ltd. 2004, S.4
sowie Standard & Poor´s 2003, S.14-18). In einem ersten Schritt überprüft die beauf-
tragte Ratingagentur den Portfolio-Manager sowie den Originator auf deren Fähigkeit,
das Referenzportfolio angemessen zu verwalten, und auch die Motivation der Transak-
tion wird festgestellt. Als nächstes wird die Qualität und der Risikogehalt des Portfolios
mit Hilfe von analytischen Modellen abgeschätzt, sowie Ausfallwahrscheinlichkeiten
und Rückflussquoten (Recovery Rates) der Assets bestimmt. Unterschiede in der Me-
thodik ergeben sich hierbei je nach Eigenschaft der Assets und Ratingagentur. Sollte die
sogenannte ,,Ramp-up Periode" (Zeitraum, in dem das Referenzportfolio zusammenge-
stellt wird) noch nicht abgeschlossen sein, geschieht dies vorerst anhand der bereits
vorhandenen Assets und der im Vertrag beschriebenen Portfoliokriterien. Die anschlie-
ßende Strukturanalyse (structural analysis) beinhaltet zum einen eine Cash Flow-
Modellierung (cash fow modelling), die u.a. die Nachrangigkeitsstruktur der Tranchen,
Gebühren, den Cash Flow-Waterfall (siehe 2.5) und die Deckungstests (siehe 2.4) be-
rücksichtigt. Außerdem werden sowohl die rechtliche Konstruktion als auch die betei-
ligten Parteien (siehe 2.2.2) der Transaktion überprüft. Schließlich versammelt sich ein
Rating Komitee und vergibt auf Basis der Analysen ein Rating. Ist der Ratingprozess
abgeschlossen, hat der Emittent üblicherweise 2-3 Wochen Zeit, um die Transaktion
abzuschließen.
11
Standard & Poor´s: www.standardandpoors.com, Moody´s: www.moodys.com, Fitch:
www.fitchratings.com
15
3.3
Ratingsymbole
Zur Beurteilung von CDO-Transaktionen werden dieselben Ratingskalen verwendet wie
bei gewöhnlichen Schuldverschreibungen. Die von Moody´s benutzten Ratingsymbole
unterscheiden sich dabei von denen der beiden anderen etablierten Ratingagenturen,
haben jedoch übereinstimmende Bedeutungen. Ratings von AAA bis BBB- (Moody´s:
Aaa bis Baa3) bilden den Investment Grade Bereich, niedrigere Ratings den Speculative
Grade Bereich. Eine Zusammenfassung und Erklärung der verwendeten Ratingsymbole
ist in Darst. 7 dargestellt:
Moody´s
Standard &
Poor´s
Fitch
Bedeutung
Aaa
AAA
AAA
Höchste Qualität der Schuldtitel, außer-
gewöhnliche finanzielle Sicherheit der
Zins- und Tilgungszahlungen
Aa1
AA+
AA+
Aa2
AA
AA
Aa3
AA-
AA-
Hohe Qualität, d.h. sehr gute bis gute
finanzielle Sicherheit der Zins- und Til-
gungszahlung
A1
A+
A+
A2
A
A
A3
A-
A-
Gute bis angemessene Deckung von Zins
und Tilgung, aber anfällig ggü. negati-
ven wirtschaftlichen Entwicklungen
Baa1
BBB+
BBB+
Baa2
BBB
BBB
Baa3
BBB-
BBB-
Angemessen gute Qualität, aber man-
gelnder Schutz ggü. negativen wirt-
schaftlichen Entwicklungen.
Ba1
BB+
BB+
Ba2
BB
BB
Ba3
BB-
BB-
Spekulativ, mäßige Deckung für Zins
und Tilgung, bei negativen wirtschaftli-
chen Bedingungen
B1
B+
B+
B2
B
B
B3
B-
B-
Sehr spekulativ, geringe Sicherung lang-
fristiger Zins- und Tilgungszahlungen
CCC+
CCC+
CCC
CCC
Caa
CCC-
CCC-
Niedrigste Qualität, geringster Anleger-
schutz und erste Anzeichen von Zah-
lungsverzug
Ca
CC
CC
Höchstspekulative Titel
C
C
C
Zahlungsverzug, bei Moody´s bereits
niedrigste Stufe
-
D
D
Zahlungsverzug
Darst. 7:
Ratingsymbole der Agenturen und ihre Bedeutung
Quelle: IHK Nord Westfalen (2006)
3.4
Charakterisierung von ,,Default"
Für die weiteren Ausführungen ist es elementar, die Bedeutung des Begriffs ,,Default"
zu verstehen. Dabei ist zu beachten, dass die in den Analysemodellen der Ratingagentu-
16
ren verwendete Definition von Default nicht mit der für aufsichtsrechtliche Zwecke
verwendeten übereinstimmt.
3.4.1
Definition nach Basel II und verwendete Notation
Gemäß der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II) gilt ein Kreditausfall im
Hinblick auf einen spezifischen Schuldner als gegeben, wenn eines oder beide der fol-
genden Ereignisse eingetreten sind (vgl. Basler Ausschuss für Bankenaufsicht 2004,
Paragraph 452):
Die Bank geht davon aus, dass der Schuldner mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen Kre-
ditverpflichtungen gegenüber der Bankengruppe nicht in voller Höhe nachkommen wird
und/oder eine wesentliche Verbindlichkeit des Schuldners gegenüber der Bankengruppe
ist mehr als 90 Tage überfällig.
Außerdem werden in Paragraph 453 der Rahmenvereinbarung verschiedene Indikatoren
für drohende Zahlungsunfähigkeit benannt, wie z.B. ein Verzicht der Bank auf die lau-
fende Belastung von Zinsen oder Verkauf der Kreditverpflichtung mit Verlustrealisie-
rung.
12
Laut Basel II - Notation ergibt sich der durch die Kreditvergabe erwartete Verlust (Ex-
pected Loss bzw. EL) als
(3)
LGD
EAD
PD
EL
×
×
=
.
PD bezeichnet die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default), EAD den erwar-
teten ausstehenden Forderungsbetrag bei Ausfall (Exposure at Default) und LGD den
Verlust bei Ausfall (Loss given Default) .
3.4.2
Definitionen der Ratingagenturen
Die Default-Definitionen der großen Ratingagenturen Moody´s, Standard & Poor´s und
Fitch Ratings weichen nicht nur von der Definition der Basler Eigenkapitalvereinbarung
ab, sondern variieren auch zwischen den Agenturen.
Standard & Poor´s stellt lediglich auf das Ausbleiben von Zins- und Tilgungszahlungen
am Fälligkeitstag ab. Diesem wird noch eine Toleranzfrist, die sogenannte ,,Grace Peri-
od" zugerechnet. Des weiteren gelten ,,Distressed Exchanges" (Umstrukturierungsmaß-
nahmen des Schuldners) dann als Ausfallereignis, wenn sie Nachteile für die Gläubiger
12
Siehe Basler Ausschuss für Bankenaufsicht 2004, S. 87 für eine ausführliche Darstellung.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836604871
- DOI
- 10.3239/9783836604871
- Dateigröße
- 3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität zu Köln – Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Studiengang Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2007 (August)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- collateralized asset sucurisation kreditrisikomanager verbriefung backed securities
- Produktsicherheit
- Diplom.de