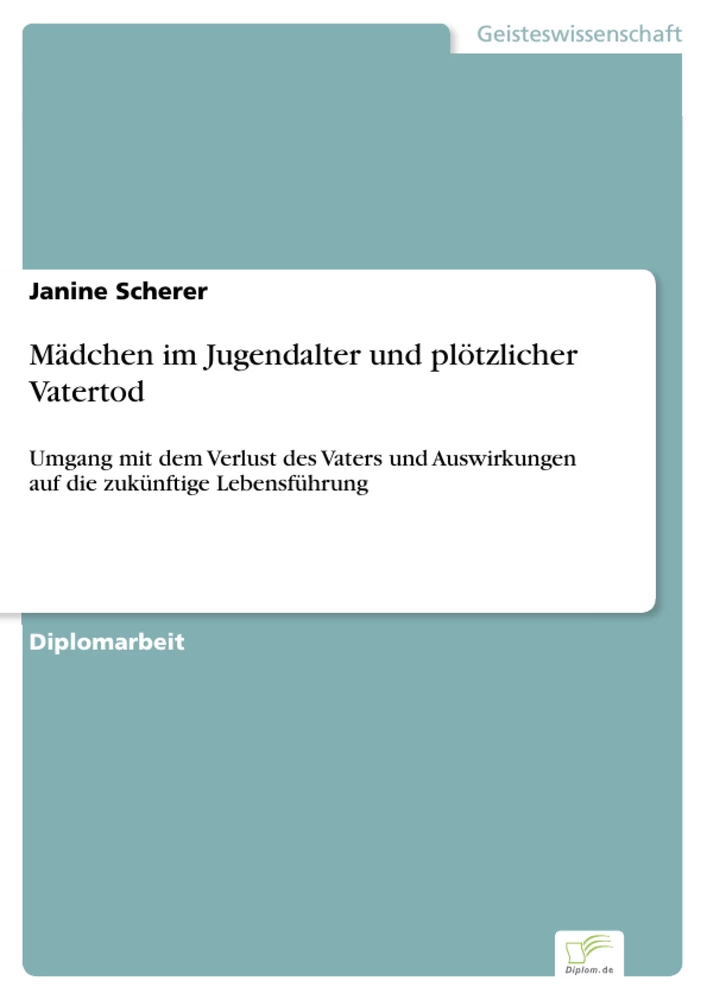Mädchen im Jugendalter und plötzlicher Vatertod
Umgang mit dem Verlust des Vaters und Auswirkungen auf die zukünftige Lebensführung
©2007
Diplomarbeit
218 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit sozialwissenschaftlichen Fragestellungen, die bislang nur unzureichend geklärt werden konnten. Das Thema "Mädchen im Jugendalter und plötzlicher Vatertod" entstand auf der Grundlage der Erkenntnis, dass die so genannte Bindungsforschung insofern immer noch in den Anfängen steckt, als sie sich vornehmlich auf die Beziehung des Kindes zur Mutter konzentriert.
Es wird zwar immer wieder betont, dass ein Kind auch eine primäre Bindung zu einer anderen Person aufbauen kann, z.B. dem Vater, aber Untersuchungen, welche die bedeutungsvolle Beziehung des Kindes zum Vater erforschen, sind praktisch kaum existent. Was der väterliche Verlust durch Tod für ein Mädchen im Jugendalter auch im Hinblick auf geschlechtsspezifische Aspekte bedeutet, ist demnach ein nahezu unerforschtes Gebiet, denn wenn nur bedingt geklärt werden konnte, wie eine Bindungsbeziehung zwischen Heranwachsenden und ihren Vätern aussieht, ist es kaum möglich, aufzuschlüsseln, welche Auswirkungen ein Verlust des männlichen Elternteils für eine Jugendliche haben kann.
Folglich wurden im ersten Kapitel die Besonderheiten der Eltern-Kind-Bindung aufgezeigt, wobei der Fokus im zweiten Teil dieses Kapitels auf die Vater-Tochter-Beziehung und das Jugendalter einer Heranwachsenden eingestellt wurde. Um einen Einblick in das Thema Tod und Trauer zu gewähren, wurde das allgegenwärtige Abschiednehmen, das im Leben eines Menschen einen besonderen Stellenwert einnimmt, im zweiten Kapitel näher ausgeführt und im Hinblick auf den generellen Umgang von Kindern und Jugendlichen mit Verlust allgemein untersucht. Das dritte Kapitel behandelt dann die Konfrontation eines jungen Menschen mit dem Tod eines Elternteils.
Die verschiedenen Todesarten werden näher beleuchtet und die Bedeutung eines plötzlichen Todes wird mit der eines vorhersehbaren verglichen. Kapitel eins bis drei arbeitet auf das vierte Kapitel hin, den Höhepunkt des theoretischen Teils der vorliegenden Arbeit. Hier werden die zuvor einzeln erarbeiteten Themenschwerpunkte miteinander verknüpft und die Umgangsweise einer Jugendlichen mit dem plötzlichen Tod ihres Vaters und dessen Auswirkungen herauskristallisiert.
Im Zusammenhang damit werden verschiedene Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten für trauernde Jugendliche aufgeführt. Den empirischen Teil der Arbeit bilden die beiden letzten Kapitel, wobei das fünfte die Vorbereitungen für die Interviews und deren […]
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit sozialwissenschaftlichen Fragestellungen, die bislang nur unzureichend geklärt werden konnten. Das Thema "Mädchen im Jugendalter und plötzlicher Vatertod" entstand auf der Grundlage der Erkenntnis, dass die so genannte Bindungsforschung insofern immer noch in den Anfängen steckt, als sie sich vornehmlich auf die Beziehung des Kindes zur Mutter konzentriert.
Es wird zwar immer wieder betont, dass ein Kind auch eine primäre Bindung zu einer anderen Person aufbauen kann, z.B. dem Vater, aber Untersuchungen, welche die bedeutungsvolle Beziehung des Kindes zum Vater erforschen, sind praktisch kaum existent. Was der väterliche Verlust durch Tod für ein Mädchen im Jugendalter auch im Hinblick auf geschlechtsspezifische Aspekte bedeutet, ist demnach ein nahezu unerforschtes Gebiet, denn wenn nur bedingt geklärt werden konnte, wie eine Bindungsbeziehung zwischen Heranwachsenden und ihren Vätern aussieht, ist es kaum möglich, aufzuschlüsseln, welche Auswirkungen ein Verlust des männlichen Elternteils für eine Jugendliche haben kann.
Folglich wurden im ersten Kapitel die Besonderheiten der Eltern-Kind-Bindung aufgezeigt, wobei der Fokus im zweiten Teil dieses Kapitels auf die Vater-Tochter-Beziehung und das Jugendalter einer Heranwachsenden eingestellt wurde. Um einen Einblick in das Thema Tod und Trauer zu gewähren, wurde das allgegenwärtige Abschiednehmen, das im Leben eines Menschen einen besonderen Stellenwert einnimmt, im zweiten Kapitel näher ausgeführt und im Hinblick auf den generellen Umgang von Kindern und Jugendlichen mit Verlust allgemein untersucht. Das dritte Kapitel behandelt dann die Konfrontation eines jungen Menschen mit dem Tod eines Elternteils.
Die verschiedenen Todesarten werden näher beleuchtet und die Bedeutung eines plötzlichen Todes wird mit der eines vorhersehbaren verglichen. Kapitel eins bis drei arbeitet auf das vierte Kapitel hin, den Höhepunkt des theoretischen Teils der vorliegenden Arbeit. Hier werden die zuvor einzeln erarbeiteten Themenschwerpunkte miteinander verknüpft und die Umgangsweise einer Jugendlichen mit dem plötzlichen Tod ihres Vaters und dessen Auswirkungen herauskristallisiert.
Im Zusammenhang damit werden verschiedene Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten für trauernde Jugendliche aufgeführt. Den empirischen Teil der Arbeit bilden die beiden letzten Kapitel, wobei das fünfte die Vorbereitungen für die Interviews und deren […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Janine Scherer
Mädchen im Jugendalter und plötzlicher Vatertod - Umgang mit dem Verlust des Vaters
und Auswirkungen auf die zukünftige Lebensführung
ISBN: 978-3-8366-0450-5
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Fachhochschule Köln, Köln, Deutschland, Diplomarbeit, 2007
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
I
Inhaltsverzeichnis
Einleitung ... 1
1 Die Eltern-Kind-Beziehung ... 3
1.1 Bindung und Bindungsverhaltenssystem ...3
1.2 Funktion der Bindung eines Kindes an seine Eltern ...4
1.3 Die Bindungsstile - Erziehungs- und Sozialisationsforschung ...6
1.4 Die Vater- Tochter- Beziehung...9
1.4.1 Funktion des Vaters für die Tochter...9
1.4.2 Vater-Tochter-Bindung und die ödipale Komponente...11
1.5 Identifikation von Mädchen im Jugendalter ...13
1.6 Unabhängigkeit und Bindungsfähigkeit im Jugendalter...16
1.7 Zusammenfassung...18
2 Das allgegenwärtige Abschiednehmen ... 19
2.1 Das abschiedsreiche Leben des Menschen ...19
2.2 Der Mensch und die Trauer ...20
2.3 Die Phasen der Trauer...22
2.4 Kinder und Jugendliche ergründen den Tod ...25
2.5 Mädchen im Jugendalter zwischen Autonomie und Verlust ...29
2.6 Zusammenfassung...30
3 Konfrontation mit dem Tod eines Elternteils ... 32
3.1 Die Übermittlung der Todesnachricht...32
3.2 Die Todesursache...36
3.2.1 Krankheit...37
3.2.2 Unfall ...38
3.2.3 Suizid ...40
3.3 Das soziale Umfeld und der Wunsch der Trauernden ...43
3.4 Zusammenfassung...45
4 Mädchen im Jugendalter und plötzlicher Vatertod... 47
4.1 Der Umgang mit dem plötzlichen Vatertod...48
4.1.1 Die erste Zeit nach Übermittlung der Todesnachricht ...49
4.1.2 Das Ritual der Beerdigung...51
Inhaltsverzeichnis
II
4.1.3 Das Beziehungsnetz junger Frauen und die Fähigkeit zu reden.. 53
4.1.4 Die Hilf- und Ratlosigkeit anderer akzeptieren ... 54
4.1.5 Zwischen Verlust und Gewinn ... 56
4.2 Mögliche Konsequenzen für die zukünftige Lebensführung junger
Frauen ... 58
4.2.1 Psyche und Körper... 59
4.2.2 Persönliche und berufliche Orientierung ... 63
4.2.3 Soziales Umfeld... 65
4.2.4 Vertrauen und Bindung... 67
4.3 Hilfe in der schwierigen Zeit ... 68
4.3.1 Familie und nahe stehende Personen ... 69
4.3.2 Professionelle Hilfe... 71
4.4 Zusammenfassung ... 73
5 Die Praxis: Die Interviews mit weiblichen Betroffenen...77
5.1 Zielvorstellungen ... 77
5.2 Zielgruppe... 78
5.3 Methode: Das narrative Interview ... 79
5.4 Vorbereitungen und Rahmenbedingungen ... 81
5.5 Durchführung der Interviews... 82
5.6 Auswertung der Interviews... 84
5.8 Zusammenfassung ... 85
6 Die Ergebnisse der narrativen Interviews ...87
6.1 Persönliche Gegebenheiten der befragten Frauen ... 87
6.2 Umgang der Befragten mit dem plötzlichen Vatertod... 93
6.2.1 Erste Reaktionen auf den Tod des Vaters... 93
6.2.2 Emotionale Reaktionen... 95
6.2.3 Kognitive Reaktionen ... 98
6.2.4 Handlungen... 100
6.2.5 Körperliche Reaktionen ... 102
6.2.6 Wo wurde Hilfe gefunden?... 103
6.3 Auswirkungen des Verlusts auf die Lebensführung der Befragten .. 105
6.3.1 Soziales Umfeld... 106
Inhaltsverzeichnis
III
6.3.2 Selbstbild der Befragten...109
6.3.3 Verhältnis zur Mutter und zu den Geschwistern...110
6.3.4 Partnerwahl und Beziehungsfähigkeit...114
6.3.5 Risikoverhaltensweisen...116
6.3.6 Berufliche Orientierung ...118
6.4 Rückblickende Bemerkungen der interviewten Frauen ...119
6.5 Zusammenfassung und Reflexion der Ergebnisse ...122
6.6 Kategorisierte Kurzdarstellungen der jeweiligen Interviews...128
Resümee und Ausblick ... 143
Fazit der vorliegenden Arbeit ...143
Ausblick für die angewandte Sozialwissenschaft ...147
Kritische Selbstreflexion...148
Darstellungsverzeichnis ...V
Literaturverzeichnis...VI
Materialanhangverzeichnis ...XII
Materialanhang ... XIV-1
Einleitung
1
Einleitung
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit sozialwissenschaftli-
chen Fragestellungen, die bislang nur unzureichend geklärt werden
konnten. Das Thema "Mädchen im Jugendalter und plötzlicher Vater-
tod" entstand auf der Grundlage der Erkenntnis, dass die so genannte
Bindungsforschung insofern immer noch in den Anfängen steckt, als sie
sich vornehmlich auf die Beziehung des Kindes zur Mutter konzentriert.
Es wird zwar immer wieder betont, dass ein Kind auch eine primäre
Bindung zu einer anderen Person aufbauen kann, z.B. dem Vater, aber
Untersuchungen, welche die bedeutungsvolle Beziehung des Kindes
zum Vater erforschen, sind praktisch kaum existent. Was der väterliche
Verlust durch Tod für ein Mädchen im Jugendalter auch im Hinblick auf
geschlechtsspezifische Aspekte bedeutet, ist demnach ein nahezu
unerforschtes Gebiet, denn wenn nur bedingt geklärt werden konnte,
wie eine Bindungsbeziehung zwischen Heranwachsenden und ihren
Vätern aussieht, ist es kaum möglich, aufzuschlüsseln, welche Auswir-
kungen ein Verlust des männlichen Elternteils für eine Jugendliche
haben kann. Folglich wurden im ersten Kapitel die Besonderheiten der
Eltern-Kind-Bindung aufgezeigt, wobei der Fokus im zweiten Teil dieses
Kapitels auf die Vater-Tochter-Beziehung und das Jugendalter einer
Heranwachsenden eingestellt wurde. Um einen Einblick in das Thema
Tod und Trauer zu gewähren, wurde das allgegenwärtige Abschied-
nehmen, das im Leben eines Menschen einen besonderen Stellenwert
einnimmt, im zweiten Kapitel näher ausgeführt und im Hinblick auf den
generellen Umgang von Kindern und Jugendlichen mit Verlust allge-
mein untersucht. Das dritte Kapitel behandelt dann die Konfrontation
eines jungen Menschen mit dem Tod eines Elternteils. Die verschiede-
nen Todesarten werden näher beleuchtet und die Bedeutung eines
plötzlichen Todes wird mit der eines vorhersehbaren verglichen. Kapitel
eins bis drei arbeitet auf das vierte Kapitel hin, den Höhepunkt des
theoretischen Teils der vorliegenden Arbeit. Hier werden die zuvor
Einleitung
2
einzeln erarbeiteten Themenschwerpunkte miteinander verknüpft und
die Umgangsweise einer Jugendlichen mit dem plötzlichen Tod ihres
Vaters und dessen Auswirkungen herauskristallisiert. Im Zusammen-
hang damit werden verschiedene Hilfe- und Unterstützungsmöglichkei-
ten für trauernde Jugendliche aufgeführt. Den empirischen Teil der
Arbeit bilden die beiden letzten Kapitel, wobei das fünfte die Vorberei-
tungen für die Interviews und deren Durchführung und das sechste die
Ergebnisse der narrativen Befragungen darlegt. Diese Untersuchungen
dienen dem Vergleich mit der erarbeiteten Theorie und sollen zur Bes-
tätigung bzw. Erweiterung dieser Theorie führen.
Kapitel 1: Die Eltern-Kind-Beziehung
3
1 Die Eltern-Kind-Beziehung
Das erste Kapitel gibt Aufschluss über die Besonderheiten der Eltern-
Kind-Beziehung, wobei der Begriff der "Bindung" als wesentliches
Hauptmerkmal erläutert wird. Die Funktion der Bindung wird dargestellt,
um deutlich zu machen, wie wichtig die Beziehung zu einer bestimmten
Person für das menschliche Überleben ist. Verhaltensforscherinnen und
-forscher haben durch empirische Untersuchungen unterschiedliche
kindliche Bindungstypen herausgefunden, die vor allem in der Entwick-
lungspsychologie und Psychotherapie seit Jahren anerkannt sind und in
der vorliegenden Arbeit zu einem besseren Verständnis der Eltern-
Kind-Beziehung beitragen sollen. Des Weiteren wird näher auf die Va-
ter-Tochter-Beziehung eingegangen, mit dem Ziel, die kaum erforsch-
ten Bindungsmuster zwischen dem männlichen Elternteil und dem
weiblichen Abkommen zu beleuchten. Der letzte Abschnitt dieses Kapi-
tels beschäftigt sich mit der Identifikation von Mädchen im Jugendalter
und gibt Einblick in die Lebenswelt weiblicher Adoleszenten, ihre Be-
ziehung zu nahe stehenden Personen, insbesondere zum Vater, und
ihre Erfahrung mit der einhergehenden Autonomieentwicklung.
1.1 Bindung und Bindungsverhaltenssystem
Bindungen auf zwischenmenschlicher Ebene können die unterschied-
lichsten Formen annehmen, jedoch wird in der Sozialisationsforschung
die Bindung als besondere Beziehung zwischen dem Kind und seinen
Eltern oder Personen, die es beständig betreuen, angesehen.
John Bowlby, ein britischer Psychoanalytiker und inzwischen einer der
bekanntesten Bindungsforscher, stellte in den 50er Jahren eine Bin-
dungstheorie auf, die klinisch-psychoanalytisches Wissen mit evoluti-
Kapitel 1: Die Eltern-Kind-Beziehung
4
onsbiologischem Denken verbindet.
1
Aus dieser Theorie geht hervor,
dass eine Bindung noch nicht unmittelbar nach der Geburt besteht,
sondern sich im Laufe der ersten Lebensmonate entwickelt. Dem Säug-
ling wird ein genetisch vorgegebenes Programm zugeschrieben, das
die Bindung zur Bezugsperson auslöst und aufbaut. Infolgedessen
erfüllen alle Kinder die nötigen Voraussetzungen, personenbezogene
Bindung auszubilden, sobald die Möglichkeit zur Interaktion mit einem
anderen Menschen besteht. Dieses Bindungsverhalten und die damit
einhergehende Bindungsbeziehung haben über die gesamte Lebens-
spanne Auswirkungen auf das Denken, Fühlen, Planen, Wollen und
Tun eines Individuums (Ontogenese).
2
Stellt ein Kind eine Bindung zu einem Menschen her, mit dem es in den
ersten Lebensmonaten den intensivsten Kontakt hatte, so besteht die-
se, selbst bei räumlicher Trennung der Personen, über längere Zeit
hinweg. Am häufigsten wird die Mutter als primäre Bindungsperson des
Kindes angesehen, da die allermeisten Säuglinge hauptsächlich von ihr
versorgt und betreut werden; jedoch können verschiedene Umstände,
wie beispielsweise Abwesenheit der Mutter, dazu führen, dass das Kind
sich einer anderen Bezugsperson zuwendet.
3
Damit fällt in der Regel
dem Vater als zweitem Elternteil die Aufgabe zu, die Rolle der primären
Bindungsfigur zu übernehmen.
1.2 Funktion der Bindung eines Kindes an seine Eltern
Das zuvor beschriebene Bindungsverhalten (englisch: attachment) des
Säuglings direkt nach der Geburt löst das elterliche Fürsorgeverhalten
1
Vgl. Grossmann/ Grossmann, Bindungen, 2005, 29.
2
Vgl. Bowlby, Verlust, 2006, 45.
3
Vgl. Grossmann/ Grossmann, Bindungen, 2005, 73.
Kapitel 1: Die Eltern-Kind-Beziehung
5
(englisch: bonding) aus.
4
Die Bindung des Kindes an eine oder mehrere
Bezugspersonen hat in erster Linie die Aufgabe, das Überleben des
Kindes zu sichern. Durch das kindliche Verhalten wird die Pflegeperson
dazu animiert, in der Nähe zu bleiben und, wenn nötig, Schutz, Hilfe
und Fürsorge zu bieten. In einer Gefahrensituation ist das Kind völlig
auf den älteren und somit auch erfahreneren Menschen angewiesen.
Es organisiert sein Fühlen, seine Wahrnehmung, sein Verhalten und
Denken so, dass das übergeordnete Ziel, Sicherheit und Fürsorge zu
erhalten, erreicht wird. Diese Bedürfnisse befriedigt das Kind, indem es
seiner Bezugsperson, beispielsweise durch Schreien bei Hungergefühl,
signalisiert, dass sie gebraucht wird. Sobald die Forderung des Kindes
erfüllt ist, schaltet sich automatisch das Explorationsverhaltenssystem
ein, das der Erkundung der Umwelt dient und die Anpassung an diese
optimiert. Indem die Bindungsperson für die Belange des Kindes zur
Verfügung steht, vermittelt sie ihm die Sicherheit, sich in aller Ruhe
seinem Lebensraum widmen und somit nach und nach seine sozialen
und persönlichen Kompetenzen ausbauen zu können. In diesem Lern-
prozess ist die Verlässlichkeit der Bezugsperson von eminenter Bedeu-
tung für das Kind, denn eine Trennung von ihr kann Angstzustände und
negative Entwicklungen hervorrufen. In Fällen, in denen Säuglingen
nach der Geburt die Bindungsperson über einen längeren Zeitraum
hinweg versagt blieb, wurden nachhaltige Störungen der motorischen,
kognitiven und emotionalen Entwicklung festgestellt, die in der Entwick-
lungspsychologie auch unter dem Phänomen des Hospitalismus be-
kannt sind. Diese Bezeichnung geht auf den Psychoanalytiker R.A.
Spitz zurück, der 1935 Säuglinge in Kinderheimen beobachtete, die in
der ersten Lebensphase ohne jegliche emotionale Bindung an eine
4
Vgl. Oerter/ Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie, 2002, 142.
Kapitel 1: Die Eltern-Kind-Beziehung
6
bestimmte Person aufwuchsen.
5
Die Beobachtungen von Spitz führten
zu Untersuchungen, in denen geprüft wurde, wie Kinder in ihrer indivi-
duellen Beziehung zu ihren primären Bindungspersonen reagieren,
wenn sie zeitweise von ihnen getrennt werden.
1.3 Die Bindungsstile - Erziehungs- und Sozialisationsforschung
Die kanadische Psychologin Mary S. Ainsworth bekräftigte in jahrelan-
ger Zusammenarbeit mit John Bowlby dessen Überlegungen zur Bin-
dungstheorie durch ihre empirischen Untersuchungen. Zur Erforschung
kindlicher Bindungsmuster und zur Feststellung der Qualität der Bin-
dungsbeziehung des Kindes zu seiner primären Bezugsperson entwi-
ckelte sie den so genannten "Fremde-Situations-Test". In diesem Test
ist das Kleinkind mit seiner primären Bezugsperson (in diesen Fällen
der Mutter) und einer fremden Person, die kurze Zeit später hinzu-
kommt, zusammen in einem Raum, in welchem dem Kind altersgemä-
ßes Spielzeug zur Verfügung steht. Kurzzeitig verlässt die Mutter die
Räumlichkeit. Die Reaktion des Kindes auf die Gesamtsituation wird
beobachtet, bis die Mutter an den Ort zurückkehrt.
6
Durch diese Untersuchung kristallisierten sich zunächst einmal drei
kindliche Bindungstypen heraus:
Ein sicher gebundenes Kind ist an eine "feinfühlige" Bindungsperson
gewöhnt, die für die Belange des Kindes stets zur Verfügung steht und
diese auch richtig interpretiert. Die Kinder solcher Mütter bzw. primären
Bezugspersonen, die sich um das Kind kümmern, reagieren bei Verlas-
senwerden mit einem offen gezeigten Trennungsschmerz und lassen
sich von der fremden Person im Raum und von der Bindungsperson,
wenn diese zurückkehrt, trösten. Die Stresssituation ist somit beendet
5
Vgl. Brisch, Bindungsstörungen, 2005, 38f, 63.
6
Vgl. Oerter/ Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie, 2002, 198.
Kapitel 1: Die Eltern-Kind-Beziehung
7
und das Kind kann sich wieder der Erkundung seiner Umwelt widmen.
Es besteht ein Gleichgewicht zwischen Bindungs- und Explorationsver-
halten.
Kinder mit einer unsicher- vermeidenden Bindung erfahren durch ihre
primären Bindungspersonen schroffe Zurückweisung, wenn sie ihre
Nähe suchen oder negative Emotionen zeigen. Bei Trennung zeigen
diese Kinder so gut wie keine Reaktionen, denn sie beschäftigen sich
weiterhin mit der Spielsituation. Sie wirken zwar wenig belastet, jedoch
weisen diese Kinder in der Zeit, in der sie von der Bindungsperson
getrennt sind, die meisten Stresshormone auf. Wenn die Bezugsperson
zurückkehrt, unterdrückt das Kind seine Bindungsgefühle, um sich vor
weiteren Enttäuschungen zu schützen.
Unsicher- ambivalent gebundene Kinder sind durch Bindungspersonen
geprägt, die völlig unberechenbar auf das kindliche Verhalten reagie-
ren. Sie können sich einmal liebevoll dem Kind zuwenden und ein an-
dermal unerreichbar für das Kind oder auch abweisend sein. Dement-
sprechend verhält sich auch das Kind bei Trennung von der Bezugs-
person, denn es steht im Zwiespalt, ob es ihre Nähe suchen oder die
Umwelt erforschen soll. Einerseits sucht das Kind den Kontakt, ande-
rerseits lehnt es ihn selbst immer wieder ab. Das Bindungsverhaltens-
system bleibt ständig aktiviert.
Erst wesentlich später wurde die Einteilung in diese drei Bindungsstile
von Mary Main (2000) durch einen vierten Stil erweitert. Die Forscherin
führte die Bezeichnung desorientiert/ desorganisiert gebundene Kinder
ein. Das Verhalten dieser Kinder konnte nicht eindeutig einer der drei
Gruppierungen zugeordnet werden, da die Haltung der Kinder je nach
Situation zu unterschiedlichen Bindungsstilen passte. Forscher gehen
davon aus, dass bei diesen Verhaltensweisen die Eltern selbst die
Kapitel 1: Die Eltern-Kind-Beziehung
8
Gefahrenquelle darstellen, beispielsweise Eltern, die ihre Kinder miss-
handeln.
7
Ab dem vierten bis sechsten Lebensmonat sind die kindlichen Bin-
dungsmuster an die Bezugsperson schon stark ausgeprägt, jedoch
erreicht die Bindungsfestigkeit ihren Höhepunkt im zweiten Lebensjahr.
Gerade in dieser Zeit löst eine Trennung von der Bindungsperson er-
heblichen Protest beim Kind aus.
8
Die Bindung zwischen Kind und Bezugsperson kann bis ins hohe Er-
wachsenenalter bestehen bleiben.
9
Deren wechselseitige Nährung ist
vor allen Dingen bis zur Ablösung des Kindes vom Elternhaus wichtig.
Dieser Loslösungsprozess vollzieht sich meist im Jugendalter und hat
die Aufgabe, den jungen Menschen zur Selbständigkeit und Eigenver-
antwortlichkeit zu befähigen.
Die Ergebnisse der Testverfahren können natürlich nicht nur auf die
Mutter, sondern auch auf eine andere primäre Bindungsperson, z. B.
den Vater, bezogen werden. Der Fremde-Situations-Test wurde mit
Müttern durchgeführt, da sie, wie bereits erwähnt, für die meisten Kin-
der die Haupt-Bindungspersonen darstellen. Jedoch wird in einer Fami-
lie ebenso das väterliche Engagement gefordert, denn für die gesunde
Entwicklung eines Kindes ist unabdingbar, dass beide Geschlechter
Fürsorge und Erziehung in die Hand nehmen. Ferner lösen sich in der
heutigen Gesellschaft zusehends die Mehrgenerationenhaushalte auf,
wodurch die Großeltern als zusätzliche Bezugspersonen für viele Kin-
der nur noch schwer zu erreichen sind. Somit ist wichtig, dass sich
beide Eltern ihrer Erziehungsaufgabe so widmen, dass die Entwicklung
des Kindes durch liebevolle Zuwendung geprägt ist.
7
Vgl. Streeck-Fischer (Hrsg.), Adoleszenz, 2004, 162f.
8
Vgl. Grossmann/ Grossmann, Bindungen, 2005, 74f.
9
Vgl. Bowlby, Verlust, 2006, 45.
Kapitel 1: Die Eltern-Kind-Beziehung
9
1.4 Die Vater- Tochter- Beziehung
Die bedeutende Rolle des Vaters für die Familie, insbesondere für die
Entwicklung seiner Kinder ist mittlerweile unumstritten. In der Fachlite-
ratur ist zumeist die Rede von der Vater-Sohn-Beziehung und davon,
wie wichtig das männliche Vorbild für die Persönlichkeitsbildung von
Jungen ist. Mittlerweile rückt jedoch auch in der Forschung immer mehr
die Rolle des Vaters für seine Tochter in den Vordergrund. Ihre Bedeu-
tung ist für das Zusammenleben in der Familie nicht minder wichtig.
Auch Ratgeber, die offensichtlich speziell für Väter geschrieben wur-
den, um ihnen eine Anleitung zum Vatersein an die Hand zu geben,
verweisen immer wieder deutlich auf den unersetzbaren Einfluss des
Vaters auf seine Tochter: "Den Töchtern eröffnen Väter die männliche
Welt und legen den Grundstein dafür, wie sie sich in dieser Welt ein-
richten werden. Die Anerkennung als Frau durch den Vater ist ein wich-
tiger Schritt zu reifem Frausein."
10
Die Qualität der Vater-Tochter-
Beziehung ist somit für den weiblichen Reifungsprozess, die Persön-
lichkeitsentwicklung und die Handlungsweise einer heranwachsenden
Frau entscheidend. Die neuesten Studien beschäftigen sich mit den
unzähligen Facetten einer Vaterschaft und weisen darauf hin, dass
Väter bezüglich geschlechtsspezifischer Verhaltensweisen dazu tendie-
ren, Töchter und Söhne unterschiedlich zu behandeln.
1.4.1 Funktion des Vaters für die Tochter
Töchter erleben schon in frühen Jahren durch ihre Mütter bezüglich der
Gleichgeschlechtlichkeit den "Kern und die Kontinuität" ihres Selbst,
während die Väter die Differenzierung desselben ermöglichen.
11
10
Hofer, Väter, 2001, 127.
11
Vgl. Happel, Einfluss, 2003, 40.
Kapitel 1: Die Eltern-Kind-Beziehung
10
Die verbale und emotionale Interaktion mit Mutter und Vater ist vor allen
Dingen wichtig für die Entwicklung von sozialen und kognitiven Kompe-
tenzen der Tochter. Befinden sich Mädchen noch im Kindesalter, ver-
halten sich ihre Väter ihnen gegenüber, meist in körperbezogenen Spie-
len, emotional und fordernd. Hierbei wird der Tochter Verantwortung
und moralisches Bewusstsein vermittelt. Im Jugendalter ist der Vater
als Interaktionsfigur nicht weniger bedeutend. Mädchen ziehen in dieser
Phase zur Klärung von Entwicklungsfragen zwar Freundinnen und
Mütter als Gesprächspartner vor, jedoch werden Väter fast immer in die
Gespräche zwischen Müttern und Töchtern einbezogen, da die Mäd-
chen ebenso Wert auf die Meinung ihrer Väter legen. Eine unüberseh-
bare Tendenz, den männlichen Elternteil als Interaktionspartner zu
wählen, zeigt sich in Gesprächen über Berufswahl und gesellschaftliche
Fragen.
12
Für den Ausbau der kognitiven Eigenschaften der Tochter ist es förder-
lich, wenn der Vater auf die intellektuellen Fähigkeiten seines Kindes
vertraut. Ist er eher durch eine traditionelle Geschlechtsrollentypisierung
geprägt und fehlt ihm das Interesse, die verschiedenen Neigungen
seiner Tochter zu unterstützen, so kann dies ihre kognitive Entwicklung
behindern.
Väter können sich im Allgemeinen nicht so gut auf den kindlichen
Sprachstil einstellen wie Mütter und fördern durch die Anwendung einer
komplexeren Kommunikationsweise, oft unbewusst, die sprachliche
Kompetenz der Mädchen.
Darüber hinaus hat der Lebensstil des Vaters Einfluss auf die Leis-
tungsmotivation sowie das Selbstvertrauen in die eigene Leistungs-
kompetenz seiner Tochter. Auch die Beeinflussung der Risikobereit-
12
Vgl. Fthenakis/ Minsel/ BMFSFJ (Hrsg.), Rolle, 2002, 311.
Kapitel 1: Die Eltern-Kind-Beziehung
11
schaft und die Begeisterung für Technik und sportliche Aktivitäten ste-
hen im Vordergrund der väterlichen Erziehung.
Für die zukünftige Persönlichkeitsentwicklung in Bezug auf Selbstbe-
wusstsein, Eigenständigkeit, beruflichen Erfolg und Gestaltung von
Partnerbeziehung ist wichtig, dass Väter ihren Töchtern das Gefühl
geben, in ihrer weiblichen Rolle angenommen zu sein.
Wenn alle väterlichen Verhaltensweisen durch Empathie, Wärme und
Zuwendung gekennzeichnet sind, hat dies positive Auswirkungen auf
den Entwicklungsverlauf der heranwachsenden Mädchen. Das Selbst-
wertgefühl eines jeden Kindes hängt jedoch vor allen Dingen von der
Verlässlichkeit solcher Beziehungen ab.
13
1.4.2 Vater-Tochter-Bindung und die ödipale Komponente
Die Bindung zwischen Tochter und Vater ist durch die bereits erwähnte
Beziehungsebene in der frühen Kindheit des Mädchens geprägt, in der
der Vater einerseits als gutes Vorbild fungieren und andererseits eine
liebevolle und verlässliche Erziehung anstreben sollte. Eine besondere
Rolle in dieser Bindungsbeziehung und in der Entwicklung der Ge-
schlechtsidentität spielt die ödipale Identifikation der Tochter. Es steht
hier zur Diskussion, inwieweit die geschlechtliche Entwicklung von
Mädchen durch die Eltern bestimmt wird.
Sigmund Freud, Begründer der Psychoanalyse, geht in der Theorie der
psychosexuellen Identifikation zunächst davon aus, dass sich Söhne
mit ihren Vätern identifizieren und somit die ersten sexuellen Triebe
ihren Müttern widmen. Erst viel später bezieht Freud diese Triebbestre-
bungen auf das Verhalten junger Mädchen, die sich anfangs, ebenso
wie die Jungen, libidinös an die Mutter binden. Das Mädchen wird somit
vorerst als "kleiner Mann" angesehen, der seine Mutter liebt und den
13
Vgl. BMFSFJ (Hrsg.), Facetten, 2006, 142ff.
Kapitel 1: Die Eltern-Kind-Beziehung
12
Vater als Rivalen empfindet. In dieser Phase befindet sich die Tochter
im negativen Ödipuskomplex. Danach kommt es zur Identifikation mit
dem gleichgeschlechtlichen Elternteil, der Mutter, und der heterosexuel-
len Zuwendung des Mädchens zum Vater, wobei dies nach Happel die
positive Form darstellt.
14
"Der Ödipuskomplex wird auf seinem Höhe-
punkt zwischen 3. und 5. Lebensjahr (phallische Phase) erlebt und
verschwindet dann mit Beginn der sog. Latenzphase, um in der Puber-
tät noch einmal aufzuleben und dann in verschiedener Weise überwun-
den zu werden."
15
Durch die körperliche und seelische Veränderung des Mädchens in der
Zeit der Adoleszenz ist der Vater verunsichert in der Art und Weise, wie
er sich gegenüber seiner zur Frau heranwachsenden Tochter verhalten
soll. Diese nähert sich dem Vater, der für sie ein vertrautes Objekt dar-
stellt, libidinös, um herauszufinden, wie sie auf das männliche Ge-
schlecht als reifende Frau wirkt. Jedoch weiß der Vater dies zuweilen
nicht richtig einzuschätzen. "Denn die körperliche Nähe und Zärtlichkeit
der Kindheit wird nun zwangsläufig sexualisiert und ruft Ängste und
Phantasien hervor, die Inzestschranken zu überschreiten."
16
So ist es
für den Vater wichtig, zu wissen, dass die Entwicklung seiner Tochter
ein natürlicher Vorgang ist, der zur Pubertät eines Mädchens für ge-
wöhnlich dazu gehört; erst dann kann er angemessen auf ihr Verhalten
reagieren. Er muss sich nicht von ihr abwenden, um weitere Annähe-
rungen zu vermeiden, was von der Tochter als Zurückweisung interpre-
tiert werden würde, sondern kann ihr das Gefühl geben, dass sie eine
interessante weibliche Persönlichkeit ist, ohne seine Grenzen zu über-
schreiten.
14
Vgl. Happel, Einfluss, 2003, 76.
15
Machleidt, Vater, 1992, 101.
16
King, Entstehung, 2002, 142.
Kapitel 1: Die Eltern-Kind-Beziehung
13
In der besonderen Liebesbeziehung zu Mutter und Vater neigt die
Tochter dazu, ihre Eltern zu idealisieren, was in der Adoleszenzzeit in
ausgewogener Dosierung einem gesunden Selbstbewusstsein und der
Stabilität der eigenen Identität dient.
17
1.5 Identifikation von Mädchen im Jugendalter
Durch das Eintreten in das Jugendalter erreichen Mädchen die Phase
ihrer eigenen Identifikationsentwicklung und somit auch die Zeit der
Ablösung von Mutter und Vater, in der die autonome Persönlichkeit nun
neue Beziehungsformen aufbauen kann. Die Identität einer Heran-
wachsenden entwickelt sich im Laufe der Lebensjahre durch Selbst-
und Fremdwahrnehmung. Sie erlangt diese nicht nur durch ihre Eltern,
sondern auch durch die Bestätigung bzw. Nicht-Bestätigung in der
Gemeinschaft mit Gleichaltrigen. Meist ist diese Phase der Orientierung
an neuen Vorbildern durch die Knüpfung heterosexueller Beziehungen
und Freundschaften gekennzeichnet. Die "Peergroup" stellt somit ein
besonders entwicklungsförderliches Übungsfeld für Mädchen dar, in
dem sie ihre sozialen Fähigkeiten ausbauen können und somit auch ein
Stück mehr Unabhängigkeit von den Eltern gewinnen. In dieser Periode
wird der Zusammenhang zwischen körperlichen, psychischen und sozi-
alen Prozessen im Leben einer Jugendlichen deutlich.
18
Da diese Pro-
zesse zumeist sehr unterschiedlich verlaufen, ist nicht eindeutig festzu-
legen, wann Jugend beginnt und endet. Die wissenschaftliche Zeit-
spanne, mit der das Jugendalter eingegrenzt wird, erstreckt sich auf-
grund der unterschiedlichen Meinungen der Forscher vom 10. bis zum
17
Vgl. Happel, Einfluss, 2003, 198ff.
18
Vgl. Flaake/ King (Hrsg.), Adoleszenz, 2003, 13.
Kapitel 1: Die Eltern-Kind-Beziehung
14
25. Lebensjahr. Jedoch wird die Hauptphase der Adoleszenz bzw. des
Jugendalters meist in Verbindung von 12- bis 18- Jährigen genannt.
19
Die Identifikation von Mädchen im Jugendalter ist in unterschiedlichen
Erklärungsansätzen begründet. Um zu einem besseren Verständnis
diesbezüglich beizutragen, ist es sinnvoll, einen kurzen Einblick in die
einzelnen wissenschaftlichen Bereiche zu gewähren.
Biologische Ansätze beschreiben die sexuelle Reifung in Bezug auf
primäre (z.B. Funktion der Gebärmutter) und sekundäre Geschlechts-
merkmale (z.B. Brustwachstum) und die Veränderung des Hormon-
haushalts, die bei Mädchen durch eine vermehrte Ausschüttung von
Östrogen gekennzeichnet ist.
Kognitive Modelle beschäftigen sich damit, wie sich Jugendliche selbst
wahrnehmen, wie sie von anderen wahrgenommen werden und wie sie
sich zwischen wissenschaftlichen Theorien und Selbstkonzept sehen.
20
Die Imitationstheorie geht vom Modell- und Nachahmungslernen aus.
Kohlberg (1974) stellt dar, wie Kinder schon im zweiten bzw. dritten
Lebensjahr ihre Ähnlichkeit oder Nicht-Ähnlichkeit mit einem der beiden
Geschlechter wahrnehmen und sich somit als Mädchen oder Junge
kategorisieren. Die Geschlechtsidentität wird verstärkt, indem aktiv
nach geschlechtsbezogenen Informationen gesucht wird. Letztendlich
kommt es zu selektiver Nachahmung und einer immer stabiler werden-
den Identifikation.
21
Dieser Prozess steht im Zusammenhang mit der
bereits erwähnten und näher beschriebenen psychosexuellen Identifika-
tion des Mädchens mit den Eltern.
22
In sozialisations-theoretischen Ansätzen hingegen wird davon ausge-
gangen, dass von Geburt an unterschiedliche Erwartungen an die Ge-
19
Vgl. Breitenbach, Mädchenfreundschaften, 2000, 9ff.
20
Vgl. Flammer/ Alsaker, Adoleszenz, 2002, 144.
21
Vgl. Oerter/ Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie, 2002, 220.
22
Vgl. Kapitel 1.4.2.
Kapitel 1: Die Eltern-Kind-Beziehung
15
schlechter herangetragen werden. Nach und nach werden Mädchen
und Jungen in ihrem jeweiligen Verhalten so bekräftigt, dass die Ge-
schlechtsrollenstereotypisierungen, die in jedem Menschen mehr oder
weniger vorhanden sind, immer wieder bestätigt werden. Im Bekräfti-
gungslernen geschieht dies größtenteils durch Lob und Tadel in verba-
ler bzw. nonverbaler Form. So wird beispielsweise ein Mädchen, meist
im Zusammenhang mit unbewussten traditionellen Erziehungsschema-
ta, eher dazu angehalten, mit einer Puppe zu spielen als mit einem
Auto. Hier wird dem Vater, als gegengeschlechtlicher und eventuell
ausgleichender Elternteil, eine besondere Bedeutung für seine Tochter
zugesprochen.
23
Jugendliche orientieren sich untereinander ebenso an den verschiede-
nen Rollenbildern, die dem Geschlecht zugeschrieben werden und
entwickeln sich in Abgrenzung aber auch Abhängigkeit von diesen. Es
zeichnet sich deutlich ab, dass in geschlechtergemischten Peergroups
eine Jungendominanz gilt. Jungen nehmen sehr selten weibliche Rollen
ein und präsentieren sich eher als von Beziehungen unabhängig. Sie
werden mehrheitlich dazu veranlasst, die jeweiligen Geschlechterord-
nungen immer wieder herzustellen. Mädchen übernehmen in der Regel
sehr wohl auch männliche Rollen, achten mehr auf Beziehungen und
sind auch stärker von ihnen abhängig.
24
Hierbei kommt der Einfluss des
Vaters auf seine Tochter wieder zum Vorschein. Durch den Kontakt mit
dem Vater lernen weibliche Jugendliche, mit dem anderen Geschlecht
umzugehen und können sich auf die männliche Lebenswelt einstellen.
Jedoch ist hierbei nicht auszuschließen, dass sie sich ebenso von die-
ser abhängig machen, um in der Gesellschaft anerkannt zu sein. Dies
könnte sich im späteren Lebensverlauf einer jungen Frau u. a. ungüns-
23
Vgl. Rendtorff, Geschlecht, 2003, 30.
24
Vgl. MSJK in NRW (Hrsg.), Gender, 2005, 11f.
Kapitel 1: Die Eltern-Kind-Beziehung
16
tig auf die paritätische Entwicklung in Partnerschaftsbeziehungen aus-
wirken. Es steht hier zur Diskussion, inwieweit der Vater seine Tochter
in ihrer Autonomieentwicklung unterstützen kann, damit sie einerseits
das Gefühl hat, von ihm geliebt zu werden, andererseits sich dennoch
von ihm lösen kann.
1.6 Unabhängigkeit und Bindungsfähigkeit im Jugendalter
Die Loslösung von Jugendlichen und ihren Eltern verläuft in der Regel
nicht ohne Konflikte, denn gerade Heranwachsende stehen zwischen
dem Wunsch nach einer gewissen Nähe zu den Eltern und dem einer
klaren Abgrenzung und Unabhängigkeit von ihnen.
Die Sozialisationsforschung weist in Bezug auf das Bindungsverhalten
von Jugendlichen Lücken auf und beschäftigt sich vor allem mit der
Qualität der Beziehungen zwischen Eltern und kleinen Kindern. Das
Explorationsverhalten und die Bindungsfähigkeit im Jugendalter wurden
weitgehend ausgespart, auch wenn diese beiden Komponenten sich
gegenseitig bedingen. "Aspekte der Exploration sind allerdings für das
Jugendalter von besonderer Bedeutung, die Ausweitung auf neue In-
teraktionspartner und die zunehmende Autonomie ist [sic!] auffallend,
wie auch die besondere Bedeutung des Vaters, der ein gutes Modell für
Trennung und Autonomie ist."
25
In Längsschnittstudien aus Minnesota,
Regensburg und Bielefeld wurden die aktuellen Bindungsrepräsentatio-
nen der einzelnen Jugendlichen herauskristallisiert, die als Kleinkinder
auf ihr Bindungsverhalten hin getestet worden waren.
26
Die Ergebnisse
sahen wie folgt aus:
Sicher gebundenen Jugendlichen ist die Bindung an bestimmte Be-
zugspersonen sehr wichtig. Sie können durch ihre positive Grundhal-
25
Streeck-Fischer (Hrsg.), Adoleszenz, 2004, 165.
26
Vgl. Grossmann/ Grossmann, Bindungen, 2005, 80ff.
Kapitel 1: Die Eltern-Kind-Beziehung
17
tung negative Erfahrungen mit ihren Eltern ausgleichen und sind dies-
bezüglich konfliktlösungsfähig. Bindungs- und Explorationsverhalten
halten sich die Balance.
Bei unsicher-distanziert gebundenen Jugendlichen ist weder Autonomie
noch Elternverbundenheit zu erkennen, sie stellen sich jedoch als von
Beziehungen besonders unabhängig dar. Sie tendieren dazu, ihre El-
tern zu idealisieren und nehmen im Allgemeinen kaum negative Affekte
bei sich und anderen wahr.
Unsicher-verwickelt gebundene Jugendliche verhalten sich ihren Eltern
gegenüber häufig überengagiert, was sich jedoch nicht immer als effi-
zient herausstellt. Ihr Bindungsverhaltenssystem bleibt fortwährend
aktiviert.
Das bedeutet, dass sich in der Regel die Loslösung der sicher-
gebundenen Jugendlichen von ihren Eltern am schnellsten, einfachsten
und produktivsten vollzieht. Ist die Bindung zwischen Eltern und Ju-
gendlichen durch Unsicherheit geprägt, so ist die Erkundung von der
sicheren Basis aus gehemmt.
27
Das lässt darauf schließen, dass sich eine solche Entwicklung auch
negativ auf die Bereitschaft, neue Freundschaften und Partnerschafts-
beziehungen zu knüpfen, auswirkt. Bezogen auf die Vater-Tochter-
Beziehung vollzieht sich der Prozess der Ablösung in Abhängigkeit vom
Verhältnis beider. So sind in der zweiten ödipalen Phase eines Mäd-
chens, die in der Pubertät liegt, Qualität der Vater-Tochter-Beziehung
und Anwesenheit des Vaters von besonderer Bedeutung. Der männli-
che Elternteil hat während der Adoleszenz seiner Tochter die Aufgabe,
sie in ihrem Ablösungsprozess, ihrer Entwicklung zu sexueller Intimität
und ihrem Streben nach Selbständigkeit zu unterstützen.
28
27
Vgl. Streeck-Fischer (Hrsg.), Adoleszenz, 2004, 166f.
28
Vgl. Happel, Einfluss, 2003, 227.
Kapitel 1: Die Eltern-Kind-Beziehung
18
1.7 Zusammenfassung
Die Beziehung zwischen Eltern und Kind baut auf einer von Geburt an
gedeihenden Bindung auf, die im Idealfall durch elterliche Liebe und
Fürsorge gekennzeichnet ist und das Überleben des Kindes sichert. Die
Qualität der Eltern-Kind-Bindung sagt viel darüber aus, wie die emotio-
nale, kognitive und soziale Entwicklung des Kindes verläuft. Hierbei ist
anzumerken, dass es für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes
förderlich ist, wenn ein positives Klima in der Eltern-Kind-Beziehung
durch Verlässlichkeit der Elternfiguren geprägt ist.
Die Vater-Tochter-Beziehung gewinnt in der Wissenschaft zwar mehr
und mehr an Bedeutung, jedoch gibt es noch wenig Befunde über das
Verhältnis zwischen Vater und Tochter in den einzelnen Lebensab-
schnitten. Es steht jedenfalls fest, dass der Vater im Leben einer jungen
Frau einen entscheidenden Einfluss auf ihre Identitäts- und Autonomie-
entwicklung hat. Der Höhepunkt dieser Entwicklung vollzieht sich in der
Pubertät, der Phase, in der dem Vater die Aufgabe zufällt, seiner Toch-
ter in der Entfaltung ihrer Selbständigkeit entgegenzukommen. Je
nachdem, wie sich die Identität einer jungen Frau gestaltet, ist sie in der
Lage, einerseits eine gewisse Unabhängigkeit von ihren Eltern zu er-
langen, andererseits eine sichere Bindung zu ihnen aufrecht zu erhalten
und gleichzeitig neue Beziehungen zu knüpfen. Diesen Prozess sollte
ein junger Mensch so durchleben können, dass die Loslösung vom
Elternhaus sich in Freiwilligkeit und persönlichkeitsgerechter Entwick-
lung vollzieht. Hier stellt sich die Frage, wie sich eine plötzliche Unter-
brechung des Ablösungsprozesses durch Trennung bzw. Verlust eines
Elternteils auf die Entwicklung eines heranwachsenden Menschen
auswirkt und welche Erfahrungen Jugendliche überhaupt im Zusam-
menhang mit Trennung und Verlust machen.
Kapitel 2: Das allgegenwärtige Abschiednehmen
19
2 Das allgegenwärtige Abschiednehmen
Im zweiten Kapitel werden verschiedene Facetten des Abschiedneh-
mens veranschaulicht, die im Leben des Menschen eine bedeutende
Rolle spielen. Die menschliche Trauer, eine Folge ständiger unumgäng-
licher Abschiede, wird näher beschrieben und in vier ineinander grei-
fende Phasen unterteilt.
Bevor sie in das Erwachsenenalter eintreten, lernen Kinder und
Jugendliche durch zahlreiche Verluste mit Trennung umzugehen. Wie
Heranwachsende Sterben und Tod begegnen, ist somit eine weitere
Facette des Abschiednehmens, die behandelt werden muss. Das Ju-
gendalter stellt durch den Prozess der Identitätsfindung eine besondere
Herausforderung für junge Menschen dar, weil sie in dieser Entwick-
lungsphase ihre Zukunft als selbständige Personen bestimmen. Welche
Auswirkungen der Verlust eines geliebten Menschen auf die Autono-
mieentwicklung von Jugendlichen haben kann, wird am Beispiel "Mäd-
chen im Jugendalter und Tod des Vaters" erläutert. Die genauere Be-
trachtungsweise im letzten Abschnitt dieses Kapitels ist wichtig zum
Verständnis von Jugendlichen, insbesondere Mädchen, die auf der
Suche nach Identität und Autonomie sich davor fürchten, einen gelieb-
ten Elternteil zu verlieren.
2.1 Das abschiedsreiche Leben des Menschen
Das Leben hält viele Abschiede für den Menschen bereit. Schon bei der
Geburt muss er sich von seinem bisherigen Lebensraum trennen, dem
Mutterleib. Im Laufe der Zeit sieht er sich mit weiteren Abschieden
konfrontiert, denn tagtäglich lernt er, dass Dinge nicht so geschehen,
Kapitel 2: Das allgegenwärtige Abschiednehmen
20
wie in seiner Vorstellung angenommen.
29
Die emotionale Reaktion, die
durch solche Situationen hervorgerufen wird, ist die Enttäuschung.
Schon im Kleinkindalter werden dem Sprössling in seinem Explorati-
onsgang Grenzen aufgezeigt. Das Kind greift nach einem verschluckba-
ren Gegenstand, den die Eltern ihm, kaum, dass es ihn in seinem Be-
sitz hat, wieder entreißen. Der Verlust, der damit verbunden ist, so
unbeträchtlich er Erwachsenen erscheinen mag, wird vom Kind nur mit
erheblichem Protest hingenommen. Neben diesen alltäglichen kleinen
Verlusterfahrungen gibt es natürlich auch einschneidendere Ereignisse
für den Menschen, wie z.B. die Trennung von vertrauten Orten oder von
wichtigen Personen.
30
Durch die Erfahrung mit unzähligen Abschieden im Laufe der Persön-
lichkeitsentwicklung lernt das Individuum, mit Rückschlägen umzuge-
hen. Überdies nehmen Menschen mit der Zeit wahr, dass Verluste mit
Hilfe anderer Bezugspersonen überwindbar sind und es sich lohnt,
Risiken einzugehen und neue Beziehungen aufzubauen, die für den
weiteren Werdegang bereichernd erscheinen. Das "Sich-Einlassen und
Loslassen" gehört elementar zum Leben eines Menschen dazu.
31
2.2 Der Mensch und die Trauer
Trauer ist eine Emotion, die dem Menschen ermöglicht, Trennung oder
Verlust von etwas lieb Gewonnenem oder jemand nahe Stehendem zu
verarbeiten. Im alt- und mittelhochdeutschen Sprachgebrauch bedeutet
das Wort Trauer, "Niederfallen, matt und kraftlos werden, den Kopf
sinken lassen, die Augen niederschlagen."
32
Das Trauern ist ein
29
Vgl. Käsler-Heide, Diagnose, 1999, 7.
30
Vgl. Kapitel 1.3 dieser Arbeit.
31
Vgl. Kast, Sich einlassen, 2006, 7ff.
32
Specht-Tomann/ Tropper, Abschied, 2004, 34.
Kapitel 2: Das allgegenwärtige Abschiednehmen
21
schmerzhafter Prozess, der bei einem tief greifenden Verlust so durch-
lebt werden sollte, dass die Erinnerungen an verloren gegangene Ob-
jekte oder Personen weder vergessen noch verdrängt werden.
Trauer wird in den unterschiedlichsten Situationen bewusst durchlebt,
wenn beispielsweise das erste Heimtier oder sogar eine enge Bezugs-
person stirbt. Auch in die Brüche gegangene Partnerschaftsbeziehun-
gen werden betrauert.
33
Die zu diesem Thema unverzichtbaren Untersuchungen von Erna Fur-
mann und einer Gruppe englischer Psychoanalytiker (1977) zeigen,
dass es sehr wohl Unterschiede gibt zwischen der Trauer um verlasse-
ne Wohnorte, unbelebte Objekte, vergangene Zeitabschnitte und der-
gleichen und der Trauer um geliebte Bezugspersonen, zu denen zuvor
eine feste Bindung aufgebaut worden war.
34
Aus diesem Grund wird im
Folgenden, wenn von Trauer die Rede ist, diese als Reaktion auf den
Tod eines geliebten Menschen behandelt.
Wie begegnen nun Menschen dem Tod einer wichtigen Bezugsperson?
Zumeist reagiert das Individuum auf den Verlust eines geliebten Men-
schen mit innerem Widerstand und ist mehr oder weniger in einem
Schockzustand befangen. Erst nach einer Weile wird dem Schmerz ein
gewisser Freiraum zugestanden und im Idealfall wird der Verlust nach
und nach so verarbeitet, dass wiederum Lebensmut gefasst und die
Erfahrung als Chance für einen Neuanfang genutzt wird. Der Trauernde
geht aus diesem Prozess als veränderte Persönlichkeit hervor.
Es gibt Menschen, die solche schicksalhaften Lebensereignisse nie
wirklich überwinden; die einen Bruch in ihrem Leben sehen, den sie
nicht auszugleichen vermögen. Die Loslösung vom Verstorbenen fällt
Betroffenen, die chronisch trauern, schwer, denn sie haben den Verlust
33
Vgl. Kast, Sich einlassen, 2006, 29.
34
Vgl. Furmann, Untersuchungen, 1977, 49ff.
Kapitel 2: Das allgegenwärtige Abschiednehmen
22
weder verarbeitet noch akzeptiert. Dazu ist eine gewisse Trauerarbeit
notwendig.
35
2.3 Die Phasen der Trauer
Die Gefühlswelt der Trauer hat viele Gesichter. Mit dem Wort Trauer
wird nicht nur Traurigkeit verbunden, sondern auch Angst, Wut, Ver-
zweiflung, Hilflosigkeit, Verdrängung, Depression, Leid, Schmerz,
Schuldgefühle und vieles mehr. Jeder Mensch erlebt derartige Emotio-
nen in unterschiedlicher Intensität und zu ungleichen Zeiten des Trau-
erprozesses. Die im Folgenden aufgeführten Phasen der Trauer nach
Verena Kast bieten eine wichtige Orientierungshilfe, um die ineinander
übergehenden Grundmuster der Trauerentwicklung anlässlich des
Todes einer geliebten Person darzustellen.
· Die erste Phase: Nicht-Wahrhaben-Wollen
In der ersten Phase des Trauerprozesses reagieren Betroffene fast
immer mit einem inneren Schockzustand, in dem sie wie erstarrt und
fern jeder Realität wirken. Die trauernde Person nimmt in dieser Zeit
weder die eigenen, noch die Gefühle anderer wahr und es fällt ihr
schwer, ihren persönlichen Zustand zu beschreiben. Dies dient der
hinterbliebenen Person als Schutzmechanismus, denn eine vollständige
Realisierung des Verlusts in den ersten Momenten unmittelbar nach der
Konfrontation mit dem Tod wäre eine zu große Belastung für den Men-
schen und würde seine Gesundheit gefährden. In dieser Phase können
sich jedoch zwischenzeitlich schmerzhafte Emotionen bemerkbar ma-
chen, die dann wieder schlagartig verschwinden können. Die charakte-
ristischen Sinnesempfindungen, die häufig mit diesem Trauerprozess
einhergehen, sind innere Leere, Betäubung, Panik und Starre. Manche
35
Vgl. Kast, Sich einlassen, 2006, 12, 20.
Kapitel 2: Das allgegenwärtige Abschiednehmen
23
Menschen spüren überdies eine gewisse Wut, die vermehrt in der zwei-
ten Trauerphase auftritt. Die Intensität und Dauer des Schockerlebens
hängen davon ab, wie die Beziehung zum Verstorbenen war und wel-
che Möglichkeiten die hinterbliebene Person zuvor hatte, sich auf den
Tod dieses Menschen vorzubereiten.
Die Verdrängungs- bzw. Verleugnungsphase kann etwa eine Woche
lang andauern, jedoch gibt es auch Menschen, bei denen dieser Pro-
zess langsamer verläuft.
· Die zweite Phase: Aufbrechende Emotionen
Der Eintritt in die zweite Trauerphase hebt die zuvor angeführten Läh-
mungserscheinungen auf und bringt eine Vielzahl von Emotionen zum
Ausdruck. In dieser Zeit herrscht Gefühlschaos, einhergehend mit Ge-
fühlsschwankungen, die zwischen Wut, Ohnmacht, Traurigkeit, Angst,
Zorn, Freude und Schmerz in unterschiedlicher Intensität variieren
können. Einerseits beginnt die trauernde Person allmählich zu realisie-
ren, dass der Tod des geliebten Menschen tatsächlich eingetreten ist,
andererseits versucht sie immer wieder, den Verlust gedanklich rück-
gängig zu machen. Sätze wie "Wäre ich doch zuhause geblieben, dann
würde sie noch leben", machen deutlich, dass überdies massive
Schuldgefühle durch den Todesfall ausgelöst werden können. Betroffe-
ne bedürfen in der Phase der aufbrechenden Emotionen der Unterstüt-
zung von Menschen mit besonders sensiblem Einfühlungsvermögen.
Jegliche Gefühlsäußerungen sind wichtige Verarbeitungsfaktoren und
sollten zunächst einmal angenommen werden und unkommentiert blei-
ben.
· Die dritte Phase: Suchen und Sich-Trennen
Das Suchen nach Sicherheit gebenden Stützen in der dritten Trauer-
phase ist als natürliche Reaktion auf die Verlusterfahrung anzusehen.
Die trauernde Person versucht, den Verstorbenen so lebendig wie mög-
lich zu halten, indem sie Anhaltspunkte sucht, die sie mit dem Toten
Kapitel 2: Das allgegenwärtige Abschiednehmen
24
identifiziert. Trauernde empfinden es als tröstlich und schmerzlindernd,
wenn gewisse Vorstellungen und bestimmte Verhaltensweisen beibe-
halten werden können, die eng mit dem Verstorbenen in Beziehung
stehen. So kann es sein, dass ein heranwachsendes Mädchen jeden
Tag um die gleiche Zeit am Fenster steht und die Rückkehr des ver-
storbenen Vaters von der Arbeit erwartet. Die Hoffnung, dass der ge-
liebte Mensch wieder zurückkommen könnte, ist in dieser Phase stark
ausgeprägt. Durch die immer wiederkehrende Einsicht, dass dies nicht
geschehen wird, stellt sich nach einer Weile die ruhelose Suche ein und
der Verlustschmerz wird als solcher akzeptiert. In der dritten Trauer-
phase können Menschen einerseits Verzweiflung und Hilflosigkeit,
andererseits Freude und Dankbarkeit für das Erlebte empfinden.
36
· Die vierte Phase: Neuer Selbst- und Weltbezug
Nachdem die trauernde Person sich ihren Weg durch Gefühlswelten
und neue Erfahrungen gebahnt hat, geht sie aus dieser Entwicklung als
reifer gewordene Persönlichkeit hervor. In der vierten und letzten Phase
des Trauerprozesses ist sie bereit, sich vom Verlustgeschehnis zu
lösen, sich einer neuen veränderten Lebenswelt zu stellen und sich an
dieser zu erfreuen. "Der Verstorbene ist zu einer inneren Figur gewor-
den. Lebensmöglichkeiten, die durch die Beziehung möglich geworden
und die zuvor nur innerhalb der Beziehung möglich gewesen sind, wer-
den zum Teil zu eigenen Möglichkeiten [sic!]."
37
Die hinterbliebene
Person erlebt nun eine spürbare Befreiung vom Verlustschmerz. Ob-
wohl oder gerade weil der Trauerprozess eine kummervolle und
schmerzliche Angelegenheit war, ist sie dankbar dafür und stolz darauf,
diesen mit allen Höhen und Tiefen durchlebt und gemeistert zu haben.
Die Neudefinition der eigenen Persönlichkeit und die gewonnene Selb-
36
Vgl. Specht-Tomann/ Tropper, Abschied, 2004, 36ff.
37
Kast, Sich einlassen, 2006, 17.
Kapitel 2: Das allgegenwärtige Abschiednehmen
25
ständigkeit geben dem Individuum auch bezüglich der Knüpfung neuer
Beziehungen wiederkehrenden Lebensmut.
Die Zeitdauer der letzten drei Trauerphasen ist schwer einzuschätzen,
denn je nach der Länge und Intensität der Beziehung zum Verstorbe-
nen und der eigenen Erfahrungen und Gefühlswelten des Hinterbliebe-
nen kann sich der Prozess der Ablösung verlängern oder verkürzen.
Die vier Phasen der Trauer wurden anhand von Studien der Reaktionen
von Erwachsenen erarbeitet, die den Verlust eines geliebten Menschen
erlebten. Je nachdem, wie weit Kinder und Jugendliche in ihrem jeweili-
gen Entwicklungsstadium vorangeschritten sind, können sie den Tod
ähnlich wie Erwachsene begreifen und die Trauerphasen in gleicher
Weise durchleben.
2.4 Kinder und Jugendliche ergründen den Tod
"Wie Kinder auf den Tod reagieren, hängt von vielen Faktoren ab: Die
Einstellung der Eltern zu Sterben und Tod spielt eine Rolle, das Alter
des Kindes, die Beziehung zu dem Verstorbenen, die Art des Todes,
frühere Erfahrungen mit dem Tod und auch religiöse Vorstellungen."
38
Früher oder später werden Kinder mit Sterben und Tod konfrontiert,
denn auch sie erleben Situationen, die viele Fragen aufwerfen. So
könnte ein Kind beispielsweise eine tote Katze auf der Straße entde-
cken und sich von den Eltern losreißen, um zu sehen, was mit der Kat-
ze geschehen ist. Die Katze, durch Erfahrung und Vergleich mit ande-
ren Katzen vertraut, wirkt in ihrer jetzigen Leblosigkeit und Starre be-
fremdend auf das Kind, das diese Tiere immer als lebendige, sich be-
wegende, weiche, zutrauliche oder auch scheue Wesen kennen gelernt
hat. Das Kind hat zuvor Vertrautheitsschemata ausgebildet, die in die-
38
Tausch-Flammer/ Bickel, Sterben, 2006, 68.
Kapitel 2: Das allgegenwärtige Abschiednehmen
26
ser Situation nicht mehr bestätigt werden und es somit ängstigen. Es
fragt Mutter oder Vater, was passiert sei. Je nachdem, wie Erwachsene
selbst ihre ersten Erfahrungen in ähnlichen Situationen gemacht haben,
werden sie in Kombination mit ihren erweiterten Vorstellungen von
Leben und Tod versuchen, dem Kind zu antworten. Sie können sagen,
die Katze sei tot. Will das Kind aber wissen, ob es für die Katze ein
Weiterleben nach dem Tod gibt, so würden viele Eltern eine Antwort
lieber umgehen, um ihre eigene Unwissenheit zu verhehlen.
In solchen Situationen, besonders aber beim Tod eines geliebten Men-
schen, ist es nicht ratsam, dem Kind die Wahrheit zu verschweigen. Die
Unsicherheit, die Erwachsene ausstrahlen, wenn sie keine adäquate
Antwort parat haben, bemerken Kinder schnell. Die Antworten der El-
tern fallen sehr verschieden aus und beruhen auf wissenschaftlichen
bis unterschiedlichen religiösen Vorstellungen. Metaphern wie: "Dein
Vater hat eine lange Reise angetreten und kommt nie mehr zurück",
werden von kleinen Kindern wörtlich genommen, sind zweideutig und
nicht mit der Realität vereinbar.
39
Jedes Mal, wenn ein geliebter Mensch
verreist, ist das Kind nunmehr verängstigt und glaubt, die Person kom-
me nicht wieder.
40
In diesem Fall ist es besser zu erklären, dass nie-
mand wirklich genau weiß, was nach dem Tod geschieht, dennoch
jeder diesbezüglich seine eigenen Vorstellungen hat. Verschiedene
Auffassungen über Sterben und Tod, auch die eigenen, können dem
Kind wiedergegeben werden, damit es sich selbst ein Bild machen kann
und zunächst das für sich am besten geeignete Beispiel übernehmen
oder gegebenenfalls seine eigene Variante einbringen kann. Im Laufe
der Zeit entwickeln Kinder ihre individuellen Vorstellungen von Sterben
und Tod, die dann im Jugendalter bereits stark ausgeprägt sind, jedoch
39
Vgl. Bowlby, Verlust, 2006, 260f.
40
Vgl. Leist, Tod, 2004, 16.
Kapitel 2: Das allgegenwärtige Abschiednehmen
27
gerade in diesem Lebensabschnitt auch immer wieder hinterfragt wer-
den.
41
Die Vorstellungen von Kindern und Jugendlichen der verschiedenen
Altersstufen bezüglich Sterben und Tod werden wie folgt unterschieden:
Kinder unter 3 Jahren können den Tod noch nicht realisieren, weil ihnen
die kognitiven Voraussetzungen fehlen, die begrifflichen Zusammen-
hänge zu verstehen. Der Tod einer Bezugsperson wird vom Kind ledig-
lich als vorübergehende Abwesenheit interpretiert. Die Vorstellung einer
zeitbegrenzten Trennung löst dennoch beachtlichen Widerstand bei ihm
aus. Das Kind zeigt Trauersymptome wie Angst, Frustration, Wut und
Suchen nach der fehlenden Bezugsperson. Trauern die Angehörigen,
die dem Kind am nächsten stehen, auch, so leidet das Kind mit ihnen.
Seine eigene Trauer kann sich verstärken, wenn es infolge des tragi-
schen Ereignisses nicht die nötige Zuwendung erhält. Die Vorstellung
vom Tod ist unabhängig von der erlebten Trauer, denn kleine Kinder,
die noch keinerlei Todesbegriff haben, können dessen ungeachtet um
eine geliebte Person trauern, wenn diese nicht mehr zugänglich ist.
42
Kinder zwischen 3 und 5 Jahren erleben den Tod altersgemäß entspre-
chend, haben aber auf dieser Entwicklungsstufe ein realeres Weltbild
als zuvor und können Verknüpfungen zwischen Dingen erstellen, die
sie gelernt und erfahren haben und denen, die ihnen neu begegnen.
Sie können sich bereits angemessen artikulieren und drängen darauf,
Unbekanntes zu erforschen. Offene Gespräche mit dem Kind sind in
der Zeit, in der es mehr über den Tod wissen möchte, besonders wich-
tig. Der Tod wird zwar immer noch als vorübergehender Zustand ange-
sehen, doch je länger die Abwesenheit des Toten sich hinzieht, umso
41
Vgl. Tausch-Flammer/ Bickel, Sterben, 2006, 69f.
42
Vgl. Specht-Tomann/ Tropper, Abschied, 2004, 68ff; vgl. dazu auch Tausch-
Flammer/ Bickel, Sterben, 2006, 77ff; anderer Auffassung ist Bowlby, Verlust,
2006, 261.
Kapitel 2: Das allgegenwärtige Abschiednehmen
28
stärker entwickelt sich der Gedanke, dass dem Tod eine tiefere Prob-
lematik innewohnen müsse als einer kurzzeitigen Trennung.
Kinder zwischen 6 und 9 Jahren begreifen den Tod als endgültiges
Geschehen, können sich jedoch noch kein konkretes Bild über das
Ausmaß des Todes machen. Sie verstehen allmählich die Zusammen-
hänge zwischen Leben und Tod, möchten aber dennoch die trostlose
Unwiderruflichkeit dieser Realität nicht uneingeschränkt hinnehmen.
Das Rätsel des Todes veranlasst Kinder, es weiterhin zu erforschen,
um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.
Mit dem Eintritt in das Jugendalter gleichen Heranwachsende ihre Vor-
stellung vom Tod und ihre Reaktionen auf ihn denen der Erwachsenen
an. Jugendliche sind in ihrer Identitätsfindung damit beschäftigt, Fragen
an die eigene Person zu stellen. Sie sehen sich in der Vergangenheit,
der Gegenwart und der Zukunft und versuchen, ihren persönlichen
Werdegang aus diesen drei Komponenten abzuleiten. Bei der Ausei-
nandersetzung mit der Zukunft kommen die jungen Menschen an dem
Tabuthema Tod nicht vorbei. Sie erkennen, dass alles irdische Leben
einen Anfang und ein Ende hat und beschäftigen sich mit dem Sinn des
Lebens und dem Leben nach dem Tod.
Grundsätzlich verarbeiten Jugendliche einen schmerzlichen Verlust wie
Erwachsene. Sie durchlaufen auch die vier Phasen der Trauer. Dieser
Prozess ist bei vielen jungen Menschen nicht ganz so deutlich zu er-
kennen wie bei Erwachsenen, denn in der Zeit der Identitätsfindung
neigen Jugendliche vermehrt zu Introversion, weil sie vor allen Dingen
mit sich selbst beschäftigt sind. Jedoch ist es gerade in dieser Lebens-
phase besonders wichtig, dass sich mindestens eine nahe stehende
Bezugsperson um den trauernden Jugendlichen kümmert und ihm zur
Kapitel 2: Das allgegenwärtige Abschiednehmen
29
Seite steht.
43
Die Gründe hierfür werden im nächsten Abschnitt ausführ-
licher erläutert.
2.5 Mädchen im Jugendalter zwischen Autonomie und Verlust
Jugendliche, die sich mit Verlusten vertraut und sich diese als unaus-
weichlich bewusst gemacht haben, sehen sich irgendwann mit dem Tod
eines geliebten Menschen und seinen Folgen konfrontiert. Die Angst,
eine primäre Bezugsperson, wie Mutter oder Vater zu verlieren, wird
von den meisten jungen Menschen verdrängt. Der Gedanke an ein
solch tragisches Ereignis wird beiseite geschoben, denn auf dieser
speziellen Entwicklungsstufe befinden sich Jugendliche ohnehin in
einer Ich-Gefährdungsphase. Eine zusätzliche existentielle Gefährdung,
die auf einem elterlichen Verlust beruht, wäre eine zu große seelische
Belastung für Heranwachsende.
44
In der Regel ist die Jugendzeit ein Prozess des freiwilligen Loslösens
eines jungen Menschen von elterlicher Abhängigkeit. Beim Eintritt in
das Jugendalter orientieren sich Mädchen zusehends am männlichen
Elternteil, denn der Vater wird im klassischen Geschlechtsrollenbild von
seiner Tochter als autonome Persönlichkeit wahrgenommen.
45
Je nach
Art der Vater-Tochter-Beziehung findet der Vater durch die Tochter
höchste Anerkennung für seinen beruflichen Erfolg und wird als männli-
ches Objekt gegebenenfalls so idealisiert, dass die junge Frau sich
ihren zukünftigen Partner ebenso wie ihren Vater vorstellt.
46
Im natürlichen pubertären weiblichen Entwicklungsverlauf geschieht
folgendes: Das Mädchen befreit sich, mit Unterstützung des Vaters, in
43
Vgl. Specht-Tomann/ Tropper, Abschied, 2004, 68ff; vgl. dazu auch Tausch-
Flammer/ Bickel, Sterben, 2006, 77ff.
44
Vgl. Leist, Tod, 2004, 18, 22, 38f.
45
Vgl. Kapitel 1.6 dieser Arbeit
46
Vgl. Kapitel 1.4.1 und 1.5 dieser Arbeit.
Kapitel 2: Das allgegenwärtige Abschiednehmen
30
der Jugendzeit von seinen Vaterkomplexen und geht daraus mit dem
Bewusstsein eines individuellen Selbst hervor.
47
Wird dieser natürliche
Prozess durch den Tod des Vaters unterbrochen, so können sich psy-
chische Beeinträchtigungen in der Entwicklung des Mädchens bemerk-
bar machen. Der zuvor aktive Drang nach Autonomie würde dann von
der Tochter im Zusammenhang mit dem Tod des Vaters negativ wahr-
genommen werden. Der Verlust wird demzufolge von ihr als Strafe für
den Versuch, sich vom Vater loszulösen angesehen, wobei das Mäd-
chen starke Schuldgefühle entwickelt. Andererseits ist es nicht unwahr-
scheinlich, dass die Idealisierung des Vaters durch den frühzeitigen
Verlust noch zusätzlich verstärkt wird, was zur Folge hätte, dass der
zukünftige Partner der Tochter diesem Ideal nicht gerecht werden
kann.
48
Hat sich die Loslösung vom Vater also noch nicht zufrieden stellend
vollzogen, kann dessen plötzlicher Tod sich zunächst nachteilig auf die
Autonomieentwicklung der Tochter auswirken. Somit ist wichtig, Mäd-
chen, die sich in einer solchen Situation befinden, in ihrer Trauer zu
begleiten und mit ihnen über ihre bedrückenden Gedanken offen zu
sprechen, wenn sie dies wünschen, denn ein Verlust bedeutet nicht nur
Schmerz und psychische Unsicherheit, sondern auch Wachstum und
Stärke.
49
2.6 Zusammenfassung
In einer Reihe von Abschieden, die der Mensch im Laufe seines Da-
seins erlebt, lernt das Individuum, sich den Gesetzen der Natur anzu-
passen. Die unabdingbare Vorbereitung auf Verluste in Kindheit und
47
Vgl. Kast, Sich einlassen, 2006, 115.
48
Vgl. Kapitel 1.4.2 dieser Arbeit.
49
Vgl. Bowlby, Verlust, 2006, 281ff.
Kapitel 2: Das allgegenwärtige Abschiednehmen
31
Jugend ist die Grundvoraussetzung für ein Leben, das von Mal zu Mal
schwerere Abschiedsbegegnungen bereithält. In der Regel sieht der
Mensch sich nicht ausschließlich einem schicksalhaften Verlust ausge-
setzt, sondern gewinnt durch die Fülle der Erfahrungen, die ein tragi-
sches Ereignis mit sich bringt, eine stärkere und reifere Persönlichkeit.
Der mit dem Verlust eines geliebten Menschen einhergehende Trauer-
prozess ist für die heilsame Verarbeitung eines Todesfalls notwendig.
Die Trauerarbeit besteht aus vier verschiedenen Phasen, die in der
Regel durchlaufen werden: Die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens,
die Phase der aufbrechenden Emotionen, die Phase des Suchens und
Sich-Trennens und die Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs. Kin-
der- und Jugendliche durchleben diese Phasen ähnlich wie Erwachse-
ne. Je reifer ihr Entwicklungsstadium, desto mehr gleicht sich ihr Ver-
halten dem der Erwachsenen an. Die Vorstellungen von Leben und Tod
entfalten sich entsprechend dem Alter des Individuums, den zuvor er-
lebten Verlusten und ihren Folgen, dem Verhältnis zum Verstorbenen
und seiner Todesoption, dem Vorbild von Bezugspersonen und der
Einstellung zum Transzendenten. Die Hilfsbedürftigkeit von Jugendli-
chen im Hinblick auf Sterben und Tod wird von Erwachsenen aufgrund
der introvertierten Haltung der jungen Menschen allzu oft falsch inter-
pretiert. Selbst wenn ein Individuum gegenwärtig noch keinen folgen-
schweren Verlust erleiden musste, so entwickelt sich im Laufe der Zeit
dennoch die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren.
Am Beispiel von Mädchen im Jugendalter, die konfrontiert sind mit dem
Tod des Vaters, wird deutlich, welche Auswirkungen der Verlust einer
wichtigen Bezugsperson auf die Autonomieentwicklung einer jungen
Frau haben kann. Angehörige sollten daher in der Zeit der Identitätssu-
che junger Menschen auf intensive Gespräche mit ihnen setzen, um die
Angst vor schicksalhaften Geschehnissen zu mildern, ihnen bei eintre-
tendem Todesfall angemessen zu begegnen und sie entsprechend zu
begleiten.
Kapitel 3: Konfrontation mit dem Tod eines Elternteils
32
3 Konfrontation mit dem Tod eines Elternteils
Das zweite Kapitel beschäftigte sich vorwiegend mit wissenschaftlichen
Erkenntnissen über Trennung und Tod, mit Verlusterfahrung, verbun-
den mit Trauer und ihren Phasen und vor allem damit, wie sich diese
Ereignisse bei Kindern und Jugendlichen auswirken. Das dritte Kapitel
geht dann zur Behandlung der tatsächlichen Konfrontation mit dem Tod
über. Es erörtert die Übermittlung der Todesnachricht, die im Vergleich
zum realen Erleben des Todes andere Reaktionen beim Betroffenen
auslösen kann. Als Grundlage für die Erörterung des Hauptgedankens
von "Mädchen im Jugendalter und plötzlicher Vatertod" im vierten Kapi-
tel dienen die Ausführungen über die wesentlichen Todesursachen,
sowie über das soziale Umfeld des Verstorbenen und seine Reaktion
auf dessen Tod.
3.1 Die Übermittlung der Todesnachricht
Die Umstände, unter denen ein Mensch vom Tod eines ihm Naheste-
henden benachrichtigt wird, entscheiden oft über den Verlauf des Trau-
erprozesses. Verschiedene Faktoren spielen hierbei eine Rolle. Es
kommt in erster Linie auf die Todesursache des Verstorbenen an, denn
es ist ein Unterschied, ob eine nahe stehende Person plötzlich und
ohne jegliche Vorahnung stirbt, oder ob sie zuvor einen langwierigen
Krankheitsverlauf durchlebte, sodass für Angehörige noch die Möglich-
keit bestand, sich zu verabschieden.
50
Darüber hinaus ist die Feinfüh-
ligkeit der Person ausschlaggebend, die eine Todesnachricht über-
bringt. Von Verwandten und Bekannten, die mit dem Tabuthema Tod
keine ausreichende Erfahrung haben, wird kaum erwartet, dass sie die
50
Vgl. Käsler-Heide, Diagnose, 1999, 18, 107.
Kapitel 3: Konfrontation mit dem Tod eines Elternteils
33
Aufgabe der Übermittlung der Todesnachricht professionell meistern.
Es wäre ohne Frage sinnvoll, dass sich jeder Mensch auf Verlustsituati-
onen in seinem Leben gefasst macht und sich mit dem Gedanken an
den Tod einer nahe stehenden Person vertraut macht.
51
Kaum jemand
möchte sich jedoch in einer Gesellschaft, in der jung und gesund sein
einen so hohen Stellenwert besitzt, wie in der Unseren, mit dem Tod
beschäftigen. Aus diesem Grund ist es umso schwerer, gerade jungen
Menschen vom Todesfall einer geliebten Person zu berichten, denn
Heranwachsende werden in ihrer unbeschwerten dynamischen Art nicht
gerne mit dem Thema Sterben und Tod belastet.
Im Falle des Todes von Vater oder Mutter ist wünschenswert, dass die
Todesnachricht von einer vertrauten Person, z.B. vom überlebenden
Elternteil, übermittelt wird. Allerdings kommt es nicht selten vor, dass
der Todesfall gerade von engen Verwandten vor Kindern und Jugendli-
chen so lange verschwiegen wird, bis eine Eröffnung der Nachricht
unausweichlich wird. Wird die Todesnachricht schließlich übermittelt, so
geschieht dies oft in irreführender Form, um dem heranwachsenden
Menschen den Schmerz zu ersparen, der mit dem tragischen Verlust
einhergeht.
52
Dieses Vorgehen ist zwar gut gemeint, dennoch dürfen
weder Kinder noch Jugendliche ihrer eigenen, wenn auch schmerzli-
chen, Erfahrungen beraubt werden. Abgesehen vom Alter eines Indivi-
duums ist es unumgänglich, dass Gefühle, die mit Trauer in Verbindung
stehen, durchlebt werden, damit der Verlust heilsam verarbeitet werden
kann. Jeder Mensch hat das Recht, die wahre Todesgeschichte einer
nahe stehenden Person zu erfahren, auch wenn eventuell eine tragi-
sche Geschichte dahinter steht. Dies bedeutet allerdings nicht, dass
einem kleinen Kind unter allen Umständen der Leidensweg des Vaters
51
Vgl. Kapitel 2.3 und 2.4 dieser Arbeit.
52
Vgl. Bowlby, Verlust, 2006, 257.
Kapitel 3: Konfrontation mit dem Tod eines Elternteils
34
oder der Mutter vor Eintreten des Todes detailgetreu geschildert wer-
den sollte. Es muss beachtet werden, wie belastbar ein Kind in seinem
Entwicklungsstand ist. Jugendliche können je nach Todesursache bes-
ser verstehen, wie es zu einem schmerzlichen oder tragischen Todes-
ereignis kommen konnte, darum sollten ihnen wichtige Details, die zum
Verständnis des Sterbevorgangs ihres Elternteils beitragen, nicht ver-
heimlicht werden. Lücken in der Todesgeschichte enger Angehöriger
lassen einen Menschen ein Leben lang nach dem "Warum?" oder "Wie
konnte dies geschehen?" fragen. Eine abschließende Trauerarbeit wird
somit verhindert. Die Art und Weise, wie und wann eine Todesnachricht
übermittelt wird, ist also entscheidend für den weiteren Trauerverarbei-
tungsprozess.
53
Wichtig ist auch, dass Angehörige, insbesondere der überlebende El-
ternteil, ihre eigene Trauer vor Heranwachsenden nicht zu verheimli-
chen suchen, denn Erwachsene haben vor allem in traumatisierenden
Situationen eine grundlegende Vorbildfunktion für junge Menschen.
Werden eigene Emotionen, die mit dem Tod des Ehepartners zusam-
menhängen, verborgen, so nehmen Kinder und Jugendliche an, es sei
die beste Art, mit dem Tod von Vater oder Mutter umzugehen, indem
sie ihre Gefühle nicht äußern.
54
Wie sinnvoll Trauerarbeit ist, die der
Mensch zu erkennen geben kann, wurde bereits im zweiten Kapitel
erläutert.
Die Tatsache, dass Angehörige verstorbener Personen sich in ihrer
eigenen Trauer sehr hilf- und orientierungslos verhalten, besonders bei
der Übermittlung der Todesnachricht an jüngere Familienmitglieder,
weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass Menschen, die beruflich mit
Trauernden zu tun haben, einen einfühlsamen Kommunikationsstil
53
Vgl. Leist, Tod, 2004, 160ff.
54
Vgl. Kübler-Ross, Kinder, 2003, 85ff
Kapitel 3: Konfrontation mit dem Tod eines Elternteils
35
beherrschen. Selbst in Berufen, die mit Sterben und Tod zu tun haben,
werden Fachkräfte nicht ausreichend im sensiblen Umgang mit Hinter-
bliebenen ausgebildet. So könnte es beispielsweise vorkommen, dass
eine Polizistin nach dem Suizid eines Familienvaters an der Haustür der
betroffenen Familie steht und der noch nichts ahnenden, fünfzehnjähri-
gen Tochter die Schreckensnachricht überbringt, weil das Mädchen die
erste ist, die sie antrifft. Als Folge würde sich die Tochter des Verstor-
benen, wenn es zukünftig an der Haustür läutete, an die tragische
Nachricht, die ihr dort übermittelt wurde, erinnern. Dies löst die Angst in
ihr aus, dass weitere Verluste mit dem Klingeln an der Haustür verbun-
den sein könnten. Es stellt sich also die Frage, ob es nicht besser ge-
wesen wäre, zunächst der Mutter in einem ruhigen, rücksichtsvollen
Gespräch unter vier Augen vom Tod des Ehegatten zu berichten und
ihr die Aufgabe der Übermittlung der Todesnachricht an die Tochter zu
überlassen. Wäre vielleicht sogar ein Hinzuziehen eines Pfarrers oder
einer Seelsorgerin in diesem Fall sinnvoll gewesen?
55
Verwirrungen und pathologische Entwicklungsverläufe bei Kindern und
Jugendlichen können weitgehend vermieden werden, wenn Polizeibe-
amte, Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Sozialarbeiterinnen und -
arbeiter, medizinisches Fachpersonal, Menschen mit therapeutischer
Ausbildung, kirchliche Beschäftigte und andere, die Möglichkeit hätten
und auch nützten, professionelle Kurse und spezielle Lehrgänge zu
besuchen, die Themen wie Sterben und Tod eingehend beleuchten und
den feinfühligen Umgang mit Hinterbliebenen lehren.
56
Darüber hinaus
lastet ja auch ein unerhörter Druck auf den Menschen selbst, die beruf-
lich mit dem Tod konfrontiert werden. Wenn gerade diese nur laienhaft
mit der Materie umzugehen verstehen, laufen sie Gefahr, ihrem Leben
55
Vgl. Käsler-Heide, Diagnose, 1999, 18f.
56
Vgl. Bowlby, Verlust, 2006, 259f.
Kapitel 3: Konfrontation mit dem Tod eines Elternteils
36
ein Ende zu setzen. In Polizeiberufen beispielsweise begehen laut
Statistik mehr als 50 Polizeibeamte jährlich Suizid, darunter viele Fami-
lienväter.
57
3.2 Die Todesursache
Die geschlechtsspezifischen Abweichungen bezüglich Morbidität
(Krankheitswahrscheinlichkeit), Letalität (Tödlichkeit) und Lebenserwar-
tung zwischen Männern und Frauen wurden bereits in den 60er Jahren
erforscht.
Männer sind in ihrem allgemeinen Gesundheitszustand und der im
Durchschnitt sieben Jahre kürzeren Lebenserwartung gegenüber Frau-
en benachteiligt. Dieser Unterschied macht sich vor allen Dingen bei
plötzlichen Todesfällen bemerkbar, denn Männer erleiden statistisch
gesehen häufiger einen tödlichen Herzinfarkt als Frauen, neigen stärker
dazu Opfer von Unfällen zu werden und begehen wesentlich öfter Sui-
zid.
58
Demzufolge begegnen Kinder und Jugendliche eher dem plötzli-
chen Tod des Vaters als dem plötzlichen Tod der Mutter.
Bezogen auf den Prozess der Trauerverarbeitung birgt der unerwartete
Tod eines geliebten Menschen für Angehörige mehr Schwierigkeiten als
ein vorhersehbarer Tod, weil keinerlei Chance besteht, sich auf den
Verlust vorzubereiten. Die nach Erhalt der Todesnachricht sofort ein-
setzende Schockphase lässt eine tiefgehende Verarbeitung zunächst
nicht zu. Stirbt ein Vater durch eine Krankheit, die seinen Angehörigen
zuvor bekannt ist, so haben die Familienmitglieder die Möglichkeit, sich
zu verabschieden. Ungeklärte Fragen können bereinigt und dem Ver-
storbenen in aller Ruhe die letzte Ehre erwiesen werden. Je nach
Krankheitsbild und Dauer des Krankheitsverlaufs sind die Angehörigen
57
Vgl. Hestermann, Suizid, 2006, 6ff.
58
Vgl. Klotz, Geschlecht, 1998, 7, 15.
Kapitel 3: Konfrontation mit dem Tod eines Elternteils
37
in dieser Zeit jedoch einer starken Belastung ausgesetzt, weil Mütter
neben der Pflege des erkrankten Mannes nicht selten berufstätig und
die Kinder und Jugendlichen dem Druck ausgesetzt sind, trotz der ge-
sundheitlichen Einschränkung des Vaters gute schulische Leistungen
zu erbringen.
59
Im Folgenden werden verschiedene Todesursachen und deren Bedeu-
tung für Angehörige, insbesondere für junge Familienmitglieder betrach-
tet.
3.2.1 Krankheit
In der Regel erkrankt ein Mensch nicht innerhalb weniger Stunden und
erleidet demzufolge einen plötzlichen Tod, sondern dem Sterben geht
eine längere Krankheit voraus. Es kommt nicht selten vor, dass die
Symptome erst dann erkannt werden, wenn es für Heilung und Gene-
sung zu spät ist. Anhand der Betrachtung von Krankheitsverläufen
zahlreicher Männer wurde festgestellt, dass durch traditionelle Ge-
schlechtsrollenbilder eindeutige Krankheitszeichen auch von Männern
selbst verleugnet werden und unerwähnt bleiben. Insbesondere Väter,
die für ihre Familie Sorge tragen sollen, sehen sich in unserer Gesell-
schaft immer noch angehalten, das starke Geschlecht zu verkörpern.
Wurden die Krankheitszeichen übergangen oder sind sie unerwähnt
geblieben, trifft der daraus resultierende Tod des Familienvaters seine
Angehörigen ebenso plötzlich, wie dies bei einem Unfall oder unange-
kündigten Suizid der Fall wäre. Je nach Krankheitsbild des Verstorbe-
nen können sich aufgrund psychosomatischer Störungen ähnliche
Symptome der Krankheit bei Töchtern und Söhnen bemerkbar ma-
chen.
60
Denn jeder Mensch hat seine eigene Art, mit Trauer umzuge-
59
Vgl. Leist, Tod, 2004, 159f.
60
Vgl. Tausch-Flammer/ Bickel, Sterben, 2006, 55ff.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836604505
- DOI
- 10.3239/9783836604505
- Dateigröße
- 853 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Hochschule Köln, ehem. Fachhochschule Köln – Sozialarbeit, Studiengang Sozialpädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2007 (Juli)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- weibliche jugend trauerarbeit vater bindungstheorie psychologie trauer gender verlust sozialpädagogik
- Produktsicherheit
- Diplom.de