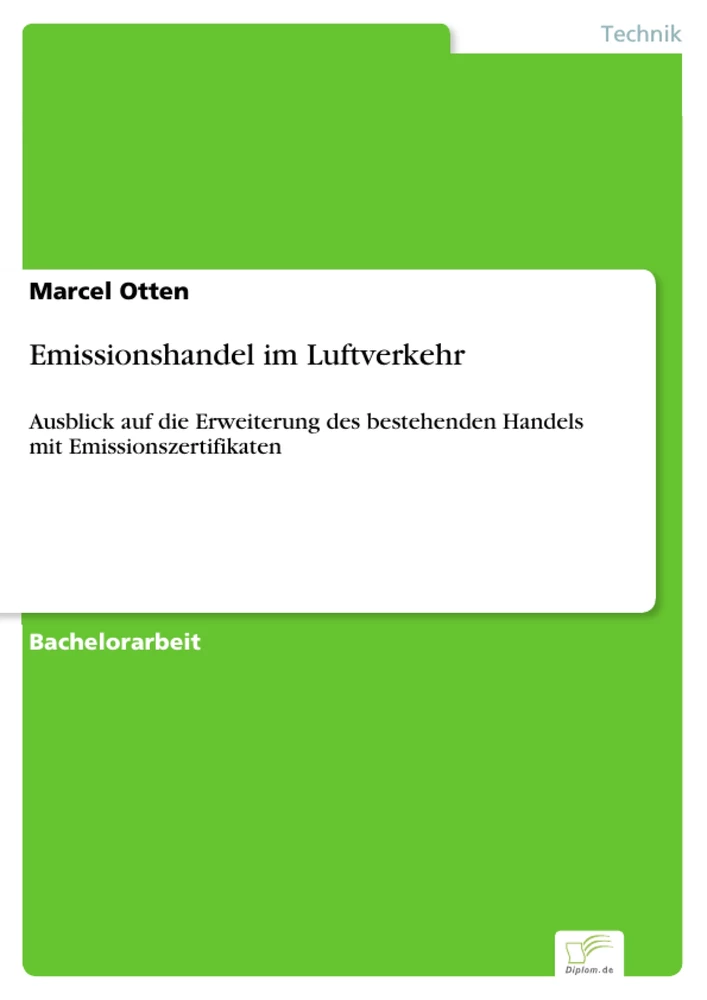Emissionshandel im Luftverkehr
Ausblick auf die Erweiterung des bestehenden Handels mit Emissionszertifikaten
©2007
Bachelorarbeit
49 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Seit 1990 ist der CO2-Ausstoß des Luftverkehrs um 87% gestiegen. Er verursacht ca. 3% der gesamten anthropogenen CO2-Emissionen. Der Anteil wird nach Schätzungen auf 5% ansteigen. Dieser Anstieg könnte die Anstrengungen anderer Industriezweige unterlaufen, den europäischen Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll nachzukommen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Luftverkehr nur in geringem Maße zur Bekämpfung des Klimawandels verpflichtet, da Emissionen aus dem Luftverkehr nicht vom Kyoto-Protokoll umfasst sind. Die Staaten haben sich zur Begrenzung von Umweltverschmutzung im Rahmen des Kyoto-Protokolls auf einen Zerfikatehandel als ein mögliches Instrument der Verringerung des CO2-Ausstoßes verständigt. Dieser gewährt den Staaten ein Verschmutzungsrecht was handelbar ist. Mithilfe dieses Handels soll die Umweltverschmutzung wenn nicht ganz abgeschafft, dann zumindest begrenzt werden.
Am 1. Januar 2005 begann für die Länder der Europäischen Union (EU) der Handel mit Emissionsrechten. Damit trat das erste multinationale Emissionshandelssystem in Kraft. Anders als im Falle des Kyoto-Protokolls sind es im europäischen Emissionshandelssystem nicht Staaten, die Reduktionsverpflichtungen erfüllen müssen, sondern energieintensive Unternehmen. Die Haupteffizienz des Systems besteht darin, dass es den Unternehmen Anreize bietet, ihre Emissionen z.B. durch Investitionen in klimafreundlichere Anlagen zu reduzieren. Eine Steigerung der Emissionen macht sich dagegen durch höhere Kosten bemerkbar.
Fraglich ist, ob ein solcher Handel auch auf den Luftverkehr übertragbar ist. Internationale Flüge sind an keine Staatsgrenzen gebunden. Emissionen werden zum Teil in Ländern freigesetzt, die nur überflogen werden. Diese und weitere spezielle Bedingungen geben dem internationalen Luftverkehr einen besonderen Status und machen es besonders schwierig, geeignete Lösungen zu finden. Die Möglichkeiten der Ausgestaltung eines Emissionshandelssystems für den Luftverkehr sind vielfältig.
Gang der Untersuchung:
Zunächst wird der Emissionshandel nach dem Kyoto-Protokoll beschrieben. Die EU hat mit der Richtlinie 2003/87/EG den rechtlichen Rahmen für den Emissionshandel in Europa geschaffen. Die Vereinbarkeit mit den Grundrechten des EG-Vertrages musste hier beachtet werden. Auf dieser Richtlinie könnte ein möglicher Emissionshandel im Luftverkehr aufbauen. Dabei bieten sich verschiedene Möglichkeiten für die Ausgestaltung eines solchen. Die zentralen […]
Seit 1990 ist der CO2-Ausstoß des Luftverkehrs um 87% gestiegen. Er verursacht ca. 3% der gesamten anthropogenen CO2-Emissionen. Der Anteil wird nach Schätzungen auf 5% ansteigen. Dieser Anstieg könnte die Anstrengungen anderer Industriezweige unterlaufen, den europäischen Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll nachzukommen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Luftverkehr nur in geringem Maße zur Bekämpfung des Klimawandels verpflichtet, da Emissionen aus dem Luftverkehr nicht vom Kyoto-Protokoll umfasst sind. Die Staaten haben sich zur Begrenzung von Umweltverschmutzung im Rahmen des Kyoto-Protokolls auf einen Zerfikatehandel als ein mögliches Instrument der Verringerung des CO2-Ausstoßes verständigt. Dieser gewährt den Staaten ein Verschmutzungsrecht was handelbar ist. Mithilfe dieses Handels soll die Umweltverschmutzung wenn nicht ganz abgeschafft, dann zumindest begrenzt werden.
Am 1. Januar 2005 begann für die Länder der Europäischen Union (EU) der Handel mit Emissionsrechten. Damit trat das erste multinationale Emissionshandelssystem in Kraft. Anders als im Falle des Kyoto-Protokolls sind es im europäischen Emissionshandelssystem nicht Staaten, die Reduktionsverpflichtungen erfüllen müssen, sondern energieintensive Unternehmen. Die Haupteffizienz des Systems besteht darin, dass es den Unternehmen Anreize bietet, ihre Emissionen z.B. durch Investitionen in klimafreundlichere Anlagen zu reduzieren. Eine Steigerung der Emissionen macht sich dagegen durch höhere Kosten bemerkbar.
Fraglich ist, ob ein solcher Handel auch auf den Luftverkehr übertragbar ist. Internationale Flüge sind an keine Staatsgrenzen gebunden. Emissionen werden zum Teil in Ländern freigesetzt, die nur überflogen werden. Diese und weitere spezielle Bedingungen geben dem internationalen Luftverkehr einen besonderen Status und machen es besonders schwierig, geeignete Lösungen zu finden. Die Möglichkeiten der Ausgestaltung eines Emissionshandelssystems für den Luftverkehr sind vielfältig.
Gang der Untersuchung:
Zunächst wird der Emissionshandel nach dem Kyoto-Protokoll beschrieben. Die EU hat mit der Richtlinie 2003/87/EG den rechtlichen Rahmen für den Emissionshandel in Europa geschaffen. Die Vereinbarkeit mit den Grundrechten des EG-Vertrages musste hier beachtet werden. Auf dieser Richtlinie könnte ein möglicher Emissionshandel im Luftverkehr aufbauen. Dabei bieten sich verschiedene Möglichkeiten für die Ausgestaltung eines solchen. Die zentralen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Marcel Otten
Emissionshandel im Luftverkehr - Ausblick auf die Erweiterung des bestehenden
Handels mit Emissionszertifikaten
ISBN: 978-3-8366-0428-4
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Universität Paderborn, Paderborn, Deutschland, Bachelorarbeit, 2007
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
Emissionshandel im Luftverkehr
i
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis... i
Abkürzungsverzeichnis ... iii
Abbildungsverzeichnis ... v
1. Einleitung ... 1
2. Darstellung von Zertifikaten ... 3
2.1. Grundlagen und Entwicklung des Emissionshandels... 3
2.2. Der Treibhauseffekt... 4
2.3. Das Kyoto-Protokoll ... 6
2.3.1. Die flexiblen Mechanismen... 6
2.3.1.1. Joint Implementation... 7
2.3.1.2. Clean Devolopment Mechanism ... 8
2.3.1.3. Emissions Trading ... 9
2.4. Die Richtlinie 2003/87/EG ... 10
2.5. Die Grundfreiheiten des EGV i.V.m der Richtlinie 2003/87/EG... 11
2.5.1. Warenverkehrsfreiheit, Art. 23 ff. EGV ... 12
2.5.2. Dienstleistungsfreiheit, Art. 49 ff. EGV ... 12
2.5.3. Niederlassungsfreiheit, Art. 43 ff. EGV ... 13
2.5.4. Kapitalverkehrsfreiheit, Art. 56 ff. EGV ... 14
2.6. Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz... 14
3. Der Emissionshandel für den Luftverkehr ... 17
3.1. Ausgestaltung eines Emissionshandelssystems... 18
3.2. Geographischer Anwendungsbereich ... 21
3.3. Verfahren der Primärverteilung ... 24
3.3.1. Grandfathering ... 25
3.3.2. Benchmarking ... 26
3.3.3. Versteigerung ... 27
3.4. Die Einbindung des Luftverkehrs in den EU-Emissionshandel ... 28
4. Auswirkungen und Schwierigkeiten... 31
4.1. Juristische Probleme... 31
4.1.1. Subsidiaritätsprinzip ... 32
4.1.2. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ... 33
4.2. Auswirkungen auf Fluggesellschaften, Flughäfen und Kunden... 34
4.3. Auswirkungen auf den Tourismus... 35
4.4. Umweltauswirkungen ... 36
Emissionshandel im Luftverkehr
ii
5. Schlussbemerkung ... 37
Literaturverzeichnis... vii
Emissionshandel im Luftverkehr
iii
Abkürzungsverzeichnis
Bafin
Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht
BIP
Bruttoinlandsprodukt
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
CAEP
Committee on Aviation Environmental Protection
CDM
Clean Development Mechanism
DÖV
Die Öffentliche Verwaltung
DVBl.
Deutsches Verwaltungsblatt
EGV
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
ETS
Emission Trading Scheme
EWR
Europäischer Wirtschaftsraum
FIR
Flight Information Region
ICAO
International Civil Aviation Organization
IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change
JI Joint
Implementation
KWG
Kreditwesengesetz
THG
Treibhausgas
UNFCCC
United Nationen Framework Convention on Climate Change
UPR
Ultra Peripheral Regions
Emissionshandel im Luftverkehr
v
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1:
Entwicklung der THG-Emissionen der EU-25 aus dem internationalen
Flugverkehr...17
Abb. 2:
Percentage of emissions included for EU-related routes under various scenarios ...23
Abb. 3:
Absolute und prozentuale Reduktionswerte ...36
Emissionshandel im Luftverkehr
1
1. Einleitung
Seit 1990 ist der CO
2
-Ausstoß des Luftverkehrs um 87% gestiegen
1
. Er verursacht
ca. 3% der gesamten anthropogenen CO
2
-Emissionen
2
. Der Anteil wird nach Schät-
zungen auf 5% ansteigen
3
. Dieser Anstieg könnte die Anstrengungen anderer Indust-
riezweige unterlaufen, den europäischen Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll
4
nachzukommen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Luftverkehr nur in geringem Maße zur
Bekämpfung des Klimawandels verpflichtet, da Emissionen aus dem Luftverkehr
nicht vom Kyoto-Protokoll umfasst sind. Die Staaten haben sich zur Begrenzung von
Umweltverschmutzung im Rahmen des Kyoto-Protokolls auf einen Zerfikatehandel
als ein mögliches Instrument der Verringerung des CO
2
-Ausstoßes verständigt.
Dieser gewährt den Staaten ein Verschmutzungsrecht was handelbar ist. Mithilfe
dieses Handels soll die Umweltverschmutzung wenn nicht ganz abgeschafft, dann
zumindest begrenzt werden.
Am 1. Januar 2005 begann für die Länder der Europäischen Union (EU) der Handel
mit Emissionsrechten. Damit trat das erste multinationale Emissionshandelssystem
in Kraft. Anders als im Falle des Kyoto-Protokolls sind es im europäischen Emissi-
onshandelssystem nicht Staaten, die Reduktionsverpflichtungen erfüllen müssen,
sondern energieintensive Unternehmen. Die Haupteffizienz des Systems besteht
darin, dass es den Unternehmen Anreize bietet, ihre Emissionen z.B. durch Investiti-
onen in klimafreundlichere Anlagen zu reduzieren. Eine Steigerung der Emissionen
macht sich dagegen durch höhere Kosten bemerkbar.
Fraglich ist, ob ein solcher Handel auch auf den Luftverkehr übertragbar ist. Interna-
tionale Flüge sind an keine Staatsgrenzen gebunden. Emissionen werden zum Teil in
Ländern freigesetzt, die nur überflogen werden. Diese und weitere spezielle Bedin-
gungen geben dem internationalen Luftverkehr einen besonderen Status und ma-
1
Vgl. EU-Kommission (2006b), S.3.
2
Vgl. Scheelhaase, J. (2006), S.481.
3
Vgl. EurActiv.com (2007).
4
Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen vom 11.
Dezember 1997.
Emissionshandel im Luftverkehr
2
chen es besonders schwierig, geeignete Lösungen zu finden. Die Möglichkeiten der
Ausgestaltung eines Emissionshandelssystems für den Luftverkehr sind vielfältig.
Zunächst wird der Emissionshandel nach dem Kyoto-Protokoll beschrieben. Die EU
hat mit der Richtlinie 2003/87/EG den rechtlichen Rahmen für den Emissionshandel
in Europa geschaffen. Die Vereinbarkeit mit den Grundrechten des EG-Vertrages
musste hier beachtet werden. Auf dieser Richtlinie könnte ein möglicher Emissions-
handel im Luftverkehr aufbauen. Dabei bieten sich verschiedene Möglichkeiten für
die Ausgestaltung eines solchen. Die zentralen Ansätze werden in Kapitel 3 näher
betrachtet und erläutert.
Die Europäische Kommission hat am 20. Dezember 2006 einen Richtlinienvorschlag
vorgelegt
5
. Somit ist eine Richtung für die Form eines Handels mit Emissionsrechten
im Luftverkehr bereits vorgegeben. Mögliche Auswirkungen auf Wirtschaft und Um-
welt, sowie juristische Aspekte werden in Kapitel 4 behandelt. Wie schon bei der
Richtlinie 2003/87/EG darf dieser Richtlinienvorschlag nicht gegen geltendes Recht
verstoßen.
Die Arbeit schließt mit einer kritischen Betrachtung des Vorhabens der EU-
Kommission. Mögliche Schwachstellen des Richtlinienvorschlags werden aufgezeigt
und eventuelle Lösungsvorschläge gegeben.
5
EU-Kommission (2006a).
Emissionshandel im Luftverkehr
3
2. Darstellung von Zertifikaten
Umweltpolitisch ist der Emissionshandel eine eher junge Erscheinung. Auch die
öffentliche Meinung hat dieses Thema erst in den letzten Jahren für sich entdeckt.
Der Durchbruch sowohl auf politischer Ebene als auch in der Öffentlichkeit gelang
1997, als die Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention auf ihrer Konferenz in
Kyoto beschlossen, den Handel mit Emissionen ausdrücklich als eine der Maßnah-
men zu nennen, mit denen die Vertragsstaaten ihrer Verpflichtung zur Reduzierung
des Treibhausgasausstoßes nachkommen können.
2.1. Grundlagen und Entwicklung des Emissionshandels
Um Unternehmen vom Umweltschutz zu überzeugen, muss ein Instrument geschaf-
fen werden, das über genügend Anreize verfügt, damit es auch akzeptiert wird.
Wenn Umweltnutzung kostenlos ist, wird sie nicht von den Unternehmen in der Kal-
kulation berücksichtigt und es kann zu einer Übernutzung kommen. Wird ein Preis für
die Nutzung der Umwelt eingeführt, so stehen den Unternehmen zwei Möglichkeiten
zur Wahl. Einerseits könnte die Produktion umweltfreundlicher gestaltet werden (zum
Beispiel durch Filteranlagen). Dadurch könnte eine Grenze zur Nutzung eingehalten
oder gar unterschritten werden.
Andererseits kann der Preis für die Nutzung entrichtet werden. Diese ökonomischen
Instrumente haben einen entscheidenden Vorteil. Für die Unternehmen ist der Anreiz
geschaffen, in bessere Umwelttechniken zu investieren um Kosten für die Umwelt-
nutzung einzusparen.
Ein Preis für die Umweltnutzung kann aber nur entstehen, wenn die Umweltnutzung
zu einem marktfähigen Gut wird. Hier sind staatliche Interventionen gefragt. Auf der
einen Seite kann der Staat den Preis unmittelbar selbst festsetzen. Auf der anderen
Seite kann der Preis auch über die Mengensteuerung ermittelt werden. Hierzu die-
nen die so genannten Zertifikatslösungen. Diese sind frei handelbar. Nach der Aus-
gabe werden sie den Marktkräften überlassen. Der Sinn hierbei ist es, dass die Um-
Emissionshandel im Luftverkehr
4
welt nur dann genutzt werden darf, wenn eine Berechtigung hierfür vorliegt. Der Preis
für diese Befugnisse bildet sich am Markt.
Warum überhaupt Umweltnutzung zu einem marktfähigen gemacht werden sollte,
erklärt sich durch die starken Klimaänderungen. Die empirischen Beobachtungen der
letzten Jahrhunderte seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zeigen einen Anstieg der
Durchschnitttemperaturen. Es ist mittlerweile die herrschende Meinung, dass der
Mensch eine gewisse Verantwortung an dieser Erwärmung trägt. Diese Erwärmung
ist die Folge des sog. Treibhauseffektes.
2.2. Der Treibhauseffekt
Der Begriff Treibhauseffekt bezeichnet ein natürliches Phänomen, das für die Er-
wärmung der Luftschicht über der Erdoberfläche verantwortlich ist. Ursprünglich
wurde der Begriff verwendet, um den Effekt eines Gewächshauses zu beschreiben.
Hierbei steigen hinter Glasscheiben die Temperaturen an, wenn die Sonne darauf
scheint. So können Pflanzen vorzeitig austreiben, blühen und fruchten. Heute wird
der Begriff weiter gefasst. Er bezeichnet den atmosphärischen Wärmestau. Aus-
gangspunkt hierfür sind die Sonnenstrahlen. Sie gelangen als kurzwellige Strahlung
durch die Atmosphäre auf die Erdoberfläche, werden dort teilweise absorbiert und in
Form von langwelliger Wärmestrahlung wieder abgegeben. Die Treibhausgase neh-
men einen Teil dieser Wärmestrahlung auf und geben ihrerseits einen Teil davon in
den erdnahen Schichten der Atmosphäre wieder ab. Nehmen solche Gase in ihren
atmosphärischen Konzentrationen zu, so wird es in den unteren Schichten der Atmo-
sphäre wärmer und aufgrund des geringeren Wärmetransports nach oben in der
Stratosphäre kälter.
Nach dem gegenwärtigen Wissensstand sind die wichtigsten Treibhausgase, die zu
einer Klimaänderung beitragen, Kohlendioxid (CO
2
), Methan (CH
4
), Distickstoffoxid
(N
2
O), Fluorkohlenwasserstoff (HFC), vollhalogenierter Kohlenwasserstoff (PFC) und
Schwefel-Hexafluorid (SF
6
). Des Weiteren sind noch die Fluorchlorkohlenwasserstof-
Emissionshandel im Luftverkehr
5
fe (CFCs) zu nennen, die bereits in das Montrealer Protokoll zum Schutz der Ozon-
schicht aufgenommen wurden
6
.
Beim natürlichen Treibhauseffekt hat der Wasserdampf (H
2
O) mit 62% einen weit
größeren Anteil als das CO
2
mit 22%
7
. Beim anthropogenen, d.h. durch menschliche
Aktivitäten verursachten Verstärkung des Treibhauseffektes, dominiert jedoch das
CO
2
deutlich mit circa 61%
8
. Dieser anthropogene Einfluss wird als wesentlicher
Hintergrund des seit Mitte des 18. Jahrhunderts zu verzeichnenden Anstiegs der
CO
2
-Konzentration in der Atmosphäre gesehen. Seit dieser Zeit wurde durch Unter-
suchungen von Eisbohrkernen und seit Mitte des 20. Jahrhunderts durch unmittelba-
re Messungen festgestellt, dass der Anteil an CO
2
in der Erdatmosphäre stetig
steigt
9
.
Ebenso wie der Anstieg des CO
2
-Anteils gilt der Anstieg der globalen mittleren Tem-
peratur seit dem Ende des 19. Jahrhunderts als sicher.
10
Jedoch ist der Ursachenzu-
sammenhang zwischen Treibhausgasemissionen und Klimaveränderungen nicht
definitiv bewiesen. Dies ist angesichts der Komplexität unseres Klimasystems und
der damit verbundenen schwierigen Analyse nicht weiter verwunderlich. Empirische
Beobachtungen wie zum Beispiel des IPCC
11
lassen aber erkennen, dass die mit
empirischen Befunden abgeglichenen Modellannahmen Klimaänderungen anzeigen,
die auf anthropogene Einflüsse zurückzuführen sind.
6
Die Europäische Gemeinschaft ist dem Protokoll von Montreal beigetreten (Entscheidung 88/540, ABl.EG
1988,Nr. L 297, S.8) und hat seit 1988 verschiedene Regelungen erlassen, um die durch das Protokoll er-
fassten Stoffe in der Gemeinschaft schrittweise zu verbieten.
7
Vgl. Sattler, A. (2004) S.5.
8
Vgl. Sattler, A. (2004) S.5.
9
Die Konzentration des CO
2
in der Atmosphäre stieg von unter 270ppm (1ppm = 1 Teil CO2 auf eine
Million Teile Luft) in der Mitte des 18.Jahrhunderts auf 370ppm im Jahr 2005. Siehe IPCC, Climate Chan-
ge 2007: The Physical Science Basis, S.3.
10
Die globale mittlere Temperatur hat sich seit dem Jahr 1900 um 0,6°C erhöht. Siehe IPCC, Climate Change
2007: The Physical Science Basis, S.11.
11
Der IPCC (Intergovernental Panel on Climate Change, deutsch: Zwischenstaatlicher Ausschuss zu Klima-
veränderungen) wurde 1988 von der WMO (Meteorologische Weltorganisation) und dem Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen (United Nations Environmental Programme, UNEP) gegründet. Seine Auf-
gabe ist es, den Wissenstand zu Klimaveränderungen in bewertenden Berichten zusammenzutragen. Die
Teilnahme an der Arbeit des IPCC steht allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen offen, siehe Ziff.4 der
Verfahrensgrundsätze des IPCC (Principles Governing IPCC Work). Allgemeine und aktuelle Informatio-
nen über den IPCC und seine Tätigkeiten sind im Internet abrufbar unter http://www.ipcc.ch.
Emissionshandel im Luftverkehr
6
2.3. Das Kyoto-Protokoll
Das Protokoll von Kyoto wurde am 11. Dezember 1997 von der 3. Konferenz der
Vertragsstaaten des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klima-
änderungen (UNFCCC) verabschiedet. Erstmals wurden für die Treibhausgasemis-
sionen der Industriestaaten Grenzwerte festgelegt. Die Annex B-Staaten
12
haben
sich in diesem Zusammenhang dazu verpflichtet die Emissionen der sechs Treib-
hausgase
13
im Zeitraum 2008 bis 2012 um 5% gegenüber dem Stand von 1990 zu
reduzieren
14
.
Die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Gemeinschaft haben das
Kyoto-Protokoll im Jahr 2002 ratifiziert. Es tritt aber erst dann in Kraft, wenn es von
mindestens 55 Ländern unterzeichnet ist, die zusammen für mindestens 55% der
Schadstoff-Emissionen im Jahr 1990 verantwortlich waren
15
. Die Zahl von mindes-
tens 55 teilnehmenden Staaten wurde mit Islands Ratifikation am 23. Mai 2002 er-
reicht. Die zweite Bedingung wurde am 5. November 2004 erfüllt, nachdem Russland
das Protokoll ratifiziert hatte. 90 Tage danach, am 16. Februar 2005, trat das Kyoto-
Protokoll in Kraft
16
. Heute haben 191 Staaten das Protokoll ratifiziert
17
. Mit dem
Inkrafttreten des Protokolls werden erstmals völkerrechtlich verbindliche Ziele zur
Begrenzung und Reduktion von Treibhausgasemissionen vorgeschrieben.
2.3.1. Die flexiblen Mechanismen
Das Kyoto-Protokoll sieht mehrere flexible Mechanismen vor, mit denen die Ver-
tragsparteien ihre Ziele erreichen können. Die Staaten, die einer Emissionsminde-
rungspflicht unterliegen, müssen diese nicht vollständig durch emissionsmindernde
Maßnahmen im eigenen Land erfüllen. Auf der Vertragsstaatenkonferenz von Marra-
12
Hierbei handelt es sich um die in Anhang B des Kyoto-Protokolls aufgelisteten Staaten.
13
Diese Treibhausgase sind in Anlage A des Kyoto-Protokolls aufgeführt. Es handelt sich um: Kohlendioxid
(CO
2
), Methan (CH
4
), Distickstoffoxid (N
2
O), Teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW/HFC),
Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW/PFC), Schwefelhexafluorid (SF
6
).
14
Art. 3 Abs. 1 Kyoto-Protokoll.
15
Art. 25 Abs. 1 Kyoto-Protokoll.
16
Art. 25 Abs. 1 Kyoto-Protokoll.
17
Vgl. UNFCCC (2007).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836604284
- DOI
- 10.3239/9783836604284
- Dateigröße
- 698 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Paderborn – Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht & Europäisches Wirtschaftsrecht
- Erscheinungsdatum
- 2007 (Juli)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- luftverkehr umweltzertifikathandel emissionshandel kyoto-protokoll luftverschmutzung richtlinie
- Produktsicherheit
- Diplom.de