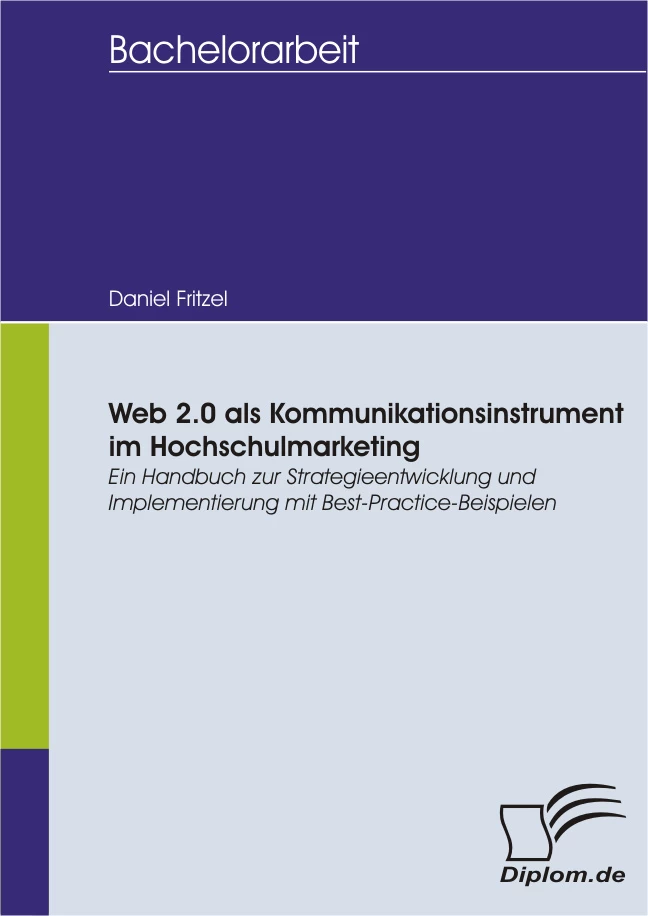Web 2.0 als Kommunikationsinstrument im Hochschulmarketing: Ein Handbuch zur Strategieentwicklung und Implementierung mit Best-Practice-Beispielen
©2012
Bachelorarbeit
101 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Szenario:
Melissa D., 19 Jahre alt, hat im Sommer 2010 ihr Abitur absolviert und zum Wintersemester 2010/2011 mit dem Bachelor-Studium Betriebswirtschaft und Kultur-, Freizeit- und Sportmanagement an der Reinhold-Würth-Hochschule begonnen. Mit dem Internet und den Web 2.0-Plattformen ist sie natürlich bestens vertraut. Schon zu Schulzeiten hat sie in Wikipedia Informationen recherchiert, die sie für ihre Referate benötigte. Über die Netzwerkplattformen Facebook und StudiVZ steht sie mit ihren Kommilitonen und alten Schulfreunden im ständigen Kontakt.
Mit der Auswahl ihres Studiengangs hat sie ein Jahr zuvor begonnen und hat hierfür auch das Internet genutzt: Neben den verschiedenen Hochschulwebseiten, die sie besucht hatte, informierte sie sich auch über das Studienportal (studieren.de) über verschiedene Studiengänge. Nach Eingabe ihrer Suchbegriffe Kultur- und Sportmanagement gelang sie dort auf das Studiengangprofil mit allen relevanten Informationen. Da Melissa sich schon zu Abiturzeiten bei StudiVZ angemeldet hatte, konnte sie dort in einer Gruppe der Reinhold-Würth-Hochschule Fragen zum Studiengang und der Stadt Künzelsau stellen. Kommilitonen höherer Semester haben ihr selbstverständlich Auskunft gegeben und den Link eines YouTube-Videos geschickt, in dem das Ausstellungsprojekt Initiation mit Timo Wuerz präsentiert wird. Sie bekam so einen Einblick in die Räumlichkeiten und Praxisnähe der Hochschule.
Vor und zu Beginn des Studiums konnte sie sich schon mit vielen Kommilitonen in Facebook vernetzen. Recht schnell entdeckte sie dort auch die Facebook-Seiten der ASTA-Künzelsau und des Campus Künzelsau. Über diese Seiten bleibt die 19-Jährige immer auf dem Laufenden, denn sie wird stets über allgemeine Informationen, Anmeldefristen und verschiedene Veranstaltungen informiert. Das gefällt ihr natürlich sehr, da sie täglich Facebook nutzt.
Relevanz des Themas:
Das Thema Hochschulmarketing wird heutzutage immer wichtiger für die deutsche Hochschullandschaft. Dies liegt neben den Etatkürzungen des Staates besonders an den Veränderungen der bildungspolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Die Hochschulen (Universitäten, Wissenschaftlichen Hochschulen, Fachhochschulen) stehen immer mehr im Wettbewerb und konkurrieren um die klügsten Studenten, die neueste Ausstattung, die meisten Drittmittel und die besten Dozenten und Professoren. Deshalb rückt auch das Marketing immer mehr in den Mittelpunkt der […]
Szenario:
Melissa D., 19 Jahre alt, hat im Sommer 2010 ihr Abitur absolviert und zum Wintersemester 2010/2011 mit dem Bachelor-Studium Betriebswirtschaft und Kultur-, Freizeit- und Sportmanagement an der Reinhold-Würth-Hochschule begonnen. Mit dem Internet und den Web 2.0-Plattformen ist sie natürlich bestens vertraut. Schon zu Schulzeiten hat sie in Wikipedia Informationen recherchiert, die sie für ihre Referate benötigte. Über die Netzwerkplattformen Facebook und StudiVZ steht sie mit ihren Kommilitonen und alten Schulfreunden im ständigen Kontakt.
Mit der Auswahl ihres Studiengangs hat sie ein Jahr zuvor begonnen und hat hierfür auch das Internet genutzt: Neben den verschiedenen Hochschulwebseiten, die sie besucht hatte, informierte sie sich auch über das Studienportal (studieren.de) über verschiedene Studiengänge. Nach Eingabe ihrer Suchbegriffe Kultur- und Sportmanagement gelang sie dort auf das Studiengangprofil mit allen relevanten Informationen. Da Melissa sich schon zu Abiturzeiten bei StudiVZ angemeldet hatte, konnte sie dort in einer Gruppe der Reinhold-Würth-Hochschule Fragen zum Studiengang und der Stadt Künzelsau stellen. Kommilitonen höherer Semester haben ihr selbstverständlich Auskunft gegeben und den Link eines YouTube-Videos geschickt, in dem das Ausstellungsprojekt Initiation mit Timo Wuerz präsentiert wird. Sie bekam so einen Einblick in die Räumlichkeiten und Praxisnähe der Hochschule.
Vor und zu Beginn des Studiums konnte sie sich schon mit vielen Kommilitonen in Facebook vernetzen. Recht schnell entdeckte sie dort auch die Facebook-Seiten der ASTA-Künzelsau und des Campus Künzelsau. Über diese Seiten bleibt die 19-Jährige immer auf dem Laufenden, denn sie wird stets über allgemeine Informationen, Anmeldefristen und verschiedene Veranstaltungen informiert. Das gefällt ihr natürlich sehr, da sie täglich Facebook nutzt.
Relevanz des Themas:
Das Thema Hochschulmarketing wird heutzutage immer wichtiger für die deutsche Hochschullandschaft. Dies liegt neben den Etatkürzungen des Staates besonders an den Veränderungen der bildungspolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Die Hochschulen (Universitäten, Wissenschaftlichen Hochschulen, Fachhochschulen) stehen immer mehr im Wettbewerb und konkurrieren um die klügsten Studenten, die neueste Ausstattung, die meisten Drittmittel und die besten Dozenten und Professoren. Deshalb rückt auch das Marketing immer mehr in den Mittelpunkt der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Daniel Fritzel
Web 2.0 als Kommunikationsinstrument im Hochschulmarketing: Ein Handbuch zur
Strategieentwicklung und Implementierung mit Best-Practice-Beispielen
ISBN: 978-3-8428-3098-1
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2012
Zugl. Künzelsau, Reinhold-Würth Hochschule Künzelsau, Künzelsau, Deutschland,
Bachelorarbeit, 2012
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2012
Inhaltsverzeichnis
I
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ... I
Abkürzungsverzeichnis ... IV
Abbildungsverzeichnis ... V
Tabellenverzeichnis ... VII
1
Einleitung ... 2
1.1
Szenario ... 2
1.2
Relevanz des Themas... 3
1.3
Zielsetzung und Vorgehensweise ... 3
2
Grundlagen und Abgrenzung ... 4
2.1
Definitionen ... 4
2.2.1
Hochschule ... 4
2.2.2
Hochschulmarketing ... 5
2.2
Veränderungen und Entwicklungen des Hochschulsystems ... 5
2.3
Zielgruppen des Hochschulmarketings ... 6
2.4
Einordnung in die Marketingwissenschaft ... 7
2.4.1
Dienstleistungsmarketing... 8
2.4.2
Non-Profit-Marketing... 9
2.4.3
Relationship-Marketing ... 9
2.4.4
Standortmarketing ... 10
2.5
Kommunikationspolitik im Hochschulmarketing ... 10
2.5.1
Ziele... 10
2.5.2
Instrumente... 12
3
Web 2.0 als Kommunikationsinstrument... 13
3.1
Definition Web 2.0 ... 13
3.2
Instrumente und Anwendungstypen ... 13
3.2.1
Netzwerkplattformen... 14
Inhaltsverzeichnis
II
3.2.2
Multimedia-Plattformen... 14
3.2.3
Weblogs, Microblogging ... 14
3.3
Zahlen und Fakten ... 15
3.4
Voraussetzungen ... 16
3.5
Chancen und Risiken ... 17
4
Strategieentwicklung und Implementierung ... 18
4.1
Analyse ... 19
4.1.1
SWOT-Analyse ... 19
4.1.2
Benchmarking... 20
4.1.3
Zielgruppen-Analyse... 21
4.1.4
Instrumente-Analyse... 25
4.2
Planung ... 27
4.2.1
Strategie- und Zielformulierung... 28
4.2.2
Web 2.0-Guidelines ... 29
4.2.3
Corporate Identity ... 31
4.2.4
Rechtliche Rahmenbedingungen... 34
4.3
Durchführung/Steuerung ... 36
4.3.1
Vernetzung ... 36
4.3.2
Marketingmaßnahmen... 37
4.3.3
Kombination von online und offline ... 40
4.4
Kontrolle ... 41
4.4.1
Monitoring ... 41
4.4.2
Statistiken und Auswertungen ... 43
5
Best-Practice-Beispiele ... 45
5.1
Ganzheitliches Konzept... 46
5.2
Hochschul-Blogs ... 49
5.3
E-Learning und Podcasts ... 52
5.4
Internationales Vorbild... 55
Inhaltsverzeichnis
III
6
Fazit... 57
6.1
Zusammenfassung... 57
6.2
Kritische Würdigung ... 59
Literaturverzeichnis ... VIII
Anhang ... XIII
Abkürzungsverzeichnis
IV
Abkürzungsverzeichnis
AStA
Allgemeiner Studierendenausschuss
App
Applikation
CD
Corporate Design
CI
Corporate Identity
ECTS
European Credit Transfer and Accumulation System
FB
Facebook
GG
Grundgesetz
HRG
Hochschulrahmengesetz
HS
Hochschule
PR
Public Relations
RSS
Really Simple Syndication
RstV
Rundfunkstaatsvertrag
TMG
Telemediengesetz
Abbildungsverzeichnis
V
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Einordnung in die Marketingwissenschaft ... 8
Abbildung 2: Instrumente der Kommunikationspolitik... 12
Abbildung 3: Nutzungszahlen und Altersgruppen im Web 2.0... 15
Abbildung 4: Anzahl der Hochschulen auf Web 2.0-Plattformen ... 16
Abbildung 5: Phasen zur Strategieentwicklung und Implementierung... 18
Abbildung 6: Aufbau der SWOT-Analyse ... 19
Abbildung 7: Bestandteile der Corporate Identity ... 31
Abbildung 8: Corporate Design der Hochschule Aalen ... 33
Abbildung 9: Web 2.0-Icons zur Verlinkung... 37
Abbildung 10: Web 2.0-Buttons zum Teilen und Verbreiten ... 37
Abbildung 11: Marketingmaßnahmen bei der Durchführung ... 38
Abbildung 12: Willkommens-Seite der Universität Potsdam... 46
Abbildung 13: Reiter "Studium" der Universität Potsdam auf Facebook ... 46
Abbildung 14: Alumni-Gruppe der Universität Potsdam auf XING... 47
Abbildung 15: Universität Potsdam auf Twitter und YouTube ... 48
Abbildung 16: Blog der Universität Passau ... 50
Abbildung 17: Blog der Universität Freiburg ... 51
Abbildung 19: "studierenzweinull" der Technischen Universität Darmstadt... 53
Abbildung 20: iTunes U-Kanal des Hasso-Plattner-Instituts... 54
Abbildung 21: Arizona State University auf Facebook... 55
Abbildungsverzeichnis
VI
Abbildung 22: Mobile-App der Arizona State University ... 56
Tabellenverzeichnis
VII
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Zielgruppen des Hochschulmarketings... 7
Tabelle 2: Chancen und Risiken des Web 2.0... 18
Tabelle 3: Web 2.0-Nutzung 2011 nach Alter... 22
Tabelle 4: Nutzugsfrequenz von Web 2.0-Angeboten ... 23
Tabelle 5: Nutzungshäufigkeit von Anwendungen... 24
Tabelle 6: Social-Media-Scorecard ... 45
Einleitung
2
1
Einleitung
1.1
Szenario
Melissa D., 19 Jahre alt, hat im Sommer 2010 ihr Abitur absolviert und zum
Wintersemester 2010/2011 mit dem Bachelor-Studium ,,Betriebswirtschaft und
Kultur-, Freizeit- und Sportmanagement" an der Reinhold-Würth-Hochschule
begonnen. Mit dem Internet und den Web 2.0-Plattformen ist sie natürlich bestens
vertraut. Schon zu Schulzeiten hat sie in Wikipedia Informationen recherchiert, die
sie für ihre Referate benötigte. Über die Netzwerkplattformen Facebook und
StudiVZ steht sie mit ihren Kommilitonen und alten Schulfreunden im ständigen
Kontakt.
Mit der Auswahl ihres Studiengangs hat sie ein Jahr zuvor begonnen und hat
hierfür auch das Internet genutzt: Neben den verschiedenen Hochschulwebseiten,
die sie besucht hatte, informierte sie sich auch über das Studienportal
(studieren.de) über verschiedene Studiengänge. Nach Eingabe ihrer Suchbegriffe
,,Kultur- und Sportmanagement" gelang sie dort auf das Studiengangprofil mit allen
relevanten Informationen. Da Melissa sich schon zu Abiturzeiten bei StudiVZ
angemeldet hatte, konnte sie dort in einer Gruppe der Reinhold-Würth-Hochschule
Fragen zum Studiengang und der Stadt Künzelsau stellen. Kommilitonen höherer
Semester haben ihr selbstverständlich Auskunft gegeben und den Link eines
YouTube-Videos geschickt, in dem das Ausstellungsprojekt ,,Initiation" mit Timo
Wuerz präsentiert wird. Sie bekam so einen Einblick in die Räumlichkeiten und
Praxisnähe der Hochschule.
Vor und zu Beginn des Studiums konnte sie sich schon mit vielen Kommilitonen in
Facebook vernetzen. Recht schnell entdeckte sie dort auch die Facebook-Seiten
der ASTA-Künzelsau und des Campus Künzelsau. Über diese Seiten bleibt die
19-Jährige immer auf dem Laufenden, denn sie wird stets über allgemeine
Informationen, Anmeldefristen und verschiedene Veranstaltungen informiert. Das
gefällt ihr natürlich sehr, da sie täglich Facebook nutzt.
Einleitung
3
1.2
Relevanz des Themas
Das Thema ,,Hochschulmarketing" wird heutzutage immer wichtiger für die
deutsche Hochschullandschaft. Dies liegt neben den Etatkürzungen des Staates
besonders an den Veränderungen der bildungspolitischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen.
Die Hochschulen
(Universitäten, Wissenschaftlichen
Hochschulen,
Fachhochschulen) stehen immer mehr im Wettbewerb und konkurrieren um die
klügsten Studenten, die neueste Ausstattung, die meisten Drittmittel und die
besten Dozenten und Professoren.
1
Deshalb rückt auch das Marketing immer
mehr in den Mittelpunkt der deutschen Hochschulen. Neben der Werbung ist auch
der Aufbau eines positiven Images besonders wichtig. ,,Es sind die zwei Welten
von Wissenschaft und Kommerz, die lange voneinander getrennt, jetzt
aufeinandertreffen mit einer Wucht, auf die kaum eine Hochschule vorbereitet
ist."
2
Besonders im Zeitalter der digitalen Medien bedienen sich auch die Hochschulen
an den Kommunikationsinstrumenten, die das Internet zu bieten hat. Schlagwörter
wie ,,Web 2.0" und ,,Social Media" sind auch in der Hochschullandschaft
angekommen und nicht mehr wegzudenken. Immer mehr Hochschulen bedienen
sich dieser Instrumente, um beispielsweise ihr Image aufzubauen, potenzielle
Studenten zu gewinnen oder gar ein Alumni-Netzwerk aufzubauen.
1.3
Zielsetzung und Vorgehensweise
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Web 2.0 als weiteren und
neuen Kommunikationskanal
im Hochschulmarketing. Zielsetzung ist die
Bereitstellung eines Handbuches, um eine erfolgreiche Strategieentwicklung und
Implementierung der Web 2.0-Tools zu ermöglichen. Darüber hinaus werden Best-
Practice-Beispiele genannt und veranschaulicht.
Das zweite Kapitel stellt die Grundlagen des Hochschulmarketings dar. Neben der
Definition und Entwicklung des Hochschulmarketings geht der Verfasser auf die
1
Vgl. WIARDA (2011)
2
Ebd.
2 Grundlagen und Abgrenzung
4
Einordnung in die Marketingwissenschaft ein und beschreibt die Aufgaben und
Instrumente der Kommunikationspolitik.
Im Dritten Kapitel wird auf die Instrumente und Verwendungsbereiche des Web
2.0 sowie auf die Chancen und Risiken eingegangen.
Besonders wichtig ist die Strategieentwicklung und Implementierung. Das Vierte
Kapitel befasst sich mit der Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle und
bildet den Hauptteil dieser Arbeit.
Um einen Überblick zu erlangen, werden im Fünften Kapitel Best-Practice-
Beispiele dargestellt und veranschaulicht. Hierbei möchte der Verfasser ein
ganzheitliches Web 2.0-Konzept vorstellen. Darüber hinaus wird auf ein Beispiel
eingegangen, wie Studenten während des Studiums in Web 2.0-Aktivitäten
integriert werden können. Anschließend soll ein Beispiel aus dem Ausland den
Unterschied zu Deutschland veranschaulichen.
2
Grundlagen und Abgrenzung
2.1
Definitionen
2.2.1 Hochschule
Unter Hochschulen versteht man alle ,,Universitäten, die Pädagogischen
Hochschulen, die Kunsthochschulen, die Fachhochschulen und sonstige
Einrichtungen des Bildungswesen, die nach Landesrecht staatliche Hochschulen
sind".
3
Zudem werden in der Literatur die Hochschulen dem Dienstleistungssektor
zugeordnet.
4
Der Verfasser beschäftigt sich ausschließlich mit den öffentlichen Hochschulen
und lässt die privaten Hochschulen außen vor. Der Begriff ,,Hochschule" wird als
Synonym für alle Universitäten und (Fach-)Hochschularten verwendet.
3
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Hochschulrahmengesetz §1 HRG (1999)
4
Vgl. WEFERS (2007), S. 47
2 Grundlagen und Abgrenzung
5
2.2.2 Hochschulmarketing
Der Begriff ,,Hochschulmarketing" lässt sich nicht pauschal zuordnen und findet in
der Literatur unterschiedliche Verwendungen. In dieser Arbeit wird der Begriff aus
Sicht der Hochschulen definiert. Denn auch Unternehmen betreiben
Hochschulmarketing, um beispielsweise Absolventen durch ihre Recruiting-
Maßnahmen zu erreichen.
Der Verfasser definiert Hochschulmarketing als eine bewusst marktorientierte
Führung der gesamten Hochschule im Zusammenhang mit einer Ausrichtung und
Koordination aller Aktivitäten auf die Bedürfnisse der relevanten Zielgruppen, um
einen Vorteil im Hochschulwettbewerb zu sichern.
5
Die Hochschulen verfügen über kein klassisches Produkt im wissenschaftlichen
Sinne, sondern tauschen immaterielle Güter auf den Märkten. Das
Leistungsangebot von Hochschulen umfasst sowohl den Absatz von Lehre und
Forschung sowie die Beschaffung von finanziellen Mitteln, Personal und
Studenten.
6
Eine genaue Zuordnung des Begriffs in die Marketingwissenschaft erfolgt in Punkt
2.5.
2.2
Veränderungen und Entwicklungen des Hochschulsystems
Aufgrund vieler Veränderungen der bildungspolitischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen im europäischen Raum stehen die Hochschulen neuen
Herausforderungen gegenüber. Ausgangspunkt war die Bologna-Reform von
1999. Diese verfolgt folgende Ziele:
x Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des europäischen
Hochschulsystems
x Einführung einheitlicher und arbeitsmarktqualifizierter Abschlüsse
5
Vgl. MEFFERT (2007), S. 6
6
Vgl. WEFERS (2007), S. 10
2 Grundlagen und Abgrenzung
6
x Förderung der Mobilität durch eine bessere Vergleichbarkeit der
Hochschulleistungen
7
Durch die Einführung der gestuften Abschlüsse in Bachelor-
und
Masterstudiengänge in allen Hochschularten wurde eine Gleichstellung von
Universitäten, Wissenschaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen geschaffen.
Auch die Einführung des ,,European Credit Transfer and Accumulation System"
(Leistungspunktesystem, kurz ECTS)
schafft eine Vergleichbarkeit der
Studieninhalte. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Akkreditierung als
Voraussetzung für die Zulassung der Bachelor- und Masterstudiengänge, wodurch
die Qualität der Studiengänge gesichert werden soll.
8
Diese neuen Rahmenbedingungen führen zu einer größeren Mobilität der
Studierenden innerhalb Europas und zu einer besseren Vergleichbarkeit der
Studiengänge an allen Hochschulen. Darüber hinaus führt dies auch zu einer
veränderten Nachfrage, da die Studierenden eine breitere Auswahlmöglichkeit an
Studiengängen haben und sich somit mehr über diese informieren.
9
Die Hochschulen stehen durch diese Entwicklungen immer mehr im nationalen
und internationalen Wettbewerb. Ein weiterer Aspekt ist die Zunahme der privaten
Hochschulen. Deshalb ist auch das Thema Hochschulmarketing aktueller und
wichtiger denn je und bewegt die Hochschulen dazu, ihre Marketingaktivitäten
voranzutreiben.
2.3
Zielgruppen des Hochschulmarketings
Zielgruppen beziehungsweise Adressaten des Hochschulmarketings sind alle
Organisationen und Personen, die in Beziehung zu Hochschulen stehen. Die
Interessen und Einflüsse sind jedoch unterschiedlich.
10
Wichtig ist der
Austauschprozess, der sowohl an die internen als auch an die externen
Zielgruppen gerichtet sein sollte. Allgemein lassen sich bezüglich des
Hochschulmarketings vier Interessengruppen bestimmen: Gruppen innerhalb der
Hochschule, Gruppen, welche die Hochschule unterstützen, Gruppen, die als
7
Vgl. VOSS (2009), S. 1
8
Vgl. ebd., S. 2
9
Vgl. VOSS(2009), S. 3
10
Vgl. ebd., S. 66
2 Grundlagen und Abgrenzung
7
Leistungsabnehmer agieren und Gruppen, die einen regulierenden Einfluss auf die
Hochschule ausüben.
11
Tabelle
1
veranschaulicht die Zielgruppen im
Hochschulmarketing.
Zielgruppen des Hochschulmarketing
x Potentielle Studierende
x Immatrikulierte Studierende
x Absolventen
x Angehörige (Eltern)
x Wirtschaft (Unternehmen)
x Förderale Institutionen (Stadt,
Bezirk, Land)
x Ausländische Partner und
Interessenten
x Förderer und Vereine
x Andere Hochschulen,
Forschungs- und
Bildungseinrichtungen
x Berufsberater/-innen
x Politiker/-innen
x Stiftungen
x Lieferanten
x Spender/-innen
x Massenmedien
x Journalisten
x Mitarbeiter/-innen
x Allgemeine Öffentlichkeit
x Ministerien
x Professoren
x Dozenten
Tabelle 1: Zielgruppen des Hochschulmarketings
12
2.4
Einordnung in die Marketingwissenschaft
In diesem Teil der Arbeit wird die Einordnung des Hochschulmarketings in die
Marketingwissenschaft im Mittelpunkt stehen. Aktuell stellt das
Hochschulmarketing noch keinen eigenständigen Ansatz im Marketing dar.
In Abbildung
1 werden
vier
relevante Marketingteilbereiche
dem
Hochschulmarketing zugeordnet und im weiteren Verlauf erläutert.
11
Vgl. WEFERS (2007) S. 54
12
Selbsterstellte Tabelle in Anlehnung: VOSS (2009), S. 67, WEFERS (2007), S. 55
2 Grundlagen und Abgrenzung
8
Marketingwissenschaft
Hoch
sch
ulmark
etin
g
Dienstleistungsmarketing
Non-Profit-Marketing
Relationship-Marketing
Standort-Marketing
Abbildung 1: Einordnung in die Marketingwissenschaft
2.4.1 Dienstleistungsmarketing
Wie in Kapitel 2.2.1 erläutert, zählen die Hochschulen zu den öffentlichen
Dienstleistern und werden somit dem Dienstleistungssektor zugeordnet. Sie ,,(..)
leisten Dienste an der Gesellschaft, die durch ihren öffentlichen Auftrag genau
definiert sind."
13
Die Hochschulen bieten eine Leistungsfähigkeit bzw. ein Leistungsversprechen in
Form einer Dienstleistung an. Dies erfolgt durch die Bereitstellung von
qualifizierten Professoren und Dozenten sowie einer guten Ausstattung. Die
Inanspruchnahme der Dienstleistung erfolgt durch den externen Faktor dem
Studierenden. Erst durch die Inanspruchnahme der Dienstleistung durch den
externen Faktor kann die Qualität der Dienstleistung ermittelt werden.
14
,,Unter Dienstleistungsmarketing werden die Analyse, Planung, Implementierung
und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten eines Dienstleistungsunternehmens [hier:
Hochschule] verstanden, die einer Ausrichtung des Leistungsprogramms [hier:
Lehre und Forschung] am Kundennutzen [hier: Wissen,
Know-How,
Studienabschluss] dienen."
15
13
WEFERS (2007), S. 47
14
Vgl. VOSS (2009), S. 31
15
BRUHN (2011)
2 Grundlagen und Abgrenzung
9
2.4.2 Non-Profit-Marketing
Die Hochschulen sind eindeutig den Non-Profit-Organisationen zuzuordnen, da sie
nicht gewinnorientiert handeln. Dies ist auch der Hauptunterschied zu Profit-
Organisationen, die eine Gewinnmaximierung anstreben.
Die Non-Profit-
Organisationen dienen oft dem Gemeinwohl der Gesellschaft und verfolgen
Sachziele, wie beispielsweise die Erfüllung eines Bildungsauftrages.
16
,,(..) [Non-Profit-Marketing] ist die Planung, Organisation, Durchführung und
Kontrolle
von Marketingstrategien und -aktivitäten nicht kommerzieller
Organisationen [hier: Hochschulen], die direkt oder indirekt auf die Lösung sozialer
Aufgaben [hier: Bildung] gerichtet sind."
17
2.4.3 Relationship-Marketing
Relationship-Marketing ist auch als Beziehungsmarketing geläufig. Hierbei geht es
um die Entwicklung und Verbesserung von Kundenbeziehungen, welche auch
langfristig bestehen sollen. Da die Hochschulen mehrere Interessensgruppen
besitzen, bezieht sich das Marketing nicht nur auf den Kunden (hier: Student),
sondern richtet sich auch an wichtige Partner (hier: Lieferanten, Unternehmen).
18
,,Aufgabe des Beziehungsmarketing ist die bewusste Steuerung und
Ausgestaltung langfristiger und zufriedenstellender Beziehungen"
19
mit den
Kunden und Partnern. Für Hochschulen bedeutet dies, dass potentielle Studenten
frühzeitig umworben, während des Studiums intensiv betreut und informiert und
nach Beendigung des Studiums durch ein Alumni-Netzwerk gehalten werden.
20
16
Vgl. WEFERS (2007), S. 45 f.
17
KOZIOL / PFÖRTSCH / HEIL / ALBRECHT (2006), S. 4
18
Vgl. WEFERS (2007), S. 52
19
WEFERS (2007), S. 52
20
Vgl.
e
bd., S. 52
2 Grundlagen und Abgrenzung
10
2.4.4 Standortmarketing
Der Standort ist der geographische Ort der Erstellung und Verwertung von
Produkten und Leistungen seitens der Hochschule.
21
Das Standortmarketing umfasst die Standortanalyse sowie Planung und
Organisation, Durchführung und Kontrolle von Strategien zur Vermarktung des
Hochschulstandortes.
22
Standortstrategien können zur Optimierung bestehender
Standorte oder zur Erschließung neuer, zusätzlicher Standorte sein.
23
2.5
Kommunikationspolitik im Hochschulmarketing
Für diese Arbeit greift der Verfasser nur die Kommunikationspolitik aus dem
Marketing-Mix auf, da sie ausschlaggebend für die Kommunikation mit den Web
2.0-Aktivitäten ist.
,,Kommunikation bedeutet die Übermittlung von Informationen und
Bedeutungsinhalten zum Zweck der Steuerung von Meinungen, Einstellungen,
Erwartungen
und Verhaltensweisen bestimmter (..) [Zielgruppen]
gemäß
spezifischer Zielsetzung."
24
Die Kommunikationspolitik befasst sich mit den Instrumenten und Maßnahmen der
externen Kommunikation (z.B. Internetauftritt der Hochschule) und der internen
Kommunikation (z.B. Info-Mail an die Studenten), um die relevanten Zielgruppen
optimal zu erreichen und zu versorgen.
25
2.5.1 Ziele
Die Kommunikationspolitik hat verschiedene Zielsetzungen und ist auch für die
Hochschulen ein wichtiger Bestandteil. Dies ergibt sich auch aus dem
Hochschulrahmengesetz (HRG), wodurch die Hochschulen verpflichtet sind, die
21
Vgl. BALDERJAHN (2000), S. 1
22
Vgl. BALDERJAHN (2000), S. 57 f.
23
Vgl. ebd., S. 21
24
Vgl. BRUHN (2009), S. 1
25
Vgl. MEFFERT, BRUHN (2009), S. 283
2 Grundlagen und Abgrenzung
11
Öffentlichkeit über ihre Aufgabenerfüllung zu informieren und ihre Leistungen
transparent zu machen.
26
Darüber hinaus verfolgen die Hochschulen weitere Kommunikationsziele, die der
Verfasser als nächstes aufzählt und erläutert.
x Information: Aufgrund der Immaterialität der Dienstleistungen muss die
Hochschule ihr Leistungsangebot bei den Zielgruppen genau definieren.
Dies erfordert ein hohes Maß an Informationsgehalt, wobei verschiedene
Kommunikationsinstrumente bei der Übermittlung der Informationen an die
relevanten Zielgruppen helfen.
x Profilierung: Wichtig ist eine Abgrenzung zu den Wettbewerbern. Hierbei
müssen sich die Leistungsangebote der Hochschule von denen der
Konkurrenz abheben. Dies erfolgt durch die Herausstellung von Vorteilen
gegenüber den Angeboten der Wettbewerber.
x Vertrauen und Image: Um die Zielgruppen zu gewinnen, bedarf es an
Vertrauen. Dieses Vertrauen kann durch hohe Qualität der Leistungen
erreicht werden. Aufgrund der Immaterialität der Dienstleistung ist es
jedoch schwer, die Qualität zu vermitteln. Hierbei spielt der Imageaufbau
eine große Rolle, denn wenn ein positives Gesamtbild einer Hochschule
dauerhaft wirkt, kann auf diesem Wege Vertrauen geschaffen werden.
x Dialog: Der Dialog sollte zu allen relevanten Zielgruppen gehalten werden.
Dadurch können Erfahrungen und Erwartungen der Zielgruppen erfragt und
das Leistungsangebot der Hochschule verbessert und optimiert werden.
Dies kann nur durch dialogfähige Kommunikationsinstrumente erreicht
werden.
x Motivation: Die Kommunikationsinstrumente sollen die relevanten
Zielgruppen dazu motivieren, die angebotenen Leistungen in Anspruch zu
nehmen. Außerdem ist die Motivation der Mitarbeiter, Professoren und
Dozenten von großer Bedeutung, um die Qualität der Dienstleistung
dauerhaft zu halten oder zu steigern.
27, 28
26
Vgl. WEFERS (2007), S. 105
27
Vgl. MEFFERT / BURMANN / KIRCHGEORG (2008), S. 634 f.
28
Vgl. MAST (2010), S. 220 ff.
2 Grundlagen und Abgrenzung
12
2.5.2 Instrumente
Es gibt in der Kommunikationspolitik viele Instrumente, die zum Einsatz kommen
können. Immer mehr Hochschulen bedienen sich neben der klassischen
Öffentlichkeitsarbeit auch an neumodischen Instrumenten. In Abbildung 2 werden
mögliche Kommunikationsinstrumente dargestellt.
Abbildung 2: Instrumente der Kommunikationspolitik
Für diese Arbeit ist besonders das Instrument der Online-Kommunikation von
Bedeutung, denn dies ist die Grundlage der Web 2.0-Aktivitäten, auf welche der
Verfasser im nächsten Kapitel eingeht.
Als Online-Kommunikation werden alle Kommunikationsmaßnahmen zwischen der
Hochschule und der relevanten Zielgruppe verstanden, die über das Internet
abgewickelt werden.
29
Instrumente bzw. Maßnahmen der Online-Kommunikation
sind beispielsweise eine Hochschul-Webseite, Online-Werbung (z.B. Banner in
Hochschulportalen), Online-Direct-Marketing (z.B. Mail-Newsletter), Online-PR
(z.B. Pressemitteilungen in Online-Zeitungen)
30
und Web 2.0-Marketing (z.B.
Ankündigungen auf einer Facebook-Seite).
29
Vgl. MEFFERT / BURMANN / KIRCHGEORG (2008), S. 662 f.
30
Vgl. BRUHN (2009), S.458
· Online-Kommunikation
· Öffentlichkeitsarbeit
· Werbung
· Direkt-Kommunikation
· Promotion
· Event-Marketing
· Messen und Ausstellungen
Instrumente
3 Web 2.0 als Kommunikationsinstrument
13
3
Web 2.0 als Kommunikationsinstrument
3.1
Definition Web 2.0
Der Ausdruck ,,Web 2.0" besitzt keine allgemeingültige Definition, dennoch ist er
heute ein feststehender Begriff. Das Web 2.0 ist durch Eigenschaften wie
neuartige Web-Applikationen, neue Geschäftsmodelle und ein neues
Nutzungsverständnis gekennzeichnet.
31
Das heutige Internet bietet im Vergleich
zum ,,Web 1.0" weitaus vielfältigere Kommunikationsformen und ist durch
Interaktionen und nutzergenerierte Inhalte geprägt. Private Nutzer stellen nicht
mehr nur Konsumenten dar, sondern beteiligen sich aktiv an der Produktion von
Inhalten. Deshalb beschreibt der Begriff im Grunde den Wandel von einem
Informationslieferanten hin zu einem interaktiven Medium.
32
Zudem ist in der
gesamten Entwicklung des Webs von seinen technikdominierten Anfängen bis
heute eindeutig eine zunehmende soziale Orientierung erkennbar.
33
Drei Viertel
(74 %) der Internetnutzer in Deutschland sind in mindestens einem sozialen
Online-Netzwerk angemeldet. Zwei Drittel nutzen diese auch aktiv.
34
Für das Marketing und Public Relations (PR) ergeben sich hieraus völlig neue
Möglichkeiten im Hinblick auf eine angestrebte Kundenorientierung und die eigene
Wettbewerbsfähigkeit. Zudem ist eine zielgruppenspezifische Ansprache auch bei
kleinem Budget durchführbar.
35
Solche Chancen gilt es mit Hilfe zielgerichteter
Webinstrumente so effizient und effektiv wie möglich zu nutzen.
3.2
Instrumente und Anwendungstypen
Mittlerweile gibt es ein großes Angebot an Web 2.0-Instrumenten. In diesem
Kapitel möchte der Verfasser eine Auswahl der populärsten Instrumente
vorstellen, welche gleichzeitig für das Hochschulmarketing geeignet sind. Dabei ist
zu beachten, dass eine strikte Trennung der verschiedenen Anwendungstypen
kaum möglich ist, da sich viele Elemente bzw. Funktionen überschneiden.
31
Vgl. SCHÖNEFELD (2009), S. 20 ff.
32
Vgl. FISCHER / HOFER (2008), S. 921
33
Vgl. SCHÖNEFELD (2009), S. 13 ff.
34
BITKOM (2012)
35
Vgl. SCOTT (2009), S. 41
3 Web 2.0 als Kommunikationsinstrument
14
3.2.1 Netzwerkplattformen
Netzwerkplattformen bzw. auch Social Network Sites dienen dem persönlichen
Austausch und der Kommunikation innerhalb eines Freundes-
und
Bekanntenkreises. Jeder Benutzer hat ein Profil, welches zur Selbstdarstellung
dient. Darüber hinaus können in diesem Profil Beziehungen zu anderen Personen
dargestellt werden, indem diese als ,,Freunde" oder ,,Kontakte" hinzugefügt
werden. Die bekanntesten Netzwerkplattformen innerhalb Deutschlands sind
Facebook, ,,Wer-kennt-wen" und die ,,VZ-Netzwerke" (SchülerVZ, StudiVZ,
meinVZ). Des Weiteren gibt es auch Plattformen, die sich auf das berufliche
Networking spezialisieren, wie beispielsweise XING und LinkedIn.
36
3.2.2 Multimedia-Plattformen
Bei den Multimedia-Plattformen stehen die multimedialen Inhalte im Vordergrund,
wie beispielsweise Videos (YouTube) und Fotos (Flickr). Für das Bereitstellen und
Abrufen von Präsentationen gibt es eine spezielle Plattform (Slideshare).
37
Auch bei diesen Plattformen ist ein Austausch bzw. Dialog durch Kommentare der
Nutzer möglich. Oftmals ist auch ein Bewertungssystem in Form einer
Bewertungsskala oder einem ,,Gefällt mir"-Button integriert. Dies verschafft einem
Nutzer einen schnellen Überblick über die Popularität der multimedialen Inhalte.
Ein großer Vorteil dieser Plattformen ist die leichte Integration der Medien (Videos
und Fotos) in die Netzwerkplattformen, wie Facebook.
3.2.3 Weblogs, Microblogging
Weblogs bzw. Blogs erleichtern das Veröffentlichen von Inhalten und legen einen
großen Bezug auf die einzelnen Autoren (,,Blogger"). Hierbei werden oft die
Elemente bzw. Beiträge der offiziellen Webseite mit einem Diskussionforum
kombiniert. Im Vordergrund der Blogs steht ein themen- und fachspezifischer
Dialog mit den Nutzern bzw. Lesern. Der Unterschied zu den Microblogging-
Diensten liegt in der Länge der Beiträge und der Kommentierfähigkeit. Der
36
Vgl. o.V. (2011), S.13
37
Vgl. ebd., S. 13
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2012
- ISBN (eBook)
- 9783842830981
- Dateigröße
- 14.8 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Heilbronn; Künzelsau – Betriebswirtschaft und Kultur-, Freizeit- und Sportmanagement
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- social media hochschulmarketing kommunikation
- Produktsicherheit
- Diplom.de