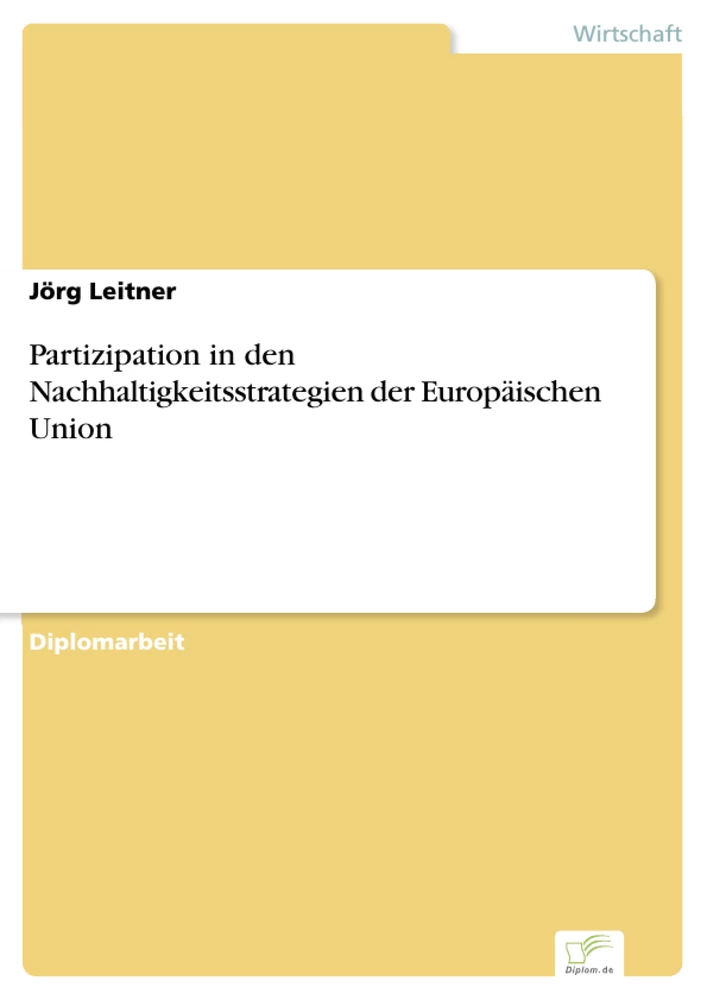Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
©2007
Diplomarbeit
108 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Anlässlich der UN Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 verpflichteten sich die Regierungen der teilnehmenden Staaten durch Verabschiedung der Agenda 21 nationale Nachhaltigkeitsstrategien zu erstellen. Dieser Verpflichtung wurde noch einmal durch die UN-Millenniums-Deklaration Nachdruck verliehen und die Staaten wurden dazu aufgefordert, nationale Strategien bis spätestens 2005 zu etablieren. Die Europäische Union fordert ihre Mitgliedsstaaten in der 2001 zum ersten Mal erstellten und 2006 überarbeiteten EU-Strategie auf, bis spätestens Juni 2007 eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie zu implementieren.
Dieser Verpflichtung, wie sie aus den vier o.g. Dokumenten erwächst, sind bis Ende 2006 24 der 25 EU-Staaten nachgekommen.
Sicherung der menschlichen Existenz, Erhaltung des gesellschaftlichen Produktivitätspotentials, Bewahrung der Entwicklungs und Handlungsmöglichkeiten, Gleichrangigkeit von inter und intragenerativer Gerechtigkeit stellen die generellen Ziele von Nachhaltiger Entwicklung dar. Die Komplexität dieser Anliegen macht deutlich, dass nur durch die gemeinsame Anstrengung möglichst vieler Menschen in allen Staaten der Erde jene grundlegenden Veränderungen auf den Weg gebracht werden können, die zur Erreichung der oben genannten Ziele notwendig sind.
Nachhaltigkeit ist also auch eine Herausforderung an die Gestaltung von Kommunikationsprozessen. Es muss nach realisierbaren Möglichkeiten gesucht werden, Menschen dazu zu motivieren, sich an der Gestaltung der Gesellschaft, in der sie leben aktiv zu beteiligen, die Strukturen ihrer Lebensbedingungen kritisch zu reflektieren, politische und sozioökonomische Machtverhältnisse zu hinterfragen und sich schließlich in mündiger und verantwortungsvoller Weise in Entscheidungsprozesse einzubringen. Partizipation ist kein Entgegenkommen der Politik oder der Verwaltung an die Bürger, Partizipation ist die selbstverständliche Folge daraus, dass sich Politik und Verwaltung an Bürgerinteressen auszurichten hat. Partizipation lediglich als Recht eines jeden Bürgers, an der Gestaltung der Gesellschaft, in der er lebt, teilnehmen zu können, reicht nicht aus. Damit Beteiligung nicht zum demokratiepolitischen Alibi verkommt und Partizipationsrhetorik sich dort breit macht, wo konstruktive Veränderungspotentiale wirksam werden könnten, müssen zum Recht auf Partizipation zwingend Wissen. Urteilsfähigkeit und Zivilcourage des Bürgers hinzukommen, die die […]
Anlässlich der UN Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 verpflichteten sich die Regierungen der teilnehmenden Staaten durch Verabschiedung der Agenda 21 nationale Nachhaltigkeitsstrategien zu erstellen. Dieser Verpflichtung wurde noch einmal durch die UN-Millenniums-Deklaration Nachdruck verliehen und die Staaten wurden dazu aufgefordert, nationale Strategien bis spätestens 2005 zu etablieren. Die Europäische Union fordert ihre Mitgliedsstaaten in der 2001 zum ersten Mal erstellten und 2006 überarbeiteten EU-Strategie auf, bis spätestens Juni 2007 eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie zu implementieren.
Dieser Verpflichtung, wie sie aus den vier o.g. Dokumenten erwächst, sind bis Ende 2006 24 der 25 EU-Staaten nachgekommen.
Sicherung der menschlichen Existenz, Erhaltung des gesellschaftlichen Produktivitätspotentials, Bewahrung der Entwicklungs und Handlungsmöglichkeiten, Gleichrangigkeit von inter und intragenerativer Gerechtigkeit stellen die generellen Ziele von Nachhaltiger Entwicklung dar. Die Komplexität dieser Anliegen macht deutlich, dass nur durch die gemeinsame Anstrengung möglichst vieler Menschen in allen Staaten der Erde jene grundlegenden Veränderungen auf den Weg gebracht werden können, die zur Erreichung der oben genannten Ziele notwendig sind.
Nachhaltigkeit ist also auch eine Herausforderung an die Gestaltung von Kommunikationsprozessen. Es muss nach realisierbaren Möglichkeiten gesucht werden, Menschen dazu zu motivieren, sich an der Gestaltung der Gesellschaft, in der sie leben aktiv zu beteiligen, die Strukturen ihrer Lebensbedingungen kritisch zu reflektieren, politische und sozioökonomische Machtverhältnisse zu hinterfragen und sich schließlich in mündiger und verantwortungsvoller Weise in Entscheidungsprozesse einzubringen. Partizipation ist kein Entgegenkommen der Politik oder der Verwaltung an die Bürger, Partizipation ist die selbstverständliche Folge daraus, dass sich Politik und Verwaltung an Bürgerinteressen auszurichten hat. Partizipation lediglich als Recht eines jeden Bürgers, an der Gestaltung der Gesellschaft, in der er lebt, teilnehmen zu können, reicht nicht aus. Damit Beteiligung nicht zum demokratiepolitischen Alibi verkommt und Partizipationsrhetorik sich dort breit macht, wo konstruktive Veränderungspotentiale wirksam werden könnten, müssen zum Recht auf Partizipation zwingend Wissen. Urteilsfähigkeit und Zivilcourage des Bürgers hinzukommen, die die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Jörg Leitner
Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
ISBN: 978-3-8366-0729-2
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Zugl. Wirtschaftsuniversität Wien, Wien, Österreich, Diplomarbeit, 2007
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
I
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort... 1
1
Einleitung... 3
1.1
Ziel der Arbeit... 4
1.2
Gliederung der Arbeit ... 4
2
Theoretische Grundlagen... 6
2.1
Nachhaltige Entwicklung ... 6
2.1.1
Etymologie der Begriffe ,,Nachhaltigkeit" bzw. ,,Nachhaltige Entwicklung"...9
2.1.2
Brundtland-Bericht ,,Our common future" 1987 ...11
2.1.3
Der Erdgipfel von Rio de Janeiro 1992 ...12
2.1.4
Der Folgeprozess nach dem Erdgipfel von Rio de Janeiro...14
2.1.5
Die Konferenz von Johannesburg 2002 (Rio + 10) ...15
2.2
Nachhaltigkeitsstrategien... 16
2.2.1
Definition Nachhaltigkeitsstrategie ...16
2.2.2
Die EU-Strategie für Nachhaltige Entwicklung 2006...18
2.2.3
Entstehungszeitpunkt der verglichenen Nachhaltigkeitsstrategien der Staaten
der Europäischen Union ...19
2.3
Partizipation... 20
2.3.1
Stufen der Partizipation ...21
2.3.2
Rechtlicher und politischer Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ...25
2.3.2.1
Aalborg Charta 1994...26
2.3.2.2
Aarhus Konvention 1998 ...26
1. Säule: Zugang zu Informationen ...27
2. Säule: Anrecht auf Teilhabe in Entscheidungsverfahren...27
3. Säule: Zugang zu Gerichten ...28
3
Analyse des Aspektes der Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der
Europäischen Union... 30
3.1
Methodik... 30
3.2
Stellenwert der Partizipation in den europäischen Nachhaltigkeitsstrategien
und deren Begründung... 34
3.2.1
Osteuropa...34
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
II
3.2.2
Südeuropa... 39
3.2.3
Mitteleuropa ... 40
3.2.4
Nordeuropa... 43
3.2.5
Westeuropa... 45
3.3
Grundvoraussetzungen für Partizipation... 51
3.3.1
Osteuropa ... 51
3.3.2
Südeuropa... 53
3.3.3
Mitteleuropa ... 54
3.3.4
Nordeuropa... 55
3.3.5
Westeuropa... 57
3.4
Wer soll partizipieren? ... 60
3.4.1
Osteuropa ... 61
3.4.2
Südeuropa... 63
3.4.3
Mitteleuropa ... 64
3.4.4
Nordeuropa... 65
3.4.5
Westeuropa... 67
3.5
Handlungsfelder für Partizipation ... 68
3.5.1
Osteuropa ... 68
3.5.2
Südeuropa... 71
3.5.3
Mitteleuropa ... 72
3.5.4
Nordeuropa... 75
3.5.5
Westeuropa... 77
4
Resümee ...82
5
Literaturverzeichnis...98
6
Abbildungsverzeichnis...104
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
1
Vorwort
Den Wunsch eine Diplomarbeit im Bereich Nachhaltige Entwicklung zu verfassen, ent-
stand infolge des Besuchs des Kompetenzfeldes Umweltmanagement an der Wirtschafts-
universität Wien.
Das eigentliche Thema ,,Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union" wurde gemeinsam mit meiner Betreuerin Frau Dipl. Ing. Ursula
Kopp entwickelt.
Frau Dipl. Ing. Ursula Kopp gilt mein besonderer Dank für die vielfältigen Anregungen
und ihre wertvolle Unterstützung, die sie mir in der Erstellungsphase der Arbeit entgegen-
brachte. Wesentlich war für mich ihre konstante, konstruktive Ermutigung, die einen
wichtigen Beitrag dazu lieferte, meine Arbeitsmotivation bis zum Abschluss der Arbeit auf
hohem Niveau beibehalten zu können.
Besonders möchte ich an dieser Stelle meinen Eltern Dr. Erich und Dipl. Psych. Irmgard
Leitner danken. Sie waren es, die mir dieses Studium und den akademischen Abschluss
ermöglicht haben. Ihnen widme ich auch diese Arbeit.
Wien, im Mai 2007 Jörg Leitner
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
3
1 Einleitung
Anlässlich der UN Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 ver-
pflichteten sich die Regierungen der teilnehmenden Staaten durch Verabschiedung der
Agenda 21 nationale Nachhaltigkeitsstrategien zu erstellen.
1
Dieser Verpflichtung wurde
noch einmal durch die UN-Millenniums-Deklaration Nachdruck verliehen und die Staaten
wurden dazu aufgefordert, nationale Strategien bis spätestens 2005 zu etablieren. Die
Europäische Union fordert ihre Mitgliedsstaaten in der 2001 zum ersten Mal erstellten und
2006 überarbeiteten EU-Strategie auf, bis spätestens Juni 2007 eine eigene Nachhaltig-
keitsstrategie zu implementieren.
Dieser Verpflichtung, wie sie aus den vier o.g. Dokumenten erwächst, sind bis Ende 2006
24 der 25 EU-Staaten nachgekommen.
Sicherung der menschlichen Existenz, Erhaltung des gesellschaftlichen Produktivitätspo-
tentials, Bewahrung der Entwicklungs und Handlungsmöglichkeiten, Gleichrangigkeit
von inter und intragenerativer Gerechtigkeit stellen die generellen Ziele von Nachhaltiger
Entwicklung dar.
2
Die Komplexität dieser Anliegen macht deutlich, dass nur durch die
gemeinsame Anstrengung möglichst vieler Menschen in allen Staaten der Erde jene grund-
legenden Veränderungen auf den Weg gebracht werden können, die zur Erreichung der
oben genannten Ziele notwendig sind.
Nachhaltigkeit ist also auch eine Herausforderung an die Gestaltung von Kommunikati-
onsprozessen. Es muss nach realisierbaren Möglichkeiten gesucht werden, Menschen dazu
zu motivieren, sich an der Gestaltung der Gesellschaft, in der sie leben aktiv zu beteiligen,
die Strukturen ihrer Lebensbedingungen kritisch zu reflektieren, politische und sozioöko-
nomische Machtverhältnisse zu hinterfragen und sich schließlich in mündiger und verant-
1
The DAC Guidelines.Strategies for Sustainable Development.Guidance for Development Cooperation
(OECD), 2001, S. 11.
2
Vgl.
www.srzg.de/ndeutsch/5publik/Nachhaltigkeitslexikon.html
[Abfrage 23.5.2007].
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
4
wortungsvoller Weise in Entscheidungsprozesse einzubringen. Partizipation ist kein Ent-
gegenkommen der Politik oder der Verwaltung an die Bürger, Partizipation ist die selbst-
verständliche Folge daraus, dass sich Politik und Verwaltung an Bürgerinteressen auszu-
richten hat.
3
Partizipation lediglich als Recht eines jeden Bürgers, an der Gestaltung der
Gesellschaft, in der er lebt, teilnehmen zu können, reicht nicht aus. Damit Beteiligung
nicht zum demokratiepolitischen Alibi verkommt und Partizipationsrhetorik sich dort breit
macht, wo konstruktive Veränderungspotentiale wirksam werden könnten, müssen zum
Recht auf Partizipation zwingend Wissen. Urteilsfähigkeit und Zivilcourage des Bürgers
hinzukommen, die die Basis für eine mündige und eigenverantwortliche Handlungskompe-
tenz darstellen. Partizipation in diesem Sinne bedeutet Demokratie tatsächlich zu leben und
nicht nur an der repräsentativen Demokratie passiv teilzuhaben.
1.1 Ziel der Arbeit
Ziel dieser Arbeit ist zu erforschen, wie Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union behandelt wird. Es soll analysiert werden, wel-
chen Stellenwert Partizipation in den jeweiligen Nachhaltigkeitsstrategien einnimmt, ob
spezifische Bevölkerungsgruppen einbezogen werden sollen, welche Handlungsfelder
gemäß den Strategien als wesentliche Partizipationsarenen gesehen werden bzw. in wel-
chen Handlungsfeldern Partizipation bereits umgesetzt wird. Parallelen und Unterschiede
werden herausgearbeitet und Erklärungshypothesen für auffallende Differenzen gebildet.
1.2 Gliederung der Arbeit
Diese Arbeit hat den Vergleich der Partizipation in 18 ausgewählten Nachhaltigkeitsstrate-
gien der EU-Mitgliedsstaaten zum Inhalt.
4
In Kapitel 2 werden zunächst die themenspezi-
fischen Grundlagen für Nachhaltige Entwicklung und Partizipation und deren rechtliche
3
Vgl.
http://www.brangsch.de/partizipation/dateien/Partizipation%20Rio%2011.pdf
[Abfrage 23.5.2007].
4
Näheres hierzu siehe Kapitel 3.1.
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
5
und politische Rahmenbedingungen anhand von einschlägiger Literatur und spezifischer
Internetquellen herausgearbeitet. In diesem Kapitel wird auch der Sinn und Zweck von
Nachhaltigkeitsstrategien unter Bezugnahme auf o.g. Quellen erörtert und die erneuerte
EU-Nachhaltigkeitsstrategie unter besonderer Berücksichtung der partizipationsspezifi-
schen Textstellen vorgestellt.
In Kapitel 3 wird die Partizipation in den jeweiligen Nachhaltigkeitsstrategien analysiert.
Für diesen Abschnitt wurde folgende Gliederung gewählt: Kapitel 3.2 fragt nach dem
Stellenwert der Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien sowie deren Begründung,
Kapitel 3.3 arbeitet die Grundlagen heraus, welche in den Nachhaltigkeitsstrategien als
Basis für erfolgreiche Teilhabe an Nachhaltiger Entwicklung gesehen werden, Kapitel 3.4
umschreibt, welche gesellschaftlichen Gruppen besonders in den Strategien als Partizipien-
ten hervorgehoben werden. Schließlich untersucht Kapitel 3.5, welche Handlungsfelder für
Partizipation eine besondere Bedeutung haben respektive wo Partizipation bereits umge-
setzt wurde. Für diese Analyse wurden die Staaten aufgrund ihrer geographischen Lage
und/oder ihres aktuellen bzw. ehemaligen politischen Systems in Gruppen zusammenge-
fasst.
5
Als Grundlage für die Analyse in Kapitel 3 diente ein Analyseraster je Staatengruppe, eine
zuvor erstellte Microsoft Excel-Tabelle, in der die in den Strategien gefundenen partizipa-
tionsrelevanten Aussagen kategorisiert wurden. Der Aufbau dieses Analyserasters orien-
tiert sich an den Forschungsfragen.
6
Im Resümee werden die partizipationsrelevanten Gemeinsamkeiten und Unterschiede
zwischen den Staaten zusammenfassend dargestellt und diese unter Bildung von Hypothe-
sen begründet.
5
Näheres hierzu siehe Kapitel 3.1.1.
6
Näheres zur Erstellung des Rasters siehe Kapitel 3.1.1.
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
6
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Nachhaltige Entwicklung
,,Sustainable development" wird im Deutschen häufig mit dauerhaft durchhaltbare, dauer-
haft aufrechterhaltbare, nachhaltig zukunftsverträgliche Entwicklung übersetzt.
7
Grunwald/Kopfmüller definieren Nachhaltige Entwicklung folgendermaßen: Diese ,,be-
zeichnet einen Prozess gesellschaftlicher Veränderung, während der Begriff Nachhaltigkeit
das Ende eines solchen Prozesses, also einen Zustand beschreibt."
8
Weit verbreitet ist heute die Definition aus dem Brundtlandbericht, die Nachhaltige Ent-
wicklung dann verwirklicht sieht, wenn diese ,,die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt,
ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen
können."
9
Diese Aussage findet sich sinngemäß auch bei anderen Autoren:
So sehen Grunwald/Kopfmüller zwei wesentliche Funktionen Nachhaltiger Entwicklung:
,,Zum einen geht es um eine eher statische Erhaltung von natürlichen und kulturellen
Ressourcen im Interesse zukünftiger Generationen. Zum anderen steht dynamisch die
nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft im Mittelpunkt, mit der Betonung auf dem
Entwicklungsgedanken zur Verbesserung der Situation vieler heute lebender Menschen."
10
In der Literatur wird Nachhaltige Entwicklung häufig als Drei-Säulen-Konzept oder als
so genanntes magisches Dreieck dargestellt. Nachhaltige Entwicklung basiert auf drei von
einander abhängigen gesellschaftlichen Dimensionen: Wirtschaft, Ökologie, Soziales.
7
Vgl. Rogall, 2004, S. 26.
8
Grunwald/Kopfmüller, 2006, S. 7.
9
Hauff, 1987. S. 46.
10
Grunwald/Kopfmüller, S. 7f.
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
7
Abbildung 1: Magisches Dreieck
Quelle:
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/agenda21/info/bildung-nachhaltig.htm
[Abfrage 13.02.2007]
Alle drei Bereiche sind in solcher Weise aufeinander bezogen, dass Entwicklungsprozesse
eines Bereiches nur gelingen können, wenn die Erfordernisse der beiden anderen Bereiche
in gleicher Weise berücksichtigt werden.
Folgendes Zitat schildert die wechselseitigen Verflechtungen aller Dimensionen und
beschreibt zugleich das zentrale Anliegen von Nachhaltigkeit:
,,Nachhaltigkeit umfasst ökonomische, soziale, kulturelle und ökologische Aspekte. Es
geht darum, Wachstumserwartungen und Umweltanliegen in den entwickelten Nationen
und die legitimen Aufholziele rund um den Globus, inklusive dem Ziel der Überwindung
der weltweiten Armut, simultan zu befriedigen. Friedenssicherung, die Durchsetzung der
Menschenrechte, Vermeidung von Furcht und Terror, die langfristige Bewahrung einer
intakten Umwelt und generell die Berücksichtigung der Interessen nachfolgender Genera-
tionen sind weitere wesentliche Erfordernisse. [...] Nachhaltigkeit bedeutet, von den
Zinsen der Systeme und der Bestände (des `Kapitals') zu leben. Aus heutiger Sicht ist die
entscheidende Frage für eine nachhaltige Entwicklung die weltweite soziale Frage, die
Frage der Co-Finanzierung von Entwicklung und der Herausforderung der weltweiten
Überwindung der Armut."
11
11
Rademacher zitiert nach
www.srzg.de/ndeutsch/5publik/Nachhaltigkeitslexikon.html
[Abfrage 30.3.2007].
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
8
Rademacher inkludiert damit auch eine 4. Dimension von Nachhaltigkeit: Die kulturelle
Dimension. ,,[...] Kultur beinhaltet die Gesamtheit der geistigen, materiellen, intellektuel-
len und emotionalen Aspekte, die eine Gesellschaft kennzeichnen. Dies schließt nicht nur
Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, Wertvorstellungen, Traditionen und
Glaubensrichtungen. [...]"
12
Im Nachhaltigkeitsbeschluss der Österreichischen Bundesre-
gierung vom 29.6.2004 ist zu lesen: ,,Nachhaltige Entwicklung bedeutet und fordert Ver-
änderungen. Gelingen kann der notwendige Wandel nur, wenn wir ihn als gesellschaftli-
ches Gesamtprojekt begreifen als eine umfassend kulturverändernde, kreative Aufga-
be."
13
Fragen nach dem Lebensstil und der Lebensqualität, nach dem Inhalt eines gelunge-
nen Lebens, nach dem eigenen Maß stellen den Kern der kulturellen Dimension der
Nachhaltigkeit dar. ,,Nachhaltigkeit braucht und produziert Kultur: als formschaffenden
Kommunikations- und Handlungsmodus, durch den Wertorientierungen entwickelt, reflek-
tiert, verändert und ökonomische, ökologische und soziale Interessen austariert werden."
14
Kunst und Kultur dienen als Motor für Veränderungsprozesse, Verschiebung des Blick-
winkels, Infragestellung alter Normen und Beziehungsmuster, aber auch als Hilfe zur
Verdeutlichung von Zusammenhängen und Hintergründen. Die Unterzeichner des ,,Tut-
zinger Manifests für die Stärkung der kulturell ästhetischen Dimension Nachhaltiger
Entwicklung" (April 2001) schlagen vor, die Kultur nicht als vierte Säule der Nachhaltig-
keit einzuführen, vielmehr als quer liegende Dimension, die in alle Gestaltungsfelder
Nachhaltiger Entwicklung verändernd eingreift. Die Beiträge aus Kunst, Kultur und Ästhe-
tik werden in dem Diskurs um Nachhaltigkeit am intensivsten vorangetrieben, wenn alle
Akteure und Akteurinnen einbezogen werden. Um diese Partizipationsbereitschaft zu
erreichen muss Nachhaltigkeit als ein sinnlich erfahrbares Leitbild kommuniziert werden,
es muss die Menschen emotional bewegen, um sie zur Mitgestaltung zu motivieren, oder
wie St. Éxupery es ausdrückte: Um Schiffe zu bauen muss erst die Sehnsucht nach dem
weiten Meer im Menschen geweckt werden.
15
12
www.umweltundmarktwirtschaft.at/index.php?option=com_content&task=view
[Abfrage 24.4.07].
13
Brodil/Holzinger/Sperka/Spielmann/Trattnigg, 2007, S. 12.
14
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/service/download/publikationen/konferenzpapiere/Ergebnispapier_
Kulturworkshop_Dezember_2001.pdf
[Abfrage 10.4.2007].
15
Vgl.
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/service/download/publikationen/konferenzpapiere/Ergebnispapier_
Kulturworkshop_Dezember_2001.pdf
[Abfrage 10.4.2007].
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
9
Dalal-Clayton/Bass nennen als wesentliche Vorraussetzungen, um dem Ziel einer Nachhal-
tigen Entwicklung näher zu kommen
16
:
· Die Etablierung eines wandlungsfähigen Systems, welches kontinuierlich verbes-
sert werden kann;
· den Wandel der Sichtweise, dass der Staat allein für die Entwicklung verantwort-
lich ist, hin zu einer Sichtweise, welche die Verantwortung der gesamten Gesell-
schaft betont;
· den Wechsel von zentralisierter, kontrollierter Entscheidungsfindung hin zu einer
Lösungsfindung, die auf transparenten Verhandlungen, Kooperation und gemein-
samen Aktionen beruht;
· die Orientierung an Ergebnissen, an Qualität von Partizipation, an Qualität von
Managementprozessen;
· den Wechsel von sektorspezifischem Planen hin zu einem gemeinsamen integrie-
renden Planen;
· die Fokussierung auf Projekte, die ohne Fremdfinanzierung auskommen, die der
Staat also aus den eigenen Mitteln finanzieren kann.
Nachdem einführend versucht wurde einen definitorischen Überblick zur Nachhaltigen
Entwicklung zu geben, wird in Folge das Thema im zeitlichen Kontext behandelt.
2.1.1 Etymologie der Begriffe ,,Nachhaltigkeit" bzw. ,,Nachhaltige Entwicklung"
Das Wort ,,nachhaltig" ist keine reine Schöpfung des 20. Jahrhunderts, sondern findet
seinen Ursprung bereits in der Epoche des späten Barocks. 1713 forderte der sächsische
Berghauptmann Hans-Carl von Carlowitz, in Anbetracht der damals vorherrschenden
Holzknappheit, in seinem Werk ,,Sylvicultura Oeconomica":
,,Wenn nicht [...] alle ersinnliche Mittel angewendet werden, dass eine Gleichheit zwischen
An- und Zuwachs und zwischen dem Abtrieb derer Hölzer erfolget, so [...] muss [...]
16
Vgl. Dalal-Clayton/Bass, 2002, S. 29.
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
10
Mangel entstehen [...] Wird derhalben die größte Kunst, Wissenschaft, Fleiss und Einrich-
tung hiesiger Lande darinnen beruhen, wie eine sothane Conservation und Anbau des
Holzes anzustellen, dass es eine continuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung
gebe; weilen es eine unentbehrlich Sache ist, ohne welche das Land in seinem Esse nicht
bleiben mag."
17
Carlowitz forderte also, dass nicht mehr Holz gefällt werde, als nachwächst.
18
,,Dieses (ressourcenökonomische) Prinzip, welches das ökonomische Ziel der maximalen
dauerhaften Nutzung des Waldes mit ökologischen Bedingungen des Nachwachsens
kombinierte, wurde ein Vorbild für spätere Nachhaltigkeitsüberlegungen. Es bedeutet von
den Erträgen einer Substanz und nicht von der Substanz selbst zu leben, also von den
Zinsen und nicht vom Kapital."
19
1972 veröffentlichte der Club of Rome den Bericht ,,Grenzen des Wachstums." Dieser
Bericht, der sich mit der Begrenztheit von Ressourcen beschäftigte, wurde in der Fachwelt
heftig kritisiert, prägte aber entscheidend das heutige Begriffsverständnis von Nachhaltig-
keit bzw. Nachhaltiger Entwicklung. Durch den Bericht konnten Denkanstösse gegeben
werden, die zu einem tieferen Verständnis für den globalen Zusammenhang zwischen
Ökonomie und Ökologie führten.
20
Die zentrale These des Berichts lautete: ,,weil die Rohstoffvorräte zur Neige gehen, muss
die industrielle Produktion schrumpfen; weil Ackerland und Wasservorräte knapp werden,
müssen die Menschen Hunger leiden. Wenn die Entwicklung so anhält `werden die
Wachstumsgrenzen im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht'."
21
Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts kam dann der Begriff ,,sustainable deve-
lopment" - Nachhaltige Entwicklung auf. Dieser wurde von der IUCN (International
Union for Conservation of Nature and Natural Resources), der heutigen World Con-
17
Carlowitz zitiert nach Weinmann, 2002, S. 1.
18
Vgl. Grunwald/Kopfmüller, 2006, S. 14.
19
Grunwald/Kopfmüller, 2006, S. 14.
20
Möller, 2003, S. 19.
21
http://www.urbaner-metabolismus.de/wachstum.html
[Abfrage 8.4.2007].
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
11
servation Union (WCU) geprägt. Zunächst wurde ,,Nachhaltige Entwicklung" aber nur in
Fachkreisen thematisiert.
22
2.1.2 Brundtland-Bericht ,,Our common future" 1987
1983 wurde von den Vereinten Nationen die Weltkommission für Umwelt und Entwick-
lung begründet.
23
Diese Kommission setzte sich aus insgesamt 22 Mitgliedern unter dem
Vorsitz der norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland zusammen. Ziel
dieser auch unter dem Namen ,,Brundtland-Kommission" bekannten Expertengruppe war
es, neben der Definition der entwicklungspolitischen Kernprobleme, Empfehlungen zu
geben, wie nachhaltiges Handeln besser realisiert werden könne.
24
Im Jahr 1987 veröffent-
lichte die Kommission den sog. Brundtland-Bericht ,,Our Common Future". Durch
diesen wurde eine Konfrontation der breiten Öffentlichkeit mit Nachhaltiger Entwicklung
ermöglicht.
25
Laut Juliane Jörissen lassen sich aus dem Brundtland-Bericht vier normative Grundannah-
men über Nachhaltigkeit ableiten:
· Nachhaltigkeit ist ein globales Konzept;
· Nachhaltigkeit ist ein integratives Konzept: Zwischen ökonomischer, ökologischer,
sozialer, institutioneller Entwicklung besteht ein enger Zusammenhang;
· Nachhaltigkeit schließt verantwortungsvolles Verhalten gegenüber der heutigen
und gegenüber künftigen Generationen ein.
26
· ,,Nachhaltigkeit ist ein anthropozentrisches Konzept: Als primäres Ziel einer Nach-
haltigen Entwicklung wird im Brundtland-Report die Befriedigung menschlicher
Bedürfnisse heute und in Zukunft betrachtet. Damit stehen menschliche Nutzungs-
22
Vgl. Rogall, 2004, S. 24.
23
Vgl. Rogall, 2004, S. 24.
24
Vgl. Sebaldt, 2003, S. 64.
25
Vgl. Grunwald/Kopfmüller, 2006, S. 20.
26
Vgl. Jörissen, 2005, S. 13f.
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
12
ansprüche an die Natur im Vordergrund. Die Bewahrung der natürlichen Umwelt
wird nicht als Ziel an sich angestrebt, sondern als Voraussetzung für eine dauerhaf-
te soziale und ökonomische Entwicklung."
27
Der Brundtland-Bericht antizipiert bereits wesentliche Aussagen der Agenda 21, die an-
lässlich des Erdgipfels von Rio 1992 verfasst wurde. Die Agenda 21 gilt heute als wesent-
liche Basis für moderne Nachhaltigkeitsstrategien.
28
2.1.3 Der Erdgipfel von Rio de Janeiro 1992
Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts fand auf Initiative der Brundtland-
Kommission die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) statt.
29
,,Die UN-Konferenz von Rio, an der im Jahre 1992 nicht weniger als 178 Staaten teilnah-
men, führte schließlich zur offiziellen Verankerung des Nachhaltigkeitsprinzips in der
politischen Agenda der Vereinten Nationen."
30
Die Rio-Konferenz gilt als zentrales Ereignis in Bezug auf die Forcierung von Nachhalti-
ger Entwicklung.
31
Obwohl die Verhandlungen durch verschiedene Interessenslagen der Staaten erschwert
wurden, die Repräsentanten der Länder der Dritten Welt wollten primär eine Verbesserung
der wirtschaftlichen Entwicklung forcieren, die Vertreter der Industriestaaten hingegen
fokussierten den ökologischen Aspekt der Nachhaltigen Entwicklung
32
, waren diese insge-
samt durch eine sehr konstruktive Verhandlungsatmosphäre heute wird vielfach vom
Geist von Rio gesprochen gekennzeichnet. So konnten im Zuge der Konferenz fünf
wesentliche Dokumente verabschiedet werden:
27
Jörissen, 2005, S. 14.
28
Vgl. Sebaldt, 2003, S. 64.
29
Vgl. Grunwald/Kopfmüller, S. 22.
30
Sebaldt, 2003, S. 66.
31
Vgl. Grunwald/Kopfmüller, 2006, S. 24.
32
Vgl. Sebaldt, 2003, S. 66.
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
13
· Rio-Deklaration für Umwelt und Entwicklung;
· Agenda 21;
· Klimarahmenkonvention;
· Biodiversitätskonvention;
· Erklärung zur Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung der Wälder.
33
Im Folgenden soll auf die Agenda 21 eingegangen werden, da diese das wesentlichste
Dokument der Rio-Konferenz ist, ,,insoweit sie es nicht nur bei der Formulierung allge-
meiner Nachhaltigkeitsprinzipien beließ, sondern in nicht weniger als 40 Einzelabschnitten
mit mehreren hundert Druckseiten einen detaillierten Aktionsplan nachhaltiger Politik für
das 21. Jahrhundert entwarf. [...] Gerade hier sind auffallende inhaltliche Parallelen zum
Brundtland-Bericht zu finden, die dessen Thematisierungs- und Mobilisierungsfunktion
einmal mehr unterstreichen."
34
Einige wichtige Themen dieses Aktionsplans sind u.a. der Kampf gegen Armut, die Ände-
rung von Konsummustern, die Verbesserung der Gesundheitsbedingungen, die Integration
von Umwelt und Entwicklung in die Entscheidungsfindung, Schutz der Atmosphäre und
Erhaltung der Artenvielfalt.
35
Die Agenda 21 enthält eine Aufforderung an die Staatsregierungen, nationale Nachhaltig-
keitsstrategien zu verabschieden. Diese Strategien sollten unter möglichst breiter Öffent-
lichkeitsbeteiligung entwickelt werden.
36
In Kapitel 28 der Agenda 21 wird auf die Bedeutung der Aktivitäten auf lokaler Ebene für
eine Nachhaltige Entwicklung hingewiesen. Um dem Ziel der Nachhaltigen Entwicklung
näher zu kommen, sollten die Kommunen in einen Dialog mit den Stakeholdern (Bürger,
NGOs, Wirtschaft) eintreten und eine Lokale Agenda 21 verabschieden.
37
33
Vgl. Grunwald/Kopfmüller, 2006, S. 24.
34
Sebaldt, 2003, S. 68.
35
Vgl.
http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf
[Abfrage 28.1.2007].
36
Vgl. Agenda 21, 1992, S. 68.
37
Vgl. Agenda 21, 1992, S. 291.
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
14
Die Agenda 21 geht eingehend auf den Aspekt der Partizipation ein. Der Präambel zum 3.
Teil ,,Stärkung der Rolle wichtiger Gruppen" ist Folgendes zu entnehmen:
,,Eine der Grundvoraussetzungen für die Herbeiführung nachhaltiger Entwicklung ist die
umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entscheidungsfindung. Darüber hinaus
hat sich im engeren Kontext der Umwelt und Entwicklung die Notwendigkeit neuer For-
men der Partizipation gezeigt. Dazu gehören die Mitwirkung von Einzelpersonen, Gruppen
und Organisationen an Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie ihre Unterrichtung und
Beteiligung an Entscheidungen, insbesondere solchen, die möglicherweise die Gemein-
schaft betreffen könnten, in der sie leben und arbeiten. Einzelpersonen, Gruppen und
Organisationen sollten Zugang zu umwelt- und entwicklungsrelevanten Informationen
haben, die sich in Händen nationaler Stellen befinden, so auch Informationen über Produk-
te und Aktivitäten, die maßgebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben oder wahr-
scheinlich haben werden, sowie Informationen über Umweltschutzmaßnahmen."
38
Ausdrücklich wird in der Agenda 21 die Teilhabe u.a. von Frauen, von Kindern und
Jugendlichen und von Nichtregierungsorganisationen gefordert.
39
Die indigenen Bevölke-
rungsgruppen sollen ebenfalls beteiligt werden. ,,Indigene Bevölkerungsgruppen und ihre
Gemeinschaften haben eine historische Beziehung zu ihrem Land und sind im allgemeinen
Nachfahren der Ureinwohner solcher Gebiete."
40
2.1.4 Der Folgeprozess nach dem Erdgipfel von Rio de Janeiro
1992 wurde die Commission for Sustainable Development (CSD) der Vereinten Natio-
nen gegründet, deren Aufgabe es ist den Nachfolgeprozess der Konferenz von Rio zu
koordinieren und zu kontrollieren.
41
38
Agenda 21, 1992, S. 276.
39
Vgl. Agenda 21, 1992, S. 276f.
40
Agenda 21, 1992, S. 285.
41
Vgl. Sebaldt, 2003, S. 70.
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
15
Außerdem fanden auf internationaler Ebene im Zeitraum ab 1992 verschiedene UN-
Konferenzen statt, die Nachhaltige Entwicklung direkt oder indirekt thematisierten.
Innerhalb der Europäischen Union fanden ebenfalls einige bedeutende Weichenstellungen
in Bezug auf Nachhaltige Entwicklung statt:
1992 verpflichtete sich die Europäische Union in ihrem fünften und sechsten Umweltak-
tionsprogramm zu einer dauerhaften und umweltgerechten Entwicklung im Sinne der
Beschlüsse der Konferenz von Rio.
1998 wurde Nachhaltige Entwicklung als Staatszielbestimmung in der Präambel des EU-
Vertrages von Amsterdam definiert.
Im Juni 2001 wurde die erste EU-Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen.
42
2.1.5 Die Konferenz von Johannesburg 2002 (Rio + 10)
Im Jahre 2002 fand, wie es anlässlich des Erdgipfels von Rio 1992 festgelegt wurde, der
zweite Erdgipfel für Nachhaltige Entwicklung statt. Im Rahmen dieser Konferenz
konnte ein Aktionsprogramm verabschiedet werden, mit dessen Hilfe die fundamentalen
Probleme der Menschheit gelöst und eine nachhaltigere Bewirtschaftung der Erde herbei-
geführt werden sollten. Beispielsweise hatte dieses Aktionsprogramm die Erhöhung des
Anteils erneuerbarer Energie am weltweiten Energiebedarf und die nachhaltige Änderung
der Produktions- und Konsummuster zum Ziel.
43
42
Vgl. Rogall, 2004, S. 24.
43
Vgl. Grunwald/Kopfmüller, 2005, S. 25.
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
16
2.2 Nachhaltigkeitsstrategien
Nachdem im vorhergehenden Abschnitt ein Überblick über das Konzept der Nachhaltigen
Entwicklung gegeben wurde, beschäftigt sich dieser Abschnitt nun mit dem eigentlichen
Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, den Nachhaltigkeitsstrategien. Dieser Abschnitt
ist dreigeteilt. Einleitend wird der Begriff ,,Nachhaltigkeitsstrategie" definiert. Darauf folgt
eine chronologische Übersicht über den Entstehungszeitpunkt der verglichenen Nachhal-
tigkeitsstrategien. Abschließend wird die erneuerte EU-Nachhaltigkeitsstrategie mit beson-
derem Fokus auf die partizipationsspezifischen Aussagen dargestellt.
2.2.1 Definition Nachhaltigkeitsstrategie
Gemäß Artikel 8 der Agenda 21 ist es Zweck einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie,
die verschiedenen Politiken und Pläne eines Landes im ökologischen, ökonomischen,
sozialen Bereich auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Bereits gewonnene Erfahrun-
gen, Umweltaktionspläne, Naturschutzstrategien sollen in die nationale Nachhaltigkeits-
strategie integriert werden.
44
Eine Strategie soll gemäß den Verfassern der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ,,die
wichtigen Trends in Wirtschaft und Gesellschaft aufzeigen und auf dieser Grundlage die
[...] notwendigen Weichenstellungen deutlich machen, das Leitbild einer nachhaltigen
Entwicklung entwerfen und Ziele festlegen.
45
Weiters soll diese ,,Grundlage sein für [...]
politische Reformen wie auch für ein verändertes Verhalten von Unternehmen und
Verbrauchern. Weit über die ökologische Herausforderung hinaus dient die Strategie als
Handlungsanleitung für eine umfassende zukunftsfähige Politik, um der Generationen
übergreifenden Verantwortung für eine ökonomisch, ökologisch und sozial tragfähige
Entwicklung gerecht zu werden.
46
44
Vgl. Agenda 21, 1992, S. 68.
45
Perspektiven für Deutschland Unsere Strategie für eine Nachhaltige Entwicklung, 2002, S. 4.
46
Perspektiven für Deutschland Unsere Strategie für eine Nachhaltige Entwicklung, 2002, S. 4.
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
17
Dalal-Clayton/Bass
47
nennen unter Bezugnahme auf eine Studie des Development As-
sistance Committee der OECD folgende Schlüsselprinzipien für Nachhaltigkeitsstrate-
gien:
· Personen stehen im Mittelpunkt;
· es besteht gesellschaftlicher Konsens über langfristige Visionen;
· die Strategie ist verantwortungsvoll und integriert soziale, ökologische und ökono-
mische Zielsetzungen;
· die Ziele der Strategie basieren auf einer ausreichenden finanziellen Basis;
· Grundlage für die Strategie ist eine verantwortungsvolle und zuverlässige Analyse;
· es existiert ein Monitoringsystem, welches die Fortschritte überwacht;
· Grundlage für die Strategien darf nicht externer Druck sein. Die Staaten müssen
selbst eine Strategie entwerfen, wenn diese dauerhaft wirken soll;
· der Staat muss die Verantwortung u.a. für die Implementierung der Strategie über-
nehmen;
· die Strategie sollte nicht ein gänzlich neues Dokument sein, sondern existierende
Pläne und Strategien in sich vereinigen;
· effektive Partizipation der Stakeholder hier wird unter anderem auch auf die Be-
deutung der Partizipation von Randgruppen hingewiesen sollte verwirklicht wer-
den;
· die strategischen Hauptprinzipien und Zielrichtungen sollten auf zentraler Ebene
bestimmt werden, die detaillierte Umsetzung sollte auf dezentraler Ebene erfolgen;
· bestehende gesellschaftliche Netzwerke sollten genutzt werden;
· um Konflikten unter Stakeholdern, welche aufgrund von Ressourcenallokation ent-
stehen können, zu begegnen und um eine Basis für ein gutes Gesprächsklima zu
schaffen, sollte ein effektives Konfliktlösungs- und Verhandlungsmanagementsys-
tem eingeführt werden.
47
Vgl. Dalal-Clayton, B./Bass, 2002, S. 33f.
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
18
2.2.2 Die EU-Strategie für Nachhaltige Entwicklung 2006
Die im Jahr 2006 verabschiedete neue EU-Strategie fordert - wie die ursprüngliche EU-
Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahre 2001 - alle EU-Staaten auf, eigene Nachhaltigkeits-
strategien zu verfassen. Die erneuerte EU-Strategie für Nachhaltige Entwicklung enthält
die Aufforderung an jene EU-Staaten, welche bis dato keine Strategie für Nachhaltige
Entwicklung verfasst haben, dies bis Ende Juni 2007 zu bewerkstelligen.
48
Für künftig zu erstellende Fassungen sollte die neue EU-Strategie für Nachhaltige Ent-
wicklung als Vorlage dienen ,,um Einheitlichkeit, Kohärenz und gegenseitige Unterstüt-
zung zu gewährleisten."
49
Als übergeordnetes Ziel der EU-Strategie wird die Schaffung und Ermittlung von Maß-
nahmen seitens der Gemeinschaft gesehen, die auf eine Verbesserung der Lebensbedin-
gungen der jetzigen und der zukünftigen Generationen abzielen.
50
Die europäische Nachhaltigkeitsstrategie gibt verschiedene Leitprinzipien für die
Politik vor. Drei von zehn Leitprinzipien befassen sich mit der Beteiligung der Stakehol-
der:
51
,,[...] OFFENE UND DEMOKRATISCHE GESELLSCHAFT
Gewährleistung, dass die Bürgerinnen und Bürger den ihnen rechtlich zustehenden Zugang
zu Information sowie Zugang zur Justiz erhalten. Bereitstellung angemessener Möglichkei-
ten der Konsultation und der Teilnahme aller interessierten Kreise und Verbände.
48
Vgl. Die erneuerte EU-Strategie für Nachhaltige Entwicklung, 2006, S. 28.
49
Die erneuerte EU-Strategie für Nachhaltige Entwicklung, 2006, S. 28.
50
Vgl. Die erneuerte EU-Strategie für Nachhaltige Entwicklung, 2006, S. 3.
51
Vgl. Die erneuerte EU-Strategie für Nachhaltige Entwicklung, 2006, S. 4f.
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
19
BETEILIGUNG DER BÜRGERINNEN UND BÜRGER
Stärkere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Entscheidungsfindung. Bessere
Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Nachhaltige Entwicklung. Informa-
tion der Bürgerinnen und Bürger über die Umweltfolgen ihres Handelns und ihre Möglich-
keiten, nachhaltiger zu handeln.
BETEILIGUNG DER UNTERNEHMEN UND SOZIALPARTNER
Intensivierung des sozialen Dialogs, Stärkung der sozialen Verantwortung der Unterneh-
men und Ausbau der öffentlich-privaten Partnerschaften, damit Zusammenarbeit und
gemeinsame Verantwortung zur Erreichung nachhaltiger Produktions- und Konsummuster
gefördert werden. [...]"
52
2.2.3 Entstehungszeitpunkt der verglichenen Nachhaltigkeitsstrategien der Staaten
der Europäischen Union
In einigen der in der vorliegenden Arbeit verglichenen Staaten der Europäischen Union
existieren Nachhaltigkeitsstrategien seit mittlerweile zehn Jahren
53
, also fünf Jahre nach-
dem die nationalen Regierungen in der Agenda 21 zur Verfassung von Nachhaltigkeitsstra-
tegien aufgefordert wurden
54
und vier Jahre bevor in der ersten EU-Nachhaltigkeits-
strategie dieselbe Forderung an die EU-Mitgliedstaaten aufgestellt wurde.
Belgien und Irland veröffentlichten 1997 ihre Nachhaltigkeitsstrategien. 1998 erschien die
finnische, 1999 die britische Nachhaltigkeitsstrategie. Im Jahre 2001 wurde die slowaki-
sche Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht. 2002 folgten Österreich, Dänemark, Frank-
reich, Deutschland, Griechenland und Lettland. 2003 wurden die niederländische und
die litauische Nachhaltigkeitsstrategie publiziert. Seit 2004 verfügen Tschechien und
Schweden über eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie. Im Jahr 2005 wurden schließlich die
estnische und die slowenische Strategie veröffentlicht. Von einigen Strategien sind bereits
52
Die erneuerte EU-Strategie für Nachhaltige Entwicklung, 2006, S. 4f.
53
Näheres hierzu siehe Kapitel 3.1.
54
Siehe Kapitel 2.1.3.
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
20
überarbeitete Fassungen erschienen: Finnland (2006), Großbritannien (2005), Irland
(2002). In Malta gibt es bis dato keine gültige Endfassung, aktuell (2006) liegt der dritte
Entwurf zur maltesischen Strategie vor.
55
2.3 Partizipation
Partizipation wird in der Brockhaus-Enzyklopädie aus dem Jahre 2006 als ,,mehr oder
minder anerkannte bzw. berechtigte Teilhabe einer Person oder Gruppe an Entscheidungs-
prozessen oder Handlungsabläufen in Organisationen und Strukturen"
56
definiert. Der
Begriff Partizipation beschränkt sich laut der Enzyklopädie ,,nicht nur auf polit. Systeme,
Wahlen oder Parteien, sondern auch auf andere Organisationsformen (z. B. Gewerkschaf-
ten, Vereine) und gesellschaftliche Teilsysteme (z. B. Management, Beteiligungsmöglich-
keiten im kommunalen Raum oder seitens bestimmter Gruppen) [...]."
57
Über Bedeutung und Zweck von Partizipation bestehen unterschiedliche Auffassungen.
Einerseits besteht die Überzeugung, Partizipation verbessere die öffentliche Akzeptanz und
erleichtere die Implementierung von Entscheidungen, andererseits wird Partizipation als
Vehikel gesehen, um die Entscheidungsfindung transparenter, demokratischer und qualita-
tiv höherwertig zu gestalten. Die Vorstellungen von der Implikation der Partizipation
reichen allgemein von öffentlicher Information über Konsultation bis hin zur aktiven
Einbindung in die Entscheidungsfindung.
58
Im Folgenden werden Stufenmodelle der Partizipation vorgestellt und die politischen und
rechtlichen Rahmenbedingungen für Partizipation beschrieben.
55
Näheres hierzu vgl.
http://www.esdn.eu/?k=country%20profiles&s=basic%20information
[Abfrage 27.2.2007].
56
Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 21, 2006, S. 65.
57
Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 21, 2006, S. 65.
58
Mostert, 2005, S. 164.
Jörg Leitner: Partizipation in den Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union
21
2.3.1 Stufen der Partizipation
1969 publizierte Sherry Arnstein im ,,Journal of the American Institut of Planners" die
sogenannte "ladder of participation". Dieses Stufenmodell gilt heute als Standard für die
Definition von Partizipation.
59
Abbildung 2: ladder of participation
Quelle:
http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.pdf
[Abfrage: 4.4.2007]
59
Vgl.
http://www.blk-
demokratie.de/fileadmin/public/dokumente/Bausteine/bausteine_komplett/partizipation_baustein.pdf
[Ab-
frage 15.2.2007].
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836607292
- DOI
- 10.3239/9783836607292
- Dateigröße
- 689 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Wirtschaftsuniversität Wien – Betriebswirtschaft, Nachhaltige Entwicklung
- Erscheinungsdatum
- 2007 (Dezember)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- europäische union umweltpolitik nachhaltige entwicklung partizipation nachhaltigkeitsstrategie bürgerbeteiligung europapolitik
- Produktsicherheit
- Diplom.de