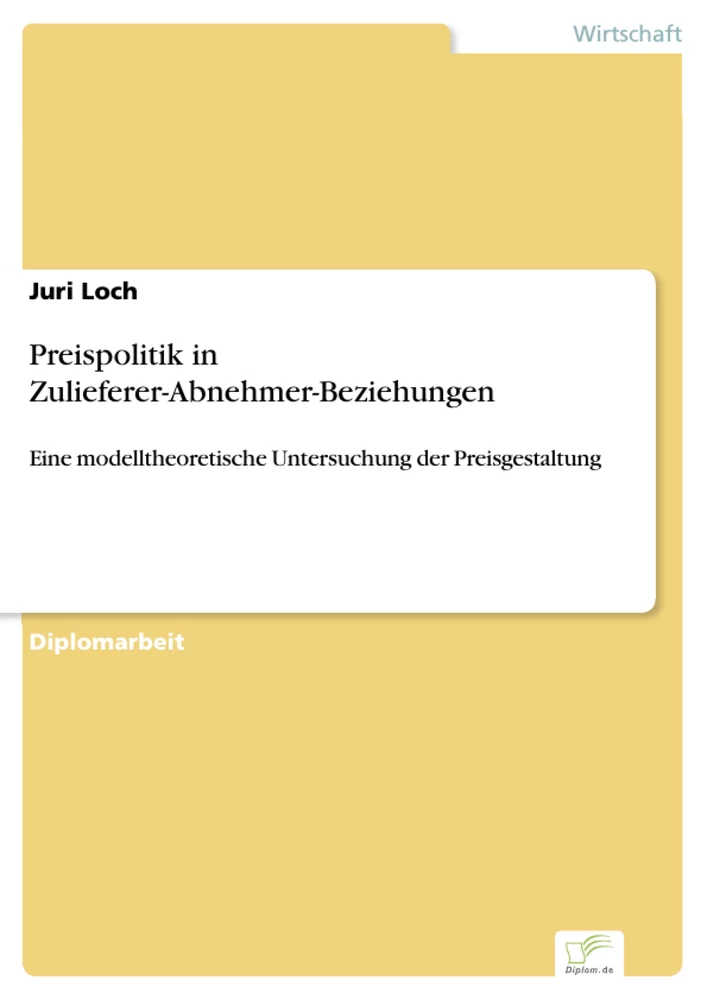Preispolitik in Zulieferer-Abnehmer-Beziehungen
Eine modelltheoretische Untersuchung der Preisgestaltung
©2006
Diplomarbeit
63 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Angesichts des immer mehr steigenden Druckes auf die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsbeziehungen wird die Koordination von Teilnehmern einer Supply Chain auf aufeinander folgenden Stufen immer wichtiger. Praktisch kein Unternehmen ist in der Lage, allein die Produktion, die Distribution und den Vertrieb eines Produktes zu bewältigen. Dies wird noch deutlicher durch die zunehmende Konzentration von Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen. Die Beziehungen zwischen Zulieferern und Abnehmern innerhalb einer Supply Chain gewinnen daher immer mehr an Bedeutung. Die Preisgestaltung in einer Zulieferer-Abnehmer-Beziehung spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Profitoptimierung der gesamten Supply Chain, die sich auch auf die Gewinne der Teilnehmer auswirkt.
Es gibt mehrere Wege, die Geschäftpartner dazu zu bringen, sich gesamtoptimal zu verhalten. Eine Möglichkeit der Durchsetzung und Sicherung eines bestimmten Verhaltens besteht darin, einen Geschäftspartner durch Vorgabe von bestimmten Bedingungen zu animieren, seine Entscheidungen an den Zielen der gesamten Supply Chain auszurichten, Wenn die Entscheidung für eine bestimmte Größe der tatsächlichen Optimierung des Gewinns des jeweiligen Partners entspricht, wird eine solche Lösung die stabilste sein. Eine Durchsetzung der Werte und eines bestimmten Verhaltens wird damit obsolet.
Die vorliegende Arbeit versucht, anhand von einigen ausgewählten Arbeiten über die Preisgestaltung, die in den vorliegenden modelltheoretischen Untersuchungen angewandten Herangehensweisen aufzuzeigen. Hierbei liegt die Aufmerksamkeit ausschließlich auf den Aspekten der tatsächlichen Preisgestaltung. Die anderen Möglichkeiten der Koordination von Abnehmern, wie Quantity Forcing, Rücknahme- und Mengenvereinbarungen oder Ähnliches, bleiben außer Betracht.
Gang der Untersuchung:
Die Arbeit besteht hauptsächlich aus der Beschreibung von unterschiedlichen Modellen, die eine Analyse der Preispolitik beinhalten. Es handelt sich um Modelle, die jeweils zwei aufeinander folgende Stufen einer Supply Chain beschreiben. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um die Beziehung zwischen Groß- und Einzelhändler, Rohstofflieferant und Produzent, Hersteller von Zwischenprodukten und Fertigprodukten oder Ähnliches handelt.
Alle diese Beziehungen basieren darauf, dass der sich auf der höheren Wertschöpfungsstufe befindliche Kontraktpartner ein Gut herstellt oder erwirbt und dieses an den Partner auf der nächsten […]
Angesichts des immer mehr steigenden Druckes auf die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsbeziehungen wird die Koordination von Teilnehmern einer Supply Chain auf aufeinander folgenden Stufen immer wichtiger. Praktisch kein Unternehmen ist in der Lage, allein die Produktion, die Distribution und den Vertrieb eines Produktes zu bewältigen. Dies wird noch deutlicher durch die zunehmende Konzentration von Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen. Die Beziehungen zwischen Zulieferern und Abnehmern innerhalb einer Supply Chain gewinnen daher immer mehr an Bedeutung. Die Preisgestaltung in einer Zulieferer-Abnehmer-Beziehung spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Profitoptimierung der gesamten Supply Chain, die sich auch auf die Gewinne der Teilnehmer auswirkt.
Es gibt mehrere Wege, die Geschäftpartner dazu zu bringen, sich gesamtoptimal zu verhalten. Eine Möglichkeit der Durchsetzung und Sicherung eines bestimmten Verhaltens besteht darin, einen Geschäftspartner durch Vorgabe von bestimmten Bedingungen zu animieren, seine Entscheidungen an den Zielen der gesamten Supply Chain auszurichten, Wenn die Entscheidung für eine bestimmte Größe der tatsächlichen Optimierung des Gewinns des jeweiligen Partners entspricht, wird eine solche Lösung die stabilste sein. Eine Durchsetzung der Werte und eines bestimmten Verhaltens wird damit obsolet.
Die vorliegende Arbeit versucht, anhand von einigen ausgewählten Arbeiten über die Preisgestaltung, die in den vorliegenden modelltheoretischen Untersuchungen angewandten Herangehensweisen aufzuzeigen. Hierbei liegt die Aufmerksamkeit ausschließlich auf den Aspekten der tatsächlichen Preisgestaltung. Die anderen Möglichkeiten der Koordination von Abnehmern, wie Quantity Forcing, Rücknahme- und Mengenvereinbarungen oder Ähnliches, bleiben außer Betracht.
Gang der Untersuchung:
Die Arbeit besteht hauptsächlich aus der Beschreibung von unterschiedlichen Modellen, die eine Analyse der Preispolitik beinhalten. Es handelt sich um Modelle, die jeweils zwei aufeinander folgende Stufen einer Supply Chain beschreiben. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um die Beziehung zwischen Groß- und Einzelhändler, Rohstofflieferant und Produzent, Hersteller von Zwischenprodukten und Fertigprodukten oder Ähnliches handelt.
Alle diese Beziehungen basieren darauf, dass der sich auf der höheren Wertschöpfungsstufe befindliche Kontraktpartner ein Gut herstellt oder erwirbt und dieses an den Partner auf der nächsten […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Juri Loch
Preispolitik in Zulieferer-Abnehmer-Beziehungen
Eine modelltheoretische Untersuchung der Preisgestaltung
ISBN: 978-3-8366-0259-4
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. FernUniversität Hagen, Hagen, Deutschland, Diplomarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS...I
ABBILDUNGSVERZEICHNIS ... IV
1.
EINLEITUNG ...1
1.1
Problemdarstellung... 1
1.2
Aufbau der Arbeit ... 2
2
DETERMINISTISCHE NACHFRAGE ...6
2.1
Ursachen der Suboptimalität ... 6
2.1.1
Double Marginalization: Spengler (1950)... 6
2.1.2
Suboptimalität der Bestellmenge... 9
2.2
Zweistufiges Monopol: Chan Choi (2003)... 9
2.2.1
Mengenrabatte und Channel Efficiency ... 10
2.2.2
Mengenrabatte und Transaction Efficiency... 13
2.2.3
Preisgestaltung als Mittel zur ganzheitlichen Koordination ... 19
2.3
Mehrere homogene Abnehmer: Weng (1995)... 25
2.4
Mehrere heterogene Abnehmer: Chen/Federgruen/Zheng (2001) ... 29
2.5
Koordination mit Zwischenpartner: Chan Choi et al. (2004) ... 34
2.6
Informationsasymmetrie bezüglich der Kostenstruktur: Arbeit von Corbett und Tang (1999)... 37
2.6.1
Modellbeschreibung ... 38
2.6.2
Einteiliger linearer Kontrakt mit asymmetrischer Information ... 39
2.6.3
Zweiteiliger Kontrakt mit asymmetrischer Information ... 39
2.6.4
Kontraktmenü bei asymmetrischer Information ... 40
2.7
Wirksamkeit verschiedener Tarifarten: Kolay et al. (2003)... 42
3
STOCHASTISCHE NACHFRAGE...46
3.1
Verkaufen an einen Zeitungsjungen: Lariviere (1999) ... 47
3.2
Verkaufen wie ein Zeitungsjunge: Cachon (2004) ... 49
3.3
Informationsasymmetrie bezüglich der Endnachfrage: Burnetas, Gilbert, Smith (2005)... 51
4
SCHLUSSWORT ...54
III
ANHANG...I
Literaturverzeichnis ...I
IV
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1.1: Übersicht der verwendeten Modelle... 5
Abbildung 2: Machbare Region und pareto-optimale Gerade, aus: C
HAN
C
HOI
(2003) ... 17
Abbildung 3: Tarife auf der Basis eines All-Unit-Discounts, aus: C
HAN
C
HOI
(2003)... 18
Abbildung 4: Lösungen ohne und mit Koordination und Mengenrabatt, aus: C
HAN
C
HOI
(2003) ... 21
Abbildung 5: Gängigste Arten von Tarifen. ... 26
Abbildung 6: zweiteiliger Tarif und Incremental Quantity Discount, aus: Kolay et
al. (2003)... 43
Abbildung 7: Rabattgrenzen bei der Anwendung eines All-Unit-Discounts, aus:
Kolay et al. (2003) ... 44
1. Einleitung
1.1 Problemdarstellung
Angesichts des immer mehr steigenden Druckes auf die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsbe-
ziehungen wird die Koordination von Teilnehmern einer Supply Chain auf aufeinander fol-
genden Stufen immer wichtiger. Praktisch kein Unternehmen ist in der Lage, allein die Pro-
duktion, die Distribution und den Vertrieb eines Produktes zu bewältigen. Dies wird noch
deutlicher durch die zunehmende Konzentration von Unternehmen auf ihre Kernkompeten-
zen. Die Beziehungen zwischen Zulieferern und Abnehmern innerhalb einer Supply Chain
gewinnen daher immer mehr an Bedeutung. Die Preisgestaltung in einer Zulieferer-
Abnehmer-Beziehung spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Profitoptimierung der gesamten
Supply Chain, die sich auch auf die Gewinne der Teilnehmer auswirkt. Es gibt mehrere Wege,
die Geschäftpartner dazu zu bringen, sich gesamtoptimal zu verhalten. Eine Möglichkeit der
Durchsetzung und Sicherung eines bestimmten Verhaltens besteht darin, einen Geschäfts-
partner durch Vorgabe von bestimmten Bedingungen zu animieren, seine Entscheidungen an
den Zielen der gesamten Supply Chain auszurichten, Wenn die Entscheidung für eine be-
stimmte Größe der tatsächlichen Optimierung des Gewinns des jeweiligen Partners entspricht,
wird eine solche Lösung die stabilste sein. Eine Durchsetzung der Werte und eines bestimm-
ten Verhaltens wird damit obsolet. Die vorliegende Arbeit versucht, anhand von einigen aus-
gewählten Arbeiten über die Preisgestaltung, die in den vorliegenden modelltheoretischen
Untersuchungen angewandten Herangehensweisen aufzuzeigen. Hierbei liegt die Aufmerk-
samkeit ausschließlich auf den Aspekten der tatsächlichen Preisgestaltung. Die anderen Mög-
lichkeiten der Koordination von Abnehmern, wie Quantity Forcing, Rücknahme- und Men-
genvereinbarungen oder Ähnliches, bleiben außer Betracht.
Einleitung
2
1.2 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit besteht hauptsächlich aus der Beschreibung von unterschiedlichen Modellen, die
eine Analyse der Preispolitik beinhalten. Es handelt sich um Modelle, die jeweils zwei aufein-
ander folgende Stufen einer Supply Chain beschreiben. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich
um die Beziehung zwischen Groß- und Einzelhändler, Rohstofflieferant und Produzent, Her-
steller von Zwischenprodukten und Fertigprodukten oder Ähnliches handelt. Alle diese Be-
ziehungen basieren darauf, dass der sich auf der höheren Wertschöpfungsstufe befindliche
Kontraktpartner ein Gut herstellt oder erwirbt und dieses an den Partner auf der nächsten
Wertschöpfungsstufe veräußert. Dieser steht seinerseits einer Nachfrage der nächsten Stufe
oder im Falle des Einzelhändlers der Konsumenten gegenüber. Er verwendet das Gut entwe-
der als Bestandteil der von ihm hergestellten Güter, oder verkauft es ohne Veränderung wei-
ter. Bei einer Aufteilung in Profitcenter innerhalb derselben Unternehmung können ähnliche
Untersuchungen im Hinblick auf die Optimierung des Unternehmensgewinns mittels der Ges-
taltung von Verrechnungspreisen angewendet werden. Unabhängig von dem Niveau der Ge-
schäftsbeziehung innerhalb der Supply Chain wird im folgenden Verlauf von einer Zulieferer-
Abnehmer-Beziehung gesprochen. Der vom Abnehmer an den Zulieferer zu zahlende Preis
für den Bezug des Gutes wird als Großhandelspreis und der Preis, den der Abnehmer von
seinen Käufern erhält, als Einzelhandelspreis bezeichnet.
Die wichtigste Ursache der Suboptimalität der Geschäftsbeziehungen zwischen zwei aufein-
ander folgenden Wertschöpfungsstufen ist die Double Marginalization (oder Doppelte Ge-
winnabschöpfung die Begriffe entsprechen einander und werden im weiteren Verlauf
gleichbedeutend gebraucht). Sie hat ihre Ursache darin, dass jeder Kontraktteilnehmer seine
eigenen Ziele verfolgt, ohne auf die Optimierung über die gesamte Kette zu achten. Die Be-
schreibung dieses Phänomens beinhaltet noch keine Angaben über die Preispolitik als solche.
Eine Darstellung erscheint trotzdem notwendig, da sie dem Verständnis des Problemfeldes
dienlich ist. Aus diesem Grunde wurde im Abschnitt 2.1 eine Abhandlung über dieses Thema
aufgenommen.
Die gewählten Modelle werden in einer Reihenfolge dargestellt, die dem steigenden Kompli-
kationsgrad entspricht. Hierbei wird zunächst eine Unterteilung nach der Art der Nachfrage
gemacht, mit der der Abnehmer konfrontiert wird. Die Abbildung 1 veranschaulicht die Rei-
henfolge und die Besonderheiten der dargestellten Arbeiten. Die Arbeit soll nicht als Ersatz
für die Lektüre der genutzten Arbeiten dienen, sondern einen Einblick in die vorhandenen
modelltheoretischen Herangehensweisen bieten. Aus diesem Grunde wurden aus den vorge-
Einleitung
3
stellten Arbeiten nur die mit der Preispolitik im Zusammenhang stehenden Bestandteile er-
wähnt.
Die im Abschnitt 2 vorgestellten Modelle basieren auf der Annahme einer deterministischen
Nachfrage. Die meisten vorliegenden modelltheoretischen Untersuchungen von Zulieferer-
Abnehmer-Beziehungen basieren auf einer solchen Annahme. Sie macht die Modelle zwar
leichter kalkulierbar, jedoch leidet darunter die Realitätsnähe. Am Anfang dieses Abschnitts
wurde die Darstellung der Double Marginalization aufgenommen. Der Abschnitt fährt fort mit
einer Arbeit von C
HAN
C
HOI
1
, die in einer sehr anschaulichen Weise die Modellierung sowie
die Vorgehensweise bei der Koordination der Supply Chain mittels der Preisgestaltung zeigt.
Hierbei wird auf zwei Arten von Koordination eingegangen: die Beeinflussung der gesamten
periodischen Abnahmemenge und der innerperiodischen Bestellmenge durch verschiedene
Arten von Tarifen. Die eher einfache Konstellation mit einem Zulieferer und einem Abneh-
mer wird im Abschnitt 2.3 durch ein Modell von W
ENG
2
ersetzt, welches die Koordination
von mehreren homogenen Abnehmern berücksichtigt. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass eine
wirksame Koordination der Supply Chain nur durch die Anwendung von verschiedenen Ra-
battformen in Verbindung mit einer fixen Zahlung erreicht werden kann. Im Abschnitt 2.4
wird eine Arbeit von C
HEN
,
F
EDERGRUEN UND
Z
HENG
3
behandelt, in der ein Modell entwi-
ckelt wird, mit welchem die Beziehungen zwischen einem Zulieferer und mehreren heteroge-
nen Abnehmern erfasst werden können. In diesem Modell wird eine Art Rabatt eingeführt, die
auf komplexeren Kriterien basiert, als nur die Abnahme- oder Bestellmenge. Die Realitätsnä-
he der Modelle wird im Abschnitt 2.5 durch die Behandlung einer Arbeit von C
HAN
C
HOI
,
L
EI
L
EI UND
Q
IANG
W
ANG
4
intensiviert, indem ein für die Logistik zuständiger Zwischenpartner
eingeführt wird. In dem darauf folgenden Abschnitt 2.6 werden Teile einer Arbeit von C
OR-
BETT UND
T
ANG
5
präsentiert. Diese Arbeit vergleicht die Zustände symmetrischer Informati-
onsverteilung mit solchen, in denen der Zulieferer keine genaue Kenntnis über die Kosten-
struktur des Abnehmers besitzt. Die Wirksamkeit der gängigsten Tarifarten wird im Abschnitt
2.7 anhand einer Arbeit von K
OLAY
,
S
CHAFFER UND
O
RDOVER
6
festgestellt beziehungsweise
verglichen.
1
Vgl. Chan Choi (2003)
2
Vgl. Weng (1995).
3
Vgl. Chen/Federgruen/Zheng (2001).
4
Vgl Chan Choi/Lei Lei/Qiang Wang (2004).
5
Vgl. Corbett/Tang (1999).
6
Vgl. Kolay/Schaffer/Ordover (2004).
Einleitung
4
Den Arbeiten im Abschnitt 2 wird aus Gründen der Anschaulichkeit und des leichteren Ver-
ständnis der Vorgehensweisen mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als den Arbeiten im darauf
folgenden Abschnitt 3.
Im Abschnitt 3 werden Modelle untersucht, bei denen eine stochastisch verteilte Nachfrage
zugrunde gelegt wird. Von dieser Nachfrage sind nur die Verteilungs- bzw. die Dichtefunkti-
on bekannt. Dies bringt mehr Realitätsnähe mit sich, macht die Berechnung von solchen Mo-
dellen jedoch komplizierter. Der Abschnitt 3.1 stellt eine Arbeit von L
ARIVIERE
7
vor. Da in
diesem Modell der Abnehmer das Risiko der unsicheren Nachfrage trägt, ist er mit dem klas-
sischen Zeitungsjungen-Problem konfrontiert. Die Arbeit behandelt die Möglichkeiten, die
Entscheidungen eines solchen Zeitungsjungen-Abnehmers durch Preisgestaltung zu beein-
flussen. Die Arbeit von C
ACHON
8
, auf die im Abschnitt 3.2 teilweise eingegangen wird, bietet
eine Analyse einer solchen Konstellation neben der Möglichkeit, dass der Zulieferer die Rolle
des Zeitungsjungen einnimmt. Er liefert auf Abruf und trägt damit voll das Risiko der Fehl-
einschätzung der Nachfrage. In der Arbeit wird eine Möglichkeit geboten, durch zeitpunktab-
hängige Preisgestaltung das eben erwähnte Risiko unter den beiden Vertragsteilnehmern auf-
zuteilen. Im Abschnitt 3.3 wird eine Arbeit von B
URNETAS
,
G
ILBERT UND
S
MITH
9
betrachtet,
die eine asymmetrische Informationsverteilung modelliert. Es handelt sich um eine Situation,
in der der Abnehmer genauere Informationen über die Nachfrageverteilung besitzt als der
Zulieferer.
Die Arbeit wird mit einem Schlusswort beendet, in dem die Ergebnisse der vorgestellten Mo-
delle zusammengefasst werden sowie, nach Hinweisen auf weitere Möglichkeiten der Model-
lierung, ein Ausblick auf eventuelle zukünftige Forschungsrichtungen auf dem Gebiet der
Preisgestaltung geboten wird.
7
Vgl. Lariviere (1999).
8
Vgl. Cachon (2004).
9
Vgl. Burnetas/Gilbert/Smith (2005)
Einleitung
5
Abbildung 1.1: Übersicht der verwendeten Modelle
Besonderheit des Modells
Abschnitt
1950
2003
1995
2001
2004
1999
1999
2004
2005
Vorrangige Bezugsquelle
D
e
te
rm
in
is
ti
s
c
h
e
N
a
c
h
fr
a
g
e
Mehrere homogene Abnehmer
Weng
Koordination mit
Zwischenpartner
Chan Choi/Lei Lei/Qiang Wang
Informationsasymmetrie
bezüglich der Kostenstruktur
Zweistufiges Monopol
Chan Choi
Mehrere heterogene Abnehmer
2.2
Quantity Discounts for Channel
Coordination: Transaction and Channel
Efficiency
2.3
Channel Coordination and Quantity
Discounts
Chen/Federgruen/Zheng
2.4
Coordination Mechanisms for a
Distribution System with One Supplier
and Multiple Retailers
Quantity Discounts in Single Period
Supply Contracts with Asymmetric
Demand Information
2.5
Coordinating a Three-Partners supply
Chain via Qantity Discounts
3.2
The Allocation of Inventory Risk in a
Supply Chain: Push, Pull, and Advance-
Purchase Discount Contracts
Corbett/Tang
2.6
S
to
c
h
a
s
ti
s
c
h
e
N
a
c
h
fr
a
g
e
Risokoallokation beim
Zulieferer
Lariviere
Informationsasymmetrie
bezüglich der Nachfrage
Burnetas/Gilbert/Smith
3.3
Double Marginalization
Spengler
2.1
Vertical Integration and Anti-trust Policy
3.1
Supply Chain Contracting and
Coordination with Stochastic Demand
Risokoallokation beim
Abnehmer
Cachon
Designing Supply Chain Contrakts:
Contract Type and Information
Asymmetry
2 Deterministische Nachfrage
2.1 Ursachen der Suboptimalität
Die quantitativ begründbaren Ursachen der Suboptimalität einer Zulieferer-Abnehmer-
Beziehung sind in zwei Bereichen festzustellen. Die Double Marginalization wirkt sich auf
den Umfang der gesamten Abnahmemenge, verbunden mit der Wahl des Einzelhandelspreises
und der abgesetzten Menge des Produktes. Die zweite Ursache basiert auf der fehlenden Op-
timierung der Bestellmenge innerhalb der Periode. Dieses Problem entsteht, wie auch die
Auswirkungen der Double Marginalization, bei der Verfolgung von persönlichen Zielen durch
die autark handelnden Kontraktteilnehmer. Auf die beiden Aspekte der sich ergebenden Sub-
optimalität wird im Folgenden eingegangen.
2.1.1 Double Marginalization: Spengler (1950)
Das Problem der Double Marginalization wurde zum ersten Mal von S
PENGLER
1
untersucht.
Die Darstellung ist angelehnt an B
ÜHLER UND
J
AEGER
2
. Die Erweiterung um die Marginalkos-
ten des Abnehmers und die Änderung der Preisabsatzfunktion sind eingearbeitet, um eine
höhere Kompatibilität mit den im weiteren Verlauf der Arbeit beschriebenen Modellen zu
erreichen. Das zur Erläuterung genutzte Modell wird im Folgenden beschrieben. Es besteht
aus einem Zulieferer und einem Abnehmer. Beide handeln ausschließlich im Sinne der Ma-
ximierung ihres eigenen Gewinns. Der Abnehmer steht als Monopolist einer Nachfrage für
das gekaufte Produkt gegenüber. Durch die aus der Double Marginalization entstehenden Ef-
fekte können der Zulieferer und der Abnehmer weniger an Gewinn erwirtschaften, als sie bei
einer vertikalen Koordination an Gesamtgewinn erreichen würden. Zunächst werden die im
Folgenden genutzten Variablen definiert:
=
w
Großhandelspreis, dieser wird gesetzt durch den Hersteller, hier Zulieferer.
=
w
optimaler Großhandelspreis ohne Koordination.
=
w
optimaler Großhandelspreis nach dem Rabatt im Falle einer Koordination (die Indizie-
rung der anderen Variablen erfolgt in der gleichen Weise).
=
p
Einzelhandelspreis, festgelegt durch den Einzelhändler, in diesem Fall Abnehmer.
=
)
( p
D
Nachfragefunktion, mit der der Abnehmer konfrontiert wird,
0
)
(
p
D
.
1
Vgl. Spengler (1950).
2
Vgl. Bühler und Jaeger (2002), S. 140 ff..
Stochastische Nachfrage
7
=
M
c
variable Kosten des Herstellers (Manufacturer)
=
R
c
variable Kosten des Einzelhändlers (Retailer)
M
= Gewinn des Zulieferers
R
= Gewinn des Abnehmers.
Hier und im weiteren Verlauf der Arbeit wird die gleiche Notation für die Variablen genutzt,
auch in Abweichung von der Notation der jeweiligen Arbeit. Die Nachfragefunktion sei
durch
pb
a
p
D
-
=
)
(
gegeben, wobei
a eine Grundnachfrage bei
0
=
p
und b den Steigungs-
koeffizient der Preisabsatzfunktion bedeuten. Die Kosten der Weiterverarbeitung des Produk-
tes beeinflussen seine Grenzkosten. Da er den Preis des Zulieferers als gegeben sieht, maxi-
miert er seinen Gewinn über die Variation des Einzelhandelspreises. Die Gewinnfunktion
ergibt sich, wenn man den Einzelhandelspreis abzüglich des Einstandspreises und der Grenz-
kosten mit der Absatzmenge multipliziert.
)
)(
(
)
(
)
(
)
(
bp
a
c
w
p
p
D
c
w
p
p
R
R
R
-
-
-
=
-
-
=
,
(2.1)
Zur Maximierung wird die Erste Ableitung gleich Null gesetzt:
0
2
)
(
!
=
+
+
-
=
b
c
wb
bp
a
p
R
R
.
(2.2)
Die Lösung ergibt den optimalen Einzelhandelspreis bei gegebenem Großhandelspreis:
b
b
c
wb
a
p
R
2
*
+
+
=
.
(2.3)
Die zu diesem Preis nachgefragte Menge entspricht
2
2
)
(
*
*
b
c
wb
a
b
b
c
wb
a
b
a
bp
a
p
D
R
R
-
-
=
+
+
-
=
-
=
.
(2.4)
Der Zulieferer steht damit einer steileren ,,Nachfragefunktion" gegenüber, die von dem Groß-
handelspreis
w abhängt. Diese verzerrte ,,Nachfragefunktion" ergibt sich durch die Gewinnab-
schöpfung des Einzelhändlers. Der Zulieferer maximiert seinen Gewinn unter Berücksichti-
gung dieser Funktion, indem er ebenfalls die erste Ableitung seiner Gewinnfunktion gleich
Null setzt:
2
)
(
)
(
)
(
)
(
*
b
c
wb
a
c
w
p
D
c
w
w
R
M
M
M
-
-
-
=
-
=
.
(2.5)
0
2
2
)
(
!
=
+
-
-
=
b
c
b
c
bw
a
w
M
R
M
(2.6)
Dies führt zum optimalen Großhandelspreis ohne Koordination
*
w :
b
b
c
b
c
a
w
M
R
2
*
+
-
=
.
(2.7)
Stochastische Nachfrage
8
Dieser Ausdruck, eingesetzt in (2.3), ergibt den Einzelhandelspreis und die abgesetzte Menge
ohne Koordination:
b
b
c
b
c
a
b
b
c
b
w
a
p
M
R
R
4
3
2
*
*
+
+
=
+
+
=
(2.8)
4
)
(
*
b
c
b
c
a
p
D
M
R
-
-
=
.
(2.9)
Die Gewinne der beiden Kontraktteilnehmer betragen:
b
b
c
b
c
a
M
R
R
16
)
(
2
*
-
-
=
und
(2.10)
b
b
c
b
c
a
M
R
M
8
)
(
2
*
-
-
=
,
(2.11)
was zu einem Gesamtgewinn ohne Koordination führt:
16
)
(
3
2
*
*
*
b
c
b
c
a
M
R
M
R
J
-
-
=
+
=
.
(2.12)
Angenommen, die beiden Unternehmen betrieben nun eine gemeinsame Optimierung. Der
Gesamtgewinn der Kette beträgt
)
)(
(
)
(
bp
a
c
c
p
p
R
M
J
-
-
-
=
.
(2.13)
Dieser wird über die Variation des Einzelhandelspreises maximiert:
0
2
)
(
!
=
+
+
-
=
b
c
b
c
bp
a
p
R
M
J
, und ergibt
(2.14)
b
b
c
b
c
a
p
R
M
J
2
*
*
+
+
=
.
(2.15)
Dieser Preis bewirkt einen gemeinsam erreichten Gewinn von
b
b
c
b
c
a
R
M
J
4
)
(
2
*
*
-
-
=
.
(2.16)
Durch Vergleich von (2.16) mit (2.12) erkennt man, dass der gemeinsam koordinierte Gewinn
größer ist als die Summe der Gewinne, die bei der Optimierung der jeweils eigenen Gewinn-
funktionen erreicht werden. Überdies ist der Preis, zu dem die Endabnehmer das Produkt be-
ziehen können, niedriger
3
und damit die Abnahmemenge größer. Man erkennt weiterhin, dass
der Großhandelspreis
w in dem zu optimierenden Ausdruck gar nicht berücksichtigt wird. Dies
bedeutet, dass die Gewinnabschöpfung des Zulieferers hier ausgeschaltet wurde und der
Nachfrage lediglich die Grenzkosten der Kette gegenüber gestellt werden. Wie eine solche
3
Der Preis in (2.8) ist größer als der in (2.15), wenn gilt:
b
c
c
a
R
M
)
(
+
>
, was besagt, dass es überhaupt eine
Möglichkeit gibt, bei einem Preis über den Kosten eine positive Menge abzusetzen.
Stochastische Nachfrage
9
Koordination durch die Preisgestaltung erreicht werden kann und wie der durch die Koordina-
tion erreichte Zusatzgewinn aufgeteilt wird, wird im folgenden Verlauf der Arbeit (ab dem
Abschnitt 2.2.1) erörtert.
2.1.2 Suboptimalität der Bestellmenge
Die Orientierung der Kontraktteilnehmer an den eigenen Gewinnen bzw. Kosten bringt ein
weiteres Problem mit sich. Das durch einen Aufsatz von M
ONAHAN
4
beleuchtete Problemfeld
bezieht sich auf die Koordination von Abrufentscheidungen, also der Bestellmenge des Ab-
nehmers. Der Zulieferer minimiert seine Kosten, die aus den Auflagekosten und den Lager-
haltungskosten bestehen. Da ihm mit jeder Bestellung des Abnehmers Auflagekosten entste-
hen, wäre für ihn eine einzige Bestellung, also die Herstellung der gesamten Abnahmemenge
in einer Auflage, kostenminimal. Der Abnehmer sieht sich einem trade-off zwischen den Be-
stellkosten und den Lagerkosten, die mit zunehmender Bestellmenge abnehmen bzw. zuneh-
men. Bei Optimierung der Gesamtkosten der Supply Chain würden sowohl die Auflage- bzw.
Bestellkosten der Teilnehmer als auch ihre Lagerhaltungskosten Berücksichtigung finden.
Dies würde zu einer Minimierung der Gesamtkosten der Supply Chain führen. Die formale
Beschreibung dieses Problemfeldes wird im Abschnitt 2.2.2 im Rahmen der Darstellung einer
Arbeit von C
HAN
C
HOI
geboten.
2.2 Zweistufiges Monopol: Chan Choi (2003)
Der Größte Teil der Arbeiten über die Preisgestaltung beschäftigt sich mit der Koordination
der Supply Chain bezüglich zweier Aspekte. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wird eine Ko-
ordination der Bestellpolitik des Abnehmers angestrebt. Dadurch wird eine Minimierung der
gesamten Lager-, Bestell-, und Auflagekosten erreicht. Diese Art Effizienz wird Transaction
Efficiency genannt. Die zweite Richtung der Untersuchung befasst sich mit den Absatzwirt-
schaftlichen Aspekten der Preisgestaltung. Durch eine geeignete Festlegung des Preisverlaufs
und möglicherweise einer Franchise-Gebühr wird das Problem der Double Marginalization
vermieden. Der Abnehmer wird dazu bewegt, den Verkaufspreis und damit die Abnahme-
menge so zu wählen, dass der Gesamtprofit der Supply Chain maximiert wird. Die Untersu-
chungen in diesem Bereich zielen auf die Thematik der Channel Efficiency. Eine gemeinsame
Betrachtung dieser beiden Untersuchungsrichtungen findet sich in der Arbeit von C
HAN
4
M
ONAHAN
(1984), dargestellt nach Z
IMMER
(2001), S. 56-57.
Stochastische Nachfrage
10
C
HOI
5
. Diese Arbeit zeigt sehr anschaulich die Auswirkungen von verschiedenen Formen
der
Mengenrabatte auf
die Bestellpolitik und die Preissetzung des Abnehmers. Um eine Koordi-
nation
der Tätigkeiten innerhalb der Supply Chain zu erreichen, existieren mehrere Wege.
Einer dieser Wege ist, durch geeignete Preisgestaltung die Zielfunktion des Abnehmers mit
der Zielfunktion der gesamten Supply Chain in Einklang zu bringen. Die am einfachsten zu
handhabende Form der Preisvariation ist die Abhängigkeit des Preises von der bezogenen
Menge des Gutes. Hierbei kann man zwischen der insgesamt bezogenen Menge und der Grö-
ße einer Bestellung unterscheiden. Diese beiden Rabatt-Varianten haben wegen ihrer Einwir-
kungsmöglichkeiten Auswirkungen auf die Problembereiche der Channel Efficiency und der
Transaction Efficiency. Die Form, in der der Preis von der Menge abhängt, kann je nach Aus-
gestaltung des Vertrages variieren. Die Arbeit von C
HAN
C
HOI
vereint zwei Modelle, die sich
auf die Transaction Efficiency und die Channel Efficiency beziehen, zu einem Modell, in dem
simultan beide Probleme gelöst werden. Im weiteren Verlauf des Abschnitts werden zunächst
die beiden ursprünglichen Modelle vorgestellt, danach wird das Modell mit beiden Optimie-
rungsaspekten entwickelt. Die unterschiedlichen Rabattformen werden im Laufe der Ausei-
nandersetzung mit den unterschiedlichen Arbeiten im weiteren Verlauf vorgestellt. Die Not-
wendigkeit, sich mit den unterschiedlichen Modellen zu befassen, ergibt sich daraus, dass der
Zulieferer eine Grundlage braucht, um einen Tarif zu gestalten. Er benötigt Daten über die
Zielwerte, zu deren Festlegung er den Abnehmer animieren will. Diese Werte und die Vorge-
hensweise bei deren Berechnung können vom jeweiligen Modell abhängen.
2.2.1 Mengenrabatte und Channel Efficiency
C
HAN
C
HOI
6
beschreibt in seiner Arbeit
ein Modell, das als Auszug aus mehreren Modellen
entstanden ist, die auf die Channel Efficiency eingehen. Ohne jegliche Koordination wählen
der Hersteller und der Einzelhändler ihre Variablen so, dass ihre Gewinne maximal werden:
)
(
)
(
)
(
p
D
c
w
w
M
M
-
=
(2.17)
)
(
)
(
)
(
p
D
c
w
p
p
R
R
-
-
=
(2.18)
Die fixen Kosten beider Kontraktteilnehmer wurden in diesem Modell nicht berücksichtigt.
Der Hersteller maximiert seinen Gewinn unter Berücksichtigung der antizipierten Reaktions-
funktion des Einzelhändlers. Durch eine Koordination kann eine Maximierung des Gesamt-
gewinns erreicht werden:
5
Vgl. Chan Choi (2003).
6
Vgl. Chan Choi (2003).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836602594
- DOI
- 10.3239/9783836602594
- Dateigröße
- 562 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FernUniversität Hagen – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2007 (April)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- geschäftsverbindung wertschöpfungskette preispolitik supply chain channel efficiency double margilization quantity discount
- Produktsicherheit
- Diplom.de