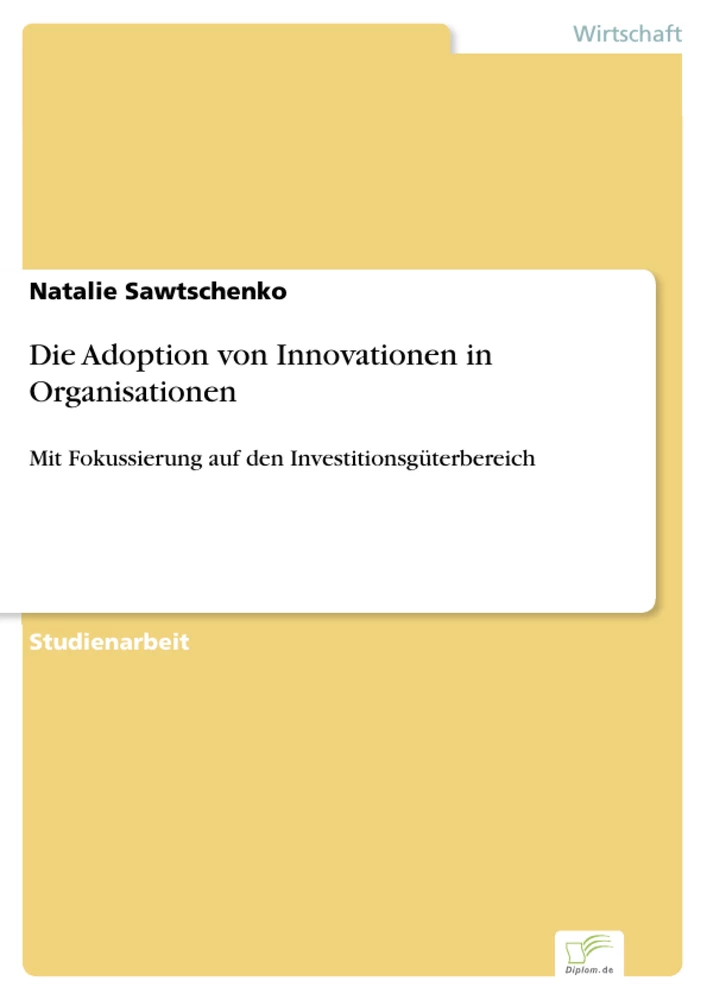Die Adoption von Innovationen in Organisationen
Mit Fokussierung auf den Investitionsgüterbereich
©2006
Studienarbeit
114 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Innovation (aus dem Spätlateinischen innovatio Neuerung, Erneuerung, Novation) bedeutet im weiteren Sinne des Wortes eine neue Art und Weise etwas zu machen. Der Begriff der Innovation beinhaltet die Entdeckung den Zuwachs an Wissen und die Erfindung eine neue Nutzungsweise schon vorhandenen Wissens. Erstmals wurde der Terminus Innovation in der Anthropologie und der Ethnologie im 19. Jahrhundert eingesetzt und bedeutete ursprünglich den Einführungsprozess von Elementen einer Kultur in eine andere. Heute wird der Begriff der Innovation meist auf technische Neuerungen bezogen, es können aber auch soziale, organisatorische oder sonstige Neuerungen damit gemeint werden.
Eine wissenschaftliche Bedeutung hat dieser Begriff in der Innovationsökonomie gewonnen, wo zwischen verschiedenen Arten von Innovation unterschieden wird: Produktinnovationen, die neue Produkte kennzeichnen, und Prozessinnovationen, die neue Herstellungswege darstellen. Des Weiteren wird zwischen prozessbezogener und objektbezogener Betrachtungsweise der Innovation unterschieden. Die Erste definiert die Innovation als einen Prozess, der aus mehreren Teilprozessen, wie Entwicklungs-, Markteinführungs- und Marktdurchdringungsprozess, besteht. Die Zweite fasst die Innovation als ein Objekt auf, dabei werden neue Ideen, Produkte, Verfahren oder Verhaltensweisen als Objekte betrachtet. Die prozessbezogene Betrachtungsweise findet sich beispielsweise in der Innovationsforschung, die objektbezogene in der Diffusionsforschung.
Rogers bezeichnet als eine Innovation an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption. Laut Rogers werden also nicht nur tatsächlich neue Produkte sondern alle solche Produkte als Innovationen betrachtet, welche von potentiellen Adoptoren als neu empfunden werden. Es handelt sich dabei also sowohl um objektive als auch um subjektive Neuheiten. Dies deutet auf eine der Dimensionen von Innovation, die unterschieden werden: die Subjektdimension. Außerdem wird noch von der Intensitätsdimension gesprochen, in der die Innovationen nach dem Grad der Neuheit in Basisinnovationen sowie Verbesserungs- und Routineinnovationen untergliedert werden. Die weisen dann jeweils einen hohen, mittleren oder niedrigen Neuheitsgrad auf.
Treibende Auslöser für Innovationen können wissenschaftliche oder technische Durchbrüche oder eine Nachfrage nach neuen Problemlösungen sein. Auch gesellschaftliche […]
Innovation (aus dem Spätlateinischen innovatio Neuerung, Erneuerung, Novation) bedeutet im weiteren Sinne des Wortes eine neue Art und Weise etwas zu machen. Der Begriff der Innovation beinhaltet die Entdeckung den Zuwachs an Wissen und die Erfindung eine neue Nutzungsweise schon vorhandenen Wissens. Erstmals wurde der Terminus Innovation in der Anthropologie und der Ethnologie im 19. Jahrhundert eingesetzt und bedeutete ursprünglich den Einführungsprozess von Elementen einer Kultur in eine andere. Heute wird der Begriff der Innovation meist auf technische Neuerungen bezogen, es können aber auch soziale, organisatorische oder sonstige Neuerungen damit gemeint werden.
Eine wissenschaftliche Bedeutung hat dieser Begriff in der Innovationsökonomie gewonnen, wo zwischen verschiedenen Arten von Innovation unterschieden wird: Produktinnovationen, die neue Produkte kennzeichnen, und Prozessinnovationen, die neue Herstellungswege darstellen. Des Weiteren wird zwischen prozessbezogener und objektbezogener Betrachtungsweise der Innovation unterschieden. Die Erste definiert die Innovation als einen Prozess, der aus mehreren Teilprozessen, wie Entwicklungs-, Markteinführungs- und Marktdurchdringungsprozess, besteht. Die Zweite fasst die Innovation als ein Objekt auf, dabei werden neue Ideen, Produkte, Verfahren oder Verhaltensweisen als Objekte betrachtet. Die prozessbezogene Betrachtungsweise findet sich beispielsweise in der Innovationsforschung, die objektbezogene in der Diffusionsforschung.
Rogers bezeichnet als eine Innovation an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption. Laut Rogers werden also nicht nur tatsächlich neue Produkte sondern alle solche Produkte als Innovationen betrachtet, welche von potentiellen Adoptoren als neu empfunden werden. Es handelt sich dabei also sowohl um objektive als auch um subjektive Neuheiten. Dies deutet auf eine der Dimensionen von Innovation, die unterschieden werden: die Subjektdimension. Außerdem wird noch von der Intensitätsdimension gesprochen, in der die Innovationen nach dem Grad der Neuheit in Basisinnovationen sowie Verbesserungs- und Routineinnovationen untergliedert werden. Die weisen dann jeweils einen hohen, mittleren oder niedrigen Neuheitsgrad auf.
Treibende Auslöser für Innovationen können wissenschaftliche oder technische Durchbrüche oder eine Nachfrage nach neuen Problemlösungen sein. Auch gesellschaftliche […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Natalie Sawtschenko
Die Adoption von Innovationen in Organisationen
Mit Fokussierung auf den Investitionsgüterbereich
ISBN: 978-3-8366-0223-5
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Universität, Abschlussarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG
1
2 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN
5
2.1 Diffusionstheorie
5
2.2 Adoptionsentscheidung in weiteren Forschungsdisziplinen
12
3 ENTSCHEIDUNGSMODELLE IN DER WISSENSCHAFTLICHEN
FORSCHUNG
15
3.1 Modelle aus dem Bereich der Diffusionsforschung
16
3.2 Modelle aus dem Forschungsbereich der Psychologie
25
3.3 Modelle aus dem Forschungsbereich der Entscheidungstheorie
31
3.4 Modelle aus dem Bereich der Innovationsforschung
42
3.5 Modelle aus dem Bereich des Industriegütermarketings
50
4 MODELLANALYSE
83
4.1 Partialansätze
85
4.1.1 Phasenmodelle
85
4.1.2 Determinantenmodelle
86
4.2 Totalansätze
91
4.2.1 Prozessmodelle
91
4.2.2 Strukturmodelle
92
4.3 Ergebnisse
93
5 ZUSAMMENFASSUNG
97
6 SUMMARY
101
LITERATURVERZEICHNIS I
ABBILDUNGSVERZEICHNIS IX
AUTORENVORSTELLUNG XI
1
1 Einleitung
Innovation (aus dem Spätlateinischen innovatio Neuerung, Erneuerung, Novation) be-
deutet im weiteren Sinne des Wortes eine neue Art und Weise etwas zu machen. Der Beg-
riff der Innovation beinhaltet die Entdeckung den Zuwachs an Wissen und die Erfin-
dung eine neue Nutzungsweise schon vorhandenen Wissens. Erstmals wurde der Termi-
nus ,,Innovation" in der Anthropologie und der Ethnologie im 19. Jahrhundert eingesetzt
und bedeutete ursprünglich den Einführungsprozess von Elementen einer Kultur in eine
andere. Heute wird der Begriff der Innovation meist auf technische Neuerungen bezogen, es
können aber auch soziale, organisatorische oder sonstige Neuerungen damit gemeint wer-
den.
1
Eine wissenschaftliche Bedeutung hat dieser Begriff in der Innovationsökonomie ge-
wonnen, wo zwischen verschiedenen Arten von Innovation unterschieden wird: Produktin-
novationen, die neue Produkte kennzeichnen, und Prozessinnovationen, die neue Herstel-
lungswege darstellen. Des Weiteren wird zwischen prozessbezogener und objektbezogener
Betrachtungsweise der Innovation unterschieden. Die Erste definiert die Innovation als ei-
nen Prozess, der aus mehreren Teilprozessen, wie Entwicklungs-, Markteinführungs-,
Marktdurchdringungsprozess, besteht. Die Zweite fasst die Innovation als ein Objekt auf,
dabei werden neue Ideen, Produkte, Verfahren oder Verhaltensweisen als Objekte betrach-
tet.
2
Die prozessbezogene Betrachtungsweise findet sich beispielsweise in der Innovations-
forschung, die objektbezogene in der Diffusionsforschung. Rogers bezeichnet als eine Inno-
vation ,,an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of
adoption" (Rogers, 2003, S.12). Laut Rogers werden also nicht nur tatsächlich neue Produk-
te sondern alle solche Produkte als Innovationen betrachtet, welche von potentiellen Adop-
toren als neu empfunden werden. Es handelt sich dabei also sowohl um objektive als auch
um subjektive Neuheiten.
3
Dies deutet auf eine der Dimensionen von Innovation, die unter-
schieden werden: die Subjektdimension. Außerdem wird noch von der Intensitätsdimension
gesprochen, in der die Innovationen nach dem Grad der Neuheit in Basis-, Verbesserungs-
1
Vgl. Plotinskij, 2001, Kap. 9.1.
2
Nähere Ausführungen zum Begriff der Innovation finden sich beispielsweise bei Bock, 1987, S. 25ff.;
Gabler, 1997.
3
Vgl. auch Helm, 2001, S. 49f.
2
und Routineinnovationen untergliedert werden. Die weisen dann jeweils einen hohen, mitt-
leren oder niedrigen Neuheitsgrad auf.
4
Treibende Auslöser für Innovationen können wissenschaftliche oder technische Durchbrü-
che oder eine Nachfrage nach neuen Problemlösungen sein. Auch gesellschaftliche Wunsch-
und Zielvorstellungen können die Genese von Innovationen beeinflussen. Der amerikani-
sche Soziologe Drucker hat sieben Hauptquellen der Neuerungen hervorgehoben:
5
1. Eine plötzliche Situationsänderung, jemandes Erfolg oder Misserfolg, Reaktion
auf unvorhergesehene Außeneinwirkung;
2. Fehlende Übereinstimmung zwischen der veränderten Realität und Vorstellungen,
Erwartungen von Menschen;
3. Die Entdeckung von Mängeln im Lauf, Rhythmus oder in der Logik eines Prozes-
ses;
4. Die Veränderungen in der Struktur der Produktion oder des Konsums;
5. Die demographischen Veränderungen;
6. Die Veränderungen im gesellschaftlichen Bewusstsein (Stimmungen, Einstellun-
gen, Werte);
7. Die Entstehung eines neuen Wissens.
Der Innovationsprozess im weiteren Sinne kann in einzelne Phasen unterteilt werden, die
mit dem Erkennen eines bestimmten Bedürfnisses oder Problems beginnen, was durch For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten zu einer Erfindung oder Invention führt. Im Falle
einer erfolgversprechenden Erfindung müssen dann die Vorbereitungen zur Markteinfüh-
rung getätigt werden, das Resultat dieser Vorgänge stellt die Innovation im engeren Sinne
dar. Die kommerzielle Vermarktung, d.h. die massenhafte Verbreitung bzw. die Markt-
durchdringung, bildet die nächste Phase in diesem Prozess.
6
Dabei werden die Begriffe der
Diffusion und der Adoption relevant, auf die im darauffolgenden Kapitel näher eingegangen
wird. Als Adoption wird die Entscheidung eines Nachfragers zur Übernahme einer Innova-
tion bezeichnet. Die Diffusion wird als der Prozess der Innovationsverbreitung innerhalb
eines sozialen Systems sowie von einem System zum anderen definiert. Die letzte Phase des
Innovationsprozesses umfasst die Auswirkungen, die sich aus der Adoption oder Nichtadop-
4
Vgl. Schultheis, 1992, S. 14f.
5
Vgl. Plotinskij, 2001, Kap 9.1.
6
Vgl. Stoetzer/Mahler, 1995, S. 4f.; Mahler, 2001, S. 8-10.
3
tion der Innovation ergeben.
7
Früher ging man davon aus, dass Innovationen in einer linea-
ren Kette entstehen, mittlerweile hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass dieses Modell zu
simpel ist und vielfältige Rückkopplungen zwischen den einzelnen Phasen bestehen.
Innovationen als notwendige Bedingungen für Veränderungen spielen eine immer größere
Rolle in unserem Leben. Die neuen Technologien sind die Grundlage der wirtschaftlichen
Entwicklung. Seit den frühesten Arbeiten auf diesem Forschungsfeld kommen die Forscher
immer wieder zur Schlussfolgerung, dass der technische Fortschritt die Basis des Wirt-
schaftswachstums darstellt.
8
Außerdem zeigen die Untersuchungen der Unterschiede der
internationalen Einkommen, dass der größere Teil der Einkommensunterschiede auf die
Unterschiede in den Technologien zurückzuführen ist, die in verschiedenen Ländern einge-
setzt werden.
9
Demzufolge ist es ersichtlich, dass die Innovationen nicht nur im betriebs-
wirtschaftlichen Sinne für ein Unternehmen notwendig, ja überlebenswichtig sind, um im
nationalen und internationalen Wettbewerb bestehen zu können, sondern auch einen unver-
zichtbaren Bestandteil der gesamten Volkswirtschaft darstellen.
In der vorliegenden Arbeit sind vor allem die Innovationen aus dem Industriegüterbereich
von Interesse. Die Adoption von Innovationen stellt einen komplexen Entscheidungsprozess
dar, der von einer Vielzahl von Faktoren determiniert wird. Der Prozessverlauf einer Inno-
vationsentscheidung wird umfassend in der Diffusionstheorie untersucht, deren Grundzüge
im Kapitel 2 dargelegt werden. Im Rahmen dieser Darlegung wird explizit auf zwei Kon-
zepte von Rogers (2003) eingegangen, die den Verlauf einer Innovationsentscheidung sowie
eine Adoptertypologie beschreiben. Dieses Kapitel schließt mit einem kurzen Ausblick auf
weitere Forschungsbereiche ab, die sich mit organisationalen Beschaffungsentscheidungen
befassen.
Im dritten Kapitel werden einige ausgewählte Konzepte zur Entscheidungserklärung aus
unterschiedlichen Fachrichtungen in der zusammengefassten Form dargestellt. Als Ergebnis
der langjährigen Forschungen ist mittlerweile ein teilweise nur schwer zu durchblickendes
Geflecht an Ansätzen entstanden, sodass die Berücksichtigung aller Entscheidungskonzepte
nicht nur für den Rahmen dieser Arbeit als unrealistisch erscheint. Deshalb konzentrieren
sich die Ausführungen im dritten Kapitel auf die Ansätze, auf die in der Fachliteratur öfters
Bezug genommen wird, sowie auf die Konzepte, die für die Erklärung von organisationalen
7
Zum Innovationsprozess vgl. auch Rogers, 2003, S. 137ff.; Milling/Maier, 1996, S. 17ff.
8
Vgl. Erdmann, 1993, S. 67.
9
Vgl. Mahler, 2001, S. 10; Gareev, 2004.
4
Kaufentscheidungen als geeignet erscheinen. Neben den Ansätzen aus der Diffusionsfor-
schung finden in diesem Kapitel auch Entscheidungsmodelle aus der Psychologie, Ent-
scheidungstheorie, Innovationsforschung sowie aus dem Industriegütermarketing Berück-
sichtigung.
Im darauffolgenden Kapitel wird eine Analyse der dargestellten Entscheidungsansätze
vorgenommen. Zu diesem Zwecke werden die Konzepte in Total- und Partialmodelle unter-
teilt und hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und Aussagekraft untereinander verglichen. Die
auf diese Weise vorausgewählten Ansätze werden schließlich anhand einer Reihe von Krite-
rien mit dem Ziel bewertet, die für die Beschreibung eines Beschaffungsentscheidungspro-
zesses am besten geeigneten Konzepte hervorzuheben. Das vierte Kapitel schließt mit einer
Darlegung der Analyseergebnisse.
Im fünften und letzten Kapitel werden die Resultate der Arbeit zusammengefasst. Es wird
ein kurzer Rückblick auf den Inhalt der vorgelegten Diplomarbeit geworfen und noch ein-
mal explizit auf die Ergebnisse der durchgeführten Analyse eingegangen. Anschließend
werden kurz einige Aspekte angesprochen, die weitere empirische Forschungen zur Be-
schreibung der Innovationsadoption in Organisationen anregen sollen. Die in englischer
Sprache ausgeführte Zusammenfassung schließt die Arbeit ab.
5
2 Theoretischer Bezugsrahmen
2.1 Diffusionstheorie
Damit eine neue Technologie an ökonomischer Bedeutung gewinnt, ist Zeit erforderlich.
Zunächst soll die Technologie in die Wirtschaft eingeführt werden (Innovation), dann wird
sie nach und nach von vielen Rezipienten übernommen (Diffusion). Die Diffusion ist nicht
weniger wichtig als die Innovation selbst: die neuen Technologien werden keinen ökonomi-
schen Einfluss haben, bevor sie keine Verbreitung in der Wirtschaft finden.
10
Mit der Erforschung der Übernahme- und Ausbreitungsprozesse von Innovationen be-
schäftigen sich die Adoptions- und Diffusionsforschung. Zwischen den beiden Disziplinen
liegt eine enge Verzahnung vor, deswegen werden sie oft unter dem Begriff der Diffusions-
theorie zusammengefasst. ,,Während die Adoptionstheorie die Faktoren analysiert, die den
Verlauf des (individuellen) Adoptionsprozesses beeinflussen, untersucht die Diffusionstheo-
rie aufbauend auf diesen Erkenntnissen die zeitliche Entwicklung der Übernahme einer In-
novation vom ersten bis zum letzten Käufer in einem sozialen System" (Weiber, 1992, S. 3).
Die Unterscheidung liegt in der Perspektive: Bei der Adoptionsforschung steht eher die
intrapersonale Betrachtungsweise im Vordergrund, bei der Diffusionsforschung die inter-
personale, wobei das Hauptinteresse der ,,Bestimmung der Zeitpunkte, zu denen die Neue-
rungen von verschiedenen Nachfragern übernommen werden" (Weiber, 1992, S. 3), gilt.
Die Entwicklung der Diffusionsforschung baut auf einer langen Forschungstradition auf,
die schon mehr als hundert Jahre alt ist. Der Diffusionsprozess von Innovationen in ver-
schiedenen Lebenssphären der Gesellschaft hat seine spezifischen Merkmale und Besonder-
heiten,
11
so stammen die ersten Arbeiten auf diesem Forschungsfeld aus den Wissenschafts-
gebieten der Anthropologie und der Soziologie. Zahlreiche Forschungen wurden unter ande-
rem auf den Gebieten der Agrar-, Medizin- und Bildungssoziologie sowie der Kommunika-
tionsforschung unternommen.
12
1962 hat Rogers mit der Veröffentlichung seines Werkes
,,Diffusion of Innovations" versucht, eine einheitliche Diffusionstheorie zu formulieren. Er
10
Vgl. Gareev, 2004.
11
Vgl. Plotinskij, 2001, Kap. 9.1.
12
Nähere Ausführungen zur Tradition der Diffusionsforschung finden sich beispielsweise bei Ecterhagen,
1983, S. 3-2ff.; Schultheis, 1992, S. 33ff.; Kortmann, 1994, S. 33ff.; Rogers, 2003, S. 39ff.
6
gilt als Begründer der Allgemeinen Diffusionstheorie und hat wohl den größten Beitrag zu
Forschungen auf diesem Gebiet geleistet. Die folgenden Ausführungen zu der Diffusions-
forschung basieren hauptsächlich auf Erkenntnissen, die Rogers in seiner Theorie formuliert
hat. Aus den 60er Jahren stammen auch die ersten Arbeiten zur Diffusionsforschung im
Bereich der Ökonomik, was das wachsende Interesse an der Diffusion von Innovationen aus
betriebswirtschaftlicher Sicht zeigte. Ebenso in den 60er Jahren wurden auch Versuche un-
ternommen, den Diffusionsprozess von Innovationen analytisch zu erfassen. Es wurden
komplexere mathematische Modelle entwickelt, die auf Erkenntnissen aus der Physik, Bio-
chemie und Epidemiologie basieren.
13
Einen der neueren ebenfalls stark mathematisch ori-
entierten Ansätze stellt das Diffusionsmodell von Milling/Maier (1996) dar.
14
In ihrem Mo-
dell gehen die Autoren explizit auf den Adoptionsaspekt ein und unterscheiden dabei zwi-
schen potentiellen Käufern und Adoptoren und gehen von den Kommunikationsbeziehun-
gen zwischen diesen beiden Gruppen aus. Ferner unterscheiden sie zwischen Innovatoren-
käufern, die ,,in ihren Kaufentscheidungen unbeeinflusst von der bisherigen Verbreitung des
Produktes" (Milling/Maier, 1996, S. 94) sind, und Imitatorenkäufern. Die mit Hilfe von ma-
thematischen Gleichungen der Programmiersprache DYNAMO abgebildeten Käuferzahlen
gehen dann in das Diffusionsmodell ein, das als Computersimulationsmodell bezeichnet
wird. Das Modell ermöglicht die Simulation unterschiedlicher Unternehmensstrategien und
Wettbewerbssituationen und bietet Entscheidungsunterstützung im Bereich des Innovati-
onsmanagements.
An dieser Stelle bleibt anzumerken, dass die Zahl der Forschungsarbeiten zur Diffusions-
theorie auf verschiedensten Fachgebieten bis heute weiter zunimmt.
Wie bereits erwähnt, stellt die Diffusion einen Prozess dar, mittels dessen sich die Innova-
tion durch Kommunikationskanäle in der Zeit und im Raum zwischen den Mitgliedern eines
sozialen Systems verbreitet.
15
Die Form und die Geschwindigkeit dieses Prozesses werden
demzufolge primär von folgenden Faktoren beeinflusst, die Rogers (2003) als Elemente der
Diffusion bezeichnet:
16
· der Innovation selbst;
· den Kommunikationskanälen, über welche die potentiellen Annehmer Informatio-
13
Beispiele für mathematische Diffusionsmodelle finden sich bspw. bei Gierl, 1987; Hesse, 1987; Bierfelder,
1989; Fantapié Altobelli, 1991; Milling/Maier, 1996.
14
Vgl. Milling/Maier, 1996.
15
Vgl. Rogers, 2003, S. 11.
16
Vgl. Rogers, 2003, S. 11.
7
nen über die Innovation erhalten;
· dem sozialen System, als die Gesamtheit der Individuen, welche aufgrund gemein-
samer Merkmale und eines ähnlichen Problemlösungsverhaltens das Marktpotenti-
al für die Neuerung darstellen;
· der Zeit, über welche sich der Diffusionsprozess erstreckt.
Ferner betrachtet Rogers (2003) vier Aspekte der Diffusion von Innovationen: den Adop-
tionsentscheidungsprozess, die individuelle Innovativität der potentiellen Adoptoren, die
Übernahmegeschwindigkeit der Innovation und die wahrgenommenen Merkmale der Inno-
vation. Er entwickelt ein Phasenmodell zur Beschreibung einer Innovationsadoptionsent-
scheidung und berücksichtigt dabei eine Reihe von Determinanten, die in bestimmten Pha-
sen den Prozess beeinflussen. Nach Rogers (2003) besteht der Adoptionsprozess aus fünf
Phasen:
17
1. Erste Wahrnehmung der Innovation (knowledge): Während dieser Phase nimmt
der potentielle Adoptor bzw. die Gruppe von Entscheidungsträgern die Existenz
der Innovation zur Kenntnis. In dieser Phase sind vor allem die Merkmale von Ent-
scheidungsträgern von Bedeutung: die sozioökonomischen, persönlichkeitsbezoge-
nen sowie die kommunikativen Eigenschaften;
2. Die Überzeugungsphase (persuasion): In dieser Phase wird eine positive bzw. ne-
gative Meinung über die Innovation gebildet. Dabei sind in erster Linie die Eigen-
schaften der Innovation wichtig, auf die später ausführlicher eingegangen wird;
3. Die Entscheidungsphase (decision), die auf Basis von Nutzenanalysen der Innova-
tion in der Gegenwart und in der Zukunft zur Adoption oder Nicht-Adoption
führt;
4. Die Approbationsphase (implementation): In dieser Phase nutzt der potentielle
Adoptor die Innovation;
5. Die Bestätigungsphase (confirmation): In dieser Phase erfolgt die Überprüfung
der vorher getroffenen Adoptionsentscheidung, die entweder zur Bekräftigung
oder unter Umständen auch zur Revision führt.
Des Weiteren entwickelt Rogers (2003) eine Typologie, die die potentiellen Adoptoren
hinsichtlich ihrer individuellen Innovativität in einzelne Gruppen unterteilt. Die individuelle
Innovativität zeichnet die Neigung der Adoptoren (Individuen und Organisationen) aus, die
17
Vgl. Rogers, 2003, S. 169ff.
8
Innovationen im Vergleich zu anderen Mitgliedern des Systems relativ früh oder später zu
übernehmen. Das ganze Kontinuum von Rezipienten unterteilt Rogers (2003) in fünf
Hauptkategorien:
18
1. Innovatoren (innovators)
Innovatoren sind diejenigen Mitglieder des sozialen Systems, die die Innovation
zuerst übernehmen. Sie sind durch hohe Risikobereitschaft charakterisiert, streben
nach der Prüfung von jeder Innovation, besitzen die notwendigen finanziellen
Ressourcen als Garantie bei einem möglichen Fehlschlag der Adoption und verfü-
gen über komplizierte technische Kenntnisse und die Fähigkeit, diese anzuwen-
den. Zu dieser Gruppe gehören 2,5 % der Mitglieder des Systems;
2. Frühe Übernehmer (early adopters)
Diese Gruppe bildet das Hauptkontingent von Meinungsführern in den meisten
sozialen Systemen: Die potentiellen Rezipienten lassen sich häufig von frühen
Übernehmern Informationen und Ratschläge bezüglich der Innovation geben. In
der Regel genießen die frühen Übernehmer ein hohes Ansehen anderer Mitglieder
des sozialen Systems und dienen als Vorbilder für weitere potentielle Adoptoren,
indem sie die Innovation gleich nach den Innovatoren annehmen. Zu dieser Grup-
pe gehören 13,5 % der Mitglieder;
3. Frühe Mehrheit (early majority)
Die Vertreter dieser Kategorie, zu denen 34 % der Mitglieder des sozialen Sys-
tems zählen, können bis zum Adoptionsmoment etwas schwanken, ihr Adoptions-
prozess dauert relativ länger als der von den Rezipienten der ersten beiden Kate-
gorien. Sie folgen gern den anderen im Adoptionsprozess, leiten jedoch nur selten
diese Bewegung;
4. Späte Mehrheit (late majority)
Zu dieser Gruppe, die ebenfalls 34 % der Mitglieder umfasst, gehören überwie-
gend Skeptiker, die die Innovation nach den ,,Durchschnittsmitgliedern" überneh-
men, oft aufgrund von wirtschaftlicher Notwendigkeit oder als Reaktion auf so-
zialen Druck;
5. Nachzügler (laggards)
Diese Adoptoren, die 16 % der Mitglieder des sozialen Systems bilden, sind die
18
Vgl. Rogers, S. 280ff.
9
Repräsentanten der traditionellen, konservativen Orientierung. Sie übernehmen
die Innovation als Letzte, und das Risiko der Nicht-Adoption ist bei dieser Gruppe
am höchsten.
Zahlreiche Forschungsergebnisse zeigten, dass die Verteilung der Adoptorenzahl in der
Zeit gemäß der Gauß-Kurve erfolgt, also normalverteilt ist. Diese Klassifikation ist sehr
bedingt, erlaubt allerdings das Erreichen der methodologischen Einheitlichkeit und Liquida-
tion der Unstimmigkeiten in der Klassifikation und der Bezeichnung von verschiedenen
Kategorien in den Forschungsarbeiten.
Des Weiteren betrachtet Rogers die Übernahmegeschwindigkeit der Innovationen und
behauptet, dass die Diffusionsprozesse mit Hilfe einer S-förmigen Kurve dargestellt werden
können.
19
Die empirische Analyse der Vielzahl von natürlichen, technisch-wirtschaftlichen
und soziokulturellen Prozessen hat gezeigt, dass die Prozessdynamik hinsichtlich ihres
Wachstums, ihrer Entwicklung und Verbreitung den logistischen Gesetzlichkeiten unter-
liegt. Die Diffusionskurve entsteht durch die Kumulation der Anzahl von tatsächlichen A-
doptoren der Innovation über die Zeit hinweg und beinhaltet drei Entwicklungsphasen: die
Bildung der Entwicklungsbasis (langsames Wachstum), das heftige Wachstum und Sätti-
gung (wieder langsames Wachstum).
20
In diesem Zusammenhang ist auch das Konzept der kritischen Masse kurz zu erwähnen.
Beim Erreichen einer bestimmten Rate von Adoptionen steigt die Übernahmegeschwindig-
keit stark an und beim Erreichen einer bestimmten Anzahl von Adoptoren wird eine ,,in der
Innovation selbst begründete, sich aufrechterhaltende, wachsende Verbreitung der Innovati-
on erwartet" (Mahler, 2001, S. 49). Der ,,Kritische-Masse-Punkt" liegt vermutlich zwischen
einer Adoptionsrate von 10 und 25 %, d.h., wenn höchstens 25 % der Bevölkerung eine
innovative Idee adoptieren, ist ihr Diffusionsprozess nicht mehr zu stoppen und verläuft
weiter selbständig, es bedarf also keiner weiteren Überzeugungsbemühungen und ,,Wer-
bung" für die Innovation. Um aber diese Rate von Adoptionen zu erreichen, müssen real 50
% der Bevölkerung bearbeitet werden.
21
19
Vgl. Rogers, 2003, S. 23, 272.
20
Vgl. Gareev, 2004.
21
Vgl. Hecker, 1997, S. 75ff.; Pochepzov, 1998, Kap. 6.1; Rogers, 2003, S. 343ff.
10
Die Geschwindigkeit von Diffusion wird nach Rogers Meinung von fünf Faktoren be-
stimmt, nämlich den wahrgenommenen Eigenschaften der Innovation, die von den Rezi-
pienten in der Überzeugungsphase des Adoptionsprozesses bewertet werden:
22
1. Relativer Vorteil (relative advantage)
Unter relativem Vorteil wird der Grad der Überlegenheit verstanden, über den die
Innovation gegenüber anderen, oft analogen Produkten oder Prozessen verfügt
und der häufig in wirtschaftlichen oder sozialen Kategorien ausgedrückt wird
(Rentabilität, Wirtschaftlichkeit, Verringerung der Verschmutzung und des Lärms
usw.).
2. Kompatibilität (compatibility)
Unter Kompatibilität wird der Grad der Übereinstimmung der Innovation mit dem
bestehenden Wertesystem, das durch kulturelle Normen des sozialen Systems
definiert wird, sowie mit früheren Erfahrungen und Bedürfnissen des Adoptors
verstanden.
3. Komplexität (complexity)
Die Komplexität einer Innovation spiegelt sich im Grad der Einfachheit und der
Leichtigkeit im Verstehen, der Anwendung oder der Anpassung an die Innovation
wider. Es wird vermutet, dass die Komplexität der Innovation mit der Adoption
negativ korreliert ist.
4. Erprobbarkeit (trialability)
Die Erprobbarkeit bedeutet die Möglichkeit, die Innovation in begrenzten Maß-
stäben testen bzw. nutzen zu können. Dieses Merkmal wird auch mit der Teilbar-
keit der Innovation in einzelne Phasen identifiziert.
5. Beobachtbarkeit (observability)
Die Beobachtbarkeit einer Innovation spiegelt sich im Grad wider, mit dem die
Ergebnisse und Folgen der Innovation von potentiellen Rezipienten erkannt und
bewertet werden können.
In einer ganzen Reihe von Forschungsarbeiten zu diesem Thema werden auch andere,
,,weniger offensichtliche" Charakteristika von Innovationen betrachtet, wie bspw. Kosten,
Rentabilität und soziale Vorteile. Es werden insgesamt mehr als dreißig verschiedene
22
Vgl. Kotler, 1996, Kap. 5; Rogers, 2003, S. 223, 229ff.
11
Merkmale in der wissenschaftlichen Literatur erwähnt, was verständlicherweise die Frage
nach Interdependenzen zwischen diesen Merkmalen aufwirft.
23
Ferner wird der Diffusionsprozess von der Leistungsfähigkeit der Kommunikationskanäle
und von den Interaktionen zwischen einzelnen Individuen bzw. Gruppen in einem sozialen
System und ihren Merkmalen wie dem demographischen Typ, Anzahl der Entscheidungs-
träger usw. beeinflusst sowie von solchen Rahmenbedingungen des Systems wie politisch-
rechtliche, wirtschaftliche, soziale und technische Umwelt.
24
Als potentielle Adoptoren in einem sozialen System können sowohl einzelne Individuen
als auch Gruppen von Individuen, bspw. Unternehmen oder andere Organisationen, auftre-
ten. Im letzteren Fall stellt die Adoption einer Neuerung eine Kollektiventscheidung dar und
kann als ,,ein Sonderfall der Beschaffung" (Fantapié Altobelli, 1991, S. 30) in einem Unter-
nehmen angesehen werden.
25
Bei der Betrachtung eines Unternehmens als Adoptionseinheit
treten bestimmte spezifische Faktoren in Erscheinung, die auf Diffusions- und Adoptions-
prozesse von Innovationen Einfluss haben. Diese können grob in zwei Kategorien unterteilt
werden: intraorganisationale bzw. unternehmensinterne und interorganisationale bzw. exter-
ne Einflussfaktoren. Zu der ersten Gruppe gehören bspw. solche Faktoren wie Unterneh-
mensgröße, Organisationsstruktur, die Erfolgslage des Unternehmens auf dem Markt: seine
Wachstumsrate, Profitabilität und Wettbewerbsposition, die erwartete Profitabilität der In-
novation, die adoptionsrelevante Ressourcenausstattung des Unternehmens: technologische
Ausstattung, finanzielle Ressourcen, qualifizierte Fach- und Arbeitskräfte sowie die Merk-
male des Entscheidungsträgers bzw. in Unternehmen häufiger der Entscheidungsträger und
der Organisationsmitglieder überhaupt: Informationsnachfrageverhalten, Risikobereitschaft,
Alter, Grad der Ausbildung bzw. Qualifikation, Motivationsstruktur, Rigidität, individuelles
Entscheidungsverhalten usw. Als unternehmensexterne Faktoren können solche Aspekte
genannt werden wie Größe und Struktur des Marktes, auf dem das Unternehmen agiert, die
Wettbewerbsintensität, das innovationsrelevante Informationsangebot, die Beziehungen zu
anderen Marktteilnehmern: Lieferanten, Abnehmer, anderen Wettbewerbern.
26
Dabei spie-
len insbesondere die oben genannten Rahmenbedingungen eines sozialen Systems eine
wichtige Rolle.
23
Vgl. Stepanov, 1983.
24
Vgl. Plotinskij, 2001, Kap. 9.1; Ivanjuk, 2002, Kap. 2.7.2.
25
Vgl. Kotzbauer, 1992, S. 33; Hecker, 1997, S. 49.
26
Eine detailliertere Darstellung der Einflussfaktoren findet sich bspw. bei Biehl, 1982; Kleine, 1983;
Fantapié Altobelli, 1991; Mahler, 2001.
12
2.2 Adoptionsentscheidung in weiteren Forschungsdisziplinen
Bisher wurde der Adoptionsentscheidungsprozess in der Diffusionstheorie betrachtet. Es
gibt jedoch auf anderen Forschungsgebieten ebenfalls Ansätze, die einen Entscheidungspro-
zess modellieren und Entscheidungsverhalten von Wirtschaftssubjekten zu erklären versu-
chen. Im Folgenden werden exemplarisch einige Forschungszweige kurz angesprochen, die
für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind.
Als das erste und wohl breiteste Forschungsgebiet ist an dieser Stelle die Entscheidungs-
theorie zu nennen. Die Entscheidungstheorie bedient sich eines Grundmodells, das die zwei
Basiselemente ,,Zielfunktion" und ,,Entscheidungsfeld" beinhaltet, wobei sich das Element
,,Entscheidungsfeld" aus Handlungsalternativen, Umweltumständen und Ergebnissen zu-
sammensetzt.
27
In der Entscheidungstheorie wurden verschiedenste Entscheidungsmodelle
entwickelt, die sich bezüglich der Elemente und Rahmenbedingungen der Entscheidung
unterscheiden.
28
Für die vorliegende Arbeit sind jedoch nur bestimmte Ansätze von Interes-
se, die im Hinblick auf Adoptionsentscheidungen eines Unternehmens im Investitionsgüter-
bereich zu selektieren sind. So kommen beispielsweise überwiegend Entscheidungen auf
der Gruppenebene und Entscheidungen unter Unsicherheit in diesem Zusammenhang in
Betracht.
Die Innovationsforschung beschäftigt sich ebenfalls mit der Diffusion und Adoption von
Neuerungen: ,,Innerhalb der Innovationsforschung hat sich die Analyse der Diffusion von
Innovationen zu einem eigenen Forschungsgebiet herauskristallisiert" (Bollmann, 1990, S.
10). Eine Darstellung der Diffusions- und Adoptionstheorien innerhalb der Innovationsfor-
schung findet sich z. B. bei Bierfelder (1989).
29
Im Rahmen des Industriegütermarketings wird im Zusammenhang mit Adoptionsent-
scheidungen vor allem das organisationale Beschaffungsverhalten bei Investitionsgütern
untersucht.
30
Als Investitionsgüter werden dabei solche langlebigen Güter bezeichnet, die
von Unternehmen zur Weiterverarbeitung oder zur Herstellung von Gütern gekauft werden,
ihre Nachfrager sind keine Letztkonsumenten (Privatverbraucher), sondern Organisationen
27
Vgl. Kahle, 2001, S. 39; Rommelfanger/Eickemeier, 2002, S. 12; Laux, 2003, S. 19f.
28
Zur Klassifikation von Entscheidungsmodellen vgl. bspw. Rommelfanger/Eickemeier, 2002, S. 25ff. Zu
Rahmenbedingungen und Elementen einer Entscheidung vgl. Bronner, 1999, S. 19ff.
29
Vgl. Bierfelder, 1989, S. 40ff.
30
Ansätze zur Beschreibung von organisationalem Beschaffungsverhalten sind bspw. bei Fitzgerald, 1989, S.
12ff.; Biller/Platzek/Werntges, 1990, S. 15ff.; Godefroid, 1995, S. 39ff.; Backhaus, 2003, S. 61ff. zu finden.
13
wie Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder öffentliche Institutionen.
31
Im Investitionsgütermarketing sind die Forschungsansätze zum organisationalen Beschaf-
fungsentscheidungsverhalten in zwei Kategorien zu unterteilen: In einer Forschungsrichtung
wurden Modelle entwickelt, die die ablaufenden Entscheidungsprozesse ausschließlich auf
der Abnehmerseite betrachten, d.h., es wird nur ein Unternehmen als Adoptor untersucht.
Die Vielzahl von Modellen kann dabei in Partial- und Totalmodelle unterschieden werden.
Die Ersteren beschäftigen sich einzeln mit solchen Aspekten wie den Phasen einer Beschaf-
fungsentscheidung, externen Einflussgrößen und Entscheidergruppe. Die Totalmodelle ver-
suchen dagegen die ganze Fülle von Einflussgrößen und Determinanten des Beschaffungs-
entscheidungsprozesses zu berücksichtigen. Zum anderen wurden Forschungsansätze entwi-
ckelt, die die Interaktionen zwischen den in einem Beschaffungsprozess beteiligten Perso-
nen und Unternehmen analysieren, d.h., es wird nicht nur ein Unternehmen als Adoptor be-
trachtet, sondern mehrere Unternehmen sowohl auf der Nachfrager- als auch auf der Anbie-
terseite und ihre wechselseitigen Beziehungen. Dabei kommt in der letzten Zeit den psycho-
logischen und soziologischen Aspekten in der Analyse immer größere Bedeutung zu, die
überwiegend im Rahmen der Psychologieforschung untersucht werden.
31
Vgl. Fitzgerald, 1989, S. 5f.
15
3 Entscheidungsmodelle in der wissenschaftlichen Forschung
In diesem Kapitel wird eine Reihe von Entscheidungsansätzen aus unterschiedlichen
Forschungsgebieten vorgestellt. Wie bereits erwähnt, befassen sich mehrere Disziplinen
seit Jahrzehnten mit den Fragen, wie eine Entscheidung zustande kommt, wie der Ablauf
eines Entscheidungsprozesses aussieht und welche Faktoren diesen Prozess und sein Er-
gebnis beeinflussen. Die Forschungskonzepte z. B. aus dem Fachbereich der Psychologie
stellen dabei das Individuum in den Vordergrund der Betrachtung und untersuchen vor
allem persönliche Merkmale des Entscheiders und ihren Einfluss auf der Gruppenebene.
Die Forschungsansätze anderer Fachrichtungen bedienen sich zum Teil dieser Erkenntnisse
und fügen den Entscheidungsmodellen weitere Konstrukte hinzu. So werden bspw. im
Rahmen des Industriegütermarketings außer Persönlichkeitsmerkmalen der Entscheidungs-
träger auch Merkmale der Organisation, die Beziehungen mit der Umwelt usw. untersucht.
Einige Forschungsarbeiten betrachten eine Vielzahl von Determinanten eines Entschei-
dungsprozesses, ohne diese zu schematisieren oder einem Modell unterzuordnen.
32
In der
vorliegenden Arbeit sollen solche Ansätze jedoch nicht weiter untersucht werden. Primär
von Interesse sind durchstrukturierte Konzepte, die zur Erklärung eines Prozesses der Ent-
scheidungsfindung herangezogen werden können.
Im Folgenden werden Entscheidungsansätze aus fünf Forschungsdisziplinen vorgestellt:
in Ergänzung zu Rogers (2003) einige weitere Modelle aus der Diffusionsforschung sowie
Ansätze aus der Psychologie, Innovationsforschung, Entscheidungstheorie und dem Indust-
riegütermarketing. Für den Rahmen dieser Arbeit wäre es unrealistisch, sämtliche existie-
renden Ansätze zur Erklärung eines Entscheidungsprozesses zu berücksichtigen, deshalb
beschränkt sich die Betrachtung auf die bekanntesten und in der Fachliteratur oft zitierten
Ansätze sowie auf solche, die für die Lösung der Problemstellung dieser Arbeit am geeig-
netsten erscheinen.
32
Vgl. bspw. Spiegel-Verlag, 1982; Simon, 1983; Keller, 1993.
16
3.1 Modelle aus dem Bereich der Diffusionsforschung
Modell des Adoptionsprozessverlaufs bei technologischen Innovationen nach Pohl
(1996)
In der Arbeit von Pohl wird ein Modell der Adoption technologischer Innovationen dar-
gestellt, das neben einem Phasenschema des Adoptionsprozesses auch dessen Determinan-
ten beinhaltet.
33
In seinen Ausführungen stützt sich der Verfasser vor allem auf die theore-
tischen Arbeiten vergangener Jahre aus dem Bereich der Diffusionsforschung. Sein Modell
erfährt jedoch eine Erweiterung, indem die Komponente des Leapfrogging-Verhaltens be-
rücksichtigt wird, die bisher in der Literatur nicht betrachtet wurde. Als Leapfrogging-
Behavior wird ,,das bewusste Überspringen der gegenwärtig am Markt verfügbaren neues-
ten Technologie und die Verschiebung der Adoptionsentscheidung auf eine in der Zukunft
erwartete Technologiegeneration" (Pohl, 1996, S. 83) bezeichnet.
34
Die von Pohl durchge-
führten empirischen Studien konnten die Notwendigkeit der Berücksichtigung dieser
Komponente bestätigen. In seinem Modell geht Pohl davon aus, dass die Höhe der Innova-
tionsbereitschaft, die Eintrittszeitpunkte in den Adoptionsprozess und die Länge des Adop-
tionsprozesses bei unterschiedlichen Nachfragern variieren und von den Determinanten des
Prozesses sowie vom Verlauf der Kommunikationskanäle und der Informationsnutzung
abhängig sind.
35
Der Adoptionsprozess in Pohls Modell besteht aus insgesamt fünf Phasen. Die ersten
drei Phasen Bewusstsein, Meinungsbildung und Entscheidung enden entweder mit der
Phase der Adoption oder mit der der gegenwärtigen Ablehnung.
36
Die Meinungsbildungsphase, die bei den technologischen Innovationen in der Regel ver-
hältnismäßig lang andauert, umfasst weitere drei Phasen: Interesse, Informationssuche und
Bewertung. Bevor es zu einer Entscheidung kommt, werden diese Phasen in der Regel
durchlaufen. Allerdings müssen sie nicht unbedingt in dieser Reihenfolge auftreten, es
können sogar einzelne Phasen übersprungen werden.
Entscheidet sich der Nachfrager zur Adoption der Innovation, so umfasst die darauf fol-
gende Adoptionsphase ebenfalls drei weitere Phasen: gegenwärtige Adoption, Implemen-
33
Vgl. Pohl, 1996, S. 57-89.
34
Vgl. auch Backhaus, 2003, S. 111ff.
35
Vgl. Pohl, 1996, S. 58.
36
Vgl. Pohl, 1996, S. 76.
17
tierung und Bestätigung. In der Bestätigungsphase ,,erfährt der Adopter die Eignung der
Innovation zur individuellen Problemlösung" (Pohl, 1996, S. 81). Entscheidet er sich ge-
gen die Adoption, so handelt es sich um eine gegenwärtige Ablehnung. Diese Entschei-
dung beinhaltet weitere Verhaltensoptionen/Möglichkeiten: Verschiebung der Adoptions-
entscheidung und fortgesetzte Ablehnung der Innovation. Im letzteren Fall wird der Adop-
tionsprozess bewusst abgebrochen, ohne Absicht der späteren Wiederaufnahme. Bei der
Verschiebung der Adoptionsentscheidung handelt es sich hingegen um eine vorübergehen-
de Unterbrechung des Adoptionsprozesses, wobei zwei Arten einer solchen Verschiebung
unterschieden werden: Leapfrogging-Behavior und vorläufige Zurückweisung.
Bei der vorläufigen Zurückweisung wird die Adoptionsentscheidung in die Zukunft ver-
schoben mit der Absicht, dieselbe Innovation zu einem späteren Zeitpunkt zu adoptieren.
Bei Leapfrogging-Behavior wird davon ausgegangen, dass neuere, gegenüber der gegen-
wärtigen Technologie verbesserte Technologie in der Zukunft auf den Markt kommt und
somit der Adoptionsentscheidungsprozess bezüglich der neuen Technologiegeneration zu
einem späteren Zeitpunkt wiederaufgenommen werden kann.
Neben den Phasen untersucht Pohl auch Determinanten eines Adoptionsprozesses. Dabei
unterscheidet er zwischen produkt-, adopter- und umweltbezogenen Determinanten.
Die umweltbezogenen Determinanten beziehen sich auf technologische, makroökonomi-
sche, politisch-rechtliche und soziokulturelle Umwelt eines Unternehmens. Durch diese
Determinanten werden ,,Rahmenbedingungen geschaffen, die sowohl kauffördernd als
auch kaufhemmend sein können" (Pohl, 1996, S. 70). Zu den relevanten Größen der tech-
nologischen Umwelt zählen bspw. Standards, die bestimmte Richtlinien zu der Größe,
Form, Leistung oder Art von Produkten oder Produktionssystemen vorgeben. Zu den mak-
roökonomischen Determinanten zählen volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen wie
bspw. die Höhe des disponiblen Einkommens, die diskretionären Einkommensteile, Wech-
selkurse, Zollvereinbarungen, tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Mit den poli-
tisch-rechtlichen Determinanten sind länderspezifische Gesetze und Verordnungen bei der
Produktgestaltung gemeint. Die Größen der soziokulturellen Umwelt beziehen sich auf
ebenfalls länderspezifisches Nachfragerverhalten.
Zu den produktbezogenen Determinanten eines Adoptionsprozesses zählen die ,,Größen,
deren Wahrnehmung primär durch das betreffende Produkt bzw. die Innovation beeinflusst
wird" (Pohl, 1996, S. 59). Pohl hebt insbesondere fünf Kriterien hervor, die in der Litera-
18
tur am meisten diskutiert werden und empirisch nachgewiesen werden konnten: relativer
Vorteil, Kompatibilität, Komplexität, Erprobbarkeit, Kommunizierbarkeit. Außerdem
nennt er noch die Kosten der Innovation, Teilbarkeit, Rentabilität, Beobachtbarkeit. Eine
besondere Bedeutung schreibt Pohl dem Kriterium des wahrgenommenen Risikos
zu
dem ,,Ausmaß, mit dem ein potentieller Adopter die Nichterreichung seiner Kaufziele be-
fürchtet" (Pohl, 1996, S. 60). Allerdings ist die Zuordnung dieses Kriteriums zu den pro-
duktbezogenen Determinanten nicht eindeutig, da die Persönlichkeitsmerkmale des Adop-
ters diese Größe ebenfalls beeinflussen.
Die adopterbezogenen Determinanten können in konsumenten- und unternehmensbezo-
gene Einflussgrößen untergliedert werden. Zu den konsumentenbezogenen Determinanten
zählen psychographische und sozioökonomische Merkmale des Adopters sowie die Grö-
ßen des beobachtbaren Kaufverhaltens. Im Folgenden werden diese Determinanten kurz
dargestellt:
37
Sozioökonomische Variablen
· Individualspezifische Größen: Geschlecht, Alter, Nationalität
· Soziale Schicht: Einkommen, Ausbildung, Berufsgruppen, Berufsausübung
· Familienlebenszyklus: Familienstand, Alter der Partner, Zahl und Alter der Kin-
der
· Geographische Kriterien: Wohnortgröße, Region/Gebiet, Bevölkerungsdichte
Psychographische Variablen
· Allgemeine Persönlichkeitsmerkmale: Lebensstil, Persönlichkeit
· Merkmale mit Bezug auf die Innovation: Wahrnehmungen, Motive, Einstellun-
gen, Erwartungen, Präferenzen, Kaufabsichten
Kriterien des beobachtbaren Kaufverhaltens
· Preisverhalten: Preiselastizität der Nachfrage/Berücksichtigung der Preisverfalls,
Preisklasse
· Produktwahl: Erfahrung mit der Produktkategorie vorhanden/nicht vorhanden,
Markentreue, Kaufhäufigkeit, Verwenderstatus, Verwendungsrate
· Mediennutzung: Zahl und Art der Medien, Nutzungsintensität
· Einkaufsstättenwahl: Art der Betriebsform, Geschäftstreue
37
Vgl. dazu Pohl, 1996, S. 66.
19
Zu den unternehmensbezogenen Determinanten gehören die organisationsspezifischen
Größen wie Organisationsstruktur, Unternehmensgröße, Branche, Standort, wirtschaftliche
Lage, Nationalität; ferner die Struktur des Buying-Centers: seine Größe, Zusammenset-
zung und die Informationsflüsse innerhalb des Centers. Anschließend sind noch Charakte-
ristika der Entscheidungsträger zu nennen: die bereits erwähnten sozioökonomischen, psy-
chographischen und kaufverhaltensbezogenen Kriterien sowie die Position im Unterneh-
men, berufliche Motivation und Risikobereitschaft.
Zusammenfassend wird das Modell von Pohl in der Abbildung 1 graphisch dargestellt.
Soziokulturelle Umwelt
M
akr
oö
ko
no
m
isc
he
Um
w
el
t
T
ec
hno
lo
gis
che
U
m
we
lt
Politisch-rechtliche Umwelt
· schwierige
Erprobbarkeit
· schwierige
Kommunizierbarkeit
maist:
· hoher relativer Vorteil
· geringe Kompatibilität
· hohe Komplexität
Wahrgenommene Produkteigenschaften
Kostenrisiko
Akzeptiertes Kostenrisiko
Leistungsrisiko
Akzeptiertes Leistungsrisiko
Wahrgenommenes Risiko
· organisationsspezifische
Größen
· Struktur des BC
· Charakteristika der
Entscheidungsträger
· sozioökonomische
· psychographische
· Kriterien des
beobachtbaren
Kaufverhaltens
Adopterbezogene Einflußfaktoren
Meinungsbildung
Adoption
Interesse
Informa-
tionssuche
Bewertung
Gegenw.
.Adoption
Inmplemen-
tierung
Bestätigung
Bewußtsein
Verfügbarkeit der
Neutechnologie
Entscheidung
Gegenwärtige Ablehnung
Verschiebung der
Adoptionsentscheidung
Vorläufige
Zurückweisung
Leapfrogging-
Behavior
Fortgesetzte Ablehnung
Zeit
Abbruch des
Adoptionsprozesses
Zeit
Meinungsbildung
Entscheidung
Bewußtsein
Adoption
Gegenwärtige Ablehnung
Verfügbarkeit der
Zukunftstechnologie
Abbildung 1: Verlauf des Adoptionsprozesses bei technologischen Innovationen
(Quelle: Pohl, 1996, S. 89)
20
Partialmodell zum risikoabhängigen Adoptionsverhalten bei technologischen Innova-
tionen von Pohl (1996)
In diesem Modell geht Pohl davon aus, dass die vom potentiellen Adopter wahrgenom-
mene Kaufunsicherheit eine der bedeutendsten Determinanten des Adoptionsprozesses dar-
stellt, daher wird das Adoptionsverhalten bei technologischen Innovationen aus der risiko-
theoretischen Perspektive mit besonderem Interesse analysiert.
38
Dabei versucht der Autor
,,in Abhängigkeit von der Risikowahrnehmung verschiedene Nachfragergruppen zu identifi-
zieren, die sich durch ähnliche Kaufverhaltensweisen kennzeichnen lassen" (Pohl, 1996, S.
119).
Das zu Beginn des Adoptionsprozesses wahrgenommene Risiko
39
wird als inhärentes Ri-
siko bezeichnet. Da der Adoptionsprozess bei technologischen Innovationen in der Regel
relativ lange dauert, gibt es mehr Möglichkeiten, das wahrgenommene Risiko und damit
auch das Adoptionsverhalten durch geeignete Risikoreduktionsstrategien zu beeinflussen,
als bei Konsumgütern. Es wird angenommen, dass durch diese Strategien auch Teile des
bisher nicht wahrgenommenen Risikos vom Nachfrager zur Kenntnis genommen werden
können, das Gesamtniveau des Residualrisikos wird in der Regel jedoch gesenkt.
40
Bei der
schematischen Darstellung wird das wahrgenommene Risiko in Form eines sich verschmä-
lernden Korridors gezeigt und als Risikokorridor bezeichnet.
41
Das wahrgenommene Resi-
dualrisiko beeinflusst den Adoptionszeitpunkt, indem es mit dem akzeptierten Risikoniveau,
d.h. mit dem subjektiv vertretbaren Niveau, verglichen wird. Dabei ist anzumerken, dass das
akzeptierte Risikoniveau im Laufe der Zeit ebenfalls variieren kann. Zu einer Adoptionsent-
scheidung kommt es nur in dem Fall, wenn das wahrgenommene Risiko kleiner bzw. gleich
dem akzeptierten Niveau ist. Dabei ist zu beachten, dass das wahrgenommene Risiko bei
technologischen Innovationen in ein Leistungsrisiko und ein Kostenrisiko differenziert wer-
den muss. Unter Leistungs- bzw. Kostenrisiko sind entsprechend negative technologie- und
nachfragerbezogene bzw. markt- und anbieterbezogene Kauffolgen zu verstehen. Das ak-
zeptierte Risikoniveau wird ebenfalls in akzeptiertes Leistungsrisiko und akzeptiertes Kos-
tenrisiko unterteilt. Bei technologischen Adoptionsentscheidungen ist diese Differenzierung
insoweit von Bedeutung, als die Adoption nur dann beschlossen wird, ,,wenn sowohl das
38
Vgl. Pohl, 1996, S. 119-178.
39
Zur Messung des wahrgenommenen Risikos bei der Adoption technologischer Innovationen vgl. Pohl,
1996, S. 136ff.
40
Vgl. dazu Pohl, 1996, S. 148ff.
41
Vgl. Pohl, 1996, Abb. 22, S. 149.
21
Kosten- als auch das Leistungsrisiko unterhalb der jeweiligen akzeptierten Niveaus liegen,
also als eher gering wahrgenommen werden" (Pohl, 1996, S. 158). Ferner erlaubt eine sol-
che Aufsplitterung die Entwicklung von Ansätzen zu unterschiedlich motivierten Verhal-
tensweisen von Adoptoren.
Das vorliegende Modell unterscheidet grob drei Phasen des Adoptionsprozesses: Be-
wusstsein, Meinungsbildung und Entscheidung. In der ersten Phase nimmt der potentielle
Käufer die technische Innovation zur Kenntnis. Das dabei wahrgenommene inhärente Risi-
ko ist in der Regel als relativ hoch einzustufen und liegt über dem akzeptablen Risikoni-
veau, sodass in dieser Phase noch keine Adoption stattfinden kann. In diesem Fall wird ver-
sucht, das wahrgenommene Risikoniveau anhand geeigneter Risikoreduktionsstrategien zu
senken, was dann während der Meinungsbildungsphase erfolgt. Als eine bewährte Strategie
zur Risikoreduktion hat sich die Informationssuche erwiesen, die sich vor allem auf die
Leistungseigenschaften der Innovation bezieht.
42
Das Ergebnis dieses Prozesses ist das Re-
sidualrisiko, das sowohl unter als auch über dem akzeptierten Risikoniveau liegen kann. Im
Falle, dass das wahrgenommene Residualrisiko kleiner als das akzeptierte ist, wird weiter-
hin geprüft, ob auch Leistungsrisiko und Kostenrisiko jeweils unter den akzeptierten Risi-
koniveaus liegen. Ist das bei beiden Teilrisiken der Fall, so kommt es zur Adoption. Die
Adoptionsentscheidung vollzieht sich in der dritten Phase und stellt eine endgültige Ent-
scheidung dar.
Werden dagegen beide Risiken oder eines der Teilrisiken als zu hoch empfunden, so stellt
sich die Frage nach weiterer Risikoreduktion, da in diesem Fall keine Adoption zustande
kommt. Zu beachten ist dabei die Tatsache, dass eine weitere Informationssuche hohe Kos-
ten verursachen kann, also kann diese Frage unter Umständen negativ beantwortet werden.
In diesem Fall kommt es zu einer Zwischenentscheidung. ,,Die Art der Zwischenentschei-
dung orientiert sich daran, welches Teilrisiko als eher hoch und welches als eher gering
wahrgenommen wird" (Pohl, 1996, S. 173). Übersteigt hingegen der Nutzen der Risikore-
duktion die Kosten für den Nachfrager, so werden weiterführende Informationen zur Inno-
vation z.B. in Form von Erfahrungsberichten bisheriger Adoptoren gesammelt. Am Ende
der Informationssuchphase wird erneut ein Vergleich zwischen dem verbliebenen Residual-
risiko und dem akzeptierten Risikoniveau vorgenommen. Wird immer noch ein Teilrisiko
42
Vgl. Pohl, 1996, S. 171.
22
als zu hoch empfunden und eine weitere Informationssuche aus Kostengründen abgelehnt,
so kommt es zur abwartenden Zwischenentscheidung.
Anhand dieser Überlegungen versucht Pohl eine Segmentierung von potentiellen Käufern
einer technologischen Innovation vorzunehmen.
43
Von entscheidender Bedeutung sind da-
bei zum einen die zweidimensionale Betrachtungsweise des wahrgenommenen Risikos, die
Unterscheidung in Kosten- und Leistungsrisiko, und zum anderen die Berücksichtigung des
gesamten Adoptionsprozesses, ,,da sich zum Analysezeitpunkt nicht alle Nachfrager not-
wendigerweise in der Entscheidungsphase befinden" (Pohl, 1996, S. 174). Diese Betrach-
tungsweise ermöglicht nicht nur eine Unterscheidung zwischen Adoptoren und Nicht-
Adoptoren, sondern auch zwischen verschiedenen Typen von Nicht-Adoptoren.
Demnach werden die potentiellen Adoptoren, bei denen die beiden Teilrisiken oberhalb
des Akzeptanzniveaus liegen, zur weiteren Informationssuche zwecks Risikoabbaus ange-
regt. Das liegt an ihrer Bestrebung die kognitiven Dissonanzen zu beseitigen, die infolge
von Unstimmigkeiten ,,zwischen ihren subjektiven Erwartungen und den abschätzbaren
Folgen der Adoptionsentscheidung" (Pohl, 1996, S. 175) entstehen. Solche Nachfrager wer-
den als Informationssucher bezeichnet. Die potentiellen Adoptoren, die das Kostenrisiko als
hoch und das Leistungsrisiko als eher gering empfinden, sind in der Regel mit der Leis-
tungsfähigkeit der technologischen Innovation zufrieden und besitzen genügend Informatio-
nen dazu. Jedoch lehnen sie die Adoption vorläufig ab, weil ihnen das Preisniveau der Inno-
vation, ihre Implementierungs- oder Folgekosten zu hoch erscheinen. In diesem Fall wird
die Adoption zwar beabsichtigt, aber vorerst in die Zukunft verlegt. Solche Nachfrager wer-
den als Kostenreagierer bezeichnet. Der dritte Typ von Nicht-Adoptoren ist durch seine
stark ausgeprägte Leistungsorientierung und eher geringe Preissensibilität charakterisiert.
Das Kostenrisiko nimmt er als gering wahr, mit den Leistungen der technologischen Inno-
vation ist er dagegen nicht zufrieden. Die Ablehnung der Adoption bedeutet in diesem Fall,
dass der Nachfrager auf weitere, verbesserte Technologiegenerationen wartet, was dem
Leapfrogging-Behavior entspricht. Zusammenfassend wird das Modell in der Abbildung 2
dargestellt.
Es ist ersichtlich, dass bei Leapfroggern und Kostenreagierern die Informationssuche zu
einer Zwischenentscheidung geführt hat, nämlich dem Warten auf weitere Technologiege-
nerationen bzw. auf Preissenkungen. Der Informationssucher hat hingegen ,,noch keine
43
Vgl. Pohl, 1996, S. 174ff.
23
endgültige Handlungsentscheidung getroffen" (Pohl, 1996, S. 178), so wird er mit der Zeit
seine Position ändern und zu anderen Segmenten wandern. Das Verhalten aller drei Typen
von Nicht-Adoptoren ist dadurch determiniert, dass die Nachfrage-Dringlichkeit als gering
empfunden wird, es liegt also keine Notwendigkeit der sofortigen Innovationsadoption vor,
was das Hinauszögern der Entscheidung ermöglicht.
Dieses Partialmodell basiert auf der Theorie des wahrgenommenen Risikos,
44
die bereits
mehrfachen empirischen Untersuchungen unterzogen wurde. Die auf dieser Grundlage
durchgeführte hypothetische Nachfragersegmentierung und die dazugehörenden Hypothe-
sen zum Nachfragerverhalten konnten von Pohl ebenfalls durch empirische Studien bestä-
tigt werden.
45
44
Vgl. Pohl, 1996, S. 120ff.
45
Zu empirischen Untersuchungen vgl. Pohl, 1996, S. 203ff.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836602235
- Dateigröße
- 641 KB
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 3,0
- Schlagworte
- innovationsforschung investitionsgüter innovationsökonomie diffusion adoptionsforschung produktionswirtschaft
- Produktsicherheit
- Diplom.de