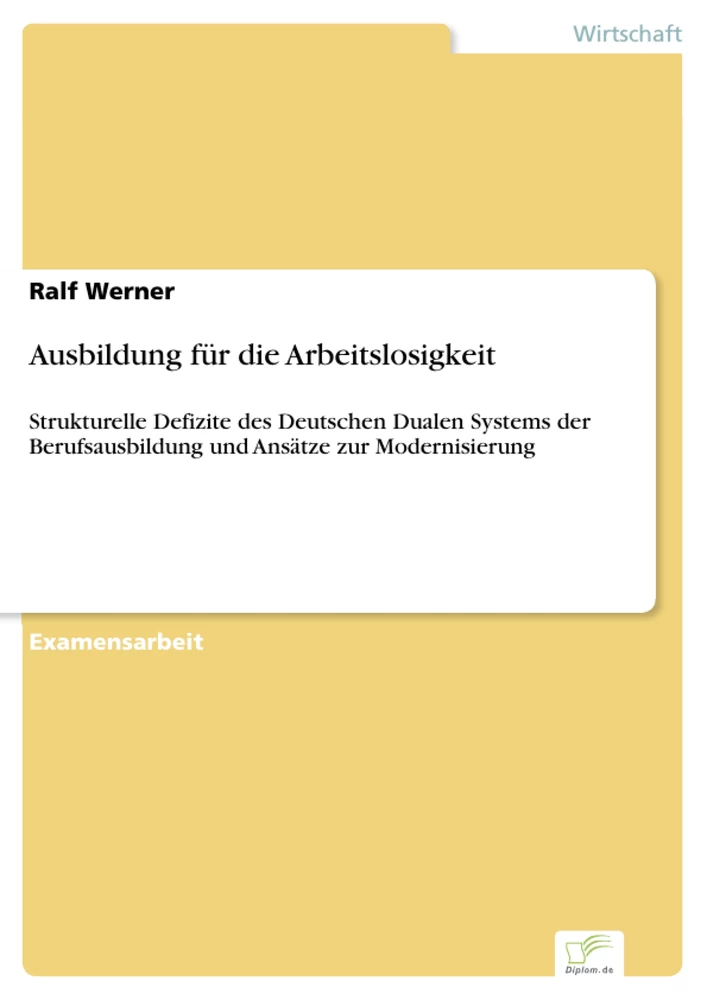Ausbildung für die Arbeitslosigkeit
Strukturelle Defizite des Deutschen Dualen Systems der Berufsausbildung und Ansätze zur Modernisierung
©2006
Examensarbeit
83 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Seit den frühen 70er Jahren lässt sich in den meisten OECD-Staaten ein Anstieg der Arbeitslosigkeit erkennen. Die Kontinuität und Dauer dieser Arbeitsmarktentwicklung verursacht auch in Deutschland wachsende individuelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme. Für die meisten Menschen hat der Verlust ihres Arbeitsplatzes eine Verminderung ihres Lebensstandards und psychische Probleme zur Folge. Eine hohe Arbeitslosigkeit hat destabilisierende Auswirkungen auf die Gesellschaft. Ökonomisch betrachtet stellt sie eine grobe Verzerrung der Allokation von Ressourcen dar. Während einerseits ein großer Teil des Produktionsfaktors Arbeit ungenutzt bleibt und damit das tatsächliche Volkseinkommen hinter dem Möglichen zurückbleibt, werden andererseits die sozialen Sicherungssysteme erheblich belastet.
Die Arbeitsmarktentwicklung ist verbunden mit einem tief greifenden Strukturwandel der Wirtschaft, der zu einer deutlichen Verlagerung der Beschäftigungsentwicklung führt. Während die Zahl der Erwerbstätigen in produzierenden Tätigkeitsfeldern sinkt, steigt sie in tertiären Tätigkeitsfeldern kontinuierlich an. Dual ausgebildete Fachkräfte sind von dieser Entwicklung besonders betroffen. Aufgrund ihrer Ausbildung gelingt ihnen zwar ein vergleichsweise reibungsloser Übergang von der Schule in das Berufsleben. Diesem stehen aber wachsende Arbeitslosigkeitsrisiken in späteren Lebensjahren gegenüber. Das begründet die Vermutung, dass es den Absolventen dieses Bildungsweges weniger gut gelingt, sich den rasch wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarktes genügend anzupassen.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die beobachtbare Arbeitsmarktentwicklung theoretisch fundiert und in Übereinstimmung mit den stilisierten Fakten zu erklären. Insbesondere geht es darum, den Wirkungszusammenhang zwischen dem strukturellen Wandel der Wirtschaft und der qualifikatorischen Beschäftigungsentwicklung auszuleuchten, um auf Grundlage dieser Analyse Ansätze zur Modernisierung des Dualen Systems der Berufsausbildung aufzuzeigen.
Gang der Untersuchung:
Um diesen Themenkomplex näher zu untersuchen, werden im Kapitel 2 zunächst die stilisierten aggregierten Merkmale der Arbeitsmarktentwicklung dargestellt. Durch den internationalen Vergleich der empirischen Fakten kann herausgestellt werden, dass eine allgemeine Entwicklung der Arbeitslosigkeit betrachtet wird. Für das Verständnis der zugrunde liegenden Prozesse werden anschließend die strukturellen […]
Seit den frühen 70er Jahren lässt sich in den meisten OECD-Staaten ein Anstieg der Arbeitslosigkeit erkennen. Die Kontinuität und Dauer dieser Arbeitsmarktentwicklung verursacht auch in Deutschland wachsende individuelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme. Für die meisten Menschen hat der Verlust ihres Arbeitsplatzes eine Verminderung ihres Lebensstandards und psychische Probleme zur Folge. Eine hohe Arbeitslosigkeit hat destabilisierende Auswirkungen auf die Gesellschaft. Ökonomisch betrachtet stellt sie eine grobe Verzerrung der Allokation von Ressourcen dar. Während einerseits ein großer Teil des Produktionsfaktors Arbeit ungenutzt bleibt und damit das tatsächliche Volkseinkommen hinter dem Möglichen zurückbleibt, werden andererseits die sozialen Sicherungssysteme erheblich belastet.
Die Arbeitsmarktentwicklung ist verbunden mit einem tief greifenden Strukturwandel der Wirtschaft, der zu einer deutlichen Verlagerung der Beschäftigungsentwicklung führt. Während die Zahl der Erwerbstätigen in produzierenden Tätigkeitsfeldern sinkt, steigt sie in tertiären Tätigkeitsfeldern kontinuierlich an. Dual ausgebildete Fachkräfte sind von dieser Entwicklung besonders betroffen. Aufgrund ihrer Ausbildung gelingt ihnen zwar ein vergleichsweise reibungsloser Übergang von der Schule in das Berufsleben. Diesem stehen aber wachsende Arbeitslosigkeitsrisiken in späteren Lebensjahren gegenüber. Das begründet die Vermutung, dass es den Absolventen dieses Bildungsweges weniger gut gelingt, sich den rasch wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarktes genügend anzupassen.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die beobachtbare Arbeitsmarktentwicklung theoretisch fundiert und in Übereinstimmung mit den stilisierten Fakten zu erklären. Insbesondere geht es darum, den Wirkungszusammenhang zwischen dem strukturellen Wandel der Wirtschaft und der qualifikatorischen Beschäftigungsentwicklung auszuleuchten, um auf Grundlage dieser Analyse Ansätze zur Modernisierung des Dualen Systems der Berufsausbildung aufzuzeigen.
Gang der Untersuchung:
Um diesen Themenkomplex näher zu untersuchen, werden im Kapitel 2 zunächst die stilisierten aggregierten Merkmale der Arbeitsmarktentwicklung dargestellt. Durch den internationalen Vergleich der empirischen Fakten kann herausgestellt werden, dass eine allgemeine Entwicklung der Arbeitslosigkeit betrachtet wird. Für das Verständnis der zugrunde liegenden Prozesse werden anschließend die strukturellen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Ralf Werner
Ausbildung für die Arbeitslosigkeit
Strukturelle Defizite des Deutschen Dualen Systems der Berufsausbildung und Ansätze
zur Modernisierung
ISBN: 978-3-8366-0213-6
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Universität Paderborn, Paderborn, Deutschland, Staatsexamensarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
Ralf Werner, Diplom-Jurist (Universität Münster), Studium der Rechtswissenschaften, Wirt-
schaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften an den Universitäten Münster, Zürich,
Nijmegen, Dortmund und Paderborn. Derzeit tätig als Studienreferendar im Bereich des Be-
rufsbildenden Schulwesens.
I
Inhaltsverzeichnis:
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS:... IV
ABBILDUNGSVERZEICHNIS: ... V
TABELLENVERZEICHNIS: ... VI
0
ZUSAMMENFASSUNG...1
1
EINFÜHRUNG...2
1.1 P
ROBLEMSTELLUNG UND
Z
IELSETZUNG
...2
1.2 A
UFBAU DER
A
RBEIT
...3
2
STILISIERTE EMPIRISCHE FAKTEN DER ARBEITSLOSIGKEIT...4
2.1 M
ERKMALE DER AGGREGIERTEN
A
RBEITSMARKTENTWICKLUNG
...4
2.1.1
Anstieg der aggregierten Arbeitslosigkeit ...4
2.1.2
Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit ...5
2.1.3
Verlagerung der Beveridge-Kurve ...7
2.2 S
TRUKTURELLE
M
ERKMALE DER
A
RBEITSMARKTENTWICKLUNG
...8
2.2.1
Relativ geringe Jugendarbeitslosigkeit ...8
2.2.2
Entwicklung der relativen Bildungsbeteiligung ...9
2.2.3
Relativ hohes Arbeitslosigkeitsrisiko in späteren Lebensjahren ...10
2.2.4
Geringe relative Weiterbildungsbereitschaft ...11
2.2.5
Beschäftigungsentwicklung nach Sektoren...12
2.2.6
Beschäftigungsentwicklung nach Tätigkeitsgruppen...14
2.3 Z
USAMMENFASSUNG
...15
3
ERKLÄRUNGSANSÄTZE ZUR ARBEITSLOSIGKEIT ...16
3.1 E
IN
Ü
BERBLICK
...16
3.2 H
YSTERESE
...19
3.2.1
Zentrale Annahmen und Hypothesen...19
3.2.2
Empirische Evidenz und Kritik...20
3.3 I
NSIDER
-O
UTSIDER
-M
ODELLE
...21
3.3.1
Zentrale Annahmen und Hypothesen...21
3.3.2
Empirische Evidenz und Kritik...21
3.4 T
HE
F
LOW
A
PPROACH TO
L
ABOUR
M
ARKETS
...23
II
3.4.1
Zentrale Annahmen und Konzept... 23
3.4.2
Ein einfaches Modell... 23
3.4.3
Die Beveridgekurve... 26
3.4.4
Empirische Evidenz... 27
3.5 Z
USAMMENFASSUNG
... 29
4
STRUKTURWANDEL DER WIRTSCHAFT... 30
4.1 G
RUNDLINIEN UND
D
ETERMINANTEN DER
T
ERTIARISIERUNG
... 30
4.1.1
Produktivitäts-Bias und Nachfrage-Bias ... 30
4.1.2
Strukturveränderungen auf der Angebotsseite... 31
4.1.3
Strukturveränderungen auf der Nachfrageseite... 33
4.1.4
Globalisierung von Märkten und Unternehmensstrukturen ... 34
4.1.5
Strukturveränderungen in der Arbeitsnachfrage ... 36
4.2 I
NNOVATIONSPOTENTIALE DER
T
ERTIARISIERUNG
... 36
4.2.1
Veränderungen in der Unternehmensorganisation... 37
4.2.2
Veränderung der Arbeitsverhältnisse und -organisation... 38
4.2.3
Veränderung der globalen Marktstrukturen... 38
4.2.4
Veränderung der Qualifikationsanforderungen... 40
4.3 B
ESCHÄFTIGUNGSPOTENTIALE DER
T
ERTIARISIERUNG
... 41
4.3.1
Projektionen des Arbeitskräftebedarfs... 41
4.3.2
Qualifikationsdefizite in dienstleistungsintensiven Branchen ... 42
4.3.3
Qualifikationsdefizite in IuK-Technologie intensiven Branchen ... 44
4.3.4
Anforderungen an die Flexibilität des Arbeitsmarktes ... 45
4.3.5
Sektorale bzw. qualifikatorische Mobilität und Lohndifferenzierung... 48
4.3.6
Bildung von Humankapital für Beschäftigung und Wachstum ... 49
4.4 Z
USAMMENFASSUNG
... 49
5
MODERNISIERUNG DER DUALEN BERUFSAUSBILDUNG... 50
5.1 E
IN
Ü
BERBLICK
... 50
5.2 A
KTUALISIERUNG UND
F
LEXIBILISIERUNG DER
B
ERUFSAUSBILDUNG
... 51
5.2.1
Früherkennung von Qualifikationsprofilen ... 51
5.2.2
Modularisierung der Berufsausbildung... 52
5.3 K
OMPETENZEN UND IHRE
F
ÖRDERUNG IM
L
ERNFELDKONZEPT
... 54
5.3.1
Der Kompetenzbegriff in der Deutschen Wirtschaftspädagogik... 54
5.3.2
Handlungsorientierung als didaktisch methodisches Konzept ... 56
III
5.3.3
Lernen in komplexen Lehr-Lernarrangements...57
5.3.4
Das Lernfeldkonzept als curricularer Modernisierungsansatz...58
5.4 Z
USAMMENFASSUNG
...59
6
SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK ...60
ANHANGVERZEICHNIS ...61
LITERATURVERZEICHNIS ...65
IV
Abkürzungsverzeichnis
BBIB
Bundesinstitut für Berufsbildung
BLBS
Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen
BMBF
Bundesministerium für Bildung und Forschung
EU
Europäische
Union
et al.
et alteri, und andere
f.
folgende
ff.
fortfolgende
FreQueNz
Früherkennung von Qualifikationserfordernissen
IAB
Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
IfAS
Institut
für
Angewandte Sozialforschung
ILO
International Labour Organisation
IMS
Institute of Manpower Studies
ISB
Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung
IZA
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit
KMK
Kultusministerkonferenz
MIT
Massachusetts Institute of Technology
NAIRU
Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development
Vgl.
Vergleiche
ZEW
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
V
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Standardisierte Arbeitslosenquoten ausgewählter OECD-Staaten, 1970-2004...5
Abb. 2: Anteil der Langzeitarbeitslosen ausgewählter OECD-Staaten, 1981-2004...6
Abb. 3: Beveridgekurven ausgewählter OECD-Staaten, 1980-2001...7
Abb 4: Jugendarbeitslosigkeit im Ländervergleich, 2003, USA 1960-2003...8
Abb. 5: Entwicklung der relativen Bildungsbeteiligung, 1992-2005...9
Abb. 6: Beschäftigungsentwicklung nach Sektoren ausgewählter OECD-Staaten, 1970-
2003...13
Abb. 7: Beschäftigungsentwicklung nach Tätigkeitsgruppen, 1995-2010...14
Abb. 8: Modell der Beveridgekurve und der Stellenangebotskurve...25
.
Abb. 9: Beveridge-Kurve, Deutschland, 1970-2000...27
Abb. 10: Szenarien zur Entwicklung des Erwerbspersonenpotentials 1900-2050...41
Abb. 11: Entwicklung von Beschäftigung und Ausbildung nach Wirtschaftsektoren
1980-2002...42
Abb. 12: Arbeitsmarkteffekte der Tertiarisierung...46
Abb. 13: Perspektivenmodell zur Kompetenzentwicklung...55
Abb. 14: Struktur eines Lernfeldes, Automobilkaufmann/-kauffrau...58
VI
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Wertetabelle zu Abbildung 1... 61
Tab. 2: Wertetabelle zu Abbildung 2...62
Tab. 3: Zuwachsraten unterschiedlicher Produktivitätsgrößen...64
1
0
Zusammenfassung
In Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten die qualifikationsspezifische Struktur der
Arbeitsnachfrage verschoben. Diese Beobachtung ist auf die Tertiarisierung der Wirtschaft
zurückzuführen. Der Strukturwandel zugunsten der Dienstleistung wird im Wesentlichen
durch das Zusammenwirken eines Produktivitäts-Bias und eines Nachfrage-Bias erklärt, ist
aber auch mit Globalisierungstendenzen und neuen Technologien verbunden. Damit stellt sich
die Frage, ob in Deutschland überhaupt noch adäquat ausbildet wird. Im Bereich der Dualen
Berufsausbildung sind erhebliche Modernisierungsdefizite erkennbar. Diese liegen zum einen
in einem Mangel an modernen Berufsbildern und zum anderen in veralteten Inhalten. Zudem
erweisen sich dual ausgebildete Fachkräfte mit ihrem hohen Anteil spezifischen Wissens als
nicht hinreichend mobil, um dem Strukturwandel am Arbeitsmarkt gewachsen zu sein. Die
Folgen sind Mismatch und ein frühzeitiges Ausscheiden aus der Arbeitswelt.
2
1
Einführung
1.1
Problemstellung und Zielsetzung
Seit den frühen 70er Jahren lässt sich in den meisten OECD-Staaten ein Anstieg der Arbeits-
losigkeit erkennen. Die Kontinuität und Dauer dieser Arbeitsmarktentwicklung verursacht
auch in Deutschland wachsende individuelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme.
Für die meisten Menschen hat der Verlust ihres Arbeitsplatzes eine Verminderung ihres Le-
bensstandards und psychische Probleme zur Folge. Eine hohe Arbeitslosigkeit hat destabili-
sierende Auswirkungen auf die Gesellschaft. Ökonomisch betrachtet stellt sie eine grobe Ver-
zerrung der Allokation von Ressourcen dar. Während einerseits ein großer Teil des Produkti-
onsfaktors Arbeit ungenutzt bleibt und damit das tatsächliche Volkseinkommen hinter dem
Möglichen zurückbleibt, werden andererseits die sozialen Sicherungssysteme erheblich be-
lastet.
1
Die Arbeitsmarktentwicklung ist verbunden mit einem tief greifenden Strukturwandel der
Wirtschaft, der zu einer deutlichen Verlagerung der Beschäftigungsentwicklung führt. Wäh-
rend die Zahl der Erwerbstätigen in produzierenden Tätigkeitsfeldern sinkt, steigt sie in tertiä-
ren Tätigkeitsfeldern kontinuierlich an. Dual ausgebildete Fachkräfte sind von dieser Ent-
wicklung besonders betroffen. Aufgrund ihrer Ausbildung gelingt ihnen zwar ein vergleichs-
weise reibungsloser Übergang von der Schule in das Berufsleben. Diesem stehen aber wach-
sende Arbeitslosigkeitsrisiken in späteren Lebensjahren gegenüber. Das begründet die Ver-
mutung, dass es den Absolventen dieses Bildungsweges weniger gut gelingt, sich den rasch
wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarktes genügend anzupassen.
2
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die beobachtbare Arbeitsmarktentwicklung theoretisch fundiert
und in Übereinstimmung mit den stilisierten Fakten zu erklären. Insbesondere geht es darum,
den Wirkungszusammenhang zwischen dem strukturellen Wandel der Wirtschaft und der qua-
lifikatorischen Beschäftigungsentwicklung auszuleuchten, um auf Grundlage dieser Analyse
Ansätze zur Modernisierung des Dualen Systems der Berufsausbildung aufzuzeigen.
1
Vgl. auch Fehn (1997), S. 17.
2
Vgl. auch OECD (2005a), S. 5.
3
1.2
Aufbau der Arbeit
Um diesen Themenkomplex näher zu untersuchen, werden im Kapitel 2 zunächst die stilisier-
ten aggregierten Merkmale der Arbeitsmarktentwicklung dargestellt. Durch den internationa-
len Vergleich der empirischen Fakten kann herausgestellt werden, dass eine allgemeine Ent-
wicklung der Arbeitslosigkeit betrachtet wird. Für das Verständnis der zugrunde liegenden
Prozesse werden anschließend die strukturellen Merkmale dieser Veränderungen dargestellt.
Das dritte Kapitel beginnt mit einem kurzen Überblick zu den Arbeitsmarkttheorien, die ge-
eignet erscheinen die empirischen Fakten zu erklären. Es folgt eine vertiefende theoretische
und empirische Diskussion dieser Erklärungsansätze. Dabei wird neben der ,,Hysterese-
Hypothese" und den ,,Insider-Outsider-Modellen" auf den ,,Flow Approach to Labormarkets"
eingegangen, da der ,,Mismatch-Hypothese" erhebliche Bedeutung zukommt.
Das zunehmende Nebeneinander von offenen Stellen und Arbeitslosigkeit ist mit dem Struk-
turwandel der Wirtschaft verbunden, der in Kapitel 4 erläutert wird. Hier wird die Verlage-
rung der qualifikatorischen Struktur der Arbeitsnachfrage vor dem Hintergrund der Tertiari-
sierung der Wirtschaft beschrieben. Im Vergleich zu dem schrumpfenden Bereich der Produk-
tion erfordern die expandierenden tertiären Tätigkeitsbereiche andere und höhere Qualifikati-
onen von den Beschäftigten. Das qualifikatorische und berufsbedingte Ungleichgewicht am
Arbeitsmarkt wird in erheblichem Umfang durch das
Ausbildungssystem verursacht, welches
die Fachkräfte nur unzureichend auf die sich ändernden Anforderungen vorbereitet.
Welche Ansätze zur Modernisierung für das von rund 60 Prozent aller Schulabgänger nachge-
fragte Duale Berufsausbildungssystem in Betracht kommen, soll in Kapitel 5 diskutiert wer-
den. Dabei erfolgt eine Konzentration auf drei Forschungsrichtungen. Zunächst wird die
Früherkennungsforschung thematisiert. Sie versucht Veränderungen des künftigen Qualifika-
tionsbedarfs vorherzusagen, um die berufliche Bildung zu aktualisieren. Das Potenzial der
diskutierten Modularisierungskonzepte liegt in der Flexibilisierung, Differenzierung und Indi-
vidualisierung des Ausbildungssystems. Den Befürwortern des Lernfeldkonzeptes geht es
schließlich um eine kompetenzbasierte Wende, da die traditionellen Qualifikationen nicht ge-
eignet erscheinen, um sich in der Dynamik des Wandels zurechtzufinden.
4
2
Stilisierte empirische Fakten der Arbeitslosigkeit
Die Arbeitsmärkte der meisten OECD-Staaten sind seit den frühen 70er Jahren einem drama-
tischen Wandel unterworfen. Diese Entwicklung wird zunächst anhand aggregierter Merkma-
le des Arbeitsmarktes beschrieben. Der internationale Vergleich mit den führenden Industrie-
ländern USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Japan verdeutlicht, dass keine
spezielle, sondern vielmehr eine allgemeine Entwicklung der Arbeitslosigkeit analysiert wird.
Da sich hinter diesen aggregierten Verlaufsmustern deutliche Strukturveränderungen verber-
gen, folgt anschließend eine Darstellung der strukturellen Merkmale der Arbeitsmarktent-
wicklung. Insbesondere für das Verständnis des Zusammenhangs zwischen der Tertiarisie-
rung der Wirtschaft und den Beschäftigungsaussichten von dual ausgebildeten Fachkräften er-
scheint dies sinnvoll. Es zeigt sich bereits hier, dass das Problem der Arbeitslosigkeit in ver-
schiedenen Qualifikationsgruppen von unterschiedlicher Bedeutung ist und dass der Struk-
turwandel der Wirtschaft auf den Arbeitsmärkten eine permanente Veränderung der Arbeits-
nachfrage bewirkt.
2.1
Merkmale der aggregierten Arbeitsmarktentwicklung
2.1.1
Anstieg der aggregierten Arbeitslosigkeit
Seit den frühen 70er Jahren weisen die Arbeitsmärkte nahezu aller OECD-Staaten einen an-
haltenden Anstieg der aggregierten Arbeitslosigkeit auf (vgl. Abb. 1). Eine besonders deutli-
che Zunahme der Unterbeschäftigung ist in den großen europäischen OECD-Staaten zu er-
kennen. In Deutschland ist die Arbeitslosigkeit über alle Konjunkturzyklen hinweg treppenar-
tig gestiegen. Während sie im Jahr 1970 lediglich 0,6 Prozent betrug, wuchs sie bis zum Jahr
2004 auf 9,8 Prozent. In Frankreich ist eine ähnliche Entwicklung von 1,7 Prozent auf 9,9
Prozent erkennbar. Insbesondere Großbritannien, und außerhalb Europas die USA bilden hier
eine Ausnahme. Nach einem zunächst starken Anstieg sind ihre Arbeitslosenquoten nunmehr
rückläufig. Selbst Japan, das lange Zeit durch eine vergleichsweise niedrige Arbeitslosenquo-
te auffiel, ist mit einer zunehmenden Arbeitslosigkeit konfrontiert.(Vgl. auch Jungblut 1998,
S. 8)
5
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
France
Germany
Japan
United Kingdom
United States
OECD countries
Abbildung 1: Standardisierte Arbeitslosenquoten ausgewählter OECD-Staaten, 1970-2004.
3
Quelle: Eigene Darstellung; Werte, OECD (2006) Labour Market Statistics Indikators; 1970-1983 Uni-
ted Kingdom, OECD (2001) Historical Statistics 1970-2000; Wertetabelle im Anhang 1.
2.1.2
Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit
Ein weiteres Kennzeichen der Arbeitsmarktentwicklung vieler OECD-Staaten ist der erhebli-
che Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. In Deutschland hat sich der Anteil der Arbeitslosen,
die als langzeitarbeitslos eingestuft werden, weil sie ein Jahr oder länger ohne Beschäftigung
waren, mehr als verfünffacht: Während ihr Anteil 1970 lediglich 8,8 Prozent betrug, waren es
2004 bereits 51,8 Prozent. In Großbritannien ist der Anteil der Arbeitslosen von etwa 10 Pro-
zent auf gegenwärtig 21,4 Prozent gestiegen. In Frankreich hat sich die Langzeitarbeitslosig-
keit in diesem Zeitraum ebenfalls verdoppelt. (Vgl. OECD 2005b, S. 46 f.; Jungblut 1998, S.
10 m.w.N.)
3
Anmerkungen: Int. vergleichbare Angaben in Prozent gem. ILO. Ab 1991 Werte für Gesamtdeutschland.
6
0
10
20
30
40
50
60
198
1
19
82
19
83
1984 198
5
198
6
19
87
19
88
1989 1990 199
1
19
92
19
93
1994 1995 199
6
19
97
19
98
1999 2000 200
1
20
02
20
03
2004
France
Germany
Japan
United Kingdom
United States
Abbildung 2: Anteil der Langzeitarbeitslosen ausgewählter OECD-Staaten, 1981-2004.
4
Quelle: Eigene Darstellung; Werte, OECD (2005d)Labour Force Statistics 1984-2004, S. 46 f.; 1981-1983,
Wertetabellen aller OECD-Staaten im Anhang 2.
Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit ausgewählter OECD Staaten
von 1981 bis 2004. Der Ländervergleich zeigt, dass Deutschland über die letzten zweieinhalb
Dekaden durch einen besonders hohen Anteil auffällt. Auch Frankreich weist mit einem Mit-
telwert von rund 40 Prozent eine besonders hohe Langzeitarbeitslosigkeit auf. Demgegenüber
ist ihr Anteil in den USA mit rund 10 Prozent vergleichsweise gering. Die Entwicklung in
England deutet eine mögliche Trendwende an, da der Anteil der Langezeitarbeitslosen nach
einem kräftigen Anstieg nunmehr rückläufig ist. Demgegenüber zeigt sich ihr Anstieg in Ja-
pan besonders in der letzten Dekade.
4
Anmerkungen: Prozentualer Anteil der Langzeitarbeitslosen an den Arbeitslosen insgesamt. Langzeitarbeitslo-
sigkeit ist definiert als Arbeitslosigkeit mit einer Dauer von einem Jahr oder länger.
7
2.1.3
Verlagerung der Beveridge-Kurve
Ein weiteres Kennzeichen der Arbeitsmarktentwicklung vieler OECD-Staaten ist die deutliche
Verlagerung der Beveridge-Kurve. Mit Ausnahme von Schweden und Norwegen kam es für
die meisten OECD-Staaten zu einer Rechtsverschiebung der Beveridge-Kurve im Verlauf der
60er bis 80er Jahre. Von diesem Zeitpunkt an unterschieden sich die Länder in zwei Gruppen
(vgl. Abb. 3): Die Staaten, bei denen es zu einer weiteren Auswärtsverlagerung der Kurve
kam, unter ihnen Frankreich, Deutschland und Japan aber auch Norwegen und Schweden.
Und die Länder, bei denen eine Linksverschiebung einsetzte, wie etwa die Niederlande (ohne
Abb.), Großbritannien und die USA. (Vgl. OECD 2003, S. 31)
..
.
Abbildung 3: Beveridgekurven ausgewählter OECD-Staaten, 1980 2001.
Quelle: OECD (2003) Empoyment Outlook, S. 32 f.
Die Beveridge-Kurve, die das Verhältnis zwischen der Arbeitslosenquote und der Quote der
offenen Stellen darstellt, vermittelt einen ersten Eindruck von der Entwicklung der Aus-
gleichsprozesse am Arbeitsmarkt. Obwohl ihre zugrunde liegenden Indikatoren mit Schwä-
chen behaftet sind (vgl. Kap. 3.4.3), deutete eine Auswärtsverlagerung der Beveridgekurve
auf ein zunehmendes Mismatch am Arbeitsmarkt hin. (Vgl. OECD 2003, S.34 f.)
8
2.2
Strukturelle Merkmale der Arbeitsmarktentwicklung
2.2.1
Relativ geringe Jugendarbeitslosigkeit
Abbildung 4 zeigt die Jugendarbeitslosigkeit im Verhältnis zur Arbeitslosenquote für
Deutschland und andere europäische OECD-Staaten im Jahr 2003. Die entsprechenden Werte
der USA wurden ab 1960 durch Punkte dargestellt. Sie verdeutlichen eine exemplarische Reg-
ressionslinie. In den anderen Staaten besteht ebenfalls ein Zusammenhang zwischen der Höhe
der Arbeitslosenquote und dem Ausmaß der Jugendarbeitslosigkeit. (Vgl. Blanchard 2005, S.
8)
Abbildung 4: Jugendarbeitslosigkeit im Ländervergleich, 2003, USA 1960 2003.
5
Quelle: Blanchard (2005): OECD Database.
Aufallend ist, dass in keinem anderen OECD-Land die Jugendarbeitslosigkeit im Verhältnis
zur allgemeinen Arbeitslosigkeit so niedrig ist wie in Deutschland. Mit 10,6 Prozent liegt die
Arbeitslosigkeit in der Gruppe der 15-bis 24-Jährigen in Deutschland deutlich unter dem
OECD-Durchschnitt von 13,5 Prozent. Sie unterscheidet sich von der Gesamtarbeitslosigkeit
5
Anmerkung: Eine von mir durchgeführte Überprüfung der Darstellung hat ergeben, dass es sich um Werte aus
dem Jahr 2003 und nicht, wie angegeben, um Werte aus dem Jahr 2004 handelt. Vgl. OECD 2005b, S. 241 f.
9
Deutschlands, die 9,3 Prozent beträgt, nur geringfügig. Allerdings steigt die Jugendarbeitslo-
sigkeit in Deutschland. Im Jahr 2004 betrug sie bereits 11,7 Prozent. (Vgl. OECD 2005b, S.
240)
Die relativ geringe Arbeitslosigkeit in der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen wird von der OECD
(2005a, S. 5) vor allem dem Dualen System der Berufsausbildung zugeschrieben. Bei der In-
tegration der jungen Generation erweist sich das Berufsausbildungssystem Deutschlands er-
heblich erfolgreicher als Bildungssysteme anderer Länder. (Vgl. OECD 2005a, S.4; 2005b, S.
40) Durch seine innere Differenzierung haben Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Schul-
abschlüssen eine Chance einen Sekundarabsschluss II zu erreichen. Die Kombination von
praktischer und theoretischer Ausbildung an den Lernorten Schule und Betrieb erleichtert zu-
dem nach der Ausbildung die rasche Übernahme im Betrieb. (Vgl. Bosch 2001, S. 28).
2.2.2
Entwicklung der relativen Bildungsbeteiligung
In Deutschland absolvieren rund 60 Prozent aller Schulabgänger eine Duale Ausbildung. Da-
mit ist das Duale System die am meisten gefragte nachschulische Ausbildungsform (vgl. Abb.
5)
Abbildung 5: Entwicklung der relativen Bildungsbeteiligung, 1992-2005.
Quelle: BMBF (2006) Berufsbildungsbericht S. 7.
10
Allerdings wird es für Jugendliche zunehmend schwieriger einen Ausbildungsplatz zu be-
kommen. 45,7 Prozent der Jugendlichen, die eine duale Berufsausbildung für sich anstrebten,
konnten im Herbst 2004 keine solche beginnen. Aufgefangen wurden sie zu 18,4 Prozent
durch die Berufsfachschule, dem Berufsvorbereitungsjahr und dem Berufsgrundbildungsjahr.
In diesen schulischen Bildungsgängen können sie jedoch keinen Berufsabschluss erlangen.
(Vgl. BMBF 2005, S.78)
Betrachtet man die Entwicklung über den Kernbereich der Dualen Berufsausbildung hinaus,
so zeigt sich eine deutliche Verschiebung des Gefüges der verschieden Bildungsbereiche. In
der Zeit von 1992 bis 2005 hat sich insbesondere das Verhältnis von beruflicher Vollqualifi-
zierung und beruflicher Grundbildung stark verändert. Während im Vergleich zu 1992 die
Zahl der Jugendlichen, die eine duale Berufsausbildung aufnahmen, um nahezu 20 Prozent
gesunken ist, stieg die Zahl der Eintritte in das Berufsgrundbildungsjahr im gleichen Verhält-
nis. In diesem Zeitraum stieg ebenfalls die Quote der Studienanfänger und der Anteil der Ju-
gendlichen die an der Berufsfachschule einen Berufsabschluss anstrebten. (Vgl. BMBF 2006,
S.6)
2.2.3
Relativ hohes Arbeitslosigkeitsrisiko in späteren Lebensjahren
Ein Gesichtspunkt, den die OECD in ihrer aktuellen Ausgabe von ,,Bildung auf einen Blick"
erneut betont, ist die Verteilung des Arbeitslosigkeitsrisikos über den Lebenszyklus. In der
Gruppe der 25- bis 29-Jährigen ist das Risiko arbeitslos zu werden in Deutschland bei den
Absolventen des Sekundarbereichs II/Duales System mit 6,2 Prozent relativ gering. Es liegt
rund 2 Prozent über dem Arbeitslosigkeitsrisiko für Absolventen der Hochschulen und Fach-
hochschulen (4,1 Prozent).(Vgl. OECD 2005a, S. 5; OECD 2005b, S. 127)
Ein anderes Bild ergibt sich in späteren Jahren des Erwerbslebens. Während das Arbeitslosig-
keitsrisiko bei Hochschulabsolventen diesen Wert bis in die Altersgruppe der 50- bis-54 Jäh-
rigen nicht übersteigt, wächst das Arbeitslosigkeitsrisiko bei den Absolventen des Dualen
Systems für diese Altersgruppe bis auf 8,3 Prozent. (Vgl. OECD 2005a, S. 5; OECD 2005b,
S. 127)
Die OECD führt dazu aus: ,,Dem Erfolg des dualen Systems zu Beginn des Arbeitslebens, das
einen vergleichsweise reibungslosen Übergang von der Schule ins Berufsleben sicherstellt,
stehen wachsende Risiken in späteren Lebensjahren gegenüber. Möglicherweise gelingt es
den Absolventen dieses Bildungsweges weniger, sich den rasch wandelnden Anforderungen
des Arbeitsmarktes hinreichend anzupassen." (OECD, 2005a, S. 5)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836602136
- DOI
- 10.3239/9783836602136
- Dateigröße
- 825 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Paderborn – Wirtschaftswissenschaften, Studiengang Lehramt Sekundarstufe II
- Erscheinungsdatum
- 2007 (März)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- deutschland arbeitslosigkeit arbeitsmarkt berufsausbildung duales system ausbildung lehre strukturwandel jugendarbeitslosigkeit
- Produktsicherheit
- Diplom.de