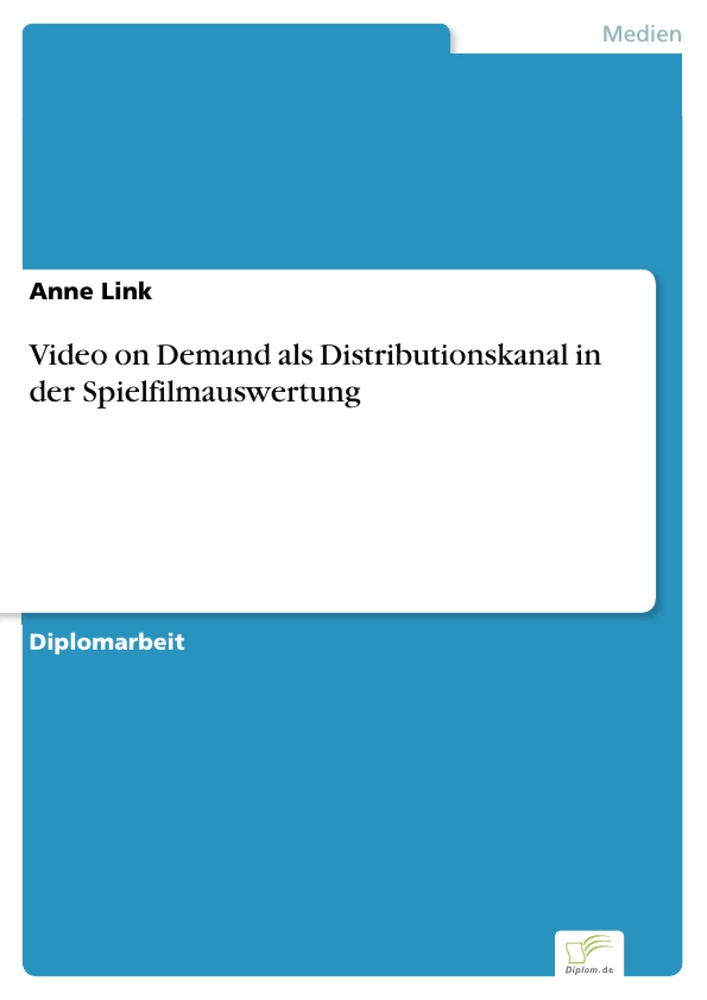Video on Demand als Distributionskanal in der Spielfilmauswertung
©2006
Diplomarbeit
115 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Lange hat die Filmbranche nach einem adäquaten Mittel gesucht, der Filmpiraterie, die sie jährlich Umsatzeinbußen in Millionenhöhe kostet, einen Riegel vorzuschieben. -Bisher mehr oder minder erfolglos. Nun gehen die Studios dazu über, nach Alternativen zum illegalen Download zu suchen. Die Zeitfenster der Filmauswertung werden verkürzt, der Status quo des Kinos in Frage gestellt und der Preisverfall im DVD-Verkauf vorangetrieben, um den legalen Filmerwerb attraktiver zu gestalten.
Auf einem Angebot ruhen ganz besondere Hoffnungen, da es dem heutigen Trend zur Heimkinoanlage am ehesten ent- und neue Einnahmen verspricht, dem Filmdownload gegen Bezahlung (Video on Demand bzw. Download-to-Own). Egal ob CBS seine Fernsehserien über iTunes anbietet, Warner-Filme legal über BitTorrent heruntergeladen werden können oder sich die Studios zusammenschließen, um gemeinsam VoD-Plattformen wie Movielink oder CinemaNow zu betreiben, alles deutet darauf hin, dass zumindest die nordamerikanische Filmindustrie ihre Vorliebe für den digitalen Filmvertrieb übers Internet entdeckt hat.
Problemstellung:
In meiner Diplomarbeit über Video on Demand als neuen Distributionskanal in der Spielfilmauswertung möchte ich untersuchen, ob so viel Optimismus hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von Video on Demand angebracht ist. Denn das Geschäftsmodell der VoD-Plattformen scheint bis jetzt eher prototypisch unausgereift, geradeso, als sei der Filmdownload auf Anfrage lediglich ein Übergangsmodell auf dem Weg zur Entwicklung ähnlicher, aber doch verschiedenartiger Distributionskanäle.
Ich möchte überprüfen, welche Lebensdauer Video on Demand in seiner jetzigen Form haben könnte: Ist es eine kurzfristige Modeerscheinung oder verändert es die Wertschöpfungskette der Spielfilmauswertung tatsächlich längerfristig? Hierfür ist es angebracht in Augenschein zu nehmen, ob ein Unternehmen, das bspw. sein Produktportfolio um VoD erweitert, auch Gewinne erzielt und in welcher Höhe diese liegen.
Des weiteren soll auf die möglichen Folgemodelle, die zwar nur leichte Modifikationen des ursprünglichen Video on Demand darstellen, jedoch einige entscheidende Vorteile gegenüber VoD bieten, eingegangen werden. Denn auch sie würden für ein Fortleben des digitalen Filmvertriebs sprechen, in anderer Form zwar, jedoch mit ganz ähnlichen Funktionsweisen.
Spielfilme im Internet als digitale Dateien zum legalen Download anzubieten, ist längst keine Zukunftsvision […]
Lange hat die Filmbranche nach einem adäquaten Mittel gesucht, der Filmpiraterie, die sie jährlich Umsatzeinbußen in Millionenhöhe kostet, einen Riegel vorzuschieben. -Bisher mehr oder minder erfolglos. Nun gehen die Studios dazu über, nach Alternativen zum illegalen Download zu suchen. Die Zeitfenster der Filmauswertung werden verkürzt, der Status quo des Kinos in Frage gestellt und der Preisverfall im DVD-Verkauf vorangetrieben, um den legalen Filmerwerb attraktiver zu gestalten.
Auf einem Angebot ruhen ganz besondere Hoffnungen, da es dem heutigen Trend zur Heimkinoanlage am ehesten ent- und neue Einnahmen verspricht, dem Filmdownload gegen Bezahlung (Video on Demand bzw. Download-to-Own). Egal ob CBS seine Fernsehserien über iTunes anbietet, Warner-Filme legal über BitTorrent heruntergeladen werden können oder sich die Studios zusammenschließen, um gemeinsam VoD-Plattformen wie Movielink oder CinemaNow zu betreiben, alles deutet darauf hin, dass zumindest die nordamerikanische Filmindustrie ihre Vorliebe für den digitalen Filmvertrieb übers Internet entdeckt hat.
Problemstellung:
In meiner Diplomarbeit über Video on Demand als neuen Distributionskanal in der Spielfilmauswertung möchte ich untersuchen, ob so viel Optimismus hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von Video on Demand angebracht ist. Denn das Geschäftsmodell der VoD-Plattformen scheint bis jetzt eher prototypisch unausgereift, geradeso, als sei der Filmdownload auf Anfrage lediglich ein Übergangsmodell auf dem Weg zur Entwicklung ähnlicher, aber doch verschiedenartiger Distributionskanäle.
Ich möchte überprüfen, welche Lebensdauer Video on Demand in seiner jetzigen Form haben könnte: Ist es eine kurzfristige Modeerscheinung oder verändert es die Wertschöpfungskette der Spielfilmauswertung tatsächlich längerfristig? Hierfür ist es angebracht in Augenschein zu nehmen, ob ein Unternehmen, das bspw. sein Produktportfolio um VoD erweitert, auch Gewinne erzielt und in welcher Höhe diese liegen.
Des weiteren soll auf die möglichen Folgemodelle, die zwar nur leichte Modifikationen des ursprünglichen Video on Demand darstellen, jedoch einige entscheidende Vorteile gegenüber VoD bieten, eingegangen werden. Denn auch sie würden für ein Fortleben des digitalen Filmvertriebs sprechen, in anderer Form zwar, jedoch mit ganz ähnlichen Funktionsweisen.
Spielfilme im Internet als digitale Dateien zum legalen Download anzubieten, ist längst keine Zukunftsvision […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Anne Link
Video on Demand als Distributionskanal in der Spielfilmauswertung
ISBN: 978-3-8366-0147-4
Druck Diplomica® GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Hochschule Magdeburg-Stendal (FH), Magdeburg, Deutschland, Diplomarbeit,
2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
1
Inhaltsverzeichnis
Seite
Verwendete Abkürzungen... 4
Teil I... 5
1.
Einleitung... 5
2.
Die Wertschöpfungskette der Spielfilmauswertung... 9
2.1
Einführung Wertschöpfungskette... 9
2.2 Die
Kinoauswertung...
12
2.2.1 ein
Marktüberblick...
12
2.2.2
Die zukünftige Entwicklung... 14
2.3 Die
Videoauswertung...
16
2.3.1 ein
Marktüberblick...
16
2.3.2 Verleih...
17
2.3.3 Verkauf...
18
2.3.4
Die zukünftige Entwicklung... 20
2.4 Die
Fernsehauswertung...
22
2.4.1 ein
Marktüberblick...
22
2.4.2
Die fiktionale Programmgestaltung... 24
2.4.3
Die zukünftige Entwicklung... 25
Teil II... 27
3.
Die Online-Filmdistribution am Beispiel von Video on Demand... 27
3.1
Die Online-Filmdistribution eine kurze Einleitung... 27
3.2
die technischen Rahmenbedingungen von Video on Demand... 29
3.2.1
zur Definition von Video on Demand... 29
3.2.2
Video on Demand in Server-basierten Systemen... 31
3.2.3
Video on Demand in Peer-to-Peer Netzwerken... 32
2
3.3
Geschäftsmodell Video on Demand... 33
3.3.1 Einleitung...
33
3.3.2
Markt und Wettbewerb... 36
3.3.2.1 Marktanalyse... 36
a) Die illegale Vervielfältigung von Filmen... 37
b) Konkurrenz von Seiten der Videotheken... 39
3.3.2.2 Die
Wettbewerbssituation... 40
3.3.2.3 Zielgruppenanalyse... 45
3.3.3
Chancen und Risiken für kommerzielle Anbieter... 46
3.3.3.1 Chancen... 47
3.3.3.2 Risiken... 49
3.4
Zur Vermarktung einer VoD-Plattform... 54
3.4.1 Produktpolitik...
54
3.4.2 Preispolitik...
56
3.4.3 Distributionspolitik...
59
3.4.4 Kommunikationspolitik...
62
4. Zusammenfassung...
65
Teil III... 69
5.
Empirische Untersuchung der Präferenzstruktur im Filmkonsum
mittels Fragebogens...
69
5.1 Einleitung...
69
5.2 Das
Untersuchungsdesign...
70
5.2.1 Datenerhebung...
70
5.2.2 Der
Fragebogen...
71
5.3 Empirische
Befunde...
74
5.3.1
Alters- und Geschlechtsverteilung... 74
5.3.2 Präferiertes
Übertragungsmedium...
74
5.3.3
Spielfilme im sozialen Kontext... 75
5.3.4 Filmverhalten...
76
5.3.5
Alternativen zum Kino... 82
5.3.6
Zahlungsbereitschaft für Video on Demand... 85
3
5.4 Schlussbetrachtung...
87
5.4.1
Zusammenfassende Interpretation der Untersuchungsergebnisse... 87
6. Fazit...
90
7. Anlagenverzeichnis...
95
8. Anhang...
97
9. Verwendete
Abbildungen...
111
10. Verwendete
Tabellen...
113
11. Literaturverzeichnis...
115
4
in der Diplomarbeit verwendete Abkürzungen
bspw. beispielsweise
d. h.
das heißt
DRM
Digital Rights Management
DVD
Digital Video Disc, auch: Digital Versatile Disc
ebd. ebendiese(r/s)
i. d. R.
in der Regel
o. ä.
oder ähnlich
o. Ä.
oder Ähnliches
PPV Pay-per
View
sog. sogenannte(r/s)
Telco(s)
Unternehmen der Telekommunikationsbranche
TK Telekommunikation
u. a.
unter anderem, unter anderen
u. U.
unter Umständen
v. a.
vor allem
VoD
Video on Demand
Vgl. Vergleich
z. B.
zum Beispiel
5
Teil I
1. Einleitung
Als Apple's Online-Musik-Plattform iTunes im Oktober letzten Jahres damit begann,
neben Musiktiteln und Videoclips auch Fernsehshows und serien anzubieten, war die
Fachwelt zunächst skeptisch. Mittlerweile können US-amerikanische Konsumenten aus
einem Angebot von über 100 aktuellen TV-Sendungen auswählen und sich die jeweili-
ge Episode für 1,99 $ auf ihrem Computer oder Video iPod ansehen
1
. Und das Ange-
bot wird angenommen: laut Apple wurden seit dem Launch 30 Millionen Videos ver-
kauft
2
.
Inzwischen sind selbst die Hollywood-Studios auf den Erfolg von iTunes aufmerksam
geworden und ziehen in Erwägung, ihre Filme per Dowload-to-Own auf der Web-
seite des Computerherstellers feilzubieten.
Lange hat die Filmbranche nach einem adäquaten Mittel gesucht, der Filmpiraterie, die
sie jährlich Umsatzeinbußen in Millionenhöhe kostet, einen Riegel vorzuschieben. -Bis-
her mehr oder minder erfolglos. Nun gehen die Studios dazu über, nach Alternativen
zum illegalen Download zu suchen. Die Zeitfenster der Filmauswertung werden ver-
kürzt, der Status quo des Kinos in Frage gestellt und der Preisverfall im DVD-Verkauf
vorangetrieben, um den legalen Filmerwerb attraktiver zu gestalten. Auf einem Ange-
bot ruhen ganz besondere Hoffnungen, da es dem heutigen Trend zur Heimkinoanlage
am ehesten ent- und neue Einnahmen verspricht, dem Filmdownload gegen Bezahlung
(Video on Demand bzw. Download-to-Own). Egal ob CBS seine Fernsehserien über
iTunes anbietet, Warner-Filme legal über BitTorrent heruntergeladen werden können
oder sich die Studios zusammenschließen, um gemeinsam VoD-Plattformen wie Mo-
vielink oder CinemaNow zu betreiben, alles deutet darauf hin, dass zumindest die
nordamerikanische Filmindustrie ihre Vorliebe für den digitalen Filmvertrieb übers
Internet entdeckt hat.
Der Wandel des Freizeitverhaltens scheint den Major Studios Recht zu geben. Die
Faszination am technischen Fortschritt könnte kaum größer sein. Immer mehr Konsu-
menten zeigen sich eher angetan von HDTV und ultraflachen Fernsehern, surfen lieber
stundenlang im Internet oder spielen Computerspiele als ins Kino zu gehen.
1
Vgl. Netherby, J., 2006 c).
2
Vgl. Netherby, J., 2006 c).
6
Doch das Kino, oft schon totgesagt, hat bisher viele Krisen überstanden. Ob VoD den
Auslöser für eine solche darstellt und sich tatsächlich einreihen kann in die überragen-
de Konkurrenz zum Lichtspieltheater wie sie einst die Einführung des Fernsehens oder
des Videorecorders bedeuteten, ist noch nicht abzusehen. Amerikanische VoD-
Plattformen jedenfalls verzeichnen in den letzten zwölf Monaten einen großen Zulauf.
Selbst weniger bekannte Webseiten wie MovieFlix, die sich bisher hauptsächlich auf
Independentfilme konzentriert haben, können schon auf zwei Millionen registrierte
Nutzer verweisen.
3
Optimistisch blicken die Betreiber der Online-Videodownloadportale
in die Zukunft, schließlich sollen die Breitbandnetze erweitert werden und so für einen
kontinuierlichen Zustrom an Kunden sorgen.
In meiner Diplomarbeit über Video on Demand als neuen Distributionskanal in der
Spielfilmauswertung möchte ich untersuchen, ob so viel Optimismus hinsichtlich der
zukünftigen Entwicklung von Video on Demand angebracht ist. Denn das Geschäfts-
modell der VoD-Plattformen scheint bis jetzt eher prototypisch unausgereift, geradeso,
als sei der Filmdownload auf Anfrage lediglich ein Übergangsmodell auf dem Weg zur
Entwicklung ähnlicher, aber doch verschiedenartiger Distributionskanäle. Ich möchte
überprüfen, welche Lebensdauer Video on Demand in seiner jetzigen Form haben
könnte: Ist es eine kurzfristige Modeerscheinung oder verändert es die Wertschöp-
fungskette der Spielfilmauswertung tatsächlich längerfristig? Hierfür ist es angebracht
in Augenschein zu nehmen, ob ein Unternehmen, das bspw. sein Produktportfolio um
VoD erweitert, auch Gewinne erzielt und in welcher Höhe diese liegen. Des Weiteren
soll auf die möglichen Folgemodelle, die zwar nur leichte Modifikationen des ursprüng-
lichen Video on Demand darstellen, jedoch einige entscheidende Vorteile gegenüber
VoD bieten, eingegangen werden. Denn auch sie würden für ein Fortleben von Video
on Demand sprechen, in anderer Form zwar, jedoch mit ganz ähnlichen Funktionswei-
sen.
Spielfilme im Internet als digitale Dateien zum legalen Download anzubieten, ist längst
keine Zukunftsvision mehr. Video on Demand gibt es nun schon seit vielen Jahren in
Europa, Asien und Nordamerika, aber erst seit kurzem wird ihm von Seiten der
Verbraucher Beachtung geschenkt in einigen Ländern mehr, in anderen weniger. In
Deutschland bspw. ist das Interesse an VoD im allgemeinen noch sehr gering, wie
auch eine für diese Diplomarbeit durchgeführte nicht-repräsentative Umfrage belegt
hat. Dennoch sprechen Zukunftsprognosen auch hierzulande von einem Trend, der
3
Vgl. Netherby, J., 2006 g).
7
sich vom Kinobesuch wegbewegt und gerade deshalb Chancen für neuartige Distribu-
tionkanäle wie Video on Demand bietet.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich nachweisen, dass es sich bei Video on Demand
um ein Geschäftsmodell handelt, das es sehr wohl mit den herkömmlichen Vertriebs-
wegen aufnehmen kann, und zwar auf Dauer. Hierfür werde ich deshalb zunächst auf
die herkömmlichen Distributionskanäle der Spielfilmauswertung eingehen. Der erste
Teil der Arbeit beschäftigt sich folglich mit den Besonderheiten, Funktionen und den
Marktprognosen für Kino-, Video- bzw. DVD-Auswertung sowie fürs Fernsehen. Im
anschließenden zweiten Teil werde ich das Geschäftsmodell Video on Demand detail-
liert vorstellen. Technische Spezifika werden erklärt, Marktchancen und risiken erör-
tert. Zu guter Letzt wird im dritten Teil der Diplomarbeit eine Untersuchung des Film-
verhaltens und der Zahlungsbereitschaft der Verbraucher mittels Fragebogens vorge-
stellt und ausgewertet. Sie soll die zuvor ausschließlich theoretischen Annahmen und
Hypothesen, die in dieser Diplomarbeit aufgestellt wurden, stützen.
9
2.
Die Wertschöpfungskette der Spielfilmauswertung
2.1 Einführung Wertschöpfungskette
In der vorliegenden Arbeit bezeichnet der Ausdruck Wertschöpfungskette lediglich die
Verwertungs- und Distributionsmedien, die den direkten Kontakt zum Endkunden her-
stellen, und nicht den gesamten Werschöpfungsprozess, der bei der Produktion eines
Spielfilms beginnt. Die stufenweise Verwertung eines Films mit dem Ziel, einen mög-
lichst großen Teil der Konsumentenrente abzuschöpfen, soll hier im Vordergrund ste-
hen. Ausgehend von der Grundressource ,,Content" und unter dem Gesichtspunkt der
Mehrfachverwertung des Einzelproduktes Film steht für die in der Spielfilmindustrie
operierenden Unternehmen im Vordergrund, immer neue Wertschöpfungsketten auf-
zubauen. Im Folgenden werden die gängigsten, nämlich die Kino-, Video- und Fern-
sehauswertung, beschrieben.
,,Spielfilme durchlaufen verschiedene, zeitlich sequentiell angeordnete Auswertungs-
prozesse"
4
(,,Windowing"; vgl. Abbildung 1 im Anhang), wobei zwischen einem ,,do-
mestic market" und ,,foreign markets" unterschieden werden muss. An die Konzeption,
Finanzierung und Produktion eines Spielfilms schließt sich i. d. R. zunächst im Herstel-
lungsland seine Aufführung im Kino, genauer in sog. Erstaufführungstheatern (,,first-
run-theatres"). Ebenfalls im Herstellungsland folgen nacheinander die Veröffentlichung
in Zweitaufführungstheatern oder Programmkinos (,,second-run-theatres"), die Auswer-
tung des Films auf Video und DVD, die Ausstrahlung im Pay-TV und zu guter Letzt die
Ausstrahlung im öffentlich-rechtlichen bzw. privaten Fernsehen (,,Free-TV").
Dabei ist die Reihenfolge der Distributionsmedien bedingt durch ihre unterschiedliche
Fähigkeit, nicht-zahlende Zuschauer vom Konsum auszuschließen.
Hinsichtlich der Video- und DVD-Veröffentlichung sowie der Fernsehauswertung kann
noch einmal in einzelne Stufen untergliedert werden. So ist es üblich (jedoch nicht
zwingend), dass bei der Videoauswertung zwischen einer Verleih- und Verkaufsveröf-
fentlichung unterschieden wird, wobei spezielle Versionen für die Verleihauswertung
produziert werden, die schon einige Tage oder Wochen früher in den Videotheken
veröffentlicht werden als die Ausgaben für den Handel. Die Pay-TV-Auswertung eines
Spielfilms erfolgt, sofern das jeweilige Land, in welchem der Film veröffentlicht wird,
über Pay-per-View-Systeme verfügt, ebenfalls auf eine zweistufige Weise. Beim Free-
4
Hennig-Thurau, T. (2003), S. 368
.
10
TV schließlich wird - analog zur Unterscheidung von Erst- und Zweitaufführungsthea-
tern unterschieden in Erstaufführungssender (z. B. RTL) und Zweitaufführungssender
(z. B. VOX).
Abbildung 1: Die Wertschöpfungskette des Spielfilms
Quelle: nach Hennig-Thurau, T. (2003)
Ein beim nationalen deutschen Film eher zu vernachlässigendes Phänomen ist die
Veröffentlichung eines Spielfilms in anderen regionalen Märkten. ,,Im Fall von US-
amerikanischen Spielfilmproduktionen durchläuft ein Film dabei im Ausland grundsätz-
lich dieselbe Auswertungskette wie im Heimatland."
5
Die Filmindustrie stellt hierbei die
bisher herausragendste Ausschöpfung internationaler Märkte im gesamten Spektrum
der Medienwirtschaft dar.
Der Spielfilm bildet zudem die Grundlage für weitere unternehmerische Aktivitäten wie
die Markteinführung von Merchandisingprodukten (z. B. T-Shirts) oder die Auswertung
von Elementen des Films in anderen Medien (z. B. PC-Spiele). War ein Film erfolg-
reich, hat er also einen gewissen Markenwert entwickelt, so kann dies eine Weiterfüh-
rung (,,brand extension") in Form von Sequels (bzw. neuerdings auch Prequels) oder
TV-Serien veranlassen.
5
Hennig-Thurau (2003), S. 369.
11
Allerdings ist der Status quo des Kinos innerhalb der Wertschöpfungskette in Gefahr.
Denn das Zeitfenster zwischen der Veröffentlichung eines Spielfilms im Kino und sei-
ner anschließenden Auswertung auf dem Videomarkt schrumpft. Waren es ursprüng-
lich einmal sechs Monate, die der Kunde auf den Release eines Films auf DVD (oder
VHS-Kassette) warten musste, so sind die Silberlinge nun zum Teil schon ein viertel
Jahr nach Kinofilmstart im Handel oder in der Videothek erhältlich. Neue Distributions-
formen, wie der legale Download von Filmen (Video on Demand sowie Download-to-
own), sollen die Zeitspanne der exklusiven Kinoauswertung noch einmal verkürzen.
Der Zenit des DVD-Umsatzes ist ohnehin überschritten. In 2005 wurden so viele Sil-
berscheiben verkauft wie nie zuvor. Mit einem weiteren Anstieg wird nicht gerechnet
im Gegenteil: sinkende Preise wirken sich Umsatz minimierend aus. Nicht nur deshalb,
sondern auch um der Piraterie entgegenzuwirken, versuchen die Hollywood-Studios
Anreize neuer Art zu schaffen, indem sie den Zeitabstand zwischen Kino-, Video- und
Pay-TV-Auswertung verringern, wenn nicht sogar gänzlich aufheben.
Einen der ersten Probeläufe in Richtung Simultanauswertung unternahm der angese-
hene Hollywood-Regisseur Steven Soderbergh. Er veröffentlichte seinen Film ,,Bubble"
gleichzeitig im Kino, auf DVD und über Video on Demand. Obgleich ,,Bubble" nicht zu
den kostspieligen und aufwendigen Großproduktionen zu zählen ist, die Erfolgschan-
cen und risiken des Films also von vornherein begrenzt waren, unternahm Soder-
bergh einen in der Branche noch sehr umstrittenen Schritt in eine Richtung, die die
Wertschöpfungskette des Spielfilms völlig verändern könnte.
Tatsächlich stehen Produzenten schon länger vor einem Timing-Dilemma, sind sie
doch vor die Herausforderung gestellt, ,,den gewinnmaximalen Zeitpunkt des Über-
gangs der einzelnen Auswertungsstufen festzulegen."
6
Denn bei allen Auswertungsstu-
fen handelt es sich um denselben Spielfilm, die verschiedenen Stufen sind demnach
unweigerlich untereinander substituierbar.
6
Lange, C. (1999), S. 56.
12
2.2 Die Kinoauswertung
2.2.1 ein Marktüberblick
,,Es ist sicher für viele ein ketzerischer Gedanke, doch er muss einmal ausgesprochen
werden: Vielleicht sind die Kinos, so wie wir sie kennen, tatsächlich am Ende ihrer
Existenzberechtigung angekommen."
7
(Franz Everschor)
An erster Stelle der Wertschöpfungskette steht nach wie vor die Auswertung des Spiel-
films im Kino. Was die Einnahmen anbelangt, wurde das Kino zwar von den folgenden
Auswertungsstufen abgelöst allen voran von der DVD-Auswertung, die mit 23,3 Mrd.
US-Dollar die Erlöse aus der Kinoauswertung (8,9 Mrd. US-Dollar) 2005 um mehr als
das Doppelte überstieg und das Kino in wirtschaftlicher Bedeutung mittlerweile über-
trifft
8
. Trotzdem konnten die Lichtspieltheater ihre Position an der Spitze der Wert-
schöpfungskette auch 2005 behaupten.
Hollywood brauche die Kinos als Marketing-Lokomotive, um seine Produkte der Öffent-
lichkeit bekannt zu machen, schreibt der Filmdienst
9
zu Recht und charakterisiert damit
die Hauptfunktion des Kinos als Instrument der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.
Trotzdem wird die Konstitution des Kinos in letzter Zeit immer wieder in Frage gestellt,
denn einstige Kinogänger kehren auf Grund technischer Neuerungen und billiger wer-
dender DVD's dem Lichtspieltheater den Rücken. Tatsächlich ergaben die oben ge-
nannten 8,9 Mrd. Dollar Umsatz an amerikanischen Kinokassen ein Minus von 5,2%
10
gegenüber dem Vorjahr und damit das ,,schlechteste Jahr-zu-Jahr-Ergebnis seit
1985
11
." In Deutschland ist die Lage noch prekärer: Hier wurde 2005 ein Umsatzrück-
gang von 16,6%
12
zum Vorjahr verzeichnet. Damit ist die Zahl der Besucher auf das
Niveau von 1995 gesunken (allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Filmbranche
erst 2001 dank gestiegener Besucherzahlen und Umsätze als Rekordjahr verbuchen
konnte). Durchschnittlich 1,54 mal ist der deutsche Zuschauer 2005 ins Kino gegan-
gen, im europäischen Mittel (2,22) ist das wenig
13
.
7
Everschor, F. (2006), S. 49.
8
Vgl. Everschor, F. (2006), Ratlos in Hollywood.
9
Vgl. Everschor, F. (2006), Ratlos in Hollywood.
10
Vgl. Everschor, F. (2006), Ratlos in Hollywood.
11
Everschor, F. (2006), S.64.
12
Vgl. FFA (2006), Vertrauen und begründete Zuversicht.
13
Vgl. Europäische Audiovisuelle Informationsstelle (2005), Focus 2005.
13
Abbildung 2: Verkaufte Eintrittskarten / 1994-2004
und Brutto-Einspielergebnis / 1994-2004
Quelle: Quelle: Europäische Audiovisuelle Informationsstelle, 2005: ,,Focus 2005"
Schon in den 80er Jahren litt der deutsche Kino-Markt unter einem Abwärtstrend,
ausgelöst durch die Einführung des Kabel- und Satellitenfernsehens sowie den Auf-
stieg der Home-Entertainment-Branche. Mit dem Aufkommen der Multiplexkinos inner-
halb und außerhalb der Städte in den 1990er Jahren konnte das Kino wieder an Boden
gewinnen. Inzwischen sind 27% der 4870 Leinwände in der Hand von Multiplex-
Betreibern
14
. Ihr Anteil am Gesamtumsatz beträgt genau 50%
15
, wobei immer noch
über die Hälfte der Besucher herkömmliche Kinos bevorzugen. Tatsächlich beschreibt
FFA Info in der Einschätzung über das Kinojahr 2005 eine Trendwende im Geschmack
der Kinobesucher hin zu kleineren, intimeren Kinos. Vielleicht eine Reaktion auf das als
Overscreening bezeichnete Überangebot an Kinoleinwänden und Sitzplätzen für ein zu
geringes Besucherpotential, das nach dem Boom-Jahr 2001 einsetzte.
Etwa 12% der Leinwände in Deutschland befinden sich in der Hand von Programmki-
nos
16
, deren Filmangebot sich überwiegend aus sogenannten Arthouse-Produktionen
zusammensetzt und die somit eine Art Gegenpol zum traditionellen und zum Multiplex-
Kino darstellen. Programmkinos befinden sich verstärkt in Großstädten und verfügen in
der Regel über nur 1-3 Leinwände
17
. Ihre stärkste Besuchergruppe stellen im Gegen-
satz zu Kinos mit herkömmlichen Angebot, das sich vorwiegend aus
14
Vgl. Weischer.Mediengruppe (2005).
15
Vgl. ebd.
16
Vgl. FFA (2005), Programmkinos in der BRD und ihr Publikum in 2004.
17
Vgl. ebd.
14
Hollywood-Blockbustern zusammensetzt und ein eher junges Publikum anzieht (64%
der Kinobesucher sind zwischen 14 und 29 Jahre alt), die 30 bis 39jährigen dar
18
.
Weitere 12% Anteil an deutschen Leinwänden haben Sonderformen wie Autokinos,
IMAX und Kinovorführungen an Unis und Schulen inne
19
. Der größte Teil entfällt jedoch
auf konventionelle Kinos (dazu sind auch Multiplexkinos zu zählen).
Das Kinoprogramm wird dominiert von ausländischen Filmproduktionen, allen voran
US-amerikanische. Dennoch konnte der deutsche Film seinen Marktanteil über die
letzten Jahre seit der Jahrtausendwende relativ stabil halten, wie Tabelle 1 verdeut-
licht.
Tabelle 1: Marktanteile des deutschen Films in Deutschland / 2001-2005
Jahr
Marktanteil
2005
17,1%
2004
23,8%
2003
17,5%
2002
11,9%
2001
18,4%
Quelle: eigene Darstellung
Zum Vergleich: 2005 lag der Marktanteil des europäischen Films innerhalb der EU bei
26,5%
20
.
2.2.2 Die zukünftige Entwicklung
Wie im ersten Kapitel schon angedeutet, gibt es Anzeichen für tiefgreifende Verände-
rungen in der Auswertung von Kinofilmen. So könnte sich eine Simultanauswertung,
also das gleichzeitige Veröffentlichen von Filmen im Kino, auf DVD, über Video on
Demand und im Pay TV, sofern sie sich denn tatsächlich durchsetzt, zum ,,schleichen-
den Exodus"
21
des Kinos entwickeln. Um dies zu vermeiden, ist laut Filmdienst eine
Umorientierung der Kinobranche hinsichtlich der Kinoauswertung unvermeidbar:
18
Vgl. FFA (2005), Programmkinos in der BRD und ihr Publikum in 2004.
19
Vgl. Weischer.Mediengruppe (2005).
20
Vgl. Europäische Audiovisuelle Informationsstelle (2005), Focus 2005.
21
Vgl. Everschor, F., Mord am Kino?.
15
,,Wenn sich die Hollywood-Studios und die Kinoketten zum Beispiel darauf verständi-
gen könnten, einen bestimmten Typ von Filmen, nämlich die aufwendigen und spekta-
kulären Produktionen, über eine adäquate Zeitspanne exklusiv für die Kinoauswertung
zu reservieren, so wäre es vielleicht möglich, den (in ihrer Zahl sicher geschrumpften)
Filmtheatern ihren Ereignischarakter zurückzugeben, den sie einst einmal besessen
haben."
22
Ob es über kurz oder lang nur noch Großproduktionen wie ,,Der Herr der
Ringe", deren Sehvergnügen auf einer riesigen Kinoleinwand auch von einer noch so
fortschrittlichen Heimkinoanlage nicht übertroffen werden kann, vorbehalten ist, im Kino
aufgeführt zu werden, bleibt fraglich. Noch schätzen Kinobetreiber und Filmproduzen-
ten die Lage weniger problematisch ein, wollen sogar hohe Investitionen in die Installa-
tion digitaler Projektionsanlagen tätigen. Für die Hollywood-Studios bietet das digitale
Kino gravierende finanzielle Vorteile, denn die verhältnismäßig teure Herstellung von
Filmkopien entfällt nahezu: ,,Currently, a major Hollywood release in the USA such as
Mission: Impossible 3 will require more than 4000 prints to be made at a cost of around
$5 million. (...) In this sense, film distributors have a lot to gain from the conversion to
digital films can be sent directly to cinemas without the need for physical prints."
23
Doch nicht nur Kosteneinsparungen sind mit der neuen Technik verbunden. So soll
durch die Einführung des digitalen Kinos auch die Bildqualität der Filme verbessert und
ein breiteres Spektrum an (Independent-) Filmen aufgeführt werden können. Darüber
hinaus verspricht sich die Filmindustrie vom digitalen Kino ein wirksames Instrument im
Kampf gegen die Filmpiraterie.
Bis Ende 2006 soll die Zahl der Digitalprojektionen in den USA von 400 auf 1500 stei-
gen
24
. 97 Filmtitel wurden 2005 weltweit digital veröffentlicht, die meisten davon in den
Vereinigten Staaten und in Asien
25
. Die hohen Investitionskosten hierfür (im Schnitt
kostet ein digitaler Projektor fünf- bis zehn mal so viel wie ein regulärer Filmprojektor
26
)
haben die Kinobetreiber zu tragen. Dafür wird ihnen eine glorreiche Zukunft prophezeit:
,,Digital technology will also enable cinema operators to create new revenue streams as
theatres move towards becoming multi-purpose public venues, rooted in their commu-
nities potentially showing sports events and concerts, as well as more educational
and local community content."
27
Das Kino als Gemeinschaftszentrum ist natürlich Zu-
kunftsmusik, nichtsdestotrotz würde die Umsetzung einer derartigen Vision dem Licht-
22
Everschor, F. (2006), Mord am Kino?, S. 49.
23
Screen Digest (2006).
24
Everschor, F. (2006), Im Aufbruch, S 49.
25
Vgl. ebd.
26
Vgl. ebd.
27
Screen Digest (2006).
16
spieltheater ganz neue Impulse verleihen. Ob dies der ,,Abspielstation" Kino ausreichen
wird, vermehrt Kunden anzulocken und somit die Einspielergebnisse der Spielfilme
wieder in die Höhe zu treiben, bleibt abzuwarten.
2.3 Die
Videoauswertung
2.3.1 ein Marktüberblick
"Die einst weitverbreitete Meinung, Filme könnten grundsätzlich nur auf der Leinwand
ihre volle Wirkung entfalten, wurde durch die technischen Entwicklungen des letzten
Jahrzehnts weitgehend relativiert."
28
(F. Everschor)
Im Vergleich zu den Medien Kino und Fernsehen ist das Geschäft mit Videos und
neuerdings DVDs ein relativ junger Industriezweig. Seitdem der Videorekorder Ende
der siebziger Jahre seine Markteinführung erlebte, ist die Bedeutung des Verleihs und
Verkaufs von Videokassetten in den darauffolgenden Jahren bis zur Erfindung der
DVD stetig gestiegen. Längst hat der Home-Video-Markt das Kinogeschäft volumen-
mäßig bei weitem überholt.
Immer mehr Menschen zeigen sich fasziniert von technischen Neuerungen wie Flatsc-
reens, Home-Theatre-Anlagen und preiswerten DVD-Angeboten. Dabei liegen die
Vorteile der kleinen Silberscheiben auf der Hand: Der Zuschauer kann Szenen wieder-
holen, es werden vermehrt sogenannte Extras angeboten wie bspw. Interviews mit den
Filmschaffenden oder längere Versionen des Films. Für viele stellt das einen Mehrwert
gegenüber dem Kino dar, der eine Wartezeit von bis zu sechs Monaten nach Filmstart
(bei Independentfilmen kann es sogar noch länger dauern) durchaus rechtfertigt.
28
Everschor, F. (2006), Mord am Kino?, S.49.
17
2.3.2 Verleihgeschäft
Wie hoch genau Konsumenten den Mehrwert der Digitalen Video Disc schätzen, zeigt
der kontinuierliche Erfolg des Verleihgeschäfts: auch 2005 konnte die Home-
Entertainment-Branche ein Umsatzplus verbuchen. So wurde ein Anstieg der Verleih-
vorgänge um 7,9%
29
zum Vorjahr verzeichnet: 112,7 Millionen Mal wurden in den
ersten elf Monaten des Jahres 2005 in Videotheken Filme ausgeliehen
30
. Dadurch
konnten Umsätze in Höhe von 292 Millionen Euro (277 Millionen Euro im Jahr 2004)
erzielt werden, was einem Zuwachs von 5,4% entspricht
31
.
Dabei spielt der Verleih (und auch Verkauf) der VHS-Kassette nur noch eine zu ver-
nachlässigende Rolle, wie die folgende Abbildung verdeutlicht.
Abbildung 3:
Ausgaben für Leihkassetten/ -DVDs in Europa 2002-2009
Quelle: Screen Digest
29
Vgl. FFA Info, 2006.
30
Vgl. ebd.
31
Vgl. BVV, 2006.
18
Etwa zwei Millionen Videokassetten wurden bis Mitte des vergangenen Jahres noch
verliehen, ,,doch man kann davon sprechen, dass die Videokassette (...) nur noch
vereinzelt zum Verleih ausliegt."
32
Zumindest in den Ländern Westeuropas wird sie bis
spätestens 2008 vollkommen von der Bildfläche verschwunden sein. Das Geschäft mit
dem sogenannten Offline-Verleih, also dem Verleihen von DVDs und Videokassetten in
herkömmlichen Videotheken und im Automatenverleih, bekommt seit Beginn des neu-
en Jahrtausends zunehmend Konkurrenz von Seiten des Online-DVD-Verleihs. Hier ist
das Videoangebot auf einer Online-Plattform einseh- und bestellbar, die ausgewählten
Filme werden dann von einem zentralen Ort aus postalisch verschickt. Nachdem sich
der Kunde den Film angesehen hat, schickt er die DVD wieder zum Anbieter zurück
und erhält je nach Vereinbarung einen neuen Film. Auf den Internet- und Automa-
tenverleih gehen mittlerweile 12% aller Verleihvorgänge zurück
33
.
Ende 2005 gab es circa 4300 Videotheken in Deutschland, ,,von denen etwas mehr als
900 sogenannten Automatenverleihgeschäften zuzuordnen sind."
34
Konsumenten im Alter zwischen 20 und 29 Jahren zeichnen sich allein für 42%
35
aller
Transaktionen verantwortlich und stellen somit das Segment der eifrigsten Videothe-
kenkunden. Dennoch setzt sich der Trend zum Altersanstieg fort. Mittlerweile ist das
Durchschnittsalter der Leihkunden auf 31,0 Jahre (2005)
36
geklettert, was vorwiegend
auf den zunehmenden Einfluss der Internetvideotheken zurückzuführen ist, deren
Klientel zu einem Drittel mindestens 40 Jahre alt ist
37
.
2.3.3 Verkauf
Sowohl in Deutschland als auch in Europa dominiert der Verkauf den Videomarkt. So
wurden in Westeuropa 2004 DVD's im Wert von insgesamt 11,6 Mrd. US$
38
verkauft,
während der Verleih mit den Silberscheiben lediglich 2,7 Mrd. US$
39
erwirtschaftete.
32
FFA Info (2006), Schallgrenze durchbrochen, S. 15.
33
Vgl. BVV, 2006.
34
BVV (2006), S. 16.
35
Vgl. BVV, 2006.
36
Vgl. ebd.
37
Vgl. ebd.
38
Vgl. Screen Digest, 2005.
39
Vgl. ebd.
19
Trotz gestiegenen DVD-Absatzes um 9,5% zum Vorjahr 2004 mit 98,7 Mio. verkauf-
ten digitalen Bildspeichern konnte 2005 fast die 100 Mio. Schwelle durchbrochen wer-
den - ist der Umsatz um 5,1% zurückgegangen
40
. Dies ist auf die weiterhin gesunke-
nen Verbraucherpreise für DVD's zurückzuführen. ,,Hat ein Bildtonträger (VHS oder
DVD) im Jahr 2004 noch durchschnittlich 13,96 gekostet, so ist dieser Durchschnitts-
preis in 2005 auf 13,09 gesunken."
41
Damit konnte die ,,vergleichsweise kräftige Stei-
gerungsrate von 5,4% im Verleih nicht ganz kompensiert werden."
42
Tatsächlich strebt
der DVD- und Video-Markt einem Sättigungsgrad entgegen, der ein weiteres enormes
Wachstum, wie wir es über die letzten Jahre seit der Einführung der digitalen Bildspei-
chermedien erlebt haben, in Zukunft unwahrscheinlich macht (Vgl. Abbildung 2, An-
hang). Der Rückgang der Wachstumsraten wird allerdings verlangsamt durch die Ver-
marktung neuer Produkte wie teureren DVD Sets oder der TV-DVD. Letztere bezeich-
net die Vermarktung und Auswertung von TV-Formaten auf DVD. In 2005 machte die
TV-Vermarktung schon 19% des gesamten DVD-Kaufmarktes aus Tendenz stei-
gend
43
. Dagegen ging der Kinofilmanteil im selben Jahr um sieben Prozent auf ein
gutes Drittel (36%) zurück.
44
Dies lässt darauf schließen, dass die Kinokrise des ver-
gangenen Jahres zeitversetzt auch den Markt der filmischen Zweitverwertung erfasst
hat.
Bis sich neue Bildspeichermedien wie die zwei rivalisierenden Formate HDDVD und
Blu Ray, die dieses Jahr erstmalig in den Vereinigten Staaten zu einem vergleichswei-
se hohen Einstiegspreis von circa 30 US$
45
auf den Markt kamen, gegen die herkömm-
liche DVD durchsetzen, sie evtl. sogar ersetzen werden, können noch ein paar Jahre
vergehen. Bisher hält die Verbraucher die Zufriedenheit mit ihren altbewährten DVD's
und den dazugehörigen Abspielgeräten sowie der hohe Preis vom Kauf der neuen
physischen Datenträger ab.
40
Vgl. FFA Info, 2006.
41
FFA Info (2006), Schallgrenze durchbrochen, S. 15.
42
Vgl. ebd.
43
Vgl. BVV, 2006.
44
Vgl. BVV, 2006.
45
Vgl. Everschor, F. (2006), ,,King Kong" auf dem PC.
20
2.3.4 Die zukünftige Entwicklung
Mit einem Umsatz von 1.686 Mio ,,übertrifft der Home Entertainment Markt das Kino-
einspielergebnis des vergangenen Jahres
(745 Mio. lt. FFA) mittlerweile um mehr als
das Doppelte (+126%)"
46
und bildet somit weiterhin das Rückgrat der deutschen Film-
wirtschaft. Was die VHS-Kassette noch nicht vermochte Kino-Boxofficeergebnis und
Videogesamtmarktumsatz waren vor Einführung der DVD noch nahezu ausgeglichen,
wurde von der Digital Video Disc um ein Vielfaches übertroffen. Seit 1999, als die DVD
erstmals auf dem deutschen Markt erschien
47
, zeichnete sich immer deutlicher der
Trend ab, dass das Geschäft mit DVD's und Videokassetten die umsatzstärkste Film-
auswertungsstufe der Filmwirtschaft in Deutschland, aber auch in allen anderen euro-
päischen Ländern sowie in Nordamerika sein würde. Problematisch ist jedoch der
verglichen mit der VHS-Kassette kurze Produktlebenszyklus der DVD. Bereits für
2006 wird ein Umsatzrückgang prophezeit, der sich auch in den nächsten Jahren
fortsetzen könnte, sollten die neuen Formate Blu Ray und HDDVD keine neuen Kauf-
impulse geben. Dabei spielt weniger mangelndes Kundeninteresse (das im übrigen
nicht oder nur geringfügig abnehmen wird) eine Rolle als ein zunehmender Preisverfall
der Silberscheiben.
Die verstärkte Expansion von Breitbandnetzen und deren Anbietern seit der Jahrtau-
sendwende wirkt sich allerdings durch die Piraterieproblematik - auch negativ auf die
Home-Entertainment-Branche aus. Es werden bereits mehr Filme als gebrannte Kopie
oder aus dem Internet bezogene Vorlage konsumiert als im Kino oder als Vermiet-
bzw. Kauf-DVD. Dadurch wird der legale Konsum eingeschränkt oder sogar gänzlich
substituiert. Laut der GfK-Brennerstudie aus dem Jahre 2005 geben 44% der kopier-
bzw. brennaktiven Filmfans an, ,,dass sie seitdem weniger oder keine DVDs mehr
leihen und zu 42% auf den Kinobesuch verzichten oder diesen zumindest einge-
schränkt haben."
48
Dies schlägt sich logischerweise in der Umsatzentwicklung der
Kinobranche nieder, wie Abbildung 4 zeigt.
46
BVV (2006), S. 2.
47
Vgl. BVV, 2006.
48
BVV (2006), S. 20.
21
Abbildung 4: Umsatzentwicklung im Home-Entertainment und Kinomarkt
1999-2005 in Millionen
Quelle: Bundesverband Audiovisuelle Medien
Da die Marktdurchdringung der DVD-Player und Recorder seit Einführung des Medi-
ums DVD im Jahre 1997 (USA) stetig zugenommen und in Westeuropa mittlerweile
eine Rekordrate von 52% (2004) erreicht hat
49
(siehe Abbildung 5), wird nicht mit einer
ernsthaften Krise ähnlich der des Kinos gerechnet. Ganz im Gegenteil: Screen Digest
erwartet für 2005 eine weitere Steigerung. So werden 2005 etwa 60% aller westeuro-
päischen Haushalte mit mindestens einem DVD-Player bzw. Recorder ausgestattet
sein
50
. In Deutschland verfügen bereits etwa zwei Drittel aller Haushalte über mindes-
tens ein derartiges Abspielgerät
51
. Allerdings steht das Verleihgeschäft vor einer digita-
len Trendwende: neue Wettbewerber aus dem Online-Bereich haben sich - zunächst
ohne viel Aufsehen zu erregen - auf dem Markt etabliert. Mittlerweile ist Video on De-
mand zumindest in den USA ein gängiger Begriff und wird zusehends von den Konsu-
menten in Anspruch genommen. Alle großen Hollywood-Studios jedenfalls haben
schon einmal in die neue Technologie investiert und VoD-Plattformen wie Movielink
und CinemaNow geschaffen, auf denen sie ihre Filme selbst vertreiben, ganz so, als
würden sie geradezu mit dem schleichenden Rückgang des DVD-Geschäfts rechnen.
Wann und inwieweit sich der legale Filmdownload gegen Bezahlung als ernsthafte
Konkurrenz zu herkömmlichen und Online-Videotheken durchsetzen wird, hängt von
den neu entstandenen Geschäftsmodellen der Online-Videodistribution ab. Erste Sta-
49
Vgl. Callaghan, P., 2006.
50
Vgl. ebd.
51
Vgl. BVV, 2006.
22
tistiken sehen aber auch für Deutschland eine Entwicklung hin zu steigenden Umsät-
zen im Download-Bereich.
Abbildung 5: Marktdurchdringung von DVD Playern/Recordern
in Europa 2002-2009
Quelle: Screen Digest 2005
2.4 Die
Fernsehauswertung
2.4.1 ein Marktüberblick
Das Fernsehen ist das am weitesten verbreitete Medium weltweit. 97% aller deutschen
Haushalte besitzen mindestens einen Fernsehapparat
52
. Dies entspricht etwa dem
westlichen Durchschnitt.
Mit der Entstehung und Etablierung des Fernsehens in den 50er Jahren wurde der
Einfluss des Kinos zurückgedrängt. Spielfilme konnten nunmehr auch vorm heimischen
TV-Gerät konsumiert werden. Das in den 80er Jahren eingeführte private, werbefinan-
zierte Fernsehen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der sich vorwiegend aus
Rundfunkgebühren finanziert und nur geringe Einnahmen aus der Werbung generiert,
52
Vgl. Göttgens, O., Wastl, S., 2003.
23
bilden das duale Rundfunksystem und dominieren die gesamte deutsche Fernsehland-
schaft. Zur Zeit gibt es lediglich einen Pay-TV-Sender (Premiere)
in Deutschland. Mit dem Umstieg von analogem auf digitales Fernsehen und der damit
einhergehenden Welle von Senderneugründungen wird sich dies voraussichtlich än-
dern. Die Vollprogramme wiederum könnten daraufhin Marktanteile einbüßen und ihren
bisherigen Einfluss verlieren.
Zwar ist die durchschnittliche Fernsehdauer in Deutschland über die Jahre kontinuier-
lich gestiegen - von 1988 bis 2002 von 144 auf 201 Minuten
53
. Jedoch hat auch die
Anzahl der TV-Sender zugenommen, allerdings nicht im gleichen Maße wie die Nach-
frage. ,,Diese Marktentwicklung führte dazu, dass der deutsche TV-Rezipientenmarkt
zu einem wettbewerbsintensiven Markt geworden ist."
54
Doch die einzelnen Fernseh-
sender stehen nicht nur im harten Konkurrenzkampf untereinander, denn Informations-
und Unterhaltungsmöglichkeiten bietet nicht nur das Fernsehen. Endgeräte wie Com-
puter und Handys locken vor allem die Generation der Heranwachsenden, deren Me-
diennutzungsverhalten sich von dem ihrer Eltern stark unterscheidet. 2001/2002 wurde
das deutsche Fernsehen nach Jahren des ungebremsten Wachstums mit der ersten
länger andauernden konjunkturellen Schwäche konfrontiert
55
. Die Umsätze aus dem
Verkauf von Werbezeiten gingen zurück, neue Erlösquellen wie Merchandising, Tele-
shopping und der Verkauf von Klingeltönen mussten erschlossen werden.
Um langfristig mit den neuen Medien mithalten zu können ist jedoch ein Umdenken
gefragt. So kann die Wettbewerbsfähigkeit des Rundfunks nur gewährleistet werden,
wenn Medienanbieter ihr Angebot ,,über die wichtigsten von breiteren Bevölkerungs-
und Nutzerkreisen in Anspruch genommenen Verteilwege und Ausgabemöglichkeiten
zugänglich machen."
56
Und tatsächlich versuchen immer mehr deutsche TV-Produzenten, ihren Content auch
außerhalb der herkömmlichen Sendeplätze unterzubringen. Die ,,Harald Schmidt
Show" wird von T-Vision, dem VoD-Portal von T-Online, zum Download gegen Bezah-
lung angeboten, die deutsche Comedyserie ,,Hausmeister Krause" ist auf One4Movie,
ebenfalls einem VoD-Anbieter, verfügbar. Die Sendergruppe ProSiebenSat1 hat be-
reits Verbreitungsverträge mit drei Internetdiensten, darunter T-Online, abgeschlossen,
um seine Programme auch im Internet zugänglich zu machen. Dadurch und mittels
53
Vgl. Krafft, M., Götz, O., 2003.
54
Krafft, M., Götz, O. (2003), S.343.
55
Vgl. Zeiler, G., 2003.
56
Schächter, M. (2003), S.270.
24
einer eigenen VoD-Plattform (,,Maxdome"), auf der weitere von den Sendern ProSie-
ben, Sat1 und Kabel 1 aufgekaufte bzw. produzierte Filme und Serien über VoD ver-
fügbar gemacht werden, verspricht sich die ProSiebenSat1 MediaAG Jahresumsätze
in Millionenhöhe.
2.4.2 Die fiktionale Programmgestaltung
Die Gesamtproduktion von TV-Fiktion hat 2004 in den fünf größten Ländern Europas
(Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich) leicht zugenom-
men, dem Abwärtstrend der europäischen Fernsehbranche konnte demnach Einhalt
geboten werden, ,,obgleich er sich nicht umgekehrt hat."
57
Zurückzuführen ist der bescheidene Zuwachs um 2,5%
58
zum Vorjahr auf neue Ent-
wicklungsimpulse: Inländisch produzierte Telenovelas, ,,die 2004 vom öffentlich-
rechtlichen Sender ZDF in Deutschland gestartet wurden"
59
, waren so erfolgreich, dass
sich das Konzept auch auf die Privaten ausgeweitet hat und die Produktion von TV-
Fiktion der ,,europaweit stärksten Fernsehbranche"
60
weiter angetrieben wurde.
Der Marktanteil der öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter, die Hauptauftraggeber
und anbieter von inländischer TV-Fiktion in Europa bleiben, liegt in Deutschland seit
Beginn des Jahrzehnts relativ stabil bei 43-44%
61
. In Gesamteuropa ging ihr Anteil
zugunsten der privaten Sender leicht zurück. Letztere setzen in ihrer Programmierung
überwiegend auf US-amerikanische Fiktionsprogramme, die mit 68,6% (2000) den
größten Teil des westeuropäischen Sendevolumens ausmachen
62
. Da sich der private
Rundfunk fast ausschließlich aus Werbeeinnahmen finanziert, also dem Verkauf von
Werbezeiten, ist er stark abhängig von den Einschaltquoten. Was die Sehgewohnhei-
ten des europäischen Publikums anbelangt, so sind diese geprägt von US-
amerikanischen Formaten, wie schon der hohe Anteil der US-Spielfilme auf dem Kino-
markt andeutet. Europäische TV-Produktionen hingegegen kennzeichnet ihr stark
lokaler Charakter, der eine internationale Auswertung erschwert, so dass sich das
Ungleichgewicht im Programmaustausch zwischen der Europäischen Union und Nord-
amerika über die Jahrzehnte vergrößert hat. Das Außenhandelsdefizit Europas gegen-
57
Europäische Audiovisuelle Informationsstelle (2005), Eurofiction 2005.
58
Vgl. ebd.
59
Vgl. ebd.
60
Vgl. ebd.
61
Vgl. Lange, A., 2005.
62
Vgl. Europäische Audiovisuelle Informationsstelle, 2001.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836601474
- DOI
- 10.3239/9783836601474
- Dateigröße
- 2.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Magdeburg-Stendal; Standort Magdeburg – Kommunikation und Medien, Studiengang Journalistik
- Erscheinungsdatum
- 2007 (Februar)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- filmwirtschaft video absatzweg medienmanagement digital rights management demand
- Produktsicherheit
- Diplom.de