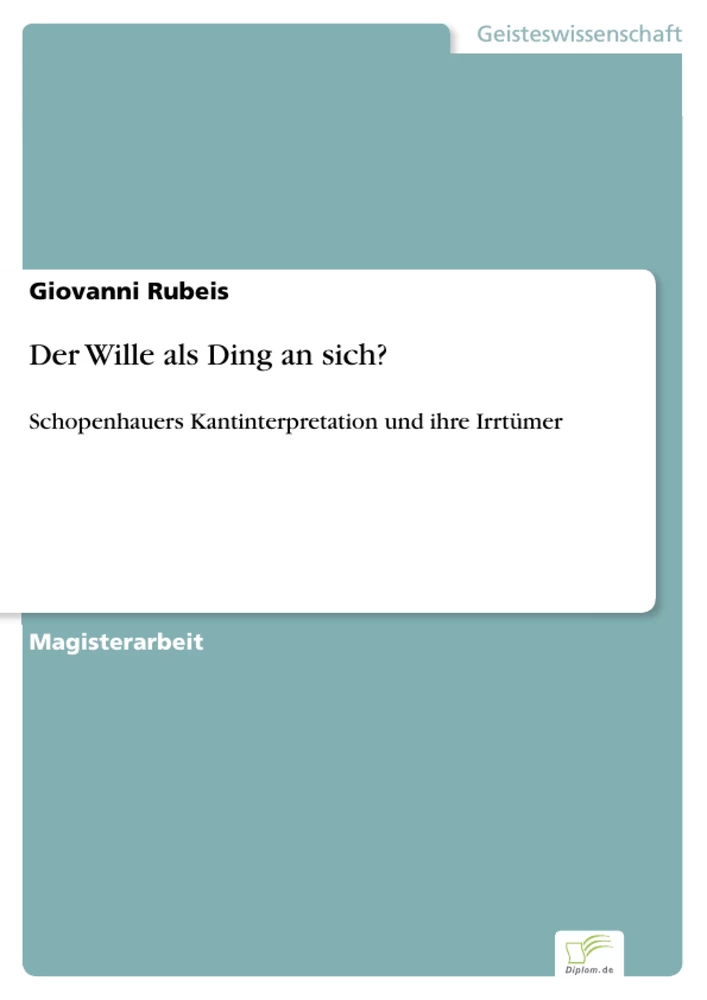Der Wille als Ding an sich?
Schopenhauers Kantinterpretation und ihre Irrtümer
©2006
Magisterarbeit
100 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, ob Schopenhauer seinem Anspruch, der Vollender der Kantschen Philosophie zu sein, tatsächlich gerecht wird. Exemplarisch für diesen Anspruch Schopenhauers lässt sich folgendes Zitat heranziehen: Kant ist mit seinem Denken nicht zu Ende gekommen: ich habe bloß seine Sache durchgeführt. Demgemäß habe ich was Kant von der menschlichen Erscheinung allein sagt auf alle Erscheinung überhaupt, als welche von jener nur dem Grade nach verschieden ist, übertragen, nämlich daß das Wesen an sich derselben ein absolut Freies, d.h. ein Wille ist. Im Wesentlich soll dieser Satz widerlegt werden. Positiv gewendet lautet die These, die hierbei überprüft werden soll:
Schopenhauer interpretiert die Kantsche Erkenntnistheorie teils falsch, teils verwirft er deren fundamentale Einsichten. Die Tatsache, dass Schopenhauer bereits auf dem Weg zum Ding an sich eine falsche Abzweigung nimmt, führt schließlich zu der metaphysischen Fehlinterpretation des Willens als Ding sich.
Es ergibt sich jedoch auch ein äußerst fruchtbares Resultat der Schopenhauerschen Kantkritik, indem nämlich Schopenhauer die Problematik der Verbindung von theoretischer und praktischer Vernunft aufzeigt.
Die Kritik der Kantischen Philosophie, welche Schopenhauer als Anhang zu den vier Büchern des ersten Bandes seines Hauptwerkes Die Welt als Wille und Vorstellung beigefügt hat, soll als Leitfaden der Untersuchung dienen. Anhand der Kritik lässt sich die Kantinterpretation Schopenhauers sowie ihre grundlegenden Irrtümer und Missverständnisse anschaulich darlegen. Dabei ist es auch immer wieder notwendig, Kant dem Kant Schopenhauers gegenüberzustellen, um eben jene Fehler aufzuzeigen. Da Schopenhauer die Angewohnheit hat, meist sehr rhapsodisch, selektiv und kursorisch in der Darstellung der Kantschen Philosophie vorzugehen, sollen Schlüsselstellen bei Kant detailliert ausgeführt werden. Diese Vorgehensweise soll v.a. zeigen, dass die Theorie Kants in ihrer Komplexität mehr Behutsamkeit in der Betrachtung verlangt, als Schopenhauer meist aufbringt.
In der Einleitung werden zunächst die Grundzüge der Schopenhauerschen Kritik kurz dargestellt, um einen Eindruck von Schopenhauers Kantbild zu vermitteln. Danach wendet sich der erste Abschnitt der epistemologischen Seite der Kantkritik bei Schopenhauer zu. Hier soll aufgezeigt werden, inwieweit Schopenhauer Kant fehl interpretiert bzw. verwirft und dadurch von ihm abweicht. […]
Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, ob Schopenhauer seinem Anspruch, der Vollender der Kantschen Philosophie zu sein, tatsächlich gerecht wird. Exemplarisch für diesen Anspruch Schopenhauers lässt sich folgendes Zitat heranziehen: Kant ist mit seinem Denken nicht zu Ende gekommen: ich habe bloß seine Sache durchgeführt. Demgemäß habe ich was Kant von der menschlichen Erscheinung allein sagt auf alle Erscheinung überhaupt, als welche von jener nur dem Grade nach verschieden ist, übertragen, nämlich daß das Wesen an sich derselben ein absolut Freies, d.h. ein Wille ist. Im Wesentlich soll dieser Satz widerlegt werden. Positiv gewendet lautet die These, die hierbei überprüft werden soll:
Schopenhauer interpretiert die Kantsche Erkenntnistheorie teils falsch, teils verwirft er deren fundamentale Einsichten. Die Tatsache, dass Schopenhauer bereits auf dem Weg zum Ding an sich eine falsche Abzweigung nimmt, führt schließlich zu der metaphysischen Fehlinterpretation des Willens als Ding sich.
Es ergibt sich jedoch auch ein äußerst fruchtbares Resultat der Schopenhauerschen Kantkritik, indem nämlich Schopenhauer die Problematik der Verbindung von theoretischer und praktischer Vernunft aufzeigt.
Die Kritik der Kantischen Philosophie, welche Schopenhauer als Anhang zu den vier Büchern des ersten Bandes seines Hauptwerkes Die Welt als Wille und Vorstellung beigefügt hat, soll als Leitfaden der Untersuchung dienen. Anhand der Kritik lässt sich die Kantinterpretation Schopenhauers sowie ihre grundlegenden Irrtümer und Missverständnisse anschaulich darlegen. Dabei ist es auch immer wieder notwendig, Kant dem Kant Schopenhauers gegenüberzustellen, um eben jene Fehler aufzuzeigen. Da Schopenhauer die Angewohnheit hat, meist sehr rhapsodisch, selektiv und kursorisch in der Darstellung der Kantschen Philosophie vorzugehen, sollen Schlüsselstellen bei Kant detailliert ausgeführt werden. Diese Vorgehensweise soll v.a. zeigen, dass die Theorie Kants in ihrer Komplexität mehr Behutsamkeit in der Betrachtung verlangt, als Schopenhauer meist aufbringt.
In der Einleitung werden zunächst die Grundzüge der Schopenhauerschen Kritik kurz dargestellt, um einen Eindruck von Schopenhauers Kantbild zu vermitteln. Danach wendet sich der erste Abschnitt der epistemologischen Seite der Kantkritik bei Schopenhauer zu. Hier soll aufgezeigt werden, inwieweit Schopenhauer Kant fehl interpretiert bzw. verwirft und dadurch von ihm abweicht. […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Giovanni Rubeis
Der Wille als Ding an sich? Schopenhauers Kantinterpretation und ihre Irrtümer
ISBN: 978-3-8366-0107-8
Druck Diplomica® GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Universität Wien, Wien, Österreich, Magisterarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
1
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS 1
VORWORT 3
EINLEITUNG
DIE KRITIK DER KANTISCHEN PHILOSOPHIE
7
I. ABSCHNITT:
DER WEG ZUM DING AN SICH 15
I.1.
Transzendentale Ästhetik
15
I.2.
Schopenhauers Kritik der Transzendentalen Ästhetik
19
I.2.1. Kausalität als Funktion des Verstandes - Der Satz vom zureichenden Grunde
19
I.3.1. Die Deduktion der reinen Verstandesbegriffe
26
I.3.2. Transzendentale Deduktion
34
I.3.3. Kritik der transzendentalen Logik
42
I.3.4. Kritische
Anmerkung:
49
II. ABSCHNITT
DAS DING AN SICH 53
II.1. Das Ding an sich als Grenzbegriff
53
II.2. Der Wille als Ding an sich
55
II.3. Schopenhauers Kritik am ,Ding an sich'
59
II.4. Die Idee der Freiheit
60
II.4.1. Die Antinomienlehre
62
II.4.2.
Schopenhauers Kritik der transzendentalen Ideen und der Antinomienlehre
67
II.4.3.
Der Wille bei Kant
75
2
II.4.4. Maxime und praktisches Gesetz
76
II.4.5. Das Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft
79
II.4.6. Vom Sittengesetz zur Freiheit
82
II.5. Schopenhauers Kritik der Kantschen Ethik
84
II.6. Die Problematik der homogenen Vernunft
87
III. CONCLUSIO
91
LITERATURVERZEICHNIS 97
LEBENSLAUF 99
3
VORWORT
Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, ob Schopenhauer seinem Anspruch, der Vollender
der Kantschen Philosophie zu sein, tatsächlich gerecht wird. Exemplarisch für diesen An-
spruch Schopenhauers lässt sich folgendes Zitat heranziehen:
,,Kant ist mit seinem Denken nicht zu Ende gekommen: ich habe bloß seine Sache durchgeführt. Dem-
gemäß habe ich was Kant von der menschlichen Erscheinung allein sagt auf alle Erscheinung überhaupt, als
welche von jener nur dem Grade nach verschieden ist, übertragen, nämlich daß das Wesen an sich derselben ein
absolut Freies, d.h. ein Wille ist." (WWV I, S.693)
Im Wesentlich soll dieser Satz widerlegt werden. Positiv gewendet lautet die These, die hier-
bei überprüft werden soll:
Schopenhauer interpretiert die Kantsche Erkenntnistheorie teils falsch, teils verwirft er deren
fundamentale Einsichten. Die Tatsache, dass Schopenhauer bereits auf dem Weg zum Ding an
sich eine falsche Abzweigung nimmt, führt schließlich zu der metaphysischen Fehlinterpreta-
tion des Willens als Ding sich.
Es ergibt sich jedoch auch ein äußerst fruchtbares Resultat der Schopenhauerschen Kantkritik,
indem nämlich Schopenhauer die Problematik der Verbindung von theoretischer und prakti-
scher Vernunft aufzeigt.
Die ,,Kritik der Kantischen Philosophie", welche Schopenhauer als Anhang zu den vier Bü-
chern des ersten Bandes seines Hauptwerkes ,,Die Welt als Wille und Vorstellung" beigefügt
hat, soll als Leitfaden der Untersuchung dienen. Anhand der Kritik lässt sich die Kantinterpre-
tation Schopenhauers sowie ihre grundlegenden Irrtümer und Missverständnisse anschaulich
darlegen. Dabei ist es auch immer wieder notwendig, Kant dem Kant Schopenhauers gegen-
überzustellen, um eben jene Fehler aufzuzeigen. Da Schopenhauer die Angewohnheit hat,
meist sehr rhapsodisch, selektiv und kursorisch in der Darstellung der Kantschen Philosophie
vorzugehen, sollen Schlüsselstellen bei Kant detailliert ausgeführt werden. Diese Vorgehens-
weise soll v.a. zeigen, dass die Theorie Kants in ihrer Komplexität mehr Behutsamkeit in der
Betrachtung verlangt, als Schopenhauer meist aufbringt.
4
In der Einleitung werden zunächst die Grundzüge der Schopenhauerschen Kritik kurz darge-
stellt, um einen Eindruck von Schopenhauers Kantbild zu vermitteln. Danach wendet sich der
erste Abschnitt der epistemologischen Seite der Kantkritik bei Schopenhauer zu. Hier soll
aufgezeigt werden, inwieweit Schopenhauer Kant fehl interpretiert bzw. verwirft und dadurch
von ihm abweicht. Der zweite Abschnitt befasst sich mit den Konsequenzen dieser fundamen-
talen Unterschiede, wie sie sich auf metaphysischem und ethischem Gebiet niederschlagen.
Da Schopenhauer die Ethik Kants fast zur Gänze verwirft, fällt die Darstellung seines Ver-
hältnisses zur praktischen Philosophie Kants entsprechend knapp aus, da er sich hier nicht als
Vollender Kants versteht, sondern dessen gesamte Moraltheorie verwirft. Es soll an dieser
Stelle zunächst gezeigt werden, warum Schopenhauer keinen Zugang zur Kantschen Ethik
finden kann, um in der Folge darzulegen, dass seine Kritik der Kantschen Ethik auf eine ge-
wichtige Problematik der Kantschen Vernunftkonzeption verweist. Im dritten Abschnitt
schließlich soll geprüft werden, inwieweit obige These zutreffend ist.
Diese Einteilung dient dazu, die Parallelisierung von theoretischer und praktischer Philoso-
phie, wie sie in Kants Werk auftritt, nachzuzeichnen, um den Zusammenhang von theoreti-
scher und praktischer Vernunft verdeutlichen zu können. Die äußerst detaillierte Darstellung
des Kantschen Ansatzes soll v.a. eines leisten: Nicht nur die Irrtümer der Schopenhauerschen
Interpretation, sondern auch deren Gründe sollen herausgearbeitet werden.
Die herangezogenen Werke Kants werden wie folgt abgekürzt:
Kritik der reinen Vernunft: KrV
Kritik der praktischen Vernunft: KpV
Grundlegung der Metaphysik der Sitten: GMS
Für Schopenhauers Werke werden folgende Kürzel verwendet:
Die Welt als Wille und Vorstellung Band I/Band II: WWV I/II
Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde: SvG
Die beiden Grundprobleme der Ethik: GPE
Parerga und Paralipomena: PP
5
Bei Verweisen auf Textstellen innerhalb der vorliegenden Arbeit wird einfach die Seitenzahl
angegeben.
Hervorhebungen und Orthographie der Zitate wurden aus dem jeweiligen Original unverän-
dert übernommen.
7
EINLEITUNG
DIE KRITIK DER KANTISCHEN PHILOSOPHIE
Die wichtigste und umfangreichste Quelle der Kantexegese Schopenhauers stellt die ,,Kritik
der Kantischen Philosophie" dar, ein Anhang zu den vier Büchern des ersten Bandes der
WWV (S.575-735). Die hier formulierte Kritik und die Auffassung der Kantschen Philoso-
phie, welche aus ihr erhellt, lassen sich auch in anderen Schriften Schopenhauers finden
(vgl.Werke Bd.III: GPE, S.642-715; Werke Bd.IV: PP, S.101-162), jedoch nirgends in einer
derart konzisen Form. Zunächst würdigt Schopenhauer die drei wichtigsten Errungenschaften
der Philosophie Kants, bevor er zur eigentlichen Kritik übergeht. Bereits in diesem ersten
,,würdigenden" Abschnitt lassen sich Grundzüge des Schopenhauerschen Kantbildes feststel-
len, die auch Aufschluss über die gravierenden Irrtümer dieser Interpretation geben.
Die Unterscheidung von Ding an sich und Erscheinung ist für Schopenhauer die größte Leis-
tung Kants. Kant habe nachgewiesen, daß zwischen Objekt und Subjekt der Intellekt als ver-
mittelnde Instanz stehe, wodurch die Erkenntnis des Dinges, wie es an sich ist, nicht möglich
ist, sondern immer nur das Bild, welches durch den Intellekt vermittelt wird, erkannt werden
kann (WWV I, S.580). Hier ortet Schopenhauer den Einfluss Locke's (primäre-sekundäre
Qualitäten), obwohl er diese Unterscheidung nur für ein ,,jugendliches Vorspiel der Kanti-
schen"(WWV I, S.581) hält, da Kant auch die primary qualities als bloß der Erscheinung
anhaftend erfasst, weil diese erst durch die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung a
priori Raum, Zeit und Kausalität konstituiert werden. Die Unterscheidung von a priori und
a posteriori ist eine der entscheidenden Einsichten der Kantschen Philosophie.
Die wichtigsten Einflüsse auf Kant sind Locke, Hume und die Leibniz-Wolffsche Schule,
doch spiegelt sich in der Philosophie Kants auch der Grundgedanke Platons wider, wonach
der empirischen Welt kein Sein zukomme, da sie vom Werden konstituiert ist. Hier verweist
Schopenhauer v.a. auf das Höhlengleichnis (WWV I, S.582).Diese Einsicht finde sich auch in
den Veden (Maja-Lehre; vgl. Zimmer, S.30ff; S.368ff). Dort wird die sinnlich erfahrbare
Realität als Trugbild aufgefasst, als Schleier der Maja. Der Welt der Maja entspricht die Welt
der Erscheinungen (phänomenale Welt). Insofern ist Kants Ansatz nicht neu, doch im Ge-
gensatz zu den eher mystischen Lehren Platons und der Inder philosophisch stringent.
8
,,Solche deutliche Erkenntniß und ruhige, besonnene Darstellung dieser traumartigen Beschaffenheit der
ganzen Welt ist eigentlich die Basis der ganzen Kantischen Philosophie, ist ihre Seele und ihr allergrößtes Ver-
dienst." (WWV I, S. 583)
Kant gelang die Darstellung dieser ,,traumartigen Beschaffenheit", indem er das Erkenntnis-
vermögen selbst analysierte.
Die bisherige abendländische Philosophie habe den Fehler begangen, Zeit, Raum und Kausa-
lität zu verabsolutieren und aus diesen Gesetzen der Erfahrung das Dasein als solches abzulei-
ten. Von voraussetzungslosen aeternae veritates auszugehen, um dadurch Wesen und Sein
der Welt zu ergründen, vergleicht Schopenhauer mit dem Bestreben von Leuten, ,,welche
meinten, daß wenn sie nur recht lange geradeaus giengen, sie zu der Welt Ende gelangen
würden[.]" (WWV I, S.584)
Die Unterschiedlichkeit der Ansätze liegt in der Differenz von dogmatischer und kritischer
bzw. Transzendentalphilosophie begründet. Der kritische Ansatz besteht nun darin, gerade die
aeternae veritates zu thematisieren und sie im Intellekt zu lokalisieren. ,,Vor Kant also waren
wir in der Zeit; jetzt ist die Zeit in uns[.]" (WWV I, S.589)
Kant habe damit den Realismus zerstört, worunter Schopenhauer den Irrtum, Erscheinungen
für das wahrhafte Wesen der Welt zu halten, versteht. Diesen Irrtum hätten zwar schon Ma-
lebranche und v.a. Berkeley erkannt, doch wären sie nicht in der Lage gewesen, ihm etwas
entgegenzusetzen.
Diese Destruktion der ,,realistischen Philosophie (ebd.)" wirkte sich auch auf den Bereich der
Ethik aus. Dort habe sich alles um bloßen ,,Wortkram" und ,,Begriffe ohne positiven Inhalt",
wie z.B. Vollkommenheit gedreht, ein Begriff, der ,,wie ein algebraisches Zeichen, ein bloßes
Verhältnis in abstracto andeutet (alle WWV I, S.590)." Kant jedoch gelang es, die Ethik von
der Erscheinungswelt abzukoppeln und zu zeigen, daß sie sich ihrem Wesen nach auf das
Ding an sich bezieht. Das zweite Hauptverdienst Kants sieht Schopenhauer deshalb auch
darin, daß dieser die moralische Komponente menschlichen Handelns unabhängig von den
Prinzipien der phänomenalen Welt sieht und ,,als etwas, welches das Ding an sich unmittelbar
berühre, darstellte[.]" (WWV I, S.586)
Kant hat jedoch vor dem Ding an sich halt gemacht und es noch nicht als den Willen erkannt;
diesen Schritt gemacht zu haben sei seine, Schopenhauers, Vollendung der Kantschen Philo-
sophie.
9
Der dritte Verdienst besteht in der Überwindung der scholastischen Philosophie, die für
Schopenhauer mit Augustinus beginnt und erst ,,dicht vor Kant (ebd.)" endet. Erst Kant hat
die Philosophie vom Primat der Religion befreit. Dies ist in erster Linie eine Anspielung auf
die Destruktion der spekulativen Theologie und rationalen Psychologie in der KrV.
Mit Kant beginnt nach der 1400 Jahre dauernden Epoche der Scholastik nun ein neues, näm-
lich das dritte Zeitalter der Philosophie. Die Leistung Kants bestand dabei nicht in einem
geschlossenen System, das er hinterlassen oder einer Schule, die er begründet hätte, war also
keine positive, sondern durch das Wachrütteln der Philosophie aus den metaphysischen
Träumereien und die oben beschriebene Destruktion des ,,Realismus", in erster Linie eine
negative Wirkung. Nach der bzw. durch die Kantsche Revolution, genauer gesagt, durch ihren
primär negativen Charakter, entstand jedoch ein Vakuum in der Philosophie, da
,,[a]lle zwar merkten, es sei etwas sehr Großes geschehen, aber doch keiner recht wußte was. Sie sahen
wohl ein, daß die ganze bisherige Philosophie ein fruchtloses Träumen gewesen, aus dem jetzt die neue Zeit
erwachte; aber woran sie sich nun halten sollten, wußten sie nicht." (WWV I, S.591)
In dieser Situation der Ratlosigkeit seien nun Leute aufgetaucht, die auf unzulängliche Art
und Weise versuchten, diese Leere in der Philosophie mittels ihrer eigenen Systeme zu über-
winden. Schopenhauer geht in seiner Anspielung auf den deutschen Idealismus noch weiter.
Er vergleicht die Kantsche Wende mit der Naturepoche, in welcher zuerst das Leben die Büh-
ne der Welt betrat und zwar noch in seltsamen und äußerst befremdlichen Wesenheiten. E-
benso sei in der Philosophie ,,ein Zeitalter der ungeheuren Ausgeburten" (WWV I, S.592)
nach und durch Kant angebrochen, was darauf schließen läßt, daß die Kantsche Philosophie
auch Mängel aufweist, die derartige Monstrositäten erst erzeugen.
10
Kant ging anknüpfend an den Dogmatismus seiner Vorgänger, so Schopenhauer - von drei
Voraussetzungen aus:
·
Er versteht Metaphysik als Wissenschaft von Gegenständen, welche die Möglichkeit
von Erfahrung überschreiten.
·
Diese Gegenstände können nicht nach Prinzipien gedacht werden, die ihrerseits wieder
aus der Erfahrung genommen sind, sondern nur das a priori Gewusste kann über die
Möglichkeit von Erfahrung hinausgehen.
·
Derartige Grundsätze sind vorhanden und werden als ,,Erkenntnisse aus reiner Ver-
nunft" bezeichnet.
Kant geht jedoch über seine Vorgänger hinaus, indem er diese Erkenntnisse aus reiner Ver-
nunft nicht als absolute, ewige Wahrheiten, sondern als Formen des Intellekts fasst, also nicht
als Prinzipien, nach denen sich die Dinge als solche richten, sondern Gesetzmäßigkeiten, nach
welchen sich unsere Erkenntnis der Dinge als Erscheinungen richtet. Dieser Erscheinungswelt
entspricht in Schopenhauers Terminologie die Welt als Vorstellung. Demgegenüber steht das
Wesen der Dinge an sich, also die Welt als Wille.
Da sich die Erkenntnis auf die phänomenale Welt, also die Vorstellung beschränkt, ist Meta-
physik nach der obigen Definition nicht möglich.
Schopenhauer setzt zuerst bei der Definition von Metaphysik an und enttarnt diese als petitio
principii. Kant begründe seine Behauptung wonach die Metaphysik ihre Prinzipien nicht aus
der Erfahrung schöpfen dürfe, unzureichend.
Der fundamentale Trugschluss besteht darin, zu glauben, Metaphysik entspricht Erkenntnis a
priori, unabhängig von Erfahrung. Vielmehr muß die Erfahrung als Hauptquelle der Erkennt-
nis begriffen werden, woraus folgt, daß die Aufgabe der Metaphysik darin besteht, die Erfah-
rung im Hinblick auf diese ihre Funktion zu untersuchen. Schopenhauer will damit sagen, daß
es einen Mittelweg zwischen dem nunmehr überwundenen Dogmatismus und ,,der Ver-
zweiflung der Kantischen Kritik" (WWV I, S.594) gibt.
Die Kritik Schopenhauers hat noch weitere Dimensionen. So hält Schopenhauer fest, Kants
Stil sei zwar brillant und von einer glänzenden Trockenheit, doch oft auch unklar und verwor-
11
ren; außerdem übernehme er oftmals scholastische Begriffe. Die Eigenarten seines Stiles
hätten fatale Folgen: ,,Das Publikum war genöthigt worden einzusehen, daß das Dunkle nicht
immer sinnlos ist: sogleich flüchtete sich das Sinnlose hinter den dunklen Vortrag" (WWV I,
S.596). Wieder ein Seitenhieb auf den deutschen Idealismus.
Nun führt Schopenhauer einen seiner Hauptvorwürfe gegen Kant ein (WWV I, S.597ff), der
in der Folge als Architektonik-Vorwurf bezeichnet werden soll. Schopenhauer vergleicht die
Philosophie Kants mit dem Gotischen Baustil und hebt vor allem Kants Vorliebe für Symmet-
rie hervor, die sich am deutlichsten in seiner Urteilstafel und - darauf aufbauend - in der Kate-
gorienlehre zeigt. Dabei wird v.a. kritisiert daß Kant sich in seiner Betrachtung der Katego-
rien auf die Mathematik versteift, während er die anschauliche Erkenntnis vernachlässigt und
diese nirgends klar von der abstrakten Erkenntnis unterscheidet. Was die Formen der Urteile
angeht, hätte Kant zunächst feststellen müssen, daß es sich hierbei um Begriffe handelt. Da-
nach hätte das Wesen eines jeden dieser Begriffe und das Verhältnis von Begriff und An-
schauung geklärt werden müssen. Kant habe es versäumt zu zeigen, wie die empirische An-
schauung überhaupt ins Bewusstsein kommt. Aus all diesen Versäumnissen resultiert schließ-
lich, dass Kant keine klare Definition der Begriffe Verstand und Vernunft und v.a. keine klare
Abgrenzung dieser Begriffe voneinander liefert. Die Definition der Vernunft als Vermögen
der Prinzipien und des Verstandes als Vermögen der Regeln (wobei Regeln a priori aus der
reinen Anschauung erkannt werden, Prinzipien hingegen aus Begriffen a priori hervorgehen)
welche in KrV A299 zu finden ist, bezeichnet Schopenhauer schlichtweg als willkürlich
(WWV I, S.600). Darüber hinaus werden beide Begriffe an mehreren Stellen der KrV nicht
nur unterschiedlich und widersprüchlich, sondern schlichtweg falsch verwendet. So ist die
Vernunft das Schlussvermögen (KrV A 330), während der Verstand das Vermögen zu urtei-
len darstellt (KrV A 69). Damit sei gesagt, daß der Verstand unmittelbar aus einem Satz fol-
gert, während die Vernunft für jene Fälle zuständig ist, bei welchen eine Kopula benötigt
wird. An einem Bespiel erläutert, würde das bedeuten, daß der Verstand zwar aus dem Satz:
,,Alle Menschen sind sterblich" folgern kann, daß einige Sterbliche Menschen sind, aber aus
demselben Satz auf: "alle Gelehrten sind sterblich" zu schließen, vermag allein die Vernunft.
Weiters wird die Vernunft noch als beharrliche Bedingung aller willkürlichen Handlungen
(KrV A 553), als Vermögen, von Behauptungen Rechenschaft zu geben und die Begriffe des
Verstandes zu Ideen zu vereinigen (KrV A 642ff), sowie als Vermögen, das Besondere aus
dem Allgemeinen zu deduzieren (KrV A 646) definiert.
12
Der Verstand taucht in der KrV mal auf als Vermögen, Vorstellungen hervorzubringen (KrV
A 51), durch Begriffe zu erkennen, also zu urteilen oder schlichtweg zu denken (KrV A 69),
zu Erkenntnissen schlechthin (KrV B 137), der Regeln (KrV A 132), dann wieder als Quell
der Grundsätze der Regeln (KrV A 158), als Vermögen der Begriffe (KrV A 160) sowie der
Einheit der Erscheinungen durch Regeln (KrV A 302).
Aus dieser Konfusion resultiert auch die für Schopenhauer vollkommen verfehlte Unterschei-
dung von theoretischer und praktischer Vernunft. Er wirft Kant sogar vor, die Verstandesbeg-
riffe (Kategorien) von den Vernunftbegriffen (Ideen) differenziert zu haben, ohne zu definie-
ren, was überhaupt ein Begriff ist. Darüber hinaus habe es Kant nicht für nötig befunden zu
klären, was ein Gegenstand und was die Vorstellung, was Anschauung und was Reflexion,
was Objekt und was Subjekt, ja nicht einmal, was Wahrheit und was Schein sei.
Noch einmal hält Schopenhauer fest, daß die Unterscheidung von Ding an sich und Erschei-
nung zwar richtig ist, daß jedoch seltsamerweise Kant dabei nicht von der ,,unleugbaren
Wahrheit ,K ei n O b j e k t o h n e S u b j e k t'" (WWV I S.602) ausgeht, die doch bereits
Berkeley erkannt hatte. Schopenhauer relativiert diese Kritik jedoch umgehend, da er sie nur
für die zweite Auflage der KrV will gelten lassen. In KrV A 348-392, einer Stelle, die in der
zweiten Auflage weggelassen wurde, tritt Kants Idealismus hingegen noch deutlich hervor.
Hier trifft man auf einen weiteren Hauptkritikpunkt Schopenhauers: die zweite Auflage der
KrV stelle ,,einen verstümmelten, verdorbenen, gewissermaaßen unächten Text" (WWV I,
S.604) dar, welcher die Widersprüche und Unverständlichkeit der KrV erst bedingt. In erster
Linie ist es die Herleitung des Dinges an sich, die einen Selbstwiderspruch darstellt. Jedes
erkennbare Objekt muß in der empirischen Anschauung gegeben sein, d.h. für Schopenhauer,
daß die Sinnesempfindung eine externe Ursache haben muß. Daraus folgt, daß das Ding an
sich nicht erkannt werden kann, weil es sich der empirischen Anschauung entzieht. Dieser
Schluss ist jedoch nur auf dem Prinzip der Kausalität aufbauend möglich, welches subjektiv,
weil a priori bekannt ist; ebenso ist die Sinnesempfindung subjektiv und sogar der Raum, den
wir bei der Unterscheidung von innerer Empfindung und äußerem Reiz voraussetzen müssen.
Somit ist für Schopenhauer die ganze empirische Anschauung subjektiv und so läßt sich ein
von ihr Verschiedenes, also das Ding an Sich gar nicht denken. Erst wenn man das Selbstbe-
wusstsein heranzieht, in welchem sich der Wille ,,als das Ansich unserer eigenen Erschei-
13
nung" (WWV I, S.605) manifestiert, läßt sich das Ding an sich von der Vorstellung trennen:
Es besteht im Willen.
Zusammenfassend ließe sich also sagen, nicht das Ding an sich ist der große Irrtum der Kant-
schen Philosophie, sondern die Art seiner Herleitung. Dieser Irrtum resultiert v.a. aus der
bereits dargestellten Begriffsverwirrung im Kantschen System.
Dieser erste Ausblick enthält in nuce die Hauptkritikpunkte Schopenhauers. Zusammenge-
fasst lauten diese wie folgt:
·
Es gibt keine von jeglicher Erfahrung unabhängige Erkenntnis a priori und diese ist auch
nicht Gegenstand der Metaphysik.
·
Die empirische Anschauung wird vernachlässigt und Kant erläutert nirgendwo explizit,
wie diese zu Stande bzw. ins Bewusstsein kommt.
·
Kants Darstellungsstil ist dunkel und verworren und es wird häufig auf scholastische
Begrifflichkeiten zurückgegriffen. Hierin ist ein Bündel von Kritikpunkten verpackt:
durch die angeblich teils mangelhafte, teils falsche Definition von Schlüsselbegriffen,
wie Anschauung, Verstand, Vernunft, Vorstellung, Reflexion, entstehen Missverständ-
nisse und Irrtümer. V.a. die unklare Definition bzw. Unterscheidung der Begriffe Ver-
nunft und Verstand trägt entscheidend dazu bei, dass sich die ganze Untersuchung oft
auf Holzwege begibt. Nicht zuletzt resultiert daraus die diffuse Unterscheidung zwi-
schen theoretischer und praktischer Vernunft.
·
Kant zeigt eine Vorliebe für architektonische Symmetrie in der Komposition seines
Werkes, zu deren Gunsten er des Öfteren den behandelten Gegenstand ungebührlich
verformt; er lässt sich sozusagen zu oft von der Form der Darstellung zum Nachteil des
dargestellten Inhalts leiten. Den prägnantesten Ausdruck dieser Symmetrieverliebtheit
stellt verbunden mit dem o.g. Kritikpunkt des fehlerhaften Begriffsgebrauchs die
Kategorienlehre dar.
·
Die zweite Auflage der KrV ist mitverantwortlich für die Widersprüche, die in diesem
Werk auftreten
1
.
1
Dieser Kritikpunkt wird in der folgenden Untersuchung nicht explizit behandelt, da er keine unmittelbare
Relevanz für die Zielsetzung vorliegender Arbeit besitzt.
14
·
Die Annahme eines Dinges an Sich außerhalb der Erscheinungswelt ist zwar richtig,
dessen Herleitung jedoch falsch.
Vor dem Hintergrund dieser Hauptkritikpunkte ist die Schopenhauersche Auseinandersetzung
mit der Kantschen Philosophie zu lesen. Schopenhauer selbst ist in seiner Darstellung oft
sprunghaft, überfliegt zunächst große Abschnitte, um später einzelne ihrer Punkte genauer zu
betrachten. Die Auflistung der wesentlichen Argumente Schopenhauers gegen Kant soll hier
gewissermaßen als Leitfaden und Orientierungshilfe dienen.
15
I. ABSCHNITT:
DER WEG ZUM DING AN SICH
I.1. Transzendentale Ästhetik
Die Transzendentale Ästhetik ist für Schopenhauer der gelungenste Abschnitt in der gesamten
KrV, enthält sie doch ,,das Seltenste auf der Welt" (WWV I, S.607), nämlich vollkommen
stringente und unbezweifelbare metaphysische Erkenntnisse. Die Kantsche Entdeckung der-
jenigen Formen des Intellekts, welche nicht aus der Erfahrung stammen, sondern diesem a
priori innewohnen, ist die Grundlage der großen Wende in der Philosophie, die mit Kants
Namen verknüpft ist. Die Erkenntnis richtet sich nach den Formen des Intellekts, die somit
auch Formen der Erkenntnis als solcher sind. Trotz ihrer fundamentalen Einsichten ist die
Transzendentale Ästhetik jedoch unvollständig. Kant hätte gleich die ganze euklidische Me-
thodik über Bord werfen müssen, da ja die geometrische Erkenntnis der Anschauung imma-
nent ist. Vielmehr gibt es zur transzendentalen Ästhetik für Schopenhauer nicht zu sagen;
Kants Bestimmung von Raum und Zeit fasst er als schlüssig auf. Der Übergang zur transzen-
dentalen Logik, also von der Anschauung zum Denken, ist für ihn jedoch sprunghaft und ohne
klare Überleitung.
Da Schopenhauer die transzendentale Ästhetik grosso modo akzeptiert, ja sogar von ihr
schwärmt: ,,Alles ist lichtvoll, keine finstern Schlupfwinkel sind gelassen: Kant weiß, was er
will, und weiß, daß er Recht hat" (WWV I, S.618), sei diese hier nur summarisch dargestellt.
Ihre Resultate sind für die Betrachtung der transzendentalen Logik und deren Kritikpunkte
von Bedeutung.
Die transzendentale Ästhetik befasst sich mit der Anschauung als Werkzeug der Erkenntnis
(KrV B 33ff/A 19ff). Wie Kant später ausführt (KrV B 74/A 50), stellt die Anschauung einen
der beiden Erkenntnisstämme dar; der andere besteht im Denken. Die Erkenntnisfunktion der
16
Anschauung bezieht sich direkt und unmittelbar auf Objekte, welche durch die Sinnlichkeit
gegeben sind. Die auf diese Weise erzeugten Anschauungen werden schließlich vom Verstand
als dem Begriffsvermögen gedacht. Entscheidend hierbei ist, dass das Denken sich nicht di-
rekt auf die Gegenstände, sondern auf die Anschauungen der Gegenstände bezieht.
Es werden zwei Arten der Anschauung unterscheiden:
Die empirische Anschauung bezieht sich auf Gegenstände, welche das Anschauungsvermö-
gen mittels Empfindungen affizieren und somit sinnlich vermittelt werden.
Die reine Anschauung oder reine Form der Sinnlichkeit besteht in Vorstellungen, die keinerlei
empirischen Gehalt haben, ist also eine Instanz a priori. Diese reine Form umfasst die Ver-
hältnisse innerhalb der Mannigfaltigkeit des sinnlich Gegebenen, ist also das Strukturprinzip
der Erscheinung als Objekt der empirischen Anschauung. Während also die Materie der Er-
scheinung a posteriori empirisch vermittels der Sinnlichkeit aufgenommen wird, ist ihre Form
a priori vorhanden.
Kant macht sich nun an die metaphysische Erörterung der Begriffe Raum und Zeit als Formen
der Anschauung, in welcher deren Wesen dargstellt werden soll. Darauf folgt eine transzen-
dentale Erörterung, in welcher die Möglichkeit und Grundlage verschiedener Wissenschaften
(Mathematik, Physik) behandelt wird.
Während der äußere Sinn (äußere Anschauung) die Ausdehnung, Gestalt und Lage eines
Gegenstandes festlegt und somit das räumliche Ordnungsprinzip darstellt, bezieht sich der
innere Sinn (innere Anschauung) auf die inneren Zustände des Subjekts und ordnet diese nach
Zeitverhältnissen.
Der Raum wird zunächst in vierfacher Weise bestimmt, wobei es sich um je zwei positive und
negative Bestimmungen handelt:
Der Begriff des Raums kann nicht aus der Erfahrung abgeleitet sein, da er jeglicher räumli-
chen Erfahrung bereits zugrunde liegt. Insofern kann man ihn als ,,Raum überhaupt", ,,Räum-
lichkeit" (beide Höffe 2003, S.97) oder ,,die Urgestalt von allem, was äußerlich da ist" (Gray-
eff, S.30) verstehen.
Da der Raum der äußeren Anschauung zugrunde liegt, ist er eine notwendige Vorstellung,
d.h. es kann kein Objekt ohne räumliche Ausdehnung und Position im Raum gedacht werden,
17
wobei sich jedoch ein Raum ohne ihn erfüllende Gegenstände denken lässt. Insofern ist der
Raum die Bedingung der Möglichkeit der Erscheinung.
Dass der Raum kein diskursiver Begriff, sondern eine (reine) Anschauung ist, erklärt sich wie
folgt: Ein Begriff vereinigt verschiedene Elemente unter sich und stellt deren allgemeinsten,
obersten Ausdruck dar; der Raum überhaupt verhält sich zu den in ihm vorkommenden Ein-
zelräumen nicht wie Allgemeines zum Einzelnen, sondern wie das Ganze zu seinen Teilen
(Höffe 2003, S.95). Seine Teile, die Einzelräume, können nur in ihm, dem Raum überhaupt
gedacht werden.
Daraus erhellt schon die Unendlichkeit des Raumes: einem Begriff können zwar unzählige
Vorstellungen subsumiert werden; der Raum aber enthält eine unendliche Mannigfaltigkeit
von Vorstellungen in sich. Insofern hat er keinen Begriffscharakter, sondern er ist eine reine,
apriorische Anschauung.
Der Raum bestimmt die Erscheinung formativ und ist dabei ein subjektives Prinzip der Sinn-
lichkeit, da er a priori als Anschauungsform im Gemüt liegt; insofern ist er transzendental
ideal. Andererseits wird durch die Raumvorstellung auch die Objektivität der Erscheinung
konstituiert, da ohne diese Vorstellung kein Gegenstand gedacht werden kann, d.h. der Raum
ist zugleich empirisch real (KrV B 44/A 28). Kant weist klar und ausdrücklich darauf hin,
dass der Raum zwar eine notwendige Vorstellung, eine ,,Bedingung der Sinnlichkeit" (KrV B
43/A 27) ist, diese jedoch nur Erscheinung enthält. Somit ist der Raum die Bedingung der
Möglichkeit der Gegenstände, wie sie uns erscheinen, was aber nicht bedeutet, dass dies auch
für die Dinge an sich gilt,
,,sondern daß uns die Gegenstände an sich gar nicht bekannt seien, und, was wir äußere Gegenstände
nennen, nichts anderes als bloße Vorstellungen unserer Sinnlichkeit seien, deren Form der Raum ist, deren
wahres Correlatum aber, d.i. das Ding an sich selbst, dadurch gar nicht erkannt wird, noch erkannt werden kann,
nach welchem aber auch in der Erfahrung niemals gefragt wird." (KrV B 45/ A 30)
Was für den Raum gilt, läßt sich analog dazu auch auf die Zeit anwenden (KrV B 46ff/ A
30ff). Die Zeit ist eine reine Form der sinnlichen Anschauung, ist nicht empirisch abgeleitet,
sondern liegt der Erfahrung des Zugleich und Nacheinander zugrunde. Sie ist eine notwendige
Vorstellung, mithin a priori gültig. Diese apriorische Gültigkeit besteht in der Eindimensiona-
lität der Zeit: verschiedene Zeiten (oder besser: Zeitperioden) können nur sukzessiv, nicht
zugleich gedacht werden, während sich dies beim Raum umgekehrt verhält. Die Zeit, als Zeit
überhaupt, ist unendlich und umfasst die einzelnen Perioden limitierend.
18
Als Form des inneren Sinnes ist die Zeit das Ordnungsprinzip der inneren Zustände, hat also
keinen direkten Außen- oder Objektsbezug. Dennoch ist sie vor dem Raum dadurch beson-
ders ausgezeichnet, dass sie die ,,formale Bedingung a priori aller Erscheinungen überhaupt"
(KrV B 50/A 34) ist. Alle Vorstellungen sind Teil des inneren Zustandes, dessen Formprinzip
die Zeit ist; somit bedingt die Zeit indirekt auch Vorstellungen, die sich auf Externa beziehen.
Wie der Raum, so hat auch die Zeit sowohl transzendental-idealen, als auch empirisch-realen
Charakter.
Durch diese Feststellung wird auch klar, warum die transzendental-ideale Raum-Zeit zugleich
empirisch-real ist, oder, anders ausgedrückt, warum die subjektiven Anschauungsprinzip des
Raumes und der Zeit objektive Gültigkeit beanspruchen können. Hier ist implizit bereits die
richtungweisende Unterscheidung zwischen Erscheinungswelt und Welt der Dinge an sich
enthalten. Erkenntnis ist dem Menschen nur von den Dingen, wie sie erscheinen, genauer
gesagt, wie sie ihm erscheinen, also den Objekten der Erscheinungswelt, nicht von den Din-
gen an sich möglich: ,,alle unsere Anschauung [ist] nichts als die Vorstellung von Erschei-
nung" (KrV B 59/A 41). Die Subjektivität als transzendental-idealer Faktor der Erfahrung
führt keineswegs dazu, dass die vom Menschen erfahrene Welt zum bloßen Schein wird. Die
Erscheinungswelt ist der Bezugsrahmen der menschlichen Erfahrung, nicht die Welt der Din-
ge an sich. Bezüglich einer Welt der Dinge an sich können der Raum und die Zeit keine Ob-
jektivität beanspruchen; in der uns zugänglichen Erscheinungswelt hingegen sind sie objektiv
gültige Prinzipien. Insofern ist Erscheinung keineswegs gleichbedeutend mit Schein (KrV B
68ff).
Diese Verbindung von transzendentaler Idealität und empirischer Realität ist besonders im
Bezug auf die Antinomien von Bedeutung und kann als Ansatz der Überwindung sowohl
spekulativer, als auch empiristischer (physikalistisch-reduktiver) Naturmodelle gesehen wer-
den (Höffe 2003, S.107f).
Raum und Zeit sind als reine Anschauungsformen bewiesen worden, d.h. sie sind Medien,
welche der Vermittlung zwischen Verstand und empirischer Welt dienen. Das Resultat der
transzendentalen Ästhetik liegt demnach in der Feststellung, dass Raum und Zeit keine exter-
nen Gegebenheiten oder den Dingen inhärierenden Qualitäten sind, sondern formative Prinzi-
pien, welche die Sinnesdaten grob vorstrukturieren, wodurch jedoch noch kein geordnetes
Gefüge von Vorstellung entsteht. Mit der Anschauung ist erst eine Seite des menschlichen
19
Erkenntnisvermögens untersucht worden. In der transzendentalen Logik sollen der Verstand
und seine Funktionsweise betrachtet werden.
I.2. Schopenhauers
Kritik
der Transzendentalen Ästhetik
Wie bereits erwähnt, lässt Schopenhauer die transzendentale Ästhetik im Großen und Ganzen
gelten, führt jedoch zwei Einwände gegen sie an, die er als Ergänzungen verstanden wissen
will.
Der erste Einwand betrifft die Rolle der Kausalität im Kantschen Modell. Kant wird die Kau-
salität später als Kategorie einführen, in der Anschauung tritt sie jedoch noch nicht auf. Für
Schopenhauer ist das Kausalgesetz jedoch die einzige Funktion des Verstandes. Er erweitert
also das Kantsche Modell der Anschauung dahingehend, dass er erstens den Verstand als
Vermögen der Anschauung auffasst und zweitens neben Raum und Zeit als Formen der An-
schauung das Kausalgesetz als vermittelnde Funktion postuliert. Um dieses Schema verständ-
lich zu machen, sei hier die Schopenhauersche Kausalitätslehre kurz erläutert.
I.2.1. Kausalität als Funktion des Verstandes -
Der Satz vom zureichenden Grunde
Für Schopenhauer ist der Satz vom zureichenden Grunde ein Ursatz der Erkenntnis. Bereits
bei Wolff ist dieser Satz - neben dem Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch - von funda-
mentaler Bedeutung und Schopenhauer führt ihn auch in der Wolffschen Formulierung ein:
Nichts ist ohne Grund warum es sei und nicht vielmehr nicht sei (Werke III, S.15). In dieser
allgemeinen Formulierung drückt er die apriorische Verbindung aller Vorstellungen des Sub-
jekts aus. Die unterschiedlichen Arten von Objekten bedingen verschiedene Arten der Ver-
bindung und dementsprechend gibt es auch verschiedene Formen, in welchen der Satz vom
zureichenden Grunde auftritt. Schopenhauer unterscheidet vier Spezifikationen des Satzes
vom zureichenden Grunde und mit diesen jeweils korrelierend vier Klassen von Vorstellun-
20
gen, wobei für die hier durchzuführende Untersuchung v.a. die erste und vierte Klasse rele-
vant sind.
Die erste Klasse bilden die anschaulichen, empirischen oder vollständigen Vorstellungen
(Werke III, S.42ff). Diese enthalten sowohl Form als auch Materie der Erscheinung und ste-
hen damit den abstrakten, d.h. rein gedachten Begriffen gegenüber. Raum und Zeit sind die
Formen dieser Vorstellungen, die Materie deren Gehalt. Die wechselseitige Durchdringung
von Raum und Zeit konstituiert die empirische Realität. Das Faktum der Subjektivität der
Anschauungsformen führt Schopenhauer zu dem bereits genannten Schluss, dass jegliche
Objektivität vom Subjekt bedingt ist (,,Kein Objekt ohne Subjekt"; vgl S.9). Der Satz vom
Grunde erlaubt es nun, empirische, d.h. raum-zeitliche Vorstellungen miteinander zu verknüp-
fen, genauer gesagt eine Abfolge von Zuständen zu erkennen. Der Satz vom Grunde struktu-
riert beide Anschauungsformen; in der Zeit ist er Bestimmungsgrund der Sukzession, im
Raum Bestimmungsgrund der Lage (WWV I, S. 42). Der Schnittpunkt von Raum und Zeit ist
die Materie. Sie füllt den Raum in allen drei Dimensionen aus und erstreckt sich als beständig
in der Zeit. Insofern ist ihr Sein wesentlich Wirken, was bedeutet: Materie ist die Manifestati-
on der Kausalität (ebd.; vgl. WWV II, S.71ff sowie Werke III, S.104). In dieser Klasse tritt
der Satz vom Grunde als das eigentliche Gesetz der Kausalität oder Satz vom zureichenden
Grunde des Werdens (Werke III, S.48) auf. Die Abfolge von Ursache und Wirkung manifes-
tiert sich im Auftreten eines Zustandes, der von einem anderen, vorhergehenden Zustand
bedingt ist. Kausalität findet demnach nur ihre Anwendung, wenn Veränderung vorliegt;
daher nennt Schopenhauer diese Spezifaktion auch den Satz vom zureichenden Grunde des
Werdens. Der zureichende Grund kann hierbei eine Ursache, ein Reiz oder ein Motiv sein.
Die Ursache bedingt Veränderungen im anorganischen Bereich, ist also wesentlich das Prin-
zip chemischer und physikalischer Prozesse. Hier gilt der Grundsatz, dass Ursache und Wir-
kung ihrer Intensität nach einander entsprechen. Reize treten im Pflanzen- und Tierreich auf,
wobei ein asymmetrisches Verhältnis von Ursache und Wirkung besteht. Motive gehen über
Reize insofern hinaus, als sie handlungsleitend sind. Zweckorientiertes Handeln ist nur durch
ein Erkenntnisvermögen möglich, d.h. der Zweck der Handlung muß vorgestellt werden kön-
nen.
Dieser ersten Klasse von Vorstellung entspricht der Verstand als subjektives Vermögen.
Der Verstand nimmt eine Wirkung als Sinnesreiz auf und führt diese Wirkung auf eine Ursa-
che zurück, die nur außerhalb des Körpers, also im Raum liegen kann (Werke III, S.69). Zu
21
dieser Operation ist der Verstand aufgrund seiner apriorischen Verfasstheit durch den Satz
vom Grunde fähig. Hierbei handelt es sich um eine Konstitutionsleistung des Verstandes:
Durch das Rückführen der Wirkung (Sinnesreiz) auf eine Ursache wird das Objekt als eben-
jene Ursache vom Verstand konstituiert. Somit wird eine bloß subjektive Empfindung zu
einer objektiven Anschauung. Diese Verstandesoperation ist intuitiv und nicht diskursiv. Es
handelt sich also nicht um ein Denken, sondern um unreflektierte Anschauung. Da die Sinne
nichts anderes als Datensätze, ,,rohen Stoff" (Werke III, S.70) liefern und erst der Verstand
den Gegenstand konstruiert, ist die empirische Anschauung als intellektuelle Anschauung zu
begreifen. Erst der Verstand erschafft eine Welt der Objekte und es besteht kein Unterschied
zwischen Objekt und Vorstellung; Objekt und Vorstellung sind ein und dasselbe (WWV I,
S.50). Insofern ist die empirisch wahrgenommene Realität die Welt als Vorstellung.
Der Satz vom Grunde manifestiert sich darüber hinaus noch als Satz vom Grunde des Erken-
nens, wenn er sich auf Urteile bezieht. Diese bilden die zweite Klasse von Vorstellungen
(,,Vorstellungen von Vorstellungen"). Das damit korrelierende Vermögen stellt die Vernunft
als die begriffsbildende und mit Begriffen operierende Instanz dar. Die dritte Klasse von Vor-
stellungen umfasst die reinen Formen der Anschauung, Raum und Zeit. Für das Vermögen
der reinen Sinnlichkeit fungiert der Satz vom Grunde als Satz vom Grunde des Seins. Dies sei
nur der vollständig halber erwähnt.
Die vierte und letzte Klasse von Vorstellungen ist relevanter: Sie enthält eigentlich nur eine
Vorstellung, nämlich das Subjekt des Wollens, welches für das erkennende Subjekt als Objekt
figuriert. Diese verwirrende Formulierung wird im Laufe der vorliegenden Arbeit, insbeson-
dere im zweiten Abschnitt an Klarheit gewinnen. An dieser Stelle sei nur erwähnt, dass dieser
Satz vom Grunde der Motivation, der mit dem Vermögen des Selbstbewusstseins korreliert,
noch von eminenter Wichtigkeit sein wird.
Es kann demnach festgehalten werden, dass Schopenhauer das Kantsche Modell der An-
schauung, wie es in der transzendentalen Ästhetik dargestellt ist, in zwei Punkten entschei-
dend modifiziert: Erstens fasst er den Verstand als das Vermögen der Anschauung, zweitens
fügt er den Formen der Anschauung, Raum und Zeit, noch die Kausalität als Funktion des
Verstandes hinzu. Der Verstand verbindet raum-zeitliche Koordinaten gemäß dem Satz vom
Grunde, wodurch für das Subjekt die Vorstellung der empirischen Realität entsteht (Werke
III, S.43). Damit versucht Schopenhauer den falschen Gebrauch des Terminus bei Kant zu
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836601078
- DOI
- 10.3239/9783836601078
- Dateigröße
- 490 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Wien – Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, Philosophie
- Erscheinungsdatum
- 2007 (Januar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- kant immanuel rezeption schopenhauer arthur philosophie erkenntnistheorie metaphysik
- Produktsicherheit
- Diplom.de