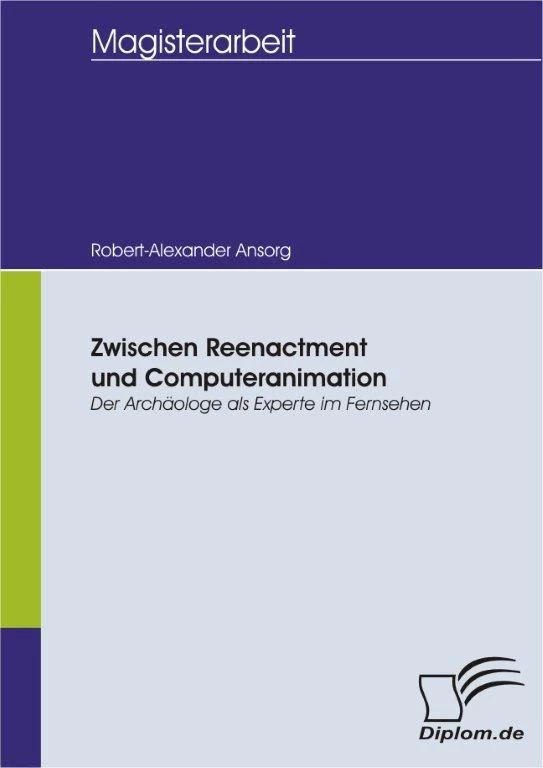Zwischen Reenactment und Computeranimation: Der Archäologe als Experte im Fernsehen
Zusammenfassung
Wissenschaftsjournalismus boomt. In Radio, Zeitung, Fernsehen und Internet platzieren eigenständige Wissenschaftsredaktionen Sendungen und Formate. Vorbei sind die Zeiten als sich an wenigen Programmtagen im Jahr vereinzelte Dokumentationen mit einem speziellen wissenschaftlich aufbereiteten Thema beschäftigten. Dies kommt durchaus auch heute noch vor. Dann wird aber das spezielle Thema, oft aus Anlass eines mehr oder minder bekannten Jahrestages, zu einem Event erklärt, entsprechend aufwendig, im Rahmen eines Themen- oder Eventtags, gestaltet und dieser so oft wie möglich rund um die Uhr beworben. Dokumentationen laufen dann direkt vor oder hinter einem das entsprechende Thema behandelnden Spielfilm, und eine angeschlossene Magazinsendung vermittelt, mal mehr, mal weniger interessantes dazugehöriges Sekundärwissen. So geschehen zum Jahrestag des Hitlerattentats von Oberst Graf von Stauffenberg am 20. Juli 2004 im ZDF oder dem Jubiläum zur Wende in der DDR am 09. November 2009 in der ARD. Andere Sender dagegen bewerben intensiv ihr dokumentarisches Vorzeigeformat zur Wissensvermittlung und senden unter der Flagge dieser Produktion einen ganzen Tag oder eine ganze Nacht Dokumentationen wie zum Beispiel das ZDF mit seiner Reihe Terra X.
Unabhängig von solchen Aufwand jedoch verteilen sich Produktionen wissenschaftlichen Inhalts über alle Sender und alle Programmtage in der Woche, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Einige private Programmbetreiber haben inzwischen, teils im Verein mit großen Verlagen oder Produktionsfirmen, eigene Dokumentationskanäle gegründet und bestücken das Programm mit Wissenssendungen aller Art. Im Pay-TV wird die Entwicklung besonders markant deutlich. Bei dessen Sendern ist eine immer weiter führende Programmspezialisierung und die Aufteilung in Spartenprogramme deutlich zu erkennen, so gliedert sich der Discovery-Chanel, welcher nach eigener Aussage ausschließlich Dokumentationen sendet und auch selbst produziert, inzwischen in einen Kanal mit eher klassischen Dokumentationen aus Wissenschaft und Technik im Programm, während ein weiterer Kanal, der Animal-Chanel desselben Betreibers, Tier- und Naturdokumentationen in den Vordergrund stellt. Mit dem Spartenprogramm Phoenix, das sich selbst als Ereignis- und Dokumentationskanal versteht, sind auch die öffentlich-rechtlichen Sender an dieser Entwicklung beteiligt. Es verdeutlicht das große Potential dieser Sparte.
Mit einer solchen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.2 Geschichte im Fernsehen
1.3 Wissenschaft und Journalismus
1.4 Konzept und Einteilung
1.5 Quellenlage
2. Archäologie und Film
2.1 Der Archetypus im Spielfilm
2.2 Blockbuster contra Wissenschaft
2.3 Erwartungshaltungen
3. Dokumentarische Formate und Archäologie
3.1 Dokumentarfilm oder Dokumentation?
3.2 Sensationen
3.3 Authentizität in dokumentarischen Formaten
3.4 Fiktionelemente
3.5 Film und Dokumentarfilm
3.6 Nutzungsverhalten und Formatbildung
3.7 Darstellung in den Medien
4. Die Himmelscheibe von Nebra
4.1 Das Artefakt
4.2 Herstellung
4.3 Die Entwicklungsphasen
4.4 Die Bildwelt
5. Filmanalyse
5.1 Einführung zu „Sterne, Mond und Horizont“
5.2 Beschreibung des Inhalts der Produktion „Sterne, Mond und Horizont“
5.3 Die Himmelsscheibe
5.4 Das Erlebniszentrum „Arche-Nebra“
5.5 Das Sonnenobservatorium von Goseck
5.6 Langeneichstätt
5.7 Das „Himmelswege“-Projekt
5.8 Die Wirkung von Ton und Musik
5.9 Die Musik in „Sterne, Mond und Horizont“
5.10 Allgemeine Analyse von „Sterne, Mond und Horizont“
5.11 „Terra X – Der Herr der Himmelsscheibe“
5.12 Beschreibung von „Terra X – Der Herr der Himmelsscheibe“
5.13 Die Musik in „Terra X – Der Herr der Himmelsscheibe“
5.14 Allgemeine Analyse von „Terra X – Der Herr der Himmelsscheibe“
6. Wissenschaftler als Experten im Fernsehen
6.1 Streit um Ergebnisse
6.2 Wissenschaftsjournalisten
6.3 Fach- und Wissenschaftsjournalist
6.4 Internet
6.5 Wissenschaftler in „Sterne, Mond und Horizont“
6.6 Wissenschaftler in „Terra X – Der Herr der Himmelsscheibe“
7. Reenactment
7.1 Die Reenactment Entwicklung
7.2 Reenactment im Fernsehen
7.3 Reenactmenteinsatz
7.4 Zum Reenactment in „Sterne, Mond und Horizont“
7.5 Zum Reenactment in „Terra X – Der Herr der Himmelscheibe“
8. Computeranimation
8.1 Computeranimation in „Sterne, Mond und Horizont“
8.2 Computeranimation in „Terra X – Der Herr der Himmelscheibe“
9. Klischees und Klischeewirkung
9.1 Klischees in „Sterne, Mond und Horizont“
9.2 Klischees in „Terra X – Der Herr der Himmelsscheibe“
10. Zusammenfassung
11. Literatur
11.1 Literaturliste
1. Einleitung
Wissenschaftsjournalismus boomt. In Radio, Zeitung, Fernsehen und Internet platzieren eigenständige Wissenschaftsredaktionen Sendungen und Formate. Vorbei sind die Zeiten als sich an wenigen Programmtagen im Jahr vereinzelte Dokumentationen mit einem speziellen wissenschaftlich aufbereiteten Thema beschäftigten. Dies kommt durchaus auch heute noch vor. Dann wird aber das spezielle Thema, oft aus Anlass eines mehr oder minder bekannten Jahrestages, zu einem „Event“ erklärt, entsprechend aufwendig, im Rahmen eines „Themen-“ oder „Eventtags“, gestaltet und dieser so oft wie möglich rund um die Uhr beworben. Dokumentationen laufen dann direkt vor oder hinter einem das entsprechende Thema behandelnden Spielfilm, und eine angeschlossene Magazinsendung vermittelt, mal mehr, mal weniger interessantes dazugehöriges Sekundärwissen. So geschehen zum Jahrestag des Hitlerattentats von Oberst Graf von Stauffenberg am 20. Juli 2004 im ZDF oder dem Jubiläum zur Wende in der DDR am 09. November 2009 in der ARD. Andere Sender dagegen bewerben intensiv ihr dokumentarisches Vorzeigeformat zur Wissensvermittlung und senden unter der Flagge dieser Produktion einen ganzen Tag oder eine ganze Nacht Dokumentationen wie zum Beispiel das ZDF mit seiner Reihe „Terra X“.[1]
Unabhängig von solchen Aufwand jedoch verteilen sich Produktionen wissenschaftlichen Inhalts über alle Sender und alle Programmtage in der Woche, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Einige private Programmbetreiber haben inzwischen, teils im Verein mit großen Verlagen oder Produktionsfirmen, eigene Dokumentationskanäle gegründet und bestücken das Programm mit Wissenssendungen aller Art. Im Pay-TV wird die Entwicklung besonders markant deutlich. Bei dessen Sendern ist eine immer weiter führende Programmspezialisierung und die Aufteilung in Spartenprogramme deutlich zu erkennen, so gliedert sich der „Discovery-Chanel“, welcher nach eigener Aussage ausschließlich Dokumentationen sendet und auch selbst produziert, inzwischen in einen Kanal mit eher klassischen Dokumentationen aus Wissenschaft und Technik im Programm, während ein weiterer Kanal, der „Animal-Chanel“ desselben Betreibers, Tier- und Naturdokumentationen in den Vordergrund stellt. Mit dem Spartenprogramm „Phoenix“, das sich selbst als Ereignis- und Dokumentationskanal versteht, sind auch die öffentlich-rechtlichen Sender an dieser Entwicklung beteiligt. Es verdeutlicht das große Potential dieser Sparte.
Mit einer solchen Spezialisierung lässt sich gezielt der jeweilig interessierte Zuschauerkreis ansprechen und an das Format binden. Um auch wirklich jeden potentiellen Kunden zu erreichen, wiederholen die Sender außerdem ihre Dokumentationen an unterschiedlichen Wochentagen und zu unterschiedlichen Tageszeiten. Sowohl bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, wie auch bei den Privaten findet zudem ein Austausch oder eine Mehrfachverwertung der dokumentarischen Produktionen statt.
Lange vorbei auch die Zeit als Wissen im TV noch hauptsächlich vom Schulfernsehen vermittelt wurde. Die Sendungen sind bunter, poppiger und jugendgerechter geworden. Dabei hatten die Naturwissenschaften, was die mediale Präsenz angeht, über lange Zeit die Nase vorn, mit Wissenschaftsjournalismus meinte man früher fast schon synonym Naturwissenschaft, Technik und Medizin, inzwischen ziehen die Geisteswissenschaften nach und holen immer mehr auf.[2] Seit es Fernsehen gibt betrachteten die Programmmacher, zu erkennen an der früheren Sendungsarmut dazu im Fernsehen, einige Geisteswissenschaften mit vorurteilsbeladener Ablehnung, quasi als dem Rezipienten zu schwer vermittelbar. Das ist vorbei, selbst die Philosophie, in den letzten Jahrzehnten äußerst stiefmütterlich von allen Massenmedien behandelt, da sie als nicht massenkompatibel galt, hat es ins Fernsehen geschafft.[3] Ob jedoch ein philosophisches Weltgerüst oder ein physikalisches Quantenmodell einfacher zu begreifen ist, nur weil es zeitgemäß im musikuntermalten 3D-Animationsfilm erklärt wird, ist zumindest zweifelhaft.[4]
Mittlerweile hat sogar die ursprüngliche Bezeichnung solcher Sendungen eine Weiterentwicklung erfahren, es werden immer noch eigene „Wissenschaftsmagazine“ produziert, die aber mittlerweile nicht mehr so heißen, sondern als „Wissensmagazin“ angekündigt werden. Winfried Göpfert stellt die Frage, ob schon hier versucht wird, dem Zuschauer den Einstieg in die ihm normalerweise fremde Welt der Wissenschaft zu vereinfachen.[5] Trotz der inhaltlich allgemein gehaltenen „Wissensmagazine“, sind die Sendungen mit eindeutig wissenschaftlichem Anteil auf dem Vormarsch und außerdem steigt die Anzahl der Wissenschaftsjournalisten stetig.
„Sie arbeiten in der Regel für Institutionen die den Regeln der Marktwirtschaft gehorchen; „sience sells!“ ist fast schon zu einem abgedroschenen Slogan geworden.“[6]
Wissenschaft im Fernsehen hat Hochkonjunktur. Nicht nur die Erwachsenen scheinen sich für Wissensformate begeistern zu können. Auch die Nachfrage nach Wissenssendungen für Kinder steigt. Geradezu eine Explosion erlebte dieses Format nach den desaströsen Pisaumfragen der vergangenen Jahre.[7] Neue Konzepte wie „Wissen macht Ah!“ bilden eine Symbiose mit älteren Formaten wie der „Sesamstraße“.[8] Schließlich ist das Fernsehen eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen bei Kindern und Jugendlichen. Der daraus entstehende Vorteil für die Sender liegt auf der Hand: Das Kind wird vom Beginn seiner Entwicklung an mit Wissenssendungen konfrontiert und lernt im besten Fall diese sinnvoll für sich zu nutzen. Eine solche frühe Gewöhnung wird auch das Verhalten bei der Wissensgewinnung im Erwachsenenalter bestimmen. Allen pädagogischen Untergangszenarien zum Trotz, spielt diese mediale Art der Wissensvermittlung, nicht zuletzt aufgrund der zeitunabhängigen, ständigen Abrufbarkeit von Sendungen im Internet, inzwischen eine sehr große Rolle.
1.2 Geschichte im Fernsehen
Von all den „Wissenschafts-“ oder „Wissenssendungen“ haben aber keine einen solch unvergleichlichen Aufschwung erlebt wie die mit historischem Inhalt. „Histotainment“ wird dies an verschiedener Stelle inzwischen genannt. Im Pay-TV gibt es mit dem „History-Chanel“ einen Sender, der sich, laut seiner Eigenwerbung, nur und ausschließlich den historischen Inhalten verschrieben hat. Natürlich schaffen es auch dort Sendungen ins Programm, deren angeblicher historischer Hintergrund sich nicht erschließt, aber die Definitionen dessen, was Geschichte, und was vor allen Dingen sendungswürdige und vermarktbare Geschichte ist, bleibt Ansichtssache der Redaktionen.
Diese Arbeit wird sich mit archäologischen Dokumentationen befassen oder vielmehr mit Dokumentationen archäologischen Inhalts, mit dem Ziel, die Rolle des Archäologen darin näher zu untersuchen. Die eben gemachte Unterscheidung ist notwendig, wie später noch deutlicher werden wird, denn eine klare inhaltlich wie formal abgegrenzte Dokumentation, gerade im historisch-archäologischen Segment, ist im Fernsehens nur noch selten zu finden. Die Hybridformen des dokumentarischen Formats überwiegen im Programmalltag. Fritz Wolf zitiert hier, um die stetig steigende Anzahl von Mischformen zu charakterisieren, ironisch das Kunstwort fictiohybridformatanimiert [sic].[9]
In den letzten Jahren ist die Anzahl jener Dokumentationen, welche einen archäologischen Inhalt oder zumindest einen archäologischen Zusammenhang vor historischer Kulisse beschreiben, enorm angestiegen. Nicht nur die Fernsehsender, auch Zeitung, Radio und die Online-Redaktionen haben diesen ganz speziellen Sendeinhalt für sich entdeckt. Nun ist es bei weitem nicht so, dass es vorher keine solchen Sendungen gegeben hätte, jedoch stellt sich die Frage, wieso auf einmal so viele Formate mit archäologisch-historischen Inhalt auf den Markt drängen. Neben den älteren, hinreichend bekannten Flaggschiffen der öffentlich-rechtlichen Sender wie „Terra X“ (ZDF) oder „Schliemanns Erben“ (ZDF), ziehen die privaten Sender nach und installieren mit „Gallileo-History“ (ProSieben) oder „Planetopia“ (Sat1) eigene Magazine, in denen oft historische oder archäologische Inhalte unter dem Einsatz eines Archäologen vermittelt werden.
Welchen Vorteil, wenn es denn einen gibt, hat dieser große Sendungsoutput für die Wissenschaft oder den Wissenschaftler, speziell den Archäologen, der es in diesem Rahmen immer öfter selbst ins Fernsehen schafft? Könnte bei einem Überangebot ein Übersättigungseffekt eintreten oder eine permanente Überforderung des Zuschauers ein dauerndes Desinteresse wecken?
1.3 Wissenschaft und Journalismus
Ein weiteres Problem eröffnet sich, denn bei der Produktion dieser Art Sendungen müssen die Vertreter zweier Fachgebiete, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten – der Archäologe und der Journalist – zusammenarbeiten.
Im Verhältnis zwischen Wissenschaft und Journalismus, bestehen bestenfalls unterschwelliges Misstrauen und fest zementierte Vorurteile, in anderen Fällen ausgeprägte Abneigung, bis hin zu in der Öffentlichkeit geführten Fehden zwischen Journalisten und Wissenschaftlern. Die Kritik an der Wissenschaft lautet regelmäßig: Sie nutzte eine kryptische, nur ihr vertraute Sprache, wohne, beschützt von Eingeweihten, in einem unerreichbaren Elfenbeinturm und lege sich mit Blick auf die von ihr gefundenen Erkenntnisse nie fest. Umgekehrt gelten Journalisten als mäßig gebildet – ihre Berufsbezeichnung ist noch nicht einmal geschützt – die Berichterstattung orientiert sich ausschließlich an Katastrophen und Sensationen, nicht am mühseligen Wissenschaftsbetrieb und seinem täglichen Fortgang. Entsprechend verzerren, verkürzen und verfälschen die Journalisten die für die Gesellschaft folgenreiche wissenschaftliche Arbeit. Von den Journalisten wird dann angeblich ein beliebiges, einseitiges, schnell konsumierbares Destillat erstellt, in dem die tatsächlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse kaum noch zu erkennen sind.[10] Vorurteile sind also auf beiden Seiten im Überfluss vorhanden.
Bei Sendungen mit archäologischem Inhalt ergeben sich außerdem noch weiterführende Fragen. Es gibt weltweit viele archäologische Artefakte und Ausgrabungsstätten, die regelmäßig in den Medien Beachtung finden. Andere, genau so interessant, werden zum Unmut der Archäologen kaum je gezeigt. Auch die Struktur der Sendungen gibt oft Rätsel auf: Warum füllen sich historische Dokumentationen immer mehr mit dem so genannten „Reenactment“?[11] Welche Wirkung hat der Archäologe noch, wenn er zwischen Reenactmentszene mit wissenschaftlichen Erklärungen auf der Leinwand erscheint? Findet eine Wissensvermittlung über den Forschungsstand, an welcher dem Archäologen ja gelegen ist, überhaupt noch statt?
Um einen Ansatzpunkt für die Beantwortung solcher Fragen und der sich daraus ergebenden Zusammenhänge zu bestimmen, ist es von Nöten ein möglichst allgemein bekanntes und medial präsentes archäologisches Beispiel auszuwählen. Mit der Himmelscheibe von Nebra bietet sich hier ein hervorragendes Objekt. Dieses archäologische Artefakt, „gefunden“ in Deutschland, erregte und erregt die Aufmerksamkeit aller großen meinungsbildenden Medien weltweit und die der Fachpresse sowieso. Die Berichte und Spekulationen um die Bronzescheibe reißen nicht ab, auch weil sie den Blick der Archäologie auf ein ganzes Zeitalter in Europa so grundlegend verändert hat. Diese fortgesetzte mediale Aufmerksamkeit äußert sich in einer Reihe verschiedener Formate mit unterschiedlichen Ansätzen. Deshalb lässt sich auch in einem direkten Vergleich der Sendungen erfahren, welchen Wert eigentlich Dokumentationen archäologischen Inhalts und der Auftritt des Archäologen darin bei der Wissensvermittlung für den Zuschauer haben. Bei der Himmelsscheibe kommt der interessante Umstand hinzu, dass der Kreis der mit ihrer Erforschung direkt beschäftigten Fachkräfte zunächst relativ klein war und die in den ausgewählten Sendungen wirkenden Wissenschaftler zumindest in zwei Fällen dieselben sind. Somit kann ein direkter Vergleich zwischen den jeweiligen Auftritten, ihrer Wirkung und Inszenierung erfolgen.
1.4. Konzept und Einteilung
Um Aussagen zu den oben gestellten Fragen machen zu können, wurden zwei verschiedene Sendungen ausgewählt. Beide Produktionen folgen unterschiedlichen Konzepten. Aufgrund von Erfolg und Bekanntheitsgrad des Formats, fiel die Wahl auf eine Sendung aus der „Terra X“-Reihe des ZDF mit dem Titel „Der Herr der Himmelsscheibe“. Für die Auswahl der zweiten Sendung, „Himmel, Mond und Horizont“, produziert im Auftrag des MDR, sprach der Umstand, dass sie unter anderem vom Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte in Halle selbst vertrieben wird und von einer regional ansässigen Firma produziert wurde.
Um eine bessere Übersicht zu erreichen wurde die folgende Untersuchung in verschiedene Abschnitte geteilt. Zunächst soll es kurz um das vom Spielfilm vermittelte Bild der Archäologie und das des Archäologen überhaupt gehen. Ein solcher kurzer Überblick war notwendig geworden, als sich im Laufe der Beobachtungen in den untersuchten Dokumentation, zumindest in einem Fall, eine starke Anlehnung an den Spielfilm und damit auch an gewisse spielfilmtypische Elemente ergab.
Einige Beobachtungen zu dem Begriff der Dokumentation und Dokumentation mit archäologischem Anteil folgen, um einen Überblick über die Sachlage im journalistischen Bereich zu geben. Der anschließende Teil befasst sich, nach einer kurzen Einführung zum archäologischen Hauptthema der Sendungen, mit der Analyse der beiden ausgewählten Dokumentationen. Einige wichtige Aspekte dieser Analyse, die für eine genauere Bestimmung wichtig erschienen, wie etwa die Frage nach der Stellung des Experten in den vorliegenden Sendungen, nach dem Reenactmentanteil, der Computeranimation, und der Klischees wurden einzeln in besonderen Abschnitten behandelt.
1.5. Quellenlage
Die Quellenlage, zumindest zu Teilen des Themas, wie etwa der Frage nach dem dokumentarischen Format überhaupt, ist sehr umfangreich, was eine massive Beschränkung notwendig macht. Zum einen beschäftigen sich zahlreiche, auch neuere Untersuchungen mit dem Bereich der Dokumentation oder mit den dokumentarischen Formaten im Fernsehen an sich. Zum anderen wird in solchen Analysen in vielen Fällen auf das „Histotainment“, welches mit den Erfolgen einiger Formate ins Kreuzfeuer der Medienkritik geriet, eingegangen.
Diese Art Sendungen beförderten eine anhaltende kritische Beobachtung durch die Medienwissenschaft. Daraus entstanden dann in der Regel Untersuchungen zu Fragen nach der Darstellung von geschichtlicher Realität, zum Reenactment oder zur Computeranimation. Die bisherigen Untersuchungen bewerten allerdings selten die Rolle des Archäologen als Experten in einer filmischen Dokumentation, obwohl durchaus eine Beschäftigung mit dem archäologischen Film oder dem Archäologen im Film stattfindet, dann allerdings mehr zu grundlegenden Fragen, wie der Geschichte des archäologischen Films selbst oder unter Berücksichtigung gewisser fachlicher Prämissen, wie etwa der Steinzeit.[12]
2. Archäologie und Film
Wie später der Film, nahm die Kunst ganz allgemein den Archäologen und seine Profession als thematische Inspirationsquelle auf. Malerei[13], Literatur[14] und Photographie[15] thematisierten archäologische Forschungen oder den Archäologen selbst.[16] Mit den spektakulären Entdeckungen Heinrich Schliemans, Carl Koldeweys und Howard Carters weitete sich die Faszination für diesen vergleichsweise jungen Bereich der Altertumswissenschaften noch aus. Erwähnenswert ist dabei die so genannte „Ägyptomanie“, welche im Zuge der ägyptischen Expedition Napoléon Bonapartes von 1798 – 1801 durch Europa rollte und einen Höhepunkt markiert. Die schiere Begeisterung für die fremde Kultur schlug solch hohe Wellen, dass Kleidung, Schmuck und Möbel im „ägyptische“ Stil reißenden Absatz fanden. In den Anfangsjahren der Archäologie, welche als eigener Wissenschaftszweig von manchen nicht ernst genommen wurde, entwickelten sich einige Arbeitstechniken der darstellenden Kunst wie Graphik oder Photographie zu wichtigen Arbeitsmitteln der Archäologen. Die Beschäftigung des Films mit der Archäologie und dem Archäologen als filmisches Thema begann relativ früh und das Sujet blieb über die Jahrzehnte der Produktionen für Filmemacher interessant. Beide, der Film und die Archäologie, teilen denselben Entstehungszeitraum ab etwa 1895. Der Film prägte das Bild des Archäologen und seiner Arbeit in der öffentlichen Meinung entscheidend mit.
Nach bisherigen Forschungsergebnissen erschien einer der ersten Archäologen, damals noch im Stummfilm, schon 1915 in „The Galloper“ im Kino. Nicht nur als Charaktere im Film traten Archäologen auf, sondern sie arbeiteten schon zu jener Zeit als Berater an entsprechenden Filmprojekten mit. Für den teuersten Film der Stummfilmzeit, „Ben Hur“, wurde unter der Leitung des Architekten und Archäologen Horace Jackson der Circus Maximus nachgebaut.[17] Schon früh griffen die Filmschaffenden auf das Fachwissen der Spezialisten zurück.
2.1. Der Archetypus im Spielfilm
Das Bild, welches der Film von der Archäologie im Kino zeichnete, entsprach schon damals, 1915, nicht der Realität der wissenschaftlichen Arbeit. Einerseits wurde der Archäologe heroisiert, andererseits ist die Archäologie zum Teil selbst nicht ganz unschuldig an dieser filmischen Abbildung. Einige Vertreter der „Spatenwissenschaft“ verfolgten massiv eine Strategie der idealisierten Selbstdarstellung. Durch Bücher und Bilder zweifellos befördert, umwehte den Archäologen die Aura des furchtlosen Abenteurers, und gerade im Zeitalter der großen archäologischen Entdeckungen des 19. Jh. betrieben illustre, wagemutige Gestalten diesen Berufszweig. Männer deren spektakuläre Entdeckungen und abenteuerliche Lebenswege zu einem großen Teil für den Ruf des Archäologen von heute mitverantwortlich sind.
Das Bild des Archäologen in der Öffentlichkeit bestimmte der Abenteurer, welcher wider alle Tücken die unglaublichsten Dinge entdeckt.
Der Abenteurer, dieser Archetypus einer Figur, macht das Substrat aus, das noch heute in zahlreichen Variationen die Filme archäologischen Inhalts bestimmt und von manchen Archäologen als nicht gerade vorteilhaft empfunden wird.[18] Der Archäologe hat es in dieser Rolle bis in die Blockbuster Hollywoods geschafft. Jedoch dient sein Hintergrund als Wissenschaftler oft nur zur Legitimation, um als ambitionierter Globetrotter die Welt zu bereisen oder gleich, weniger rühmlich, als Grabräuber zu agieren. Diese Art der Darstellung eines ganzen Wissenschaftszweigs schadet ihrem Ansehen beim Publikum seltsamer Weise nicht, es erwartet diese Überzeichnung geradezu und so scheint eine eigenartige und ambivalente Faszination vom Archäologen auszugehen.
Der Film „Indiana Jones – Raiders of the Lost Ark“ von Steven Spielberg wurde überaus erfolgreich. Harrison Ford unterrichtet als „Indiana Jones“ tatsächlich in einigen Szenen an einer Universität, bevor er sich aufmacht die mythischen Gegenstände der Welt zu entdecken. Der „Indiana Jones“-Plot war so erfolgreich, dass man ihn fortsetzte. Vier Teile sind es bisher und weitere werden, glaubt man den Plänen der Studios, noch folgen. Der Erfolg scheint, ob der immer gleichen Geschichte unverständlich, Haupthandlung des Plots ist eine ungeheuerliche Schatzsuche nach Objekten aus der Mythologie oder Sagenwelt, die durch archäologisches, materielles und politisches Interesse notwendig ist.[19] Der Erfolg dieser einfachen Geschichte wurde auch an anderer Stelle fortgesetzt. In unzähligen Comics, Büchern und schließlich einer Serie, welche die Abenteuer des Haupthelden in seiner Jugend thematisiert, verfuhr man nach diesem Muster. Hinter dem Film stehen zwei der erfolgreichsten Akteure Hollywoods, Steven Spielberg und George Lukas, wobei George Lucas schon mit der „Star-Wars“-Reihe überaus erfolgreich war. Das einer der Schauspieler, welcher schon in eben jener legendären Filmfolge mitwirkte, auch die Rolle des „Indiana Jones“ verkörpert, mag einen Teil zum Erfolg der Filme beigetragen haben.[20] Nach Georg Sesslen gelang es den „Indiana Jones“-Filmen ein ganzes, zur Zeit seines ersten Auftretens danieder liegendes Filmgenre, nämlich das des Abenteuerfilms, zu reanimieren. Nach seiner Einschätzung ist „Indiana Jones“ die Reaktion auf die hemmungslose Gewaltendfesselung und den technologischen Overkill auf der Leinwand in den 80er Jahren, wieder zurück zu einem „Kino der Träume“.[21] Die Hauptfigur der „Indiana Jones“-Filme ist demnach das Vorbild für eine ganze Reihe einsamer Helden, wie die englische Antwort „Quartermain“, das australische Pendant „Crocodile Dundee“ oder für den Hongkong Film Helden Jackie Chan in zahlreichen Abenteuerfilmen, wie „Der rechte Arm der Götter“.[22]
„Indiana Jones-Raiders of the Lost Ark“ ist eine ganz und gar unwahrscheinliche Geschichte, der Plot stellt keinen Anspruch auf Wahrhaftigkeit und das muss er auch nicht, denn ein Kinofilm ist Fiktion, die Erzählung einer erfundenen Geschichte voller Versatzstücke vorhandener Mythen und Legenden unter Einsatz aller vorhandenen technischen Möglichkeiten. Eine formidable Werbung für das Fach sind die „Indiana Jones“-Filme allemal. Leider in gewisser Weise auch ein Fluch. Denn seit „Indiana Jones“ verbinden sich mit dem Ruf des Archäologen viele Klischees.[23] Die erfolgreiche Filmfolge beeinflusst ihre Genrenachfolger in hohem Maße. Ob im Plot von „Die Akte Golgatha“, das „Das Jesus Video“ oder „Lara Croft: Tomb Raider“, einer der Hauptakteure hat Archäologie studiert. Auffällig bleibt der sich oft ähnelnde Plot dieser Filme. In der Regel findet der Archäologe, nach dem Endecken einer Reihe von uralten Geheimnissen und dem Lösen der in ihnen gestellten Rätselfragen, ein zwar mysteriöses, aber kulturhistorisch bekanntes Artefakt, dessen Bergung verheerende Folgen für die gesamte Menschheit hat. Den Rest des Films ist er damit beschäftigt, gegen eine Unzahl von haarsträubenden Tücken, die Folgen seiner Neugier zu überleben oder zu beseitigen. In „Stargate“ kann der Hauptheld nicht einmal die Fachkollegen von seinen unorthodoxen Ideen überzeugen, er ist eigentlich ein Underdog. Erst wenn er auf seinem Fachgebiet gefordert wird, entwickelt er ungeahnte Kräfte und Fähigkeiten. Ein Erzählplot, der ob seines Erfolges, den Start mehrerer Science-Fiction-Seriensequels möglich machte, in welchen immer wieder Archäologen auftauchen.[24]
Wie in „Planet der Affen“ und den „Enterprise“-Serien zu sehen, scheint es, wenn es um die Dramatisierung von Vergangenheit geht, auch im „Science-Fiction“-Kino bzw. Fernsehen nicht ohne einen Archäologen zu gehen.
2.2. Blockbuster contra Wissenschaft
„Esse est percipi“[25] erklärt Christoph Türcke zur hauptsächlichen Prämisse in der modernen Medienwelt. In gewisser Weise hat er damit Problem und Chance des Wissenschaftlers in den Medien beschrieben.[26] Dass Archäologen so oft in den Plots der Blockbuster auftauchen sollte sie freuen, dem ist aber in den seltensten Fällen so. Die Argumente sind häufig ebenso einleuchtend, wie gleich lautend. Der Wissenschaftler und seine Arbeit werde verzerrt dargestellt, mit der wissenschaftlichen Wirklichkeit, dem tatsächlichen archäologischen Erkenntnisstand, hätten die Filme in vielen Fällen nichts zu tun und man schlachte einen ernsthaften Forschungszweig zum Zwecke der reinen Unterhaltung aus.
Wie viele andere Wissenschaftler könnten sich im ähnlichen oder noch stärkeren Maße über die Filmindustrie beschweren! Man denke nur an die Biologen mit dem Fachgebiet Genetik, deren spektakuläre Erfolge im Filmlabor in geradezu zwingender Regelmäßigkeit mit Mord und Totschlag enden. Mal erschaffen sie, stets mit den besten Absichten, einen furchtbaren Virus wie in „I’m Legend“ oder sie beleben urzeitliche Tiere, welche nichts lieber tun als Menschen auf visuell besonders wirkungsvolle Art zu verspeisen, wie in „Jurassic Park“. Auch die Geologen könnten sich beschweren. Sie scheinen auf der Kinoleinwand immer nur das nahe Ende der Welt erklären zu dürfen, so in „The Day After Tomorrow“ oder in „2012“. Selbst die immer als etwas zurückgezogen geltenden Astronomen wurden schon, wenn sie denn ihr Observatorium einmal verlassen, zu Boten der Finsternis und des Untergangs wie in „Deep Impact“. Die Kritik an den Filmemachern wäre begründet, wenn diese nicht Unterhaltung produzieren würden. Ihre Filme sind moderne Märchen voller phantastischer, maßlos übertriebener Ereignisse und unglaublicher Wendungen. Die Darstellung der Wissenschaftler und ihrer Arbeit ist nichts als Fiktion, eine ausgedachte Vorstellung, entsprungen aus der Phantasie des Drehbuchautoren, wie Shakespeare es Mercutio sagen lässt: „Wohl war ich rede von Träumen, Kindern eines müs’gen Hirns von nichts als eitler Phantasie erzeugt, die aus so dünnen Stoff als Luft besteht ...“[27].
Lothar Mikos schreibt zur Frage der Wirklichkeit in Spielfilmen:
Es sollte jedoch klar sein, dass es beim Spielfilm nicht um die Wiedergabe von Wirklichkeit geht, sondern um die Repräsentation von Wirklichkeit, die dramaturgisch und ästhetisch gestaltet ist. In Spielfilmen werden Geschichten erzählt, die auf Wirklichkeitseindrücken beruhen, aber nicht Wirklichkeit sind.[28]
In den USA geht man mit unterhaltsamen Überzeichnungen von Figuren spielerischer um als in Deutschland. Dieser spielerische Umgang beschränkt sich nicht nur auf die Darstellung der Figuren, sondern auch auf die Auswahl und Bearbeitung der Themen.[29] Anstatt sich über die ihnen zukommende Aufmerksamkeit zu freuen, wird von Wissenschaftlern oft über eine vollkommen unsachliche Darstellung geklagt.[30]
Vielleicht sind Filme wie „The purple Rose of Kairo“ an diesem ablehnenden Verhalten schuld, weil der Archäologe hier in den Mittelpunkt des erotischen Interesses rückt, dabei spielt sein Beruf in diesem Streifen nur eine Nebenrolle. Oder es sind Filme in denen der Archäologe keinen angenehmen Charakter verkörpert wie in „March or die“.
Es stimmt also was Kurt Denzer schreibt: „... kaum ein Körnchen Wahrheit steckt in den Spielfilmen und die wissenschaftliche Arbeit ist nicht zu erkennen.[31] “ Jedoch, man kann es nicht oft genug betonen, geht es im Kino um Unterhaltung und nicht um wirklichkeitsnahe Darstellung. Der gegen alle Gefahren bestehende Archäologe, ist eine Projektionsfläche für die Phantasie des Zuschauers, nichts weiter. Michael Mittermeier erklärte diesen Umstand in einem Comedyprogramm, als seine Freundin den Realismus der Leinwanddarstellung bezweifelt, treffend: „Hier geht’s um Unterhaltung, nicht um Realismus, außerdem heißt der Film „Auf der Flucht“ und nicht „Gekriegt [sic] nach fünf Minuten““.[32]
Der Auftritt der Filmarchäologen ist in der Regel nur dem Archäologen unangenehm, dem Zuschauer sind solche Animositäten herzlich egal, wie der Erfolg der Filme beweist.[33] Wohl kaum ein Archäologe ist noch nicht auf seine filmischen Kollegen angesprochen worden. Verständlich, erliegen doch selbst die Archäologen dem flimmernden Zauber der Lichtbilder, wie in folgenden Interviewausschnitt aus dem Spiegel zu lesen ist, in dem Harald Meller einen direkten Bezug zwischen dem berühmten Ausstellungsstück des Landesmuseums Sachsen-Anhalt, dem Präsentationsgedanken und einem bekannten Science-Fiction-Film herstellt.
Harald Meller:
„In einem runden, vollkommen schwarzen Raum mit zehn Meter Durchmesser. In dessen Mitte steht ein tiefschwarzer Monolith. Das ist wie bei Kubricks „2001 – Odyssee im Weltraum“. In dem Monolith gibt es einen hell erleuchteten Ausschnitt, in dem wie magisch die Himmelsscheibe schwebt. Kein Text lenkt ab, alle Informationen gibt es in einem Vorraum. Und wer nach oben blickt, der schaut auf einen strahlenden Himmel, an dem sich 70.000 Sterne bewegen.“[34]
Wenn der Landesarchäologe dann in der „Terra X“-Folge „Der Herr der Himmelsscheibe“ vom „Nebra-Code“ spricht, so schafft er ganz bewusst eine Anspielung auf die vielen Filme und Sendungen, welche sich immer wieder mit einem vermeintlich vorhandenen geheimnisvollen Code in den überlieferten Artefakten und den Schriften des Altertums beschäftigen.
2.3. Erwartungshaltungen
Zur Darstellung der wissenschaftlichen Arbeit in einer breiten Öffentlichkeit eignet sich kaum ein Medium so gut wie das Fernsehen, weil es heute allgegenwärtig ist. Natürlich ist ein solches Auftreten in der Öffentlichkeit auch gleichzeitig Werbung, welche die Bereitstellung von finanziellen Mitteln wahrscheinlicher werden lässt. Doch schließlich forscht die Wissenschaft zuallererst für den Erkenntnisgewinn der Menschen, die sich eine solche Wissenschaft leisten. Sie haben ein Anrecht darauf zu erfahren zu welchen Ergebnissen diese Arbeit kommt, auch wenn sie nicht so spektakulär wie die Himmelsscheibe sind. Die Archäologie beschäftigt sich mit der Vergangenheit aller und was sie birgt ist das Kulturgut aller.
Dass die oft reißerische und verzerrte Abbildung einiger Forschungszusammenhänge in den Medien Wissenschaftler verärgert ist verständlich, doch machen sich die Wissenschaftler oft nicht klar, dass sie in einen Produktionsprozess geraten an dessen Ende eine Rendite erwartet wird. Kein Sender und keine Produktionsfirma kann es sich daher leisten die, oft durch das Kino noch gesteigerten, Erwartungen des Zuschauers nicht zu bedienen. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender sind in der Bringepflicht, denn die Quote muss stimmen um die Gebühren zu rechtfertigen. Das Format „Terra X“ ist dafür ein hervorragendes Beispiel.
Meist hat der Archäologe keinen Einfluss auf seine Darstellung in der Sendung; ihm wird das Konzept erklärt und wie man ihn und sein spezielles Fachwissen einsetzen will. Doch der Archäologe sollte sich ausführlich mit dem Konzept der Sendung beschäftigen, damit er nicht zum platten „Erkläronkel“ (sit venia verbo) degradiert wird.
Diese kurze Beschäftigung mit der Archäologie und dem Archäologen im Spielfilm ist vor dem Hintergrund gerechtfertigt, dass der Spielfilm den Ton angibt, wenn es um die filmischen Mittel im Dokumentarfilm geht. Außerdem hat der Kinofilm letztendlich Zuschauer wie auch Filmemacher ein Leben lang konditioniert. Der Filmemacher und Autor Thomas Balkenhol beschreibt es so:
„Alle meine Dokumentarfilmregisseure haben eine große Liebe: das Kino. Es ist eine unerfüllte Liebe denn Dokumentarfilme kommen nur selten ins Kino.“[35].
Wie eng die Verzahnung von Kinofilm und Dokumentation sein kann und wie sehr die bekannten Hollywoodproduktionen zur Erzeugung einer bestimmten Grundstimmung genutzt werden, zeigt beispielhaft die Verwendung des Schauspielers John Rhys-Davies[36] als Sprecher für die Archäologiekurzdokumentationen im Programm des „Lerning-Connection“[37] Auf geradezu typische Weise ergänzten sich hier der Schauspieler, seine Rolle, die Erwartung des Zuschauers und der Werbeffekt. Mit dem Erscheinen des Schauspielers auf dem Bildschirm fühlt sich der Zuschauer sofort in die Stimmung des „Indiana Jones“ Filme versetzt.
3. Dokumentarische Formate und Archäologie
Was Filme, und damit auch Dokumentationen, grundsätzlich sind, beschreibt der Medienforscher Knut Hickethier so:
„Audiovisuelle Bilder und Töne sind direktes Ergebnis eines technischen Produktionsvorgangs, eine mit technischen Apparaturen operierenden Inszenierung und Realisation eines kommunikativen Vorhabens. Sie sind Resultat der Arbeit von einzelnen Autoren, Regisseuren, künstlerischen und technischen Mitarbeitern, die in der Regel jedoch nur kollektiv Zustande kommt. Sie entstehen bis auf wenige Ausnahmen heute innerhalb einer Institution, sei es eines kommerziellen Unternehmens oder einer öffentlich rechtlichen Anstalt. Sie unterliegen damit den inneren Mechanismen, Abhängigkeiten und Zwängen dieser Institutionen, die ihrerseits gesellschaftlichen Regulativen wie Gesetzen, Staatsverträgen, Verordnungen etc. bzw. den marktwirtschaftlichen Bedingungen gehorchen. Doch gegenüber diesem Rahmen der Kommunikationsbedingungen bewahren die Produkte, Filme und Fernsehsendungen, auch eine gewisse Unabhängigkeit, da sie zwar unter den jeweiligen Bedingungen zustande gekommen sind, dies aber nicht direkt abbilden.“[38]
Knut Hickethiers Zusammenfassung umreißt in einem kurzen Absatz gleich mehrere für diese Arbeit interessante Problemfelder. Es darf nicht vergessen werden, dass es einmal eine Bestrebung gab Fernsehen per se als Kunst zu deklarieren. Seine enge Verwandtschaft mit dem Kino, welches sich zunächst ebenfalls als eine reine Kunstform definieren wollte, legte diesen Umkehrschluss nah. Noch Anfang der sechziger Jahre blieb dieses Selbstverständnis ein wichtiger Bestandteil der Fernsehmacher. Mit der Weiterentwicklung der Formate wurde es aber nicht mehr haltbar, man erkannte: Nur die wenigsten Formen des Fernsehens halten einem Kunstanspruch stand.[39] Nichts desto trotz, vermengen sich dieser Kunstanspruch und die journalistische Wirklichkeit wieder beim Dokudrama oder den Reenactmentformaten.
3.1 Dokumentarfilm oder Dokumentation?
Der Dokumentarfilm gilt von seiner ersten Benennung an als eine Art des Films, in der mit filmischen Mitteln tatsächliches Geschehen sachlich und realistisch aufgezeigt wird. Dabei bleibt der Begriff des Dokumentarfilms selbst umstritten, was vor allen an den vielen Misch- und Hybridformen liegt, welche sich im Laufe der Fernsehgeschichte ausgeprägt haben. Die Übergänge zwischen einzelnen dokumentarischen Formaten wie Dokumentarfilm, Dokumentation und Feature sind fließend. Annette Kätsch-Hattendorf weist darauf hin, dass viele Programmzeitschriften das Format Feature als Dokumentation ankündigen, da der Begriff Feature in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt ist.[40] Oft wird auch der Begriff Dokumentation synonym als Ober- oder Sammelbegriff für alles dokumentarische, also Wirklichkeitsabbildende, verwendet. Was Dokumentarfilm und Dokumentation voneinander genau unterscheidet oder was sie verbindet, kann letztendlich niemand zur Zufriedenheit aller definieren. Die Meinungen und Definitionsversuche gehen hier teilweise weit auseinander. Laut Manfred Götzke und Leila Knüppel ist nicht einmal geklärt, ob es sich bei den jeweiligen Begriffen um ein Genre, ein Qualitätsmerkmal oder einen Sammelbegriff handelt.[41] Nach beider Meinung muss trotzdem deutlich zwischen Dokumentation und Dokumentarfilm unterschieden werden.[42]
Der Dokumentarfilm beschreibt die von ihm zu erklärenden Zusammenhänge, er behauptet von sich tatsächlich stattgefundenes verifizierbares Geschehen abzubilden.[43] Damit stellt er sich selbst, qua Definition, unter das Primat der Authentizität.[44] In wie weit dieses Primat gerade im Fernsehen überhaupt erreicht werden kann, soll an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden, dazu nur soviel, die Meinungen unter Medienwissenschaftlern darüber reichen von der Behauptung, man könne eine wahre Authentizität beim Dokumentarfilm niemals erreichen, da alle filmische Abbildung bereits eine Interpretation des Machers sei, bis zu der Aussage man könne natürlich absolut authentisch und objektiv sein. In diesem Bereich eines Definitionsversuches, im Bereich der Festlegung wie fähig der Mensch und sein Medium zur Unterscheidung zwischen objektiv und subjektiv sind, betritt man das weite Feld der Philosophie.
Mit der Frage nach der Authentizität lässt sich also weder der Dokumentarfilm noch ein anderes dokumentarisches Format schlüssig definieren ohne zwangsläufig in eine Diskussion über filmische Realität zu geraten.
Es gibt aber Versuche die Dokumentation ganz allgemein zu beschreiben. Nach dem Ergebnis dieser Bemühungen ist sie eine journalistische Darstellungsform, welche im Fernsehen als eine Langform von meist zwischen 30 und 45 Minuten Dauer auftritt. In Dokumentationen werden, um dem ihr innewohnenden Anspruch der Authentizität gerecht zu werden, verschiedene Mittel als Nachweis wirklichen Geschehens benutzt. Zeitzeugen, Dokumente, Film- wie Tonausschnitte und Spielszenen führen den Rezipienten an das Thema heran und versuchen einen objektiven Überblick zu bieten.
Die Erfolge der mit großem Aufwand produzierten amerikanischen Kinodokumentationen der letzten Jahre haben diese journalistische Darstellungsform wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit und der kommerziellen Produzenten gerückt. Doch diese Dokumentationen bewegen sich nach der eben versuchten Charakterisierung in einem Grenzbereich, weil sie nicht dem klassischen Authentizitätsdogma verpflichtet sind, beziehungsweise sich davon bewusst absetzen. Sowohl Michel Moores Filme, wie zum Beispiel „Fahrenheit 9/11“, oder Al Gores „An Inconvenient Truth“, erreichen zwar ein großes Publikum, aber sie polarisieren auch, da sie im Dienste einer Meinung, einer vorher aufgestellten These, die es zu beweisen gilt, stehen. Sie dokumentieren nicht, sondern berichten einseitig, um eine vorher festgelegte Prämisse zu vertreten und den Zuschauer zum Vertreter dieser Idee zu machen.
Wie wirksam und überzeugend der Film sein kann erkannte man schon früh. Es wäre in jeder Form ungerecht Filme wie „Darwin's Nightmare“ mit den menschenverachtenden Propagandafilmen totalitärer Systeme zu vergleichen, doch zeigen diese Arbeiten wie sehr das Mittel Film überzeugen kann. Auf der großen Leinwand werden die Dokumentationen, schon allein des Aufwands bei ihrer Produktion wegen, weiter nur ein Nischenprodukt bleiben. Für einen derartigen Film über ein archäologisches Thema bestehen wenige Chancen. So interessant der Background archäologischer Informationen und Erkenntnisse auch ist, er beschränkt sich im Wesentlichen auf eine bestimmte Zielgruppe. In der Archäologie ist die Trennung zwischen Kino und Fernsehen vollkommen. Im Kino werden archäologische Themen und der Archäologe als Protagonist für Fiktion benutzt, im Fernsehen wird innerhalb der dokumentarischen Formate ernsthafter über ihn, seine Wissenschaft und die Forschungsergebnisse berichtet.
Ist man sich auf der einen Seite noch über die Ursprünge einig, dass nämlich die ersten bewegten Bilder überhaupt, wie bei den ersten Filmen der Brüder Lumière, dokumentarischer Natur waren[45], so ist man auf der anderen Seite heute auf der Suche nach Begriffen. In Frankreich wurde die Bezeichnung „Feuilleton documentaire“ etabliert.[46] Die folgende Definition beschreibt eine filmische Dokumentation eigentlich ziemlich genau:
„Das Wort Dokumentation bezeichnet auch – Anlass zu Missverständnissen - eine journalistische Darstellungsform, die vor allen Aktenauszüge und sonstige dokumentarische Texte (bei der Presse) sowie Originalaufnahmen (bei Funk und Fernsehen) verwendet. Dokumentationen bedeuten in diesem Zusammenhang Darstellung des für ein Problem oder ein Ereignis einschlägigen Materials.“[47]
Welches Material aber entspricht der Wirklichkeit? Oft wird behauptet, dass sich schon mit dem ersten abendfüllenden Dokumentarfilm „Nanook of the North“ aus dem Jahre 1922 von der Authentizität und damit der Wirklichkeit verabschiedet wurde, da der Regisseur Robert J. Flaherty mit Regieanweisungen und geschickten Bauten seinen Film attraktiver machte.[48] So ließ er seinen Protagonisten, der besseren Bildausbeute wegen, eine schon tote Robbe noch einmal erlegen und versuchte durch den Umbau eines Iglus spektakuläre Einstellungen zu bekommen. Doch schon vor der Erfindung des abendfüllenden Dokumentarfilms zeigte der deutsche Filmpionier Oskar Messter dem Publikum unter der Rubrik „historische Aufnahme“ in „vollkommenster Naturwahrheit“ einen deutschen Kanzler, der gar keiner war, sondern ein dem Kanzler ähnlich sehender Freund der Familie. Wie Paul Werner schreibt begann damit schon in der Kinderzeit des Films der Betrug am Kunden und die Beförderung einer Sucht nach Sensationen.[49]
3.2 Sensationen
Mit dem Wort Sensation ist man auch heute schnell bei der Hand. Es ist zu einem brauchbaren, verkaufsfördernden Etikett geworden. Der Begriff Sensation bezeichnet inzwischen etwas so außergewöhnliches, dass man davon wissen muss. Deshalb erlebt die Sensation eine inflationäre Ausbreitung. Ursprünglich meinte das Wort nichts weiter als eine Empfindung oder eine Wahrnehmung.[50] Inzwischen bezieht es sich ausnahmslos auf das Spektakuläre. Die Masse, mit der Sensationelles regelmäßig und ausdauernd in den Medien präsentiert wird, lässt eine gewisse Ereignislosigkeit in früheren Zeiten vermuten. Oder sind die so wirksam beschworenen Sensationen gar nicht so sensationell? Sie werden so dargestellt und vermittelt, aber der Nachschubbedarf an Sensationen ist gewaltig und so werden sie mit der Zeit allmählich beliebig, „die Grenze zwischen studiositas und curiositas verschwimmt dabei.“[51] beschreibt Christoph Türcke dieses Problem, welches besonders die historischen Dokumentationen befällt.
Wie soll man einen weitgehend historisch bekannten Umstand noch weiter aufwerten? Es gab nur eine Schlacht im Teutoburger Wald, nur einen Otto den Großen, nur eine Schlacht bei Hastings, nur einen Luther und nur einen 1. Weltkrieg. Wenn also die Geschichte nicht zu ändern ist, muss eine neue Art der Vermittlung her und noch die kleinste neue wissenschaftliche, in vielen Fällen archäologische Erkenntnis, muss, zur Sensation erklärt, verwendet werden. Nicht nur die Dokumentationen, ihre verschiedenen Unterkategorien, wie das Dokudrama, die Dokusoap und ähnliche, kaum noch auf den Ursprung zurückführbare Hybriden haben ein Authentizitätsproblem; es ist eine allgemeine Entwicklung. Stefan Niggemeier schrieb in einem Artikel zur Gegenwart des Fernsehens:
„Das „Supertalent“ als Show zu bezeichnen ist irreführend. Es ist ein Showkonzentrat, immer wieder eingekocht, reduziert, angedickt, mit Geschmacksverstärkern zu einem fettigen, überwürztem Brühwürfel der Fernsehunterhaltung geronnen. Die Sendung ist darauf angelegt eine Reizüberflutung zu produzieren, die es ausschließt, dass auch nur einen winzigen Moment nichts passiert.“[52]
Für diese Betrachtung ist der letzte Satz entscheidend. In einer reinen Wissenschaftssendung lassen sich Momente des Innehaltens nicht vermeiden. Ebenso wenig in einer Dokumentation. Wenn man aber das Format ändert lässt sich deutlich mehr Fahrt aufnehmen. Genau an jenen Stellen, an denen die Wissenschaft ein Nachdenken vom Zuschauer einfordern würde um den Sinnzusammenhang begreifbar zu machen, wird nun Reenactmentaction geboten. Und da einfache Reenactmentaction auf die Dauer wenig wirksam ist, wird versucht immer spektakulärer zu werden.[53] Die Aufmerksamkeitsspanne des Zuschauers ist begrenzt. Schon in der Forschung zum Medium Radio erkannte man, dass dem Zuschauer bei der Verarbeitung von Inhalten biologische Grenzen gesetzt sind, nach drei Sekunden lässt die Aufmerksamkeit nach und eine Zäsur erfolgt.[54]
3.3 Authentizität in dokumentarischen Formaten
Zwei völlig gegensätzliche Meinungen standen schon am Beginn des Dokumentarfilms gegenüber. Auf der einen Seite zum Beispiel die von Robert J. Flaherty vertretene Auffassung und auf der anderen Seite Meinungen wie die des sowjetische Filmemacher Dziga Vertov. Der eine inszenierte, der andere forderte den Verzicht auf jegliche Inszenierung. An diesem Disput hat sich bis heute nichts geändert. Die neuen Möglichkeiten der digitalen Technik machen eine Beeinflussung des Geschehens wesentlich einfacher. Einig ist man sich lediglich über einige Punkte, was das Ziel des dokumentarischen Formats ist; ein Dokumentarfilm soll bilden, ist einer dieser Punkte. Ein wenig klingt das als würden andere filmische Genres nicht bilden, aber der Dokumentarfilm wurde schon am Beginn seiner Entwicklung als ein Mittel zur Bildung und Erziehung der Massen betrachtet.[55] Dokumentationen über Archäologie sind keine neue Erfindung, „Stadt unter Wasser“ zum Beispiel stammt aus dem Jahre 1931 und zeigt Aufnahmen aus Cherson.
Fast zwangsläufig wurden Dokumentationen auch zum Mittel der Agitation und Propaganda, gerade in der Zeit des zweiten Weltkriegs. Wie ein solcher Film dann wirkt, kann auf der deutschen Seite mit „Pharaonen gegen Germanen“, in dem gegen die Theorie des „Ex oriente lux“ polemisiert wird und in „Wir wandern mit den Ostgermanen“ betrachtet werden. Trotz aller Streitgespräche bleibt immer wieder der Anspruch der Wirklichkeit für das dokumentarische Format.[56]
Nach Sachlage wäre aus verständlichen Gründen der Dokumentarfilm das Mittel der Wahl, bei der filmischen Darstellung und Aufarbeitung historischer und archäologischer Zusammenhänge. Allerdings werden inzwischen Filme, die früher mit dem Begriff des Dokumentarfilms beschrieben wurden, in den Programmzeitschriften und in der Werbung der Produzenten selbst nur noch als Dokumentation präsentiert. In dieser Arbeit wird für den weiteren Verlauf der Begriff der Dokumentation für jene dokumentarischen Formate verwendet, die sich selbst so bezeichnen.
In der Regel taucht die Archäologie in Dokumentationen mit einem größeren historischen oder interdisziplinären Kontext auf. Da auch im Bereich der historischen Dokumentationen, in denen oft genug ein Archäologe auftritt, die Benennungen der Hybridformen selbst die Fachleute verwirren, hat man es zu einer eigenen Bezeichnung gebracht, dem so genannten „Histotainment“. Eigentlich bezeichnet man mit „Histotainment“ die Vermengung von Geschichte und Unterhaltung, ein Begriff der allgemein Guido Knopp zugesprochen wird.[57] An anderer Stelle wird einfach unter dem Begriff „Dokutainment“ oder „Infotainment“, ein bereits in den 70er Jahren einsetzender Trend, bei dem Wissenschaft möglichst unterhaltsam dargeboten werden soll, zusammengefasst.[58]
3.4 Fiktionelemente
Von der klassischen Dokumentation unterscheidet die daraus entstandenen Hybridformate besonders der exponentiell gestiegene Anteil an Fiktionelementen. Die so genannte „Reenactment“-Darstellung war bis etwa ins Jahr 2000, mal mehr, mal weniger in dokumentarischen Formaten präsent. Inzwischen ist sie aus geschichtsbezogenen oder archäologischen Dokumentationen nicht mehr wegzudenken. Argumentiert wird mit der besseren visuellen Verdeutlichung von geschichtlichen Zusammenhängen. Tatsächlich geht es aber oft nur darum, den reinen Unterhaltungswert zu steigern.[59] Die Grundfrage bleibt dabei, wieder, die Frage nach der Wirklichkeit von dokumentarischen Inhalten. Dazu Stefan Niggemeier:
„Ein weiteres Genre das erheblich zum aktuellen Höhenflug von RTL beiträgt, vermischt ebenfalls konsequent Fiktion und Realität: die Elends-Shows am Nachmittag. „Scripted Reality“ nennen die Fernsehleute ganz unironisch das, was in Sendungen wie „Mitten im Leben“ oder „Familien im Brennpunkt“ zu sehen ist Friedrich Küppersbusch spricht von „Quotenbeschaffungskriminalität“. Im Stil einer Dokumentation werden mit Laienschauspielern Konflikte im Hartz IV Milieu inszeniert. Nur ein winziger Hinweis im Abspann erwähnt, dass es sich um ausgedachte Geschichten handelt.“[60]
und weiter
„RTL erklärt die Frage, ob das Gezeigte in irgendeinem Maße Wirklichkeit dokumentiert, für schlicht irrelevant: Dem Zuschauer (die in unfassbarer Zahl einschalten) sei das egal. Teilweise laufen unter demselben Titel fiktionale und nichtfiktionale Inhalte. Und auch der Sender hat längst den Überblick verloren und nennt die Harz-IV-Märchen gelegentlich Doku-Soaps. Die Verwechslung von Realität und Fiktion ist kein Versehen, sondern Prinzip.“[61]
Die Frage, ob dem Zuschauer wirklich schlicht egal ist, ob das Gezeigte Fiktion oder Realität ist, wird an dieser Stelle besonders interessant. Denn wenn es so sein sollte, welchen nutzen haben Formate, die sich bemühen, Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu vermitteln, dann überhaupt? Entweder der Zuschauer glaubt dem Gezeigten sowieso nicht oder er glaubt alles, was vielleicht noch schlimmer wäre. Offensichtlich traut der Autor dem Konsumenten, der dieses qualitativ minderwertige Fernsehen einschaltet, keine Medienkompetenz zu. Dass jedoch die Begriffe wie Wahrheit oder Realität geradezu selbstverständlich keine Rolle mehr spielen, ist erschreckend, vor allen Dingen, weil die von Stefan Niggemeier folgerichtig angenommene Entwicklung einsetzt:
„Wenn man sich erst einmal in einzelnen Formaten erfolgreich von einer starren Trennung verabschiedet hat muss die Verführung groß sein. Mehrere vermeintlich dokumentarische Formate von RTL sind in den vergangenen Monaten ins Gerede gekommen, weil sich herausstellte, dass Bauern, die Frauen suchten, nicht echt waren oder Häuser die versteigert werden sollten, gar nicht versteigert wurden. Teilweise merkte man den schulterzuckenden Redaktionen des Senders an, wie überholt der Gedanke ist, dass solche Details irgendwie stimmen müssen.“[62]
Was soll man als Zuschauer also glauben und wie sich derjenige verhalten, der als Experte zu einer solchen Sendung gerufen wird? Sollen bestimmte Sender oder Produktionsfirmen gemieden werden? Die öffentlich-rechtlichen Sender distanzieren sich von einer solchen Vorgehensweise. Sie bieten nach eigenem Verständnis Qualitätsfernsehen zur Erfüllung des Bildungsauftrags, der in ihren Satzungen und im Grundgesetz steht. Allerdings sind die öffentlich-rechtlichen auf jeden noch so absurden, jedoch Quotenerfolg versprechenden Zug der Privaten aufgesprungen.[63] Die öffentlich-rechtlichen Sender stecken in einem Dilemma. Wenn sie keine Quote machen, fragen die Zuschauer schnell warum sie dann ihren Obolus zur Finanzierung leisten sollen. Die Frage nach der Qualität der Sendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird immer wieder gestellt, wenn es um die Bereitstellung von finanziellen Mitteln gehen soll. So schrieb Roger Schawinski, ehemaliger Senderchef von Sat1:
„Der galoppierende Verlust einer gewissen Fernsehkultur bei ARD und ZDF, die unter dem Titel „Qualität“ immer als Argument gegen das Angebot der Privaten ins Feld geführt wird, findet seinen Niederschlag in zahllosen Publikationen.[64] “
Ganz abgesehen davon, dass hier der ehemalige Chef eines Privatsenders gegen die öffentlich-rechtlichen polemisiert, sei der Subtext der Aussage deutlich hervorgehoben. Denn sie impliziert, man selbst, also die Privaten, könne durchaus, quasi De jure, ein Trashprogramm machen, denn für die Qualität seien die öffentlich-rechtlichen Sender zuständig, was weiter heißt, die öffentlich-rechtlichen Sender sollen sich aus jenen Bereichen des Programms herauszuhalten, damit sind inzwischen, wie noch zu sehen sein wird, auch die Dokumentationen archäologischen Inhalts gemeint, wo Geld zu verdienen ist.[65]
Für den Zuschauer der keinerlei fachliche Vorkenntnis besitzt, bleibt keine Möglichkeit zur Überprüfung des Gezeigten. Es fällt erst auf, dass man ihm eindeutig gestellte Szenen unterjubelt, wenn die dafür verpflichteten Laiendarsteller gar zu schlecht sind, ähnlich wie der Betrug des Filmpioniers Oskar Messter erst offenbar wurde, als er 1889 den längst verstorbenen Preußenkönig Friedrich II. in „Friedrich beim Flötenspiel“ wieder auferstehen ließ.[66]
3.5 Film und Dokumentarfilm
Beim Streit um das Reenactment im dokumentarischen Format wird an einigen Stellen von einer künstlerisch motivierten Verschiebung der Elemente gesprochen.[67] Der Dokumentarfilm wandelt sich nach diesen Thesen mehr in Richtung fiktionaler Film, während der Spielfilm immer mehr Elemente des Dokumentarfilms aufweisen würde. Die Entwicklung des Dokumentarfilmes bliebe dabei folgerichtig und sei eine künstlerisch ästhetische Notwendigkeit. Solche Thesen scheinen überzeugend und werden mit vielen Beispielen versehen lanciert, sie übersehen dabei aber die lange Geschichte des Films. Visuelle Entwicklungen hat es immer gegeben, was die derzeitige so grundlegend anders macht, sind die veränderten technischen Möglichkeiten, welche selbst eine Produktion mit kleinem Budget, sei sie nun Non-fiction oder Fiction, in die Lage versetzt, eine technisch anspruchsvolle Arbeit zu leisten.[68]
Die angebliche Annäherung der beiden Spektren, Dokumentar- und Spielfilm, ist nicht besonders neu und hat einen eher künstlerischen Hintergrund, um die klassischen dramaturgischen Erzähl- und Darstellungsmuster zu durchbrechen. Bei Spielfilmen wie „District 9“ oder „Blair Witch Project“, die mit dokumentarischen Mitteln als ästhetisch-inhaltliche Aussage arbeiten, wird kein Zuschauer meinen einen Dokumentarfilm zu sehen. Solche Stilmittel sind keineswegs neu, im amerikanischen Klassiker „Citizien Kane“ aus dem Jahre 1941 werden sie schon angewandt.
An mancher Stelle klingt die so ausdrücklich beschriebene Verwischung der Grenzen zwischen Dokumentar- und Spielfilm wie ein Versuch, dem Dokumentarfilm eine Bedeutungssteigerung angedeihen zu lassen, die er gar nicht nötig hat oder den Einbau von überflüssigen Fiktionelementen zu rechtfertigen.
Wie sehr sich Dokumentar- und Spielfilm zumindest darstellungstechnisch beeinflussen, lässt sich im direkten Vergleich gut erkennen. Die Ästhetik des Films wird immer noch von den großen Vorbildern, also Hollywood bestimmt. An dieser Stelle seien nur zwei Beispiele einer Übernahme auffälliger visueller Techniken in dokumentarische Formate mit archäologischem Inhalt beschrieben. Als 2001 die amerikanische Kriminalserie „CSI: Crime Scene Investigation“ in Deutschland startete, erwartete zunächst niemand einen großen Erfolg. Die Serie füllte das Programm des relativ kleinen Kanals VOX und wurde zunächst unter ferner liefen eingeordnet. Nach Ausstrahlung der ersten Folgen jedoch steigerte sich der Quotenanteil. Die Serie brach mit allem, was Serien bis dato ausmachte. „CSI“ wurde extrem aufwendig und teuer produziert. Alles, die Bauten, das Licht, der Ton, die Tricktechnik und die Geschichte erinnerten in Ästhetik und Gebaren an die teuren Blockbuster des amerikanischen Kinos. Obwohl die Handlung ausrechenbar blieb, wurden die Charaktere der Hauptfiguren über die Folgen weiter entwickelt. Die hohe Qualität wurde beibehalten und so hatte der Zuschauer plötzlich etwas, was es vorher nicht gab, eine Serie in Kinoqualität, einen quasi unendlichen Kinofilm. Die ursprüngliche Serie erhielt weitere Ableger, die alle eine besondere technische wie handlungsorientierte Charakterisierung erfuhren, wobei jedoch das Muster unverwechselbar und gleich blieb.
Bald darauf erfolgten die ersten Versuche diese Mittel im Dokumentarfilm zu nutzen. Der Zuschauer hatte, so vermutete man, bestimmte Sehgewohnheiten entwickelt, die man bedienen wollte. Besonders die Hochglanzdokumentationen versuchten den „CSI“-Stil zu kopieren, indem sie dieselben Schnitttechniken und besonderes Licht einsetzten. So zum Beispiel zu sehen in der „Terra X“-Folge „Brennpunkt Qumran“.
Die im Jahre 2001 gestartete Serie „24“ wartete mit einem ähnlich revolutionären Konzept wie „CSI“ auf. Zunächst wurde jede Folge auf exakt eine Stunde Laufzeit geschnitten. Der Zuschauer erlebt also immer eine Stunde im Leben des Spezialagenten Jack Bauer in Echtzeit. Selbst die Werbepausen wurden in dieses Konzept mit eingebaut. Auch diese Serie startete in Deutschland auf einem kleinen Sender, RTL II, und wurde zu einem spektakulären Erfolg. Auch sie wurde in überragender Qualität gedreht und sie brachte ein altes, bis dahin nur noch selten zu sehendes Mittel des Films wieder zum tragen, den Splitscreen. Dabei wird der Bildschirm geteilt und unterschiedliche Blickwinkel derselben Handlung oder unterschiedliche Handlungen zur selben Zeit gezeigt. Eigentlich wurde er, obwohl Regiegrößen wie Brian de Palma einst mit ihm arbeiteten, längst in die Avantgardeecke des Films verbannt, weil er nicht den Sehgewohnheiten der Zuschauer entsprach. Aber die Generation der Multiplayerspieler auf Konsolen- und PC-Bildschirmen war erwachsen geworden. Sie störte es nicht, mehrere Bildfelder gleichzeitig verfolgen zu müssen, eine bei Computerspielen übliche Methode, und so fand sich dieses so erfolgreiche Element von „24“ bald in verschiedenen Dokumentationen, so zum Beispiel in der ZDF Produktion „Tag X“.[69] „Tag X“ ging so weit, gleich das gesamte Konzept von „24“ weitestgehend für ein dokumentarisches Format zu kopieren und versuchte beim Zuschauer den Eindruck zu erwecken, man verfolge einen wichtigen Zeitabschnitt der Geschichte, wie zum Beispiel die Belagerung Wiens durch die Türken 1683, in Echtzeit. Nicht nur der Splitscreen fand Verwendung, sondern auch die für „24“ typische „Silent Clock“, welche dem Zuschauer die für den Haupthelden ablaufende Zeit anzeigt.[70]
3.6 Nutzungsverhalten und Formatbildung
Ein weiterer schwer zu fassender Punkt, neben den sich rasant entwickelnden technischen Möglichkeiten, ist der des sich ändernden Medienverhaltens der Konsumenten. Die Hierarchie in der Beziehung zwischen Anbieter und Konsument ändert sich. War früher diese Beziehung vom Anbieter bestimmt, so hat der Rezipient heute eine größere Möglichkeit zur Einflussnahme wann er welchen Inhalt wo sehen will. Die technischen Entwicklungen und deren Zwänge bewirken eine langsame Umkehrung der Verhältnisse. Schon mit dem Aufkommen analoger Datenträger, wie der Videokassette, war es möglich eine Sendung zu konservieren und für den kommenden Gebrauch einzulagern.
Das Internet mit seinen Datenbanken und der Möglichkeit einer sofortigen Verfügbarkeit des Gewünschten, erweitert diesen Umstand beträchtlich. In den Mediatheken der Sender warten die entsprechenden Sendungen abrufbereit auf den Nutzer, wie das Beispiel „Terra X“ zeigt. Die Einschränkung liegt in der Bereitstellung der Technologie und in der Möglichkeit des Kunden diese Angebote auch bezahlen zu können. Für die Wissenschaft ist diese neue digitale Welt bei allen Streit um Urheberrechtsfragen ein Segen, denn Erkenntnisse die, gerade in der Archäologie, früher einen langen Weg gebraucht hätten um der Fachwelt und der breiten Öffentlichkeit bekannt zu werden, können nun innerhalb kürzester Zeit Verbreitung finden.
Am Beispiel von „Terra X“ lässt sich die Formatbildung mit ihrer ausgeprägten rundum Vermarktung beobachten. Wie Fritz Wolf beschreibt, hat der Begriff des Formats, den des Genres abgelöst. Genre stammte aus dem Kunstbereich, unter anderem der Musik und der Literatur. Das Format dagegen richtet sich nach den Vorgaben der Programmplanung.[71] Der Begriff des Formats bezieht sich auf alle Gestaltungsmerkmale einer Sendung, indem ein Sender sein Programm formatiert, macht er sich für den Zuschauer wieder erkennbar. Eine Programmformatierung bedeutet Programmplanung vom Reißbrett. Man berechnet schon bei der Planung des Programms einen bestimmten Quotenanteil. Alle Programmteile werden nacheinander ausgerichtet und der „audience flow“ soll so hoch wie nur möglich sein. So gilt für die Montagsdokumentation in der ARD ein Minimum von 10 % Zuschaueranteil.[72] „Terra X“ verfolgt diesen Weg konsequent weiter. Da die Sendeverantwortlichen schon bei der Programmplanung einen gewissen Marktanteil im zweistelligen Bereich anpeilten, hat dies auch Auswirkungen auf die Themenauswahl. Gerade bei „Terra X“ ist äußerst auffällig wie viel Themen, die eigentlich schon zur Genüge diskutiert wurden, in neuer Variation eine Wiederauflage bekommen.
Mit dem Format „Terra X“ fällt eine solche immer wieder erfolgende Bespielung der schon bekannten Themen besonders leicht, denn seit die Macher der jeweiligen Sendung in Kriminalfilmmanier immer eine Frage voranstellen, die dann im Verlauf der Sendung geklärt werden soll, braucht man nur die Frage zu variieren. Besonders beliebt scheinen die frühen südamerikanischen Zivilisationen und die ägyptischen Reiche zu sein. Die Produzenten sehen sich allerdings durch das anhaltend hohe Interesse der Zuschauer bestätigt, sehr zum Leidwesen der Archäologen, die auf ebenso spannende wie weitgehend unbekannte Themen verweisen. Da die Sendungsmacher oft dasselbe Thema noch einmal aufgreifen und wieder mit denselben Mitteln erklären, bleiben sich auch bestimmte Entwicklungen bei den Sendungen gleich, so etwa beim Einsatz der Musik, der Tricktechnik oder der Erzählstruktur. Statt auf neue Erkenntnisse zu setzen und andere Funde ins Programm zu nehmen, scheint es gerade bei den Hochglanzdokumentationen einen Inhaltsmainstream zu geben, der nicht verlassen wird. Deutlich wird dabei, dass nicht der Archäologe den Inhalt der Sendung bestimmt, sondern der Produzent.
3.7 Darstellung in den Medien
Am besten ist es natürlich für die Medienmacher, wenn der wissenschaftliche Beitrag eines Mediums selbst zum Medienereignis wird. So geschehen bei der Liveübertragung der Erforschung der „Seelenschächte“ in der Cheopspyramide mittels eines speziell konstruierten Roboters. Die Sendung erzielte weltweit hohe Einschaltquoten und wurde dutzendfach selbst dokumentiert. Schon im Vorfeld erweckte der bloße Plan mediale Aufmerksamkeit, verband er doch die Spielfilmregeln surprise/suspense/mystery mit dem dokumentarischen Format.[73] Die Möglichkeiten einer weltweiten medialen Aufmerksamkeit versprachen enorme Einschaltquoten. An diesem Beispiel sind auch die Zwistigkeiten zu erkennen die eine solche Aktion auslöst. Mehrere Beteiligte lieferten sich eine medial zu verfolgende, regelrechte Kabale um die Währung Aufmerksamkeit. Im Clinch lagen der in der Ägyptologie umstrittene, jedoch aufgrund seines Amtes mächtige ägyptische Antikenverwalter Zahi Hawass, der ursprünglich schon einmal mit einem Roboter in die Pyramide vorgedrungene deutsche Ingenieur Rudolf Gantenbrink und der Leiter des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo Prof. Dr. Rainer Stadelmann. Aus dieser mit allen medialen Mitteln geführten Auseinandersetzung ist keiner der Beteiligten unbeschädigt herausgekommen. Rainer Stadelmann äußerte im Anschluss: „Die Archäologie-Show wird weniger der Wissenschaft dienen, als vielmehr den Ägypten-Tourismus ankurbeln“[74]
Mögen solche Ereignisse auch die Neugier des Publikums befriedigen und das Gefühl bescheren bei einem „Jahrhundertereignis“ dabei gewesen zu sein, sie beschädigen die Wissenschaft und die Wissenschaftler als solche. Denn die letztendlich unerfüllten Erwartungen der Zuschauer werden nicht auf die Medienmacher projiziert, sondern auf die archäologische Forschung insgesamt.
Als schlecht für die Wissenschaft wird es von den Forschern auch empfunden, wenn ein Filmemacher auf weniger schönen Seiten des Fachs hinweist. Dabei offenbaren Dokumentationen wie die Tilman Scholls für Spiegel TV über das Wettrennen um die besten Ausgrabungsclaims in Afrika lediglich, dass Archäologen auch nur Menschen sind und keine Filmklischees.[75]
Der Umgang mit den Medien bleibt ein schmaler Grad und doch hat Harald Meller recht, wenn er eine mediale Begeisterung der Menschen für die Archäologie einfordert. Dazu Harald Meller in einem Spiegel Online Interview auf die Frage nach dem Aufwand bei der Präsentation der Himmelscheibe:
„Wir müssen die Archäologie sichtbar und verständlich machen. Das sind wir den Steuerzahlern schuldig, die unsere Arbeit finanzieren. Es kann nicht reichen, Fundstücke ins Lagerregal zu legen und Fachpublikationen zu schreiben. Wir müssen die Menschen begeistern. Aber: Auch wenn Archäologie bei uns manchmal sehr leicht aussieht, ist sie doch immer wissenschaftlich abgesichert. Wir haben die wichtigsten Spezialisten bei der Gestaltung der Ausstellung herangezogen.“[76]
Wie wichtig der Archäologie der Film geworden ist, zeigt das eigene internationale Archäologie-Film-Kunst-Festival „Cinarchea“, welches offiziell im Jahre 1992 von Kurt Denzer in Kiel ins Leben gerufen wurde. Das Festival wurde nach internationalen Vorbildern, wie dem „Festival du film d`art et d`archèologie de Bruxelles“, und den kurze Zeit darauf gegründeten Festivals von Verona und Paris, gestaltet. Die Veranstalter haben es sich zur Aufgabe gemacht, eine Retrospektive des archäologischen Films mit all seinen Themengebieten aufzuzeigen. Denn Archäologie umfasst nicht nur die Ausgrabungstätigkeit sondern zum Beispiel auch die Erhaltung und Restauration der Funde oder die experimentelle Archäologie. Dabei wird besonderer Wert auf die Darstellung der interdisziplinären Zusammenarbeit gelegt. Das Festival hat es sich zur Aufgabe gemacht im oft schwierigen Verhältnis zwischen Film und Wissenschaft zu vermitteln.[77]
Der Leiter des Festivals, Kurt Denzer, geht mit den bisherigen Dokumentationen über Archäologie und archäologischen Inhalts hart ins Gericht. Die Arbeit der Archäologen ist nach seiner Einschätzung fast nie zu sehen, es werden immer nur Statements vor immer gleichem Hintergrund abgegeben. Wovon gesprochen wurde war nicht zu sehen. Toneinspielungen und Bild passten in keiner Weise zusammen. Selbst wenn Grabungssituationen dargestellt wurden, ließ sich nicht erkennen welche Absicht dahinter steckte. Die Sprache der Wissenschaftler hatte einen fast arkanen (sic!) Klang und Inhalt. Die Notwendigkeit von Geduld und Ausdauer wurde nie vermittelt. Ausgrabungen und Impressionen von Fundstücken werden grundsätzlich mit einer mehr oder minder passenden Musik aufgerüstet und Kommentar von einer markanten Männerstimme gesprochen. Die verwendeten Graphiken waren unübersichtlich und verstörten mehr, als das sie Wissen vermittelten.[78]
Lothar Spree, Autor, Regisseur und Produzent zahlreicher archäologischer Dokumentationen, konfrontiert die Archäologen dagegen mit bitteren Wahrheiten. Nicht jeder kann einfach dokumentarisches Fernsehen machen, es gibt einen Grund für eine jahrelange Ausbildung und unterschiedliche Berufszweige im Produktionsprozess. Das ein Filmemacher inszenieren muss, was eigentlich dem Authentizitätsanspruch zuwider läuft, um eine Wirkung zu erzielen, scheint nicht jedem klar zu sein und auch nicht, dass der Zuschauer von einem langen Vortrag des Grabungstechnikers schnell gelangweilt wird, er nicht immer ein Nichts sagendes Loch als Sensation erkennt und seine Vorstellungskraft begrenzt ist. Die mühsame Arbeit eines Archäologen im Feld, die oft aus stundenlangen bearbeiten einer Fläche besteht, eignet sich nicht als Handlung für eine Produktion. Er beschreibt wie schwierig die Arbeit des Filmemachers mit einem Archäologen ist, der nicht verstehen will, warum der Zuschauer nicht in Ekstase gerät, wenn man mit der reinen Wissenschaft argumentiert.[79]
4. Die Himmelscheibe von Nebra
Um einen besseren Zugang zur Thematik der beiden für diese Untersuchung ausgewählten Sendungen zu schaffen, soll das in ihnen zu Grunde liegende Artefakt und seine Geschichte kurz beleuchtet werden.
Die Himmelsscheibe von Nebra ist eines der wichtigsten archäologische Objekte Deutschlands. Ihre Einzigartigkeit macht einen großen Teil ihrer Bedeutung aus, ein weiteres Artefakt dieser Art ist bisher nicht noch einmal gefunden worden und ob das je geschieht, ist fraglich. Mit ihrem Fund und der anschließenden Deutung der darauf befindlichen Bildwelt, hat sich die bisherige Sicht der Archäologie auf ein ganzes Zeitalter, das der europäischen Frühbronzezeit, grundlegend verändert. Die bei ihrer Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse haben zu ähnlich bedeutsamen Einsichten zum Wissen und den Fertigkeiten der Bronzezeitmenschen geführt, wie die Entdeckung des Mannes vom Hauslabjoch oder jene der Brunnen des Neolithikums aus den Braunkohletagesbaugebieten in Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Mit dem Mann vom Hauslabjoch hat sie außerdem eine ähnlich spektakuläre Entdeckungsgeschichte gemeinsam.
Unzählige Berichte, Dokumentationen, Reportagen und Beiträge in allen nur möglichen Medien und Formaten sind aufgrund ihrer Bedeutung über sie gemacht worden. Das nationale wie internationale Interesse an dem Artefakt war und ist enorm. Alle großen deutschen Leitmedien und Fernsehsender, so wie auch die größten internationalen Medien, berichteten über sie. Inzwischen ist die Himmelscheibe Thema mehrerer nicht nur fachspezifischer Bücher. Denn auch in der belletristischen Literatur ist sie mittlerweile angekommen.[80] Über den Wert dieser Veröffentlichungen lässt sich streiten, aber zumindest zeigen derlei Produkte die breite Faszination und das ungebrochene Interesse an diesem einzigartigen archäologischen Objekt in der Öffentlichkeit. Diese ungebrochene Faszination macht die Himmelscheibe so interessant für mediale Produktionen aller Art. Auf der anderen Seite eignet sie sich genau deshalb auch hervorragend, um die Folgen dieser medialen Aufmerksamkeit für die Archäologie, und nicht zuletzt für den Archäologen, zu untersuchen.
Nach ihrem Fund wurde sie zum Aufsehen erregenden archäologischen Aushängeschild einer an ungewöhnlichen archäologischen Funden sowieso schon reichen Region und machte Gelder für ausgedehnte interdisziplinäre Forschungsprojekte frei. Bei der Vorstellung der Himmelscheibe für die Öffentlichkeit in der Ausstellung im Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte in Halle im Jahre 2004, wurde sie gemeinsam mit so bedeutenden Objekten wie dem „Sonnenwagen von Trundholm“ und den „Goldschiffchen von Nors“ präsentiert, mit denen sie, nach Überzeugung einiger Forscher, eine grundlegende religiöse, zumindest aber kultische, Bedeutung teilt. Aufgrund ihrer Entdeckung wurde in Nebra mit der „Arche“ ein eigenes Erlebniszentrum errichtet und unter dem Namen „Himmelswege“ eine Besucherroute geschaffen, welche dem Interessierten einen tieferen Einblick in die Vergangenheit, speziell in die der Frühbronzezeit in Sachsen-Anhalt gewähren soll.[81] Modernste Mittel der musealen Präsentation sowie der Museumspädagogik finden hier Anwendung. Das weltweit größte Forschungsprojekt zur Frühbronzezeit gründet auf dem Fund der Himmelsscheibe. Spekulationen und hitzige Diskussionen um ihre Echtheit oder Herkunft schaffen es immer wieder in die Massenmedien.
[...]
[1] Zum Beispiel am 02.01.2011 unter dem Titel „Terra XXL: Die lange Terra X- Nacht“ oder am 09.01.2011 „Terra X: Die lange Nacht der Erdbeben“ im ZDF.
[2] W. Göpfert (Hrsg.), Wissenschaftsjournalismus. Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis (Berlin 2006) 11.
[3] Zum Beispiel „Das philosophische Quartett.“ im ZDF oder „Denker des Abendlandes“ im BR.
[4] Siehe unten „Computeranimation“ S. 114.
[5] W. Göpfert (Hrsg.), Wissenschaftsjournalismus. Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis (Berlin 2006) 7.
[6] H. Hettwer/M. Lehmkuhl/H. Wormer/F. Zotta (Hrsg.), Wissenswelten. Wissenschaftsjournalismus in Theorie und Praxis (Gütersloh 2008) 13 – 14.
[7] Große Nachfrage nach Wissenssendungen für Kinder im TV. Epd Medien 92, 2010, 14.
[8] Die „Sesamstraße“ verbindet das Konzept von Unterhaltung und Wissensvermittlung für Vorschulkinder. Vgl. M. Wladkowski, Kinderfernsehen in Deutschland zwischen Qualitätsansprüchen und Ökonomie unter Berücksichtigung der Vorschulserie Sesamstrasse (Braunschweig 2003). oder N. Gantenbrink, 40 Jahre Sesamstrasse (2010). <http://www.muenster.org/draussen/artikelarchiv/2010_Artikel/1002Artikel01.pdf> [Stand: 05. Dezember 2010].
[9] F. Wolf, Trends und Perspektiven für die dokumentarische Form im Fernsehen. Eine Fortschreibung der Studie „Alles Doku – oder was? Über die Ausdifferenzierung des Dokumentarischen im Fernsehen“ (2005) 12. <http://www.dokville.de/dokville2005/schriften/Fritz-Wolf.pdf> [Stand: 01.Dezember 2010].
[10] M. C. Martin, Zur Emanzipation des Wissenschaftsjournalismus. Eine Berufsrolle zwischen Fortschritt und reflexiver Moderne (Saarbrücken 2008) 14.
[11] Siehe unten „Reenactment“ S. 94.
[12] P. Rahemipour, Archäologie im Scheinwerferlicht. Die Visualisierung der Prähistorie im Film 1895 – 1930 (2008). <http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000006665/ONLINEVERSIONFinaldessertieren1.1.pdf?hosts=> [Stand: 21.Januar 2011].
[13] So war Paula Modersen-Becker von einer Ausstellung ägyptischer Mumienporträts so stark beeindruckt, dass sie sich in einem Teil ihres Werks wieder spiegeln. Vgl. R. Stamm (Hrsg.), Paula Moderson-Becker und die ägyptischen Mumienporträts. Eine Hommage zum 100. Todestag der Künstlerin (München 2007).
[14] Vgl. E.G. Bulwer-Lytton, Die letzten Tage von Pompeji (München 2009).
[15] Vgl. A. Alexandrids/W. D. Heilmeier, Archäologie der Fotographie (Darmstadt 2004).
[16] Auf die Diskussion, welche am Anfang des 20. Jh. ihren Ausgang nahm und noch andauert, ob Film Kunst sei, und wenn ja wann, soll hier nicht eingegangen werden. Vgl. R. Arnheim, Film als Kunst (Frankfurt am Main 2002).
[17] G. Sesslen, Geschichte und Mythologie des Abenteuerfilms (Marburg 1996) 9.
[18] S. Heinken, Wir müssen das Image des Schatzgräbers loswerden. Interview mit H. Parzinger (30.01.2011). <http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,741800,00.html.> [Stand: 31.Januar 2011].
[19] G. Sesslen, Geschichte und Mythologie des Abenteuerfilms (Marburg 1996) 216.
[20] Harrison Ford spielte in den „Star Wars“ Filmen die Rolle des Abenteurers Han Solo in den „Indiana Jones“-Filmen verkörpert er diesen Typus erneut.
[21] G. Sesslen, Geschichte und Mythologie des Abenteuerfilms (Marburg 1996) 220.
[22] Ebd.
[23] Siehe unten „Klischees und Klischeewirkung“ S. 119.
[24] Nach dem Erfolg des Kinofilms „Stargate“ produzierte man zunächst eine Serie gleichen Titels und schließlich weitere Sequels wie „Stargate Atlantis“ und „Stargate Universe“.
[25] Sein ist wahrgenommen werden.
[26] Ch. Türcke, Die erregte Gesellschaft. Philosophie der Sensation (München 2002) 38.
[27] W. Shakespeare, Romeo und Julia. Dramatische Werke in sechs Bänden 4 (Berlin und Weimar 1964) 24.
[28] L. Mikos, Film und Fernsehanalyse (Konstanz 2008) 79.
[29] Mediale Diskussionen wie in Deutschland um „Der Untergang“ und „La vita è bella“ sind in den USA schwer vorstellbar, wie die Debatte um „Inglourious Basterds“ gezeigt hat.
[30] Vgl. P. Weingart/P. Pansegrau u.a., Von Weltbeherrschern, Menschenverbesseren u.a. verrückten Wissenschaftlern. (20.10.2003). <http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/Zentrale%20Institute/IWT/FWG/Film/Arbeitsgruppe.html> [Stand: 22.Dezember 2010].
[31] K. Denzer, Das internationale Archäologie-Film-Kunst-Festival 1999 – 2010. In: K. Denzer.(Hrsg.), Cinarchea/Eine Chronik (Kiel 2010) 35.
[32] M. Mittermeier, „Zapped! – Ein TV-Junkie knallt durch“ 1996.
[33] R. Schawinski, Die TV-Falle. Vom Sendungsbewusstsein zum Fernsehgeschäft (Hamburg 2008) 222.
[34] C. Seidler, Genauso echt wie die Mona Lisa (22.05.2008). <http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,554338,00.html> [Stand: 15.Dezember 2010].
[35] T. Balkenhol, Ein Dorf das man sieht, braucht keinen Fremdenführer. Archäologie im Fernsehen aus Sicht der Dokumentarfilmmontage. In: K. Denzer (Hrsg.), Filme, Funde, falsche Freunde. Der Archäologiefilm im Dienste von Profit und Propaganda (Kiel 2003) 211.
[36] John Rhys-Davies spielte in den “Indiana Jones“-Filmen die Rolle des Sallah.
[37] „Learning Connection“ ist ein zusätzliches Kabelprogramm des Discovery-Channel.
[38] K. Hickethier, Film und Fernsehanalyse (Stuttgart 2001) 5.
[39] Ebd. 7.
[40] A. Kätsch-Hattendorf, Formate im Fernsehen. In: J. Gruhler (Hrsg.), Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland 1 (Stuttgart 2006) 20 – 26.
[41] M. Götzke/L. Knüppel, Die Veränderung dokumentarischer Formate durch die DV-Technologie. Schneller, Näher, Persönlicher (Hamburg 2009) 9.
[42] Ebd. 15.
[43] Dies gilt im Grunde allerdings auch für die Dokumentation.
[44] Vgl. A. Kluge, Chronik der Gefühle (Frankfurt am Main 2000).
[45] Die Gebrüder Luminere zeigten z.B. Alltagsszenen aus ihrer Fabrik.
[46] F. Wolf, Plot, Plot und wieder Plot „Doku-Soap“: Mode oder Zukunft des Dokumentarfilms? Epd Medien 22, 1999, 3-6.
[47] W. von La Roche/G. Hofacker (Hrsg.), Einführung in den praktischen Journalismus (Berlin 2006) 16.
[48] Robert Flaherty gilt mit seinen Filmen „Nanook of the North“ und „Moana“ als Begründer des Dokumentarfilms, denn in einer Rezension des Films „Moana“ von John Grierson wird zum ersten Mal das Wort „Documentary“ verwendet.
[49] P. Werner, Die Skandalchronik des deutschen Films (Frankfurt am Main 1990) 10.
[50] Ch. Türcke, Die erregte Gesellschaft. Philosophie der Sensation (München 2002) 7.
[51] Ebd. 92.
[52] St. Niggemeier, Es darf nie nichts passieren. Wie es RTL schafft, aus seinem Programm die Wirklichkeit zu verbannen – und damit unfassbar erfolgreich zu sein. F.A.S. 47, 2010, 33.
[53] Siehe unten „Reenactment“ S. 94.
[54] Vgl. St. Wachtel, Schreiben fürs Hören: Trainingstexte, Regeln und Methoden (Konstanz 2009).
[55] Vgl. P. Hörl, Film als Fenster zur Welt. Eine Untersuchung des filmtheoretischen Denkens von John Grierson (Konstanz 1996).
[56] Vgl. M. Strompen, Eine wahre Erfolgsstory? Zur Authentizität moderner TV-Dokumentationsformate (Saarbrücken 2009) 3.
[57] M.Grassel, Das Wesen des Dokumentarfilms. Möglichkeiten der Dramaturgie und Gestaltung (Saarbrücken 2007) 40.
[58] B. Seiler, Fernsehen das Wissen schafft. Forschungsthemen in Magazin und Doku-Formaten (Marburg 2009) 17.
[59] P. Zimmermann/Kai Hoffmann (Hrsg.), Dokumentarfilm im Umbruch. Kino-Fernsehen-Neue Medien (Konstanz 2006) 46.
[60] St. Niggemeier, Es darf nie nichts passieren. Wie es RTL schafft, aus seinem Programm die Wirklichkeit zu verbannen – und damit unfassbar erfolgreich zu sein. F.A.S. 47, 2010, 33.
[61] Ebd. 33.
[62] Ebd. 33.
[63] So geschehen bei den Quizsendungen wie „Wer wird Millionär?“, den Vorabendtelenovelas und den Talksendungen.
[64] R. Schawinski, Die TV-Falle. Vom Sendungsbewusstsein zum Fernsehgeschäft (Hamburg 2008) 164 – 165.
[65] Siehe unten „Terra X – Der Herr der Himmelsscheibe“ S. 25.
[66] P. Werner, Die Skandalchronik des deutschen Films (Frankfurt am Main 1990) 11.
[67] Vgl. A. Kluge, In Gefahr und höchster Not bringt der Mittelweg den Tod. Texte zu Kino, Film, Politik (Hamburg 1999).
[68] Vgl. U. Ganz-Blättler, Genres zwischen Fiktion und Dokumentation. Versuch einer Neubestimmung (15. Juni 2005). <http://www.medienheft.ch/dossier/bibliothek/d23_Ganz-BlaettlerUrsula.html> [Stand: 02. November 2010] oder M. Thiele, Publizistische Kontroversen über den Holocaust im Film (Münster 2002) 426.
[69] „Tag X“ stammt aus der „Terra X“-Redaktion.
[70] Die „Silent Clock“ ist ein stilistisches Mittel bei dem eine Uhr ohne Ton läuft um den Zuschauer eine zeitliche Orientierung zu ermöglichen.
[71] F. Wolf, Trends und Perspektiven für die dokumentarische Form im Fernsehen, Eine Fortschreibung der Studie „Alles Doku – oder was? Über die Ausdifferenzierung des Dokumentarischen im Fernsehen“ (2005) 12. <http://www.dokville.de/dokville2005/schriften/Fritz-Wolf.pdf> [Stand: 01.Dezember 2010].
[72] Der „Audience flow“ erfasst jene Zuschauer, die von einer Sendung in die Nachfolgende mitgenommen werden konnten.
[73] Vgl. G. Traufetter, Liveshow aus Nekropolis, Spiegel 38, 2002, 170.
[74] Ebd.
[75] G. Traufetter, Kabale um die Knochen (06.08.2001). <http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-19815953.html> [Stand: 14. November 2010].
[76] C. Seidler, Genauso echt wie die Mona Lisa (22.05.2008). <http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,554338,00.html> [Stand: 15.Dezember 2010].
[77] K. Denzer, Das internationale Archäologie-Film-Kunst-Festival 1999 – 2010. In: K. Denzer (Hrsg.), Cinarchea/Eine Chronik (Kiel 2010) 16 – 39.
[78] Ebd. 62 – 64.
[79] L. Speer, Wissenschaft oder Kunst, Antagonismen für die Anschaulichkeit? In: K. Denzer (Hrsg.), Cinarchea – Sichtweisen zu Archäologie – Film – Kunst, Perspectives on archeology – film – art. Cinarchea 4 (Kiel 2000) 22 – 23.
[80] Vgl. W. Hohlbein, Die Kriegerin der Himmelsscheibe (München 2010).
[81] Vgl. Himmelswege die neue Tourismusroute durch Sachsen-Anhalt. <http://www.himmelswege.de/82/> [Stand: 02. Januar 2011].
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (eBook)
- 9783842823273
- DOI
- 10.3239/9783842823273
- Dateigröße
- 625 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg – Institut für Prähistorische Archäologie
- Erscheinungsdatum
- 2011 (Dezember)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- reenactment archäologie fersehen dokumentarfilm computeranimation
- Produktsicherheit
- Diplom.de