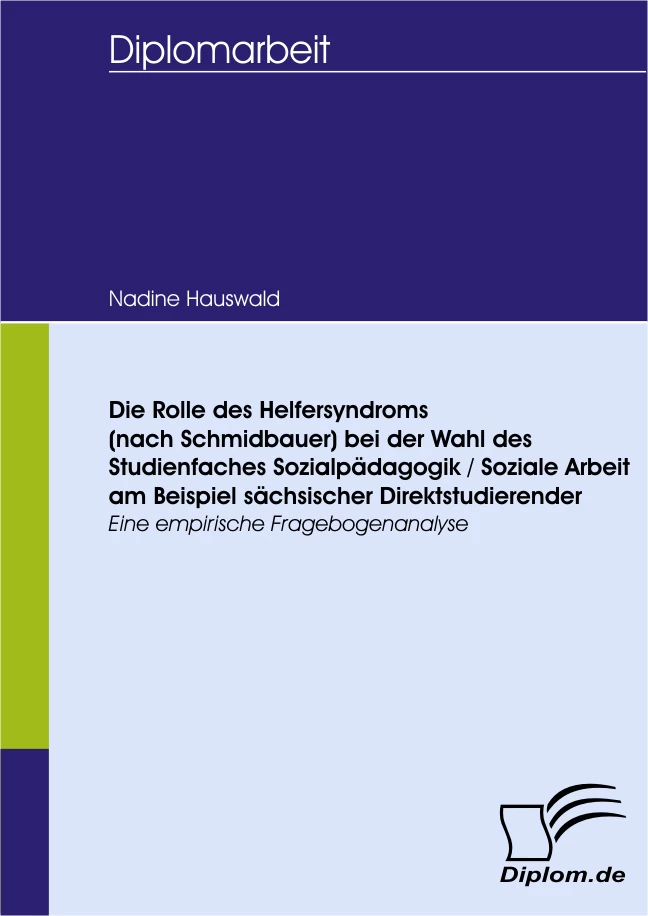Die Rolle des Helfersyndroms (nach Schmidbauer) bei der Wahl des Studienfaches Sozialpädagogik / Soziale Arbeit am Beispiel sächsischer Direktstudierender
Eine empirische Fragebogenanalyse
Zusammenfassung
Schon vor Beginn meines Studiums fragte ich mich, ob und inwiefern sich der Beruf des Helfens von anderen unterscheidet, woran dies festgemacht werden kann und was einen Menschen auf welche Weise dazu bewegt, sozial tätig zu sein nicht nur nebenbei und ehrenamtlich, sondern aus der Motivation für einen Beruf heraus. Können jene, die im sozialen Bereich tätig sind, als Helferpersönlichkeiten bzw. als Menschen mit einem Helfersyndrom bezeichnet werden, denen bestimmte Charaktere und Eigenschaften zugeschrieben werden können? Wohl kaum. Was macht dabei das professionelle Helfen aus? Da muss etwas Unsichtbares im Hintergrund sein, das viele nicht alle angehende, so genannte Helfer verbindet.
In meiner Diplomarbeit möchte ich untersuchen, in wie weit das psychoanalytische Modell und Phänomen Helfersyndrom nach Schmidbauer mit all seinen Verwinklungen tatsächlich und empirisch nachgewiesen auf angehende Sozialpädagogen und Sozialarbeiter zutrifft. (Anmerkung der Verfasserin: ich werde in meiner Arbeit, der Übersicht halber, gänzlich das generische Maskulinum verwenden.) Genauer gesagt beschäftigt mich die Frage: Kann verallgemeinert festgestellt werden, ob aus der Motivation eines in sich schlummernden Helfersyndroms heraus ein Studium der Sozialpädagogik / Sozialen Arbeit (SP / SA) aufgenommen wird und wie genau diese Motivation dann aussieht? Wie sehr unterscheidet sie sich von anderen, fern von Altruismus und der Anthropologie, welche soziales Miteinander als Urform im Kampf des Überlebens zählt und auch fern vom social-support-Begriff, der die soziale Unterstützung und Hilfe zwischen Menschen in nichtprofessionellen Beziehungen in ihren alltäglichen Netzwerken beschreibt und die psychische Gesundheit eines jeden unterstützen soll. Bisher existieren nur nachträgliche Feststellungen eines Helfersyndroms von bereits ausübenden Sozialarbeitern / Sozialpädagogen (SP / SA) und zahlreiche Untersuchungen über Motive für ein SP / SA-Studium, die jedoch das Thema des Helfersyndroms nur ungenügend implizieren.
Das Helfersyndrom ist meines Erachtens im Alltagsgebrauch gängig und oberflächlich bekannt. Zudem ist es negativ konnotiert, teilweise wird ihm auch das Etikett des Klischees aller Sozialberufe zugeschrieben, empirisch bestätigt ist das Helfersyndrom jedoch noch nicht. Nachdem ich im ersten Teil meiner Arbeit den Begriff sorgfältig definieren werde, möchte ich in die Tiefe der Kindheit gehen und die Entstehung […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Helfersyndrom
2.1 Begriffsklärung
2.1.1 Entstehung des Helfersyndroms (im weiten Sinne)
2.1.2 Ursprung des Helfersyndroms (im engeren Sinne)
2.1.3 Helfersyndrom und Gesellschaft
2.2 Helfersyndrom und Burn-out-Gefahr
2.2.1 Verfestigung des Helfersyndroms
2.2.2 Burn-out
2.2.3 Prävention und Helfersyndrom-Bewältigung
2.3 Kritiker und Befürworter - warum helfen wir?
2.3.1 Fengler
2.3.2 Richter
2.3.3 Fricke / Grauer
2.3.4 Missel und Fisher
2.3.5 Wellhöfer
2.4 Zusammenfassung
3. Stand der Forschung
3.1 Motivation Helfen
3.1.1 Geschichtlicher Rückblick
3.1.2 Exkurs: humanistische Herangehensweise
3.1.3 Roßrucker
3.1.4 Gildemeister
3.2 Berufswahl Sozialpädagogik / Soziale Arbeit - quantitative Studien
3.2.1 Garlichs
3.2.2 Seifert
3.2.3 Knüppel
3.2.4 Kraak
3.2.5 Wirth
3.3 Berufswahl Sozialpädagogik / Soziale Arbeit - qualitative Studien
3.3.1 Ackermann
3.3.2 Groß
3.4 Zusammenfassung
4. Die Rolle des Helfersyndroms bei der Wahl des Studienfaches Sozialpädagogik / Soziale Arbeit
4.1 Theoretische Vorüberlegung
4.2 Erhebungsinstrument: Der Online-Fragebogen
4.3 Fragestellung und Hypothesenbildung
4.4 Operationalisierung
4.4.1 Instruktion
4.4.2 Sozialstatistische Angaben
4.4.3 Motive zur Studienfachwahl
4.4.4 „Helfersyndrom-Persönlichkeitstest“
4.4.5 Begriff Helfersyndrom
4.4.6 Kommentare und Kritik
4.5 Datenerhebung / Datenaufbereitung
4.6 Datenauswertung
4.7 Darstellung der Untersuchungsergebnisse
4.7.2 Motive für die Studienfachwahl
4.7.3 „Helfersyndrom-Persönlichkeitstest“
4.7.4 Begriff Helfersyndrom
4.7.5 Kommentare und Kritik
4.7.6 Die „Helferpersönlichkeiten“
4.8 Deutung und Interpretation der Ergebnisse
4.8.1 Motive für die Studienfachwahl
4.8.2 „Helfersyndrom-Persönlichkeitstest“ / „Helferpersönlichkeiten“
4.8.3 Begriff Helfersyndrom
4.9 Hypothesenwiederaufgriff
4.10 Resümee
5. Fragestellung für weiterführende Untersuchungen und Schlussfolgerung
6. Literaturverzeichnis
Anlage 1: Selbstständigkeitserklärung
Anlage 2: Online-Fragebogen als Worddatei
Anlage 3: Diagramme zu 4.7
1. Einleitung
Schon vor Beginn meines Studiums fragte ich mich, ob und inwiefern sich der Beruf des Helfens von anderen unterscheidet, woran dies festgemacht werden kann und was einen Menschen auf welche Weise dazu bewegt, sozial tätig zu sein - nicht nur nebenbei und ehrenamtlich, sondern aus der Motivation für einen Beruf heraus. Können jene, die im sozialen Bereich tätig sind, als „Helferpersönlichkeiten“ bzw. als Menschen mit einem Helfersyndrom bezeichnet werden, denen bestimmte Charaktere und Eigenschaften zugeschrieben werden können? Wohl kaum. Was macht dabei das professionelle Helfen aus? Da muss etwas Unsichtbares im Hintergrund sein, das viele - nicht alle - angehende, so genannte „Helfer“ verbindet.
In meiner Diplomarbeit möchte ich untersuchen, in wie weit das psychoanalytische Modell und Phänomen „Helfersyndrom“ nach Schmidbauer mit all seinen Verwinklungen tatsächlich und empirisch nachgewiesen auf angehende Sozialpädagogen und Sozialarbeiter zutrifft. (Anmerkung der Verfasserin: ich werde in meiner Arbeit, der Übersicht halber, gänzlich das generische Maskulinum verwenden.) Genauer gesagt beschäftigt mich die Frage: Kann verallgemeinert festgestellt werden, ob aus der Motivation eines in sich schlummernden Helfersyndroms heraus ein Studium der Sozialpädagogik / Sozialen Arbeit (SP / SA) aufgenommen wird und wie genau diese Motivation dann aussieht? Wie sehr unterscheidet sie sich von anderen, fern von Altruismus und der Anthropologie, welche soziales Miteinander als Urform im Kampf des Überlebens zählt und auch fern vom „social-support-Begriff“, der die soziale Unterstützung und Hilfe zwischen Menschen in nichtprofessionellen Beziehungen in ihren alltäglichen Netzwerken beschreibt und die psychische Gesundheit eines jeden unterstützen soll (vgl. Nestmann 1988, S. 19). Bisher existieren nur nachträgliche Feststellungen eines Helfersyndroms von bereits ausübenden Sozialarbeitern / Sozialpädagogen (SP / SA) und zahlreiche Untersuchungen über Motive für ein SP / SA-Studium, die jedoch das Thema des Helfersyndroms nur ungenügend implizieren.
Das Helfersyndrom ist meines Erachtens im Alltagsgebrauch gängig und oberflächlich bekannt. Zudem ist es negativ konnotiert, teilweise wird ihm auch das Etikett des „Klischees aller Sozialberufe“ zugeschrieben, empirisch bestätigt ist das Helfersyndrom jedoch noch nicht. Nachdem ich im ersten Teil meiner Arbeit den Begriff sorgfältig definieren werde, möchte ich in die Tiefe der Kindheit gehen und die Entstehung eines Helfersyndroms (nach Schmidbauer) näher beleuchten. Was bedeutet es, das Helfersyndrom in sich zu tragen, unter welchen Bedingungen entsteht es, in welche Richtungen kann das eigene Leben gelenkt werden und was für Gefahren birgt es? Ich werde die „Helferpersönlichkeit“ (HPSK) nach Schmidbauer eruieren und kritisch hinterfragen, indem ich andere Meinungen heranholen und gegenüberstellen werde.
Um schließlich den Übergang vom Helfersyndrom zu seiner Rolle bei der Studienwahl des Faches SP / SA herzustellen, werde ich die Motive des Helfens untersuchen, die im engeren Sinne bei der Studien- und Berufswahl und im weiteren Sinne über die Berufswahl hinaus für das weiterführende Leben eine Rolle spielen. Dazu diskutiere ich - in einer Auswahl - den Stand der Forschung, sowohl qualitativ als auch quantitativ, da bereits des Öfteren untersucht wurde, warum und aus welchen Motivationen heraus SP / SA studiert wird.
Im zweiten Teil meiner Arbeit beschreibe ich die Herangehensweise und Aufbereitung meiner empirischen Untersuchungen, zeige Fragestellungen und Prozesse auf und werde die Ergebnisse deskriptiv und interpretierend darstellen, um abschließend ein Resümee ziehen und eventuelle Ausblicke schaffen zu können. (Anmerkung der Verfasserin: sämtliche Prozentangaben werde ich aufgrund des teilweise sehr häufigen Gebrauchs in meiner Arbeit mit dem Zeichen „%“ abkürzen.)
2. Das Helfersyndrom
2.1 Begriffsklärung
Der Begriff „Helfersyndrom“ dürfte mittlerweile ein recht bekanntes Wort sein, welches jedoch im Allgemeingebrauch oft negativ behaftet ist (vgl. Kapitel 4.7.4). Gibt es dafür einen Grund? Das Wort setzt sich aus den Wörtern Helfen und Syndrom zusammen. Diese Zusammensetzung wurde von Wolfgang Schmidbauer „erschaffen“. Kurz zur Person: Wolfgang Schmidbauer, geboren 1941 in München, ist ein deutscher Psychoanalytiker, Supervisor und Autor. 1977 erschien sein sehr erfolgreiches und viel verkauftes Buch „ Hilflose Helfer. Über die seelische Problematik der helfenden Berufe “ (verwendete Auflage in meiner Arbeit von 2000), in welchem er den Begriff „Helfersyndrom“ prägte. Dieser Begriff hat nicht nur Einzug in die Hochschulen und Universitäten gefunden, sondern ist auch zu einem gängigen Begriff in der Durchschnittsbevölkerung geworden (vgl. Kapitel 4.7.4). Doch wie kann Helfen schlecht bzw. negativ, gar ein Syndrom sein, wenn unter einem Syndrom das gleichzeitige Auftreten verschiedener Symptome verstanden werden kann und Symptome Krankheitsanzeichen sind? Wie ist Schmidbauer zu seiner psychoanalytischen Theorie gelangt? Bereits in seinem Studium stieß Schmidbauer auf Statistiken, welche das Burn-out von Ärzten in seinen verschiedensten Erscheinungen schilderten. Weitergehend im Laufe seiner Berufskarriere, in der psychoanalytischen Ausbildung über seine eigene Lehranalyse bis hin zu seiner Tätigkeit als Leiter von Fortbildungsveranstaltungen für Angehörige helfender Berufe, stieß er vor allem in von ihm geleiteten Selbsterfahrungsgruppen auf Menschen, die in sich ähnelnder Weise mit sich und ihrem Beruf nicht mehr zurecht kamen. Es interessierte ihn, warum und wie professionell ausgebildete und gute Helfer sich selbst blockieren und im Leben nicht weiterkommen, nicht einfac h das an sich anwenden können, was sie ihren Klienten alltäglich raten. Schmidbauer untersucht, was es Negatives gibt am eigentlichen Helfen und wie dies vor allem mit der Gesellschaftsform und den Institutionen zusammenhängt - ein interessantes Phänomen, was gleichzeitig die Diskussion über „gute und schlechte Helfer“ auslöste (vgl. Schmidbauer 1999, S. 239). Aus all diesen ihm deutlich gewordenen wiederkehrenden Symptomen formulierte er das so genannte „soziale Syndrom“ bzw. umgangssprachlich bekannter als das „ Helfer-Syndrom “ (vgl. Wellhöfer 1988, S. 32). Um so erstaunlicher ist die Tatsache, dass es nach all seinen beeindruckenden und überzeugenden Büchern zu diesem Thema bis dato keine empirische Studie über das Helfersyndrom gibt.
2.1.1 Entstehung des Helfersyndroms (im weiten Sinne)
Schmidbauer äußert sich zum Helfersyndrom folgendermaßen: „Das Helfer-Syndrom, die zur Persönlichkeitsstruktur gewordene Unfähigkeit, eigene Gefühle und Bedürfnisse zu äußern, verbunden mit einer scheinbar omnipotenten, unangreifbaren Fassade im Bereich der sozialen Dienstleistungen, ist sehr weit verbreitet“ ( Schmidbauer 2000, S. 15). Weiter beschreibt er das Helfersyndrom als „[s]oziales Helfen [aus] Abwehr von Ängsten, von innerer Leere, von eigenen Wünschen und Bedürfnissen[…]“ (ebd., S. 205) und dass es in das gesamte Leben eingreifen würde.
Um an den Kern des Motivs zu gelangen, grenzt er das narzisstisch gesteuerte Helfen per Dreiteilung von dem spontanem Helfen (siehe Lukasevangelium „der barmherzige Samariter“) und dem rational gesteuerten Helfen ab, um so den Hintergrund und die Absicht des Helfens deutlicher verstehbar werden zu lassen (vgl. ebd., S. 40).
Die Grundproblematik, wovon Schmidbauer ausgeht, ist eine über lange Zeit stark empfundene Ablehnung des eigenen Wesens und eine damit einhergehende starre Orientierung am eigenen, geschaffenen Ich-Ideal (Fantasieschöpfung) bzw. die damit zusammenhängende Identifikation (bewusst oder unbewusst) mit einem anspruchsvollen und ablehnenden Über-Ich (im Sinne der Eltern). So werden beispielsweise Gefühle als etwas Kindisches gesehen, was umerzogen werden muss. Das Ich-Ideal dient vor allem der sozialen Fassade. Schwächen, Wünsche, Bedürfnisse werden verleugnet. Schon hier wird erkennbar, dass das Helfen sehr gut ins Bild passt. Es bedient das Ich-Ideal und auch das Über-Ich, da das (äußerliche) „Machen“ und weniger das (innerliche) „Sein“ im Helfen gut zur Geltung kommen kann und Wert hat (vgl. Schmidbauer 2000). Bereits frühzeitig werden diese negativen Erfahrungen gemacht und sind von großer Bedeutung. So kann das Helfen außerdem genutzt werden, um den fehlenden Selbstwert zu erhöhen und Anerkennung zu erhalten. Da das Bedürfnis jedoch so groß ist und die Quellen beschränkt sind (der Selbstwert macht sich fast ausschließlich von außen über das Helfen als Zufuhr fest), ist immer mehr Energie (Helfen) notwendig, um den nötigen Selbstwert aufrecht zu erhalten. Dies wird negativ unterstützt, in dem Niederlagen mehr wiegen als Erfolge. Es gibt keinen vorhandenen „inneren Vorrat“ oder „Speicher“, über den hingegen der „normale Mensch“ verfügt. Dies führt allerdings zu einem Widerspruch, da Gegenseitigkeit in jeglicher Form von Menschen mit dem besagten Helfersyndrom vermieden wird. Zum einen, da das Über-Ich Dominanz und Kontrolle fordert, was aus der narzisstischen Kränkung (aus früheren Abhängigkeits- und Nähesituationen) herrührt und einen unerträglichen Schmerz verursachen würde. Zum anderen ist die Gefahr eines möglichen Zusammenbruchs der Ich-Ideal-Fassade zu groß. Somit kann aus der Helferrolle ohnehin und aus eben diesem Tatbestand heraus eine Beziehung nur unter Erzeugung von Abhängigkeit des Anderen (zum Helfer) ent- und bestehen (vgl. Schmidbauer 2000). (Betrachtet man diese Situation objektiv und vorausschauend, so wird absurderweise an dieser Stelle deutlich, dass es sich um jeweils zwei Hilfsbedürftige / Klienten bzw. zwei Helfer / Therapeuten handelt.) Dieses Abhängigkeitsverhältnis schafft dem Helfer ein Machtgefühl (welches die Redewendung “Ich werde dir schon helfen!“ (Schmidbauer 2007, S. 15) negativ unterstützt), das dennoch durch eine lebenslange, mitwachsende (narzisstische) Unersättlichkeit, die eng an den Perfektionismus angelehnt ist, nicht stabil bleiben kann. Die Fassade bröckelt, sie kann den abgespaltenen und versagten Bedürfnissen und Wünschen nicht standhalten, welche nun „getarnt“ und nicht angemessen zum Ausdruck kommen. Eine Form dieser Offenbarung ist die indirekte Aggression. Da der Helfer aufgrund seines Über-Ichs und seines Ich-Ideals keine negativen Gedanken und Gefühle zulassen kann, steigt sein Aggressionspotential insgeheim immer mehr an und muss letztendlich doch irgendwie eine Öffnung finden. Auch sind Harmonie und Zufriedenheit mit Beziehungen nicht vereinbar, was zusätzlich negatives Empfinden schürt. So muss kompensiert werden, was sich z.B. durch alloplastische (die Umwelt betreffende) und autoplastische (sich selbst betreffende) Anpassungsformen ermöglichen lässt, zu Gunsten des psychischen Überlebens (vgl. Schmidbauer 2000, S.92). Dadurch kann wieder vermehrt geholfen und die progressive Stellung eingenommen werden. Dies ermöglicht einen Rückkopplungsprozess (aus „Opfer“ werden „Täter“). Kompensationen brauchen jedoch viel Energie, so dass es oftmals anstelle dieser zu Projektionen auf Dritte kommt und / oder temporäre Ersatzbefriedigungen den einfacheren Weg darstellen. Das Helfersyndrom folgt schließlich den Gesetzen eines Suchtprozesses (vgl. Schmidbauer 2000, S. 216).
Kurz und übertrieben ausgedrückt, könnte es folgendermaßen heißen: „Der Helfer kommt depressiv und verzweifelt zu seinem Schützling und verlässt ihn gestärkt, narzißtisch bestätigt. Er ist gebraucht worden. [...] Um für solche subtilen und indirekten narzißtischen Bestätigungen empfänglich zu sein, muß der Helfer in seiner primären Wunschproduktion erheblich beeinträchtigt sein.“ (Schmidbauer 1999, S. 139)
2.1.2 Ursprung des Helfersyndroms (im engeren Sinne)
Die „Helferpersönlichkeit“ entsteht in der oralen bzw. narzisstischen Phase. (Chronologisch betrachtet war das Wort „oral“ eher im Gebrauch, welches im Nachhinein allerdings vorwiegend die reine Triebentwicklung und nicht die des Selbst beschreibt, was jedoch kaum trennbar voneinander ist.)
Um den Kern des Helfersyndroms näher verstehen zu können, muss die innere Situation eines Menschen mit Helfersyndrom verstanden werden. Schmidbauer beschreibt solch einen Menschen als „verwahrlostes, hungriges Baby hinter einer starken, prächtigen Fassade“ (Schmidbauer 2000, S. 18).
„Nächstenliebe als Beruf zieht jene Menschen an, die das Gefühl haben, zuwenig Liebe erhalten zu haben.“ ( Schmidbauer 1999, S. 25)
Wenn der Ursprung im weiten Sinne gesucht wird, dann fängt der sozialethische Ursprung des Helfersyndroms bereits in der Religion, dem Christentum, an. Schmidbauer sieht in der Erbsünde, womit nach christlicher Auffassung ein jeder geboren wird, bereits den ersten psychologischen Schatten, welcher Schuldgefühle vermittelt und das Ich mit dem Über-Ich verschmelzen lässt (vgl. Schmidbauer 2000, S. 42 f.).
Konzentriert man sich jedoch auf die ausgereifte Variante im engeren Sinne, dreht sich letztendlich alles um die Delegation der eigenen Abhängigkeit nach außen. Jemand hilft, weil eigentlich selbst Hilfe gebraucht wird. Ein Leben ganz im Sinne des Über-Ichs schützt das Ich vor dem Erleben jeglicher Ohnmachtsgefühle (vgl. Schmidbauer 2007, S. 9).
Die Wurzel des Helfersyndroms sieht Schmidbauer in der intensiven Mutter - Kind-Beziehung. „Rauschdrogen sind giftige Muttermilch“ (Schmidbauer 2000, S. 20), diese Metaphorik drückt am besten den Ausgangspunkt des Helfersyndroms und dessen Verlagerung aus. Schmidbauer geht davon aus, dass jedes ausgeprägte Helfersyndrom seine Wurzeln in der oralen Phase (in welcher gesäugt wird) hat. Was dem Kind in der oralen Phase an Zuwendung bzw. Bedürfnisbefriedigung nicht gegeben werden kann, es sich somit in irgendeiner Weise abgelehnt fühlt, das könne, so Schmidbauer, nicht „nachgeholt werden“. Es kommt zu Ersatzbefriedigungen jeglicher Art, die Suchtcharakter haben können, eben weil durch sie keine absolute Befriedigung ermöglicht werden kann. Zum einen, weil es diese bedingungslose Art der Bedürfnisbefriedigung im Laufe des Lebens nicht mehr gibt, die einen Menschen vor allem emotional weiterentwickeln lässt. Zum anderen ist die bedingungslose Art der Liebe „auf normalem Wege“ nicht nachholbar, weil der gereifte Mensch nicht mehr zugänglich dafür ist, die Entwicklungsstufe überschritten ist (vgl. Schmidbauer 2000). Ich betonte im vorigen Satz das Wort fühlt, da eine Ablehnung nicht einmal „beabsichtigt“ sein muss, viel mehr können Mutter und Kind einfach „nicht zusammen passen“ oder aber das Kind ist um einiges sensibler als die Mutter „Fühler“ hat. So werden Bedürfnisse nicht erkannt und das Kind kann nicht zu 100% versorgt werden. Mutter und Kind schaffen es nicht in einen Dialog zu treten. Das Kind ist narzisstisch gekränkt. Jedes Kind wird einmal mehr oder weniger im Laufe seiner Entwicklung narzisstisch gekränkt werden. Wie jedoch individuell damit umgegangen wird, das ist das Entscheidende und nicht Vorhersagbare. Dabei spielen innere Ressourcen, Resilienzfaktoren und Persönlichkeit und Charakter eine wichtige Rolle (vgl. Schmidbauer 2000).
Diese angehäuften Kränkungen geben dem Kind das Gefühl, dass es nicht für das, was es ist (Ich), geliebt wird, sondern für das, was es macht (Über-Ich). Dementsprechend nehmen das Ich und das Über-Ich auch besagte starke Positionen ein und können nicht „versetzt“ werden, was - wie bereits erwähnt - zu zahlreichen Problemen führen kann und zur ewigen Suche nach dieser vermissten, bedingungslosen Liebe verurteilt. Je nachdem, welche Faktoren diesen Prozess nun positiv (z.B. Resilienzfaktoren) wie negativ (z.B. eine besonders stark ausgeprägte Sensibilität) beeinflussen, ist dieser Werdegang eine (hier negative) Möglichkeit von vielen und natürlich keine Kausalität (vgl. Schmidbauer 2000, S. 20). Schmidbauer macht deutlich, dass das Helfersyndrom eine solche Möglichkeit ist, die narzisstische Kränkung, welche den Menschen in vielem behindert und schädigt, scheinbar zu bewältigen. „Wenn der Helfer nicht mehr schwach sein kann, braucht er die Schwachen draußen, braucht er Abhängige, Unmündige“ (Schmidbauer 1999, S. 10).
Nach Schmidbauer lassen sich grob fünf Komponenten bzw. Konfliktbereiche, die die „Helferpersönlichkeit“ ausmachen und eine Kausalitätskette bilden, beschreiben:
(1) (gefühlte) Ablehnung durch die Eltern >
(2) Identifizierung mit elterlichem, anspruchsvollem Über-Ich >
(3) (verborgene) narzisstische, unersättliche Bedürftigkeit >
(4) Vermeidung von Gegenseitigkeit in Beziehungen >
(5) hohes inneres Aggressionspotential > indirekte Äußerung von Aggression (gegen Nicht-Hilfsbedürftige) (vgl. Schmidbauer 2000, S. 90)
- HELFEN als Abwehr und Kompensationsmöglichkeit
Die Schwierigkeit der narzisstischen Gefühlslage liegt darin, dass zwischen den Extrema Idealisierung / Machtrausch und Depression / Ohnmachtsangst kein Spielraum existiert. Gesunder Narzissmus orientiert sich an Aufgaben und Durchschnittsleistungen, um an die Spitze kommen zu können. Kranker Narzissmus orientiert sich an Erfolg und lehnt den Durchschnitt ab, es gibt nur „die Spitze“ (vgl. Schmidbauer 2002, S. 80).
2.1.3 Helfersyndrom und Gesellschaft
Schmidbauer sieht durch die moderne Leistungsgesellschaft eine Begünstigung des Helfersyndroms bzw. ist es so, dass sich Mechanismen des Helfersyndroms mit Werten unserer heutigen Gesellschaft überschneiden (vgl. Schmidbauer 2000, S. 60). Schmidbauer geht sogar so weit, dass unsere Gesellschaft gar nicht mehr oder noch weniger funktionieren würde, gäbe es nicht so viele Menschen (mit Helfersyndrom), die sich bis weit über die Selbstschädigung hinaus für ihre Mitmenschen aufopfern (vgl. ebd., S. 90 f.). Sie sind demzufolge wichtig und gut für eine funktionierende Gesellschaft. Indem die Klienten die (negativen) Eigenschaften des Helfers (für ihn) tragen, macht dieser sich zu etwas anderem, zum starken Gegenteil, dessen er sich ständig bewusst machen muss. Somit kämpft er sich selbst frei von Schlechtem und Schwachem, stets orientiert am selbst erschaffenen Ideal. Stark mit diesem verschmolzen, ist er unbesiegbar (vgl. Schmidbauer 1999, S. 182). Hinzuzufügen ist jedoch, dass Schmidbauer die Ursachen des Helfersyndroms im weiten Sinne in der Gesellschaft sieht, der Industrialisierung, der leistungsorientierten, westlichen Welt mit bürokratischem System, obgleich auch andere Kulturen solche Persönlichkeiten wachsen lassen (vgl. ebd., S. 198). Als Voraussetzung sieht Schmidbauer eine Gesellschaft, die die „individualistische Entwicklungsphase“ erreicht hat (Schmidbauer 1999, S. 209).
Schmidbauer kritisiert außerdem den Idealanspruch der Ausbildungsanforderungen sozialer Berufe und vergleicht ihn mit dem Ich-Ideal der Eltern und den folgenden neurotisierenden Erziehungsprozessen, was Auslesungsprozesse anregt und Spaltungen mit sich bringt. Dabei seien „schlechte Eigenschaften“ wichtig, die viele Verhaltensweisen erst ermöglichen. Auf die Ausbildung übertragen würde das bedeuten, Gefühle, Wünsche und vor allem praktische Übungen unbedingt mit einzubeziehen und nicht trocken, theoretisch und allgemeingültig daherredend zu sein. Dass Studierende nahezu anormal perfekt sein müssten, dafür sei das Fach nicht gemacht. Damit stellt sich Schmidbauer auch eindeutig auf die Gegenseite des weit verbreiteten Axioms „Wer selbst Hilfe braucht, kann niemandem helfen“ (vgl. Schmidbauer 2000, S. 13 ff.). Dabei gilt auch hier, wie in vielen Bereichen, dass das Wachsen an Aufgaben und die Möglichkeit der Bewältigung von wesentlicher Bedeutung sind. Fakt ist, dass ein Gesellschaftssystem Bestand hat: „Es wird immer Hilfsbedürftige geben, die ebenso suchtartig auf Hilfe angewiesen sind wie der Helfer auf das Helfen […] der Helfer lebt in einer Nische der Leistungsgesellschaft“ (ebd., S. 216, S. 219).
Zwischen dem Helfer und dem Klienten können interessante und vorwiegend unbewusste Helfer-Klient-Konstellationen entstehen, die teilweise gut und nützlich sind, solange Gegenseitigkeit und Einfühlungsvermögen vorhanden bleiben (vgl. ebd., S. 134). Diese Konstellationen werden Kollusionen genannt (geprägt von H. V. Dicks und J. Willi), die Schmidbauer als „eine gemeinsame Illusion, ein uneingestandenes, voreinander vertuschtes Zusammenspielen von zwei oder mehreren Partnern“ (ebd., S. 108) definiert. Selbige Kollusionen seien in partnerschaftlichen Beziehungen auffindbar. Schmidbauer geht davon aus, dass in Kollusionen beide Seiten einen unbewältigten Grundkonflikt in sich tragen, welcher in unterschiedlichen Rollen ausgetragen wird (in der Regel progressiv (Helfer) und regressiv (Klient / Partner) als neurotische Abwehrhaltungen). Dafür gibt es verschiedenste Formen. Gleich bleibt jedoch meistens, dass der Helfer seinen Klienten / Partner schwach halten muss, um seine Stärke daraus zu ziehen, obwohl er unsicher ist und teilweise versucht, im Klienten / Partner sich selbst zu versorgen. Schmidbauer bearbeitet dieses Thema sehr genau und detailliert mit verschiedenen Herangehensweisen (vgl. Schmidbauer 2000). Da es jedoch eine nicht sehr relevante Rolle in dieser Arbeit spielt, werde ich diesen Teil außen vor lassen.
Zu „Geschlechterverteilung und Helfersyndrom“ meint Schmidbauer, dass seinen Erfahrungen nach die Geschlechter zwar gleich vertreten sind, jedoch falle es bei Frauen weniger auf, da das Helfersyndrom eher „weiblich“ sei, Männer hingegen würde dieses eher „unmännlich“ wirken lassen (vgl. ebd., S. 204). Schmidbauer macht diese Aussage an zugeschriebenen, geschlechtsspezifischen Klischeevorstellungen fest, da diese „manchmal nützliche Hinweise geben, vor allem im Bereich der gestörten Gegenseitigkeit von Beziehungen zwischen dem HS-Helfer und seiner sozialen Umwelt“ (Schmidbauer 2000, S. 204).
2.2 Helfersyndrom und Burn-out-Gefahr
2.2.1 Verfestigung des Helfersyndroms
Das Helfersyndrom kann als „ein Versteck für eine verleugnende Sichtweise, ein Asyl für (Selbst-)Betrug und ausbeutende Rede“ (Schmidbauer 2007, S. 14) gesehen werden, es sollte jedoch nicht als Etikette und Trennung von „schlechten“ und „guten Helfern“, sondern als eine Komponente bei der Berufsmotivation betrachtet werden. Wichtig ist hierbei, dass es nicht die Hauptkomponente sein sollte, denn dies wäre gefährlich, so Schmidbauer. Wenn andere Motive diese hingegen ausgleichen würden, sei es kaum problematisch (vgl. Schmidbauer 2002, S. 27 f.). Das eigentliche Problem hierbei dürfte bei der Reflektion und Differenzierung der eigenen Motive liegen.
Schmidbauer sieht die Gefahr der Verfestigung eines Helfersyndroms bei strukturbildenden Vorgängen analog den Suchtprozessen. Das Helfen dient als Droge zur Ersatzbefriedigung, wovon immer mehr nötig wird und es am Ende zur „schleichenden Selbstzerstörung“ kommen kann (vgl. Schmidbauer 2000, S. 21). Auf dem Weg vom abgelehnten Kind zum mächtigen Helfer wird oftmals ein Schritt überschritten, der der Verarbeitung, Bewusstwerdung und Reflektion. Fehlt dieser wichtige Schritt, der zwischen scheinbarer Vervollkommnung und echter Weiterentwicklung entscheidet, so wächst dieser fehlende Schritt als eine Spalte mit und die notwendige Energie kann nicht mehr ausreichend für die eigenen Kräfte herangeholt werden. Sie muss sozusagen vorrangig die (mitwachsende) Spalte nähren, welche dauerhaft an der scheinbaren Vervollkommnung festhält und es mit ihr nie zu einer echten Weiterentwicklung kommen kann. Es kommt schließlich zum akuten Zusammenbruch des Helfersyndroms, welcher sich in vielfältiger Form äußern kann (psychosomatische Krankheiten, Nervenzusammenbruch, Süchte, Herzinfarkt, Magengeschwür). Auch auf der Verhaltensebene sind Veränderungen möglich. So können z.B.: plötzlich sadistisches oder masochistisches Verhalten sich selbst gegenüber oder Zynismus und Sarkasmus dem Klienten gegenüber auftreten (vgl. Schmidbauer 2000, S. 92).
Daran anknüpfend geht ein hohes Depressionspotential mit dem Helfersyndrom bzw. dem „Suchtgefährdeten“ einher, eben aufgrund dieser vermeintlich ausweglosen Situation, was wiederum die Selbstmordrate anhebt. Bei Ärzten (zwischen 25 und 39 Jahren) beispielsweise, welche die höchste Suchtgefährdung aufweisen, sei die Selbstmordrate (mit 26% aller Todesfälle) nahezu dreimal so hoch wie in der Vergleichsgruppe (Durchschnittsbevölkerung) (vgl. ebd., S. 21). Depressionen und das Helfersyndrom können gleichfalls mithilfe des Narzissmus-Konzepts (Henseler 1974) erklärt werden. Jemand wird depressiv / es wird geholfen, weil es nicht gelingt dem eigenen Ich-Ideal gerecht zu werden. Durch das Helfen kann sehr gut das Größenselbst genährt werden und das Selbstbewusstsein steigt (teilweise ins Unermessliche durch die Identifizierung mit dem Ich-Ideal). Kommt jedoch ein (noch so objektiv nichtiger) Tiefschlag, löst die Depression mit dem Versagen das Größenselbst ab usw. - ein Teufelskreis entsteht (vgl. ebd., S. 22 f.). Schmidbauer vergleicht das Selbstgefühl eines Menschen mit Helfersyndrom mit einem „geblähten Ballon“, der durch einen winzigen Nadelstich zu platzen droht (Schmidbauer 2007, S. 54). Die Ursachen eines Selbstmordes können jedoch nicht zwangsläufig mit Depressionen, Sucht und / oder dem Helfersyndrom in Verbindung gebracht werden
2.2.2 Burn-out
Ist der Prozess eher schleichend und wird der Punkt des dringenden Ausstiegs übersehen, so kann es zur chronischen Dekompensation (vgl. ebd., S. 92) kommen. Neben dem Problem der nicht mehr aufbringbaren Energie kann es zu zusätzlichen Schwierigkeiten kommen, die auch auf andere Berufsrollen zutreffen, wie z.B. Probleme mit dem Klientel, der Institution, auf gesellschaftlicher Ebene, mit der Berufsrolle oder auch das Problem mit der eigenen Profession, das Gefühl, alles halb zu können, aber „nichts wirklich zu sein“ (vgl. Ackermann 1999, S. 105).
Der Begriff Burn-out kommt aus dem Englischen (to burn out) und bedeutet wörtlich übersetzt „ausgebrannt, ausbrennen, ausgebrannt sein“. Es gibt unzählige Definitionen, Herangehensweisen, Modelle, Ansätze und Theorien über die Entstehung und den Kern dieses Begriffes. Kurz gefasst könnte Burn-out als ein „Zustand körperlicher, geistiger und emotionaler Erschöpfung“ (Aronson, Pines und Kafry 1983, zit. in: Enzmann; Kleiber 1989, S. 17) definiert werden. Der Begriff taucht zusammen mit der Helfersyndromdebatte intensiv gegen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre auf, wobei es bereits erste öffentliche Burn-out-Fälle in den 30er Jahren bei Sportlern und darstellenden Künstlern gab (vgl. ebd., S. 17). Enzmann und Kleiber gehen in ihrer Definition noch näher auf die Ursachen und eventuelle Begriffsmissverständnisse ein: „Burnout ist kein neu entdecktes Krankheitsbild, sondern ein aus Arbeitsbedingungen, Aufgabenmerkmalen und Personenmerkmalen gemeinsam erklärbares Reaktionssyndrom“ (ebd., S. 8). Gleiss (1978) betrachtet Burn-out als eine automatische und nicht wirklich lösungsorientierte Strategie der Konflikt- und Aufgabenbewältigung. Als Urvater dieses Begriffs gilt jedoch der Psychoanalytiker Freudenberger, welcher erstmals 1974 aufgrund von Beobachtungen aus seiner Praxis diesen Begriff definierte. Freudenberger stellte fest, dass viele seiner Patienten aus helfenden Berufen kamen und oftmals sehr ähnliche Symptome zeigten (analog Schmidbauers Helfersyndrom-Definition und -Entdeckung) (vgl. ebd., S.18). Freudenberger sieht als Hauptursache für ein Burn-out die sich schnell verändernde Gesellschaft. Symptome des Burn-outs wären ein geringes Leistungsvermögen, Depressivität, Hilflosigkeit, hohe Erschöpfung (hier zu verstehen als Unzufriedenheit mit sich selbst, der Arbeit und allgemein dem Leben), schwindendes Engagement und die Schwierigkeit der Abgrenzung zu den Klienten bzw. ein einsetzender Dehumanisierungsprozess (vgl. Brake 1996, S. 121 ff.). Im Prinzip sind dies genau die gleichen Merkmale, die das Helfersyndrom im Verborgenen ausmachen, hier nun nach außen gewendet und aufs Höchste getrieben.
Doch wen betrifft das nun genau? Burn-out ist mittlerweile ein gegenwärtiger, allgemein bekannter Begriff, der auf viele - unabhängig von ihrer Berufsgruppe - zutrifft und oftmals als bloßer Erschöpfungszustand durch Überarbeitung verstanden wird, ohne psychoanalytische Hintergründe darin zu sehen. Freudenberger beschreibt Burn-out als ein „sich entleeren“. Körperliche und seelische Reserven werden erschöpft und der Betroffene versucht dennoch weiterhin, unter Aufwendung aller Kräfte, hohe und unrealistische Erwartungen (eigene oder aufgesetzte) zu erfüllen, er zerstört sich praktisch selbst. Betroffen können all jene sein, die eine gewisse Persönlichkeitsstruktur aufweisen. Maslach beschränkt sich bei dem Auftreten des Burn-outs auf die helfenden Berufe, was als unzureichend beurteilt werden kann (vgl. Enzmann; Kleiber 1989). Burn-out mag in den sozialen und helfenden Berufen vermehrt und besonders auftreten, jedoch bestimmt nicht ausschließlich, da die gesamte heutige Gesellschaft als eine schnelllebige Konkurrenzgesellschaft gesehen werden kann, die mitunter hohe Anforderungen an die Menschen stellt.
Problematisch und zugleich unabdingbar ist hier (wie auch beim Helfersyndrom) die Relevanz der Reflektion. Nur so kann diese Problemlage erkannt und schließlich verändert bzw. behoben werden. Schmidbauer sieht in einer professionellen Entwicklung einen gewissen Schutz vor Burn-out (vgl. Schmidbauer 2007, S. 334).
Oftmals wird jedoch einzig das Gefühl der Unzufriedenheit wahrgenommen und nichts darüber hinaus und herum. Kann nicht genauer bestimmt und differenziert werden, so kann sich das Burn-out schnell gut einnisten und in sämtliche Lebensbereiche eindringen (vgl. Brake 1996, S. 123). Wie der Burn-out-Prozess im Einzelnen aussieht und beschrieben wird und welche verschiedenen Burn-out-Konzepte und -Ansätze es gibt, darauf werde ich nicht näher eingehen, da dies zu weit weg von meiner Arbeit führen würde. Einzig der Ansatz, welcher an Schmidbauers Helfersyndromtheorie anknüpft, soll beleuchtet werden.
Neben Schmidbauer sieht auch Maslach die Ursache und den Anlass eines Burn-outs in der helfenden Beziehung (vgl. ebd., S. 123). Was Schmidbauer vorwiegend aus der Energievergeudung und aus dem entstandenen Schaden des Helfersyndroms betrachtet, schlüsselt Maslach in vier Aspekte auf. (1) Der Helfer konzentriert sich bei seiner Arbeit vorwiegend auf die Probleme der Klienten. Er wird somit stets mit negativen Informationen konfrontiert. Mit mehr Klienten wächst auch diese Überschüttung von negativen Informationen, so dass der Helfer kaum mehr dazu kommt, das Positive im und am Klienten zu sehen oder seine eigene Person und eventuelle Überforderungsmomente wahrzunehmen. Er sieht, einfach ausgedrückt, überall Probleme. Dies kann dazu führen, dass - als Schutz - Gefühle zurückgeschraubt werden und vorwiegend routiniert gearbeitet wird, was zur Blockierung von zwischenmenschlicher Beziehung führt. (2) Tritt schließlich zusätzlich ein Fehlen an positiver Rückmeldung ein, nach welcher natürlicherweise gestrebt wird, kann es dazukommen, dass sich der Helfer unzureichend und nicht genug beachtet fühlt, was er wiederum auf die Klienten überträgt. (3) Diese Frustration kann zu Dauerfrustration und Aggressionen führen (emotionaler Stress), worunter schließlich alle in der Umgebung lebenden bzw. arbeitenden Menschen leiden (auch wenn versucht wird, diese Aggressionen so gut wie möglich zu unterdrücken). Dies kurbelt einen Kreislauf an. (4) Wird schließlich die Möglichkeit einer Veränderung verkannt, verstärkt sich das negative Bild des Sozialarbeiters auf seinen Klienten und der Zustand gilt als festgefahren (vgl. ebd., S. 123 ff.).
Fengler benutzt für den Begriff Burn-out das Wort „Deformation“ und beschreibt verschiedene Ansätze, wie es dazu kommen kann (vgl. Fengler 1996). Unter anderem schildert er eine Persönlichkeitstheorie und geht auf Schmidbauers Theorie ein. Ausgangspunkte sind auch hier der frühere Prägungsvorgang, der in Teilen negativ verlaufen ist und die damit verbundene gegenwärtige (wenn es zum Ausbruch der Deformation kommt) seelische Schädigung. Die Helferbeziehung hat zuvor meist einen symbiotischen, süchtigen und / oder abhängigen Charakter angenommen. Auch Fengler betont die Deformations- bzw. Burn-out-Problematik bei den helfenden Berufen. Es gilt mittlerweile als empirisch nachgewiesen, dass diese „in besonderer Weise (chronisch) belastet [sind]; sie sind krankheits-, sucht- und selbstmordgefährdet“ (Fengler 1996, S. 46) und wechseln häufiger als andere Berufsgruppen ihren Arbeitsplatz aufgrund von Arbeitsunzufriedenheit (vgl. Roßrucker 2008, S. 81 ff.). Man bedenke, dass es hier nicht einzig um ein Wohlwollen, den ausbrennenden Helfer betreffend, geht, vor allem sind unmittelbar seine Klienten betroffen, denen quasi keine effiziente Hilfe mehr zugetragen werden kann, da sich der Helfer in seinem Zustand bereits zu viel von ihnen „holt“. Demzufolge geht es in erster Linie darum, ein Burn-out gar nicht erst entstehen zu lassen und helfersyndrommarkante Symptome frühzeitig zu erkennen.
2.2.3 Prävention und Helfersyndrom-Bewältigung
Die Frage ist nun, wie kann Burn-out vermieden werden? Kann das Helfersyndrom gemessen werden? Sind diese beiden Begriffe miteinander verknüpfbar oder müssen sie strikt getrennt voneinander betrachtet, bewertet und gemessen werden? Freudenberger schlägt an dieser Stelle als primäre Präventionsmethode vor, eine Art Eignungstest an Universitäten und Hochschulen vor Ausbildungsbeginn absolvieren zu müssen, um damit (eine genauere Beschreibung des WIE ist jedoch unklar) ausschließen zu können, dass aufgrund eigener Defizite studiert bzw. geholfen werden möchte (vgl. Gussone; Schiepek 2000, S. 82). Gussone / Schiepek halten diese Methode für äußerst fragwürdig, dem ich mich anschließen kann. Die Frage ist, wie solch ein Eignungstest aussehen soll. Wenn darunter einzig verschiedene Fragebögen verstanden werden, so ist es, meines Erachtens, äußerst unzureichend, sich mithilfe dieser ein umfangreiches Bild von dem Bewerber zu machen. Werden damit jedoch verschiedene Aspekte angesprochen, wie z.B. ein Motivationsschreiben, ein Bewerbungsgespräch und zusätzlich ein Fragebogen (und damit den Numerus Clausus substituierend), so kann ich mir dies sehr gut vorstellen.
Zum Erfassen von Burn-out gibt es bereits mehrere Instrumente, dies sind vorwiegend diverse Fragebogenvarianten, aber auch andere Methoden (vgl. Enzmann; Kleiber 1989). So könnten allerdings nur jene erfasst werden, die bereits, sei es über das Helfersyndrom oder über einen anderen Weg, das Erschöpfungssyndrom ausgeprägt zeigen.
Um einem Burn-out präventiv entgegen zu wirken, sieht Schmidbauer z.B. die konstruktive Umsetzung des Narzissmus. Es gilt, sich diesem bewusst zu werden und ihn reflektieren zu können, um folglich die frei gewordene Energie umpolen zu können hin zu / zur Kreativität, Humor, Natur, spirituellen Körperübungen etc. (vgl. Schmidbauer 2000, S. 103). Ebenso kann sich an Ressourcen orientiert werden. Stärke soll bewusst erlebt und Schwäche zurückgestellt werden, um somit die Individualität hervorzuheben und nicht das Streben nach extern vorgegebenen Normen zum Ausgangspunkt bleiben zu lassen (vgl. Schmidbauer 1999, S. 223). Jeder im sozialen Beruf oder auf dem Weg dahin sollte sich „repetitiv dauerhaft konfrontieren“ mit reflektiven Selbstbefragungen bzgl. der eigenen Gründe, Arten und Weisen des Helfens (vgl. ebd. S. 226).
Schmidbauer betont die Relevanz einer Entwicklung auf Basis von Fehlern, um so einem Erstarren vorzubeugen (vgl. Schmidbauer 2002, S. 25) und vergleicht die seelische Belastbarkeit und Beschaffenheit, meines Erachtens zu recht, mit dem Hauttyp - jeder ist anders beschaffen, es ist kein Bewerten möglich (vgl. ebd., S. 27). Meist sei der einzige Weg aus einem festgefahrenen Burn-out der lange, aufwendige, psychotherapeutische Weg, so Schmidbauer.
2.3 Kritiker und Befürworter - warum helfen wir?
2.3.1 Fengler
Um die verschiedenen Gründe explorieren zu können, warum man helfend tätig ist, ziehe ich folgende Definition Fenglers heran. Er sieht Helfer als „alle Personen, die sich im Haupt-, Neben- oder Ehrenamt anderen Menschen unterstützend, beratend, erziehend, therapeutisch, pflegend, lehrend und versorgend widmen“ (Fengler 1996, S. 11). Dabei eröffnet er in seinem Buch „Helfen macht müde - zur Analyse und Bewältigung von Burnout und beruflicher Deformation“ von 1996 die eine oder andere negative Sichtweise und kommt Schmidbauer scheinbar nahe. Zum Beispiel sieht er aus nicht näher bestimmter „Ratlosigkeit“ heraus einen Grund zu helfen im Sinne des Ersatzes bzw. als Lückenfüller für eine andere Form der Beziehungsgestaltung. Mit Fenglers Sichtweise auf den helfenden Beruf wird oftmals ein „Helfen als Kontaktersatz“ deutlich, was die Relevanz und Bedeutung der Klienten verdeutlicht. Er geht sogar so weit, zu behaupten, dass „Ferienzeiten […] entsprechend Krisenzeiten des Helfers werden [mögen]“ (ebd., S. 13), was die Suchtproblematik, die Schmidbauer im Helfen sieht, anspricht. Des Weiteren erwähnt Fengler die Möglichkeit eines Helfens aus Abwehr oder auch aus einer Eigentherapie heraus, welches somit der Ablenkung oder auch zur Bewältigung eigener Probleme dienen könnte. Dies könnte mit Schmidbauers Kompensationsverhalten gleichgesetzt werden. Zwanghaftes Helfen, also ein stetes Helfenmüssen, bezeichnet Fengler als „Helfen als Schicksal“ (ebd., S. 14), was der eigenen Gesundheit nicht gerade zu Gute kommt. Auch das „Helfen als Ware “ (ebd., S. 14) betrachtet Fengler, wie Schmidbauer, skeptisch, da dies den Prozess widerspiegelt, den das Helfen durchgemacht hat: von der ursprünglichen Nächstenliebe weg, hin zu Professionalität mit Käuflichkeitscharakter. Um der Idealfigur des Helfers entgegenzuwirken, räumt Fengler zwar Ansprüche ein, die man an einen Helfer haben darf („etwas“ gesund, angstfrei, lebensbejahend, den Alltag bewältigend), dennoch sei „[k]ein Mensch, auch kein Helfer […] gefeit vor Angst, Schicksalsschlägen, Misserfolg, Verlust und Trauer“ (ebd., S. 16).
Fengler geht auf Schmidbauers Theorie ein und drückt nun jedoch deutlich seine Nichtübereinkunft mit ihr aus. Er sieht vor allem in den fünf Komponenten des Helfersyndroms eine Übertreibung und Generalisierung. Jede dieser Komponenten würde in gewisser Weise auf jeden Menschen zutreffen, doch ist nicht jeder ein Helfer und schon gar nicht einer, der das Helfersyndrom mit sich herumträgt. Er vergleicht Schmidbauer mit einem Propheten, der mit wenigen Worten und mit an den Haaren herbei gezogenen Zusammenhängen die Psyche des Menschen zu erklären versucht und dabei die Betroffenen (Helfer) als Opfer bzw. als zu Bemitleidende hinstellt. Fengler kritisiert und differenziert zugleich die schwarz-weiße Sichtweise der geschaffenen „Helferpersönlichkeit“ Schmidbauers, welche als zu einheitlich und mit passenden Beispielen untermauert dargestellt wird. Als empirischen Gegenbeweis verweist Fengler auf eine Studie von Brunner et al. (1978), in welcher der Freiburger Persönlichkeitstest mit Sozialarbeitern und einer Vergleichsgruppe (Durchschnittsbevölkerung) durchgeführt worden ist. Das Ergebnis war negativ. Sozialarbeiter würden sich demnach nicht von der Vergleichsgruppe unterscheiden (vgl. Fengler 1996, S. 49 f.).
Den Begriff „Helfersyndrom“ sieht Fengler als einen mittlerweile umgangssprachlichen und eingängigen Begriff, der bedeutungsarm geworden ist. Er redet von dem Prozess des Eigenlebens, welchen manche wissenschaftliche, „große“ Begriffe durchmachen. Was davon übrig bleibt, ist nicht selten eine leere Hülle. Jeder kennt das Wort, aber keiner weiß den eigentlichen Hintergrund und die theoretische Bedeutung dessen, geschweige denn den „Gründer“ dieses Wortes (vgl. ebd., S. 50). Fengler sieht neben dem Erlöschen der Bedeutung und der Verbreitung einer Worthülle vor allem die negative Konnotation dieses Wortes als problematisch an. Der Begriff „Helfersyndrom“„diskreditier[e] das Helfen insgesamt, nicht nur die zwanghafte Variante“ (ebd., S. 50) und mache das Helfen zu etwas generell Unseriösem, Neurotischem, Egozentrischem und Pathologischem. Die Deformation (Burn-out) hingegen sei bei beiden Extremen zu finden, da, wo zwanghaft geholfen wird, aber auch da, wo keineswegs beruflich geholfen wird. An dieser Stelle widerspricht er sich selbst (vgl. Kapitel 2.2.2) und es stellt sich die Frage, was Fengler genau unter Deformation versteht. Ist es der reine Erschöpfungszustand oder auch die dazugehörige, tiefer liegende Ursache dafür?
Motive, einen helfenden Beruf zu erstreben, sieht Fengler zum einen in der Identifikation mit anderen, bekannten Personen, die solch einen Beruf ausüben. Außerdem spiele ein Interesse an der eigenen Person und den seelischen Vorgängen eine wichtige Rolle, nur so würde auch der Zugang zu dem Spezifischem am Gegenüber gefunden werden. Entgegen der Professionalisierungsdebatte und der Tatsache, dass in den wenigsten helfenden Berufen viel Geld verdient werden kann, spielt die Existenzsicherung als Motiv dennoch eine Rolle. Das Machtmotiv, welches oftmals Personen eingeräumt wird, die seelische Prozesse „durchschauen“ und Rat geben können, ist ein ebenfalls anreizendes, jedoch oftmals verstecktes Motiv. In der „Begegnung“ (Umgang mit Menschen) sieht Fengler eine hohe Bedeutung. Dieser Beruf bringt ständig neue Erfahrungen im Zwischenmenschlichen und auch allgemein lebensrelevant betrachtet mit sich (vgl. Fengler 1996, S. 17 ff.).
Seiner Studie nach zu urteilen, entschieden sich Mädchen um das 16. Lebensjahr einen helfenden Beruf anzustreben, dies wäre signifikant früher als Jungen. Zudem sei die biographische Ausgangslage relevant, somit seien „Opfer“ von sozialen Problemlagen auffällig häufig an einem sozialen Beruf interessiert. Dies bewertet Fengler als Chance und zugleich als Gefahr. Das Problem liegt hier bei der schwer findbaren Balance zwischen Abgrenzung und Identifikation. Das „Ideal des Helfens“ (ebd., S. 53) ist ein weiteres Motiv, was Fengler als bedeutend beurteilt. Er weist jedoch auf die Gefahr hin, dass unkritischer Idealismus frühzeitig einen Wegweiser zum Burn-out ebnen kann (vgl. Combs; Avila; Purkey 1975 und Swensen 1971 „der gute Helfer“).
Fengler weist letztendlich jede Art der Hilflosigkeit von Helfern zurück und betont das Gegenteil, wie nützlich und überlegen sie wären, sei es den Klienten, den Kollegen, sich selbst oder Bekannten und Freunden gegenüber und formuliert Schmidbauers „Hilflosigkeit“ in „Verführbarkeit“ und „Gefährdung“ um. Einzig die „frühe Weichenstellung hin zum Helferberuf in [nachweisbar] vielen Fällen“ (ebd., S. 51) räumt Fengler Schmidbauer ein.
2.3.2 Richter
Richter vertritt Fenglers These und sieht den sozialen Beruf als „Auffüllung eines eigenen Kontaktdefizits […] Regelmäßig ist das unbewußte und zum Teil auch bewußte Bedürfnis zur Überwindung eigener Isolation eine wesentliche Komponente bei der Wahl eines sozialen Berufes“ (Richter 1976, S. 141). Er unterstellt Helfern, dass sie durch die Arbeit im Sozialen Stabilisierung und Vervollständigung des inneren Gleichgewichts und Selbst erlangen wollen. Dies sieht Richter jedoch keinesfalls negativ. „Sie empfinden, daß sie durch ihre Tätigkeit auch für sich selbst einen wichtigen emotionalen Gewinn anstreben“ (Richter 1976, S. 141 f.). Richter plädiert für mehr Offenheit und Selbstbewusstsein diesbezüglich in Form einer Eigentherapie und im Sinne gegenseitigen Brauchens. Auch Richter kritisiert die Ausbildungsformen und sieht dort vor allem die Ursache für eine „ungünstige seelische und psychische Entwicklung“ (ebd., S. 142).
Richter sieht zudem die Motivation für die Tätigkeit im sozialen Bereich in erfahrenen Isolationskonflikten (vgl. Isolationsmodell Kapitel 3.1.2) aus der Kindheit (vgl. ebd., S. 143). Er bestätigt Schmidbauers Ansichten, was den Wunsch nach Machtausnutzung, nach Manipulation und das Bedürfnis, den Schwächeren schwach halten zu wollen, betrifft (vgl. ebd., S. 149 f.). Dies bewertet er allerdings weniger als pathologisch. Es sei natürlich, aus den erlebten Erfahrungen heraus und dem Isolationsmodell nach zu urteilen, dass der Wunsch „Eltern zu spielen“ (Macht), die die „Kinder“ (Klienten) brauchen, wachse (vgl. ebd., S. 152). Das Isolationsproblem sieht Richter als „objektive Realität“ (ebd., S. 152). Er betont die Relevanz, dass sich mit dem eigenen Selbst ausgesöhnt werden muss, bevor herum experimentiert und therapiert wird, weil es sonst zu Komplikationen, wie beispielsweise der narzisstischen Projektion auf den Klienten (als Substitut des Ich-Ideals bzw. der verdrängten negativen Identität), kommen kann (vgl. ebd., S. 156 f.). Es gilt, die inneren Missstände in dieser „Chaoswelt“ (ebd., S. 158) durch äußere, echte zu bereinigen.
2.3.3 Fricke / Grauer
Fricke und Grauer fassen erhobene Ergebnisse von verschiedenen Befragungen und Studien zu Hintergründen des Berufsziels SP / SA zusammen und gehen von folgenden grundlegenden Persönlichkeitsmerkmalen aus: angehende SP / SA sind hoch sozial motiviert, weisen intrinsische Motivationen auf (Interesse am Fach / Umgang mit Menschen 91%, Neigung und Begabung 80% und berufliche Möglichkeiten 71% entgegen Berufschancen mit 3 bis 4%) und sie haben doppelt so sehr (wie andere Studiengänge) die Absicht und Erwartung „alternative Lebensformen“ zu erproben, statt eine gute Ausbildung zu erhalten (vgl. Fricke; Grauer 1994, S. 42). Dies geht einher mit der Ablehnung und Skepsis gegenüber technischem Fortschritt, Wettbewerb und Leistungsnormen, wodurch sich Schmidbauer nur bestätigt fühlen kann. Diese Ergebnisse entnahmen Fricke und Grauer vorwiegend dem Datenalmanach zum Studentensurvey 1983 bis 1993 (Simeaner H.: Entwicklung der Studiensituation und studentische Orientierungen 1994).
Interessant ist das Ergebnis eines von Fricke und Grauer (1994) durchgeführten psychologischen Testverfahrens, mit welchem sie die „typische Sozialarbeiterpersönlichkeit“ nachweisen wollten. So kommt nach Fricke / Grauer den angehenden Sozialarbeitern und Sozialpädagogen eine hohe Ambiguitätstoleranz zu Gute, was (nach Maier) so viel bedeutet wie die „Fähigkeit mit komplex-widersprüchlichen und unbekannten Situationen umgehen zu können“ (vgl. Maier 1995, S. 65). Außerdem sollen SP / SA (entgegen der Burn-out-Häufigkeit) mit Leistungsressourcen sehr schonend und behutsam umgehen und somit Stress vermeiden. Neben angeblich gesundheitlicher Robustheit (Selbsteinschätzung) weisen Studierende der SP / SA allerdings vermehrt psychische chronische Erkrankungen auf. Sie sind sehr selbstkritisch und in der Regel unzufriedener mit ihrem gegenwärtigen und früheren Leben als Studierende anderer Fächer. Anschließend nehmen Fricke / Grauer mit den gewonnenen Daten eine Einteilung (Cluster-Analyse) in drei Motivationsgruppen vor. Sie unterscheiden zwischen altruistisch-empathisch (53%) (Studium aus Interesse am Beruf, Umgang mit Menschen, soziales Engagement und Selbstentfaltung), beruflich-pragmatisch (33%) (Studium als Mittel zum Zweck und als das „kleinere Übel“) und indifferent-unmotiviert (14%) (Studium eher aus Verlegenheit, kein wirkliches Interesse und ebenfalls als das kleinste Übel) (vgl. Fricke; Grauer 1994, S. 55 ff.). Eine weitere Clustereinteilung wurde in vier Leistungstypen vorgenommen. Hier unterschieden sie in „leistungsvermeidende Introvertierte“ (30%), „erregbar Extrovertierte“ (20%), „emotional stabile Altruisten“ (40%) und „emotional labile Altruisten“. Letztere vergleichen Fricke / Grauer mit der von Schmidbauer erschaffenen „Helferpersönlichkeit“ (Affinität zum Altruismus durch übernormiertes Über-Ich bedingt), was jedoch mit 10% den kleinsten Anteil ausmacht (vgl. ebd., S. 65 f.). Bei den Motiven zur Studienwahl (Absolventen- und Studentenbefragung 1992 von Maier) war auch die Antwortmöglichkeit „Hoffnung, in diesem Studium Klärung und Lösung eigener psychischer Probleme zu finden“ gegeben. Interessant ist die Deutung der Ergebnisse. Nur wenige haben dies als Motiv angegeben, allerdings geben drei Viertel der Befragten an anderer Stelle an, dass dieses Motiv keine Rolle gespielt hat und 20% wiederum geben an in psychotherapeutischer Behandlung (gewesen) zu sein. Somit liegt es nahe, dass dieses Motiv doch eine wichtigere Rolle spielt, als angegeben wurde (vgl. Maier 1995, S. 68). Im Gegensatz zu anderen Autoren sehen Fricke / Grauer keinen Zusammenhang zwischen den Motivationsprofilen und den ermittelten soziodemographischen Variablen (Alter, Geschlecht, Herkunft, Hochschulzugang etc.), signifikant sei einzig eine vor dem Studium erfolgte Berufstätigkeit (vgl. Fricke; Grauer 1994, S. 57).
Fricke und Grauer bestätigen letztendlich Schmidbauers These der hilflosen Helfer, betonen aber, dass diese nur auf wenige Helfer zutreffen würde, dominierend ist (offiziell) der Student Ende Zwanzig, der bereits in einem festen sozialen Umfeld lebt, neben dem Studium arbeitet (vgl. Maier 1995 S. 75 ff.) und das Studium als vorantreibende und genesende Kraft sieht (vgl. Fricke; Grauer 1994, S. 304). Laut Selbsteinschätzung der Studierenden wird der Studiengang als „extrem weich“ und mit zu niedrigen Leistungsanforderungen beurteilt, ebenso würden Studieninhalte fehlen, wie sie bereits Schmidbauer bemängelte (vgl. Maier 1995, S. 132).
Ein interessanter Aspekt ist noch folgender: Fricke / Grauer messen in ihrer Studie studienbezogene Ängste und Leistungserwartungen und kommen auf den höchsten Wert bei „Angst vor beruflicher Inkompetenz“ mit 19,2%. Dies lässt in gewisser Weise einen Hang zum Pessimismus und Minderwertigkeitskomplexe erkennen (vgl. Fricke; Grauer 1994, S. 126). Fricke / Grauer widersprechen Wellhöfer (vgl. Kapitel 2.3.5), da ihre Studierenden mit 49% genauso zufrieden sind wie der Bevölkerungsdurchschnitt (Freiburger Persönlichkeitsinventar), wobei die allgemeine Studienzufriedenheit, die persönliche Zufriedenheit und spezifische Ausprägungen der Persönlichkeit gemessen wurden (vgl. ebd., S. 82). Ein „Überpointiertes Helfer-Ideal“, „Übersoll-Anspruch“ und „Grenzen der Parteilichkeit“ (was Richtung Helfersyndrom zielt) seien sehr gering bis mittelmäßig ausgeprägt (ebd., S. 172, S. 183).
Fricke und Grauer gehen also im geringen Maße von einer Sozialarbeiter-Persönlichkeit aus und beschreiben eine homogene Menge beim Freiburger Persönlichkeitsinventar (im Gegensatz zu Fengler). Allerdings bestreiten sie eine Einheitspersönlichkeit und kommen zu abschließender Aussage (vgl. ebd., S. 259 ff.). „Die idealtypische Sozialarbeiter-Persönlichkeit [ist] sozial verantwortlich und altruistisch orientiert, trotz hoher Beanspruchungsreserven auf schonenden Einsatz der Leistungsressourcen bedacht, eher leicht erregbar mit Tendenz zu emotionaler Labilität, aber psychosomatisch kaum gestört und gesundheitlich robust, offen und selbstkritisch, weniger zufrieden mit den gegenwärtigen und früheren Lebensbedingungen.“ (ebd., S. 261)
2.3.4 Missel und Fisher
Missel stellt Ähnlichkeiten zwischen Schmidbauer und Fisher [sic!] fest. Auch Fisher sieht im Helfer die narzisstische Störung, mit welcher dieser letztendlich zu Selbstüberforderungen und permanenter Selbstüberschätzung neigt (vgl. Missel; Braukmann 1995, S. 57), wobei er den Schwerpunkt auf die eigene Grandiosität legt, denn diese sei der Kern und die Ursache des Helfens. Analog zu Schmidbauer beschreibt Fisher ebenfalls den hinter der Grandiosität verborgenen Prozess des ständigen „Sich-und-anderen-beweisens“, was vom strengen Über-Ich ausgeht und welcher durch Ängste, die die eigene Mittelmäßigkeit eingestehen wollen, geprägt ist (vgl. ebd. S. 57). Der Helfer verdoppelt somit seine Anstrengungen, um „gut zu sein“ und nimmt dadurch oftmals durch die immense Kraftaufwendung eine zynische Haltung dem Klienten gegenüber ein und in Kauf, statt seine Ziele zu reduzieren, da sonst die Grandiosität an Fülle und Glanz verlieren würde. So lebt der Helfer, nach Fisher, lieber in (objektiv) dauernder Schädigung seines Selbst, als seine Ansprüche abzugeben und somit (subjektiv) seinen Selbstwert auf’s Spiel zu setzen (vgl. ebd., S. 57).
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (eBook)
- 9783842819757
- DOI
- 10.3239/9783842819757
- Dateigröße
- 1.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Dresden – Fakultät für Erziehungswissenschaften, Sozialpädagogik und Sozialarbeit
- Erscheinungsdatum
- 2011 (August)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- wolfgang schmidbauer burn-out berufswahl sozialforschung studienwahl
- Produktsicherheit
- Diplom.de