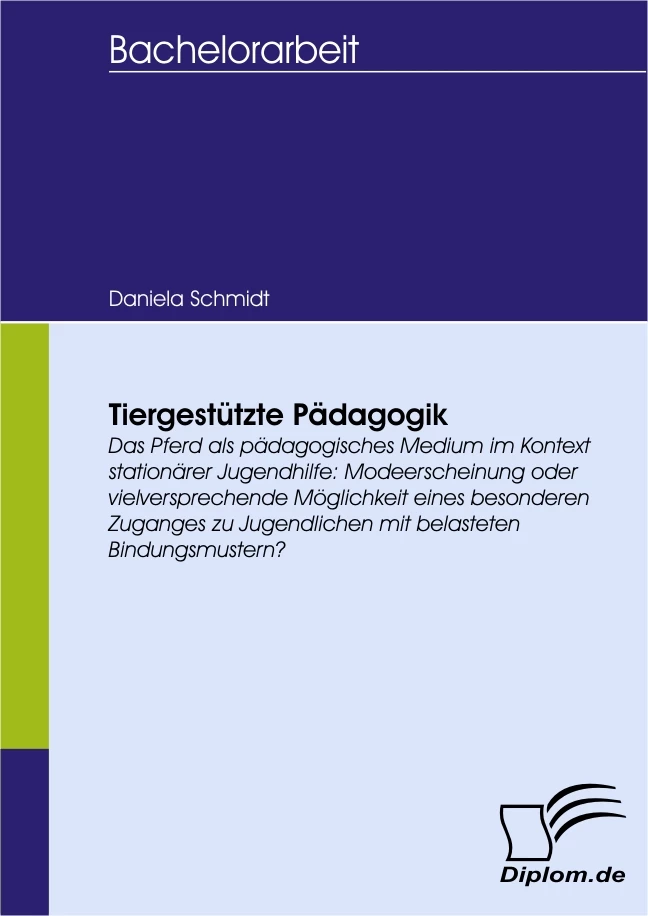Tiergestützte Pädagogik
Das Pferd als pädagogisches Medium im Kontext stationärer Jugendhilfe: Modeerscheinung oder vielversprechende Möglichkeit eines besonderen Zuganges zu Jugendlichen mit belasteten Bindungsmustern?
Zusammenfassung
Die Relevanz meiner ausgewählten Themenstellung ergibt sich ganz allgemein daraus, dass Tiere im Leben von Menschen seit jeher sowie in allen Schichten und Altersstufen eine bedeutende Rolle spielen. Ob als Arbeits- oder Lebenspartner, als Wach- oder Schutztier, als Jagdgefährte oder Nutztier, das Zusammenleben von Menschen und Tieren weist eine lange und ebenso ambivalente Geschichte auf. Auch derzeit erfreuen sich Tiere in diversen Büchern, Magazinen und vor allem im Fernsehen großer Beliebtheit.
Parallel ist seit den 90er Jahren auch die Tiergestützte Pädagogik und Therapie verstärkt in den Mittelpunkt des Medieninteresses gerückt. So hat sich diese in den letzten Jahren sprunghaft ausgebreitet und es ist ein enormes, auch mediales Interesse, entstanden. Tiergestützte Pädagogik entwickelt sich zunehmend zu einer Art Mode, die immer wieder als Thema in Gesundheitsratgebern oder auch Magazinen auftaucht. Auch eine Stichwortsuche im Internet macht deutlich: Tiere sind in.
So stolpert man hierbei über eine verwirrende und fast unüberschaubare Vielzahl von Angeboten, Titeln und Bezeichnungen, vom Tierbesuchsdienst über Tiertherapie, Tiergestützte Pädagogik, Therapiehunden bis hin zum experientiellen Reiten und der Hippotherapie.
Schnell gewinnt man den Eindruck, dass Tiergestützte Pädagogik und Therapie so etwas wie ein Allheilmittel sind, Breitbandmedikamente, welche gegen sämtliche Varianten seelischer und sozialer Leiden hilft und auch bei hoffnungslosen Fällen fast schon Wunder wirken können. Doch nur wenige dieser allgegenwärtigen Bezeichnungen sind eindeutig definiert. Anerkannte Ausbildungen und wissenschaftliche Belege gibt es bislang wenige. So ist es auch für mich nicht verwunderlich, dass eine Diskussion über die tatsächlichen Möglichkeiten der Beziehung zwischen Tieren und Menschen im Sozialpädagogischen Bereich entbrannt ist und aufgrund ihrer derzeit noch mangelnden wissenschaftlichen und theoretischen Fundierung auf breite Kritik stößt.
Auch auf mich übt das Thema der Tiergestützten Pädagogik eine große Faszination und Neugierde aus. Im Rahmen meines Praxissemesters machte ich erstmals die Erfahrung der Tiergestützten Pädagogik mit Jugendlichen im Kontext stationärer Jugendhilfe, was mein Interesse für diesen Bereich weckte. Neben dieser aktuellen Debatte bewegte es mich dazu, mich im Folgenden näher mit dieser Thematik zu beschäftigen.
Meine übergeordnete Frage lautet also: Was genau sind die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
0 Einleitung/Vorwort
Teil 1 Aspekte der stationären Jugendhilfe
1 Grundlagen stationärer Jugendhilfe
1.1. Gesetzliche Verankerung und Aufgaben
2 Die Adressaten stationärer Jugendhilfe
2.1. Exkurs Jugendalter
2.1.1. Entwicklungsaufgaben des Jugendalters
2.2. Die so genannten „Erziehungsresistenten Problemjugendlichen“ Definition und Einordnung von Verhaltensstörungen/abweichendem Verhalten
2.3. Indikationen stationärer Jugendhilfe
3 „Bindungsstörungen“
3.1. Bindung
3.2. Kritische Anmerkung zum traditionellen und weiterentwickelten Konzept der Bindungstheorie nach John Bowlby
3.3. „Bindungsstörungen“
4 Belastete Bindungsmuster und daraus resultierende Anforderungen an die Pädagogik im Rahmen der stationären Jungendhilfe
Teil 2 Tiergestützte Pädagogik
5 Definition/Begriffserklärung
5.1. Überlegungen zur Bedeutung des Begriffes „Tiergestützt“
5.2. Der Pädagogikbegriff ausgehend von Jean Jacque Rousseau
5.3. „Tiergestützte Pädagogik“
6 Grundlegende Aspekte der Mensch-Tier-Beziehung
6.1. Theoretische Denkmodelle zur Erklärung der Mensch-Tier-Beziehung
- Du-Evidenz
- Ableitungen aus der Bindungstheorie
- Die Biophilie-Hypothese
6.2. Die Mensch-Tier-Interaktion
6.2.1. Das Pferd als Interaktions- und Kommunikations partner
7 Die „Wirkung“ der Tiere auf den Menschen
7.1. Exkurs intrapersonale/interpersonale Intelligenz
7.2. Spezifische Erfahrungsmöglichkeiten Jugendlicher im pädagogisch arrangierten Umgang mit dem Pferd::
Lernmöglichkeiten bezüglich abweichenden Bindungsverhaltens
7.2.1. Förderung emotionaler (intrapersonaler) Kompetenz
- Förderung emotionalen Wohlbefindens
- Förderung der Bewusstheit eigener Emotionen
- Erlernen eines adäquaten Umganges mit eigenen Emotionen--
- Umsetzung von Erkenntnissen und Lernerfahrungen in erfolgreiche Handlungen
- Unterstützung bei der Identitätsentwicklung durch vielfältige
Projektions-Identifikations- und Entlastungsmöglichkeiten
7.2.2. Förderung sozialer (intrapersonaler) Kompetenz
- Exkurs Sozialverhalten
- Empathie
- Das Pferd als Beziehungs- und Bindungspartner
- Das Pferd als Eisbrecher
- Nähe, Intimität, Körperkontakt
- Vermittlung positiver, sozialer Attribution
7.3. Zu der Bedeutung des Setting
7.4. Tiergestützte Pädagogik als Möglichkeit eines besonderen Zuganges der Pädagogik auf die so genannten „bindungsgestörten“ Jugendlichen im Bereich der stationären Jugendhilfe
8 Kritische Stimmen zum Thema tiergestützte Interventionen
8.1. Mögliche negative Auswirkungen auf den menschlichen Körper
8.1.1. Gefahr von Allergien/mangelnde Hygiene/Infektionsrisiko
8.1.2. Unfallgefahr/Sicherheit
8.2. Sonstige kritische Aspekte
8.2.1. Geringe wissenschaftliche Fundierung
8.2.2. Kontraindikationen/Einschränkungen
8.2.3. Das Tier als Pädagoge
8.3. Negative Auswirkungen auf die Tiere selbst
8.3.1. Pathologische Tierliebe
8.3.2. Anthropomorphisierung
8.3.3. Über die Ambivalenz der Haus- und Nutztierhaltung und die
Gefahr der Instrumentalisierung von Tieren zu pädagogischen
Zwecken
8.3.4. Gedanken aus tierschutzrechtlicher Sicht
9. Fazit und Ausblick
10. Literaturverzeichnis
11. Eidesstattliche Erklärung
0. Einleitung/Vorwort
Die Relevanz meiner ausgewählten Themenstellung ergibt sich ganz allgemein daraus, dass Tiere im Leben von Menschen seit jeher sowie in allen Schichten und Altersstufen eine bedeutende Rolle spielen. Ob als Arbeits- oder Lebenspartner, als Wach- oder Schutztier, als Jagdgefährte oder Nutztier, das Zusammenleben von Menschen und Tieren weist eine lange und ebenso ambivalente Geschichte auf.
Auch derzeit erfreuen sich Tiere in diversen Büchern, Magazinen und vor allem im Fernsehen großer Beliebtheit.
Parallel ist seit den 90er Jahren auch die Tiergestützte Pädagogik und Therapie verstärkt in den Mittelpunkt des Medieninteresses gerückt. So hat sich diese in den letzten Jahren sprunghaft ausgebreitet und es ist ein enormes, auch mediales Interesse, entstanden. Tiergestützte Pädagogik entwickelt sich zunehmend zu einer Art Mode, die immer wieder als Thema in Gesundheitsratgebern oder auch Magazinen auftaucht. Auch eine Stichwortsuche im Internet macht deutlich: Tiere sind „in“.
So stolpert man hierbei über eine verwirrende und fast unüberschaubare Vielzahl von Angeboten, Titeln und Bezeichnungen, vom Tierbesuchsdienst über Tiertherapie, Tiergestützte Pädagogik, Therapiehunden bis hin zum experientiellen Reiten und der Hippotherapie.
Schnell gewinnt man den Eindruck, dass Tiergestützte Pädagogik und Therapie so etwas wie ein Allheilmittel sind, „Breitbandmedikamente“, welche gegen sämtliche Varianten seelischer und sozialer Leiden hilft und auch bei „hoffnungslosen“ Fällen fast schon Wunder wirken können. Doch nur wenige dieser allgegenwärtigen Bezeichnungen sind eindeutig definiert. Anerkannte Ausbildungen und wissenschaftliche Belege gibt es bislang wenige. So ist es auch für mich nicht verwunderlich, dass eine Diskussion über die tatsächlichen Möglichkeiten der Beziehung zwischen Tieren und Menschen im Sozialpädagogischen Bereich entbrannt ist und aufgrund ihrer derzeit noch mangelnden wissenschaftlichen und theoretischen Fundierung auf breite Kritik stößt.
Auch auf mich übt das Thema der Tiergestützten Pädagogik eine große Faszination und Neugierde aus. Im Rahmen meines Praxissemesters machte ich erstmals die Erfahrung der Tiergestützten Pädagogik mit Jugendlichen im Kontext stationärer Jugendhilfe, was mein Interesse für diesen Bereich weckte. Neben dieser aktuellen Debatte bewegte es mich dazu, mich im Folgenden näher mit dieser Thematik zu beschäftigen.
Meine übergeordnete Frage lautet also: Was genau sind die Besonderheiten der Mensch-Tier-Beziehung? Handelt es sich bei der Tiergestützten Pädagogik um eine Modeerscheinung oder eine pädagogische Methode von bislang unschätzbarem Wert?
Sind positive Erfahrungen für Jugendliche möglich - und wenn ja, welche? Wie lassen sich diese ins professionelle Handeln transformieren?
Um möglichst spezifische Aussagen über die Bedeutung und Möglichkeiten des Einflusses von Tieren treffen zu können, richte ich den Fokus meiner Arbeit auf das Klientel der stationären Jugendhilfe und der sich hieraus ergebenden Relevanz tiergestützter Interventionen. In einem weiteren Eingrenzungsprozess beziehe ich mich hierbei explizit auf Jugendliche, die von der gesellschaftlichen Norm abweichende Bindungsmuster zeigen. Darüber hinaus erörtere ich etwaige Einflussmöglichkeiten, die sich in diesem Zusammenhang im Umgang mit Pferden bieten.
Gliederung:
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei Teile:
In Teil 1 werden zunächst grundlegende Aspekte der stationären Jugendhilfe erläutert.
So zeige ich deren rechtliche Grundlagen und Verankerung auf, welche Ausgangspunkt jeglicher (sozial-)pädagogischer Arbeit darstellt. Hierauf folgt ein Exkurs über die Jugendphase und altersentsprechende zu bewältigende Entwicklungsaufgaben - als Grundlage des Verstehens von abweichendem Verhalten und so genanntem Bindungsstörungen Jugendlicher.
In Punkt 2.3 gehe ich kritisch und fachlich fundiert auf das Bild des Klientel der stationären Jugendhilfe, die „so genannten schwierigen Jugendlichen“, und deren zugrundeliegendes Verhalten ein, welches von unserer Gesellschaft und auch von pädagogischen Kreisen mit dem äußerst prekären Etikett der „Verhaltensstörung“ versehen wird.
Darauf aufbauend gehe ich über zu den Adressaten, den so genannten Indikationen stationärer Jugendhilfe. Hierbei ziehe ich verschiedene Autoren heran und versuche mich so den Indikationen zu nähern, welche in der Literatur nicht eindeutig beschrieben sind.
Im Folgenden beschäftige ich mich explizit mit der Thematik der Bindungstheorie und den so genannten „Bindungsstörungen“ als durchaus gängige Indikation im stationären Jugendhilfekontext. Hierbei weise ich darauf hin, dass die Bezeichnung der „Bindungsstörung“ vor dem Hintergrund der meist stark belasteten Lebens- und Erfahrungsgeschichte Jugendlicher dringend kritisch zu überdenken ist und entsprechendes Verhalten
als ein subjektiv Sinnvolles verstanden und anerkannt werden sollte. Aufgrund der Komplexität der Thematik beziehe ich mich hierbei ausschließlich auf die bindungstheoretische Tradition in Anlehnung an John Bowlby, welche ich abschließend kritisch beleuchte.
Die aus der Bedarfslage der ausgewählten Zielgruppe resultierenden Anforderungen an die (Sozial-)Pädagogik werden im 4. Kapitel behandelt.
Gegenstand der Betrachtung des 2. Teiles ist die Tiergestützte Pädagogik als Kernstück der Arbeit.
So nehme ich zunächst Überlegungen hinsichtlich der Begriffsklärung tiergestützter Pädagogik vor, wobei ich den Pädagogikbegriff, ausgehend von Jean Jacques Rousseau, zur Erklärung heranziehe.
In Kapitel 6 widme ich mich grundlegender Aspekte der Mensch-Tier-Beziehung, indem ich drei theoretische Denkmodelle zur Erklärung dieser Beziehung anführe.
Diese integrieren Überlegungen über mögliche Ableitungen aus der Bindungstheorie, der Du-Evidenz, die ein entscheidender Faktor dafür ist, ob eine Beziehung zwischen Mensch und Tier aufgebaut werden kann, sowie Überlegungen bezüglich
einer archaischen Verbundenheit des Menschen mit Natur und Tieren.
Hieran schließt sich die Darstellung der spezifischen Charakteristika des Pferdes als Interaktions- und Kommunikationspartner des Menschen an, welche die nachfolgend erläuterten Erfahrungsmöglichkeiten und pädagogisch nutzbare Faktoren im Umgang mit dem Pferd untermauern und verständlich machen.
In Punkt 7 werden die möglichen Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten Jugendlicher im Umgang mit Pferden, bezogen auf den sozio-emotionalen Bereich, dezidiert dargestellt und (sofern vorhanden) mit wissenschaftlichen Belegen untermauert. Voraussetzungen und Anforderungen in Bezug auf das Setting Tiergestützter Pädagogik sowie ein Transfer dieses Ansatzes auf den Bereich der stationären Jugendhilfe, explizit auf Jugendliche mit besonderen Bindungsmustern, schließen sich an.
In Kapitel 8 findet eine kritische Auseinandersetzung mit möglichen Einwänden bezüglich tiergestützter Interventionen statt, welche sich in negative Auswirkungen einerseits die Menschen und andererseits die Tiere betreffend unterteilt. Hier werden unter anderem Fragen bezüglich eines Infektionsrisikos, der wissenschaftlichen Fundierung dieses Ansatzes und kritische Aspekte in Bezug auf die Gefahr der Instrumentalisierung und Ausnutzung der Tiere sowie den Tierschutz aufgeworfen.
Schließlich werden ergänzende Überlegungen der gesammelten Erkenntnisse und Zusammenhänge in der Schlussbetrachtung dargelegt.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwende ich ausschließlich die männliche Form von Pädagoge, Sozialarbeiter, Sozialberufler und Jugendlichem, wobei selbstverständlich die weibliche Form impliziert ist.
Teil 1 Aspekte der stationären Jugendhilfe
1. Grundlagen stationärer Jugendhilfe
1.1. Gesetzliche Verankerung und Aufgaben
Das Sozialgesetzbuch VIII beschreibt die grundsätzlichen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe und setzt die möglichen Maßnahmen der Jugendhilfe, welche nach ambulanten, teilstationären und vollstationären Jugendhilfemaßnahmen unterteilt sind.
Diese sind wiederum in den Hilfen zur Erziehung nach §§27 ff. SGB VIII aufgelistet und verfolgen das generelle Ziel, die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag zu unterstützen, „wenn eine dem Wohl des Kindes und Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist“.
Die Personensorgeberechtigten haben einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfen zur Erziehung wenn sie diese Kriterien erfüllen. Die Hilfen werden insbesondere nach Maßgabe der §§27-35 SGBVIII gewährt, wobei sich Art und Umfang der Hilfe nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall richten (Stascheit 2007, 1078, §27 Abs.1).
Der Paragraph 34 SGB VIII regelt die Erziehung im Heim und in sonstigen betreuten Wohnformen.
Diese Unterbringung kann neben der klassischen Heimeinrichtung, die Erziehung und Betreuung in Außenwohngruppen, Selbstständigen Wohngruppen, das betreute Wohnen oder eine Unterbringung in Erziehungsstellen umfassen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die „Kinder und Jugendlichen durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung zu fördern“. Sie soll, abhängig von dem Entwicklungsstand und Alter des Kindes/Jugendlichen sowie der Möglichkeit der Verbesserung der Erziehungsbedingungen, in der Herkunftsfamilie „eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen“, „die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten“ (ebd. 1078, 1079, §34 SGBVIII).
2. Die Adressaten stationärer Jugendhilfe:
2.1. Exkurs Jugendalter
Auf die Frage „Was ist Jugend?“ gibt es auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts seitens der interdisziplinären Jugendforschung keine eindeutige, unumstrittene Antwort.
So besteht eine Vielzahl von Richtungen des Nachdenkens und Forschens über diese Lebensphase, welche unter anderem nach soziologischer, entwicklungspsychologischer, psychoanalytischer, pädagogischer und gesundheitlicher/biologischer Ebene ausdifferenziert sind (vgl. Fend 2005, 22, 23).
Nach dem §7 SGBVIII des Kinder- und Jugendhilfegesetz ist Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist und Jugendlicher, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. Junge Volljährige sind diejenigen, die 18 Jahre, jedoch noch keine 27 Jahre alt sind (vgl. Stascheit 2007, 1071, §7 Abs.1).
Die Jugendzeit wird durch die Wissenschaft längst nicht mehr über das Lebensalter definiert. So hat sich in der sozialwissenschaftlichen Diskussion durchgesetzt, die Jugend als eine zeitlich ausgedehnte Lebensphase zwischen Kindheit und jüngerem Erwachsensein zu begreifen, deren Beginn und Ende nicht eindeutig festzulegen ist. Sie wird somit als Übergangsphase bezeichnet, wobei laut Schulze-Krüdener (vgl. Schulze-Krüdener, in: Schulze-Krüdener 2009,7) Altersgruppenunterschiede konstitutiv sind und wie folgt unterschieden werden können:
- Die Jugendlichen im engeren Sinne: pubertäre beziehungsweise frühe Jugendphase (circa 12-17 Jahre)
- Die Heranwachsenden: nachpubertäre beziehungsweise mittlere Jugendphase (circa 18-21 Jahre)
- Die jungen Erwachsenen: späte Jugendphase (circa 22 Jahre bis Ende des zweiten Lebensjahrzehnts)
Was Jugendalter bedeutet wird jedoch weniger von dem Lebensalter als wesentlich bedeutender durch die Vergesellschaftung der Jugendphase bestimmt.
„Die“ Jugend gibt es nicht. Jugend hat viele Gesichter, sie entspricht einer Vielfalt von Entwicklungswegen sowie einer Vielfalt von Alltagsgeschehen und entspricht keineswegs einem homogenen Gebilde (vgl. Fend 2005, 20). Insofern entsprechen Normali-
tätswünsche seitens der Gesellschaft und Jugendforschung nicht der Realität „des sich immer rascher wandelnden sozialen Lebens Jugendlicher und der Lebensphase Jugend, die heterogen und kontingent ist“ (Schulze-Krüdener, in: Schulze-Krüdener 2008, 8, 9).
Differenzaspekte von Jugend sind unter anderem der Blick auf die geschlechtsspezifische Jugend, Jugend in unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen, Jugendliche mit/ohne Migrationshintergrund, Jugend der Unter-/Mittel-/Oberschicht oder auch die Familienjugend und die Jugend in sozialpädagogischen Institutionen (Göppel, in: Schulze-Krüdener 2008, 45).
Weiterhin bestehen unterschiedliche wissenschaftliche Deutungsperspektiven und methodische Zugangsweisen, die den Kern des „Jugendphänomens“ herauszuarbeiten versuchen. Beispielhaft können hier die Jugend „als Sturm und Drang“, „Kampf um die Herrschaft zwischen Es und Ich“, „Suche nach narzistischer Bestätigung“, „gesellschaftliches Konstrukt“ oder die Jugend als „Verdichtung von Entwicklungsaufgaben“ genannt werden (vgl. Göppel, in: Schulze-Krüdener 2008, 48).
Hierzu kann angemerkt werden, dass die Konzentration auf nur ein Paradigma, Differenzaspekt beziehungsweise auf eine Deutungsperspektive das Risiko einer verkürzten ideologischen Betrachtung birgt (vgl. Fend 2005, 8).
Die Jugendphase ist keine Spielwiese, sie bedeutet ein Aufwachsen mit zahlreichen Anforderungen und Erwartungen der Gesellschaft, die es zu bewältigen gilt. Misslingende Bewältigungsversuche werden „bestraft“, indem die Jugendlichen an die Ränder der Gesellschaft gedrängt werden (vgl. Münchmeier, in: Schulze-Krüdener 2008, 1).
Die Jugendlichen heute gehören einer Generation an, die in den Begriffen der Postmoderne lebt und einem deutlichen Modernisierungs- und Individualisierungsprozess unterworfen ist. Das herkömmliche Jugendmodell hat sich „pluralisiert, vielfach zeitlich verschoben und es gibt keinen einheitlich strukturierten Lebensabschnitt im Sinne einer weiblichen oder männlichen Normalbiographie“ (Schulze-Krüdener, in: Schulze-Krüdener 2008, 3).
So sind Heranwachsende gesellschaftlicher Unübersichtlichkeit, Enttraditionalisierung und Widersprüchlichkeit konfrontiert, die fehlende soziale Sicherheiten und somit Folgen für die Identitätsarbeit nach sich ziehen (vgl. ebd. 3). Identitätsentwicklung in diesem Sinne schlägt in eine zeitlich befristete Identifikation um (vgl. ebd. 3).
Fraglich ist in diesem Zusammenhang, inwieweit Identität, die Fähigkeit zu Bindung und Beziehung, angesichts unserer Multioptionsgesellschaft - in der ein funktionales Menschenbild dominiert - überhaupt noch von Relevanz sind. So wachsen Jugendliche
in eine individualisierte Welt hinein, in der biographisch improvisiert werden muss (und kann) wie nie zuvor. Sie sind die „Kinder der Freiheit“, eine selbstbestimmte Politik der Lebensführung ist damit unabdingbar. Die Pluralisierung von Lebensformen und Milieus führt zu einer schier unendlichen Fülle von Alternativen (vgl. Keupp, in: Finger-Trescher / Krebs 2003, 22ff.).
Wie die benötigten Qualifikationen und Kompetenzen erworben werden, wird dem Einzelnen überlassen. Sollte er daran scheitern, so ist er dafür auch selbst verantwortlich (vgl. Schulze-Krüdener 2008, 3).
In dieser Grunderfahrung wird die Ambivalenz der aktuellen Lebensverhältnisse spürbar und die „Chance“ und „Freiheit“, sich selbstbewusst zu inszenieren, als wichtige Bedingung der Gesunderhaltung wird - ohne den Zugang zu den erforderlichen materiellen, sozialen und psychischen Ressourcen - schnell zu einer bedrohlichen Aufgabe, der sich viele Jugendliche zu entziehen versuchen (vgl. Keupp, in: Finger-Trescher / Krebs 2003, 22ff.).
Jugend zu Beginn des 21.Jahrhundert ist von Arbeitslosigkeit, Ausbildungsplatznot, Konkurrenzdruck und somit von vielen sozialen Problemen massiv betroffen. So hat es die 12. Shell-Studie (1997) mit dem Satz “‘Die gesellschaftliche Krise hat die Jugend erreicht‘“ auf den Punkt gebracht (Schulze-Krüdener, in: Schulze-Krüdener 2008, 35).
Auch ist die Tendenz zu verzeichnen, dass sich der Blick auf die Jugend immer stärker auf die Risiko- und Gefährdungszonen der Jugend fokussiert.
Werden Kinder eher als Opfer ihres sozialen und gesellschaftlichen Umfeldes gesehen, so können sie mit steigendem Alter mit einer Verurteilung ihres Verhaltens von Seiten der Gesellschaft rechnen, indem sie von dieser zu Tätern gemacht werden (vgl. ebd. 36).
2.1.1. Entwicklungsaufgaben des Jugendalters
Die psychische Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen erscheint nach Schleiffer (2001, 65) als „normal“ und gesund, wenn es ihnen gelingt, anstehende Entwicklungs-ziele zu erreichen.
Das allgemeine Konzept, mit dem das Aufeinandertreffen von innerer Entwicklung und äußeren Anforderungen bezeichnet wird, ist das der altersspezifischen Entwicklungs-aufgaben, welches erstmals von Havighurst (1972) formuliert wurde. Dieses Konzept stellte kein neues Entwicklungsmodell, sondern eine Akzentuierung bereits vorhandener Entwicklungsmodelle dar.
Entwicklung lässt sich hiernach als Abfolge von Entwicklungsaufgaben verstehen, die sich sowohl „aus den biologischen Veränderungen und den kognitiven Entwicklungs-fortschritten, vor allem aus den Anforderungen und Erwartungen seitens der Kultur und Gesellschaft ergeben“. Die Entwicklungspsychologin Heide Keller spricht in diesem Zusammenhang auch von psychobiologischen Anpassungsprozessen (vgl. Schleiffer 2001, 65/66).
Für die Adoleszenz sind nach Fend (2005, 221/ 222) in Anlehnung an das Konzept der Entwicklungsaufgaben nach Havighurst vor allem die folgenden Aufgaben charakteristisch:
- die Verarbeitung der biologischen Entwicklung/“den Körper bewohnen lernen“/Umgang mit Sexualität
- die Reorganisation der sozialen Beziehungen zu Eltern, Gleichaltrigen, Liebespartnern sowie der Aufbau neuer Beziehungsformen.
Man spricht im Jugendalter von einer Transformation der Beziehungen. Zwar erscheint in dieser Phase das Andere und Fremdartige besonders reizvoll, gleichzeitig bleibt jedoch ein Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit bestehen (vgl. Hartmann 2010, 30).
So geht es auch in dieser Entwicklungsphase darum, die wichtige Balance zwischen Exploration und Bindung zu bewahren. Diese Balance aufrechtzuerhalten scheint ein besonderes Problem des Jugendalters zu sein, da die Autonomiebedürfnisse eher über Aktivitäten des Explorationssystems als über solche des Bindungssystems zu erreichen sind (vgl. Schleiffer 2001, 60/61).
Kein Zweifel besteht daran, dass Autonomie am ehesten von Jugendlichen erreicht wird, die eine sichere Bindung zu den relevanten Bezugspersonen aufweisen können. Es ist davon auszugehen, dass das Bindungssystem in dieser Zeit chronisch aktiviert ist, da die Jugendlichen ausprobieren und lernen, inwieweit sie dazu fähig sind, ihre Angelegenheiten selbst zu verwalten (vgl. Schleiffer 2001, 62).
Gemäß den Phasen der psychosozialen Entwicklung nach Erikson (1998, 45) ist dieses Stadium von höchster sozialer Bedeutung, was er damit belegt, dass in dieser Zeit ein erstes Gefühl für Kollektivität und Arbeitsteilung entwickelt wird.
Die soziale Kompetenz ist als eine zentrale Fähigkeit des Jugendalters gefragt, beispielsweise wenn es darum geht, intime Vertrauensbeziehungen zu FreundInnen oder erste Liebesbeziehungen einzugehen. Freundschaften beginnen die sichere Basis der Eltern-Kind Beziehung abzulösen. Zudem liefern sie „ […]Orientierung und Sicherheit und kompensieren den Mangel an Status. Gleichzeitig unterstützen sie die Emanzipation von den Eltern“, beziehungsweise relevanten Bezugspersonen (Saumweber 2009, 38). Ohne Zweifel kommt den Gleichaltrigen in diesem Alter die Funktion von Bindungspersonen zu, welche Ähnlichkeiten wie auch grundsätzliche Unterschiede zu der ursprünglichen Bindungsbeziehung aufweist. So sind bei den ersten Liebesbeziehungen Merkmale wie das Suchen von Nähe oder die Neigung, den Anderen als sichere Basis zu nutzen, beobachtbar. Ein fundamentaler Unterschied besteht jedoch darin, dass sich die Jugendlichen ihr Gegenüber auswählen, wobei die Beziehung zu den Eltern von der Geburt an vorgegeben wird. Dabei beeinflussen bisherige Bindungsrepräsentationen, wie sie in Kapitel 3.1 beschrieben werden sollen, das (Bindungs-)Verhalten gegenüber den Peers (vgl. Schleiffer 2001, 62/63).
Folglich kann von einer psychosozialen Veränderung gesprochen werden, welche im Hinblick auf die Ablösung von den Primärvertrauten und einer Hinwendung zu sekundären Vertrauten förderlich oder auch hinderlich sein kann (vgl. Hartmann 2010, 30).
Weitere Entwicklungsaufgaben nach Fend (2005, 221/ 222) sind:
- der Umgang mit schulischen Leistungsanforderungen und die Vorbereitung auf die berufliche Zukunft
- die Auseinandersetzung mit der Welt und der Aufbau von kulturellen Orientierungen sowie
- die Entwicklung einer neuen/veränderten Beziehung zu der eigenen Person/die Entwicklung einer „neuen Identität“
Zusammenfassend ist die Herausbildung einer Identität das für das Jugendalter typische Entwicklungsziel, wobei die genannten Aspekte in je individuellen Anteilen zu dieser Entwicklung beitragen. Dabei wird das Streben nach Individualität und einer selbstbestimmten Identität von Zwängen und Erwartungen der modernen Gesellschaft überlagert und massiv beeinflusst.
Folglich endet die individuelle Freiheit eigener Handlungs- und Deutungsmuster dort, wo sie auf gesellschaftliche Erwartungen und Vorstellungen sowie auf deren Normen trifft (vgl. Saumweber 2009, 39, 40).
Erikson beschreibt den Lebenszyklus als unentbehrliche Koordinate für die Identität. Er spricht in Zusammenhang mit der Jugendphase von Adoleszenz und ist der Ansicht, dass diese von der Suche nach dem Identitätsgefühl und dem Kampf um das solche dominiert wird. Dabei beinhaltet die in diesem Stadium postulierte Entstehung der Treue die Verbesserung der Fähigkeit, sich und anderen zu trauen sowie den Anspruch, selbst vertrauenswürdig zu sein und die Fertigkeit, sich mit der eigenen Treue zu etwas zu verpflichten. Die Treue ist nach Erikson die vitale Kraft der Jugend und sie kann nur durch die Vereinigung der Kräfte von Individuum und Gesellschaft hervorgerufen werden (vgl. Hartmann 2010, 47).
Der Fokus der Jugendlichen in diesem Stadium liegt auf dem Bild, das Andere von ihnen haben, und auf dem Abgleich dessen mit ihren eigenen Vorstellungen (vgl. Erikson 1999, 255/256). So wird das Bild, das sich hieraus ergibt, mit den früher entworfenen Träumen, Rollen und Leistungen verglichen und versucht in Einklang zu bringen.
Die Identitätsverwirrung- beziehungsweise Konfusion ist nach Erikson eine dem Zeitpunkt der Adoleszenz angemessene Krise, welche durch innere Konflikte getrieben ist und mehr oder minder schwer ausfallen kann (vgl. Erikson 1998, 13, 26).
Die Grundmuster der Identität gehen aus der Anerkennung beziehungsweise Nichtanerkennung der Identifikation des Individuums sowohl in der Kindheit als auch aus späteren Phasen sozialer Prozesse hervor. Erikson unterscheidet zwischen persönlicher und kultureller, zwischen positiver und negativer Identität (vgl. Erikson 1998, 17/18, 91/92). Hiernach geht die Entwicklung von Identität mit der Qualität internaler Arbeitsmodelle von Bindung einher, wie sie in Punkt 3 erläutert werden.
Dabei bedeutet Identität nicht die einfache Rollenübernahme, „[…]sondern Identität arbeitet sich an den verschiedenen Rollenerwartungen ab, sie bildet Essenzen.“ ( Bausch 2010,50)
Das Konzept der Entwicklungsaufgaben impliziert sowohl eine Sozialgeschichte der Bedingungen des Aufwachsens sowie innere Entwicklungsprozesse des heranwachsenden Menschen. Entwicklungsaufgaben lassen sich demnach in drei Bereiche kategorisieren, welche von der zentralen Aufgabe geleitet werden, ein neues und bewusstes Verhältnis zu sich und der umgebenden Welt zu erarbeiten.
Hierunter lassen sich im Wesentlichen die intrapersonalen, die interpersonalen sowie die Aspekte/Aufgabenbereiche kulturell-sachlicher Natur fassen.
Die erfolgreiche Bearbeitung von Entwicklungsaufgaben ist hiernach gleichzeitig Ausdruck gelungener, beziehungsweise „gestörter“ Entwicklung (vgl. Fend 2005, 210).
2.2. Die so genannten „Erziehungsresistenten Problemjugend-lichen“Definition und Einordnung von „Verhaltensstörungen“/“abweichendem“ Verhalten
Die so genannten „Erziehungs- oder maßnahmeresistenten Problemjugendlichen“ sind es, die das deutsche Hilfesystem immer wieder an seine Grenzen bringen und den Rahmen jeder Institution sprengen. So kennzeichnet diese ein scheinbar normal gewordenes, permanentes und ordnungsstörendes Verhalten, welches alle Formen professioneller Hilfe versagen lässt. Es gibt eine Vielzahl an Systemen der Hilfe und Kontrollen, allen gemeinsam ist der „Gegenstand“: die „Problemjugendlichen“.
Die Gestalt des „Problemjugendlichen“ ist jedoch relativ diffus, eine eigene Definition hierzu ist bisher nicht expliziert formuliert worden.
So ist die Rede von „neurotisch gestörten Dissozialen“ aus „überlasteten, von Anomie und Beziehungsverlust“ gekennzeichneten Familien, von „gewaltorientierten“ oder gar „offen rechtsradikal agierenden Jugendlichen“, „Monsterkids“, „Trebegängern“ oder auch von „Mehrfach- und Intensivtätern“.
Je nach wissenschaftlicher Perspektive werden Jugendliche als „krank“, „verhaltensgestört“, „problembeladen“, „dissozial“, „schwer- bis unerziehbar“ oder umgangssprachlich gar als „verrückt“ beschrieben.
Allen Bezeichnungen gemeinsam ist ein von der gesellschaftlich und kulturell definierten Norm abweichendes Verhalten der Jugendlichen (vgl. Witte/ Sander, Rosenbauer in: Witte/Sander 2006, 7/8, 47).
Mit Blick auf die bürgerlich-gesellschaftliche Wertorientierung erscheint nicht nur der einzelne Jugendliche, sondern die Verhaltenseigentümlichkeiten der sozialen Gruppe, der er angehört, als Makel und Stigma (vgl. Mollenhauer 1988, 137). Mittels materieller Überlegenheit sowie „[…]mit Hilfe der öffentlichen Institutionen von Jugendgerichtsbarkeit und Jugendhilfe wird die Stigmatisierung für den Betroffenen zu seiner Definition als eines abweichlerischen Individuums“ und so zum Teil seiner öffentlichen Identität (Mollenhauer 1988, 137). Dabei gelten Menschen als asozial oder dissozial „[…]wenn sie sich tradierten Mustern ‚normaler Lebensführung‘ verweigern, werden ausgegrenzt, wenn sie biographisch scheitern oder sozial und kulturell nicht mithalten können.“ (Böhnisch 2006, 13)
An diesem höchst prekären Etikett junger Menschen in stationärer Jugendhilfe trägt auch die Jugendhilfe selbst, durch ihre zielgruppenbezogene Spezialisierung von Hilfeangeboten, Mitverantwortung. Denn diese Differenzierung der Jugendhilfe hat ein für die Jugendlichen belastendes Prinzip der Delegation zur Folge. Sind sie für eine spezifische Jugendhilfemaßnahme nicht mehr tragbar, so werden sie oftmals „weitergereicht“ und die kritischen Hilfeverläufe bis hin zu der geläufigen „Jugendhilfekarriere“ nehmen ihren Lauf (vgl. Witte/ Sander, in: Witte/Sander 2006, 9).
Der Status der „schwierigen Kinder“ kann somit als Zuschreibungsprozess verstanden werden, an dem die Jugendhilfe mit beteiligt ist. So werden „schwierige“ Lebenssituationen erst durch die Definition und Interventionen des Hilfesystems zu den besagten „schwierigen Fällen“ und letztlich auch deshalb zu „Grenzfällen“, weil die Institutionen selbst an ihre Grenzen stoßen (vgl. Rosenbauer, in: Witte/Sander 2006, 48).
In Anlehnung an Nohl sind mit dem Status der „Problemjugendlichen“ junge Menschen gemeint, die gleichermaßen ihrer Umwelt Probleme bereiten als auch selbst Probleme haben, welche wiederum selbst- und fremdgefährdend sind (vgl. Witte/Sander, in: Witte/ Sander 2006, 9).
Sowohl eine „normale“ als auch eine „auffällige“ Entwicklung können nach Saumweber (2009, 42) als Ergebnis komplexer bio-psycho-sozialer Wechselwirkungen betrachtet werden.
Es sind demnach nicht die spezifischen Schlüsselsituationen der Lebens- und Familiengeschichte eines jungen Menschen, welche zu einer Ausbildung des „Problemverhaltens“ führen. Vielmehr ist es „die Summe der Ereignisse, Bewertungen und Dynamiken aller Beteiligen und ihrer Systeme“ (Witte/ Sander, in: Witte/Sander 2006, 9). Heranwachsende folgen demnach keiner „Biologie des Bösen“, sondern sind im Kontext ökonomischer sowie sozialer Deklassierungsprozesse und konflikthafter Familiendynamiken zu sehen (vgl. Rosenbauer, in: Witte/Sander 2006, 47/48).
Im Sinne eines systemischen Zuganges charakterisiert der Begriff „Problemjugendliche“ einen bestimmten Interaktionszustand zwischen dem Jugendlichen und dem für ihn bedeutsamen System und bezieht sich damit nicht auf objektive Qualitäten von Handlungen (Witte/Sander, in: Witte/Sander 2006, 9).
Böhnisch (2006, 12, 13) teilt abweichendes Verhalten in mehrere Kategorien ein:
1. Delinquenz
2. sozial desintegratives Verhalten
3. die institutionell gebundene soziale Abweichung
4. selbstdestruktive und selbstgefährdende Handlungen
Psychiatrische Störungen, welche nicht selten auch im Rahmen der stationären Jugendhilfe beobachtbar sind, werden durch die Entwicklungspsychopathologie, basierend auf dem probabilistischen Ansatz, „als Folge eines Zusammentreffens von Risikofaktoren und einer Vulnerabilität bei gleichzeitigem Fehlen ausreichender protektiver Faktoren“ betrachtet (Schleiffer 2001, 73).
Alan Sroufe ist der Ansicht, dass eine Übereinkunft darüber notwendig ist, welche Entwicklungsaufgaben in welchem Alter anstehen, erst dann kann von dem Verfehlen einer Entwicklungsaufgabe gesprochen werden (vgl. ebd. 66, 69).
Dabei ist es nach Schleiffer (2001, 68) das für das Kind oder den Jugendlichen charakteristische Ensemble von Risiko- und Schutzfaktoren, das darüber entscheidet, ob es gelingt, die anstehenden Entwicklungsaufgaben zu lösen und welcher Entwicklungspfad beschritten wird.
Dieser Ansatz sollte auch auf die Erklärung von abweichendem Verhalten zu übertragen sein, wobei derartiges Verhalten mit „pathologischem“ Verhalten korreliert, jedoch keineswegs gleichgesetzt werden kann.
So genannte „Verhaltensstörungen“ werden von protektiven Faktoren und Risikofaktoren auf verschiedenen Ebenen beeinflusst.
Risikofaktoren umfassen entwicklungsrelevante Faktoren, welche nach familienbezogenen und kindbezogenen Risikofaktoren differenziert werden. Hierzu zählen beispielsweise elterliche Verhaltensweisen und psychische Auffälligkeiten, ungeeignete Erziehungsstile oder Vulnerabilitätsfaktoren des Kindes (vgl. Hillenbrand 2006, 197). Schleiffer (2001, 67) nimmt hierzu eine Einteilung in biologische und psychologische Risikofaktoren vor. Von Bedeutung sind hiernach unter anderem genetisch bedingte Dispositionen, chronische Erkrankungen, eine eingeschränkte intellektuelle Ausstattung oder unzureichende sozioökonomische Bedingungen. Risikofaktoren finden sich selten isoliert, sie sind meist kumulativ wirksam.
Ob sich ein Sachverhalt als Risikofaktor einstufen lässt, hängt entscheidend davon ab, welche Bedeutung der Jugendliche diesem beimisst.
Unter protektiven Faktoren werden Persönlichkeitsmerkmale, Situationen und grundsätzliche Sachverhalte verstanden, die dazu geeignet sind, den Einfluss von Risikofaktoren zu verringern. Hierzu zählen die sozialen und personalen Ressourcen, wobei beispielhaft die Resilienz, ein verlässliches soziales Netzwerk oder die Überzeugung einer ausreichend sicheren Selbstwirksamkeit genannt werden können (vgl. ebd. 68).
In jedem Fall kann gesagt werden, dass „Verhaltensstörungen“ eine Anpassung an Entwicklungsbedingungen bedeuten, welche dem Kind oder Jugendlichen ungewöhnliche Wege der Sicherung seines Selbst aufzwingen, um eine Destabilisierung der Psyche zu verhindern. Seitz merkt hierzu an, dass ein Verhalten durchaus bestimmte, von außen angelegte Regeln verletzten und dennoch für die Person sinnorientiert sein kann (vgl. Vernooij/ Schneider 2009, 131).
„Normwidriges“ Verhalten sollte demnach durchaus als Bewältigungsverhalten und damit als ein subjektiv positives und funktionales Verhalten erkannt und verstanden werden (vgl. Böhnisch 2006, 11).
Betroffene können durch dieses Verhalten ihre Entwicklungsaufgaben jedoch nicht hinreichend lösen und haben aufgrund ihrer spezifischen, subjektiv sinnvollen Bewältigungsversuche wenig Zugangsmöglichkeiten zu sozialverträglichen Handlungs- und Lernalternativen, wodurch sie von der „Norm“ abweichen (vgl. Köckeritz 2004, 123ff.). In Anlehnung an Hillenbrand lässt dies die Schlussfolgerung zu, dass „abweichendes“ Verhalten in jedem Fall erschwerte Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsmöglichkeiten mit sich bringen (vgl. Hillenbrand 2006, 41).
Eine Änderung des Verhaltens ist an verschiedenen Stellen der Entwicklungspfade möglich und abhängig von den individuellen Umständen, welche einen solchen stabilisieren (vgl. Schleiffer 2001, 69).
Für das Beurteilen einer „Verhaltensstörung“ sollten wichtige Kriterien wie das Ausmaß der Beeinträchtigung der Betroffenen und zwar in Bezug auf das persönliche Leiden, die soziale Einengung, die Interferenz mit der Entwicklung sowie die Auswirkung auf Andere Beachtung finden (vgl. Hillenbrand 2006, 41).
Allen Definitions- und Erklärungsversuchen abweichenden Verhaltens ist zu entneh
men, dass es sich hierbei um ein Konstrukt und damit um einen Konstruktionsprozess handelt, der vielfältigen sozialen, psychischen und institutionellen Einflussfaktoren unterliegt und in dem der Eigensinn und die Eigentätigkeit der handelnden und fühlenden Subjekte längst keine hinreichende Bestimmungsgröße darstellt (vgl. Böhnisch 2006, 14).
2.3. Indikationen stationärer Jugendhilfe
Aufbauend auf den beschriebenen Aspekten des Konstruktes so genannter „Verhaltensstörungen“, beziehungsweise abweichendem Verhalten Jugendlicher, werden im Folgenden unter Einbezug verschiedener Autoren die Indikationen stationärer Jugendhilfe erläutert.
Laut gesetzlicher Definition besteht ein Anspruch auf Hilfen zur Erziehung, sofern eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht besteht und „die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.“(Stascheit 2007, 1078, §27 Abs.1).
Was die Frage der konkreten Indikation einer stationären Unterbringung betrifft, besteht in der Literatur jedoch keine Einigkeit.
Aus welchen Gründen werden also Jugendliche heute in Heimen und sonstigen Einrichtungen der stationären Jugendhilfe untergebracht?
Nach Saumweber (2009, 239) werden die meisten Jugendlichen in Bezug auf ihr abweichendes Verhalten erst relativ spät in die Jugendhilfe aufgenommen, so dass sich diese Störung bereits auf einer hohen, Handlungsdruck erzeugenden Eskalationsstufe befindet. Die Jugendlichen haben zu diesem Zeitpunkt eine geringe Fähigkeit zu gelingenden Sozialkontakten und zeigen einen hohen, besonders emotionalen, Leidensdruck.
Nach Günder (2007, 34) sind es Kinder und Jugendliche mit besonderen Problemlagen, die gesellschaftlich, individuell und/oder familiär begründet sein können, für deren Erziehung Interventionen im Rahmen der stationären Jugendhilfe als notwendig erachtet werden. Allen Jugendlichen ist gemeinsam, dass sie aus schwierigen bis schwierigsten Verhältnissen stammen.
So haben diese aufgrund tiefgreifender Störungen im sozio-emotionalen Bereich Verhaltensweisen entwickelt, welche für die Integration in eine als normal betrachtete gesellschaftliche Realität weder anwendbar noch akzeptabel sind (vgl. ebd. 31/32).
Nach einer deutschen Repräsentationsstudie unter der Leitung von Hans Thiersch besteht bei etwa 67% der Jugendlichen in stationären Erziehungshilfemaßnahmen eine starke Störung der Eltern-Kind-Beziehung. Weitere, auf den Ergebnissen der Studie basierende, Problemlagen sind:
- Kinder als Opfer familiärer Kämpfe (54%)
- Erlebte Gewalt- und Missbrauchserfahrungen (43%)
- Vernachlässigung(48%), Verwahrlosung (27%)
- Abweichendes Verhalten (16%)
- Aggressives Verhalten (26%)
- Entwicklungsrückstände (21%)
- Konzentrations- und Motivationsprobleme (40%)
- Lern- und Leistungsrückstände (45%)
- Fernbleiben von der Schule (28%)
- (vgl. Thiersch, in: Schleiffer 2001, 94)
Eine weitere Analyse im Rahmen des Forschungsprojektes „Aggressionen in der stationären Jugendhilfe“ ergab, dass bei 42% der in stationären Einrichtungen lebenden Jugendlichen aggressive Verhaltensweisen ein wichtiger Grund der stationären Unterbringung waren (vgl. Günder/Reidegeld in: Günder 2007, 36)
Nach Meiske (37, 44) ist, neben Verwahrlosung und Missbrauch, jugendliche Delinquenz der häufigste Grund für eine Herausnahme aus der Herkunftsfamilie. Er spricht in Bezug auf Fremdunterbringung junger Menschen vorrangig von Folgen „gestörter Bindung“ und geht davon aus, dass fremd untergebrachte Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer Lebensgeschichte und der Herausnahme aus ihrem bisherigen Umfeld fast ausschließlich psychisch belastet sind.
Nach Witte und Sander (in: Witte/Sander 2006, 7-9) zeigen Jugendliche in stationären Jugendhilfemaßnahmen oftmals eine übersteigerte Neigung zu Aggressivität und kriminellen Handlungen. Ihr Beziehungsverhalten ist geprägt durch Bindungsunfähigkeit und einem Bezugspersonenmangel. Auch ein Versagen in Schule und Arbeitswelt kann häufig beobachtet werden.
Die familiäre Herkunft dieser Jugendlichen ist unter der Bezeichnung „broken home“ oder auch den „Multiproblemfamilien“ bekannt. So ist der familiäre Alltag und Hintergrund der Jugendlichen von „Unzuverlässigkeit, Unsicherheit, Vernachlässigung, Frustration und Gewalt in jeglicher erdenklicher Art und Weise“ und somit von einem „Faktorenbündel psychischer und sozialer Not“ geprägt (ebd. 8).
Die materielle Not der Familien spiegelt sich in beengten Wohnverhältnissen, Arbeitslosigkeit, Verschuldung und häufig auch in individuellen Beeinträchtigungen wie chronisch psychischen Störungen oder einer Alkohol- und Drogenproblematik wieder. So tragen die daraus resultierenden Einschränkungen der elterlichen Erziehungskompetenz zu der von der gesellschaftlichen Norm abweichenden und gehäuft im stationären Kontext beobachtbaren Verhaltenscharakteristik der Jugendlichen bei (ebd. 8).
3. „Bindungsstörungen“
3.1. Grundlagen der Bindungstheorie
Nach Schleiffer (2001, 17) ist es nicht übertrieben, in den Hauptthemen der Bindungsforschung die wichtigsten Problembereiche von Kindern und Jugendlichen auszumachen, die in stationären Wohnformen leben.
Um derartige „Bindungsstörungen“ verstehen und pädagogisch adäquat auf betroffene Jugendliche eingehen zu können, muss zunächst geklärt werden, was Bindung bedeutet.
Aufgrund der Komplexität der Thematik und der zum Teil stark divergierenden Erklärungsansätze bezüglich der Bindung und so genannter „Bindungsstörungen“ findet im weiteren Verlauf eine Fokussierung auf die auf dem Werk John Bowlbys und der Weiterentwicklung seiner Theorie durch Mary Ainsworths aufbauende bindungstheoretische Tradition statt.
Dabei liegt die besondere Stärke der Bindungsforschung, verglichen mit anderen Sozialisations- und Entwicklungstheorien, in ihrer theoretischen Herleitung und Differenzierung von unterschiedlichen Bindungsqualitäten, wie sie im weiteren Verlauf näher erläutert werden (vgl. Gloger-Tippelt, in: Hopf/Nummer-Winkler 2007, 71).
Die Bindungstheorie wurde seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts von John Bowlby entwickelt und geht von dem Modell der Bindung der frühen Mutter-Kind-Beziehung und somit von einer dyadischen Bindung aus.
Bowlbys Interpretationsmuster stammen aus der Naturwissenschaft und haben ihre Wurzeln in der evolutionären Weltsicht Charles Darwins (vgl. Hartmann 2010, 50).
Bindung ist nach Bowlby die Bezeichnung für eine enge emotionale Beziehung zwischen Menschen und bezieht sich auf den spezifischen Aspekt und die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung.
Die Bindung veranlasst das noch abhängige Kleinkind, in potenziellen Belastungs- und Gefahrensituationen wie Bedrohung, Angst oder Schmerz Schutz und Sicherheit bei seinen Bezugspersonen zu suchen und zu erhalten. Unter Bezugs- beziehungsweise Bindungspersonen sind hierbei Personen zu fassen, mit welchen das Kind den intensivsten Kontakt in seinen ersten Lebensmonaten hatte.
Die Bindung ist nicht direkt beobachtbar, sie wird beispielsweise im vorsprachlichen Alter aus dem Bindungsverhalten des Kindes nach einer Trennung von seiner Bezugsperson erschlossen (vgl. Gloger-Tippelt, in: Hopf/ Nummer-Winkler 2007, 70).
Eine der entscheidenden Erkenntnisse der Bindungsforschung besagt, dass der Wunsch nach Sicherheit und Schutz gewährenden Beziehungen ein zentrales Grundbedürfnis des Menschen ist. Demnach ist für die psychische Entwicklung einschließlich der moralischen Entwicklung die Qualität der frühen Bindungserfahrungen und demnach die emotionale Entwicklung und Beziehung zwischen den heranwachsenden Kindern und ihren Eltern entscheidend (vgl. Finger-Trescher/Krebs, in: Finger-Trescher/Krebs 2003, 7/8; Hopf/Nummer-Winkler, in: Hopf/ Nummer-Winkler 2007, 10).
Nach Bowlby können Kinder und Jugendliche nur dann psychische Stabilität und Selbstsicherheit erlangen, wenn die Eltern, beziehungsweise die relevanten Bezugspersonen, ihr Autonomiestreben fördern, bei Bedarf aber eine verlässliche Anlaufstelle bieten und ihrer Verantwortung nachkommen.
Eine derart sichere Basis bilden diese nur dann, wenn sie das Bindungsverhalten ihrer Kinder intuitiv erfassen, akzeptieren und es nicht zuletzt als angeborenes Merkmal akzeptieren (vgl. Bowlby, 2008, 10).
Auf der Grundlage dieses Verhaltens primärer Bezugspersonen entwickeln Kinder mentale Repräsentanzen. Hierunter sind verinnerlichte Vorstellungen einer Person über enge soziale Beziehungen zu verstehen, beispielsweise was diese engen Beziehungen auszeichnet und wie verlässlich sie sind, wenn Gefahr besteht (vgl. ebd. 105).
Diese entwickelt das Kind in den ersten Lebensjahren über die Kommunikation mit seinen relevanten Bezugspersonen und deren individuellen Verhaltensweisen.
Hier muss angemerkt werden, dass die Bindungstheorie die kindlichen Bedürfnisse fokussiert und die Mutter nach Wiegand (2001, 137) in einer komplementären, reduktionistischen Weise als zentrale Bindungsfigur sieht. Eine psychodynamische oder sozialkritische Hinterfragung findet nicht statt.
Diese so entwickelten spezifischen inneren Bilder sowie die aus den Interaktionen abgeleiteten komplementären Selbstbilder vernetzen sich zu dominanten kognitiven Strukturen und formen über die realen täglichen Interaktionen das individuelle Bindungsmuster (vgl. Bowlby, 2008, 105). Zusammenhänge zwischen internalen Arbeitsmodellen und der Interpretation von Emotionen und sozialer Wahrnehmung bei Kindern sind empirisch bewiesen (vgl. Beetz, in: Olbrich/Otterstedt 2003, 78).
Bowlby unterscheidet hier zwischen der Komponente des eigenen Selbst (wie wertvoll empfindet sich die Person selbst?) und der Komponente der Umwelt (wie verlässlich, emotional unterstützend und helfend werden die Fürsorgepersonen bei Bedrohungen wahrgenommen?).
Derartige innere Arbeitsmodelle können sowohl explizit als auch implizit erfasst und zugänglich gemacht werden (vgl. Gloger-Tippelt, in: Hopf/ Nummer-Winkler 2007, 74/ 75). Nach Bowlby stellen sie affektiv-kognitiv-motivationale Schemata dar, welche die spätere Organisation der Persönlichkeit, der emotionalen wie sozialen Regulationsprozesse sowie die Strategie des Umgangs mit Bindungspersonen in bedeutender Weise formen (vgl. Saumweber 2009, 23/24).
Auch wenn weitgehend Einigkeit darüber herrscht, dass die Bindungsbereitschaft angeboren ist, so kann angenommen werden, dass die Art und Weise, mit der sich die Bindungen des Kindes entwickeln, zu einem beachtlichen Teil durch die sozialen Erfahrungen in den ersten Lebensjahren beeinflusst wird.
Mary Ainsworth machte schon früh darauf aufmerksam, dass es sich in dieser frühen Entwicklung von Kindern nicht etwa um biologisch vorprogrammierte Abläufe handelt, sondern dass es die sozialen Erfahrungen sind, welche sich als ausschlaggebend für ihre weitere Entwicklung erweisen (vgl. Hopf/Nummer-Winkler, in: Hopf, Nummer-Winkler 2007, 17). So besteht ein nachgewiesener Zusammenhang zwischen den Interaktionsformen der Hauptbezugspersonen in den ersten Lebensjahren und den mentalen Fürsorge- und Bindungsrepräsentationen sowie entsprechender Bindungsmuster von Klein- und Vorschulkindern, was mit dem Begriff der transgenerationalen Vermittlung von Bindung belegt ist.
Die Neigung, starke emotionale Bindungen zu spezifischen Individuen aufzubauen, ist nach Bowlby als eine grundlegende Komponente der menschlichen Natur anzusehen und bereits bei Neugeborenen in ersten Ansätzen zu beobachten. Hiernach existieren Bindungsbeziehungen nicht zur Befriedigung anderer Bedürfnisse, sondern gewähren Schutz und haben demnach eine eigenständige Bedeutung, eine eigene Überlebensfunktion. Diese Schutzfunktion basiert hauptsächlich auf körperlicher Nähe zwischen Mutter und Kind in den ersten Lebensjahren.
Wird diese Nähe gestört, so entwickeln sich, sowohl bei den Eltern als auch bei den Kindern, eine Reihe charakteristischer Verhaltensweisen, wie beispielsweise Jammern, Schreien oder die Suche nach dem Anderen.
Mary Ainsworth entdeckte in dem so genannten „Fremde-Situationen-Test“, der auch als “Strange Situation“ bekannt wurde, vier charakteristische Reaktionsmuster, beziehungsweise Strategien des Kindes, um diese Nähe aufrechtzuerhalten (vgl. Rygaard 2006,2/3). Damit schuf sie die experimentelle Beobachtungssituation, mit der Bindungsqualitäten nach Methoden der Verhaltensbeobachtung messbar wurden. Besonders betonte sie den prägenden Charakter der frühen Verhaltensmuster (vgl. Wiegand 2001, 127).
Diese Bindungsmuster zeigen gleichzeitig die Tradition auf, in die das Konzept der Bindungsstörung eingebunden ist.
- Sicher/Zuversichtlich/Autonom
Diese Kinder verfügen über eine flexible Balance zwischen Bindung und Exploration. Sie haben die Erfahrung einer verlässlichen, feinfühligen und unterstützenden Bezugsperson gemacht. Auch negative Gefühlsäußerungen der Kinder stoßen auf Akzeptanz und Unterstützung bei der Bewältigung.
Die Beziehung zwischen Mutter und Kind ist von Nähe und wechselseitiger Freude im Kontakt miteinander geprägt.
Nach Bombik, Sprangler und Grossmann entwickeln sicher gebundene Kinder im Verhältnis zu Kindern mit unsicheren Bindungsmustern insgesamt mehr soziale Kompetenz, sind freundlicher, kooperativer, zugewandter und empathischer. Darüber hinaus besagen ihre Forschungsergebnisse, dass sicher gebundene Personen mehr Zugang zu Gefühlen sowie eine gelingendere Emotionsregulation haben. (vgl. Beetz, in: Olbrich und Otterstedt, 2003, 78, 80).
- Unsicher/vermeidende Bindung
Diese Kinder haben gelernt, ihre natürlichen, bindungsbezogenen Reaktionen auf Gefühle der Verletzung, Zurückweisung und Kränkungen in engen Beziehungen zu unterdrücken und wenden sich verstärkt der Sachumwelt zu. Sie haben ein mentales Bindungsmodell entwickelt, in dem ihre Bezugspersonen auf derartige negative Gefühle mit Zurückweisung und Ablehnung reagierten, wodurch das Kind sich selbst als nicht liebens- und beachtenswert erfahren hat.
Nach Spangler (1999) nehmen unsicher vermeidend gebundene Kinder emotionale Informationen nur eingeschränkt oder verfälscht wahr und können diese folglich nicht zur Bewertung einer Situation sowie zur Verhaltensregulation heranziehen (vgl. Beetz, in: Olbrich, Otterstedet 2003, 78).
- Unsicher/ambivalente Bindung
Das Bindungssystem des Kindes ist hier überaktiviert und lässt keinen Raum für die Erfüllung anderer Bedürfnisse. So klammert es sich an seine Bezugsperson und hat keine Möglichkeit zur Exploration seiner Umwelt. Rygaard (2006,4) ist der Auffassung: „Das Kind scheint sich einer ihm selbst unsicheren Nähe zu vergewissern“. Diese Kinder erfahren meist eine unberechenbare, inkompetente Fürsorge und schwanken somit zwischen Hilflosigkeit und Passivität bezüglich eigener Kompetenzen und übertriebenem Ärger oder Wut. Sie schreiben sich selbst in Bezug auf Beziehungen sehr geringe Kompetenzen zu.
- Desorganisierte/desorientierte/hoch unsichere Bindung
Hierbei handelt es sich nicht um eine adaptive Strategie des Kindes. Derartiges Bindungsverhalten weist vielmehr darauf hin, dass ein Kind in der Stresssituation der Trennung und Wiedervereinigung kein adäquates Verhaltensmuster zur Verfügung hatte (vgl. Brisch 2000, 78).
Gekennzeichnet ist dieses Bindungsmuster durch den Zusammenbruch eines strategiegeleiteten Bindungsverhaltens sowie ein wenig kohärentes, mentales Bindungsmodell (vgl. Gloger-Tippelt, in: Hopf/ Nummer-Winkler 2007, 71).
Aufgrund hoch unsicherer Fürsorgeerfahrungen wie Misshandlung oder psychisch traumatisierten Eltern konnten diese Kinder kein konsistentes Bindungsmodell aufbauen. Sie verfügen möglicherweise über mehrere sich widersprechende und nicht integrierbare Modelle von sich selbst sowie ihren Bezugspersonen. Hierdurch reagiert das Kind auf durch ein in sich nicht schlüssiges, strategielos erscheinendes Verhaltensmuster. Diese Verhaltensmuster beanspruchen die Aufmerksamkeit und Energie dieses Kindes so sehr, dass die Erkundung und Entwicklung, aufgrund des Bedürfnisses nach einer sicheren Ausgangsbasis, vernachlässigt werden.
In der Interaktion zur Bindungsperson findet hier häufig eine Rollenumkehr statt. Diese Kinder fühlen sich verängstigt, in Bezug auf die Beziehung ungeschützt und sehr verletzlich.
Werden Andere als bedrohlich oder Angst auslösend wahrgenommen, so kann dies auch zu extrem aggressivem Verhalten oder auch zu Rückzug und völliger Handlungsfähigkeit führen (vgl. Gloger-Tippelt, in: Hopf/ Nummer-Winkler 2007, 75-77).
Es wurde nachgewiesen, dass diese Verhaltensmuster in Beziehung zu später auftretenden Persönlichkeitsstörungen und anderen Schwierigkeiten stehen können. So entwickeln einige der Kinder mit desorganisierten Bindungsmustern im weiteren Verlauf eine Bindungsstörung (vgl. Rygaard 2006, 3/4).
Bezüglich der Differenzierung der unsicheren Bindungsgruppen wird angenommen, dass die Kinder mit desorganisierten Bindungsmustern insgesamt mehr Problemverhalten, externalisierende sowie internalisierende Verhaltensauffälligkeiten zeigen.
Darüber hinaus gehen Bindungsforscher davon aus, dass das Erziehungsverhalten der Eltern durch ihre eigenen Bindungserfahrungen beeinflusst wird und auch spezifische Charakteristika des Kindes wie Ängstlichkeit, Unruhe, psychische wie körperliche Erkrankungen in besonderem Maße auch Behinderungen Einfluss auf die Bindung haben.
Hiernach werden „gestörte“ Entwicklungen in dem Maß wahrscheinlicher, wie die Interaktion entweder durch Eigenheiten des Kindes oder durch unangemessenes Verhalten der Bezugsperson beeinträchtigt ist (vgl. Saumweber 2009, 26).
Die so aufgebauten Bindungsrepräsentationen des Kindes bestimmen somit maßgeblich die Beziehungserwartungen sowie dessen Verhalten in weiteren Beziehungen, beispielsweise zu Erziehern, Lehrern und Peers und unterstreichen so den Zusammenhang zwischen Bindungsqualität und der Entwicklung pro- oder auch antisozialen Verhaltens (vgl. Gloger-Tippelt, in: Hopf/Nummer-Winkler 2007, 71).
Aus einer Reihe verschiedener Längsschnittstudien, die die Entwicklung von Gewaltbereitschaft und Kriminalität im Jugendalter erforschen, ergibt sich die Annahme, dass delinquente Jugendliche in ihrer Kindheit wenig emotionale Unterstützung durch die Eltern erfuhren und mit besonders harten Strafen rechnen mussten
In Rahmen der Minnesota-Längsschnittstudie wurde die Bedeutung früher Bindungserfahrungen für die Entwicklung von Devianz eindrucksvoll belegt. Hiernach sind Kinder, die unter schwierigen Bedingungen aufwachsen, körperliche oder seelische Misshandlungen erfahren und somit keine verlässliche und sichere Bindung an eine Bezugsperson aufbauen können, im Vergleich zu anderen Kindern gefährdet, da sie in ihrer moralischen Eigenständigkeit eingeschränkt sind. Sie haben Probleme damit, Gefühle innerer Verpflichtung gegenüber zentralen sozialen Normen zu entwickeln (Hopf/Nummer-Winkler, in: Hopf/ Nummer-Winkler 2007, 21-23).
Henri Parens kam nach einer langjährigen Beobachtungsstudie, auf die Nachbeobachtungen und Folgestudien über nahezu vier Jahrzehnte folgten, zu dem Ergebnis, dass bei den kindlichen Probanden eine verlässliche Korrelation zwischen Bindungsqualität und Aggressionsprofil besteht (vgl. Brisch 2000, 12).
Wichtig erscheint die Betonung, dass es sich hierbei keineswegs um Kausalzusammenhänge, sondern vielmehr um probabilistische Zusammenhänge handelt.
Es kann folglich nicht von einlinigen Einflusswegen gesprochen werden, da es sich um vielfältige überaus komplexe Prozesse der Interaktion zwischen den Heranwachsenden und ihren individuellen, sich ändernden sozialen Kontexten handelt. Zu bedenken sind beispielsweise die schulischen Einflüsse, Interaktionen mit Gleichaltrigen, Betreuern, Lehrkräften oder vielfältige Gelegenheiten zur Perspektivenübernahme (vgl. Hopf, Nummer-Winkler, in: Hopf/ Nummer-Winkler 2007, 23/24).
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (eBook)
- 9783842814745
- Dateigröße
- 788 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Katholische Fachhochschule Mainz – Soziale Arbeit
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- tiergestützte pädagogik jugendhilfe pferd medium bindungsstörung
- Produktsicherheit
- Diplom.de