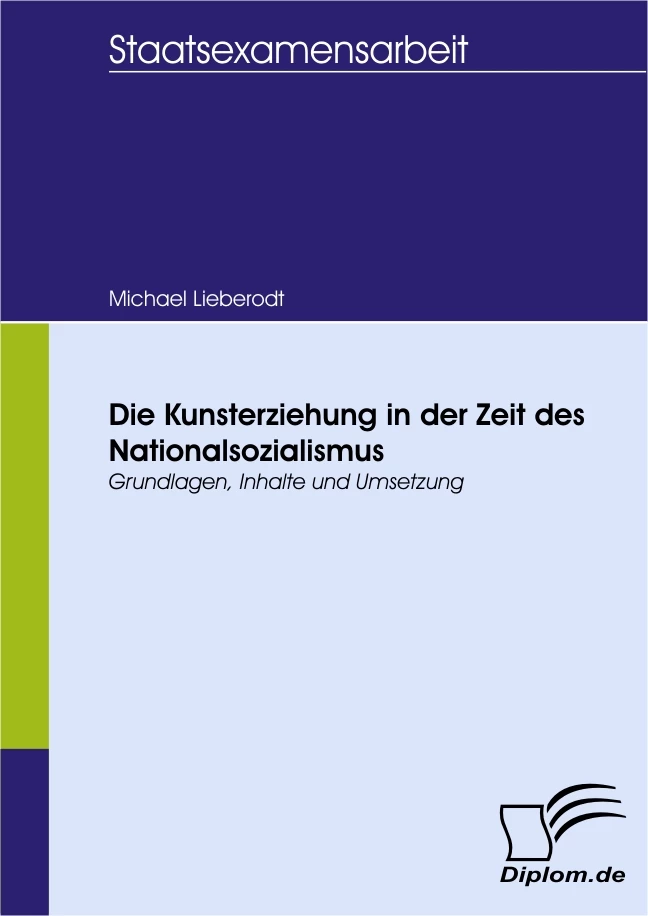Die Kunsterziehung in der Zeit des Nationalsozialismus
Grundlagen, Inhalte und Umsetzung
Zusammenfassung
Heil und rein mit dieser Überschrift beginnt Gunter Ottos Beitrag zur Kunsterziehung im Nationalsozialismus. Er hätten diesen Beitrag wahrscheinlich kaum treffender betiteln können, denn beide Begriffe ziehen sich wie ein roter Faden durch die komplette Thematik. In ihrer gesamten Bedeutung aber erscheint die Zeit von 1933 bis 1945 alles andere als heil und rein. Denn die faschistische, rassistische und zerstörerische Weltanschauung der Nationalsozialisten führte dabei nicht nur zu einem Empfinden deutscher Überlegenheit in jeglicher Hinsicht, sondern bewirkte auch die Abkehr von humanistischen Prinzipien wie Toleranz, Gewaltfreiheit und Gewissensfreiheit. Die Terrorherrschaft der Nationalsozialisten führte die Menschheit außerdem in die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts, den Zweiten Weltkrieg. Wie sich ein Volk hat derartig verführen lassen durch die kranke und untragbare Weltanschauung eines Mannes, wurde in den letzten 65 Jahren unter nahezu allen Gesichtspunkten erforscht. Vor allem hat man dabei versucht Antworten zu finden. Antworten auf die Fragen einer entsetzten und verstörten, aber gleichzeitig interessierten Nachwelt. Auf der Suche nach Gerechtigkeit und Wiedergutmachtung unternahm man den Versuch Schuldfragen zu klären, gleichzeitig haben damalige Opfer aber auch vergeben und die Welt scheint im Zuge dessen ein kleines Stück näher zusammengerückt zu sein. In unserer heutigen Generation sind das Interesse und das informelle Angebot an jener Zeit so groß wie nie zuvor. Auch wenn die NS-Thematik den wahrscheinlich dunkelsten Teil in der Geschichte der Menschheit ausmacht, so beschäftigen sich nach wie vor Wissenschaft, Medien, Schulen, Privatpersonen und nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens immer wieder mit diesem Kapitel deutscher Geschichte.
Auch während meines Studiums der Kunst und der Geschichte begegnete mir die NS-Thematik immer wieder. Der Nationalsozialismus war und ist ein fester Bestandteil meiner studentischen Arbeit und wird auch im zukünftigen Arbeitsfeld als Lehrer wiederkehren. Ich konnte feststellen, dass sich die Thematik aufgrund ihrer Komplexität, ihrer unmittelbaren zeitlichen Nähe und leider auch wegen ihrer Aktualität durch einen reichhaltigen Fundus an Quellen auszeichnet. Dadurch erweist sich der Nationalsozialismus als eines der am besten aufgearbeiteten Themen der Weltgeschichte und die Fülle an Quellen scheint unaufhörlich zu wachsen [...]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung:
‘Heil und rein’ mit dieser Überschrift beginnt Gunter
Ottos Beitrag zur Kunsterziehung im Nationalsozialismus. Er hätten
diesen Beitrag wahrscheinlich kaum treffender betiteln können,
denn beide Begriffe ziehen sich wie ein roter Faden durch die komplette
Thematik. In ihrer gesamten Bedeutung aber erscheint die Zeit von 1933
bis 1945 alles andere als ‘heil’ und ‘rein’.
Denn die faschistische, rassistische und zerstörerische
Weltanschauung der Nationalsozialisten führte dabei nicht nur zu
einem Empfinden deutscher Überlegenheit in jeglicher Hinsicht,
sondern bewirkte auch die Abkehr von humanistischen Prinzipien wie
Toleranz, Gewaltfreiheit und Gewissensfreiheit. Die Terrorherrschaft
der Nationalsozialisten führte die Menschheit außerdem in
die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts, den Zweiten
Weltkrieg. Wie sich ein Volk hat derartig verführen lassen durch
die kranke und untragbare Weltanschauung eines Mannes, wurde in den
letzten 65 Jahren unter nahezu allen Gesichtspunkten erforscht. Vor
allem hat man dabei versucht Antworten zu finden. Antworten auf die
Fragen einer entsetzten und verstörten, aber gleichzeitig
interessierten Nachwelt. Auf der Suche nach Gerechtigkeit und
Wiedergutmachtung unternahm man den Versuch Schuldfragen zu
klären, gleichzeitig haben damalige Opfer aber auch vergeben und
die Welt scheint im Zuge dessen ein kleines Stück näher
zusammengerückt zu sein. In unserer heutigen Generation sind das
Interesse und das informelle Angebot an jener Zeit so groß wie
nie zuvor. Auch wenn die NS-Thematik den wahrscheinlich dunkelsten Teil
in der Geschichte der Menschheit ausmacht, so beschäftigen sich
nach wie vor Wissenschaft, Medien, Schulen, Privatpersonen und nahezu
alle Bereiche des öffentlichen Lebens immer wieder mit diesem
Kapitel deutscher Geschichte.
Auch während meines Studiums der Kunst und der Geschichte
begegnete mir die NS-Thematik immer wieder. Der Nationalsozialismus war
und ist ein fester Bestandteil meiner studentischen Arbeit und wird
auch im zukünftigen Arbeitsfeld als Lehrer wiederkehren. Ich
konnte feststellen, dass sich die Thematik aufgrund ihrer
Komplexität, ihrer unmittelbaren zeitlichen Nähe und leider
auch wegen ihrer Aktualität durch einen reichhaltigen Fundus an
Quellen auszeichnet. Dadurch erweist sich der Nationalsozialismus als
eines der am besten aufgearbeiteten Themen der Weltgeschichte und die
Fülle an Quellen scheint unaufhörlich zu wachsen.
Warum also noch einen Beitrag zu seiner Aufarbeitung leisten? Diese
Frage lässt sich für mich recht einfach beantworten: Die
NS-Thematik hat mich in vielerlei Hinsicht gefesselt und seit meiner
ersten Begegnung im Jahr 1993 nicht mehr losgelassen. Im Laufe der
vergangenen Jahre und vor allem im Laufe meines Geschichtsstudiums habe
ich gelernt mich reflektierend zu ihm zu äußern. Das Streben
nach Objektivität stand immer an oberster Stelle. Das
Kunststudium, speziell die künstlerische Praxis, war aber das
genaue Gegenteil. Wertende Auslegungen von Sachverhalten,
beispielsweise bei Bildanalysen oder Kunstbetrachtungen sowie die
eigenen Schöpfungen im Laufe meines Studiums zeichneten sich vor
allem durch ein wesentliches Kriterium aus: Subjektivität. In der
Geschichte der Fachdidaktik scheinen nun diese beide Aspekte
aufeinanderzuprallen. Dabei ist es mir wichtig genau auf dieser
reflektierenden Ebene einen Beitrag zur Aufarbeitung der
nationalsozialistischen Kunsterziehung zu leisten.
In der nun vorliegenden Arbeit zur Kunsterziehung in der Zeit des
Nationalsozialismus versuche ich mich daher möglichst
reflektierend und neutral zu äußern. Es versteht sich dabei
für mich von selbst, dass wir es bei dieser Thematik mit einer
faschistischen, rassistischen, zerstörerischen und völlig
untragbaren Ideologie zu tun haben, die sich nicht nur heute oder
morgen, sondern auch in ferner Zukunft niemals wiederholen darf. Trotz
allem Selbstverständnis in einer demokratischen und liberalen
Gesellschaft, wie der unseren muss dies betont zum Ausdruck kommen.
Auch denke ich, dass es nicht zu meiner Aufgabe gehört von Opfern
und Tätern in der Kunsterziehung zu sprechen. Da sich die gesamte
Zeit des Nationalsozialismus als ein höchst sensibler und
emotionaler Abschnitt deutscher Geschichte erweist, ist es umso
wichtiger zugunsten einer wirklich wissenschaftlichen Betrachtung
sachlich und fachlich neutral zu formulieren. Ich distanziere mich
jedoch klar und bestimmend von auftretenden NS-Parolen, Schlachtrufen
und allem Menschenverachtenden, das der Nationalsozialismus mit sich
gebracht hat.
Inhaltlich habe ich mir folgende Schwerpunkte gesetzt: Alle
Betrachtungen sollen die Perspektive der Kunsterzieher jener Zeit
reflektieren. Ihnen gilt mein Hauptaugenmerk. Dabei ist es unvermeidbar
auch bereichsübergreifende Themen einzubeziehen, denn für die
Zeit des Nationalsozialismus im Zusammenhang mit seiner Schule gilt vor
allem eine grundlegende Tatsache: Durch das totalitäre System der
Nationalsozialisten gibt es keine Trennung zwischen Politik und Schule.
Die Schule versteht sich als ein Machtinstrument der Diktatur und wird
zu jedem Zeitpunkt meiner Arbeit als solches betrachtet. Ebenso wenig
sind Rassismus und die NS-Ideologie voneinander zu trennen. Daher kann
das NS-Regime nur unter Einbezug ihrer rassistischen Intentionen
betrachtet werden, alles andere wäre verklärend und falsch.
Bei der Verwendung bestimmter Begriffe möchte ich jedoch klar
differenzieren; allen voran den Begriff ‘Kunsterziehung’.
Immer wieder begegnet dieser Begriff im Zusammenhang mit
‘Zeichnen’ oder ‘Zeichenunterricht’, teilweise
gar als ‘Zeichnen und Werken’. Dabei versteht sich der
Zeichenunterricht als die Kunsterziehung der Volksschulen (Diel 1969,
S. 101) und versteht sich als eine hierarchische Ordnung. Zur Zeit des
Nationalsozialismus legte man einen besonders großen Wert auf die
Erziehung durch die Kunst. Es wird daher im Folgenden die Rede von der
‘Kunsterziehung’ sein, als welche sich das Fach am besten
in die Diktatur einordnen lässt. In diesem Zusammenhang sei auch
erwähnt, dass ich mich vordergründig auf der
Betrachtungsebene der Volksschulen bewegen werde, da diese die
größte Institution für Bildung im Dritten Reich
ausmachten. Auf dieser Grundlage habe ich mich dazu entschlossen meine
Betrachtungen sukzessiv von allgemeinen hin zu den spezifischen
Entwicklungen vorzunehmen. Zunächst wird die Rede vom
Kunstverständnis Hitlers und von gesellschaftlichen Entwicklungen
sein. Danach wird es um das Kunst- und Kulturverständnis sowie die
Politik der Nationalsozialisten gehen, ehe ich konkret auf die
Bildungspolitik und die Entwicklungen um die Kunsterziehung im Dritten
Reich zu sprechen kommen. Ich gehe diesen Weg deshalb, weil ich die
Kunsterziehung immer in ihrem Gesamtkontext und ihrer Situation im
Dritten Reich betrachten möchte. Für sie gelten die gleichen
Voraussetzungen zu jener Zeit wie für alle anderen
Schulfächer im Nationalsozialismus. Trotzdem kommt ihr eine
entscheidende und wichtige Rolle zu, welche ich zu ergründen
versuche.
Von dieser allgemeinen Betrachtungsebene werde ich mich lösen,
wenn es um die konkrete Umsetzung des Faches Kunsterziehung geht. Neben
den grundlegenden Theorien und Konzepten jener Zeit werde ich die
Umsetzung an den Beispielen der Städte München und Leipzig
vornehmen. Am Münchner Beispiel möchte ich konkret auf den
Unterricht an den Schulen zu sprechen kommen, während für
Leipzig eine Lehrplananalyse erfolgt. Im abschließenden Teil der
vorliegenden Arbeit möchte ich mit einem kurzen Fazit eine
Bewertung der Thematik vornehmen. Zeitgenössische Bewertungen des
Faches in jener Zeit kommen darin ebenso zur Ansprache wie mein eigener
Standpunkt. An dieser Stelle beginne ich meine Ausführungen.
Kapitel 4.1.1, Fehlende Konzepte und Kulturkonservatismus:
‘Mit Robert Böttcher, einem Zeichenlehrer aus Zwickau,
profilierte sich in den Jahren 1933 und 1934 der neue
kunstpädagogische ‘Führer’, der die alten
kulturkonservativen Gedankengänge als Neue ausgab.’ Dabei
orientierte sich diese ‘Neuauslegung’ durch Böttcher
vordergründig an den Kunstvorstellungen der Nationalsozialisten.
Eine klare Aufgabenstellung für den künftigen
NS-Kunstunterricht lieferte hingegen der Reichserziehungsminister
Bernhard Rust: ‘Der Reichserziehungsminister hat dem
Kunstunterricht die Aufgabe gestellt, an der Gestaltung des germanisch
– deutschen Wesens mitzuwirken. Für den Kunstunterricht ist
in diesem Gebot eine Verpflichtung höchster Art enthalten.’
Kunst ist nach seiner Auffassung ein Ausdruck von Rasse.
Kunstunterricht soll sich aus dem Anschauen der Umwelt und dem Schauen
in die Innenwelt gestalten. Kunstunterricht ist demnach Weltanschauung
in ihrer ursprünglichsten Art. Robert Böttcher, ab 1935
Leiter der Reichsfachgruppe deutscher Kunsterzieher, versuchte in
seinem Zuständigkeitsbereich diese Neuorganisation bis Ende 1935
gezielt und ganz im Sinne der NS-Regierung umzusetzen. Max Herrmann,
Böttchers Vorgänger, wurde in diesem Zusammenhang abgesetzt.
Die reformerisch-progressiven Elemente des Faches, die angelegt waren
an den Gestaltungslehren der Moderne (z.B. Bauhaus, Expressionismus,
Impressionismus) fanden keine Beachtung mehr. Was aber blieb ist das
Seelenvolle, das Gemeinschaftsfördernde und das Volksnahe. Der
ursprüngliche Fachgeist, nämlich das Offene, das Vielseitige
und der reformerische Geist ging durch die fortlaufende Vereinnahmung
durch die Nationalsozialisten und deren rassistisch – rationale
Weltanschauung immer mehr verloren. Die Kunstvermittlung sollte in
erster Linie ein Propagandainstrument werden und im Sinne der
nationalsozialistischen Weltanschauung erfolgen. Sie sollte entgegen
der individualistischen Auswüchse der Moderne wirken und verstand
sich genau wie die völkische Schule als ein verlängerter
Parteiarm. Entgegen den individuellen Auswüchsen der Moderne
verstand sich auch die ‘Deutsche Kunst’ als eine
Massenkunst. Mit Hilfe der Kunsterziehung sollte diese rational
ausgelegte Massenbasis erhalten und fortentwickelt werden. Dabei ist zu
betonen, dass trotz aller Rückschrittlichkeit und der Ausgrenzung
moderner Strömungen auch ein kleiner Teil der geistigen Grundlagen
der Moderne erhalten blieb. Die ‘Neue Sachlichkeit’ etwa
galt in der bildenden Kunst des Dritten Reichs zwar als entartet,
bestand aber in ihrer philosophischen Dimension ebenso wie die
Lebensphilosophie fort. ‘Für die Übertragung auf die
Kunstpädagogik hieß dies, dass man an den Varianten des
Irrationalismus festhielt. Allerdings war die Grenze dieses
Irrationalismus dort erreicht, wo die Hinwendung zum Individualismus
die faschistische Integrationsideologie störten.’ Hier
lässt sich deutlich die Instrumentalisierung der Kunsterziehung zu
weltanschaulichen und Propagandazwecken erkennen. Der Kollektivgeist
und die Massentauglichkeit einer Kunst waren grundlegend für die
Integration im Sinne der NS-Ideologie. Individualismus und freies
Schöpfertum hatten in diesem Verständnis keinen Platz und
reichten als Begründung für die Ablehnung eines Kunststils.
Für die Nationalsozialisten bestand kein Interesse an einer
freischöpferischen oder an der Individualerziehung ausgelegten
Kunstpädagogik. Das neue kunstdidaktische Konzept, auch wenn es
das bisher nicht gab, richtete sich also von Anfang an gegen die
Theorie Gustav Kolbs, der eine freie Entfaltung des produktiven Kindes
und dessen Entwicklung vorsah. Dennoch versuchte Kolb während der
Jahre 1933 und 1934 seine Theorie auf den Nationalsozialismus zu
übertragen. Er präsentierte seine Theorie vom
‘Bildhaften Gestalten als Aufgabe der Volkserziehung’ und
stellte Leitsätze für die NS-Kunstpädagogik auf.
Daraufhin ließ er sie von höheren Funktionären
überprüfen. Bereits im Vorwort der vorgelegten zweiten
‘verbesserten und erweiterten Auflage’ lassen sich jedoch
Formulierungen und Vorstellungen Kolbs finden, die nicht mit den
totalitären nationalsozialistischen Vorstellungen vereinbar waren.
Er schreibt: ‘Wer aber in dem Buch Stoffpläne im Sinne der
üblichen und üblen ‘Leitfäden’ zu finden
hofft, die die Lehrstoffe womöglich für die einzelnen
Lehrstunden des Jahres im voraus festlegen, wird nicht auf seine
Rechnung kommen. Wir werden nicht die Totengräber dessen sein, was
eben erst zum Leben erwacht. Nichts ist schädlicher als solche
Leitfäden, die den Lehrer der Aufgabe entheben wollen, den
Unterricht selbst zu gestalten, aus dem Leben der Schule und der
Schüler herauswachsen zu lassen.’ Genau das sollte aber Kern
der nationalsozialistischen Kunsterziehung werden. Es sollte einen
strikten Leitfaden geben, der vordergründig der ideologischen
Erziehung und Hinwendung zum Nationalsozialismus dienlich war. Der neue
Kunstunterricht sollte zwar vom Lehrer gestaltet werden,
Schülerinnen und Schüler sollten aber durch ihn
vordergründig erzogen und gehorsam im Sinne der NS-Weltanschauung
gemacht werden. ‘Gestaltung’ und
‘Herauswachsen’ sind demnach Begriffe, die sich mit einem
uniformierten Kunstunterricht, wie dem des Dritten Reiches nicht
vereinbaren lassen. Ein Individualgeist und der gestalterische Einfluss
von Phantasie und Vorstellungskraft seitens der Lehrer und
Schüler, wie es Kolb vorschwebte, war nicht gefragt. In der
Retrospektive und im ideologischen Verständnis des
Nationalsozialismus lässt sich demnach nur auf einen
Unterrichtsstil deuten: autoritär, unter klaren Vorgaben und ganz
im Sinne der Weltanschauung des Nationalsozialismus.
Trotz des gewagten Versuches einer weitestgehend möglichen
Umformulierungen, aber gemäß den Vorstellungen seiner
Theorie, konnte sich Kolbs Theorie vom ‘Bildhaften Gestalten als
Aufgabe der Volkserziehung’ nicht durchsetzen. Vor allem Kolbs
Vorstellungen vom Einfluss der Phantasie auf den gestalterischen
Prozess sowie seine Auffassung von Schauen und Wahrnehmen und vom
Gestalten und Darstellen waren nicht mit den rationalen Ansichten der
Nationalsozialisten zu vereinen. Zwar beruhte Kolbs Theorie u.a. auch
auf dem Naturstudium, einer bevorzugten Methode der
Nationalsozialisten, aber er erkannte dabei, dass der Mensch ohnehin
einem permanenten Strom von Bildern ausgesetzt ist. Jeden Tag dringen
Unmengen an Bildern unaufhaltsam und kontinuierlich, ob gewollt oder
ungewollt in die menschliche Seele. Er unterschied in Bewusstsein und
Unbewusstsein. Kolb formulierte wie folgt: ‘Jedes Können
erwächst aus dem Unbewussten.’ Für ihn hatte die
Phantasie einen grundlegenden Einfluss für das eigene Gestalten
und sie war wesentlicher Teil des Schöpfungsprozesses. Der
Phantasiebegriff zog sich durch die gesamte bildnerische Entwicklung
des Heranwachsenden. Außerdem betonte Kolb: ‘Die
Gefühle sind es, die zu schöpferischen Akten treiben.’
Hier werden vor allem die Bezüge zu den verschiedenen
Strömungen der Moderne deutlich, welche die NS-Diktatur
grundsätzlich ablehnte und verachtete. Außerdem betrachtet
er das freie bildnerische Gestalten von Kindern und das der bildenden
Künste auf einer Ebene. Er zog hier sogar Vergleiche heran. Auch
dies wurde von den Nationalsozialisten abgelehnt, da die Kunst der
Moderne vor allem aus den Verwirrungen der Zeit vor 1933 entstanden war
und demnach nicht kindlich war. Außerdem begründete sich
nach ihrem Schöpfungsverständnis dieser Prozess als die
Steigerung vom kindlich-naiven hin zur ästhetischen und
technischen Perfektion. Demnach musste sich an dieser Auffassung also
auch die NS-Kunsterziehung orientieren. Wie sich später noch
zeigen wird, haben letztlich auch die Vermittlungswege im
Kunstunterricht des Nationalsozialismus diese Methodik als Grundlage.
Freies Gestalten fand nur eine geringe Bedeutung und wurde als
Grundlage für höhere, bzw. meisterliche Schöpfungen
gesehen.
Kolbs Theorie war daher immer wieder der Kritik in der wachsenden
Anzahl nationalsozialistischer Gesinnungsträger der
kunstpädagogischen Fachkreise ausgesetzt. Im Herbst 1934 kam es
schließlich zum Eklat zwischen dem RmfWEV und Gustav Kolb.
Womöglich wurde dieser Eklat auch durch das energische, nicht
immer verhaltene, aber überzeugte Auftreten Kolbs provoziert.
Vermutlich sahen die Nationalsozialisten auch die Gefahr einer
völligen Stagnation bei der Konzepterarbeitung für eine
NS-Kunsterziehung und dem Kontrollverlust bei der Fachdiskussion um die
Neukonzeption des Unterrichts. Auf einer Tagung der Kunsterzieher des
Reichs in Frankfurt am Main wurde Kolb öffentlich angegriffen.
‘Die allzu hohe Bewertung phantasiegemäßer
Bildversuche im vergangenen System, ohne ernste Formenstudien,
hätte zu Scheinresultaten geführt, mit denen weder wirkliche
Kunst noch das praktische Leben etwas anzufangen wussten.’
Daraufhin wurde der Theorie Kolbs endgültig die Absage durch das
RMfWEV erteilt. Ein eigenes ideologiekonfirmes Konzept hatte man aber
nun auch nicht. Das Fach erstickte fortan in theoretischem
Geschwätz und wurde nach 1933 sogar zugunsten des
Staatsjugendtages um fast die Hälfte seines Stundenpensums
reduziert. Der Kunsterziehung an den Volksschulen tat diese Entwicklung
alles andere als gut. Die Folge waren neben der Stundenkürzung
auch die Streichung finanzieller Mittel und Materialien, was die
Kunsterzieher sehr verärgerte. Wie die Nationalsozialisten in
Folge dessen mit Gustav Kolb und seiner offenen Kritik an den
herrschenden Zuständen in der Zeitschrift ‘Kunst und
Jugend’ verfuhren, ist bereits erwähnt worden. Es ist dabei
ein besonders gutes Beispiel für die rigide Verfahrensweise der
Nationalsozialisten mit ‘Querdenkern’ und
‘Störenfrieden’, die es offensichtlich in der
Kunsterziehung auch gegeben hat.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842813847
- DOI
- 10.3239/9783842813847
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Leipzig – Kunstpädagogik, Studiengang Kunstpädagogik (Lehramt)
- Erscheinungsdatum
- 2011 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- kunsterziehung nationalsozialismus münchen leipzig inhalte
- Produktsicherheit
- Diplom.de