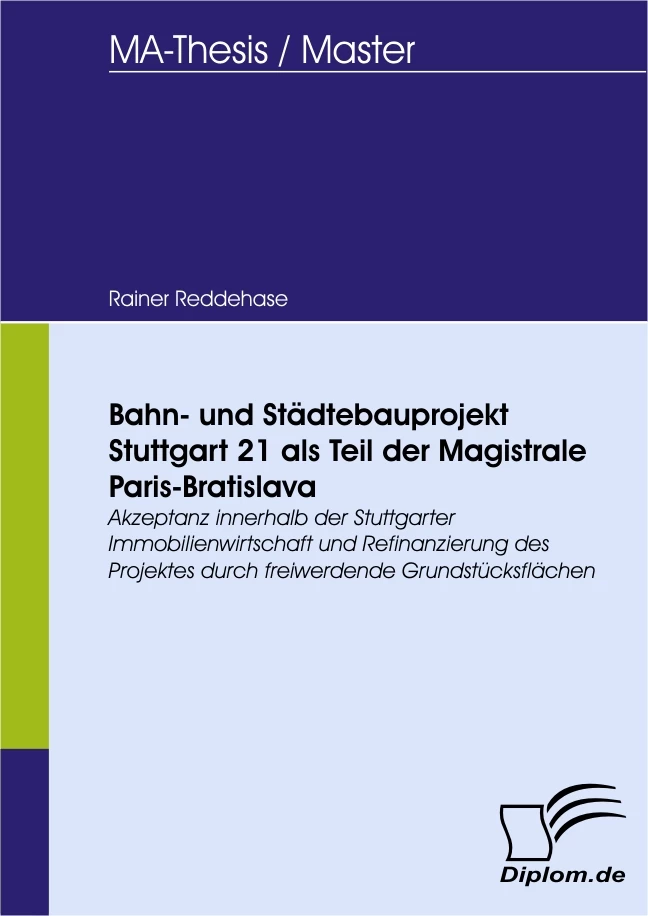Bahn- und Städtebauprojekt Stuttgart 21 als Teil der Magistrale Paris-Bratislava
Akzeptanz innerhalb der Stuttgarter Immobilienwirtschaft und Refinanzierung des Projektes durch freiwerdende Grundstücksflächen
Zusammenfassung
Die Gemeinderatswahlen in der Landeshauptstadt Stuttgart vom 7. Juni 2009 haben deutlich gemacht, dass in der Stuttgarter Bevölkerung immer noch große Verunsicherungen aufgrund des Großprojektes Stuttgart 21 bestehen. Parteien, wie die Grünen und die SÖS, die sich als Projektgegner aufstellten, konnten Stimmen gewinnen, Projektbefürworter, wie die CDU und die SPD, mussten massive Einschnitte verkraften. Erstmals sind die Grünen stärkste Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat.
Zuvor wurde am 2. April 2009 - nachdem im März 2009 das Gutachten Volkswirtschaftliche Bewertung des Projekts Baden-Württemberg 21 (BW21) fertig gestellt wurde - zwischen Bahn, Bund, Land und Stadt eine Finanzierungsvereinbarung unterschrieben, damit das Projekt ab 2010 realisiert werden kann. Durch eine Ausstiegsklausel können die Projektbeteiligten noch bis zum 31. Dezember 2009 von dem bestehenden Vertrag zurücktreten, sofern mit einer wesentlichen Kostenüberschreitung gerechnet werden kann und keine Einigung über eine Kostendeckung erzielt wird.
Beim Bahnprojekt Stuttgart Ulm geht es um die Umgestaltung des Stuttgarter Hauptbahnhofes von einem Kopfbahnhof in einen Durchgangsbahnhof sowie um die Neubaubahnstrecke zwischen Wendlingen und Ulm. Diese Eisenbahnstrecke wiederum ist Bestandteil der Magistrale für Europa zwischen Paris und Bratislava.
Bereits 1988 gab es erste Überlegungen über eine neue Bahnstrecke. 1995 wurde eine Machbarkeitsstudie vorgestellt, die die Realisierungschancen des Projektes aufzeigte. Bei der Finanzierung dieses Großprojektes gingen die Projektbefürworter davon aus, dass eine Refinanzierung durch den Verkauf der freiwerdenden ehemaligen Bahnflächen teilweise möglich sei. Hier sollten neue immobilienwirtschaftliche Projekte im Zentrum von Stuttgart entstehen.
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Umsetzbarkeit dieses Refinanzierungsansatzes für die bereits freigelegte Fläche A1 (Europaviertel), dem ehemaligen Güterbahnhof, sowie für die künftigen freiwerdenden Flächen gemäß Rahmenplan Stuttgart 21 (Flächen A2, A3, B, C1, C2, D und E).
Dabei soll untersucht werden, welche Wertansätze seinerzeit unterstellt waren und wie sich der Stuttgarter Immobilienmarkt in der Zwischenzeit entwickelt hat. Insbesondere werden die Aspekte Bodenpreis- und Mietpreisentwicklung in Stuttgart, die Hintergründe, die zur Realisierung der Bauprojekte im ersten Bauabschnitt und die daraus erzielbaren Rückschlüsse auf die weiteren zu […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Executive Summary
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
1.2 Gang der Untersuchung
2 Bahnprojekt Stuttgart – Ulm als der Teil der Magistrale von Paris – Bratislava Historie und Überblick
2.1 Magistrale Paris – Bratislava
2.2 Bahnprojekt Stuttgart – Ulm: „Baden-Württemberg 21“ inklusive „Stuttgart 21“ .
3 Parteien Stuttgart 21 und ihre Argumentation
3.1 Projektgegner
3.2 Projektbefürworter
4 Umfrage zu Stuttgart 21 innerhalb der Stuttgarter Immobilienwirtschaft
4.1 Methodik
4.2 Auswertung
5 Stadtentwicklungsprojekt von Stuttgart 21 – Immobilienwirtschaftliche Bedeutung
5.1 Städtebauliche Dimension
5.2 Teilgebiet A1 – Europaviertel
6 Stuttgarter Immobilienmarkt 1995 bis 2009
7 Refinanzierung von Stuttgart 21 aus Grundstückserlösen
7.1 Geplante Erlöse aus freiwerdenden Flächen
7.2 Abgleich der Prognosen mit der heutigen Situation
7.2.1 Teilgebiet A2 – E
7.2.2 Teilgebiet A1 – Europaviertel
8 Bewertung der Ergebnisse
8.1 Erlöse der Bahn durch Grundstücksverkäufe
8.2 Folgeinvestitionen durch Stuttgart 21 – Stadtentwicklung
8.3 Gesamtinvestitionen durch das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm
9 Schlussbemerkungen
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: TEN-T 30 Priority Projects (Vorrangige Vorhaben)
Abb. 2: Vorrangiges Vorhaben TEN-V Nr. 17 „Paris – Bratislava“
Abb. 3: Neubaustrecke (H-Trasse) Stuttgart – Ulm
Abb. 4: Stuttgart 21 – Neue Strecke HBF über Flughafen nach Wendlingen
Abb. 5: Durch den Durchgangsbahnhof werden mehr als 100 Hektar für die Stadtentwicklung frei
Abb. 6: Neue Bahnhöfe in Stuttgart
Abb. 7: Seitenflügel des Bonatzbaus
Abb. 8: Modell des neuen Durchgangsbahnhofes bei Wegfall der Seitenflügel
Abb. 9: Neuer Durchgangsbahnhof, Darstellung der unterschiedlichen Ebenen, Visualisierung: DB AG
Abb. 10: Durch Baulogistik soll die Behinderung des Verkehrs minimiert werden
Abb. 11: Mineralwasserschichten unterhalb des Stuttgarter HBF
Abb. 12: Geplante Verbesserungen der Reisezeiten der Bahn
Abb. 13: Fragebogenaktion zu Stuttgart 21 innerhalb der Immobilienwirtschaft / Große Zustimmung innerhalb der Immobilienwirtschaft
Abb. 14: Fragebogenaktion zu Stuttgart 21 innerhalb der Immobilienwirtschaft / Chancen durch das Projekt (Anzahl der Nennungen / Mehrfachnennungen möglich)
Abb. 15: Fragebogenaktion zu Stuttgart 21 innerhalb der Immobilienwirtschaft / Risiken durch das Projekt (Anzahl der Nennungen / Mehrfachnennungen möglich)
Abb. 16: Fragebogenaktion zu Stuttgart 21 innerhalb der Immobilienwirtschaft / Ein Botschafter für Stuttgart 21 wird gewünscht
Abb. 17: Fragebogenaktion zu Stuttgart 21 innerhalb der Immobilienwirtschaft / Das Shoppingcenter hat keine Mehrheit
Abb. 18: Fragebogenaktion zu Stuttgart 21 innerhalb der Immobilienwirtschaft / Bibliothek stößt auf großen Zuspruch
Abb. 19: Fragebogenaktion zu Stuttgart 21 innerhalb der Immobilienwirtschaft / Gegenkonzept zu Stuttgart 21 wird innerhalb der Immobilienwirtschaft abgelehnt
Abb. 20: Fragebogenaktion zu Stuttgart 21 innerhalb der Immobilienwirtschaft / Branchen / Teilbranchen der Teilnehmer
Abb. 21: Fragebogenaktion zu Stuttgart 21 innerhalb der Immobilienwirtschaft / Altersstruktur
Abb. 22: Fragebogenaktion zu Stuttgart 21 innerhalb der Immobilienwirtschaft / Auf der Strecke Stuttgart nach München wird das Auto bevorzugt, auf der Strecke nach Frankfurt die Bahn
Abb. 23: Landeshauptstadt Stuttgart kauft Revitalisierungsflächen
Abb. 24: Rahmenplan Stuttgart 21 vom 24.7.1997
Abb. 25: Stuttgart 21 - Revitalisierungsflächen A1, A2, A3, B, C1, C2, D
Abb. 26: Unter dem Motto „Arbeiten und Wohnen am Schlossgarten“ wird die Fläche A2 und A3 nach Fertigstellung des neuen HBF vermarktet
Abb. 27: Das zukünftige Rosensteinviertel –Plan von Pesch & Partner
Abb. 28: Bebauungsplan Stuttgart 21 – Teilgebiet A1
Abb. 29: LBBW-Gebäude (Parzellen 1,2,3) und SüdLeasing (14)
Abb. 30: Vermarktungsstand . rosa: realisiert, orange: verkauft bzw. in Planung, grau: unverkauft, Parzellen 4 + 5: Verwertung erst nach U-Bahnbau
Abb. 31: Teilgebiet A1 – Parzelle 11 – Modell Golden Loop
Abb. 32: Teilgebiet A1 – Parzelle 13 – Modell
Abb. 33: Teilgebiet A1 – Parzelle 10/1 - Modell Bibliothek des 21. Jahrhunderts
Abb. 34: Teilgebiet A1 – Parzelle 10/2 – Modell Europe-Plaza
Abb. 35: Teilgebiet A1 – Parzelle 7 – Modell Hochhaus „City Tower“
Abb. 36: Teilgebiet A1 – Parzellen 6, 8, 9 - Modell Ex-Galeria Ventuno
Abb. 37: Teilgebiet A1 - Fotomontage - geplante und realisierte Projekte
Abb. 38: Stuttgart – Entwicklung der Baulandpreise in Stuttgart
Abb. 39: Auszug aus der Bodenrichtwertkarte 2009, Teilgebiet A1 von Stuttgart 21
Abb. 40: Auszug Mietspiegel Stuttgart 2009/2010 (Datenbasis April 2008)
Abb. 41: Entwicklung der Übernachtungen in Stuttgart 1998 bis 2008 sowie Wachstum von Übernachtungen & Bettenangebot
Abb. 42: Auszug aus der Bodenrichtwertkarte 2009, Rosensteinviertel von Stuttgart 21
Abb. 43: Investitionsvolumen Bahnprojekt Stuttgart – Ulm
Abb. 44: Einnahmeeffekte der Stadt Stuttgart im Zusammenhang mit dem Projekt Stuttgart 21
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Umfrage zu Stuttgart 21 – Immobilienwirtschaft Stuttgart – Teilnehmer
Tab. 2: Parkplatzkorrelation bei Einkaufszentren in Stuttgart
Tab. 3: Stuttgart – Entwicklung der Spitzenmieten (in EUR/m²) Research
Tab. 4: Stuttgart – Büroflächenfertigstellung
Tab. 5: Stuttgart – Entwicklung des Leerstandes und der Leerstandsquoten
Tab. 6: Stuttgart – Entwicklung des Büroflächenumsatzes
Tab. 7: Erlösprognose 1995 aus Grundstücksverkäufen Stuttgart 21
Tab. 8: Stuttgart 21 – erwartete Verkaufserlöse aus freiwerdenden Grundstücken
Tab. 9: Herleitung der Aufwendungen für den Grundstückserwerb durch die Stadt Stuttgart - Kalkulatorischer Zinsansatz 3,5 %, 4 % und 4,5% p.a. (2 % Inflationsansatz)
Tab. 10: Stuttgart 21 – Teilgebiet A1 – Übersicht / Annahmen Bodenpreise / Flächen
Tab. 11: Stuttgart 21 – Teilgebiet A1 – Übersicht / Annahmen Grundstückspreise
Tab. 12: Näherungswerte zur Bodenwertermittlung für das Teilgebiete A1
Tab. 13: Stuttgart 21 – Teilgebiet A1 – Bodenwertvarianten
Tab. 14: Mögliche Erlöse durch Grundstücksverkäufe im Vergleich mit Prognosen 1995/1998
Tab.15: Herleitung der Aufwendungen für den Grundstückserwerb durch die Stadt Stuttgart – Kalkulatorischer Zinsansatz 4 % p.a. (2 % Inflationsansatz)
Tab. 16: Geschossfläche von Stuttgart 21
Tab. 17: Szenarien der Erlösermittelung
Tab. 18: Stuttgart 21 – Teilfläche A1 – Investitionsvolumen
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Executive Summary - Deutsche Version
Die Masterarbeit analysiert die immobilienwirtschaftliche Bedeutung des Bahn- und Städtebauprojektes Stuttgart 21. Die neue Bahnstrecke Stuttgart – Ulm ist Bestandteil der Magistrale von Europa zwischen Paris und Bratislava. Der Stuttgarter Kopfbahnhof wird zum Durchgangsbahnhof umgebaut und die Gleise an den geplanten Filderbahnhof am Stuttgarter Flughafen und der neuen Messe angebunden. Auf den ehemaligen Bahnflächen im Stuttgarter Zentrum entstehen im Rahmen der Stadtentwicklung neue Stadtquartiere am Schlossgarten, im Rosensteinviertel sowie im Europaviertel (Teilgebiet A1). Die Veräußerungserlöse der Grundstücke stellen einen wesentlichen Teil der Finanzierung des Bahnprojektes dar.
Wie jedes Großprojekt ist auch Stuttgart 21 in der Bevölkerung sehr umstritten. Daher werden die Argumente der Projektgegner und der Projektbefürworter analysiert. Im Rahmen der Arbeit wurde eine Akzeptanzanalyse innerhalb der Stuttgarter Immobilienwirtschaft vorgenommen. Aufgrund des hohen Rücklaufes der Fragebogenaktion – 166 von 500 Fragebögen wurden ausgefüllt und ausgewertet – können die Ergebnisse als repräsentativ bewertet werden. Die Auswertung ergab eine überdurchschnittliche Befürworterquote innerhalb der Immobilienwirtschaft für das Gesamtprojekt Stuttgart 21 (90%). Die Befragten gehen zu 94 % davon aus, dass das Projekt Stuttgart 21 den Wirtschaftsstandort Stuttgart stärkt und dazu führt, dass Stuttgart im internationalen Vergleich weiter nach Vorne rückt. Dennoch wurden Defizite im Bereich der Projektkommunikation ausgemacht. Einzelne Teilprojekte wie z.B. das geplante Einkaufszentrum wurden von der Mehrheit der Befragten abgelehnt. 60 % der Probanten erwarten, dass sie beruflich von dem Projekt betroffen sein werden; davon positiv (83 %) und negativ (17%). Ferner wurde deutlich, dass sich nach Fertigstellung der Neubaustrecke der Verkehr von Stuttgart nach München von der Autobahn hin zur Schiene verlagern wird.
In einer Machbarkeitsstudie wurden 1995 Prognosen über die zu erzielenden Grundstückserlöse getroffen (1,08 Mrd. €). Die Annahmen wurden mit der heutigen Situation abgeglichen und es wurde untersucht, wie sich der Immobilienmarkt seit Planungsbeginn entwickelt hat. Ferner wurde analysiert, welche Projekte sich auf dem Teilgebiet A1 (Europaviertel) zwischenzeitlich realisieren ließen. So wurden 9 von 16 Grundstücken bereits veräußert, weitere Veräußerungen sind vom Projektverlauf abhängig. Die Untersuchung ergab, dass Annahmen über die geplanten Grundstückserlöse in der Machbarkeitsstudie von 1995 ein Drittel zu hoch angesetzt wurden. Des Weiteren stellte sich heraus, dass eine modifizierte Planung aus dem Jahr 1998 die heutige Situation sehr gut widerspiegelt.
Auf dem Teilgebiet A1 ist mit Immobilieninvestitionen in Höhe von ca. 1,5 Mrd. € zu rechnen. 2,5 Mrd. € werden investiert, sobald ab 2019 der Durchgangsbahnhof fertig gestellt ist und die nicht mehr benötigten Gleisanlagen und Wartungshallen entfernt werden können. Zusätzliche 5,1 Mrd. € werden in das Bahnprojekt Stuttgart 21 (3,1 Mrd. €) und in die Neubaubahnstrecke Wendlingen – Ulm (2 Mrd. €) investiert.
Durch diese direkten Investitionen in Höhe von 9 Mrd. € innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahren wird die volkswirtschaftliche Bedeutung für die Landeshauptstadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg deutlich. Die sich daraus wiederum ergebenden Folgeinvestitionen dürften noch einmal zwischen 20 Mrd. € und 40 Mrd. € liegen.
Somit wird es Stuttgart und Baden-Württemberg gelingen, ihren Spitzenplatz innerhalb der europäischen Regionen zu behaupten. Stuttgart 21 ist daher eines der größten Bahnprojekte und städtebaulichen Projekte in Europa. Gewinner werden die jetzigen und heranwachsenden Bürger der Stadt Stuttgart und der Regionen in Baden-Württemberg sein sowie die Bahnfahrer in Deutschland und Europa.
Railway- and City development Project 'Stuttgart 21' as part of the main railway axis Paris-Bratislava - An acceptancy study conducted among real estate professionals of Stuttgart, and an assessment of the refinancing of the project via revenues from sales of properties made available through 'Stuttgart 21'
This master thesis analyzes the economic significance of the rail- and city development project ‘Stuttgart 21’ for the real estate sector. The new railway line Stuttgart – Ulm is part of the most important European railway axis connecting Paris and Bratislava. As part of Stuttgart 21, the former terminal station of Stuttgart is to be converted into a through station and connected with the planned Filderbahnhof at Stuttgart Airport as well as with “neue Messe”, Stuttgart’s exhibition centre. On the former railway tracks in the heart of Stuttgart’s city-center, new city districts are to be developed at Schlossgarten, Rosensteinviertel and Europaviertel (Subsection A1). Revenues from the sale of these properties constitute a significant contribution to the financing of this major railway project.
As is the case with any large-scale development project, Stuttgart 21 is heavily contested amongst the local population. Accordingly, the arguments brought forward by both the project’s opponents and the project’s supporters are analyzed. As part of the thesis project, an acceptance-survey was conducted within the real estate sector of Stuttgart. In view of the high return rate of the questionnaire, 166 returned questionnaires out of a total of 500, the findings can be taken as representative. These findings signify an above-average approval of the entire project Stuttgart 21 (90%) amongst the professional real estate actors in Stuttgart. 94% of the respondents expect Stuttgart 21 to strengthen the business location of Stuttgart and that the project will lead to Stuttgart’s advancement in international comparison. Nevertheless, deficits were identified in the context of project communication. Parts of the project, e.g. the planned shopping mall, were viewed critically by the majority of respondents (50%). 60% of the respondents expect that the project will have an impact on their professional activities, both positive (83%) and negative (17%) in kind. Furthermore, it was made apparent that traffic between Stuttgart and Munich will shift from Autobahn (highway) to railway upon completion of the newly-constructed train-track between Stuttgart and Munich.
In a feasibility-study of 1995, the attainable sales revenues from the sale of the properties were estimated (1.08 bn €). The assumptions underlying this estimation were compared with today’s situation and it was analyzed how the real estate market has developed since then. Additionally, it was analyzed which projects have been realized in sub-sector A1 (Europaviertel) in the meantime. To date, 9 of 16 properties have been sold, with further sales contingent upon the ongoing course of the project. The findings show that the original assumptions regarding the attainable sales prices made in the feasibility study of 1995 overestimated these by around a third. Additionally, the findings suggest that a modified plan of 1998 represents today’s situation very well.
On sub-sector A1, real estate investments are expected to amount to approx. 1.5 bn €. A further 2.5 bn € will be invested upon completion of the through station in 2019, when the then no longer required tracks and railway maintenance facilities can be removed. Another 5.1 bn € shall be invested into the railway project Stuttgart 21 (3.1 bn €) and into the newly-constructed railway line between Wendlingen and Ulm (2 bn €).
These direct investments of 9 bn € within the next 10 to 20 years will have a notable impact on the economic significance of both the Federal State Capital, Stuttgart, and the Federal State of Baden-Württemberg in its entirety. Follow-up investments are expected to amount to another 20 to 40 bn €.
With this project, Stuttgart and Baden-Württemberg will retain their leading position amongst the European regions. Stuttgart 21 is one of the largest railway- and city development projects in Europe. The beneficiaries of this project shall be both todays and the forthcoming generations of citizens of the city of Stuttgart, the regions within Baden- Württemberg and rail travellers across Germany and Europe.
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
Die Gemeinderatswahlen in der Landeshauptstadt Stuttgart vom 7. Juni 2009 haben deutlich gemacht, dass in der Stuttgarter Bevölkerung immer noch große Verunsicherungen aufgrund des Großprojektes Stuttgart 21 bestehen. Parteien, wie die Grünen und die SÖS, die sich als Projektgegner aufstellten, konnten Stimmen gewinnen, Projektbefürworter, wie die CDU und die SPD, mussten massive Einschnitte verkraften. Erstmals sind die Grünen stärkste Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat.[1]
Zuvor wurde am 2. April 2009 - nachdem im März 2009 das Gutachten „Volkswirtschaftliche Bewertung des Projekts Baden-Württemberg 21 (BW21)“ fertig gestellt wurde - zwischen Bahn, Bund, Land und Stadt eine Finanzierungsvereinbarung unterschrieben, damit das Projekt ab 2010 realisiert werden kann. Durch eine Ausstiegsklausel können die Projektbeteiligten noch bis zum 31. Dezember 2009 von dem bestehenden Vertrag zurücktreten, sofern mit einer wesentlichen Kostenüberschreitung gerechnet werden kann und keine Einigung über eine Kostendeckung erzielt wird.[2]
Beim Bahnprojekt Stuttgart – Ulm geht es um die Umgestaltung des Stuttgarter Hauptbahnhofes von einem Kopfbahnhof in einen Durchgangsbahnhof sowie um die Neubaubahnstrecke zwischen Wendlingen und Ulm. Diese Eisenbahnstrecke wiederum ist Bestandteil der Magistrale für Europa zwischen Paris und Bratislava.
Bereits 1988 gab es erste Überlegungen über eine neue Bahnstrecke. 1995 wurde eine Machbarkeitsstudie vorgestellt, die die Realisierungschancen des Projektes aufzeigte. Bei der Finanzierung dieses Großprojektes gingen die Projektbefürworter davon aus, dass eine Refinanzierung durch den Verkauf der freiwerdenden ehemaligen Bahnflächen teilweise möglich sei. Hier sollten neue immobilienwirtschaftliche Projekte im Zentrum von Stuttgart entstehen.
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Umsetzbarkeit dieses Refinanzierungsansatzes für die bereits freigelegte Fläche „A1“ („Europaviertel“), dem ehemaligen Güterbahnhof, sowie für die künftigen freiwerdenden Flächen gemäß Rahmenplan Stuttgart 21 (Flächen A2, A3, B, C1, C2, D und E).
Dabei soll untersucht werden, welche Wertansätze seinerzeit unterstellt waren und wie sich der Stuttgarter Immobilienmarkt in der Zwischenzeit entwickelt hat. Insbesondere werden die Aspekte Bodenpreis- und Mietpreisentwicklung in Stuttgart, die Hintergründe, die zur Realisierung der Bauprojekte im ersten Bauabschnitt und die daraus erzielbaren Rückschlüsse auf die weiteren zu bebauenden Flächen untersucht.
1.2 Gang der Untersuchung
Zu Beginn der Masterarbeit wird das Gesamtprojekt „Magistrale für Europa“ vorgestellt, wobei während der weiteren Arbeit der Schwerpunkt auf dem Bahn- und Städtebauprojekt Stuttgart 21 selbst liegt.
Innerhalb dieses Projektes geht es dem Autor um den immobilienwirtschaftlichen Bezug. Dieser ergibt sich durch die freigewordenen bzw. freiwerdenden Flächen, die der Refinanzierung des Projektes dienen sollen. Hier stehen die Annahmen im Fokus, welche zu Planungsbeginn Mitte der 90er-Jahre dazu geführt haben, dass das Projekt weiterverfolgt wurde. Diese Annahmen werden mit dem aktuellen Projektverlauf abgeglichen.
So sollen neben der Auswertung von Stuttgarter Immobilienmarktberichten die Büroflächenfertigstellung, Leerstände und Leerstandsquoten, Büroflächenumsätze sowie die Spitzenmieten der Stadt zwischen 1995 und 2009 ausgewertet werden.
Der ehemalige Güterbahnhof wurde abgerissen. Auf diesem Gebiet, auch als Bauabschnitt A1 bzw. als Europaviertel bekannt, wurden noch vor Projektstart von Stuttgart 21 die ersten Neubauten erstellt. Mit der Vorstellung der geplanten Bauprojekte auf diesem Gebiet, lassen sich die damals geltenden Entwicklungsprognosen mit dem damaligen und heutigen Immobilienmarkt am besten vergleichen.
Auch wenn es sich bei Stuttgart 21 um ein Leuchtturmprojekt für die Region handelt sollte die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen. Volkswirtschaftliche Gutachten gehen unter gesamtwirtschaftlichen Aspekten von jährlichen positiven Erträgen aus. Projektgegner haben Gutachten erstellen lassen, die von dauerhaften Verlusten ausgehen. Die finanziellen Auswirkungen, welche das Projekt auf den Immobilienmarkt bereits hatte und hat, sollen aufgezeigt werden. Des Weiteren sollen Machbarkeitsstudien mit dem heutigen Projektverlauf verglichen werden.
Bereits seit über 20 Jahren – erstmalige Diskussion 1988 – wird über das Projekt Stuttgart 21 diskutiert. Daher wurde in dieser Zeit auch eine ganze Reihe von Publikationen veröffentlicht. Hier muss bei der Auswertung der Literatur darauf geachtet werden, dass mit diesen Publikationen in der Regel bestimmte Eigeninteressen verfolgt wurden, sei es von den Gegnern, sei es von Befürwortern. So wurden etliche Gutachten und Gegengutachten erstellt, Wahlprogramme auf Stuttgart 21 abgestimmt und in der Presse erheblich diskutiert.
Da es sich um ein laufendes Projekt handelt, gibt es folglich auch noch keine abschließende Projektliteratur. Daher wird die Recherche über Zeitungsauswertungen, Internetquellen, Hintergrundgespräche mit beteiligten Personen und Auswertung von (Grundstücks)-Marktberichten und Gutachten sowie Studien erfolgen. Ferner wurde eine Befragung innerhalb der Stuttgarter Immobilienwirtschaft durchgeführt, um Rückschlüsse über die Akzeptanz zum Projekt Stuttgart 21 zu ziehen.
2 Bahnprojekt Stuttgart – Ulm als Teil der Magistrale von Paris – Bratislava - Historie und Überblick
2.1 Magistrale Paris – Bratislava
Als Beitrag der Europäischen Union zur Umsetzung und Entwicklung des europäischen Binnenmarktes sowie zur Steigerung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhaltens innerhalb der Union werden von ihr sogenannte „Transeuropäische Netze“, TEN, gefördert. Dies ergibt sich aus den Artikeln 154 bis 156 im EG-Vertrag.[3] Unter Netze werden neben den Bereichen Energie und Telekommunikation auch der Bereich Verkehr, TEN-V bzw. TEN-T[4], gesehen und hier insbesondere der Eisenbahnverkehr.[5]
Die sogenannte Van-Miert-Gruppe[6] legte 2003 die Neuordnung der Infrastrukturpolitik im Hinblick auf die Osterweiterung fest. Am 29.04.2004 stimmte der Europäische Rat der Entscheidung Nr. 884/2004/EG des Europäischen Parlaments über „gemeinsame Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes“ zu. Für die „vorrangigen Vorhaben“ wurde ein sog. TEN-V-Haushalt aufgestellt und Mittel des Kohäsionsfonds zur Verfügung gestellt. In der Anlage 1 befindet sich eine Übersicht über die „vorrangigen Projekte“.[7]
Abb. 1: TEN-T 30 Priority Projects (Vorrangige Vorhaben)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/30_priority_projects, Abrufdatum: 13.07.2009[8]
Insgesamt wurden 30 „vorrangige Vorhaben“ festgelegt. Seit 2005 werden folgende sechs zentrale Projekte bevorzugt gefördert:[9]
1. Eisenbahnachse Berlin – Verona/Mailand – Bologna – Neapel – Messina – Palermo,
3. Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnachse in Südwesteuropa (Lissabon – Madrid – Nîmes),
6. Eisenbahnachse Lyon-Triest – Divača/ Koper – Divača – Ljubljana – Budapest – ukrainische Grenze,
17. Eisenbahnachse Paris – Straßburg – Stuttgart – Wien – Bratislava,
27. Eisenbahnachse Warschau – Kaunas – Riga – Tallinn – Helsinki sowie
Umsetzung des Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems (ERTMS).
Für das vorrangige Vorhaben Nr. 17, „Eisenbahnachse Paris – Straßburg – Stuttgart – Wien – Bratislava“, ernannte die Europäische Kommission am 20.07.2005 Péter Balázs, seit April 2009 Außenminister von Ungarn,[10] als Europäischen Koordinator. Am 9.6.2006 unterzeichnete der Deutsche Verkehrsminister, Wolfgang Tiefensee, mit seinen Ministerkollegen aus Frankreich, Wien und der Slowakischen Republik eine Absichtserklärung zu den vorrangigen Vorhaben TEN-V Nr. 17 „Paris – Bratislava“.
Abb. 2: Vorrangiges Vorhaben TEN-V Nr. 17 „Paris – Bratislava“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Balázs, Péter: Priority Project No. 17 „Rail link: Paris – Strasbourg – Stuttgart – Vienna – Bratislava“ – Annual Report 2006-2007, Brüssel 2007[11]
In seinem ersten Jahresbericht (Juni 2006) ging der Europäische Koordinator von einem Gesamtprojektvolumen in Höhe von 23 Milliarden Euro für die Eisenbahnverbindung bei einer Strecke von 1.382 km aus, wovon 13,4 Milliarden Euro noch nicht finanziert waren. Die Reisezeit sollte so zwischen Paris und Bratislava von ca. 14 Stunden auf nun 8 Stunden reduziert werden.[12] Laut der Initiative „Magistrale für Europa“ werden so 35 Millionen Bewohner und 16 Millionen Beschäftigte europaübergreifend verbunden.[13]
Bei dem Projekt ist eine Intermodalität zwischen mehreren Verkehrsmitteln, ausdrücklich gewünscht. So können bei Fertigstellung der Bahnstrecke sechs bis sieben Flughäfen direkt angebunden werden. Die Anbindung an die Flughäfen sowie an die Wasserstraßen hat auch für den Güterverkehr erhebliche Vorteile. [14]
Die Strecke beinhaltet die grenzüberschreitenden Abschnitte Straßburg – Brücke Kehl – Appenweier, München – Mühldorf – Freilassing – Salzburg sowie Wien – Bratislava.
Zu den größten Erfolgen zählt die Fertigstellung der ersten Ausbaustufe der Schnellbahnstrecke LGV Est européenne im Jahr 2007. Auf dieser Strecke wurde eine Höchstgeschwindigkeit in Höhe von 574,8 km/h gemessen; die Reisegeschwindigkeit liegt jedoch bei 320 km/h. Seitdem verkehrt der TGV von Paris über Straßburg bis nach Stuttgart, mittlerweile auch nach München. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy hat die Finanzierung für die zweite Ausbaustufe bereits zugesagt.[15] Seit 2009 ist die Anschlussstrecke zur Rheinbrücke auf französischer Seite im Bau.[16]
Daneben gab es eine ganze Reihe weiterer Projektfortschritte, wie die Fertigstellung des neuen Bahnhofes Neu-Ulm (Neu-Ulm 21) im Jahr 2007. Durch Tieferlegung und Reduzierung der vormals 16 Gleise auf nun 4 Gleise konnte der Innenstadtbereich durch Wegfall der ehemaligen Gleisanlagen wesentlich wachsen. Die freiwerdenden Flächen (ca. 18 ha) im Zentrum wurden für die Landesgartenschau 2008 genutzt. Ferner sind Wohnungen und Handels- sowie Dienstleistungskonzepte vorgesehen.[17]
Auch bei beiden Bahnhöfen München und Wien gab es Überlegungen, die vorhandenen Kopfbahnhöfe umzugestalten. In München wird der Bahnhof München-Pasing verstärkt berücksichtigt, um den Kopfbahnhof München HBF zu entlasten.[18] In Wien wurde damit begonnen, den Westbahnhof zum Bahnhof City Wien West umzugestalten. Hier geht es in erster Linie um die Generalsanierung des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes sowie der Errichtung zweier angrenzender Gebäude für Büro- und Hotelnutzung. Ferner wird parallel zum Bahnhof ein weiteres Geschoss eingezogen, damit hier ein Shoppingcenter in den Bahnhof integriert werden kann.[19], [20]
Der jährliche Tätigkeitsbericht des Europäischen Koordinators sieht bei dem Vorhaben Nr. 17 drei Engpässe: Die Strecken St. Pölten – Wien, Baudrecourt – Vendenheim sowie Stuttgart – Ulm.
Bereits 2007 gelang den Österreichern der Tunneldurchschnitt unter dem Wienerwald. Es wird damit gerechnet, dass 2013 die Strecke zwischen Wien und St. Pölten fertig gestellt ist und sich dadurch die Fahrtzeit halbiert.[21],[22] Der Koordinator sieht in seinem Bericht große Fortschritte bei den laufenden Tunnelprojekten und hebt die massiven Investitionen Österreichs hervor.[23]
Der zweite Abschnitt der französischen Hochgeschwindigkeitstrasse "LGV Est" zwischen Baudrecourt – Vendenheim (bei Straßburg) führte aufgrund der anfangs ungeklärten Finanzierungssituation zu einem unvorhersehbaren weiteren Projektverlauf. Mittlerweile gehen die Projektbeteiligten von einer Fertigstellung bis Ende 2012 aus.[24]
Die Engpässe der Strecke Stuttgart – Ulm werden im nächsten Unterkapitel näher erläutert.
2.2 Bahnprojekt Stuttgart – Ulm: „Baden-Württemberg 21“ inklusive „Stuttgart 21“
Die Strecke Stuttgart – Ulm ist Teil des TEN-V Priority Project No. 17 der Europäischen Union. Hinter diesem Bahnprojekt Stuttgart – Ulm stehen die Deutsche Bahn AG, die Stadt Stuttgart, der Verband Region Stuttgart, das Land Baden-Württemberg, die Bundesrepublik Deutschland sowie die Europäische Union.[25]
Einerseits geht es um die Erstellung der Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zwischen Wendlingen und Ulm. Andererseits geht es um die Umgestaltung des Stuttgarter Kopfbahnhofes in einen Durchgangsbahnhof und die Anbindung des Hochgeschwindigkeitsnetzes an den Stuttgarter Flughafen und die neue Landesmesse. Das Gesamtprojekt ist auch als „Baden-Württemberg 21“ bekannt, die „Neuordnung des gesamten Bahnknotens der Landeshauptstadt“ wird seit 1994 unter dem Namen Verkehrs- und Städtebauprojekt „Stuttgart 21“ diskutiert.[26]
Abb. 3: Neubaustrecke (H-Trasse) Stuttgart – Ulm
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Heimerl, Gerhard: Stadtentwicklungsimpulse durch den Ausbau der europäischen Eisenbahnmagistralen: Stuttgart 21 - Zukunftsinvestition für den Bahnknoten Stuttgart, 2002 aus:
http://www.oevg.at/archiv/veranstaltungen/20020616bregenz/56heimerl.htm,[27] Abrufdatum 19.07.2009
Erste Überlegungen der besseren Anbindung Stuttgarts an das Hochgeschwindigkeitsnetz, gab es seitens der Bahn bereits in den 80er Jahren. 1988 entwickelte der Stuttgarter Verkehrswissenschaftler Gerhard Heimerl die Idee (sog. H-Trasse) eines Durchgangsbahnhofes und eines Tunnels auf die Fildern. 1994 wurde ein Gutachten über die Rentabilität der Streckenführung über den Stuttgarter Flughafen erstellt.[28]
Der damalige Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel stellte zusammen mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel sowie Bundesverkehrsminister Matthias Wissmann und dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bundesbahn Heinz Dürr das Projekt Stuttgart 21 vor.[29] Der alte, sanierungsbedürftige Kopfbahnhof sollte aufgegeben und durch einen modernen Durchgangsbahnhof ersetzt werden. Die Teil-Finanzierung sollte über die Revitalisierung nicht mehr genutzter Gleisflächen (ca. 80 ha, später 100 ha) im Stuttgarter Innenstadtbereich sichergestellt werden.[30]
Eine umfangreiche Machbarkeitsstudie, die aus 18 Bänden mit Einzelgutachten und Detailunterlagen bestand, belegte Anfang 2005, dass das Projekt Stuttgart 21 technisch machbar sei. Ferner wurden wesentliche Vorteile für die Stadtentwicklung sowie der Verkehrsplanung gesehen.[31] Neben einem Lenkungskreis und Projekt begleitenden Arbeitsgruppen sowie der Projektleitung und Koordination unter der Drees & Sommer AG gab es 6 Fachgruppen zu Themen wie städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten, verkehrliche Fragen, volkswirtschaftliche Bedeutung, Technik Bahnanlagen, Bahnhofsplanung und Rentabilitätsrechnung. Parallel dazu wurden städtebauliche Gutachten und Planungsstudien zum Hauptbahnhof und dem Bahnhof Flughafen (Filderbahnhof) durchgeführt.[32]
Abb. 4: Stuttgart 21 – Neue Strecke HBF über Flughafen nach Wendlingen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Heimerl, Gerhard: Stadtentwicklungsimpulse durch den Ausbau der europäischen Eisenbahnmagistralen: Stuttgart 21 - Zukunftsinvestition für den Bahnknoten Stuttgart, Stuttgart 2002 in: http://www.oevg.at/archiv/veranstaltungen/20020616bregenz/56heimerl.htm[33]
Um dem Vorstand der Bahn weitere Planungssicherheit nach Vorlage der Machbarkeitsstudie zu geben, wurde 1995 in Form eines Vorprojektes untersucht, welche Planungsoptionen bestehen, wie die Kostenkontrolle effektiv erfolgen kann, welcher Projektzeitplan realistisch ist, welche hydrogeologischen Untersuchungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen erforderlich sind und wie das Trassenführungsrisiko minimiert werden kann.[34]
Nach Vorlage der Ergebnisse des Vorprojektes konnten erste Finanzierungsvorschläge erarbeitet werden.[35] Bereits im November 1995 wurde zwischen Bahn, Land und Stadt eine Rahmenvereinbarung zur Finanzierung getroffen. In den darauffolgenden Jahren liefen etliche Architektenwettbewerbe, Planfeststellungsverfahren zu Stuttgart 21, öffentliche Anhörungen, Beschlüsse des Landtags und Gemeinderatsbeschlüsse, aber auch gerichtliche Auseinandersetzungen mit Projektgegnern.[36]
Der Rahmenplan Stuttgart 21 basiert auf dem im Juli 1997 vom Stuttgarter Gemeinderat verabschiedeten Entwurf des Büros Trojan, Trojan + Neu, Darmstadt. Vorausgegangen war ein internationaler städtebaulicher Wettbewerb unter Beteiligung renommierter Büros sowie ein intensiver öffentlicher Diskussionsprozess, an dem Stuttgarts Bürger, Fachplaner, Politiker und Verbände beteiligt waren.[37] Im Rahmen der „Offenen Bürgerbeteiligung“ konnten sich Stuttgarter Bürger aktiv auf Basis des Rahmenplanentwurfs an der Planung beteiligen. So wurden in 15 Arbeitsgruppen, in denen sich circa 400 Bürger beteiligten, zahlreiche Vorschläge zur städtischen Planung mitentwickelt.[38]
Abb. 5: Durch den Durchgangsbahnhof werden mehr als 100 Hektar für die Stadtentwicklung frei
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Schuster, Wolfgang, Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm. Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen – Ulm, Stuttgart 2008, S. 35[39]
Das Architekturbüro Ingenhoven gewann den Wettbewerb zur Umgestaltung des Stuttgarter HBF. Der EU-Koordinator für die Eisenbahnachse Paris – Bratislava, Péter Balázs, empfahl 2006 eine finanzielle Förderung des Teilstücks Stuttgart – Ulm.[40]
Abb. 6: Neue Bahnhöfe in Stuttgart
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Schuster, Wolfgang: Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm. Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen – Ulm, Stuttgart 2008, S. 23[41]
Im April 2009 wurde – nach 15 Jahren Vorarbeit – die Finanzierungsvereinbarung für „Das neue Herz Europas“[42], so der neue Slogan für das Projekt, rechtswirksam von dem Stuttgarter Oberbürgermeister Wolfgang Schuster, dem Regionalpräsidenten des Verbandes Region Stuttgart, dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Günther H. Oettinger, dem Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Wolfgang Tiefensee sowie Stefan Garbe, Vorstand Infrastruktur Deutsche Bahn AG, unterschrieben. Die Bauvorbereitungen haben 2009 begonnen, so dass die Hauptbauleistungen 2010 starten können. Eine Fertigstellung des Bahnprojektes sei bis 2019 möglich.[43]
3 Parteien Stuttgart 21 und ihre Argumentation
3.1 Projektgegner
Zu Stuttgart 21 formierten sich nach dessen Vorstellung in der Öffentlichkeit eine ganze Reihe von Projektgegnern. Sie versuchten das Projekt mit juristischen Mitteln, mit der Organisation von Demonstrationen, Erstellung von Internetseiten und Broschüren, der Sammlung von Unterschriften und der Initiierung eines Bürgerbegehrens zu stoppen bzw. zu verzögern.
Dabei richtet sich heute der Protest weniger gegen die Neubaustrecke Wendlingen – Ulm, sondern vielmehr an die Umgestaltung des Stuttgarter HBF zu einem Durchgangsbahnhof.
Roland Ostertag, der als Herausgeber des Buches „Stuttgart 21: Das Milliardengrab - Die entzauberte Stadt“ die Proteste der Gegner in diesem Buch bündelt, sieht die Hauptziele des Aktionsbündnisses im Erhalt des Bonatzschen Hauptbahnhofes inklusive Sanierung und Modernisierung (Alternative zu Stuttgart 21: „Kopfbahnhof K21“) sowie eine „umweltfreundliche und nachhaltige Integration in die topographischen und städtebaulichen Gegebenheiten, die Berücksichtigung des Charakters der Stadt und ein behutsamer Anschluss an die beabsichtigte Neubaustrecke Wendlingen – Ulm“.[44]
Die Proteste konzentrieren sich im Wesentlichen auf folgende Punkte:
1. Demokratie: Das Projekt hätte keine demokratische Legitimation, da hierüber kein Bürgerbegehren abgehalten wurde.
2. Bonatzbau: Durch das Projekt müssten die Seitenflügel des bestehenden denkmalgeschützten Bonatzschen Hauptbahnhofes aus dem Jahre 1927 eingerissen werden.
3. Baustellenlogistik: Die Baustellensituation in den nächsten Jahren führt zu erheblichen Behinderungen.
4. Mineralwasserquellen: Es werden mögliche Gefahren für das Mineralwasser gesehen.
5. Kostenexplosion: Ferner wird eine Kostenexplosion befürchtet.
6. Kopfbahnhof K21: Das Alternativkonzept Kopfbahnhof K21 sei insgesamt wesentlich besser.
7. Kommunikation des Projektes Stuttgart 21 in der Öffentlichkeit.
Das Projekt Stuttgart 21 wird in der Stuttgarter Öffentlichkeit sehr emotional diskutiert. Daher müssen diese Argumente auch bei den Projektverantwortlichen gewürdigt werden.
1. Demokratie: Das Projekt hätte keine demokratische Legitimation, da hierüber kein Bürgerbegehren abgehalten wurde.
In seiner Projektvorstellung im Dezember 2008 führte der Stuttgart OB Wolfgang Schuster aus, dass seit 1993 das Thema Stuttgart 21 mehr als 180 Mal auf der Tagesordnung des Stuttgarter Gemeinderates stand. Ferner wurden eine Vielzahl von Bürgeranhörungen und Diskussionen zum Projekt durchgeführt. So stimmte im Jahr 2007 der Stuttgarter Gemeinderat mit 75 % für das Projekt Stuttgart 21 und für dessen Finanzierung. Ferner erhielt das Projekt mit jeweils über 75 % die Zustimmung des Bundestags, des Landtages von Baden-Württemberg sowie der der Regionalversammlung.[45]
Im Oktober 2007 startete ein Bündnis aus Grünen, Umweltverbänden und Bürgergruppen ein Bürgerbegehren mit folgendem Inhalt:[46]
„Sind Sie dafür, dass die Stadt Stuttgart aus dem Projekt STUTTGART 21 aussteigt;
- dass sie keine Ergänzungsvereinbarung mit den Projektpartnern abschließt, die u. a. von der Stadt abzusichernde Risiken in Höhe von 206,94 Mio. Euro vorsieht;
- dass sie keine Änderung des Kaufvertrags mit der Deutschen Bahn für die Teilgebiete A2, A3, B, C und D, insbesondere nicht unter der Erklärung des Verzichts auf Verzugszinsen aus dem Grundstücksgeschäft, vornimmt;
- dass sie keine weiteren Verträge über dieses Projekt abschließt und
- dies den Vertragspartnern mit dem Ziel des Abschlusses einer Aufhebungsvereinbarung mitteilt?“[47]
Grundsätzlich sind für ein Bürgerbegehren in Stuttgart 20.000 Unterschriften der ca. 590.000 Einwohner[48] erforderlich. Bei dieser Unterschriftenaktion stimmten ca. 67.000 Bewohner (davon 61.193 rechtsgültige Unterschriften) für den vorgeschlagenen Text.[49]
Die Stuttgarter Stadtverwaltung machte darauf aufmerksam, dass das Bürgerbegehren in der durchgeführten Form keine Aussicht auf Erfolg habe und lehnte den Antrag auf Durchführung eines Bürgerbegehrens ab. So geht aus dem Rechtsgutachten von Dolde & Partner hervor, dass sowohl die fünf Teilfragen als auch das Bürgerbegehren insgesamt unzulässig sind. Dies wird mit Verfristung, gesetzeswidrigen Zielen und inhaltlicher Unbestimmtheit begründet.[50] Ferner stellt Franz-Ludwig Knemeyer, Vorstand des kommunalwissenschaftlichen Forschungszentrums Würzburg, in seinem Gutachten fest, dass das Verschweigen der Folgen irreführend sei und dass auf das beträchtliche Kostenrisiko nicht hingewiesen wurde.[51]
Am 17. Juli 2009 wurde die Klage der Projektgegner vor dem Stuttgarter Verwaltungsgericht abgewiesen. In der Urteilsbegründung heißt es: „Zu Stuttgart 21 lagen bereits rechtlich bindende Ratsbeschlüsse und Verträge vor, die aus den Jahren 1995 und 2001 stammen.“ „Mit ihrem Bürgerbegehren hätten die Initiatoren keine konkreten Forderungen erhoben, sondern der Stadt den angestrebten Ausstieg überlassen wollen. Dies sei auf der Grundlage der baden-württembergischen Kommunalverfassung jedoch nicht zulässig.“[52]
2. Bonatzbau: Durch das Projekt müssten die Seitenflügel des bestehenden denkmalgeschützten Bonatzschen Hauptbahnhofes aus dem Jahre 1927 eingerissen werden.
Nach den Plänen des Architekten Ingenhoven sollen die beiden Seitenflügel des Bahnhofes, erstellt von dem Stuttgarter Architekten Paul Bonatz, dem Durchgangsbahnhof weichen. Laut OB Schuster wurden in den zwanziger Jahren die Seitenflügel im Wesentlichen errichtet, „um die Umgebung vor dem Lärm der Dampfloks zu schützen“[53]
Abb. 7: Seitenflügel des Bonatzbaus
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Anlehnung an Foto DPA,[54] Lederer, Arno: Stuttgart 21 - Architekt aus dem Preisgericht übt Kritik, Stuttgarter Zeitung, 16.07.2008, in: http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/ 2063401? lastupdate=2009-06-17_15:19:24, Abrufdatum: 14.08.2009
Auch unter Architekten hat sich ein großer Widerstand gegen den Abriss der Seitenflügel des bestehenden HBF erhoben. Sie folgten dem Aufruf des Kunstgeschichtlers Matthias Roser, der sich vehement für den Erhalt des Baudenkmals einsetzt.[55]
Der Architekt Ingenhoven wurde im Juli 2009 befragt, ob er die „Aufregung“ um den Wegfall der Seitenflügel verstehe: "Teils, teils. Fakt ist aber, dass es technisch unmöglich ist, die Gebäude beim Umbau stehen zu lassen. Ohnehin sind sie - hart ausgedrückt - nur Blendbauten, die die Gleise umrahmen." Weiter: "Wir wollen dem Bonatzbau etwas Neues hinzufügen und werden dabei sehr respektvoll mit dem jetzigen Bestand umgehen."[56]
Abb. 8: Modell des neuen Durchgangsbahnhofes bei Wegfall der Seitenflügel
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: http://www.stuttgart-tourist.de/DEU/ipunkt/anreise_bahn.htm[57]
Neben den Seitenflügeln sind noch weitere Denkmäler betroffen. Im Planfeststellungsbeschluss vom 28.1.2005 wurden Belange des Denkmalschutzes zurückgestellt: „Das öffentliche Interesse des beantragten Vorhabens überwiegt nicht nur die Belange des Denkmalschutzes, sondern auch das städtebauliche Interesse an einem uneingeschränkten Erhalt der Gesamtanlagen.“[58] Sollte es keine technisch bessere Lösung geben,[59] so müssen die Seitenflügel weichen.
Abb. 9: Neuer Durchgangsbahnhof, Darstellung der unterschiedlichen Ebenen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: DB AG: Visualisierung in: http://www.das-neue-herz-europas.de/ FCKEditor/upload/image/klein_HBf%20in%20Zukunft_DB(1).png Abrufdatum: 22.07.2009[60]
3. Baustellenlogistik: Die Baustellensituation in den nächsten Jahren führt zu erheblichen Behinderungen.
Viele Stuttgarter befürchten, dass es während der Bauphase zu großen Verkehrsproblemen in der Stuttgarter Innenstadt kommt und die Lebensqualität über Jahre beeinträchtigt würde. Gleiches wird beim Umbau des Bahnhofes an sich befürchtet. Bereits heute ist die Stuttgarter Innenstadt, gerade während der Hauptverkehrszeiten, stark überfüllt. Da während der Bauphase die wichtigen Verkehrsachsen Heilbronner Straße (B 27) und Willy-Brandt-Allee (B 14) von den Baumaßnahmen betroffen sind, werden hier größere Behinderungen erwartet. Durch intelligente Baulogistik wird versucht, die Behinderungen soweit wie möglich zu reduzieren.[61]
Abb. 10: Durch Baulogistik soll die Behinderung des Verkehrs minimiert werden
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Schuster, Wolfgang, Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm. Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen – Ulm, Stuttgart 2008, S. 117[62]
So ist geplant für den Erdaushub des Durchgangsbahnhofes und für das Gestein aus dem Tunnelbau eine Baulogistikstraße anzulegen. Über ein Förderband erfolgt der Abtransport zur Baulogistikstraße. Über dem Nordbahnhof erfolgt der Abtransport mit Güterzügen. Das Baumaterial wird ebenfalls über diesen Weg zur Baustelle gebracht, so dass die Straßen rund um den Hauptbahnhof kaum belastet würden.[63]
4. Mineralwasserquellen: Es werden mögliche Gefahren für das Mineralwasser gesehen.
Stuttgart hat nach Budapest mit täglich 44 Millionen Litern das zweitgrößte Mineralwasservorkommens in Europa. Diesen Mineralwasserschatz gilt es zu schützen.[64] Mehrere Gutachter bestätigten, dass die Mineralquellen sowohl während der Bauzeit als auch auf Dauer nicht gefährdet seien. Vorsorgliche Schutzmaßnahmen wurden im Planfeststellungsverfahren verbindlich festgelegt.[65]
Abb. 11: Mineralwasserschichten unterhalb des Stuttgarter HBF
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Schuster, Wolfgang: Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm. Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen – Ulm, Stuttgart 2008, S. 115[66]
Aufgrund der Kessellage hat Stuttgart langjährige Erfahrungen mit dem Bau von Tunneln. Daher ist zu erwarten, dass auch hier die notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, damit das Mineralwasser geschützt bleibt.
5. Kostenexplosion: Ferner wird eine Kostenexplosion befürchtet.
Das wichtigste Argument bei Großprojekten ist immer die Gefahr der Kostenexplosion. Anfängliche Kostenschätzungen lassen sich meist erst im Projektverlauf konkretisieren. Ausschreibungen sind erst möglich, wenn die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen wurden. Gründe für Kostenänderungen liegen nach Erkenntnissen der Bundesregierung in den „Anpassungen aufgrund von Auflagen aus den Planfeststellungsbeschlüssen, Qualifizierung der Veranschlagung durch vertiefte Planung, Wirkung der allgemeinen Baupreissteigerungen und neue technisch anspruchsvolle Bauverfahren.“[67]
Eine große Befürchtung der Projektgegner ist, dass das Geld der Stadt Stuttgart einseitig in diesem Großprojekt[68] gebunden wird und dafür weniger prestigeträchtige Projekte nachrangig behandelt werden bzw. gar nicht realisiert werden.
Die Anhänger der Gegenbewegung beauftragten die Vieregg-Rößler GmbH mit der Kostenschätzung,[69] Deren Kostenschätzung zum Münchner Transrapid-Projekt hatte mit dazu beigetragen, dass das Projekt (Investitionsvolumen ca. 2,00 Mrd. €) nicht realisiert wird. Diese versuchten anhand von mehreren Verfahren nachzuweisen, dass die angegebenen Kosten für das Projekt Stuttgart 21 sich von 2,80 Mrd. € auf 5,60 Mrd. € verdoppeln werden. So wurde beispielsweise angeführt, dass sich die Kosten bei der ICE-Strecken Köln – Frankfurt sowie Nürnberg – Ingolstadt von dessen Planung im Jahr 1992 bis zur Fertigstellung ebenfalls verdoppelt hätten.[70]
Bei der Finanzierungsvereinbarung im April 2009 gingen die Projektbeteiligten von modifizierten Kosten für Stuttgart 21 in Höhe von 3,08 Mrd. € (ohne NBS Wendlingen – Ulm) aus. Die Verteilung sieht wie folgt aus:
- Deutsche Bahn AG: 1.300,80 Mio. €
- Bund: 1.165,60 Mio. €
- Land: 370,20 Milo. €
- Verband Region Stuttgart: 100,00 Mio. €
- Flughafen Stuttgart: 107,80 Mio. €
- Landeshauptstadt Stuttgart: 31,60 Mio. €
Dabei muss beachtet werden, dass Stuttgart neben dem direkten Anteil in Höhe von 31,60 Mio. € bereits 459,00 Mio. € an die Deutsche Bahn AG geleistet hat.[71] Davon 424,40 Mio. €[72] für die nach Abbau der Gleisanlagen freiwerdenden Grundstücke A2, A3, B, C und D mit 117,7 Hektar (Kaufpreisfälligkeit 31.12.2001). Deren Verwertung kann allerdings zum Großteil erst nach Fertigstellung erfolgen,[73] so dass hier mit kalkulatorischen Zwischenfinanzierungskosten gerechnet werden muss. Ferner ist die Stadt Stuttgart zu 35 % am Flughafen Stuttgart beteiligt.[74] Daher trifft dessen Beitrag indirekt auch die Stadt Stuttgart.
Direkt ist die Stadt Stuttgart mit ca. 1 % an den Projektkosten beteiligt. Die Risikobeteiligung bei Kostenüberschreitung liegt für die Stadt bei maximal 131,00 Mio. €. Bereits 2007 bildete die Stadt aus Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer eine Rücklage in Höhe von 162,00 Mio. €. Somit ist das Projekt durch die Stadt Stuttgart finanziert. Durch den Erwerb der freiwerdenden Gleisanlagen vereinfachen sich für die Stadt Stuttgart die Abstimmungsprozesse. Nach Erschließung der Flächen dürfte die Stadt einen wesentlich höheren Betrag einnehmen, als sie an die Bahn geleistet hat. Zusätzlich wird sie von den Investitionen in diese Grundstücke profitieren.
Ein höheres Risiko tragen Bund, Land und Bahn. Diese haben sich verpflichtet insgesamt bis zu 1,45 Mrd. € (Risikovorsorge) zusätzlich zu leisten.[75] Der Bundesrechnungshof geht im Worst Case – aufgrund des hohen Tunnelanteils sowie des hohen Kupfer- und Stahlanteils – sogar von Kosten in Höhe von 5,30 Mrd. € aus.[76] Da das Projekt von der EU gefördert wird, verringert sich noch der tatsächliche Beitrag vom Bund für die gesamte Strecke Stuttgart – Ulm.
Einerseits freuen sich die Projektgegner darüber, dass sie das Projekt durch ihre juristischen Aktionen verzögern konnten und führen anderseits die durch die Verzögerungen entstanden Mehrkosten als weiteren „Dealbreaker“ auf.[77]
Sollte das Projekt tatsächlich nicht realisiert werden, gehen Stuttgart allein projektbezogene Investitionen in Höhe von ca. 3,00 Mrd. € verloren, da die Beiträge der Partner zweckgebunden waren. Ferner müssten 15 Jahre Planungsarbeit abgeschrieben werden. Zusätzlich fallen Immobilieninvestitionen im Milliardenbereich weg. In Zeiten der aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise für die nächsten Jahre erwarteten sinkenden Gewerbesteuereinnahmen würde ein Scheitern des Projektes die Lage im Land weiter verschlechtern. Für das Jahr 2009 erwartet das Statistische Landesamt für Baden-Württemberg ein negatives Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in Höhe von minus 8 %. Damit befindet sich das Land akut in der schlimmsten Wirtschaftskrise seiner Geschichte.[78] Somit kann Stuttgart 21 als ein „Konjunkturprogramm für die ganze Region“[79] gesehen werden.
6. Kopfbahnhof K21: Das Alternativkonzept Kopfbahnhof K21 sei insgesamt wesentlich besser.
Seitens der Projektgegner wird als Alternative von Stuttgart 21 angeführt, dass der bisherige Kopfbahnhof saniert werden könnte. Dies wäre einerseits kostengünstiger, andererseits würde es zu ähnlichen Fahrzeitverkürzungen wie bei Stuttgart 21 kommen. Dazu wurde seitens Klaus Arnoldi ein Alternativkonzept vorgelegt mit dem Namen Kopfbahnhof K21. Beim bestehenden Bahnhof sollten die Bahnanlagen im Dreieck Nordbahnhof, Hauptbahnhof und Bad Cannstatt modernisiert werden und die Anbindung an den Flughafen über das regionale Schienennetz erfolgen.[80]
Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim stellt in seinem Urteil vom April 2006 fest: „Der Senat hält es für zweifelhaft, dass K21 überhaupt eine Alternative zu S21 ist.“ K21 impliziert die Sanierung des bestehenden Kopfbahnhofes, die Generalsanierung des Gleisfeldes und der bestehenden Tunnel sowie den Bau weiterer Gleise bis zum Neckar und einer neuen Neckarbrücke. Ferner müsste eine neue Hochgeschwindigkeitstrasse durch Bad Cannstatt, Untertürkheim und Obertürkheim bis Wendlingen erfolgen.[81] Als wesentlicher Nachteil wird am K21-Konzept gesehen, dass eine städtebauliche Entwicklung nur begrenzt möglich sei. So wären keine Erweiterungen des Rosensteinparks und des Schlossgartens möglich. Ferner fehlen für das K21-Projekt die Finanzierungsmittel.[82]
7. Kommunikation des Projektes Stuttgart 21 in der Öffentlichkeit
Ferner wurde in der Öffentlichkeit angeführt, dass das Projekt Stuttgart 21 der Bevölkerung schlecht kommuniziert wurde.
Die Bahn und die Stadt haben bereits vor einigen Jahren am Stuttgarter HBF eine Ausstellung im TurmForum Stuttgart 21 etabliert.[83] Regelmäßig finden hier Führungen und Rundfahrten zu Stuttgart 21 statt.[84] Seit einigen Monaten befindet sich im Stuttgarter Rathaus eine Ausstellung zum Projekt. In der Stuttgarter Presse wird das Projekt seit Jahren kontrovers diskutiert. Regelmäßig finden Veranstaltungen zum Thema statt. So wurde beispielsweise der Architekt Ingenhoven am 30.6.2009 von den Stuttgarter Nachrichten zur Podiumsdiskussion eingeladen.[85]
Obwohl eine Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten angeboten wird, fühlen sich viele Stuttgarter nicht ausreichend über das Projekt informiert und lehnen es daher ab. Um die Aufklärungs- und Informationsarbeit zu verstärken hat Rüdiger Grube, neuer Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG zusammen mit Ministerpräsident Günther H. Oettinger (CDU) am 24.7.2009 verkündet, dass der baden-württembergische Landtags-Vizepräsident Wolfgang Drexler (SPD) künftig als ehrenamtlicher Sprecher und „Botschafter Stuttgart 21“ (Mister Stuttgart 21) das Bahnprojekt Stuttgart 21 vertreten wird.[86] Zusätzlich wird seitens der Landeshauptstadt Stuttgart ein Ombudsmann für die Bürger eingesetzt.
3.2 Projektbefürworter
Ein Großprojekt kann nur dann gelingen, solange ein „Projektfenster“ offen ist, bei dem die wesentlichen Rahmenbedingungen zueinander passen.[87] Zu Beginn des Projektes sprach man von „Schwaben-Connection“, die das Projekt Mitte der neunziger Jahre auf den Weg brachte. Die Hauptakteure, Manfred Rommel (Stuttgarter Oberbürgermeister), Erwin Teufel (Ministerpräsident Baden-Württemberg), Matthias Wissmann (Bundesverkehrsminister) und Heinz Dürr (Deutsche Bahn Vorstandsvorsitzender) waren alle sehr eng mit der Region Stuttgart verbunden. Unter den Kommunalpolitikern gab es 1994 eine große Zustimmung für das „Jahrhundertprojekt“.[88]
Ähnlich wie bei den Projektgegnern, hat sich auf der Befürworterseite auch eine ganze Reihe von Gruppierungen gebildet. Meist haben deren Initiatoren einen politischen oder einen wirtschaftlichen Hintergrund.
Die Arbeitsgruppe „Stuttgart21 – Ja bitte!“ beispielsweise beantwortet die Frage nach der Notwendigkeit von Stuttgart 21 anhand der Bereiche 1) Vorteile für Städtebau und Landschaft, 2) besseres Verkehrsangebot auf der Schiene und 3) der zukünftige Hauptbahnhof. Die Argumente wurden in die Anlage 4 übernommen.[89] Der Verein „ProStuttgart21“ setzt sich in der Öffentlichkeit mit bekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport für das Projekt Stuttgart 21 ein.[90] Die Deutsche Bahn AG und die Stadt Stuttgart haben „21 gute Gründe für Stuttgart 21“ gefunden, die in der Anlage 5 aufgeführt werden.[91]
In der Bundesrepublik Deutschland müssen die öffentlichen Körperschaften Wirtschaftlichkeitsberechnungen[92] erstellen, bevor einzelne Maßnahmen beschlossen werden können. Hier sollen im Rahmen von Kosten-Nutzen-Analysen die Kosten im Verhältnis zum Nutzen errechnet werden.[93] Der Quotient aus Nutzen und Kosten muss positiv sein, d. h. größer 1 um zu erkennen, ob eine Maßnahme wirtschaftlich ist.
Der volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Faktor wurde 1999 für das Gesamtprojekt (Stuttgart 21 und NBS Wendlingen-Ulm) ohne städtebauliche Vorhaben nach Berechnungen der Deutschen Bahn AG mit 2,7 angegeben.[94] Im Synergiekonzept Stuttgart 21 wurde im Jahre 1995 aufgrund der Berechnung des verkehrswissenschaftlichen Institutes an der Universität Stuttgart der Nutzen-Kosten-Quotient mit 2,6 angegeben. Dies entsprach einem volkswirtschaftlichen Nutzen in Höhe von 314 Mio. DM pro Jahr. Die Berechnung konnte nicht eingesehen werden. Dennoch handelt es sich um einen positiven Wert.[95] Somit können die Befürworter den volkswirtschaftlichen Nutzen des Gesamtprojektes herausstellen.
Das Innenministerium von Baden-Württemberg hat ein Gutachten über die „Volkswirtschaftliche Bedeutung des Projekts Baden-Württemberg 21“ durch die Institute IWW (Karlsruhe), SFR (Wien) und VWI (Stuttgart) erstellen lassen. Danach wurde festgestellt, dass durch das Gesamtprojekt ca. 1 Mrd. Pkw-km je Jahr eingespart werden können. Demnach werden sich die CO2-Emissionen um 177 Tonnen jährlich reduzieren. Ferner werden in dem Gutachten positive Effekte innerhalb der Bauzeit sowie Dauereffekte nach Fertigstellung durch die verbesserte Erreichbarkeit ausgemacht. Die Städtebauprojekte und die Beschäftigungseffekte werden sehr positiv gesehen.[96]
Die Amortisationszeit der öffentlichen Investitionen des Landes Baden-Württemberg wurde bei einer statischen Betrachtung (ohne Zinsen) mit 13 Jahren berechnet. Bei einer dynamischen Betrachtung unter Berücksichtigung von Zinsen in Höhe von 3,5 % p.a. beträgt die Amortisationszeit 20 Jahre. Das bedeutet, dass innerhalb von 20 Jahren die öffentlich investierten Gelder an das Land zurückfließen. Damit ist die Amortisationszeit im Vergleich zu anderen internationalen Großprojekten vergleichsweise niedrig.[97]
Zwischenfazit: Das „Projektfenster“ Stuttgart 21 hat sich durch die Finanzierungsvereinbarung vom April 2009[98] geöffnet: „Die Zeit ist reif!“ stellte der Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner fest.[99] Die Planungen sind weitgehend abgeschlossen, 2010 kann der Baubeginn erfolgen. Den Hauptnutzen werden hier die heranwachsenden Generationen haben. Während der knapp zehnjährigen Bauzeit werden die Stuttgarter mit Einschränkungen umgehen müssen. Bis alle freiwerdenden Flächen einer neuen Nutzung übergeben sind, werden 20 Jahre vergehen. Dennoch werden mehrere Generationen von dem „Jahrhundertprojekt“ profitieren können.
Der Geschwindigkeitsvorteil für Bahnreisende in Deutschland und Europa ist enorm. München wird von Stuttgart in 1 h 35 Minuten (heute 2 h 18 Minuten) erreichbar sein, Wien in 4 h 50 Minuten. Für die Strecke von Stuttgart nach Paris werden nur noch 3 h 10 Minuten benötigt. Die Bahn wird Marktanteile gewinnen, der Flug- und Autoverkehr werden Marktanteile verlieren.
Abb. 12: Geplante Verbesserungen der Reisezeiten der Bahn
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Deutsche Bahn AG, Ideen umsetzen, Menschen verbinden, Perspektiven schaffen – Bahnprojekt Stuttgart – Ulm, München 2009, S. 18[100]
Unter Abwägung aller Interessen und Belange hat die Realisierung des Projektes deutliche Vorteile für den Standort Stuttgart sowie für die Region und das Land. Die Projektdurchführung wird für die Menschen in Europa, Deutschland, Baden-Württemberg und Stuttgart weitreichende Verbesserungen bringen. Und das über Generationen.
4 Umfrage zu Stuttgart 21 innerhalb der Stuttgarter Immobilienwirtschaft
In den letzten Jahren gab es mehrere Umfragen zum Projekt Stuttgart 21. So wurde beispielsweise im März 2008 seitens der Universität Stuttgart die „Akzeptanzstudie Stuttgart 21 - Die Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger“ im Auftrag der Stuttgarter Nachrichten erstellt. Der Studie nach halten sich die Befürworter und Gegner die Waage.[101] So wurden von den Befragten die Folgen für den Wirtschaftsstandort Stuttgart, Veränderungen im Fern- und Regionalverkehr sowie die Gestaltung neuer Stadtteile überwiegend als positiv angesehen. Negativ wurden die Folgen für die Umwelt sowie die Finanzierung von Stuttgart 21 empfunden.[102]
Aus der Bürgerumfrage 2009 des Statistischen Amtes der Landeshauptstadt Stuttgart geht hervor, dass die Zustimmung zum Projekt Stuttgart 21 tendenziell eher gesunken ist. Hier gab es allerdings alterspezifische Unterschiede. So hatten in den Altersgruppen 18 bis unter 25 sowie 25 bis unter 35 eine schlechte bzw. sehr schlechte Meinung 39 bzw. 36 %. Die größte Ablehnung gab es in der Altersgruppe 45 bis unter 55. Hier hatten 56 % eine schlechte bzw. sehr schlechte Meinung (Mittelwert 47). Auch gab es Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Probanten. Während 51 % der weiblichen Befragten eine schlechte bzw. sehr schlechte Meinung vom Projekt hatten, waren es bei den Männern nur 44 %.[103]
4.1 Methodik
Für diese Arbeit wurden circa 500 Personen aus der Immobilienwirtschaft der Region Stuttgart gebeten, an einer Fragebogenaktion (siehe Anlage 6) teilzunehmen. Die Umfrage wurde zwischen dem 8.7.2009 und 24.7.2009 durchgeführt. Per Email wurden Mitglieder der Royal Institution of Chartered Surveyors Regionalgruppe Stuttgart (RICS RG Stuttgart) sowie des Vereins Immobilienwirtschaft Stuttgart e.V. - Verband für die Metropolregion Stuttgart (IWS e.V.) kontaktiert und gebeten, den Fragebogen zu beantworten. Ferner wurde der Fragebogen beim Stuttgarter Immobiliendialog am 14.7.2009 im Stuttgarter Rathaus ausgelegt sowie bei einer Gemeinschaftsveranstaltung der RICS Regionalgruppe Stuttgart und des IWS am 21.7.2009 bei der Industrie- und Handelskammer der Region Stuttgart. Insgesamt wurden 700 Bögen[104] versandt bzw. verteilt. Da hier teilweise Mehrfachmitgliedschaften vorlagen, mussten die Zahlen bereinigt werden, so dass von 500 angesprochenen Kontakten aus der Immobilienwirtschaft aus der Region Stuttgart auszugehen ist. Ein Drittel (166 Stück) der Befragten haben den Fragebogen ausgefüllt und rechtzeitig eingereicht. Dies ist ein sehr hoher Rücklauf bei Fragebogenaktionen. Die 500 angesprochenen Kontakte dürften mehr als 50 % der Stuttgarter Immobilienwirtschaft vertreten. Daher können die Ergebnisse als sehr repräsentativ für die Immobilienwirtschaft in der Region Stuttgart angesehen werden. Zu Beginn des Fragebogens wurde der Erhebungszweck erläutert und das Projekt kurz vorgestellt. Insgesamt gab es 16 Fragen. Die Auswertung erfolgte anonym.
[...]
[1] Vgl. http://www.stuttgart.de/item/show/357112, Abrufdatum: 07.12.2009
[2] Vgl. Isenberg, Michael: Stuttgart-21-Verträge sind bereits unkündbar in: http://www.stuttgarter- nachrichten.de/stn/page/2048856_0_9223_-die-wichtigsten-antworten-stuttgart-21-vertraege-sind-bereits-unkuendbar.html, Erscheinungsdatum: 08.06.2009, Abrufdatum: 22.07.2009
[3] Vgl. Deutsche Bahn (Hrsg.): Eisenbahnatlas Deutschland – Ausgabe 2009/2009, Schweers + Wall, Belgien 2009, S. 239
[4] Vgl. http://www.euractiv.com/de/verkehr/ten-v-aufbau-transeuropischen-verkehrsnetzes/article-157380, Abrufdatum: 12.07.2009
[5] Vgl. Grünbuch der Kommission der Europäischen Gemeinschaften TEN-V: Überprüfung der Politik - ein besser integriertes transeuropäisches Verkehrsnetz im Dienst der gemeinsamen Verkehrspolitik KOM, Luxemburg 2009
[6] Karel Van Miert ist am 22.06.2009 verstorben in: Arbeitskreis Initiative „Magistrale für Europa“, Initiative aktuell Nr. 9 –August 2009, Karlsruhe 2009, S. 1
[7] Vgl. European Commission: Trans-European Transport Network – TEN-T priority axes and projects 2005, Luxembourg 2005
[8] Vgl. http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/30_priority_projects, Abrufdatum: 13.07.2009
[9] Vgl. Stuppert, Sabine: Deutscher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste – Aktueller Begriff „Das Transeuropäische Verkehrsnetz (VEN-V), Berlin 2006, in: http://www.bundestag.de/wissen/analysen/ 2006/Das_Transeuropaeische_Verkehrsnetz__TEN-V_.pdf, Abrufdatum: 13.07.2009
[10] Vgl. http://www.mfa.gov.hu/kum/en/bal/, Abrufdatum: 12.07.2009
[11] Vgl. Balázs, Péter: Priority Project No. 17 „Rail link: Paris – Strasbourg – Stuttgart – Vienna – Bratislava“ – Annual Report 2006-2007, Brüssel 2007
[12] Vgl. Balázs, Péter Vorrangiges Vorhaben Nr. 17 „Eisenbahnachse Paris – Straßburg – Stuttgart – Wien – Bratislava“, Jahresbericht des Europäischen Koordinators, Brüssel 2006
[13] Vgl. http://www.magistrale.org, Abrufdatum: 31.07.2009
[14] Vgl. Balázs, Péter: Vorrangiges Vorhaben Nr. 17 „Eisenbahnverbindung Paris – Straßburg – Stuttgart – Wien – Bratislava“, Jährlicher Tätigkeitsbericht, Brüssel 2008
[15] Vgl. http://www.deutschland-frankreich.diplo.de/Hochgeschwindigkeitsverbindung-TGV,1279.html, Abrufdatum: 13.07.2009
[16] Vgl. Martin, Egon: Magistrale für Europa, Initiative aktuell Nr. 8, Karlsruhe 2009, S. 2
[17] Vgl. http://zserver.neu-ulm.de/web/html/content.htm?theme=projekte&sub=3, Abrufdatum: 13.07.2009
[18] Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_M%C3%BCnchen-Pasing, Abrufdatum: 13.07.2009
[19] Vgl. http://www.baudoku.at/dt/portal/content.php?navId=910&language=dt,, Abrufdatum: 13.07.2009
[20] Vgl. http://www.oebb.at/bau/de/Projekte_Planung_und_Bau/Grossraum_Wien/
Umbau_Wien_Westbahnhof/ index.jsp, Abrufdatum: 13.07.2009
[21] Vgl. Balázs, Péter: Vorrangiges Vorhaben Nr. 17 „Eisenbahnverbindung Paris – Straßburg – Stuttgart – Wien – Bratislava“, Jährlicher Tätigkeitsbericht, Brüssel 2008, Seite 9
[22] Vgl. http://noe.orf.at/stories/219220, Abrufdatum: 13.07.2009
[23] Vgl. Balázs, Péter: Vorrangiges Vorhaben Nr. 17 „Eisenbahnverbindung Paris – Straßburg – Stuttgart – Wien – Bratislava“, Jährlicher Tätigkeitsbericht, Brüssel 2008, S. 10
[24] Vgl. TEN-T EA - Trans-European Transport Network Executive Agency: New railway high speed line "LGV Est" Second phase: section Baudrecourt- Vendenheim, Brüssel 2009 in: http://tentea.ec.europa.eu/download/project_fiches/france/fichenew_2007fr17210p_final.pdf
[25] Vgl. Deutsche Bahn AG: Ideen umsetzen, Menschen verbinden, Perspektiven schaffen – Bahnprojekt Stuttgart – Ulm, München 2009, S. 3
[26] Vgl. Deutsche Bahn AG: Ideen umsetzen, Menschen verbinden, Perspektiven schaffen – Bahnprojekt Stuttgart – Ulm, München 2009, S. 5
[27] Heimerl, Gerhard: Stadtentwicklungsimpulse durch den Ausbau der europäischen Eisenbahnmagistralen: Stuttgart 21 - Zukunftsinvestition für den Bahnknoten Stuttgart, Stuttgart 2002 in http://www.oevg.at/archiv/veranstaltungen/20020616bregenz/56heimerl.htm
[28] Vgl. Ostertag, Roland (Hrsg.): Die entzauberte Stadt, Stuttgart 2008, S. 13
[29] Vgl. Wolf, Winfried: „Stuttgart 21“ - Hauptbahnhof im Untergrund? Köln 1995, S. 8
[30] Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart: Stuttgart 21 – Entwürfe für die neue Stadt, Stuttgart 1996, S. 4
[31] Vgl. Deutsche Bahn AG: Projekt „Stuttgart 21“ – Die Machbarkeitsstudie, Stuttgart 1995, S. 3, 40
[32] Vgl. Deutsche Bahn AG: Projekt „Stuttgart 21“ – Die Machbarkeitsstudie, Stuttgart 1995, S. 39, 40
[33] Heimerl, Gerhard: Stadtentwicklungsimpulse durch den Ausbau der europäischen Eisenbahnmagistralen: Stuttgart 21 - Zukunftsinvestition für den Bahnknoten Stuttgart, Stuttgart 2002 in: http://www.oevg.at/archiv/veranstaltungen/20020616bregenz/56heimerl.htm
[34] Vgl. Deutsche Bahn AG: Projekt „Stuttgart 21“ – Die Machbarkeitsstudie, Stuttgart 1995, S. 38
[35] Vgl. Deutsche Bahn AG: Das Synergiekonzept Stuttgart 21 – Die Ergebnisse des Vorprojektes, Stuttgart 1995, S. 1, 38
[36] Vgl. Ostertag, Roland (Hrsg.): Die entzauberte Stadt, Stuttgart 2008, S. 14f
[37] Vgl. Stadt Stuttgart: Stuttgart 21 – Entwürfe für die neue Stadt, Stuttgart 1996,S. 16, S. 20 ff.
[38] Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart: Stadtplanungsamt: Rahmenplan Stuttgart 21 vom 24.7.1997, Stuttgart 1997, S. 13
[39] Schuster, Wolfgang: Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm. Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen – Ulm, Stuttgart 2008, S. 35
[40] Vgl. Ostertag, Roland (Hrsg.): Die entzauberte Stadt, Stuttgart 2008, S. 14f.
[41] Schuster, Wolfgang: Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm. Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen – Ulm,. Stuttgart 2008, S. 23
[42] Vgl. Deutsche Bahn AG: Ideen umsetzen, Menschen verbinden, Perspektiven schaffen – Bahnprojekt Stuttgart – Ulm, München 2009, S. 3
[43] Vgl. Deutsche Bahn AG: Ideen umsetzen, Menschen verbinden, Perspektiven schaffen – Bahnprojekt Stuttgart – Ulm, München 2009, S. 14
[44] Vgl. Ostertag, Roland (Hrsg.): Die entzauberte Stadt, Stuttgart 2008, S. 10
[45] Vgl. Schuster, Wolfgang: Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm. Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen – Ulm, Stuttgart 2008, S. 100, 105
[46] Vgl. Palmer, Boris: Die letzte Ausfahrt vor dem Tunnel: Stuttgart 21, der Bürgerentscheid und die Oberbürgermeisterwahl im Herbst 2004 in: Ostertag, R. (Hrsg.): Die entzauberte Stadt, Stuttgart 2008,
S. 71
[47] Vgl. Dolde und Partner: Gutachterliche Stellungnahme zum Bürgerbegehren gegen Stuttgart 21, Stuttgart 2007
[48] Einwohnerzahl Stuttgart: 591.762 am 30.6.2009, http://www.stuttgart.de/item/show/55064 Abrufdatum: 24.08.2009
[49] Vgl. Pfeiffer, Gerhard: Chronik des Widerstands gegen Stuttgart 21, S. 206 in: Ostertag, Hans (Hrsg.): Die entzauberte Stadt, Stuttgart 2008
[50] Vgl. Dolde und Partner: Gutachterliche Stellungnahme zum Bürgerbegehren gegen Stuttgart 21, Stuttgart 2007
[51] Vgl. Knemeyer, Franz-Ludwig: Stuttgart 21 – Bürgerbegehren unzulässig, Würzburg 2007
[52] Borgmann, Thomas: Alter Bürgerentscheid ist jetzt vom Tisch, Stuttgarter Zeitung vom 18.07.2009, S. 21
[53] Wörner, Achim: „Wir sollten den Hauptbahnhof nicht verklären“, Stuttgarter Zeitung am 15.10.2008
[54] Lederer, Arno: Stuttgart 21 - Architekt aus dem Preisgericht übt Kritik, Stuttgarter Zeitung, 16.07.2008 in: http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/2063401?lastupdate=2009-06-17_15:19:24, Abrufdatum: 14.08.2008
[55] Vgl. Nauke, Jörg: Bahnhof darf kein Torso werden, Stuttgarter Zeitung, 01.10.2008
[56] Villani, Cornelia: Architekt des neuen Hauptbahnhofes über Kosten, das Ergebnis der Gemeinderatswahl und die Flügel des Bonatzbaus, Stuttgarter Amtsblatt 02.07.2009
[57] http://www.stuttgart-tourist.de/DEU/ipunkt/anreise_bahn.htm
[58] Ostertag, Roland: Denkmalschutz und Stuttgart 21, Was ist die Stuttgarter Denkart?, Stuttgarter Nachrichten 2008-08-15, http://www.stuttgarterzeitung.de/stn/page/detail.php/1789197/r_article_print, Abrufdatum: 22.07.2009
[59] Vgl. Lederer, Arno: Stuttgart 21 - Architekt aus dem Preisgericht übt Kritik, Stuttgarter Zeitung, 2008-07-16 in: http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/2063401?lastupdate=2009-06-17_15:19:24, Abrufdatum: 22.07.2009
[60] Vgl. http://www.das-neue-herz-europas.de/FCKEditor/upload/image/klein_HBf%20in%20Zukunft_ DB(1).png, Abrufdatum: 22.07.2009
[61] Vgl. http://www.das-neue-herz-europas.de/FCKEditor/upload/image/klein_HBf%20in%20 Zukunft_DB(1).png, Abrufdatum: 22.07.2009
[62] Vgl. Schuster, Wolfgang: Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm. Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen – Ulm, Stuttgart 2008, S. 117
[63] Vgl. Schuster, Wolfgang: Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm. Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen – Ulm, Stuttgart 2008, S. 118
[64] Vgl. Kur- und Bäderamt Stuttgart: Das Stuttgarter Mineralwasser – Herkunft und Entstehung in: http://www5.stuttgart.de/baeder/mdb/item/187533/8852.pdf, Abrufdatum: 23.07.2009
[65] Vgl. Schuster, Wolfgang: Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm. Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen – Ulm, Stuttgart 2008, S. 115
[66] Vgl. Schuster, Wolfgang: Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm. Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen – Ulm, Stuttgart 2008, S. 115
[67] Bundesregierung: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage – Drucksache 16/10135 – Kosten des Bahnprojektes Stuttgart 21, Berlin 16.09.2008, S. 7
[68] Vgl. Albers, Meike: Kulturelle Großprojekte im Quartier, Saarbrücken 2008, S. 9
[69] Vgl. Vieregg, Martin: Kosten des Projekts Stuttgart 21 in: Ostertag, Roland (Hrsg.): Die entzauberte Stadt, Stuttgart 2008, S. 101
[70] Vgl. Vieregg Rössler GmbH: Stuttgart 21: Kostenfalle? Konjunkturpaket? Kopfloses Großprojekt? Stuttgart 2009
[71] Vgl. Guratzsch, Dankwart: Stuttgart kauft sich eine Innenstadt, Die Welt vom 10.2.2002, http://www.welt.de/print-welt/article367704/Stuttgart_kauft_sich_eine_Innenstadt.html, Abrufdatum: 28.07.2009
[72] Vgl. Stuckenbrock, Uwe: Stuttgart 21 – Städtebauliche Perspektiven für das Stuttgart der Zukunft, Präsentation bei der IHK Region Stuttgart am 17.10.2007, Stuttgart 2007, S. 46.
[73] http://stuttgart.de/item/show/319022/1, Abrufdatum: 28.07.2009
[74] Seit dem 25.06.2008 ist die Stadt Stuttgart mit 35 % am Stuttgarter Flughafen beteiligt und das Land Baden-Württemberg mit 65 %. Vorher waren es je 50 % in: Flughafen Stuttgart, Geschäftsbericht 2008, Stuttgart 2009, S. 22
[75] Vgl. Landtag von Baden-Württemberg: Stellungsnahme des Innenministerium vom 26.4.2009, Nr. 77-3824.1-0/408.1 (Drucksache 14/4327) , Stuttgart 2009
[76] Vgl. Wirtschaftswoche: Großes Minusgeschäft, Ausgabe 30, 20.07.2009, S. 47, Köln 2009
[77] Vgl. Ostertag, Roland (Hrsg.): Die entzauberte Stadt, Stuttgart 2008, S. 10, 199
[78] Vgl. SWR: Bislang schwerste Wirtschaftskrise des Landes - Bruttoinlandsprodukt schrumpft um acht Prozent, Stuttgart 10.08.2009 in: http://www.swr.de/bw-aktuell/video-uebersicht/-/id=4836448/ did=5062908/pv=video/gp1=5232300/nid=4836448/1r5a99g/index.html, Abrufdatum: 17.08.2009
[79] Brenner, Peter: Immobilienbranche fordert: Stuttgart 21 muss kommen – IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart betont Chancen für die Stadtentwicklung in: Unterreiner, Frank Peter (Hrsg.): Immobilienbrief Stuttgart, Ausgabe 36, 23.06.2009, Stuttgart 2009, S. 9
[80] Vgl. Arnoldi, Klaus: Kein Museumsstück, in: Ostertag, Roland (Hrsg.): Die entzauberte Stadt, Stuttgart 2008, S. 78
[81] Vgl. Schuster, Wolfgang: Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm. Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen – Ulm, Stuttgart 2008, S. 54, 65
[82] Vgl. Weeber, Rudolf: Ist der von den Gegnern von Stuttgart 21 vorgeschlagene „Kopfbahnhof 21“ eine vernünftige Alternative? in: http://www.stuttgart21-ja-bitte.de/k21, Abrufdatum: 24.07.2009
[83] Vgl. TurmForum Stuttgart 21 e.V.: TurmForum Bahnprojekt Stuttgart – Ulm, Das Informationszentrum zum Bahnprojekt Stuttgart – Ulm im Bahnhofsturm, Stuttgart 2008, S. 5
[84] Vgl. Stuttgart-Marketing GmbH: Stuttgart baut, Heft 6, Stuttgart 2008, Seite 1, 10
[85] Vgl. Isenberg, Michael: Forum Stuttgart 21 - Der Bahnhof als verheißungsvoller Ort, Stuttgarter Nachrichten, 30.06.2009 in: http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2110189_0_9223_-forum-stuttgart-21-der-bahnhof-als-verheissungsvoller-ort.html, Abrufdatum: 23.07.2009
[86] Vgl. SWR: Drexler wird Stuttgart-21-Beauftragter, Stuttgart 24.07.2009 in: http://www.swr.de/ nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=5167924/19350op/#Drucken, Abrufdatum: 24.07.2009
[87] Vgl. Stuttgarter Nachrichten: Gönner setzt auf Stuttgart 21, Stuttgart 20.07.2009 in: http:// www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2132989/r_article_print, Abrufdatum: 10.08.2009
[88] Vgl. Stuttgarter Zeitung: Kommunalpolitiker zu den Plänen der Deutschen Bahn AG: Vielstimmiger Jubel für das „Jahrhundertprojekt“, Stuttgart 19.04.1994
[89] Vgl. Arbeitsgruppe Stuttgart21-ja-bitte in: http://stuttgart21-ja-bitte.de/gewichtige-gruende-fuer-stuttgart-21, Abrufdatum: 24.07.2009
[90] Vgl. ProStuttgart21: Für Stuttgart 21, Stuttgart in: http://www.prostuttgart21.de/start, Abrufdatum: 24.07.2009
[91] Vgl. TURMFORUM Bahnprojekt Stuttgart–Ulm e. V.: 21 gute Gründe für Stuttgart 21 in: http://www.das-neue-herz-europas.de/ueberblick/21gruende/default.aspx , Abrufdatum: 24.07.2009
[92] Vgl. § 7 Bundeshaushaltsordnung
[93] Vgl. Wikipedia: Kosten-Nutzen-Analyse in: http://de.wikipedia.org/wiki/Kosten-Nutzen-Analyse, Abrufdatum: 16.08.2009
[94] Vgl. Landtag von Baden-Württemberg: Stuttgart 21 – Bedeutung und Finanzierbarkeit des Projekts, Drucksache 12 / 4061 vom 19. 05. 99, in: http://www.landtag-bw.de/wp12/drucksachen/4000/12_4061_d.pdf, Abrufdatum: 16.08.2009
[95] Vgl. Deutsche Bahn AG: Das Synergiekonzept Stuttgart 21 – Die Ergebnisse des Vorprojekts, Stuttgart 1995, S. 38
[96] Vgl. IWW, SRF, VWI: Volkswirtschaftliche Bewertung des Projektes Baden-Württemberg (BW) 21 – Endbericht, Karlsruhe/Wien/Stuttgart 2009, S. 99.
[97] Vgl. IWW, SRF, VWI: Volkswirtschaftliche Bewertung des Projektes Baden-Württemberg (BW) 21 – Endbericht, Karlsruhe/Wien/Stuttgart 2009, S. 93 f.
[98] Vor der Finanzierungsvereinbarung gab es das Memorandum of Understanding vom 19.7.2007 „zur Realisierung der Neubaustrecke Stuttgart – Ulm und des Projekts Stuttgart 21“
[99] Stuttgarter Nachrichten: Gönner setzt auf Stuttgart 21, Stuttgart 20.07.2009 in: http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2132989/r_article_print, Abrufdatum: 10.08.2009
[100] Vgl. Deutsche Bahn AG: Ideen umsetzen, Menschen verbinden, Perspektiven schaffen – Bahnprojekt Stuttgart – Ulm, München 2009, S. 18
[101] Vgl. Stuttgarter Nachrichten: Die Umfrage im Detail, Stuttgart 29.10.2008 in: http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1684410_0_2147_pdf-download-die-umfrage-im-detail.html, Abrufdatum: 10.08.2009
[102] Vgl. Universität Stuttgart, Institut für Sozialwissenschaften 1: Akzeptanzstudie Stuttgart 21 – Die Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger, Stuttgart 2008, S. 28
[103] Vgl. Stuttgarter Zeitung: Mehr Bürger gegen Stuttgart 21, Stuttgart 12.08.2009, in: http://www.stuttgarter-zeitung.de/media_fast/1203/stuttgart21.pdf, Tabelle 3
[104] Die Mitglieder des Immobilienverband Deutschland Süd (IVD Süd e.V.) aus dem PLZ-Gebieten 70173-73765 wurden durch den IVD per Email kontaktiert. Da von den ca. 250 Angeschriebenen nur ein Teilnehmer innerhalb der gesetzten Frist den ausgefüllten Fragebogen einreichte, wurde hier auf die weitere Auswertung verzichtet.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783842813571
- DOI
- 10.3239/9783842813571
- Dateigröße
- 9.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Regensburg – Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, IREBS
- Erscheinungsdatum
- 2011 (April)
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- stuttgart städtebau bahn immobilienwirtschaft
- Produktsicherheit
- Diplom.de