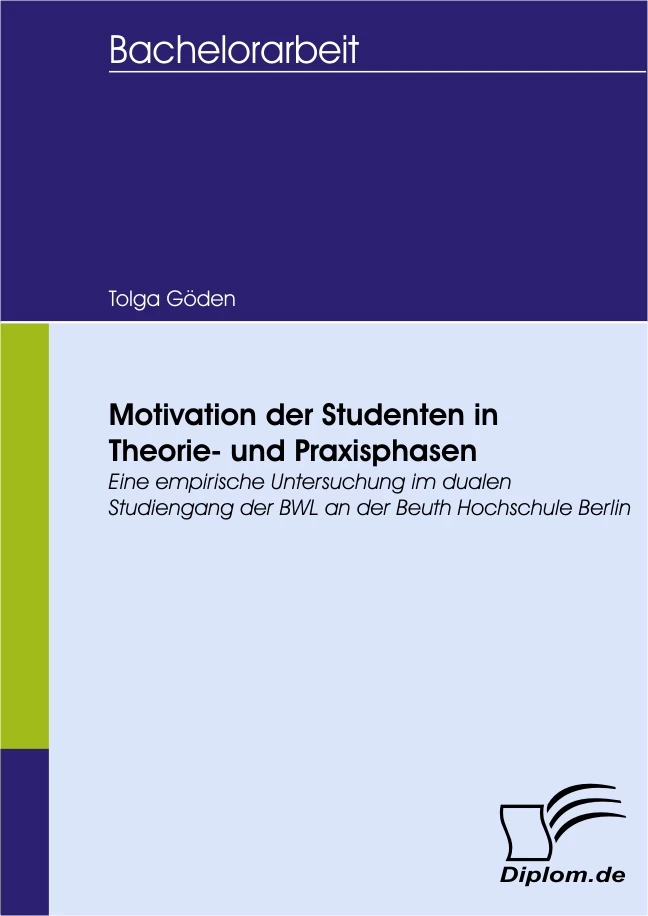Motivation der Studenten in Theorie- und Praxisphasen
Eine empirische Untersuchung im dualen Studiengang der BWL an der Beuth Hochschule Berlin
Zusammenfassung
Die deutschen Hochschulen sind als Forschungs- und Lehreinrichtungen in den letzten Jahren vermehrt der Kritik ausgesetzt. Von bildungspolitischer Seite wird gefordert, für Qualitätssicherung in Lehre und Forschung zu sorgen und nicht nur die Effizienz der Verwertbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse zu steigern, sondern auch die Studierenden in kürzester Zeit, fundiert ausgebildet, auf die berufliche Praxis vorzubereiten (Bachelorreform).
Als Maßnahmen laufen neben der Beurteilung der Forschung vor allem umfangreiche Evaluationsaktivitäten (CHE, HIS u. a. ), mit dem Ziel, die Lehrqualität zu optimieren sowie wissenschaftliches Personal leistungsbezogen zu entlohnen.
Ebenso hat die Wirtschaft ihre Anforderungen in Bezug auf künftiges Personal höher gestellt und fordert sowohl aus Wettbewerbs- als auch finanziellen Gründen, junge praxisnah ausgebildete und mit überfachlichen Qualifikationen versehene Absolventen, die sofort im Betrieb einsetzbar sind.
Doch die Realität sieht derzeitig oft anders aus. Sowohl Hochschuldozenten als auch Bachelorstudenten glauben laut Umfragen nicht an einen schnellen Übergang vom abgeschlossenen Bachelorstudium ins Arbeitsleben. So beschließen drei Viertel der Bachelorabsolventen, lieber weiterzustudieren als ins Berufsleben zu gehen. Darüber hinaus klagen Studenten während des Studiums häufig über überfüllte und praxisferne Lehrveranstaltungen. Die Bachelorstudiengänge beinhalten nun zudem viel Lehrstoff, welcher in kürzerer Zeit abgefertigt werden muss.
Außerdem können sich viele Studenten und Unternehmen mittlerweile unter den neu entstandenen englisch titulierten Studiengängen, Modulen und akademischen Graden (z. B. Bachelor of Science) kaum noch etwas vorstellen und sehnen sich nach den alten Bezeichnungen (Diplom etc.). Auch der simple Wechsel von einer Hochschule zur anderen kann sich mitunter als kompliziert erweisen, da eine Hochschule dasselbe Lehrmodul mit denselben Inhalten womöglich anders benannt hat und somit nicht anerkennt. Weitere Defizite an den augenscheinlich überforderten Hochschulen werden durch durchschnittlich hohe Studiumabbruchquoten bestätigt.
Diese Hochschulentwicklungen in der Bundesrepublik erfordern ein grundlegendes Umdenken in der bisherigen studien- und situationsbezogenen Evaluations- und Bewertungspraxis. Neben der reinen Studienzufriedenheit sollte auch die Studienmotivation von Studierenden in die Diskussionen mit einbezogen werden.
Im Übrigen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Fragestellung
1.2 Struktur und Ziel der Arbeit
2 Der duale Studiengang der Betriebswirtschaftslehre an der Beuth Hochschule für Technik Berlin
2.1 Kurzbeschreibung des BWL-Dual-Studiengangs
2.2 Inhalte der Theoriephasen des Studiengangs
2.3 Ausbildungsinhalte der betrieblichen Studienabschnitte
2.4 Allgemeine Kennzahlen zur deutschen Hochschullandschaft
2.4.1 Studienerfolg an deutschen Hochschulen
2.4.2 Studienabbruchquote in den Wirtschaftswissenschaften an Hochschulen
2.4.3 Spezifische Kennzahlen und Studienabbruchquoten im dualen Studiengang der BWL.
3 Theoretische Grundlagen zur Motivation
3.1 Historische Grundlagen–von „Platon zum Humankapital“
3.2 Das Grundmodell der Motivationspsychologie
3.3 Begriffsdefinitionen und Erläuterungen
3.3.1 Motiv und Anreiz
3.3.2 Motivation und Motivierung
3.4 Inhaltstheorien und Prozesstheorien der Motivationsforschung
3.4.1 Inhaltstheorien
3.4.2 Prozesstheorien der Motivationsforschung
3.4.3 Spezifische Motivationsausprägungen
4 Beschreibung der Datenerhebung an den Studierenden des dualen BWL-Studiengangs im Hinblick auf Theorie- und Praxisphasen
4.1 Hypothesen
4.2 Forschungsmethoden: quantitativ versus qualitativ
4.2.1 Quantitative Datenerhebungsmethoden
4.2.2 Vor- und Nachteile quantitativer Methoden
4.2.3 Qualitative Datenerhebungsmethoden
4.2.4 Vor- und Nachteile qualitativer Methoden
4.2.5 Gütekriterien empirischer Forschung
4.3 Auswahl der Forschungsmethode zur Datenerhebung
4.3.1 Funktion und Vorteile eines Online-Fragebogens
4.3.2 Voraussetzungen für eine Online-Befragung
4.3.3 Fragetypen des Online-Fragebogens
5 Durchführung, Vorstellung und Auswertung der empirischen Datenerhebung
5.1 Durchführung der Umfrage
5.2 Konstrukt der Befragung
5.3 Inhalt der Online-Umfrage
5.4 Vorstellung und Analyse der Ergebnisse
5.4.1 Ergebnisse der Befragung
5.4.2 Diskussion der Hypothesen
6 Fazit
7 Literaturverzeichnis
7.1 Gedrucktes
7.2 Internetquellen
7.3 Sonstige Quellen
8 Anhang
8.1 Fragebogen
8.2 Vollständig ausgewertete Fragebögen inklusive Antwortauszüge vom ersten und siebten Fachsemester
9 Eigenständigkeitserklärung
Abbildungsverzeichnis
Abb.2-1: Theorie- und Praxisphasen im dualen BWL-Studiengang
Abb.2-2:Studienabbruchgründe für die Wirtschaftswissenschaften an deutschen Fachhochschulen
Abb. 3-1: Grundmodell der "klassischen" Motivationspsychologie (Rheinberg, 2008)
Abb. 3-2:Die Maslow‘sche Bedürfnispyramide
Abb. 3-3:„Herzbergsche Einflussfaktoren“ auf die Arbeitseinstellung
Abb. 3-4: Risiko-Wahl-Modell nach Atkinson (1957)
Abb. 3-5: VIE-Theorie nach Vroom in Heckhausen (1989)
Abb. 4-1: Klassifikation der Befragungsmethoden
Abb. 4-2: Einteilung der Fragen in Datenerhebungen
Abb. 5-1: Durchführungsmöglichkeit einer Online-Umfrage
Abb. 5-2: Geschlechterverteilung aller Umfrageteilnehmer
Abb. 5-3: Altersgefüge aller Umfrageteilnehmer
Abb. 5-4: aktuelles Fachsemester der Umfrageteilnehmer
Abb. 5-5: gewählter bzw. geplanter Studienschwerpunkt aller Befragten
Abb. 5-6: relativer Studentenanteil mit Vorstudium (alle Umfrageteilnehmer)
Abb. 5-7: absoluter Anteil der Studiumwechsler nach Semesteranzahl (11Teilnehmer)
Abb. 5-8: relativer Anteil der Bafögbeziehenden
Abb. 5-9: Angabe zur alternativen Studiumfinanzierung(ohneBafög – 32Teilnehmer)
Abb. 5-10: Studentenanteile mit Praktikumsvergütung (alle Studenten)
Abb. 5-11: Vergütungshöhe der Praktikanten (28 Teilnehmer)
Abb.5-12: Praktikantenanteil, der auch ohne Vergütung arbeiten würde
Abb. 5-13: wichtige Motive für die Studiengangwahl
Abb. 5-14: Studiertypen (alle Teilnehmer)
Abb. 5-15: Studentenanteile für Anschlussstudium (alle Teilnehmer)
Abb. 5-16: Bewertung innerer und äußerer Bedingungen in der Theoriephase (gewichtete Durchschnittswerte/alle Teilnehmer)
Abb. 5-17: Bewertung innerer und äußerer Bedingungen in der Praxisphase (gewichtete Durchschnittswerte/alle Teilnehmer)
Abb. 5-18: Bewertungen vorgegebener Motivtypen während der Theoriephase
Abb.5-19: Bewertungen vorgegebener Motivtypen während der Praxisphase (Durchschnittswerte/alle Teilnehmer)
Abb. 5-20: Angabe der Wichtigkeit der extr./intr. Motive in der Theoriephase
Abb. 5-21: Angabe der Wichtigkeit der extr./intr. Motive in der Praxisphase
Abb. 5-22: Studentenselbsteinschätzung zur Motivationshöhe in der Theoriephase (alle/1.Fachsem./7.Fachsem.)
Abb. 5-23: Studentenselbsteinschätzung zur Motivationshöhe in der Praxisphase (alle/1.Fachsem./7.Fachsem.)
Abb. 5-24: Selbsteinschätzung der Motivationsnotwendigkeit in den Theoriephasen (alle/1.Sem./7.Sem.) Angaben in %
Abb. 5-25: Selbsteinschätzung Motivationsnotwendigkeit in den Praxisphasen (alle/1.Sem./7.Sem.) Angaben in %
Abb. 5-26: relative Anteile der Praktikumsvorschläge
Abb. 5-27: Unternehmensaufnahmeprozedurqualität aus Sicht aller Umfrageteilnehmer
Abb. 5-28: Arbeitswunsch der Studierenden in den jeweiligen Praktikumsbetrieben(alle)
Abb. 5-29: Studenteneinschätzung zur Übernahmeabsicht durch das aktuelle Praktikumsunternehmen (alle Teilnehmer)
Abb. 5-30: Studentenanteile zur Zufriedenheit mit Praktikumsunternehmen
Abb. 5-31: absolute Anzahl der bisherigen Unternehmenswechsel
Abb. 5-32: Anwendungsgrad der Theorieinhalte auf die Praxisphasen
Abb. 5-33: Umsetzungsgrad der Ausbildungsinhalte durch die Kooperationsunternehmen
Tabellenverzeichnis
Tabelle 2-1: vorgeschlagener Ausbildungsplan für die Kooperationsunternehmen von der Beuth Hochschule
Tabelle 2-2: Studienabbruchquote und Kennzahlen des dualen BWL-Studiengangs vom WS 2005/06–WS 2010/11
Tabelle 4-1: Vor-/Nachteile quantitativer Forschungsmethoden
Tabelle 4-2: Vor-/Nachteile qualitativer Forschungsmethoden
1 Einleitung
Im Folgenden wird verallgemeinernd in der Regel die maskuline Geschlechterbezeichnung verwendet. Dies geschieht vor allem zum Zweck der besseren Lesbarkeit des Textes und soll nicht diskriminierend verstanden werden. Die Bezeichnungen beziehen sich jedoch immer auf weibliche und männliche Personen.
1.1 Fragestellung
Die deutschen Hochschulen sind als Forschungs- und Lehreinrichtungen in den letzten Jahren vermehrt der Kritik ausgesetzt. Von bildungspolitischer Seite wird gefordert, für Qualitätssicherung in Lehre und Forschung zu sorgen und nicht nur die Effizienz der Verwertbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse zu steigern, sondern auch die Studierenden in kürzester Zeit, fundiert ausgebildet, auf die berufliche Praxis vorzubereiten (Bachelorreform[1]).
Als Maßnahmen laufen neben der Beurteilung der Forschung vor allem umfangreiche Evaluationsaktivitäten (CHE, HIS u. a.[2]), mit dem Ziel, die Lehrqualität zu optimieren sowie wissenschaftliches Personal leistungsbezogen zu entlohnen.
Ebenso hat die Wirtschaft ihre Anforderungen in Bezug auf künftiges Personal höher gestellt und fordert sowohl aus Wettbewerbs- als auch finanziellen Gründen, junge praxisnah ausgebildete und mit überfachlichen Qualifikationen versehene Absolventen, die sofort im Betrieb einsetzbar sind.
Doch die Realität sieht derzeitig oft anders aus. Sowohl Hochschuldozenten als auch Bachelorstudenten glauben laut Umfragen nicht an einen schnellen Übergang vom abgeschlossenen Bachelorstudium ins Arbeitsleben. So beschließen drei Viertel der Bachelorabsolventen, lieber weiterzustudieren als ins Berufsleben zu gehen[3].
Darüber hinaus klagen Studenten während des Studiums häufig über überfüllte und praxisferne Lehrveranstaltungen. Die Bachelorstudiengänge beinhalten nun zudem viel Lehrstoff, welcher in kürzerer Zeit „abgefertigt“ werden muss.
Außerdem können sich viele Studenten und Unternehmen mittlerweile unter den neu entstandenen englisch titulierten Studiengängen, Modulen und akademischen Graden (z.B. Bachelor of Science) kaum noch etwas vorstellen und sehnen sich nach den alten Bezeichnungen (Diplom etc.). Auch der simple Wechsel von einer Hochschule zur anderen kann sich mitunter als kompliziert erweisen, da eine Hochschule dasselbe Lehrmodul mit denselben Inhalten womöglich anders benannt hat und somit nicht anerkennt.[4] Weitere Defizite an den augenscheinlich überforderten Hochschulen werden durch durchschnittlich hohe Studiumabbruchquoten bestätigt[5].
Diese Hochschulentwicklungen in der Bundesrepublik erfordern ein grundlegendes Umdenken in der bisherigen studien- und situationsbezogenen Evaluations- und Bewertungspraxis. Neben der reinen Studienzufriedenheit sollte auch die Studienmotivation von Studierenden in die Diskussionen mit einbezogen werden.
Im Übrigen kommt den Studierenden in einigen Bundesländern zunehmend die Rolle eines ,,Kunden" zu, so dass die bisher dominante zufriedenheitsorientierte Betrachtung der Studien verkürzt scheint und um Aspekte der Kundenzufriedenheit ergänzt werden muss.
So dürfte mit der Einführung der Studiengebühren im Jahr 2007 in Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg der Wettbewerb um „zahlende Kunden“[6] bereits eröffnet sein. Hochschulen werden zu „Dienstleistern“ und Studenten zu „Kunden“ der angebotenen Dienstleistung der „Bildung“.
Aus dem Grund ändert sich der Anspruch der Studenten an ihre Hochschule. Die Studenten fordern von ihrer Hochschule für die gezahlten Gebühren auch entsprechende Leistungen, weil sie „Kunden“ sind und Ansprüche haben dürfen.
Sicherlich muss Studierenden aufgrund ihrer direkten Beteiligung am Lehrprozess zugestanden werden, die Leistung der Bildung kritisch beurteilen und beeinflussen zu können. Doch einige Motivationsforscher wie Voss kritisieren, dass Studenten nicht als Kunden im klassischen Sinn gesehen werden dürfen, denn es existieren einige Punkte, die den Kundenstatus des Studenten zweifelhaft erscheinen lassen.
Wenn beispielsweise ein Student gute Noten wünscht, so wäre eine entsprechende positive Notengebung durch den Dozenten doch selbstverständlich. Doch ist dies in der Realität natürlich nicht möglich. Aus diesem Grund sollten Studenten laut den Ausführungen von Voss mehr als „Stakeholder“ denn als Kunden zu betrachten sein.[7]
Deutsche Hochschulen befinden sich generell also mittlerweile unter einem globalen Druck. In Verbindung hierzu ist auch zu erwähnen, dass die finanziellen Mittel der Hochschule eingeschränkt werden können, wenn diese von der Anzahl immatrikulierter Studenten abhängt. Aus diesem Grund wird es für Hochschulen immer wichtiger, die Meinungen und Wünsche ihrer Anspruchsgruppen, in dem Fall die der Studenten, zu kennen, um so in diesem schwierigen Wettbewerb zu bestehen und sich gegen andere Hochschulen zu behaupten.
Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass das oberstes Ziel der Hochschulen darin bestehen sollte, permanent ihre Studierenden zufrieden zu stellen und deren Studienmotivation hochzuhalten.
Auch der duale Studiengang der Betriebswirtschaftslehre auf der Beuth Hochschule für Technik befindet sich im Wettbewerb zu BWL-Studiengängen[8] anderer Hochschulen, wenngleich klar ist, dass die Beuth Hochschule aufgrund ihres Non-Profit-Status „Staatliche Hochschule“, welcher durch das Landesgesetz von Berlin bestimmt und durch die öffentliche Trägerschaft staatlich finanziert wird, nicht das betriebswirtschaftliche Ziel der Gewinnmaximierung verfolgt, sondern einen Bildungsauftrag erfüllen soll.
Die hierfür gültigen rechtlichen Rahmenbedingungen und die Aufgaben der Berliner Hochschulen sind im Berliner Hochschulgesetz geregelt. So wird beispielsweise in der Rechtstellung gemäß § 2 Abs. 9 explizit bestätigt, dass keine Studiengebühren erhoben werden dürfen[9].
Dennoch ist es auch im Rahmen der Bildungsqualität und Hochschulattraktivität des dualen Studiengangs der BWL der Beuth Hochschule für Technik Berlin unabdingbar, dass die Bedürfnisse der Studenten und in diesem besonderen Fall der in Bezug auf die Praxisphasen kooperierenden Unternehmen permanent befriedigt werden.
Vor allem die Tatsache, dass dieser Studiengang ein „Aushängeschild“ der Wirtschaftswissenschaften an der eher technisch orientierten Beuth Hochschule darstellt, unterstreicht auch die Wichtigkeit der Zufriedenheit und Motivation der BWL-Studenten in den Theorie- und Praxisphasen.
Das Thema der Motivationspsychologie hat sich in den letzten Jahren einer enormen Beliebtheit erfreuen können. Fast alle Leistungen, die heutzutage erbracht werden, werden durch Tüchtigkeit und Motivation erklärt. Wie stark die Öffentlichkeit hierbei auf das Thema „Motivation“ fokussiert ist, kann an einer Vielzahl von Angeboten (Bücher, Seminare, Managementberatungen etc.) erkannt werden[10].
So wird bereits seit Jahren versucht die tiefgründig komplizierte und ohnehin nicht leicht zu deutende Welt der Motivation mit verschiedenen Theorien und Experimenten zu ergründen. Vor allem in der Berufswelt sind Lösungsansätze für die positive Förderung der Mitarbeitermotivation sehr gefragt und Bestandteil jeder Unternehmenspolitik. So wird in manchen Unternehmen ständig vonseiten der Manager versucht die Motivation der Mitarbeiter zu steigern, um mehr Leistung abrufen zu können.
Doch nicht nur in der Arbeitswelt, auch im Hochschulwesen wird der Motivation eine besondere Bedeutung zugesprochen. Studenten erklären sich beispielsweise schlechte Leistungen immer wieder mit einer nicht ausreichend vorhandenen Motivation.
Einen wenn auch kleinen Beitrag zu diesem spannenden, aber gleichzeitig auch äußerst komplizierten Thema versucht diese Arbeit zu leisten, indem empirisch untersucht werden soll, wie es derzeitig mit der Motivation der Studenten des dualen BWL-Studiengangs aussieht.
1.2 Struktur und Ziel der Arbeit
Ziel dieser Arbeit ist es, mit Hilfe einer empirischen Untersuchung Informationen bezüglich der Motivation der Studenten im Hinblick auf die Theorie und Praxisphasen zu gewinnen. Ein Fokus wird hierbei auf die intrinsischen und extrinsischen Motivationstypen gelegt.
Da wie im Kapitel 1.1 bereits erwähnt, die Situation an der Beuth Hochschule glücklicherweise noch nicht gleichzusetzen ist mit den Bundesländern, welche schon Studiengebühren eingeführt haben, und da Studenten nach Kritikermeinungen, wie Voss, nicht als „klassische Kunden“ angesehen werden dürfen, soll an der Stelle verdeutlicht werden, dass in dieser Arbeit weniger auf die marketingorientierte Kundenbindung und -zufriedenheit der Hochschule eingegangen wird, sondern vielmehr auf das wichtigere Thema der Studentenmotivation.
So werden zunächst die zu untersuchenden Bereiche theoretisch betrachtet.
Erstens soll im Kapitel 2 kurz der duale Studiengang der BWL auf der BHT vorgestellt werden. Besonders wichtig erscheint hier die explizite Darstellung der Theorie- und Praxisphasen, da diese im Verlauf der empirischen Untersuchung analysiert werden sollen. Des Weiteren wird kurz auf die Bedeutung der bundesweiten Studiumabbruchquote hinsichtlich der Studentenmotivation eingegangen.
Das anschließende 3. Kapitel beinhaltet Grundlagen der Motivationstheorie. Hier werden wesentliche Begriffe der Motivationslehre erläutert und kurz auf die Historie und Kernpunkte passender Inhalts- und Prozesstheorien der Motivationsforschung eingegangen. Ebenso werden verschiedene Arten und Ausprägungen der Motivation beschrieben (Leistungs-, Studien-, Arbeitsmotivation, extrinsische /intrinsische Motivation).
Gegenstand des 4. Kapitels ist die Beschreibung der verschiedenen in Betracht kommenden Methoden der empirischen Sozialforschung für die geplante Analyse. Besonders wird hierbei auf den Unterschied zwischen den quantitativen und qualitativen Datenerhebungsmethoden aufmerksam gemacht und die allgemeinen Gütekriterien hierzu werden explizit dargestellt.
Am Ende dieser Arbeit werden im Kapitel 5 die Ergebnisse der empirischen Untersuchung bezüglich der Motivation der Studenten in Theorie- und Praxisphasen vorgestellt und interpretiert. Hierfür sollen diese den vorab aufgestellten Hypothesen gegenübergestellt und diskutiert werden.
2 Der duale Studiengang der Betriebswirtschaftslehre an der Beuth Hochschule für Technik Berlin
2.1 Kurzbeschreibung des BWL-Dual-Studiengangs
Die Beuth Hochschule für Technik Berlin ist eine traditionsreiche Hochschule mit dem größten ingenieurwissenschaftlichen Angebot in Berlin und Brandenburg. Derzeitig studieren aktuell mehr als 10000 Studierende in 72 technischen, natur- und wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen. Die Studiengänge verlaufen praxisorientiert und bereiten die Studierenden auf innovative und vielseitige Berufsfelder vor. Zudem hat die Beuth Hochschule als erste große Berliner Hochschule bereits zum Wintersemester 2005/2006 das Studienangebot komplett auf Bachelor- und Masterabschlüsse umgestellt[11]. Insgesamt beschäftigt die Beuth Hochschule 290 Professoren, 45 Gastprofessoren und Dozenten, 520 Lehrbeauftragte sowie 464 Mitarbeiter (Stand 04.11.2010).
Im Wintersemester 2010/2011 waren insgesamt 10149 Studierende eingeschrieben, davon entfielen 1328 auf den Fachbereich I der Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften[12] und ungefähr 520 auf den dualen BWL-Studiengang.
Das siebensemestrige Studium der "Betriebswirtschaftslehre" wird in dualer Form durchgeführt: Hierbei setzen sich die ersten sechs Semester aus einer 13-wöchigen Theoriephase und einer sich anschließenden zehnwöchigen Praxisphase in einem kooperierenden Unternehmen zusammen. Im 7. Semester fertigen die Studierenden nach der 13-wöchigen Theoriephase die Bachelorarbeit an. Abschließend erhalten die Absolventen nach erfolgreichem Studium den akademischen Grad des Bachelor of Arts (B.A.). Das gesetzte Ziel des Studiengangs liegt in einer idealen Theorie-Praxis-Verzahnung.
Voraussetzung für eine Immatrikulation in den dualen BWL-Studiengang ist ein Kooperationsvertrag von einem Praktikumsunternehmen für die Dauer von sechs betrieblichen Studienabschnitten à zehn Wochen. Im Kooperationsvertrag wird die Zusammenarbeit zwischen der Beuth-Hochschule und den Praktikumsunternehmen geregelt. Die kooperierenden Unternehmen sind hierbei in einer Unternehmensliste gelistet, die im Fachbereich I angefragt oder direkt auf der Homepage der Beuth Hochschule heruntergeladen werden kann.
Unter bestimmten Bedingungen kann der Studienbewerber selbst ein Unternehmen für die Kooperation vorschlagen. Die Prüfung der Voraussetzungen dafür erfolgt durch die Studiengangsleiter des Studienganges. Diese wären in dem Fall Herr Prof. Dr. Walter oder Herr Prof. Dr. Brandt[13].
Zudem beinhaltet ein Praktikantenvertrag zwischen Student und dem Unternehmen die ordnungsgemäße Durchführung der betrieblichen Praxisphasen sowie die Vergütung. Als Vergütung wird den Unternehmen ein Betrag von 300 € bis 500 € pro Monat empfohlen, jedoch besteht bei der Vergütung keinerlei gesetzliche Verpflichtung seitens der Unternehmen.
2.2 Inhalte der Theoriephasen des Studiengangs
In den Theoriephasen erfolgt eine breit angelegte Grundausbildung. Dieses Grundwissen wird in den an der Beuth-Hochschule durchgeführten Lehrveranstaltungen insbesondere auf den Gebieten der Betriebswirtschaftslehre, der Wirtschaftsinformatik, des Wirtschaftsrechts, des Wirtschaftsenglischs sowie der Arbeits- und Organisationspsychologie vermittelt[14].
Ferner erfolgt ab dem 4. Fachsemester wahlweise eine umfassende Vertiefung der betriebswirtschaftlichen Ausbildung in den Studienschwerpunkten Management/ Marketing und/oder Wirtschaftsinformatik[15]. Durch verschiedene Übungen sowie Projekte in einigen interaktiv angelegten Lehrmodulen werden die Studenten bereits früh mit für das Berufsleben wichtigen „Soft-Skills“, wie der Teamfähigkeit, Präsentationsfertigkeiten, wissenschaftlichem Arbeiten sowie mithilfe von Hausarbeiten, vertraut gemacht.
2.3 Ausbildungsinhalte der betrieblichen Studienabschnitte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2-1 Theorie- und Praxisphasen im dualen BWL-Studiengang
An jede Theoriephase eines Semesters schließt sich direkt ein 10-wöchiger betrieblicher Studienabschnitt an. (siehe Abb. 2-2) Die Betreuung während dieser Zeit erfolgt durch einen für dieses Studium sinnvollen Hochschulabschluss und einen eine mehrjährige Berufspraxis nachweisenden Mitarbeiter des Unternehmens, welcher hierfür einen Lehrauftrag von der Beuth-Hochschule für Technik erhält. Im Rahmen der Praxisphasen durchlaufen die Studierenden die Betriebsabteilungen mit betriebswirtschaftlichen Aufgabenstellungen, um die Praktikumsstelle in all ihren Funktionsbereichen kennenzulernen. In höheren Semestern wird vonseiten der BHT vorgeschlagen, dass die Studierenden vorzugsweise an Projekten mit Bezug zu den Theoriephasen mitwirken, bei denen es um die Lösung anspruchsvoller Problemstellungen geht. Ziel der betrieblichen Studienabschnitte ist es, dass der Studierende eigenständig, verantwortungsbewusst und fachgerecht die Aufgaben löst und damit wesentliche Schlüsselqualifikationen erlangt[16].
Als Arbeitsbereiche, die für die Tätigkeit von Studierenden im Rahmen der betrieblichen Praxisphasen besonders geeignet sind, gelten der Beschaffungsbereich, der Produktions- bzw. Dienstleistungsbereich, der Vertriebsbereich sowie der allgemeine Verwaltungsbereich mit den Schwerpunkten Personalwesen, Rechnungswesen und Datenverarbeitung.
Um eine optimale Theorie-Praxis-Verzahnung zu erhalten, müssen hierzu die Praxisinhalte mit den Studieninhalten abgestimmt sein. Dazu erstellt das jeweilige Praktikumsunternehmen einen Ausbildungsplan für den Praktikanten für die Zeit der betrieblichen Praxisphasen. Dieser Ausbildungsplan wird vom Unternehmen in Absprache mit den Praktikumsbeauftragten der BHT erarbeitet und muss von ihm bestätigt werden.
Folgende Tabelle stellt relevante Auszüge aus dem Modulhandbuch des BWL-Dual-Studiengangs vonseiten der BHT dar:
Tabelle 2-1: vorgeschlagener Ausbildungsplan für die Kooperationsunternehmen von der Beuth Hochschule[17]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.4 Allgemeine Kennzahlen zur deutschen Hochschullandschaft
2.4.1 Studienerfolg an deutschen Hochschulen
Der Studienerfolg wird in der Hochschulforschung vor allem über den Faktor der Abbruchquote errechnet. Die Abbruchquote stellt hierbei den Anteil der Studienanfänger eines Studienjahrgangs dar, der das Studium vor Erreichen eines ersten akademischen Grades beendet[18]. Durch verschiedene Evaluationsverfahren lässt sich die Abbruchquote feststellen.
Hierfür wird in vielen Ländern das interne und externe Evaluationsverfahren favorisiert. Vor allem das „Niederländische Modell“, landesweit in Verantwortung der Hochschulen, Studiengänge zu evaluieren, stieß in Deutschland auf großes Interesse. So hat beispielsweise die Hochschul-Informations-System GmbH (HIS[19]) als Vorreiter 1994 dieses Modell übernommen und präsentiert seitdem deutschlandweit interessante Projektberichte über Studiengänge in Bezug auf Studienmotivation, -abbruchquote sowie -zufriedenheit.[20]
Wichtig ist auch zu erwähnen, dass vielfältige Gründe für einen Studienabbruch existieren. Prinzipiell wird die Entscheidung, ein Studium vorzeitig abzubrechen, von mehreren unterschiedlichen Faktoren bestimmt. Die wesentlichsten Motive lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen.
Zum einen sind dies Motive, die im Zusammenhang mit einer beruflichen Neuorientierung stehen.
Sekundär sehen sich viele Studierende aufgrund finanzieller Schwierigkeiten zu einem vorzeitigen Abbruch des Studiums veranlasst.
Als Letztes sind die Studienabbrecher zu nennen, deren Motive für einen vorzeitigen Studienabbruch mit mangelnder Studienmotivation begründet werden[21].
So wurde beispielsweise durch die Ergebnisse einer Befragung von Exmatrikulierten des Studienjahres 2007/08, durchgeführt vom Hochschul-Informations-System GmbH (HIS), deutlich, dass die Studienabbruchquote für Fachhochschulen bundesweit 22% beträgt[22].
Auch die Gründe für den Studienabbruch an den Hochschulen haben sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. So scheitert ein höherer Anteil an Studienabbrechern als bei den Befragungsergebnissen vor acht Jahren besonders an den Leistungsanforderungen, die an den Hochschulen gestellt werden.
Diese Zunahme erklären sich Experten unter anderem aus dem inzwischen erfolgten Übergang zum Bachelorstudium, welcher vor allem im Bereich der Natur-, Ingenieur- und auch in den Wirtschaftswissenschaften häufig zu einer Anforderungsverdichtung geführt hat. Konkret müssen die Studierenden mittlerweile im Semester nicht nur mehr Stoff als vorher bewältigen, sondern auch früher, schon im ersten Semester, anspruchsvolle Prüfungen ableisten.
Da besonders die Hochschulen im Vergleich zu den Universitäten eine „heterogene Studentenschaft“ darstellen, fällt dies vor allem den Studierenden schwer, deren Studienvoraussetzungen nicht den „normalen“ Anforderungen des Studienbeginns entsprachen–also denen, die erfahrungsgemäß nicht auf direktem Wege zum Studium fanden. Häufig haben diese Studenten beispielsweise vor oder nach dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung eine Berufsausbildung absolviert oder waren zeitweise berufstätig[23].
2.4.2 Studienabbruchquote in den Wirtschaftswissenschaften an Hochschulen
Eine überdurchschnittlich hohe Studienabbruchquote von 24% wurde laut HIS in den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen an den Hochschulen in Deutschland erkannt. Nach wie vor ist der Studienabbruch in den Wirtschaftswissenschaften bei relativ unveränderter Abbruchquote stark durch finanzielle Probleme bestimmt. Es ist auch hier davon auszugehen, dass Studierende aus einkommensschwächeren Familien von solch finanziell bedingtem Studienabbruch besonders betroffen sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2-2: Studienabbruchgründe für die Wirtschaftswissenschaften an deutschen Fachhochschulen[24]
Aber auch hier ist die mangelnde Studienmotivation zu knapp 20% als Grund für die vorzeitige Exmatrikulation der Studenten angegeben (siehe Abb. 2-2).
Diese Zahl hat sich im Vergleich zum ähnlich aufgebauten HIS-Projektbericht zur Studienabbruchquote aus dem Jahre 2000 verdreifacht.[25] Auch an dem Punkt erkennt man, dass in den letzten Jahren vor allem die Motivation in den Fokus der Studenten gerückt ist.
Ferner gaben die untersuchten Studienabbrecher als Ursache für ihre vorzeitige Exmatrikulation Leistungsgründe, Prüfungsversagen und beruflichen Neigungswechsel sowie nachlassendes Fachinteresse an[26].
2.4.3 Spezifische Kennzahlen und Studienabbruchquoten im dualen Studiengang der BWL
Erfreulicherweise hat der duale Studiengang der Betriebswirtschaftslehre der Beuth Hochschule in Berlin im bundesweiten Vergleich der Hochschulen, durchschnittlich betrachtet, nicht mit einer sonst üblichen Studienabbruchquote von 22% zu kämpfen.
In der folgenden Tabelle werden vereinfachenderweise die spezifischen Kennzahlen des dualen BWL-Studiengangs dargestellt[27]:
Tabelle 2-2: Studienabbruchquote[28] und Kennzahlen des dualen BWL-Studiengangs vom WS 2005/06–WS 2010/11
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
So ist in der Tabelle 2-2 und mit Hilfe der Kennzahlen aus dem Fachbereich I zu erkennen, dass in den Jahrgängen vom Wintersemester des Jahres 2005/06 bis zum Wintersemester 2010/11 bisher nur eine durchschnittliche Studienabbruchquote von circa 14% verzeichnet wurde.
Zudem ist hierbei wichtig zu erwähnen, dass seit dem Wintersemester 2009/10 die Studentenkapazität um einen weiteren Zug (also um circa 40 weitere Studentenplätze) erhöht wurde.
Glücklicherweise haben seit dem WS 2005/06 von ursprünglich 580 immatrikulierten BWL-Dual-Studenten lediglich 60 Studenten das Studium abgebrochen. Es ist hierbei wichtig zu bemerken, dass die Jahrgänge vom WS 2005/06 mittlerweile schon die Hochschule beendet haben oder die letzten Studierenden nun bald die Hochschule absolvieren werden. Des Weiteren haben aus diesem Jahrgang–in einem Zeitraum von sechs Jahren–nur 14 von 89 Studenten ihr Studium abgebrochen. Das entspräche einer Abbruchquote von ungefähren 15,7 % und würde dementsprechend auch unter dem bundesweiten Durchschnitt von 22% liegen.
Da die anderen Jahrgänge noch mitten in ihrem Studium stehen, können sie nicht als repräsentativ für solche Deutungen betrachtet werden und werden an der Stelle nicht näher erläutert. Die Anzahl der Studenten, die ihren Praktikumsplatz gewechselt haben, liegt zwar insgesamt gesehen relativ hoch, jedoch muss dies nicht unbedingt aus Gründen mangelnder Motivation oder Unzufriedenheit erfolgt sein.
Viele Studenten nutzen die Gelegenheit, die sich aus der dualen Form des Studiums ergibt, und bemühen sich karrierefördernd um ein Auslandspraktikum oder finden regional neue Praktikumsunternehmen, um auch andere Unternehmensbereiche kennenzulernen. Dieser Punkt soll ansatzweise im empirischen Teil der Arbeit untersucht werden.
3 Theoretische Grundlagen zur Motivation
Die wichtigsten Begrifflichkeiten zu den theoretischen Motivationsgrundlagen sollen an dieser Stelle benannt und erläutert werden, um mit einer klaren Definition arbeiten und Fehlinterpretationen ausschließen zu können.
3.1 Historische Grundlagen–von „Platon zum Humankapital“
Die wohl älteste Theorie, die die moderne Motivationspsychologie bis heute nachhaltig prägt, ist unter dem Begriff „Hedonismus“ bekannt. Bereits Sokrates (470–399 vor Christus) bzw. Epikur (341–271 vor Christus) vermuteten die Ursache menschlichen Verhaltens in dem Bestreben, Glück bzw. Freude („hedon“) zu erlangen bzw. „Schmerz“ zu vermeiden. Die grundsätzliche Vorstellung, dass menschliches Verhalten zu positiven Zuständen hin- und von negativen Zuständen weggerichtet ist, findet sich sowohl in historischen als auch in modernen Theorien und Konzepten der Annäherungs- und Vermeidungsmotivation wieder.
Über diese grobe Zweiteilung hinaus, wurde bereits in der Antike eine inhaltliche Einteilung von Zielen vorgenommen, auf die Verhalten gerichtet sein kann. So werden z.B. durch Platon verschiedene Arten von Zielen definiert.[29]
- Glück durch Erlangen irdischer Güter wie Geld, Nahrung und Kleidung
- Glück durch Erlangen von Erfolg und Ehre
- Glück durch Erlangen von Erkenntnis
Erst die Motivationsforscher der Arbeits- und Organisationspsychologie um 1960, während der Zeit der sogenannten „Human-Ressources-Theorie“, stellten als Reaktion auf die damalig umstrittene „Wissenschaftliche Betriebsführung“[30] von F. W. Taylor[31] fest, dass weniger eine erreichte Befriedigung, sondern die wahrgenommene Entfernung zwischen einem gegenwärtigen Zustand und einem erreichbaren zukünftigen Zustand für die Leistungsbereitschaft eines Individuums ausschlaggebend ist.
Nicht die Zufriedenheit einer Person, sondern eine Motivation musste also vorhanden sein, da ein befriedigtes Bedürfnis schließlich keine Motivation mehr sei.
Damit war die Notwendigkeit der Erforschung aller menschlichen Bedürfnisse und der Zusammenhänge zwischen Motivation, Frustration, Zufriedenheit und Leistung gegeben[32].
Heutzutage werden Mitarbeiter in vielen Unternehmen gern als Reservoir einer Vielzahl „potentieller“ Fähigkeiten betrachtet, und es sei die Aufgabe der Führungskräfte herauszufinden, wie diese Anlagen am besten zu aktivieren, zu fördern und weiterzuentwickeln sind.[33]
Dies wäre nach Meinung vieler Motivationsexperten (z.B: Sprenger oder F. W. Nerdinger) allerdings nur durch ein hohes Maß an Engagement, Autonomie, einen Hierarchieabbau und vielfache kommunikative Vernetzungen in der Organisation zu erreichen. Damit dieses Prinzip durchgesetzt werden kann, muss es unbedingt in der jeweiligen Organisation verankert werden[34].
Zentrale Annahmen des Human-Ressources-Modells[35]:
(1) Der Mensch ist der Arbeit nicht von Natur aus abgeneigt.
Er möchte vielmehr mit dazu beitragen, Ziele zu erreichen.
(2) Die meisten Menschen sind zu wesentlich mehr
Kreativität und Selbstbestimmung fähig, als es ihre derzeitige Arbeit zulässt.
(3) Eine günstige Gestaltung der Arbeitsumwelt und des Führungsstils ist zwar eine Voraussetzung für Zufriedenheit, genügt aber nicht für eine hohe Leistungsbereitschaft.
(4) Die Motivation ist von zentralerer Bedeutung für die Leistung der Mitarbeiter.
Erst mit diesem Modell wurde auch in Unternehmen der Wert der „Individuen“ der Mitarbeiter deutlich. Nun wurde erkennbar, dass die Mitarbeiter ein wichtiges, wenn nicht das „wichtigste Kapital“ der Unternehmen darstellen. Außerdem sollte der sorgsame Umgang mit „Humankapital“ für Betriebe nicht nur aus ethischen und moralischen Gründen wichtig sein, sondern auch aus finanziellen, wie aufgrund der Unternehmensrentabilität und des Unternehmenserfolgs. Mit der Zeit beschäftigten sich Motivationsforscher auch mit der Bedeutung und der Beeinflussbarkeit der Motivation für das Individuum in Organisationen, wobei sie sich auf die beiden Bereiche des menschlichen Motivationsphänomens an sich und der Führungsart konzentrierten.
3.2 Das Grundmodell der Motivationspsychologie
3.3 Begriffsdefinitionen und Erläuterungen
Um die komplexe Thematik der Motivation anzugehen, ist es sinnvoll, grundsätzliche Begriffe der Motivationspsychologie kurz zu definieren.
3.3.1 Motiv und Anreiz
Als Motiv werden einzelne Beweggründe des menschlichen Verhaltens bezeichnet. Beispiele hierfür wären beispielsweise Durst, Hunger, Geltungsbedürfnis etc. Synonym für Motiv können ebenso Begriffe wie Wunsch, Trieb, Strebung, Drang, Triebfeder etc. verwendet werden.
Da menschliches Verhalten vorwiegend gleichzeitig durch mehrere Faktoren in einer komplexen Weise zu Stande kommt, wird man ein Motiv nicht im konkreten Erleben beobachten können[36]. Lediglich durch die Analyse der Anreize und der darauf folgenden Reaktionen lassen sich Rückschlüsse auf Motive ziehen.
Damit es zum Verhalten kommt, müssen Motive jedoch durch Merkmale von „Situationen“ angeregt werden. Solche Situationen bieten Gelegenheiten zur Realisierung von Bedürfnissen und Zielen und fordern den Menschen dazu auf, bestimmte Handlungen zu zeigen und andere zu unterlassen.
Diese Besonderheit von Situationen wird Anreiz genannt. Damit das Motiv wirksam wird, bedarf es also eines Anreizes, der die vorhandene Handlungsbereitschaft zu einer konkreten Handlung führt. Wenn beispielsweise ein Unternehmen für das Erreichen seiner Ziele Prämien verspricht, setzt es Anreize für das erwünschte Handeln seiner Mitarbeiter.
Das subjektive Wahrnehmen und die Beurteilung der situativen Merkmale entscheiden darüber, ob ein Motiv angeregt wird. Anreize regen ganz bestimmte Motive an, angeregte Motive führen zum Verhalten[37].
Im Wesentlichen werden folgende Motivbereiche unterschieden[38]:
- Machtmotiv (Ziel des Verhaltens ist Macht)
- Leistungsmotiv (Ziel des Verhaltens ist Leistung)
- Anschlussmotiv (Ziel des Verhaltens ist positiver sozialer Kontakt)
Ferner werden in der entsprechenden Fachliteratur auch Neugier-, Aggressions-, Sexualitäts-, Hunger- und Angstmotive beschrieben.
Hierbei können die mit den Motiven verbundenen Ziele dem Handelnden mehr oder weniger bewusst sein. Zu dieser Erkenntnis haben in den letzten Jahren v.a. umfassende Untersuchungen am „Leistungsmotiv“ beigetragen[39].
3.3.2 Motivation und Motivierung
Der Motivationsbegriff ist vom lateinischen Wort movere (= in Gang setzen) abgeleitet und bezieht sich auf die „aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zielzustand“[40]. In einfachen Worten ausgedrückt, ist sie sozusagen die Eigensteuerung eines Individuums durch innerlich bedingte sogenannte „intrinsische“ Motive.
Bei dem von Sprenger favorisierten Begriff der Motivierung dagegen sind die extrinsischen (von außen kommenden) Anreize die Gründe, die dazu führen, dass ein Individuum auf ein bestimmtes Ziel hin arbeitet. So gesehen stellt sie also eine „bewusste“ Fremdsteuerung des Menschen dar, um ihn auf bestimmte Handlungsziele auszurichten und die Bedingungen des Handelns so zu gestalten, dass die Ziele erreicht werden, die im Interesse des „Steuernden“ sind[41]. In Unternehmen wird darunter häufig die Leistungssteigerung von Mitarbeitern durch gezielten Einsatz von Anreizen, also Motivationsinstrumenten (Incentives, Boni, Prämien), verstanden. In diesen Fällen wird Mitarbeitermotivierung also als Aufgabe der Unternehmensführung betrachtet.
Motivation verhält sich zur Motivierung so wie das „Warum“ zum „Wie“. Beide Variablen hängen voneinander ab und sollten daher in der Definition auch nicht getrennt betrachtet werden. Diese selbsternannte „Motivierungsberufung“ der Führungskräfte setzt jedoch ein Grundwissen über die Prozesse der Motivation im Menschen voraus[42].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3-1: Grundmodell der "klassischen" Motivationspsychologie (Rheinberg, 2008)[43]
Die Abbildung 3-1 beschreibt die Motivation und das daraus entstehende Verhalten vereinfachend wie folgt:
So spricht man explizit von einer Motivation, wenn in konkreten Situationen aus dem Zusammenwirken potentieller Anreize und verschiedener aktivierter Motive im Individuum das Verhalten entsteht.
Zusammengefasst ist die Motivation also das Produkt der Wechselwirkung von Motiven und Anreizen. Wichtig ist auch hier zu erwähnen, dass man als externer Beobachter in der konkreten Situation motivierende Beweggründe kaum von nicht motivierenden unterscheiden kann. Motivation ist eine variable Größe. Sie kann sich in ihrer Stärke, ihrer Qualität und Art des angestrebten Ziels unterscheiden. Hierbei gehen nicht nur die Motive in die Motivation ein, sondern auch andere psychische Einflussgrößen, die für das Verhalten wichtig sind. Diese umfassen u.a. auch die subjektiv geschätzte Wahrscheinlichkeit des Handelnden, das jeweilige Ziel zu erreichen[44].
Ebenso wird angenommen, dass die Person allmählich für universell auftretende Grundsituationen verallgemeinerte Zielvorstellungen und Grundwerte entwickelt hat. So kann das Individuum aufgrund früherer Erfahrungen in solchen Situationen eher zuversichtlich oder besorgt auf den weiteren Geschehensverlauf blicken und emotional mehr oder weniger beteiligt sein. Dies beträfe bspw. kognitive Prozesse wie (z.B. Bildung von Erwartungen, Entwurf von Handlungsplänen), affektive Erlebnistönungen des momentanen Befindens (z.B. Hoffnung contra Furcht), physiologische Prozesse (z.B. Ausschüttung von Neurohormonen) und basale Handlungstendenzen (z.B. hin oder weg von einem Objekt/Ereignis)[45]. Je nachdem, welcher dieser beteiligten Prozesse stärker betrachtet wird, fällt auch die Begriffsbestimmung von Motivation etwas anders aus.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Motivation als in sich homogene Einheit also nicht existiert, sondern nur das jeweilige Zusammenspiel kognitiver, affektiver, neurohormoneller und behavioraler Prozesse, die die aktivierende Zielausrichtung eines Individuums bewirken. Aus diesem Blickwinkel betrachtet ist die Motivation ein abstrakter Begriff, ein hypothetisches Konstrukt und demnach äußerst schwer zu erforschen und zu deuten. Es erweckt jedoch im alltäglichen Sprachgebrauch der Gesellschaft den Anschein, äußerst plausibel und simpel zu sein.
Synonyme für Motivation sind „Verhaltensbereitschaft“ oder auch „Orientierung“[46]. Darüber hinaus gibt es zwei Arten von Motivation, nämlich die intrinsische und die extrinsische Motivation, welche folgend erläutert werden sollen.
3.3.2.1 Typen der Motivation
In der Fachliteratur unterscheidet man zwischen zwei großen Gruppen von Motiven, den extrinsischen und intrinsischen Motiven. Analog zu den Motiven kann bei der Motivation zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation differenziert werden. Grob definiert geht Heckhausen davon aus, dass Handeln dann intrinsisch ist, wenn Mittel (Handlung) und Zweck (Handlungsziel) thematisch übereinstimmen. Anderseits ist das Handeln extrinsisch, wenn Mittel und Zweck thematisch nicht übereinstimmen[47].
Intrinsische Motive
Motive, die von einem Menschen selber ausgehen, also jene Motive, die durch die Tätigkeit selbst befriedigt werden (beispielsweise Leistungs- oder Lernmotive), werden als intrinsische Motive bezeichnet. Dazu zählt auch der Spaß an der Arbeit selbst, die den Menschen dazu bringt, also von sich aus motiviert, eine Aufgabe gerne zu erledigen.[48]
Ein passendes Beispiel für besonders intrinsisch motivierte Personen sind z.B. Aktivisten von Umweltschutzorganisationen, welche ehrenamtlich „harte Arbeit“ leisten oder sich sogar Gefahren aussetzen, weil sie wirklich von der "Sache" überzeugt sind.
Weitere Beispiele für intrinsische Motive[49] wären z.B.:
- Bedürfnis nach Tätigkeit
- Bedürfnis nach Selbstverwirklichung
- Leistungsmotivation
- reiner Wissensdrang
- Neugier
extrinsische Motive
Jene Motive, die nicht durch die Aufgabe allein, sondern durch die Folgen der Tätigkeit oder deren Begleitumstände befriedigt werden, werden als extrinsische Motive bezeichnet. Die Motivation wird sozusagen erst durch „äußere“ Faktoren ermöglicht[50]. Dies wären beispielsweise externe Anreizfunktionen, wie Provision oder Schichtzulagen vom Vorgesetzten. Hierbei kann zwischen monetären und nichtmonetären Anreizen unterschieden werden. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die extrinsische Motivation jedoch nicht funktionieren würde, ohne dass ein intrinsisches Motiv vorhanden wäre. Das Vorhaben, einem Arbeitnehmer einen monetären Anreiz zu geben, bringt also nicht die gewünschte Motivation, wenn der Arbeitnehmer keine intrinsischen Geldmotive aufweist. Deswegen gilt allgemein: Nur eine individuell ausgerichtete Motivation des Individuums kann die entsprechend gewünschte Wirkung bewirken[51].
Extrinsische Anreize können jedoch unter bestimmten Umständen die intrinsische Motivation einer Person untergraben bzw. „zerstören“. Der prominente Managementberater und Psychologe Dr. Reinhard K. Sprenger ist in seinem Bestseller „Mythos Motivation“ an diesem Punkt der festen Überzeugung, dass solche „Belohnungen“ (Incentives, Boni etc.) durch das Management an den Arbeitnehmer nach kürzester Zeit bis ins Unermessliche gehen können und letztendlich der zu Motivierende einfach nicht mehr extrinsisch motiviert werden kann, weil seine Bedürfnisse nicht mehr gestillt werden. Es sei für die Führungskräfte schlichtweg eine „Sisyphusarbeit[52] und vielmehr verursache der fremdgesteuerte Versuch beim Mitarbeiter keine längerfristige Motivation, sondern nur eine vorübergehende Befriedigung, die mit der Zeit oft in einer Demotivation des Arbeitnehmers endet. Zudem kann die „ferngesteuerte“ Motivation durch Führungskräfte vom Individuum als Manipulation verstanden werden und somit nach kurzer Zeit misslingen oder komplett verpuffen. Denn der „verwöhnte“ Mitarbeiter bringt auf dieser Stufe schon lange nicht mehr die volle Leistung, weil er ja weiß, dass ihm sein „Chef nichts mehr bieten kann“. Darüber hinaus haben zahlreiche Untersuchungen bewiesen, dass die tüchtigsten und leistungsstärksten Mitarbeiter in Unternehmen in erster Linie nicht des Geldes wegen arbeiten, sondern weil sie ihre Arbeit als sinn- und wirkungsvoll erleben wollen[53]. Dies sind die „eher“ intrinsisch orientierten Mitarbeiter.
Beispiele für extrinsische Motive in Arbeit und Studium wären z.B.:
- Vergütung in Form von materiellen Gegenwerten (Geld, Noten, Boni, Prämien, Incentives)
- Motive sozialer Natur (Wettbewerb, Gruppengefühl)
- Sicherheitsbedürfnisse
- Geltungsbedürfnisse
Die Vergütung in Form von Geld bildet in der heutigen Zeit das wohl wichtigste extrinsische Motiv. Ein anderes Motiv, das „Sicherheitsbedürfnis“, hat sich mittlerweile in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit und allgegenwärtiger Wirtschaftskrisen besonders in der Bundesrepublik als noch wichtiger erwiesen. Zum Teil ist es mit dem Geldmotiv, bezogen auf die Zukunft, identisch, da man als Arbeitnehmer sicherlich auch in der Zukunft ein gutes Einkommen erhalten möchte.
Ein weiteres wichtiges Motiv, insbesondere für das Berufsleben, stellt das Geltungsbedürfnis dar. Hierbei spielt die berufliche Position eine wichtige Rolle. Sie ist der entscheidende Faktor für das Ansehen, das Mitarbeiter inner- und außerhalb des Unternehmens erfahren.[54]
Als ein gutes Beispiel für besonders extrinsisch motivierte Arbeitnehmer kann die Zeit um die 60er Jahre angeführt werden, wo im Verlauf des deutschen Wirtschaftswachstums zahlreiche Gastarbeiter aus Italien, der Türkei oder dem ehemaligen Jugoslawien wirklich „nur“ zum Arbeiten und „Geldverdienen“ nach Deutschland kamen. Für die Gastarbeiter waren v.a. extrinsische Motive wie der Lohn, das Sicherheitsbestreben sowie der Geltungsdrang in ihren Heimatländern und Familien entscheidend.
Üblicherweise gewinnt die extrinsische Motivation in Unternehmen an Bedeutung, sobald Arbeitnehmer ein geringeres Entgelt erhalten, sich unfair behandelt fühlen oder ihnen ein grundsätzlicher Wandel bevorsteht. Ansonsten aber wird davon ausgegangen, dass ein Arbeitnehmer von intrinsischen Beweggründen geleitet wird. Dies wird im Laufe der Arbeit nochmals verdeutlicht.
Generell lässt sich jedoch auch hier sagen, dass rein intrinsische oder rein extrinsische Motive in der Praxis nicht vorzufinden sind. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes verwobenes Zusammenwirken der intrinsischen und extrinsischen Motive[55].
3.4 Inhaltstheorien und Prozesstheorien der Motivationsforschung
Aufgrund der Tatsache, dass Motive und Motivation nicht unmittelbar beobachtbar und zu erkennen sind, wird versucht, für ihre Erklärung auf gängige Theorien aus der Motivationsforschung Bezug zu nehmen. Da das Ziel dieser Abschlussarbeit auch die Analyse der Motivation der Studenten in den Praxisphasen beinhaltet, können ebenso Theorien einbezogen werden, die ihre Theorien vorrangig durch Motivation in Unternehmen begründen. Die Theorien aus der Motivationsforschung werden in zwei Klassen eingeteilt: die Inhalts- und den Prozesstheorien.
Inhaltstheorien gehen von Klassifikationen menschlicher Motive aus und versuchen zu zeigen, welche Anreize diese Motive aktivieren und zum Verhalten motivieren. Bezogen auf die Arbeitswelt bedeutet dies, dass Inhaltstheorien Erklärungsansätze für die Motivation in Bezug auf die Beschäftigung der Mitarbeiter bieten, bei Prozesstheorien fokussiert man sich auf die Dynamik der Motivation[56].
Da die Beschreibung aller Motivationstheorien den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, wird im Folgenden versucht nur Motivationstheorien explizit zu erläutern, die dem Verfasser wichtig in Bezug auf das Ziel der Arbeit erscheinen. Diese wären bezüglich der Inhaltstheorien die sogenannte Maslow´sche Theorie und die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg. Hinsichtlich der Prozesstheorien werden die VIE-Theorie von Vroom, das Risiko-Wahl-Modell von Atkinson und die Equity-Theorie von Adams angeführt.
3.4.1 Inhaltstheorien
Die im folgenden Abschnitt ausgeführten Theorien werden den sogenannten Inhaltstheorien der Motivationsforschung zugeordnet. Generell geht es bei den Inhaltstheorien darum aufzuzeigen, mit welchen „Inhalten“ Personen motiviert werden können. Ein besonders populäres Beispiel ist die Theorie von Maslow, an der sich Probleme inhaltstheoretischer Ansätze exemplarisch verdeutlichen lassen.
3.4.1.1 Maslow´sche Bedürfnistheorie
Der amerikanische Psychologe Abraham Harold Maslow formulierte im Jahr 1954 aufgrund experimentalpsychologischer Befunde und eigener klinisch-psychologischer Beobachtungen eine Theorie, die die Struktur und Dynamik der Motivation des Menschen vereinfachend erklären sollte.
Seiner Ansicht nach können die grundlegenden Bedürfnisse des Menschen in Form einer Pyramide dargestellt werden. Diese sind in fünf nach ihrer Dringlichkeit aufeinander aufbauende, hierarchische Ebenen in verschiedene Gruppen von Bedürfnissen gegliedert.
Eine Übersicht hierüber gibt die folgende Abbildung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3-2:Die Maslow‘sche Bedürfnispyramide[57]
Maslow ging es in erster Linie darum zu zeigen, unter welchen Umständen Menschen nach Selbstverwirklichung streben und zu psychischer Gesundheit finden. Er legte (siehe Abb. 3-2) fünf hierarchisch geordnete Bedürfnisklassen fest, die seiner Überzeugung nach die gesamte Bandbreite des menschlichen Verhaltens erklären sollen[58]
Diese Bedürfnisklassen sind folgende:
1. Physiologische Grundbedürfnisse (Essen, Trinken, Schlafen)
2. Sicherheitsmotive (materielle und berufliche Sicherheit,
„Schutz vor Schmerz und Furcht“)
3. Soziale Bindungsmotive (Freundschaft, Liebe, Anschluss)
4. Wertschätzungsbedürfnisse (Anerkennung und Status)
5. Selbstverwirklichungsmotive (Selbsterfüllung durch Realisierung
der in der Persönlichkeit angelegten Möglichkeiten und Fähigkeiten)
Eng verknüpft mit der hierarchischen Anordnung dieser Bedürfnisse ist die sogenannte Befriedigungs-Progressions-Hypothese. Sie besagt, dass eine Bedürfnisstufe erst dann handlungsleitend wird, wenn die untergeordneten Bedürfnisse befriedigt sind. Das jeweils hierarchisch niedrigste noch nicht befriedigte Bedürfnis ist das stärkste. Eine andauernde Frustration der vier unteren Stufen führe schließlich zur „Krankheit“ und verhindere die letzte erreichbare Stufe, nämlich die der Selbstverwirklichung derjenigen Person.
Obwohl die Maslow’sche Theorie keine direkten Bezüge zu Fragen der Arbeitsmotivation zeigt, wurde sie jedoch vielmals darauf angewandt. So müsse man als Führungskraft nur diagnostizieren, auf welcher Stufe sich ein Mitarbeiter befindet, um ihm dann in der Arbeit entsprechende Befriedigungsmöglichkeiten anzubieten. Dies sollte ihn nicht nur zur Leistung motivieren, sondern auch zufriedenzustellen.
Kritik an der Maslows Theorie:
Inhaltstheorien wirken anschaulich und sind daher sehr beliebt. Unter Praktikern erfreut sich besonders die Maslow’sche Theorie großer Beliebtheit, obwohl gravierende Mängel vor allem bei der Theorieformulierung (bspw. Probleme bei der Messung des Selbstverwirklichungsbestrebens) und methodische Schwächen bei ihrer empirischen Überprüfung (z. B. durch Querschnitts- statt Längsschnittstudien) kritisiert werden[59].
3.4.1.2 Zwei–Faktoren–Modell nach Herzberg
Das Zwei-Faktoren-Modell des amerikanischen Professors für Arbeitswissenschaften Frederick Herzberg ist den humanistischen Motivationsansätzen zuzuordnen. Herzberg geht, anders als Maslow, nicht von individuellen Motiven aus, sondern von arbeitsabhängigen Faktoren. Jedoch beruht auch seine Theorie auf einer Klassifikation von Motivzielen. Diese Theorie begründete er 1959 durch eine Studie in Pittsburgh. Sie bestand darin, 200 Mitarbeiter eines Unternehmens nach Ereignissen in ihrem Arbeitsleben zu befragen, die sie als besonders befriedigend bzw. unbefriedigend empfanden. Ziel war es, herauszufinden, welche arbeitsbedingten Faktoren bei den Mitarbeitern Zufriedenheit und welche Unzufriedenheit hervorriefen.
Im Rahmen dieser Untersuchung kam Herzberg zu dem Ergebnis, dass Zufriedenheit und Unzufriedenheit keine Gegensätze darstellen, sondern differenziert werden müssen. Somit gliederte Herzberg die Bedürfnisse der Menschen in zwei Gruppen: die Motivatoren („Satisfiers“) und die Hygienefaktoren („Dissatisfiers“)[60].
- Motivatoren sind intrinsischer Art, mit denen Arbeitszufriedenheit erreicht werden kann. Sie hängen direkt mit Arbeit und der Motivation zusammen, z.B.: Leistungserfolg, Anerkennung, Aufstieg, Verantwortung–ähnlich wie bei den Wachstumsbedingungen von Maslow
- Hygienefaktoren sind extrinsischer Art, hierdurch wird Arbeitsunzufriedenheit provoziert; sie stellen Mangelbedürfnisse dar, z.B.: Begleitumstände der Arbeit, Bezahlung, interpersonelle Beziehungen, Unternehmenspolitik[61].
Zentrale Annahme des 2-Faktoren-Modells:
Motivatoren sind innere Beweggründe, die bei Erreichen die Zufriedenheit erhöhen und dadurch motivierend wirken. Extrinsische Hygienefaktoren hingegen schaffen keinen permanenten Leistungsanreiz. Allerdings löst ihr Fehlen Unzufriedenheit aus. Sind entsprechende Arbeits- und Rahmenbedingungen gegeben, so führt dies zu einem Abbau der Unzufriedenheit, aber nicht dazu, dass der Arbeitnehmer zufrieden ist. Der Theorie nach müssen beide Ausprägungen also vorhanden sein, um Arbeitszufriedenheit zu erleben. Zufriedenheit besteht nicht zwangsläufig, wenn keine Gründe für Unzufriedenheit vorliegen[62].
Zu den Motivatoren zählen:
- die Tätigkeit selbst
- die Möglichkeit, etwas zu leisten
- Verantwortung
- Aufstiegsmöglichkeiten
- Anerkennung
Beispiele für Hygienefaktoren sind:
- Entgelt
- die Gestaltung der externen Arbeitsbedingungen
- die Beziehungen zu Kollegen
- die Beziehungen zu Vorgesetzten
- Arbeitsplatzsicherheit
- Unternehmenspolitik
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3-3:„Herzbergsche Einflussfaktoren“ auf die Arbeitseinstellung
(Angaben in %)[63]
Weitere Faktoren lassen sich aus der Abbildung 3-3 erkennen. Sie zeigt die Ergebnisse von zwölf Mitarbeiterbefragungen im Rahmen der Herzberg-Studie, bei denen über 3500 Umstände am Arbeitsplatz erfasst wurden. Kurz gefasst lautet die Kernaussage: Die „intrinsischen“ Motivatoren (rechts in der Abb.) haben einen größeren Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit, wohingegen die „extrinsischen“ Hygienefaktoren hauptverantwortlich für die Arbeitsunzufriedenheit sind. Es ist auch deutlich zu erkennen, dass die meisten Arbeitnehmer in der Befragung Hygienefaktoren vor allem in der Verwaltung wie in der Firmenpolitik und in den unzureichenden Kompetenzen der Vorgesetzten sehen. Im Gegensatz dazu wurden relativ gesehen Erfolgserlebnisse und Anerkennung als wichtigste Motivatoren angegeben.
Herzberg hat aus diesen Resultaten und weiteren Studien die Erkenntnis gezogen, dass nur solche Faktoren eine wirkliche Motivationskraft aktivieren können, die sich auf den Arbeitsinhalt und auf die Befriedigung persönlicher Wachstumsmotive beziehen. Ohne diese Faktoren (Motivatoren) kann es keine wirkliche Zufriedenheit und damit keine Motivation geben. Dies kann zugleich als eine radikale Absage an allzu einfach konzipierte Motivationsprogramme der heutigen Zeit wie Incentives, Prämien, Aktionspläne etc. aus dem „Portfolio“ der Führungskräfte betrachtet werden, die das Motivieren der Mitarbeiter als „mechanische“ Anreiztechnik missverstehen[64].
Der Ansatz von Herzberg stellte einen großen Schritt zur Humanisierung von Arbeitsplätzen dar. Kritisiert wurde aber die vage Formulierung seiner zwei Faktoren und dass er die situativen Bedingungen am Arbeitsplatz ignoriert hatte. So vermag das Modell beispielsweise auch nicht erklären, weshalb auch in Teilzeitjobs mit monotonen Aufgaben Beschäftigte vergleichsweise oft angeben, mit ihrer Arbeit zufrieden zu sein[65].
Generell lässt sich schlussfolgernd sagen, dass sich Inhaltstheorien kaum empirisch bestätigen lassen und ihre praktische Nützlichkeit extrem gering ist. Die Motivklassen weisen solch ein hohes Abstraktionsniveau auf, dass sich konkrete Verhaltensweisen kaum durch ein bestimmtes Motivniveau erklären lassen. Aus diesem Grund ist es auch nicht möglich, die individuellen Unterschiede der Arbeitsleistung zu erklären. Die psychologische Forschung konzentriert sich deshalb auf Prozesstheorien, wo die Dynamik der Motivation erklärt werden kann[66].
3.4.2 Prozesstheorien der Motivationsforschung
Die kognitiven Prozesse bei der Entscheidungsfindung eines Menschen sind Gegenstand der Prozesstheorien. Sie versuchen zu begründen, wie die Arbeitsmotivation eines Arbeitnehmers angeregt und gefördert werden kann. Hier folgen einige Ansätze aus dem Bereich der Erwartungs-Mal-Wert-Modelle, deren Grundannahme darin besteht, dass das Individuum seine Handlungsziele bewusst wählt und rational vorgeht, indem es die Attraktivität des jeweiligen Ziels mit der Wahrscheinlichkeit (Erwartung), es zu erreichen, verrechnet. Hierbei soll die Alternative mit dem subjektiv höchsten zu erwartenden Nutzen gewählt werden[67].
3.4.2.1 Risiko-Wahl-Modell nach Atkinson (Leistungsmotivation)
Unter dem Begriff der Leistungsmotivation für das Lern- und Studienverhalten wird nach einem der auf diesem Gebiet berühmtesten Psychologen Heinz Heckhausen „... das Bestreben verstanden, die eigene Tüchtigkeit in all jenen Tätigkeiten zu steigern oder möglichst hoch zu halten, in denen man einen Gütemaßstab für verbindlich hält und deren Ausführung deshalb gelingen oder misslingen kann“[68].
John William Atkinson entwickelte 1957 das sogenannte Risiko-Wahl-Modell leistungsmotivierten Verhaltens (Abb.3-4), dessen Ziel es ist eine Prognose zu generieren, für welches Aufgabenziel sich ein Proband entscheidet, wenn ihm mehrere Aufgaben variabler Schwierigkeitsstufen zur Verfügung stehen. Hierbei steht die angenommene Aufgabenschwierigkeit für die subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit, wobei der Wert des Leistungsziels herausgefunden werden kann, durch die erwarteten Gefühle bei Erreichen oder Nicht-Erreichen der beiden Standards „Stolz bei Erfolg“ oder „Betroffenheit bei Misserfolg“.
Die Motivation wäre somit das mathematische Produkt von Wert und Erwartung(M=E*V). Sie wird zusätzlich durch die individuellen Ausprägung des Leistungsmotivs („Hoffnung auf Erfolg“ und „Furcht vor Misserfolg“) gewichtet[69].
Je nachdem, welche dieser beiden Tendenzen in einem Individuum überwiegt, spricht man von „Erfolgsmotivierten“ oder „Misserfolgsmotivierten“[70].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3-4: Risiko-Wahl-Modell nach Atkinson (1957)[71]
Nach der Erwartungs-Wert-Theorie von John William Atkinson (1957) ist also ein Anreiz ausschlaggebend, um eine Leistungsmotivation bei einem Individuum zu erreichen.
Der leistungsorientierte Anreiz eines Erfolgs nach Atkinson ist umso größer, je schwieriger die zu bewältigende Aufgabe und je geringer die Erfolgswahrscheinlichkeit ist. Es besteht zwischen der „Erfolgswahrscheinlichkeit“ und dem „Erfolgsanreiz“ (siehe Abb. 3-4) also eine antiproportionale Beziehung: je größer die Variable der Erfolgswahrscheinlichkeit, desto kleiner der Erfolgsanreiz (und umgekehrt).
Atkinson geht weiterhin davon aus, dass die Zielsetzung von beiden Faktoren abhängt. Eine extrem schwere Aufgabe hätte zwar einen sehr hohen Erfolgsanreiz, doch würde sie keine Leistungsmotivation auslösen, weil die Erfolgswahrscheinlichkeit gleich Null ist. Umgekehrt sieht es bei einer extrem leichten Aufgabe aus. Diese ist zwar zu 100% zu bewältigen, jedoch ist gerade deshalb ihr Erfolgsanreiz gleich Null. Mittelschwere Aufgaben und Ziele sind hingegen ziemlich attraktiv und regen die Leistungsmotivation an. Hierzu ist zu erwähnen, dass sowohl Erfolg als auch Misserfolg möglich sind.[72] Diese Aufgaben sind zwar anspruchsvoll, jedoch mit größter Wahrscheinlichkeit erreichbar. Auch entsprechen sie dem, was einer Person mit vollem Einsatz gerade noch gelingt– jedoch nicht ohne Anstrengung. Diese Aufgaben sind diejenigen, die als Indikator der aktuellen eigenen Fähigkeit, also der realistischen Zielsetzung auf dem jeweiligen Gebiet dienen. Zwischen Erfolgsanreiz und Erfolgswahrscheinlichkeit existiert laut Atkinson also eine multiplikative Verknüpfung. Daraus resultiert die umgekehrt proportionale U-Funktion in der Risiko-Wahl-Modell-Kurve[73].
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach Atkinson Menschen, bei denen die Erfolgsmotivation größer ist als die Misserfolgsmotivation, Aufgaben mittlerer Schwierigkeit wählen, während im umgekehrten Fall sehr leichte und sehr schwere Aufgaben bevorzugt werden. Das Ergebnis ist somit auch abhängig von der Leistungsbereitschaft und dem Leistungswillen des Einzelnen.
Die Verbindung von Gerichtetheit der Leistungsmotivation, also der Erfolgszuversicht oder Misserfolgsfurcht, Selbstkonzept eigener Fähigkeit und Kausalattribuierung von Erfolg und Misserfolg wird bei Meyer (1973) deutlich: Erfolgsmotivierte haben ein Selbstkonzept guter eigener Begabung und die Tendenz, Erfolg dem eigenen Talent zuzuschreiben (und daher Misserfolg nicht mangelndem eigenem Talent); Misserfolgsmotivierte haben ein Selbstkonzept mangelnder eigener Fähigkeit und damit die Tendenz, Misserfolg mangelndem eigenem Talent zuzuschreiben (und daher Erfolg nicht hohem eigenem Talent). Erfolgsmotivierte führen hierbei Misserfolg überwiegend auf mangelnde Anstrengung und Zufall zurück, Misserfolgsmotivierte auf Aufgabenleichtigkeit und Glück. Die internale Kausalattribuierung, also die Ursachenzuschreibung der Resultate auf die eigene Handlung, ist eine notwendige Bedingung für leistungsorientiertes Verhalten. Eine externale Kausalattribuierung liegt vor, wenn eine Person die Ursache eines Ereignisses bei anderen Personen, Umwelteinflüssen oder Faktoren sieht[74].
Tatsächlich neigt der Mensch öfter dazu, bei Erfolg sich selbst als Ursache zu betrachten. In Bezug auf den Bildungsbereich würde ein Schüler oder Student beispielsweise sagen, dass er eine gute Klausur geschrieben hat, weil er gelernt habe oder intelligent sei. Bei Misserfolg wird eine andere Person beschuldigt oder einem Umwelteinfluss die Schuld am Misserfolg gegeben. Ein Schüler/Student würde so beispielsweise erklären, dass er eine schlechte Arbeit geschrieben habe, weil der Lehrer/Dozent ihn nicht leiden könne oder die Arbeit viel zu schwer gewesen sei. Diese Attribuierung stellt einen Schutz des eigenen Selbstwertgefühls dar, da man sich nicht selbst als Ursache eines negativen Ereignisses sehen und darstellen will[75].
Die Risiko-Wahl-Theorie wird kritisiert, weil sie nicht thematisiert, dass man Leistung auch dann erbringt, um Belohnungen oder Bestätigungen von anderen, also extrinsische Anreize, zu erlangen. Diese Beschränkung wird im Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs - Modell von Vroom behoben.
3.4.2.2 Die VIE-Theorie von Vroom
War es bei Atkinsons Modell ausschließlich positive Selbstbewertung, die den Wert eines Handlungsziels ausmacht, sind es im sogenannten VIE-Modell von Victor H. Vroom alle subjektiv bewerteten Konsequenzen, die das Ausführen einer Handlung verursachen können. Auf diese Weise wird es erst möglich, beispielsweise die vielfältigen positiven und negativen Anreize einer gegebenen Berufssituation zu berücksichtigen (z.B. höhere Vergütung, weniger Freizeit)[76]. Die Erweiterung um die antizipierten Ergebnis-Konsequenzen macht es auch notwendig, das Erwartungskonzept zu differenzieren.
Die Logik der Vroom-Theorie wird durch die Abbildung 3-5 veranschaulicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3-5: VIE-Theorie nach Vroom in Heckhausen (1989)[77]
Victor H. Vroom stützt seine Motivationstheorie mathematisch auf drei Variablen, die Einfluss auf die Leistungsmotivation haben[78]:
Diese wären:
(1) Valenz (V), die Stärke der Begünstigung bestimmter Objekte oder Handlungen für das Individuum gegenüber dem erreichbaren Ziel oder Ergebnis. Das Ergebnis kann als interessant, ablehnend oder unbedeutend empfunden werden. Interessante Valenz kann Geld und Belohnung sein. Negative Valenz hingegen kann z. B. Gefahr darstellen. Bei unbedeutender Valenz ist man dem Ergebnis gegenüber neutral.
(2) die Instrumentalität (I) bezeichnet den Schätzwert subjektiver Wahrscheinlichkeit, von der das Individuum meint, dass das Ergebnis eintritt. Der Wert der Instrumentalität kann zwischen - 1 (d.h. der Handlungsausgang führt voraussichtlich nicht zum Ziel) und + 1 (d.h. der Zielerreichung) liegen.
(3) die Erwartung (E) bedeutet, die subjektive Wahrscheinlichkeit des konkreten Handlungsausganges, die zwischen 0 und 1 liegt, einzubeziehen.
Die darauf aufbauende mathematische Formel drückt somit aus, dass die Anstrengung eines Individuums, seine Ziele zu erreichen, als ein Produkt aus seinen Erwartungen (E) und der Valenz (V), die dieses Resultat für den Betreffenden hat, darstellbar ist.
So ist die Motivation also das mathematische Produkt dieser Komponenten:
Motivationsformel nach Vroom[79]
M=V*E(Instrumentalität)
Die mathematische Formel ermöglicht die exakte empirische Untersuchung der Vroom-Theorie, wobei die Mehrheit der Studien bestätigt, dass mit diesen Variablen subjektiv wichtige Entscheidungen gut vorhersehbar sind. Auch Mitarbeiterbefragungen können hiermit adäquat durchgeführt werden[80].
Ein Mitarbeiter wird eine Motivation, also hohe Leistungen, beispielsweise nur dann erbringen, wenn er eine große Wahrscheinlichkeit darin sieht, dass persönliche Anstrengungen auch zu hoher Arbeitsleistung führen oder wenn eine erhebliche Wahrscheinlichkeit darin gesehen wird, dass gute Arbeitsleistung zu erwünschten persönlichen Zielen führt und wenn diese Ziele und Ergebnisse (z.B. Bezahlung) als positiv und attraktiv für den Mitarbeiter empfunden werden.
Kritiker werfen der Vroom-Theorie „Modellplatonismus“, d.h. die Kreation eines Motivationsmodelles um der Kreation willen, vor. Durchaus kann Motivation aufgrund ihrer in den vorigen Kapitelabschnitten angedeuteten Komplexität nur schwer in quantitativen Modellen abgebildet werden[81]. Trotz seiner Differenzierung der Wertkomponente berücksichtigt das VIE-Modell jedoch im Grunde nur extrinsische Anreize und vernachlässigt die in der Tätigkeit selbst liegende intrinsische Motivation, die gerade bei interessengeleitetem Handeln von zentraler Bedeutung ist[82].
3.4.2.3 Equity – Theorie nach Adams
Der Sozialpsychologe John Stacey Adams geht ebenfalls von dem Gedanken aus, dass ein Arbeitnehmer sein Arbeitsverhältnis als wechselseitige Beziehung zwischen sich und dem Unternehmen betrachtet. In dem auch als „Equity-Theorie“ bezeichneten Modell wird versucht zu erklären, wie der Entstehungsprozess der Motivation verläuft. Hierbei wird
davon ausgegangen, dass jeder Mitarbeiter bestrebt ist, zwischen sich und seinen Arbeitskollegen ein soziales Gleichgewicht herzustellen, was die folgende Formel veranschaulicht[83]:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Sind die Anreiz-Beitragsverhältnisse der Vergleichsperson(en) ausgeglichen, entsteht ein Gefühl der Gerechtigkeit. Kommt es aber zu Ungleichgewichten, werden die Mitarbeiter motiviert, das kognitive Gleichgewicht wiederherzustellen, um entstehende Spannungen abzubauen[84].
Dies kann je nach Situation durch verschiedene Maßnahmen erfolgen:
- Der Mitarbeiter verändert sein eigenes Input-Output-Verhältnis, indem eine Adaption seiner Arbeitsleistung an seiner Vergleichsperson erfolgt, der Mitarbeiter könnte hierzu seine Arbeitsleistung erhöhen oder verringern.
- Veränderte subjektive Wahrnehmung des eigenen/fremden In- oder Outputs
- Wechsel der Vergleichsperson
- Der Mitarbeiter versucht in anderen Unternehmensbereichen aktiv zu werden
- oder als letzte Möglichkeit: die Kündigung
In Studien wurde beispielsweise nachgewiesen, dass es bei einer Unterbezahlung mit Zeitlohn zu einer abnehmenden Produktivität, bei einer Unterbezahlung mit Stücklohn zu einer Abnahme der Qualität kommt. Demnach führt eine Überbezahlung bei Zeitlohn zu einem Anstieg der Produktivität sowie bei Stücklohn zu einem Anstieg der Qualität[85].
Bei der Gerechtigkeitstheorie wird kritisiert, dass sie relativ vage formuliert ist und daher kaum empirisch überprüfbare Prognosen zulässt. Im Hinblick auf die Motivierung kann sie aber dazu beitragen, Führungskräfte für die Reaktionen ihrer Mitarbeiter zu sensibilisieren. Somit lässt sich für Arbeitgeber empfehlen, dass sie sich permanent darum bemühen sollten, eine „Gleichheitssituation“ bzw. „Gerechtigkeit“ ( Lohngerechtigkeit) zwischen den Mitarbeitern herzustellen, um Demotivation und Unzufriedenheit der Mitarbeiter im Unternehmen vorzubeugen[86].
3.4.3 Spezifische Motivationsausprägungen
3.4.3.1 Arbeitsmotivation
Da in dieser Bachelorarbeit ebenfalls die Motivation der Studenten in den Praxisphasen analysiert wird, ist es an dieser Stelle kurz angebracht, auch eine Definition über die Motivation in der Praktikumsstelle bzw. hinsichtlich der Arbeitsmotivation zu geben. Diese kann näherungsweise gleichgesetzt werden mit der Motivation der Studierenden in ihren Praktikumsunternehmen.
Prägende Motive für die Arbeitsmotivation sind hierbei das Leistungsmotiv, das Anschlussmotiv (also das Bedürfnis nach Vertrautwerden und Geselligsein mit anderen und den damit verbundenen Gefühlen von Zugehörigkeit und Geborgenheit[87]) sowie das Machtmotiv (nach Kleinbeck, 1996)[88].
Genauso wie in der allgemeinen Definition der Motivation hat auch arbeitsbezogenes Verhalten seinen Ausgangspunkt in der „Situation“. Damit die persönlichen Motive in der Arbeitssituation wirklich ihre Anwendung finden können, muss der Arbeitsinhalt so gestaltet sein, dass sie deckungsgleich ist mit der jeweiligen Motivausprägung (siehe oben). Diese Besonderheiten der Handlungssituation werden Motivierungspotenziale genannt. Bezogen auf den dualen Studiengang der BWL auf der BHT entsteht eine hohe Arbeitsmotivation in den Praxisphasen also dann, wenn die Motivierungspotentiale der Arbeit bspw. in den Praxisphasen mit den persönlichen Motiven des Arbeitnehmers–in dem Fall denen des BWL-Dual Praktikanten–übereinstimmen.
Damit bei einer Person mit hoher Ausprägung des Anschlussmotivs eine große Arbeitsmotivation entstehen kann, muss sich die Arbeitstätigkeit durch ein hohes anschlussthematisches Motivierungspotential auszeichnen. Konkret heißt dies an Arbeitsstellen, dass sich bei ihrer Arbeitstätigkeit viele Gelegenheiten bieten sollten, soziale Kontakte zu knüpfen und sie zu pflegen. Beispiele hierfür sind Gruppenarbeiten oder das gemeinsame „Feierabendbier“ nach getaner Arbeit. Ist nun das individuelle Anschlussmotiv stark ausgeprägt, das anschlussthematische Motivierungspotential der Arbeit aber niedrig, kann keine hohe Arbeitsmotivation entstehen[89].
Generell herrscht in der Fachliteratur in Bezug auf die Arbeitsmotivation eine Vielzahl relativ uneinheitlicher Erklärungsversuche vor, was darauf schließen lässt, dass trotz jahrelanger Forschung keine gemeinsame Begriffsbestimmung der Motivationspsychologie vorliegt.[90]
Neben dem reinen Erkenntnisinteresse der angewandten Motivationsforschung steht das Bedürfnis der Praxis, aus den verfügbaren Theorien Interventionsstrategien abzuleiten. Dabei sind die meisten Theorien der Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit vor mehr als 20 Jahren formuliert worden und zwischenzeitlich fanden sie bei Praktikern und Forschern nur noch wenig Aufmerksamkeit. Inzwischen wird jedoch wieder für eine intensive Beschäftigung mit den Bedingungen für Motivation und Zufriedenheit am Arbeitsplatz plädiert, da deutlich wurde, dass eine hohe Leistung des Arbeitnehmers nicht allein durch technische Innovationen sichergestellt werden kann. Vielmehr hängt der Erfolg eines Unternehmens vor allem von der Bereitschaft seiner Mitarbeiter ab, die sich für die Unternehmensziele einsetzen[91]
3.4.3.2 Studienmotivation
Auch der Titel dieser Arbeit–der Begriff der „Studienmotivation“–soll an der Stelle erläutert werden.
Zunächst ist festzuhalten, dass sie ein komplexes Konstrukt darstellt, welches in der empirischen Bildungsforschung als einer der zentralen Begriffe angesehen wird, zumal eine Auseinandersetzung mit demselben in nahezu keiner Untersuchung, den Studienabbruch, den Studienwechsel, das Lernverhalten oder aber die geschlechterspezifische Bevorzugung von Studienfächern betreffend, vermeidbar ist. Trotzdem lässt sich noch heute selten eine Fachliteratur finden, wo eine einheitliche Definition anzutreffen ist.
[...]
[1] Bundesministerium für Bildung und Forschung (2010), http://www.bmbf.de/de/3336.php, (Stand 20.12.10).
1999 kam es zur Einleitung der so genannten Bologna-Hochschulreform. Kernziel dieses Prozesses war die Harmonisierung des europäischen Hochschulwesens und die Verkürzung der Studiendauer. Die an den Hochschulen erteilte Vorgabe, international vergleichbare Abschlüsse und eine konsekutive Studienstruktur zu schaffen, führte schließlich zur Umstellung der bisherigen Magister- und Diplomstudiengänge auf Bachelor- und Master-Strukturen. Im Zuge dieser Umstellung sollen u. a. die Mobilität von Studierenden im europäischen Hochschulraum gefördert und die Transparenz der Studienstrukturen erhöht werden (Bundesministerium für Bildung und Forschung.
[2] CHE (Gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung GmbH) und HIS (Hochschul-Informations-System GmbH) unterstützen die Hochschulen sowie die deutsche Hochschulpolitik durch innovative Hochschulevaluationen und Umfragen.
[3] http://www.sueddeutsche.de/karriere/bachelor-reform-qualitaet-wo-bist-du-1.394135, (Stand: 04.02.11).
[4] Aktuell gibt es in Deutschland mehr als 14.000 Studiengänge. Das hat die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ermittelt. Das Angebot in Deutschland hat sich in den letzten Jahren also um mehr als ein Viertel (27%) vergrößert (3000 neue Studiengänge).
http://www.welt.de/wirtschaft/karriere/bildung/article12673127/Erstsemester-muessen-aus-14-000-Faechern-waehlen.html, (Stand: 02.03.2011).
[5] HIS Projektbericht Februar (2008), http://www.bmbf.de/pub/his-projektbericht-studienabbruch.pdf, S. 1 f.(02.03.2011)
[6] Vgl. Voss, Studienzufriedenheit, Analyse der Erwartungen von Studierenden(2007), S. 1ff.
[7] Vgl. Ulrich/ Voss, Hochschul Relationship Marketing, (2010), S. 44–48.
[8] Einfachheitshalber wird im Folgenden die „Beuth Hochschule für Technik Berlin“ mit „BHT“ und „Betriebswirtschaftslehre“ mit „BWL“ abgekürzt
[9] Berliner Hochschulgesetz (Fassung 12.07.2007); http://www.berlin.de/imperia/md/content/senwfk/pdf-dateien/recht/berliner_hochschulgesetz.pdf?start&ts=1215512689&file=berliner_hochschulgesetz.pdf, (Stand: 25.02.11).
[10] Vgl. Felser, „Motivationstechniken“, (2004), S .7 ff.
[11] http://www.beuth-hochschule.de/8/, (Stand: 01.03.2011).
[12] http://www.beuth-hochschule.de/23/, (Stand: 17.03.2011).
[13] http://studiengang.beuth-hochschule.de/bwl/zulassung/, (Stand 03.02.2011).
[14] Beuth Hochschule für Technik Berlin (Mai 2010); aktueller Werbeflyer des dualen Studiengangs der BWL
[15] http://studiengang.beuth-hochschule.de/bwl/studienorganisation/, (Stand: 20.01.2011).
[16] http://studiengang.beuth-hochschule.de/bwl/studienorganisation/, (Stand: 20.01.2011).
[17] Quelle: relevante Auszüge aus dem Modulhandbuch; Studienordnung für den konsekutiven Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaftslehre des Fachbereichs I Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften der Technischen Fachhochschule Berlin, (Stand WS 2010/11).
[18] HIS Projektbericht Februar (2008),http://www.bmbf.de/pub/his-projektbericht-studienabbruch.pdf, S. 1f.(10.02.2011)
[19] HIS (Hochschul-Informations-System GmbH) unterstützt die Hochschulen sowie die deutsche Hochschulpolitik durch innovative Hochschulevaluationen und Umfragen.
[20] Vgl. Reissert/ Konnerth, Hochschulranking, Evaluation von Studium und Lehre, (2001), S. 181 f.
[21] http://www.arbeitsagentur.de/Dienststellen/RD-N/Kiel/AA/01-AA-Seiten-nach-Navigation/01-Buerger-Buergerinnen/Publikation/pdf/Info-2.pdf; S. 5 f., (Stand: 03.03.2011).
[22] HIS-Projektbericht (12. Januar 2010); "Ursachen des Studienabbruchs in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen"; Im Studienjahr 2007/08 hat sich die FH Gießen-Friedberg an der Exmatrikuliertenbefragung der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) beteiligt. 230 Exmatrikulierte ohne Abschluss der Hochschule wurden zu ihren Studienerwartungen und zur Studienwirklichkeit befragt. Insgesamt beteiligten sich an der Umfrage durch Rücksendung des Fragebogens rund 2.500 Studienabbrecher von 54 Universitäten und 33 Fachhochschulen.
[23] Vgl. Heublein, et al., Ursachen des Studienabbruchs in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen, (2009), S. 162.
[24] Quelle: HIS Projektbericht 2008/09.
[25] Sonderauswertung der HIS-Studienabbruchstudie, Studienerfolg an Fachhochschulen, Entscheidende Gründe des Studienabbruchs im Studienbereich Wirtschaftswissenschaften an Hochschulen(2009), S. 12.
[26] Vgl. Heublein, et al., Ursachen des Studienabbruchs in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen, (2009), S. 164 f.
[27] Die hellblauen Zahlen symbolisieren hierbei die errechnete Studienabbruchquote des jeweiligen Jahrgangs.
[28] Quelle: Kennzahlen mit freundlicher Unterstützung von Frau Plümer aus dem Fachbereich I und eigene Berechnung der Studienabbruchquote; Tabelle: eigene Erstellung.
[29] Vgl. Maria Puca, Rosa, Historische Ansätze der Motivationspsychologie, (2009), S. 109 ff.
[30] Der amerikanische Großunternehmer F. W. Taylor war der Begründer der strikten Arbeitsteilung in Produktionsstätten in Form der personellen und räumlichen Trennung zwischen den leitenden und ausführenden Organen (Manager/Arbeiter). Hierbei sollte die Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer von finanziellen Anreizen abhängen. Doch wurde das Humankapital komplett vernachlässigt, weshalb es von vielen Kritikern als ein mechanisches Menschenbild bezeichnet wurde. es wurde auch „Taylorismus“ oder „Scientific Management“ bezeichnet, eine Zuspitzung dieses Prinzips war der „Fordismus“
[31] Vgl. Kieser, Managementlehre und Taylorismus, (2002), S. 65 – 99.
[32] Vgl. Hill/ Fehlbaum./Ulrich, Organisationslehre, (1992), S. 424.
[33] Vgl. Staehle, Management, (1991), S. 38.
[34] Vgl. Scholl, Wolfgang, Bedürfnisorientierte Organisationstheorien, (2007), S. 70 f.
[35] http://www.uni-konstanz.de/FuF/Verwiss/scherer/downloads/VorlOrgaWS00_01/VOrga6.PDF, (26.02.2011).
[36] Vgl. Rosenstiel, Motivation im Betrieb, (2000), S. 6.
[37] Vgl. Nerdinger, Lehrbuch der Personalpsychologie, (2001), S. 350 f.
[38] Vgl. Lexikon für Psychologie und Pädagogik, (18.03.2011) http://lexikon.stangl.eu/335/motiv/
[39] Vgl. Heckhausen, Jutta, Motivation und Handeln, (2010), S. 300.
[40] Vgl. Rheinberg, Motivation,, Handbuch der allgemeinen Psychologie (2009), S. 668–673.
[41] Vgl. Sprenger, Mythos Motivation, (2002), S. 21 ff.
[42] Vgl. Nerdinger, Lehrbuch der Personalpsychologie, (2001), S. 350 f.
[43] Vgl. Rheinberg, Motivation, (2008), S. 70.
[44] Vgl. Rosenstiel, Motivation im Betrieb, (2000),S. 6–7.
[45] Vgl. Rheinberg, Falko, Motivation, (2008), S. 69 f.
[46] Vgl. Schmidt/ Herzer, Wege in die Naturwissenschaften, (2006), S.162 ff.
[47] Vgl. Asmussen, Übergänge im Bildungssystem, Motivation – Entscheidung – Zufriedenheit, (2006), S. 100.
[48] Vgl. Rosenstiel, Motivation im Betrieb, (2001), S. 55 ff.
[49] http://elearn.jku.at/wiki/index.php/Gestalten_und_Evaluieren_von_eLearning_Szenarien/Aktivierung_und_Bedeutung_von_Teilnehmermotivation, (Stand 07.02.11).
[50] http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/MOTIVATION/Lernmotivation.shtml, (Stand 10.03.2011).
[51] http://www.intrinsische-mitarbeitermotivation.de/S.-5.html, (Stand 10.02.11).
[52] Vgl. Sprenger, Mythos Motivation, (2002), S 67
[53] Vgl. Sprenger, Mythos Motivation, (2002), S 68–77.
[54] Vgl. Rosenstiel, Motivation im Betrieb, (2001),S 56 f.
[55] Vgl. Schmidt,/ Herzer, Wege in die Naturwissenschaften, (2006), S.162 ff.
[56] Vgl. Nerdinger, Lehrbuch der Personalpsychologie, (2001), S. 352 f.
[57] Quelle: Barthel, Karoline Prof. Dr., Personalmanagement Lehrunterlagen (Wintersemester 2009/10).
[58] Vgl. Ulich, Arbeitspsychologie, (2001),S. 45.
[59] Vgl. Brandstätter, Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit, (1999), S. 344–345.
[60] Vgl. Ulich, Arbeitspsychologie, (2001), S. 47 f.
[61] http://www.orga.uni-sb.de/wiener_hp/scholz/archiv/UE3/dunkelgruen/normativ.htm#MH,(Stand: 02.01.2011).
[62] Vgl. Holzkamp-Osterkamp, Grundlagen der psychologischen Motivationsforschung, (1981), S. 36 f.
[63] Quelle: Herzberg, Harvard Business Manager, Motivation–Was Manager und Mitarbeiter antreibt, (2004), S. 78.
[64] http://www.intrinsische-mitarbeitermotivation.de/S.-9.html, (Stand 07.01.2011).
[65] Vgl. Ulich, Arbeitspsychologie(2001), S. 48.
[66] Vgl. Nerdinger, Lehrbuch der Personalpsychologie, (2001), S. 352 f.
[67] Brandstätter, Lehrbuch der Arbeits- und Organisationspsychologie, Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit, (1999), S. 350 f.
[68] Harten-Flitner, Leistungsmotivation und soziales Verhalten, (1978), S. 40.
[69] Vgl. Brandstätter, Lehrbuch Arbeits- und Organisationspsychologie, Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit, (1999), S. 350 f.
[70] Vgl. Wilcke, Studienmotivation und Studienverhalten, (1976), S. 18.
[71] Vgl. Rheinberg,Motivation, (2008),,S. 72.
[72] Vgl. Heckhausen, Hoffnung und Furcht in der Leistungsmotivation, (1963), S.114 –117.
[73] Vgl. Rheinberg,Motivation, (2008),S. 70 ff.
[74] Vgl. Zimbardo/ Gerrig, Psychologie(2004), S.531ff.
[75] http://www.super-vision.biz/Dokumente/VergleichMotivationstheorie.pdf, (Stand 07.03.2011).
[76] Vgl. Brandstätter, Lehrbuch Arbeits- und Organisationspsychologie, Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit, (1999), S. 351 f.
[77] Vgl. Heckhausen, Jutta, Motivation und Handeln, Motivation durch Erwartung und Anreiz, (2010), S. 140.
[78] http://www.12manage.com/methods_vroom_expectancy_theory_de.html, (Stand 01.03.2011).
[79] Quelle: eigene Darstellung.
[80] Vgl. Nerdinger, Lehrbuch der Personalpsychologie, (2001), S. 355.
[81] http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/vie-theorie-von-vroom/vie-theorie-von-vroom.htm,(Stand: 20.12.2010).
[82] http://www.wissenschaft-online.de/abo/lexikon/psycho/10004, (Stand: 18.03.2011).
[83] eigene Darstellung.
[84] Vgl. Nerdinger, Lehrbuch der Personalpsychologie, (2001),S. 366.
[85] http://www.economics.phil.uni-erlangen.de/bwl/lehrbuch/gst_kap4/mottheo/mottheoh.PDF, S. 7, (06.02.2011).
[86] Vgl. Nerdinger, Lehrbuch der Personalpsychologie, (2001), S. 366 f.
[87] http://www.wissenschaftonline.de/sixcms/detail.php?template=d_wo_treffer&_schnellsuche=1&cmsvar%5Bsu_suche%5D=anschlussmotiv, (Stand 18.03.2011).
[88] Lexikon für Psychologie und Pädagogik, (18.03.2011) http://lexikon.stangl.eu/335/motiv/
[89] http://www.assistenztierarzt.ch/download/projekte/Marco_Lizentiat_2005.pdf, S. 12, (Stand: 10.03.2011).
[90] http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/motivation/Studium/lehre/alt/ss05/methodenIISS05/3_130405.pdf, Folie 8, (Stand 06.03.2011).
[91] http://www.wissenschaft-online.de/abo/lexikon/psycho/1312, (Stand 10.03.2011).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (eBook)
- 9783842813274
- DOI
- 10.3239/9783842813274
- Dateigröße
- 5.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Beuth Hochschule für Technik Berlin – Wirtschaftswissenschaften, Duale Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2011 (April)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- motivation studium fragebogen auswertung grundlagen
- Produktsicherheit
- Diplom.de