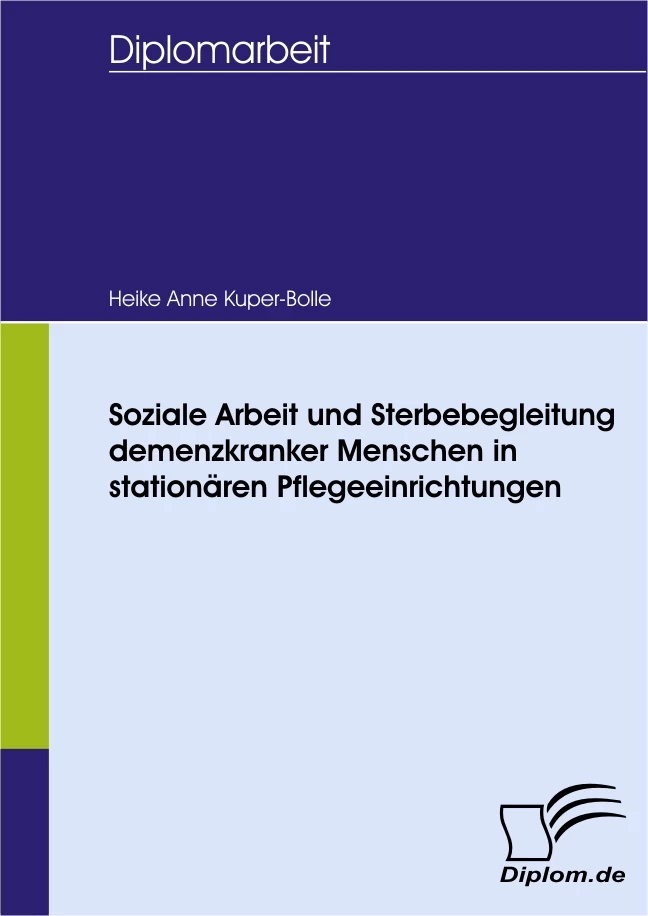Soziale Arbeit und Sterbebegleitung demenzkranker Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen
Zusammenfassung
Ein hohes Lebensalter zu erreichen, entspricht dem Wunsch vieler Menschen. Aber das Alter birgt auch negative Seiten, nimmt doch das Risiko, an einer Demenz zu erkranken zu, je älter die Menschen werden. In Deutschland leben gegenwärtig ca. 1,2 Millionen Demenzkranke, die Zahl soll sich aller Voraussicht nach bis 2040 verdoppeln. Die Zunahme von Demenz-Patienten wird laut epidemiologischen Modellrechnungen auf 1,67 bis 2,2 Millionen im Jahr 2020 steigen.
Ein Großteil der Demenzkranken in Deutschland wird zuhause betreut, sie stellen zudem auch die größte Bewohnergruppe in stationären Pflegeeinrichtungen dar. Demenzerkrankte verbringen im stationären Bereich in der Regel ihre letzten Lebensmonate bzw. -jahre, sodass Pflegeeinrichtungen die Funktion von Sterbeorten übernehmen, ohne jedoch eine Hospizeinrichtung zu sein. Ein Konzept in Anlehnung an Palliativ Care ist erforderlich, um diese sterbenden Demenzerkrankten adäquat versorgen und begleiten zu können.
Palliativ Care ist eng an die Hospizidee angelehnt. Es beinhaltet die größtmögliche Linderung der Beschwerden und die Begleitung der Sterbenden und ihrer Angehörigen auf dem letzten gemeinsamen Weg bis zum Tod. In der palliativen Versorgung gilt die Maxime ambulant vor stationär, diese umzusetzen ist jedoch bei einer fortschreitenden Demenzerkrankung häufig nicht möglich, weil Angehörige ihre sterbenden Angehörigen nicht länger versorgen können.
Viele Angehörige bringen ihr Familienmitglied erst in stationäre Versorgung, wenn sie ihre psychischen und physischen Belastungsgrenzen erreicht bzw. überschritten haben.
Demenzerkrankte leben in ihrer eigenen Welt, die kognitiven Fähigkeiten lassen im Laufe der Erkrankung verstärkt nach, wobei die emotionale Wahrnehmungsleistung oftmals erhalten bleibt. Eine besondere Schwierigkeit in der Betreuung beinhaltet das Erkennen der Bedürfnisse, da im fortgeschrittenen Stadium einer Demenz das Sprachvermögen beträchtlich eingeschränkt ist. Daher benötigen Demenzerkrankte besonders in der letzten Lebensphase intensive Begleitung und Aufmerksamkeit, um ihnen ein würdevolles Sterben zu gewährleisten. Darin äußert sich die Herausforderung an das Personal und verlangt Kompetenzen in der palliativen Versorgung und Begleitung.
Die Soziale Arbeit stellt in der stationären Versorgung die Anforderung, verschiedene Bereiche miteinander zu vernetzten. Das bedeutet, dass Sozialarbeiter Sterbende begleiten und überdies die Angehörigen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Sterbebegleitung im Rahmen von Palliativ Care
2.1. Der Sterbeprozess des Menschen
2.1.1. Die Terminale Phase
2.1.1.1. Sterbephasenmodell nach Elisabeth Kübler-Ross
2.1.2. Die Finalphase bzw. der physiologische Sterbeprozess
2.2. Einblick in die Geschichte von Palliativ Care
2.2.1. Die Verwilderung des Todes
2.2.2. Wegbereiterinnen einer modernen Hospizbewegung
2.2.3. Die Entwicklung der Hospizarbeit in Deutschland
2.3. Palliativ Care
2.3.1. Allgemeine Begriffserklärung
2.3.2. Definition der WHO von
2.4. Leitlinien von Palliativ Care
2.4.1. Der sterbenskranke Mensch und seine ihm nahestehenden Menschen stehen im Zentrum des Dienstes
2.4.2. Keine aktive Sterbehilfe
2.4.3. Ehrenamtlichkeit
2.4.4. Ein multiprofessionelles Team steht dem Sterbenden und seinen Angehörigen zur Verfügung
2.4.5. Symptomkontrolle und Kontinuität der Versorgung
2.4.6. Ermöglichung von Sterben im eigenen Heim
2.4.7. Trauerbegleitung
2.5. Palliativ Care in der stationären Altenhilfe
2.6. Zusammenfassung
3. Demenzerkrankung
3.1. Demenz
3.1.1 Definition im DSM-IV
3.1.2. Definition im ICD
3.2. Formen der Demenz
3.2.1. Vaskuläre Demenz
3.2.2. Sekundäre Demenzform
3.2.3. Primär-degenerative Demenzform
3.3. Verlauf und Symptomatik der Demenz vom Alzheimer-Typ
3.4. Besondere Symptome im Spätstadium einer Demenz gemäß des Alzheimer-Typs
3.4.1. Sprachzerfall
3.4.2. Persönlichkeitsverfall
3.4.3. Schmerzen
3.4.4. Unruhe und Aggressivität
3.4.5. Flüssigkeits- und Nahrungsverweigerung
3.5. Häufige Todesursachen
3.6. Zusammenfassung
4. Die Herausforderung, Demenzerkrankte im Sterbeprozess im Rahmen von Palliativ Care zu begleiten
4.1. Besonderheiten beim Sterbeprozess von Demenzerkrankten
4.1.1. Unterschiede zur Begleitung Nicht-Demenzerkrankter
4.1.1.1. Erschwerte Kommunikation
4.1.1.2. Höherer Pflege- und Betreuungsaufwand
4.1.1.3. Verhaltensauffälligkeiten
4.1.1.4. Biografieorientiertes Arbeiten
4.1.1.5. Tagestrukturgestaltung
4.1.1.6. Kontinuierliche Einbindung von Bezugspersonen
4.2. Spezifische Bedürfnisse im Verlauf des Sterbeprozesses
4.3. Die palliative Begleitung und Versorgung von Demenzkranken
4.3.1. Symptomkontrolle bei Demenz
4.3.2. Die palliative Begleitung sterbender Demenzkranke
4.4. Grenzen von Palliativ Care bei Demenzerkrankten
4.5. Die Zusammenarbeit von sozialer Arbeit und Altenpflege
4.6. Zusammenfassung
5. Die Aufgabenbereiche der sozialen Arbeit in der Sterbebegleitung von Demenzerkrankten in stationären Pflegeeinrichtungen
5.1. Fachliche Voraussetzungen
5.2. Aufgaben der sozialen Arbeit in der Sterbebegleitung von Demenzkranken
5.2.1. Psychosoziale Begleitung des sterbenden Demenzkranken
5.2.1.1. Basale Stimulation
5.2.1.2. Biografiearbeit
5.2.1.3. Integrative Validation
5.2.1.4. Die Bedeutung der Religion in der Sterbebegleitung
5.3. Begleitung der Angehörigen durch die Soziale Arbeit
5.3.1. Psychosoziale Begleitung
5.3.2. Trauerbegleitung der Angehörigen
5.3.2.1. Partielle Trauer
5.3.2.2. Die vier Traueraufgaben von Worden
5.3.2.3. Trauerbegleitung
5.3.3. Beratung und Information über sozialrechtliche Fragen
5.4. Weitere Aufgaben der Sozialen Arbeit in einer stationären Pflegeeinrichtung
5.4.1. Koordination, Befähigung und Anleitung ehrenamtlicher Mitarbeiter
5.4.2. Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltungsaufgaben
5.4.3. Dokumentation und Evaluation
5.4.4.Psychohygiene
5.5. Überblick über Sozialarbeiterische Methoden und Arbeitsformen
5.5.1. Methode und Konzept – Versuch einer Definition
5.5.2. Soziale Einzelfallhilfe
5.5.3. Soziale Gruppenarbeit
5.5.4. Gemeinwesenarbeit
5.5.5. Case-Management
5.5.6. Empowerment
5.5.7. Supervision
5.6. Zusammenfassung
6. Schlussbemerkung
7. Abkürzungsverzeichnis
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Ein hohes Lebensalter zu erreichen, entspricht dem Wunsch vieler Menschen. Aber das Alter birgt auch negative Seiten, nimmt doch das Risiko, an einer Demenz zu erkranken zu, je älter die Menschen werden.
In Deutschland leben gegenwärtig ca. 1,2 Millionen Demenzkranke, die Zahl soll sich aller Voraussicht nach bis 2040 verdoppeln.
Die Zunahme von Demenz-Patienten wird laut epidemiologischen Modellrechnungen auf 1,67 bis 2,2 Millionen im Jahr 2020 steigen (vgl. Falk 2004, S. 9).
Ein Großteil der Demenzkranken in Deutschland wird zuhause betreut, sie stellen zudem auch die größte Bewohnergruppe in stationären Pflegeeinrichtungen dar.
Demenzerkrankte verbringen im stationären Bereich in der Regel ihre letzten Lebensmonate bzw. -jahre, sodass Pflegeeinrichtungen die Funktion von Sterbeorten übernehmen, ohne jedoch eine Hospizeinrichtung zu sein.
Ein Konzept in Anlehnung an Palliativ Care ist erforderlich, um diese sterbenden Demenzerkrankten adäquat versorgen und begleiten zu können.
Palliativ Care ist eng an die Hospizidee angelehnt. Es beinhaltet die größtmögliche Linderung der Beschwerden und die Begleitung der Sterbenden und ihrer Angehörigen auf dem letzten gemeinsamen Weg bis zum Tod.
In der palliativen Versorgung gilt die Maxime „ambulant vor stationär“, diese umzusetzen ist jedoch bei einer fortschreitenden Demenzerkrankung häufig nicht möglich, weil Angehörige ihre sterbenden Angehörigen nicht länger versorgen können.
Viele Angehörige bringen ihr Familienmitglied erst in stationäre Versorgung, wenn sie ihre psychischen und physischen Belastungsgrenzen erreicht bzw. überschritten haben.
Demenzerkrankte leben in ihrer eigenen Welt, die kognitiven Fähigkeiten lassen im Laufe der Erkrankung verstärkt nach, wobei die emotionale Wahrnehmungsleistung oftmals erhalten bleibt. Eine besondere Schwierigkeit in der Betreuung beinhaltet das Erkennen der Bedürfnisse, da im fortgeschrittenen Stadium einer Demenz das Sprachvermögen beträchtlich eingeschränkt ist. Daher benötigen Demenzerkrankte besonders in der letzten Lebensphase intensive Begleitung und Aufmerksamkeit, um ihnen ein würdevolles Sterben zu gewährleisten.
Darin äußert sich die Herausforderung an das Personal und verlangt Kompetenzen in der palliativen Versorgung und Begleitung.
Die Soziale Arbeit stellt in der stationären Versorgung die Anforderung, verschiedene Bereiche miteinander zu vernetzten. Das bedeutet, dass Sozialarbeiter Sterbende begleiten und überdies die Angehörigen beraten und unterstützen. Speziell die Angehörigenbetreuung bedarf eines Großteils der Sozialarbeit.
Auch eine unterstützende Begleitung in der Trauerphase nach dem Tod des Demenzerkrankten gehört gegebenenfalls zu den Aufgabenbereichen des Sozialarbeiters.
Des Weiteren sind Ehrenamtliche zu schulen und Öffentlichkeitsarbeit zu tätigen. Die Funktionen eines Sozialarbeiters verlangen auch ein Grundlagenwissen in Palliativ Care.
Vorliegende Diplomarbeit skizziert die möglichen Aufgaben, aber auch fachlichen Voraussetzungen, des Sozialarbeiters in der Sterbebegleitung von demenzerkrankten Menschen in Pflegeeinrichtungen.
Ergänzend stellt sich die Frage, welche Tätigkeiten in der Sterbebegleitung eines Demenzerkrankten tatsächlich in einer stationären Einrichtung realisierbar sind und worin der Sozialarbeiter seine Dienste in der palliativen Begleitung des Dementen sieht.
Durch die Arbeit als Ergotherapeutin hatte ich vor einigen Jahren die Möglichkeit, Demenzkranke beim Sterben zu begleiten. Die Belastung und Hilflosigkeit, die dieser Prozess bei Angehörigen auslöst, und die zu berücksichtigenden Bedürfnisse der Demenzerkrankten, wurden in dieser Zeit erlebbar. Die vielseitige Arbeit der zuständigen Sozialarbeiterin in der Pflegeeinrichtung, deren Fokus vornehmlich auf der Begleitung der demenzerkrankten Bewohner lag, erschien der Autorin vorliegender Untersuchung außerordentlich interessant.
Das Interesse verstärkte sich durch eine verfasste Seminararbeit über Palliativ Care und weckte den Wunsch, mehr über diesen Themenkomplex zu erfahren, sodass im Anschluss diese Analyse entstand.
Folgende Arbeit erörtert, welche Möglichkeiten Sterbebegleitung im Rahmen von Palliativ Care bietet und worin die Aufgaben der sozialen Arbeit liegen, um Demenzerkrankte und ihre Angehörigen auf dem letzten Lebensweg würdevoll begleiten zu können. Dabei liegt der Fokus ausschließlich auf der sozialen Arbeit in stationären Altenpflegeeinrichtungen.
Der sozialarbeiterische Bezug der Diplomarbeit basiert auf der Annahme von Zielsetzungen, Methoden, aber auch Voraussetzungen für Sozialarbeiter/innen in der Sterbebegleitung.
Zu Anfang der Arbeit wird der Sterbeprozess des Menschen dargestellt. Anschließend folgt ein Überblick über die Geschichte und das Konzept von Palliativ Care. Das dritte Kapitel widmet sich der Demenzerkrankung. Zu diesem Zweck wird, nach einer kurzen Beschreibung der Erkrankung, vor allem auf die Besonderheiten und Probleme der Erkrankung im Spätstadium einer Demenz eingegangen. Dazu gehört die Symptomatik, die den Umgang mit Demenzkranken erschweren kann.
Im vierten Kapitel werden die bisherigen beiden Themen Sterbebegleitung/Palliativ Care und Demenz zusammengeführt und die Aufgaben und Merkmale von Palliativ Care bei Demenz dargestellt.
Im letzten Kapitel werden die Voraussetzungen, Funktionen und Arbeitsformen der sozialen Arbeit in Palliativ Care bei Demenzerkrankten vorgestellt. Gegenstand der Ausarbeitung sind die Demenzkranken, die Angehörigenarbeit sowie die Trauerbegleitung. In Bezug auf letzteres wird speziell die partielle Trauer erörtert, die besonders häufig bei Angehörigen Demenzerkrankter auftritt. Um einen Überblick über die Formen der Trauerbegleitung zu ermöglichen, werden zudem die Arten und Phasen der Trauer vorgestellt.
Zum Abschluss der Diplomarbeit erfolgt eine Schlussbemerkung.
Vorliegender Text verzichtet bewusst auf die geschlechtsspezifischen Endungen, um den Lesefluss nicht zu unterbrechen. Selbstverständlich sind mit der hier gewählten Form weibliche und männliche Personen gleichermaßen bezeichnet.
2. Die Sterbebegleitung im Rahmen von Palliativ Care
Der Sterbeprozess beginnt bei einem Menschen gegebenenfalls schon Monate vor seinem Tod. Das Sterbephasenmodell von Elisabeth Kübler-Ross, welches Nicht-Demenzkranke durchleben, wird erläutert, um die Besonderheit des Sterbeprozesses bei Demenzerkrankten im Vergleich darzustellen (vgl. Punkt 4.1.).
Danach wird das Konzept der Palliativ Care vorgestellt, wobei ein erster Blick in die Geschichte unerlässlich ist, um die Entwicklung der Sterbebegleitung im hospizlichen Rahmen zu verstehen. Die Definition und die Leitlinien von Palliativ Care geben einen Überblick über das Konzept.
Zum Abschluss des Kapitels werden die Möglichkeiten von Palliativ Care in stationären Altenpflegeeinrichtungen diskutiert.
2.1. Der Sterbeprozess des Menschen
2.1.1. Die Terminale Phase
Der Prozess des Sterbens eines Menschen kann sich über Wochen bis Monate hinziehen. Bei einem Nicht-Demenzerkrankten beginnt das Sterben eines Menschen mit der Terminalphase.
In diesem Stadium erfährt ein Mensch, dass er in absehbarer Zeit sterben wird (vgl. Nauck et. al. 2007, S. 221). Die Verarbeitung dieser Diagnose fällt unterschiedlich aus. Einige Betroffene gehen mit der Diagnose nüchtern um und verfassen ihr Testament, andere wiederum verdrängen die Nachricht.
Derartige Verhaltensweisen untersucht die Schweizer Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross. Sie entwickelt nach vielen Gesprächen mit Sterbenden und jahrelanger Forschungsarbeit das Sterbephasenmodell.
In diesem Modell definiert sie die verschiedenen Phasen, welche der Sterbende nach Bekanntgabe einer tödlichen Diagnose psychisch durchlebt.
Diese fünf Phasen über das Verhalten und die Gefühle von Sterbenden dienen lediglich zur Orientierung. Sie haben keine festgelegte Reihenfolge und können sich auch wiederholen.
2.1.1.1. Sterbephasenmodell nach Elisabeth Kübler-Ross
1. Phase: Nichtwahrhabenwollen
In dieser Phase kann der Sterbende die Diagnose nicht glauben, ist traumatisiert und hält sie für einen Irrtum. Die behandelnden Ärzte werden als inkompetent angesehen und häufig werden Zweitdiagnosen eingeholt.
Der Sterbende verbannt die Diagnose aus seinem Bewusstsein. Diese Verdrängung hilft, die traumatische Erfahrung zu verarbeiten. Eine Schutzfunktion der menschlichen Psyche, um emotionale Überbelastung zu vermeiden. Die Verdrängung hilft den Sterbenden, das Undenkbare denkbar zu machen.
Es verharren nur wenig Sterbende bis zum Lebensende in dieser Phase (vgl. Student 2007, S. 41).
2. Phase: Zorn
Wut ist das vorherrschende Gefühl dieser Phase. Der Kranke empfindet Wut gegenüber der Erkrankung, aber auch gegen Gott, der diese Situation zulässt. Häufig spielen Zorn und Neid gegenüber gesunden Menschen eine Rolle. Der sterbende Kranke ist unzufrieden, beschuldigt ungerechterweise andere und niemand kann ihm etwas recht machen. Dieses Verhalten verursacht oftmals Streit mit Familienmitgliedern und Freunden (vgl. Kübler-Ross 2001, S. 76–79).
3. Phase: Verhandeln
Die Verhandlungsphase benennt in der Regel eine kurze Phase. Für den Sterbenden ist die Zeit des Verdrängens vorbei und er akzeptiert den herannahenden Tod als unabwendbar.
Diese Phase ist gekennzeichnet durch die Versuche, mit den Ärzten mehr Lebenszeit auszuhandeln. Zu diesem Zweck ist der Kranke bereit, verschiedene Formen alternativer Heilmethoden anzuwenden.
Der Kranke betet zu Gott, um mehr Lebenszeit zu erwirken, wenn er sich als Gegenleistung guten Dingen verschreibt. Es werden immer neue Ziele gesetzt, wenn eins erreicht wurde (vgl. Kübler-Ross 2001, S. 119–121).
4. Phase: Depression
Die depressive Phase zeichnet sich durch Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung aus. Der nahende Tod und seine Endgültigkeit gelangen ins Bewusstsein des Sterbenden. Kübler-Ross unterscheidet zwischen zwei Perspektiven der Depression. Einerseits gilt die Depression als Reaktion auf die wahrgenommenen Verluste. Der Kranke begreift, was er in seinen Leben noch erreichen wollte und nicht erreicht hat. Er trauert um sein eigenes Leben. Letzte Dinge werden oft noch geregelt und vorhandene Konflikte aus dem Weg geräumt.
Andererseits gibt es auch die vorbereitende Depression. Der Sterbende sieht den noch drohenden Verlust seines Lebens. Er möchte nicht mehr kämpfen und trauert im Stillen. Dies führt dann häufig zu Konflikten mit den Ärzten und Angehörigen, falls noch lebensrettende Möglichkeiten existieren (vgl. Kübler-Ross 2001, S. 123–126).
5. Phase: Zustimmung
Diese letzte Phase erreichen nicht alle Sterbenden.
Der Tod wird in Ruhe erwartet und akzeptiert. Der Kranke hat Frieden mit sich und der Welt geschlossen. Er zieht sich zurück und lehnt häufig Besuch und Gespräche ab. Er löst im Stillen seine Bindungen zur Außenwelt. Dies führt bei Angehörigen vielfach zu Unverständnis, sie fühlen sich abgelehnt und können mit dieser Situation schlecht umgehen, weil sie den Sterbenden nicht loslassen möchten (vgl. Kübler-Ross 2001, S. 153–155).
2.1.2. Die Finalphase bzw. der physiologische Sterbeprozess
Die finale Phase kennzeichnet die letzten drei Tage vor dem Tode, bevor der tatsächliche Sterbeprozess beginnt. Der Beginn dieser Phase kann nicht genau definiert werden (vgl. Nauck et. al. 2007 S. 221).
Die Symptome haben sich nicht verschlechtert, sondern der Sterbende wirkt entspannt und zieht sich verstärkt nach Innen zurück. Diese Bewusstseinstrübung und zunehmende Schwäche sind Zeichen des herannahenden Todes (vgl. Student 2007, S. 44).
Weitere Symptome sind Veränderungen des Atems (Atempausen, Rasselatmung) durch Nachlassen des Schluckreflexes und Ansammlung von Flüssigkeit, wodurch das Rasseln verursacht wird.
Kalte Extremitäten, schwacher Puls, marmorierte Haut, offener Mund, ein in die Ferne gerichteter Blick und ein eingefallenes Gesicht mit spitzer Nase und Kinn („Todesdreieck“) kündigen den baldigen Tod an (vgl. Pribil 2005, S. 198).
Bevor der Arzt den Tod eines Menschen feststellt, muss er beim klinischen Tod auf unsichere und sichere Todeszeichen achten.
Zu den unsicheren Todeszeichen gehören Auskühlung (algor mortis), keine erkennbare Atmung, Puls und Herzschlag, Bewusstlosigkeit und eine Lähmung des Muskelsystems mit einer Areflexie.
Diese Zeichen können auch bei lebenden Menschen im fortgeschrittenen Sterbeprozess vorhanden sein.
Die sicheren Todeszeichen beinhalten die Totenflecken (livores) und Totenstarre (rigor mortis). Sie sind irreversible Organ- und Gewebeveränderungen (vgl. May 2007, S. 21).
Der Mensch wird für tot erklärt, wenn ein irreversibler Atem- und Kreislaufstillstand, durch den auch das Zentralnervensystem (ZNS) abstirbt, als Herztod von einem Arzt festgestellt wird (vgl. Kulbe 2008, S. 14).
Der biologische Tod wird definiert durch:
„Das Ende aller Organ- und Zellfunktionen (z. B. nach gesamter Verbrennung); kompletter Zerfall des irdischen Körpers (Tod der Einzelzellen).“ (May 2007, S. 19)
2.2. Einblick in die Geschichte von Palliativ Care
2.2.1. Die Verwilderung des Todes
Die moderne Medizin des 20. Jahrhunderts strebt an, das Sterben eines Patienten hinauszuzögern. Der Tod wird zusehends zu einen Tabuthema. Die Vorstellung des Todes ängstigt die Menschen.
Dieses urmenschliche Phänomen existiert seit Menschengedenken, jedoch in früheren Jahrhunderten beherrschten die Menschen Rituale und Bräuche, die ihnen Halt versprachen. Dieser Glaubensverlust und die Wandlung der Sterbekultur beginnt im
19. Jahrhundert und zieht sich bis in unsere Zeit fort (vgl. Aries 1999, S. 715–716).
Während die Menschen früher oftmals nach kurzer Erkrankung verstarben, zieht sich der Sterbeprozess heutiger Tage im höheren Alter dank der modernen Medizin über einen langen Zeitraum hin. Darin liegt eine Ursache für die Verwilderung des Todes begründet (vgl. Aries 1999, S. 747–749).
Der französische Historiker Aries spricht von einer Verwilderung des Todes (vgl. Aries 1999, S. 789), die gekennzeichnet ist durch:
Verheimlichung und Isolierung des Todes:
Der Sterbende wird von der Öffentlichkeit isoliert, über den Tod wird in der Gesellschaft nicht mehr öffentlich gesprochen
(vgl. Aries 1999, S. 715–716).
Anfang des 20. Jahrhunderts sterben 80 % der Menschen zuhause. In der heutigen Zeit sterben 80 % in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen (vgl. Student 2007, S. 5).
Belügen und Entmündigung des Sterbenden:
Der nahende Tod wird dem Kranken verheimlicht, in der Annahme, er sei nicht erwachsen genug, sein eigenes Sterben zu erleben (vgl. Aries 1999, S. 718–719).
Diese „Infantilisierung“ (Aries 1999, S. 786) nimmt dem Sterbenden seine Würde.
Abschaffung der Trauer:
So wenig Beachtung das Sterben in der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts findet, so wenig Platz nimmt analog dazu die Trauer ein.
Die Trauer des Menschen ist im Alltagsleben nur begrenzt sichtbar. Es wird Wert darauf gelegt, möglichst schnell in den normalen Alltagsablauf zurückzukehren. Die Menschen wollen den Tod nicht wahrhaben. Sie wünschen sich einen schnellen und abrupten Tod
(vgl. Aries 1999, S. 736–741 ).
„Nach einer Emnid-Umfrage von 2001 möchten nur 13 % der Deutschen den Tod bewusst und begleitet erleben.“
(Student 2007, S. 5)
Durch die Isolation Sterbender in Heimen oder Krankenhäusern, eine schnelle Abholung der Toten durch den Bestatter und die Professionalisierung von Bestattungen wird es den Menschen erleichtert, den Tod zu vergessen.
Daher erleben sie es umso dramatischer, wenn sie mit dem Tod unausweichlich konfrontiert werden (vgl. Student 2007, S. 5–6).
2.2.2. Wegbereiterinnen einer modernen Hospizbewegung
Die Anfänge der Hospizbewegung werden durch das Wirken zweier Frauen geprägt: Cicely Saunders und Elisabeth Kübler-Ross
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts werden im Verborgenen im angelsächsischen Raum hospices zur Pflege todkranker Menschen eingerichtet.
Aber erst gegen Mitte des 20. Jahrhunderts wird der Verwilderung des Todes ein langsames Ende bereitet, indem neue Ideen im Umgang mit dem Tod und der Trauer gefordert werden.
Aus dieser Bewegung geht die Hospizbewegung hervor, woraus später Palliativ Care entsteht.
Im Londoner Vorort Sydenham eröffnet nach 20 Jahren intensiver Vorarbeit 1967 die englische Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin Dr. Cicely Saunders das St. Christophers Hospice.
Das Hospiz soll ganz auf die Bedürfnisse Sterbender und ihrer Angehörigen ausgerichtet sein.
Dieses stationäre Hospiz unterscheidet sich von anderen Hospizen durch eine intensive Symptomkontrolle, insbesondere im Bereich der Schmerztherapie. Cicely Saunders fängt schon in ihren früheren Arbeitsstellen an, diese Therapieform zu entwickeln.
Da diese Symptomkontrolle nicht ausreicht, um eine angemessene Lebensqualität zu sichern, holt sie sich Unterstützung durch einen kompetenten Schmerztherapeuten, der ihre Arbeit zur medikamentösen Schmerzlinderung fortentwickelt. Dies ist der Beginn der modernen Morphintherapie (vgl. Pleschberger 2006, S. 25–26).
Cicely Saunders versteht es, von ihren Patienten und deren Angehörigen zu lernen.
Dadurch bringt sie in Erfahrung, dass viele ihrer Patienten sich bei ihr wohlfühlen, jedoch ihre letzten Tage gerne zuhause verbringen möchten. Diese Aussagen führen wenige Jahre nach der Eröffnung des Hospizes zur Entwicklung eines ambulanten Hospizdienstes, der mittels kompetenter Pflegekräfte Menschen in ihrem Sterbeprozess begleiten.
Hier wird der Grundstein für die ambulante Hospizarbeit gelegt (vgl. Student 2007, S. 6–7).
Die ambulante Hospizarbeit beginnt 1973 in den USA, im nordamerikanischen New Haven/Connecticut. Dort werden immer mehr Dienste ergänzt, welche dann als die Hospizbewegung bekannt werden. Diese Entwicklung prägt noch heute das Bild der ambulanten Hospizarbeit.
Die Wegbereiterin der Hospizbewegung in den USA ist die Schweizer Ärztin Elisabeth Kübler-Ross.
Das St. Christophers Hospiz in England erregt weltweit, besonders in den USA, viel Beachtung. Dieses Aufsehen verdankt sich der Veröffentlichung des Buches „On Death and Dying“ von Elisabeth Kübler-Ross im Jahre 1969. Dieses Buch entsteht aus der Arbeit und den Interviews mit Sterbenden und bricht das Tabu um die Themenbereiche Sterben, Tod und Trauer. Das aus dem Buch stammende Sterbephasenmodell ist bis in die heutige Zeit von großer Relevanz (vgl. Student 2007, S. 7).
Die entwickelte Hospizidee findet ihren Ursprung in alter Heilkunst.
Saunders und Kübler-Ross revolutionieren das Gesundheitswesen im 20. Jahrhundert, indem sie alte Heilmethoden wieder entdecken und in ihrer Hospizarbeit einbringen.
Nach Student (2007, S. 8) gibt es drei Elemente alter Heilungsprinzipien, welche angelehnt sind an die moderne Medizin:
Fähigkeit, kranken Menschen trotz Angstgefühlen nahe zu sein.
Der heutige Begriff lautet „Empathie“.
Fähigkeit, auch bei Abstoßendem genau hinzusehen.
„Diagnose“ lautet der jetzige Begriff.
Altes Wissen zu nutzen, um Schmerzen und Beschwerden zu lindern.
Der moderne Begriff dafür ist „Therapie“.
Diese drei Elemente markieren die Ursprünge heilkundlichen Handelns zu Beginn des 20 Jahrhunderts.
Diese Heilkunst stellt eine überwiegend weibliche Domäne dar.
Das sanfte, heilsame Können zeigt sich auch in der von Frauen dominierten Pflege (vgl. Student 2007, S. 8).
2.2.3. Die Entwicklung der Hospizarbeit in Deutschland
In Deutschland setzt sich die Hospizidee erst Anfang der 1980er Jahre durch.
Dieser späte Beginn liegt an der Befürchtung, dass die Vorstellung, Sterbende in spezielle Krankenhausabteilungen abzuschieben, an die Euthanasieverbrechen während des Nationalsozialismus erinnern würde. Daher lehnt vor allem die Kirche, aber auch die Öffentlichkeit die Hospizbewegung anfänglich ab.
Die Sterbebegleitung wird infolgedessen im Verborgenen von karitativen Gruppen entrichtet. Erst verzögert sieht die Kirche ein, dass die moderne Hospizbewegung sinnvollen Dienst am Menschen leistet (vgl. Kränzle 2006, S. 3).
Die erste Palliativstation für sterbenskranke Menschen wird 1983 an der Universitätsklinik in Köln eröffnet.
1986 entsteht das erste stationäre Hospiz in Aachen
(vgl. Kränzle 2006, S. 3)
Nachdem sich 1992 mehrere Einzelinitiativen der Hospizarbeit zu einem Dachverband zusammengeschlossen haben, wird Ende der 90er Jahre die Finanzierung stationärer Hospize im § 39a Sozialgesetzbuch V verabschiedet.
Wenig später wird eine Rahmenvereinbarung von Krankenkassen und Hospizträgern im § 39a Satz 4, SGB V beschlossen.
Die ambulanten Hospizdienste haben einen finanziellen Nachteil gegenüber stationären Hospizen. Erst im Jahre 2007 wird durch das Gesundheitsreformgesetz im § 37b SGB V vereinbart, ambulante Hospizdienste weiter zu stärken und auch Bewohnern in Altenpflegeeinrichtungen für eine Palliativversorgung finanzielle Unterstützung zu gewähren (vgl. Student 2007, S. 12).
Deutschland unterscheidet noch heute zwischen Palliativmedizin und Hospizarbeit. Heller (1999, S. 14) schlägt daher vor, dass Palliativ Care ein Dachbegriff ist, unter dem sich Palliativpflege, Palliativmedizin und andere Versorgungsbereiche versammeln.
2.3. Palliativ Care
2.3.1. Allgemeine Begriffserklärung
Der Beginn von Palliativ Care entwickelt sich aus der Ambulantisierung der Hospizarbeit. Das Hospiz existiert gemäß den dort in der Praxis angewandten Leitlinien und ist nicht von formalen Strukturen abhängig.
Student beschreibt den globalen Begriff Palliativ Care als die Handlungsweise des Hospizkonzepts, welches unabhängig vom Ort und kulturellen Hintergrund umgesetzt wird.
Palliativ Care setzt ein, wenn kurative Vorgehensweisen nicht mehr ausreichen, um das Wohlbefinden des Sterbenden sicherzustellen, wie zum Beispiel Schmerzen bei Demenzkranken
(vgl. Student 2007, S. 10–11).
Es geht bei Palliativ Care nach Super (2001, S. 32) um „care not cure“, das heißt, im Zentrum steht die kundige „liebevoll-umhüllende“ Fürsorge, nicht das Wieder-Gesund-Machen.
Eine erstmalige, kürzere Definition der World Health Organisation (WHO) zu Palliativ Care gibt es 1990. Dort werden allerdings nur die Grundleitlinien des Palliativ Care beschrieben.
Eine weitere ausführliche Definition von 2002 (WHO) erweitert deutlich den ursprünglichen Hospizansatz.
2.3.2. Definition der WHO von 2002
„Palliativ Care ist ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien, die mit den Problemen konfrontiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen, und zwar durch Vorbeugen und Lindern von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen, untadelige Einschätzung und Behandlung von Schmerzen sowie anderen belastenden Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art.
Palliativ Care:
- lindert Schmerzen und andere belastende Beschwerden;
- bejaht das Leben und betrachtet das Sterben als normalen Prozess;
- will den Tod weder beschleunigen noch verzögern;
- integriert psychische und spirituelle Aspekte;
- bietet jede Unterstützung, um den Patienten zu einen
möglichst aktiven Leben bis zum Tod zu verhelfen;
- steht den Familien bei der Verarbeitung seelischer
Probleme während der Krankheit des Patienten und nach dessen
Tod zur Seite;
- arbeitet multi- und interdisziplinär, um den Bedürfnissen
von Patienten und Angehörigen gerecht zu werden;
- verbessert die Lebensqualität und kann so positiven Einfluss auf
den Krankheitsverlauf nehmen;
- kann frühzeitig in der Erkrankung angewendet werden
in Kombination mit lebensverlängernden Maßnahmen,
wie beispielsweise Chemo- und Radiotherapie;
- beinhaltet auch die notwendige Forschung, um Beschwerden
oder klinische Komplikationen besser verstehen und behandeln
zu können.“ (WHO 2002)
2.4. Leitlinien von Palliativ Care
Diese sieben Leitlinien helfen, den Umgang mit Sterbenden zu erleichtern. Sie sind mehr inhaltlich ausgerichtet und besitzen weniger formale Strukturen. Weltweit wird in der Hospizarbeit nach diesen bzw. ähnlichen Kennzeichen der Palliativ Care gearbeitet.
Die Ausarbeitung dieser Leitlinien erfolgt 1996 durch Hospizmitarbeiter in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe beim Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung in Baden-Würtemberg.
2.4.1. Der sterbenskranke Mensch und seine ihm nahestehenden Menschen stehen im Zentrum des Dienstes
Die Bedürfnisse und Rechte des Sterbenden stehen im Zentrum der Hospizarbeit. Die hospizlichen Mitarbeiter passen sich den Bedürfnissen des Sterbenden an. Die situative Kontrolle, ob er Hilfe möchte oder nicht, liegt, ganz nach Cicely Saunders Grundsatz, bei dem Sterbenden.
Kübler-Ross beschreibt das Sterben als lang andauernden Prozess mit wechselnden Phasen. In diesen Sterbephasen braucht der Mensch individuelle Pflege und Unterstützung.
Aber auch Angehörige benötigen eine größere Aufmerksamkeit. Ihr Leidensprozess ist geprägt durch das Loslassen und Abschiednehmen von dem Sterbenden. Sie fühlen sich häufig überfordert im Umgang mit der Sterbesituation, dem Tod und der anschließenden Trauerphase.
Vor allem pflegende Angehörige sind einer enormen psychischen und physischen Belastung ausgesetzt. Daher ist es die Aufgabe von Palliativ Care, nicht nur die Sterbenden zu betreuen, sondern auch die Angehörigen zu begleiten (vgl. Seeger 2006, S. 9).
2.4.2. Keine aktive Sterbehilfe
„Die Hospizbewegung sieht das menschliche Leben als Ganzes von seinem Beginn bis zum Tod.“ (Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz, 1996) Diese Grundidee von der Hospizbewegung bejaht das Leben und schließt aktive Sterbehilfe aus
Die Hospizarbeit beinhaltet nach Seeger (2006, S. 10) eine lindernde Pflege und Fürsorge und keine lebensverlängernden Therapien.
In Deutschland ist die aktive Sterbehilfe nach § 211 StGB verboten.
2.4.3. Ehrenamtlichkeit
Nach der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz (Stand 2007) gibt es in Deutschland ca. 80.000 ehrenamtliche Mitarbeiter im Hospizbereich.
Sie haben eine gleichberechtigte Stellung im Mitarbeiterstamm und sind „keine Lückenbüßer“ (Student 2007, S. 9).
Ihre eigenverantwortlichen Aufgaben beinhalten alltägliche Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Einkaufen und Kochen für den Sterbenden zu erledigen.
Ehrenamtliche haben unter dem Aspekt des nahenden Todes die Aufgabe, durch mitmenschliche Begegnungen das Sterben in den Alltag zu integrieren und die Sterbenden und ihre Familien am Gesellschaftsleben teilhaben zu lassen (vgl. Student 2007, S. 9).
Ehrenamtliche Mitarbeiter vermögen durch ihre vorhandene Zeit und Erfahrung Ruhe in schweren und aussichtslosen Situationen erwirken.
Aber nicht jeder hilfsbereite Bürger kann in diesem Bereich ohne Weiteres ehrenamtlich tätig werden.
Eine ausreichende Vorbereitung durch Seminare zu den Themen Sterben, Tod und Trauer, aber auch eine persönliche Befähigung sind Voraussetzung, um im Hospizbereich zu arbeiten.
Durch Unterstützung von professionellen Kollegen und regelmäßigen Treffen von ehrenamtlichen Hospizmitarbeitern, lernen Ehrenamtliche mit Sterben und Tod positiv umzugehen (vgl. Seeger 2006, S. 10).
2.4.4. Ein multiprofessionelles Team steht dem Sterbenden und seinen Angehörigen zur Verfügung
Dem sterbenskranken Mensch und seinen ihm nahestehenden Angehörigen steht ein Team aus Ärzten, Pflegekräften, Sozialarbeitern, Seelsorgern und weiteren Therapeuten zur Verfügung die sich durch eine gute Aus- und Weiterbildung auszeichnen.
Das Sterben ist keine Erkrankung, sondern eine Lebenskrise, die mit einer Krankheit verbunden ist.
Die hospizlichen Mitarbeiter müssen sich mit Sterben und Tod auseinandersetzen. Dadurch entstehen im Team heterogene Anliegen, die durch gegenseitige Unterstützung und Gespräche mit einem Supervisor berücksichtigt werden (vgl. Student 2007, S. 9).
2.4.5. Symptomkontrolle und Kontinuität der Versorgung
„Das Hospiz verfügt über spezielle Kenntnisse und Erfahrung in medizinischen, pflegerischen, psychischen und spiritueller Beeinflussung belastender Symptome, welche das Sterben begleiten, zum Beispiel in der Schmerzbehandlung und Symptomkontrolle.“ (Seeger 2006, S. 8) Diese Multiprofessionalität wird durch verschiedene Berufsgruppen aus dem Sozial- und Gesundheitswesen im Hospiz gewährleistet bzw. durch Kooperationen mit bestehenden Diensten ergänzt.
Sterbende Menschen leiden häufig unter schmerzhaften und unangenehmen Symptomen.
Das Ziel ist es, durch das multiprofessionelle Team diese Symptome zu lindern und mehr Lebensqualität für den Sterbenden zu erreichen.
Die Mitarbeiter orientieren sich dabei an den Bedürfnissen des Betroffenen und versuchen, die Behandlung so einfach wie möglich zu halten.
Die Therapie ist nicht nur medikamentös, auch Physiotherapie u. a. können bei der Symptomlinderung helfen (vgl. Schmid 2006, S. 234).
Heimerl et. al. (2000, S. 2) bemerken in ihren Buchtitel dazu trefflich: „Wenn nichts mehr zu machen ist, gibt es noch viel zu tun.“
Die Kontinuität der palliativen Versorgung von Sterbenden kann durch eine Kooperation mit anderen Diensten im Sozial- und Gesundheitswesen sichergestellt werden.
Dabei ist eine 24-Stunden-Erreichbarkeit unumgänglich.
Besonders im Sterbeprozess muss den Betreuern die Möglichkeit gegeben werden, wichtige Entscheidungen telefonisch mit fachkundigen Palliativkräften zu besprechen, um den Sterbeprozess nicht zu unterbrechen (vgl. Seeger 2006, S. 11).
Aber auch die Kontinuität der oftmals engen und vertrauensvollen Begleitung von Angehörigen sollte über den Tod hinaus bei der Trauerverarbeitung gegeben sein (vgl. Student 2007, S. 9–10).
2.4.6. Ermöglichung von Sterben im eigenen Heim
„80–90 % aller Menschen möchten laut Umfragen gerne zu Hause sterben.“ (Seeger 2006, S. 11)
Trotzdem verstirbt ein Großteil der Menschen entgegen seines Wunsches in Pflegeheimen oder Krankenhäusern, weil die Gesellschaft und die medizinischen Möglichkeiten einen höheren Rang als der Wunsch des Einzelnen innehaben (vgl. Seeger 2006, S. 11).
Nach Student (1997, S. 2) sterben „10–20 % zu Hause, etwa 30 % in der Pflegeeinrichtung und etwa 50 % im Krankenhaus“.
Das primäre Ziel der Hospizarbeit besteht darin, das Sterben im eigenen Heim durch ambulante Betreuung zu ermöglichen. Die Politik hat durch den § 39a Sozialgesetzbuch V eine Grundlage geschaffen, den ambulanten Dienst durch eine Finanzierung der Krankenkassen sicherzustellen. Wenn die Pflege zu Hause nicht mehr geleistet werden kann oder Krankenhauspflege nicht erforderlich ist, bieten teilstationäre und stationäre Hospizdienste eine gute Alternative (vgl. Seeger 2006, S. 9–11).
2.4.7. Trauerbegleitung
Während der Sterbebegleitung ist die Betreuung von Angehörigen in der Trauerzeit ein wesentlicher Bestandteil.
In der Trauerphase ziehen sich viele Menschen zurück und neigen zu depressiven Phasen. Dadurch können sich Kontakte nach außen verändern oder abbrechen.
Im palliativen Bereich werden Einzelberatung oder Trauergruppen angeboten, um die Angehörigen bei der Verarbeitung ihrer Leids zu begleiten. Des Weiteren wird der Kontakt zu Angehörigen auch nach dem Tod des geliebten Menschen aufrecht erhalten
(vgl. Seeger 2006, S. 11).
2.5. Palliativ Care in der stationären Altenhilfe
Da vorliegende Diplomarbeit von Demenzkranken im Sterbeprozess handelt und ein Großteil dieser Patienten in Altenpflegeeinrichtungen lebt, wird an dieser Stelle lediglich der palliative Ansatz in der stationären Altenhilfe vorgestellt.
„Sterben und Tod sind im Alltag der Altenpflegeheime omnipräsent.“ (Heller/Wegleitner 2007, S. 73)
Nach Schneekloth und Müller (2000, S. 131) werden Menschen zum Zeitpunkt des Heimeintritts immer älter und pflegebedürftiger.
Das Alter beim Heimeinzug hat sich fortwährend erhöht und liegt heute bei über 85 Jahren. Die Verweildauer in einem Heim sinkt dagegen auf durchschnittlich zwei Jahre (vgl. Wilkening/Kunz 2005, S. 17).
Dessen ungeachtet konzentrieren sich nach Heller und Wegleitner (2007, S. 73) Altenpflegeeinrichtungen mehr auf die aktivierende und rehabilitative Versorgung ihrer Bewohner, obwohl der Bedarf an intensiver Pflege und Betreuung schwer pflegebedürftiger, alter Menschen zusehends größer wird. Oft ist der Umgang mit Sterben und Tod in Altenpflegeheimen ein unorganisierter Prozess. „Das heißt, das Gelingen einer würdevollen Sterbebegleitung bleibt weitgehend dem Zufall überlassen.“ (Pleschberger 2005, S. 64)
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842812048
- DOI
- 10.3239/9783842812048
- Dateigröße
- 444 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Duisburg-Essen – Bildungswissenschaften, Beratung und Management
- Erscheinungsdatum
- 2011 (März)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- soziale arbeit sterbebegleitung demenz palliative care pflegeeinrichtung
- Produktsicherheit
- Diplom.de