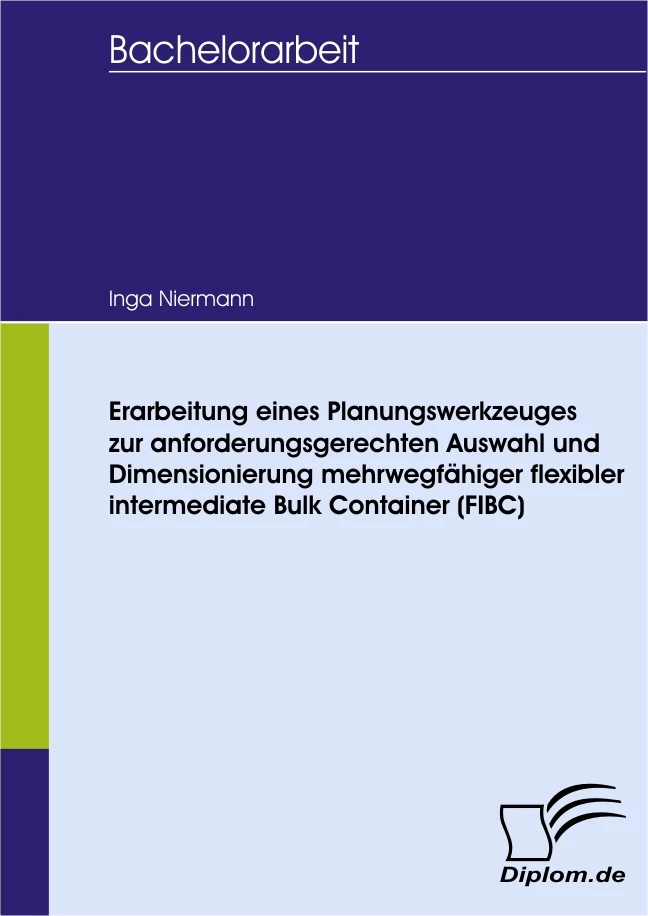Erarbeitung eines Planungswerkzeuges zur anforderungsgerechten Auswahl und Dimensionierung mehrwegfähiger flexibler intermediate Bulk Container (FIBC)
©2010
Bachelorarbeit
117 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Problemstellung und Zielsetzung:
Der starke Anstieg von entsorgungsbezogenen Materialflüssen ist vor allem auf die schärferen Gesetze, wie die Verpackungsverordnung und das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, aber auch auf das gestiegene Umweltbewusstsein von Unternehmen bzw. Verbrauchern, zurückzuführen.
Vor allem ökologische Probleme wie Ressourcenverknappung und Ressourcenqualität haben dazu geführt, dass Unternehmen sich zunehmend mit der Wiederverwendung und verwertung beschäftigen.
Jährlich werden in Europa über eine viertel Billion Tonnen verschiedener Produkte in Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC) transportiert. Der Markt ist weltweit sehr groß und steigt stetig an. Aufgrund der steigenden Transportkosten suchen Unternehmen immer neue, bessere und kosteneffektivere Lösungen.
Eine Möglichkeit ist der Einsatz von flexiblen Schüttgutbehältern. FIBCs wurden aufgrund der fehlenden Reinigungsmöglichkeiten in der Vergangenheit nur selten als Mehrwegbehälter eingesetzt. Doch vor allem für Trockenfüllgüter ist der Einsatz eines mehrwegfähigen FIBC sinnvoll, denn die mechanische Beanspruchung und der Verschmutzungsgrad sind relativ gering.
Um diese Art von Verpackungen für Schüttgüter einzusetzen, müssen besondere Anforderungen erfüllt werden. Es handelt sich bei FIBCs nicht um Massenprodukte, sondern um die Erfüllung individueller Kundenwünsche hinsichtlich spezifischer und technischer Eigenschaften.
Diese Bachelor Thesis soll dem Leser einen Überblick über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten eines mehrwegfähigen flexiblen Schüttgutbehälters verschaffen. Die Probleme beim Einsatz und der Planung werden näher beleuchtet und eventuelle Lösungsansätze werden aufgezeigt.
Bei der Planung des Einsatzes dieser Verpackungsart spielen die Eigenschaften des Füllgutes eine wichtige Rolle. Die Kenngrößen von Schüttgütern und deren Ermittlungen sollten am Ende dieser Bachelor Thesis bekannt sein.
Diese Arbeit soll weiterhin Aufschluss darüber geben, welche Vorteile mehrwegfähige FIBCs für ein Unternehmen haben können, welche Kosteneinsparungen möglich sind und wie der optimale FIBC für spezielle Anforderungen ermittelt wird.
Ziel ist es, ein Planungswerkzeug zu erarbeiten, welches den Prozess der Auswahl und der Dimensionierung eines FIBC erleichtert, beschreibt und durchführt und gleichzeitig die optimale Beladung eines ausgewählten Transportmittels […]
Problemstellung und Zielsetzung:
Der starke Anstieg von entsorgungsbezogenen Materialflüssen ist vor allem auf die schärferen Gesetze, wie die Verpackungsverordnung und das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, aber auch auf das gestiegene Umweltbewusstsein von Unternehmen bzw. Verbrauchern, zurückzuführen.
Vor allem ökologische Probleme wie Ressourcenverknappung und Ressourcenqualität haben dazu geführt, dass Unternehmen sich zunehmend mit der Wiederverwendung und verwertung beschäftigen.
Jährlich werden in Europa über eine viertel Billion Tonnen verschiedener Produkte in Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC) transportiert. Der Markt ist weltweit sehr groß und steigt stetig an. Aufgrund der steigenden Transportkosten suchen Unternehmen immer neue, bessere und kosteneffektivere Lösungen.
Eine Möglichkeit ist der Einsatz von flexiblen Schüttgutbehältern. FIBCs wurden aufgrund der fehlenden Reinigungsmöglichkeiten in der Vergangenheit nur selten als Mehrwegbehälter eingesetzt. Doch vor allem für Trockenfüllgüter ist der Einsatz eines mehrwegfähigen FIBC sinnvoll, denn die mechanische Beanspruchung und der Verschmutzungsgrad sind relativ gering.
Um diese Art von Verpackungen für Schüttgüter einzusetzen, müssen besondere Anforderungen erfüllt werden. Es handelt sich bei FIBCs nicht um Massenprodukte, sondern um die Erfüllung individueller Kundenwünsche hinsichtlich spezifischer und technischer Eigenschaften.
Diese Bachelor Thesis soll dem Leser einen Überblick über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten eines mehrwegfähigen flexiblen Schüttgutbehälters verschaffen. Die Probleme beim Einsatz und der Planung werden näher beleuchtet und eventuelle Lösungsansätze werden aufgezeigt.
Bei der Planung des Einsatzes dieser Verpackungsart spielen die Eigenschaften des Füllgutes eine wichtige Rolle. Die Kenngrößen von Schüttgütern und deren Ermittlungen sollten am Ende dieser Bachelor Thesis bekannt sein.
Diese Arbeit soll weiterhin Aufschluss darüber geben, welche Vorteile mehrwegfähige FIBCs für ein Unternehmen haben können, welche Kosteneinsparungen möglich sind und wie der optimale FIBC für spezielle Anforderungen ermittelt wird.
Ziel ist es, ein Planungswerkzeug zu erarbeiten, welches den Prozess der Auswahl und der Dimensionierung eines FIBC erleichtert, beschreibt und durchführt und gleichzeitig die optimale Beladung eines ausgewählten Transportmittels […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inga Niermann
Erarbeitung eines Planungswerkzeuges zur anforderungsgerechten Auswahl und
Dimensionierung mehrwegfähiger flexibler intermediate Bulk Container (FIBC)
ISBN: 978-3-8428-1190-4
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2011
Zugl. Hochschule Bremerhaven, Bremerhaven, Deutschland, Bachelorarbeit, 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2011
Danksagung
II
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die mich bei der
Erstellung dieser Arbeit unterstützt haben.
Besonderer Dank geht an Herrn Godehard Oppermann (CompaC Verpackung GmbH),
der ein unglaubliches Interesse zeigte. Ich danke ihm für die vielseitige Unterstützung,
seine Geduld und sein außerordentliches Engagement.
Auch möchte ich mich bei meinen Freunden bedanken, die mich nicht nur tatkräftig
unterstützt haben, sondern mich stets aufbauten und für die erforderliche Abwechslung
sorgten.
Zum Abschluss möchte ich mich natürlich noch bei meinem Vater und meiner Familie
bedanken, die mir mein Studium überhaupt erst ermöglicht haben. Für Eure einzigartige
Unterstützung während dieser Zeit, die sicherlich nicht selbstverständlich ist, vielen
Dank!
Inhaltsverzeichnis
III
Inhaltsverzeichnis
Danksagung ... II
Inhaltsverzeichnis... III
Abbildungsverzeichnis ... V
Tabellenverzeichnis ... VII
Gleichungsverzeichnis ... VIII
Variablenverzeichnis ... IX
Abkürzungsverzeichnis ... XI
1.
Einleitung ... 12
1.1
Problemstellung und Zielsetzung ... 12
1.2
Vorgehensweise ... 14
1.3
Abgrenzung ... 15
2
Terminologie ... 16
2.1
Gutspezifische Begriffsbestimmungen ... 16
2.2
Verpackungsspezifische Definitionen ... 22
3
Stand der Technik zum FIBC-Einsatz ... 26
3.1
Industrielle Einsatzfelder ... 26
3.2
Industrielle Ausführungsformen... 29
3.2.1
Packstoffe ... 29
3.2.2
Bauarten ... 31
3.2.3
Handhabungsvorrichtungen ... 36
3.2.4
Anwendungsspezifische Besonderheiten ... 39
3.3
Abfüllprozesse ... 41
3.4
TUL-Prozesse ... 45
4
Bedarfsfelder zur Verbesserung der bestehenden Planung des FIBC-Einsatzes ... 53
Inhaltsverzeichnis
IV
5
Planungswerkzeug zur anwendungsorientierten Auswahl und Dimensionierung .. 57
5.1
Anforderungen des Planungswerkzeuges ... 57
5.2
Teilprozesse zur Auswahl- und Dimensionierung ... 58
5.3
Funktionstechnische Beschreibung des Planungswerkzeuges ... 71
6
Exemplarische Anwendung des Planungswerkzeuges am industriellen Fallbeispiel ..
75
7
Zusammenfassung und Ausblick ... 80
Literatur-und Quellenverzeichnis ... 82
Anhangsverzeichnis ... 92
Abbildungsverzeichnis
V
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Ermittlung der Korngröße ... 17
Abbildung 2: Schüttkegel mit Böschungswinkel
E
... 18
Abbildung 3: Grundbegriffe des Verpackens ... 23
Abbildung 4: Beispiel für einen FIBC ... 25
Abbildung 5: mögliche Füllgüter der FIBCs ... 26
Abbildung 6: Verkauf / Produktion von FIBCs weltweit ... 27
Abbildung 7: Alternativverpackungen ... 28
Abbildung 8: Herstellung von FIBCs ... 30
Abbildung 9: Herstellung der PP-Bändchen ... 30
Abbildung 10: Vergleich formstabiler / Standard FIBC ... 34
Abbildung 11: Umschlag mit Einschlaufen-FIBC ... 36
Abbildung 12: Umschlag eines Mehrschlaufen-FIBC ... 36
Abbildung 13: Möglichkeiten der Aufhängung beim FIBC ... 37
Abbildung 14: verschiedene Deckel- und Bodenkonstruktionen eines FIBC ... 38
Abbildung 15: FIBC-Abfüllstation ... 43
Abbildung 16: vollautomatische FIBC-Abfüllanlage ... 44
Abbildung 17: relevante Chemiepaletten für FIBCs ... 46
Abbildung 18: Methode der Ladungssicherung ... 48
Abbildung 19: Ladeeffizienz von formstabilen FIBCs gegenüber Standard-FIBCs ... 49
Abbildung 20: Hebekreuz ... 50
Abbildung 21: Slip-sheet "Push-Pull-Prinzip" ... 51
Abbildung 22: "Forklift channels" ... 51
Abbildung 23: Stapelung von befüllten FIBCs ... 52
Abbildung 24: Apparatur zur Bestimmung der Schüttdichte ... 53
Abbildung 25: Vergleich der "Ausbauchung" Kies / Kaminholz ... 55
Abbildung 26: EPK Teil 1 ... 72
Abbildung 27: EPK Teil 2 ... 73
Abbildung 28: EPK Teil 3 ... 74
Abbildung 29: ausgewählter FIBC (Fallbeispiel) ... 75
Abbildung 30: Beladung der FIBCs im 20' Container ... 79
Abbildung 31: Eigenschaften von Schüttgut ... 93
Abbildungsverzeichnis
VI
Abbildung 32: Perspektivische Ansicht eines FIBC mit vier Hebevorrichtungen und
einer von oben geführten Druckplatte ... 97
Abbildung 33: Prüfprotokoll einer Wechselbelastungsprüfung (Vorderseite) ... 98
Abbildung 34: Prüfprotokoll einer Wechselbelastungsprüfung (Rückseite) ... 99
Abbildung 35: Zertifikat einer FIBC-Bauart... 100
Abbildung 36: Sicherheitslabel eines FIBC ... 101
Abbildung 37: Prozess der Rekonditionierung ... 103
Abbildung 38: Mehrwegfahne (Beispiel 1) ... 104
Abbildung 39: Mehrwegfahne (Beispiel 2) ... 104
Abbildung 40: Verschlusstechniken von FIBC ... 106
Abbildung 41: Handhabungshinweise für FIBCs ... 110
Abbildung 42: alphabetisches Schüttdichtenverzeichnis ... 111
Tabellenverzeichnis
VII
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Einteilung des Schüttgutes nach der Kornform ... 18
Tabelle 2: Einteilung des Schüttgutes nach dem Fließverhalten ... 19
Tabelle 3: Böschungswinkel
E
und Schüttwinkel
... 20
Tabelle 4: Material- und Schüttdichten... 21
Tabelle 5: Verpackungsbegriffe ... 22
Tabelle 6: Kostenvergleich Einweg / Mehrweg ... 56
Tabelle 7: verschiedene Ausführungen der Aufhängung von FIBCs ... 105
Tabelle 8: Auswahl geeigneter FIBC-Typen in Abhängigkeit von Schüttgut und
Einsatzbedingungen ... 107
Tabelle 9: Einstufung der Zündempfindlichkeit ... 108
Tabelle 10: Abmessungen und Gewichte der im Planungswerkzeug relevanten
Transportmittel ... 114
Tabelle 11: Standardmaße eines unbefüllten FIBC ... 115
Gleichungsverzeichnis
VIII
Gleichungsverzeichnis
Gleichung 1: dynamischer Schüttwinkel ... 19
Gleichung 2: Berechnung der Schüttdichte
schütt
... 20
Gleichung 3: Kreisformel ... 47
Gleichung 4: Durchmesser eines Rundgewebe
... 47
Gleichung 5: Berechnungsbeispiel Schüttdichte
... 54
Gleichung 6: Durchmesser
... 55
Gleichung 7: max. verfügbare Höhe
... 62
Gleichung 8: max. verfügbares Volumen
... 62
Gleichung 9: max. Schüttmasse
... 62
Gleichung 10: Anzahlermittlung der benötigten FIBCs ... 62
Gleichung 11: Schüttvolumens eines FIBC
ü
... 63
Gleichung 12: Innenmaße des unbefüllten FIBC ... 64
Gleichung 13: Durchmesser
... 64
Gleichung 14: Füllhöhe des Schüttgutes in einem quadratischen FIBC
... 64
Gleichung 15: Gewebelänge
... 65
Gleichung 16: Gewebebreite
... 65
Gleichung 17: Füllhöhe des Schüttgutes eines rechteckigen FIBC
... 65
Gleichung 18: Gewebelänge
... 66
Gleichung 19: Gewebebreite
... 66
Gleichung 20: Innenmaße eines FIBC beim Transport ohne Ladungsträger ... 67
Gleichung 21: Höhe des unbefüllten FIBC
... 67
Gleichung 22: Anzahl FIBCs in der Breite ... 69
Gleichung 23: Anzahl FIBCs in der Länge ... 69
Gleichung 24: Anzahl FIBCs in der Höhe ... 69
Gleichung 25: Anzahl FIBCs pro Transportmittel ... 69
Gleichung 26: Ermittlung der Anzahl der benötigten Transportmittel ... 69
Gleichung 27: Ermittlung der Zuladungsmasse
... 70
Gleichung 28: Ermittlung der Gesamthöhe
... 70
Variablenverzeichnis
IX
Variablenverzeichnis
ä
Fläche
des
Ladungsträgers
Innenbreite eines FIBC
Innenbreite des zu beladenen Transportmittels
Palettenbreite
E
Böschungswinkel
dyn
dynamischer Schüttwinkel
Innendurchmesser eines befüllten FIBC
Innendurchmesser eines unbefüllten FIBC
Durchmesser eines Korns
maximaler Durchmesser eines Korns
minimaler Durchmesser eines Korns
Durchmesser des Rundgewebes
Füllhöhe des Schüttgutes in einem FIBC
Füllhöhe des Schüttgutes in einem quadratischen FIBC
Füllhöhe des Schüttgutes in einem rechteckigen FIBC
ä
Höhe
des
Ladungsträgers
Höhe der Luft
maximale verfügbare Höhe
Höhe der Palette
Höhe des Transportmittels
Höhe der Zuladung
Innenlänge eines FIBC
kürzeste waagerechte Abmessung eines FIBC
Variablenverzeichnis
X
Palettenlänge
Höhe des unbefüllten FIBC
Masse des leeren FIBC
Schüttmasse eines befüllten FIBC
Gesamtmasse
der
Schüttung
maximale Schüttmasse
Masse der Palette
Masse des PET-Granulats
Masse der Zuladung
Materialdichte
ü
Schüttdichte
,,stretch factor"
Umfang eines Rundgewebes
maximales
verfügbares
Volumen
ü
Schüttvolumen eines befüllten FIBC
Abkürzungsverzeichnis
XI
Abkürzungsverzeichnis
BGR
Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit
CP
Chemiepalette
DIN
Deutsches Institut für Normung
EN
Europäische
Norm
EPK
Ereignisgesteuerte
Prozesskette
FIBC
Flexible Intermediate Bulk Container
IML
Institut für Materialfluss und Logistik
ISO
International Organization for Standardization
MZE
Mindestzündenergie
PE
Polyethylen
PET
Polyethylenterephthalat
PP
Polypropylen
PVC
Polyvinylchlorid
SF
Safety
factor
SI Système
international d'unités
SWL
Safe
working
load
TUL
Transport
Umschlag
Lagerung
UN
United
Nations
UV
Ultraviolett
VCI
Verband der chemischen Industrie e.V.
VDI
Verein
Deutscher
Ingenieure
VerpackV
Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von
Verpackungsabfällen
Einleitung
Seite | 12
1.
Einleitung
1.1
Problemstellung und Zielsetzung
Der starke Anstieg von entsorgungsbezogenen Materialflüssen ist vor allem auf die
schärferen Gesetze, wie die Verpackungsverordnung und das Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz, aber auch auf das gestiegene Umweltbewusstsein von Unternehmen bzw.
Verbrauchern, zurückzuführen.
1
Vor allem ökologische Probleme wie Ressourcenverknappung und Ressourcenqualität
haben dazu geführt, dass Unternehmen sich zunehmend mit der Wiederverwendung und
verwertung beschäftigen.
2
Jährlich werden in Europa über eine viertel Billion Tonnen verschiedener Produkte in
Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC) transportiert. Der Markt ist weltweit sehr
groß und steigt stetig an.
3
Aufgrund der steigenden Transportkosten suchen Unternehmen immer neue, bessere
und kosteneffektivere Lösungen.
4
Eine Möglichkeit ist der Einsatz von flexiblen Schüttgutbehältern. FIBCs wurden
aufgrund der fehlenden Reinigungsmöglichkeiten in der Vergangenheit nur selten als
Mehrwegbehälter eingesetzt. Doch vor allem für Trockenfüllgüter ist der Einsatz eines
mehrwegfähigen FIBC sinnvoll, denn die mechanische Beanspruchung und der
Verschmutzungsgrad sind relativ gering.
5
Um diese Art von Verpackungen für Schüttgüter einzusetzen, müssen besondere
Anforderungen erfüllt werden. Es handelt sich bei FIBCs nicht um Massenprodukte,
sondern um die Erfüllung individueller Kundenwünsche hinsichtlich spezifischer und
technischer Eigenschaften.
1
vgl. Steven, Tengler, & Krüger, Reverse Logistics (l), 2003, S. 644
2
vgl. Wannenwetsch, 2010, S. 439
3
vgl. http://www.efibca.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=55 (abgerufen am
12.11.10)
4
vgl. http://www.fibca.com/Files_BrochuresAndVideos/Video_English_Cable_DSL.wmv, (abgerufen am
23.10.2010)
5
vgl. http://plasticker.de/news/shownews.php?nr=1915&PHPSESSID=60ec7bf5d71a9ee8ce29c49c38549471,
(abgerufen am 1.11.10)
Einleitung
Seite | 13
Diese Bachelor Thesis soll dem Leser einen Überblick über die verschiedenen
Einsatzmöglichkeiten und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten eines
mehrwegfähigen flexiblen Schüttgutbehälters verschaffen.
Die Probleme beim Einsatz und der Planung werden näher beleuchtet und eventuelle
Lösungsansätze werden aufgezeigt.
Bei der Planung des Einsatzes dieser Verpackungsart spielen die Eigenschaften des
Füllgutes eine wichtige Rolle. Die Kenngrößen von Schüttgütern und deren
Ermittlungen sollten am Ende dieser Bachelor Thesis bekannt sein.
Diese Arbeit soll weiterhin Aufschluss darüber geben, welche Vorteile mehrwegfähige
FIBCs für ein Unternehmen haben können, welche Kosteneinsparungen möglich sind
und wie der optimale FIBC für spezielle Anforderungen ermittelt wird.
Ziel ist es, ein Planungswerkzeug zu erarbeiten, welches den Prozess der Auswahl und
der Dimensionierung eines FIBC erleichtert, beschreibt und durchführt und gleichzeitig
die optimale Beladung eines ausgewählten Transportmittels ermittelt.
.
Einleitung
Seite | 14
1.2
Vorgehensweise
Damit die aufgezeigte Zielsetzung dieser Bachelor Thesis realisiert werden kann, wird
eine Gliederung in insgesamt sieben Kapitel vorgenommen.
Das erste Kapitel beschreibt die Thematik und den Aufbau der Arbeit.
Nachfolgend definiert das zweite Kapitel, für ein besseres Textverständnis der
wissenschaftlichen Arbeit, verschiedene Begriffe aus dem Bereich der Verpackung und
dem Umgang mit Schüttgütern. Gleichzeitig erfolgt eine Abgrenzung und Erklärung der
einzelnen Fachbegriffe.
Gegenstand des dritten Kapitels ist der aktuelle Stand der Technik. Die verschiedenen
branchenübergreifenden Einsatzmöglichkeiten und die daraus resultierenden Vorteile
werden aufgezeigt. Eine Übersicht der verschiedenen Ausführungsformen, hinsichtlich
der Packstoffe und Handhabungsvorrichtungen einen FIBC, wird gegeben und die
umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten eines FIBC werden beschrieben. Im Rahmen
der industriellen Ausführungsformen werden die Abfüll-, Transport-, Umschlags und
Lagerungsprozesse unterschieden und dargestellt.
Das Kapitel vier behandelt die Probleme der Planung zum FIBC-Einsatz. Der Versuch
zur Ermittlung der Schüttdichte wird vorgestellt. Ein weiterer Betrachtungsgegenstand
des Kapitels ist die geometrische Veränderung eines FIBC nach der Befüllung.
Ebenfalls werden die Unterschiede zwischen einweg- und mehrwegfähigen FIBCs
aufgezeigt.
Durch gezielte Auswahl von Kriterien wird in Kapitel 5 ein Planungswerkzeug erstellt.
Die Anforderungen an das Planungswerkzeug werden festgelegt und nachfolgend die
herausgearbeiteten Teil- und Auswahlprozesse beschrieben.
Die funktionstechnische Beschreibung wird mittels einer ereignisgesteuerten
Prozesskette (EPK) visualisiert und soll eine unterstützende Hilfe darstellen, damit der
Anwender schnell und einfach den passenden FIBC für sein Füllgut auswählen kann.
Im Kapitel 6 wird das erarbeitete Planungswerkzeug zum besseren Verständnis an
einem praxisnahen Fallbeispiel angewendet, um die Zusammenhänge besser zu
verdeutlichen. Abschließend erfolgt in Kapitel 7 eine Zusammenfassung der
behandelten Themengebiete, eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich des
Planungswerkzeuges werden aufgezeigt und die eventuelle zukünftige Entwicklung des
FIBC-Einsatzes diskutiert.
Einleitung
Seite | 15
1.3
Abgrenzung
Aufgrund der umfangreichen Thematik hinsichtlich der Einsatz- und
Anwendungsmöglichkeiten der FIBCs, erfolgt in diesem Kapitel eine thematische
Abgrenzung.
Als Füllmaterialien der FIBCs werden ausschließlich Schüttgüter behandelt und
untersucht. Die genannten Anforderungen und Vorschriften hinsichtlich des Einsatzes
von FIBCs beschränken sich auf nicht-gefährliche Güter und schließen ebenfalls
Lebensmittel als Füllgüter aus.
Gleichzeitig konzentriert sich die Bachelor Thesis auf den Einsatz von mehrwegfähigen
FIBCs. In Kapitel 4 erfolgt lediglich ein kurzer Vergleich zwischen einweg- und
mehrwegfähigen FIBCs.
Das Planungswerkzeug bezieht sich weiterhin nur auf die konstruktionsspezifischen
Ausführungen und Auswahlmöglichkeiten, die material- und anwendungsspezifischen
Besonderheiten werden dabei vernachlässigt.
Terminologie
Seite | 16
2
Terminologie
2.1
Gutspezifische Begriffsbestimmungen
Für die Auswahl und Dimensionierung einer Verpackung bzw. zur Bestimmung eines
Transportmittels oder bestimmter Lagerungsarten spielt das Transportgut eine
entscheidende Rolle. Transport- und Lagergüter werden in feste, flüssige und
gasförmige Stoffe unterteilt. Bei den festen Gütern wird nochmals unterschieden
zwischen ,,Stückgut" und ,,Schüttgut".
6
Nach Martin werden Schütt- und Stückgüter wie folgt definiert:
Stückgut ,,[...] wird als feste[s] Transportgut [bezeichnet], das während des
Transportvorganges seine Gestalt nicht ändert und einzeln als Einheit
gehandhabt werden kann [...]". [Herv. d. Verf.]
7
,,Schüttgut ist
[...] [ein] Massengut
, das eine Fließfähigkeit aufweist, während des
Transportvorganges in der Regel seine Gestalt ändert und nicht ohne Hilfsmittel
zu einer Einheit zusammengefasst werden kann. " [Herv. d. Verf.]
8
Da sich diese wissenschaftliche Arbeit auf eine Verpackung, die in der Regel für
Schüttgüter genutzt wird, bezieht, wird nachfolgend diese Güterart ausführlicher
behandelt.
Schüttgut (engl.: bulk goods, bulk materials) bezeichnet demnach eine Klasse von
Gütern, die lose gehandhabt und gelagert werden. Schüttgut ist keine Flüssigkeit und
kein Stückgut.
9
Häufig umgeschlagene Schüttgüter sind z. B. Sand, Kohle, Getreide
etc.. Schüttgut wird nach der Partikelgröße unterteilt in: ,,stückige" (Kohle), körnige
(Getreide) und staubförmige (Mehl) Schüttgüter.
10
6
vgl. Martin, 2009, S. 59
7
ebd., S. 62
8
ebd., S. 59
9
vgl. Ten Hompel & Heidenblut, 2007, S. 257
10
vgl. http://www.fml.mw.tum.de/fml/index.php?Set_ID=320&letter=S&b_id=3939467B-4533-3045-302D-
443835452D34 (abgerufen am 18.10.10)
Terminologie
Seite | 17
Zur Festlegung von Transportmitteln, Verpackungen oder Lagerungsarten sollten die
charakteristischen physikalischen und chemischen Eigenschaften eines Schüttgutes
(siehe Anhang A) genauestens bekannt sein.
11
Weiterhin besitzen Schüttgüter verschiedene Kenngrößen nach denen sie untersucht und
klassifiziert werden. Nachfolgend werden die wichtigsten genannt und erläutert:
Die Korngröße beschreibt die Größe von einzelnen Partikeln. Die Größe eines Korns
wird durch die längste Kante
des Quaders, in den es sich einzeichnen lässt,
bestimmt.
12
Abbildung 1: Ermittlung der Korngröße
13
Schüttguter bestehen oft aus Gemischen mit Partikeln verschiedener Größen. Mit Hilfe
der sog. Korngrößenanalyse kann die prozentuale Verteilung der Körner bestimmt
werden. Je nach Art der Zusammensetzung wird unterteilt in
sortiertes
2,5
oder
unsortiertes
> 2,5 Schüttgut.
14
11
vgl. Martin, 2009, S. 59
12
vgl. Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik (fml)
13
Quelle: Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik (fml)
14
vgl. Martin, 2009, S. 61
Terminologie
Seite | 18
Schüttgüter werden gemäß DIN ISO 3435 in sechs unterschiedliche Kategorien
hinsichtlich der Kornformen (siehe Tabelle 1) unterteilt:
Tabelle 1: Einteilung des Schüttgutes nach der Kornform
15
1
Scharfe Kanten mit ungefähr gleichen Ausmaßen in drei Dimensionen
(Beispiel: Würfel)
2
Scharfe Kanten, deren eine deutlich länger ist als die anderen beiden
(Beispiel: Prisma, Klinge)
3
Scharfe Kanten, deren eine deutlich kleiner ist als die anderen
(Beispiel: Platte, Schuppen)
4
Runde Kanten mit ungefähr gleichen Ausmaßen in den drei Dimensionen
(Beispiel: Kugel)
5
Runde Kanten, in einer Richtung deutlich größer als in den anderen beiden
(Beispiel: Zylinder, Stange)
6
Faserig, fadenförmig, lockenförmig, verschlungen
Der Böschungswinkel
E
ist eine wichtige Kenngröße zur Beschreibung des
Zusammenhaltes eines Schüttgutes (Kohäsion).
Schüttgüter werden nach ihrem Fließverhalten unterteilt, welches sich durch den
Böschungswinkel
E
ausdrücken lässt. Dieser bezeichnet den Winkel eines Schüttkegels,
der durch langsames Aufschütten aus geringer Höhe entsteht
16
(siehe Abbildung 2).
Abbildung 2: Schüttkegel mit Böschungswinkel
E
17
15
Quelle: DIN ISO 3435:Klassifizierung und Symbolisierung von Schüttgütern, 1979
16
vgl. Hoffmann, Krenn, & Stanker, 2006, S. 13
17
Quelle: Hoffmann, Krenn, & Stanker, 2006, S. 13
Terminologie
Seite | 19
Der Böschungswinkel
E
ist eine ausschlaggebende Größe für die Planung einer
Bodenlagerung für Schüttgut.
18
. Sobald die Unterlage in Bewegung ist, z. B. beim
Transport des Schüttgutes auf Förderbändern, ist der sog. dynamische
Schüttwinkel
eine weitere zu beachtende Größe. Der Winkel
ist im
Gegensatz zum Böschungswinkel
E
wesentlich kleiner und zusätzlich von anderen
Faktoren wie die Schwingfrequenz abhängig.
Als Faustformel gilt:
19
dyn
(0,4
0,7)
Gleichung 1: dynamischer Schüttwinkel
Das Fließverhalten von Schüttgütern wird dem Böschungswinkel
E
nach in sechs
verschiedene Kategorien (siehe Tabelle 2) unterteilt:
Tabelle 2: Einteilung des Schüttgutes nach dem Fließverhalten
20
Fließverhalten
Böschungswinkel
E
1
In Luft schwebend, wie
Flüssigkeit fließend
0°
2
Leicht fließend
30°
3
Normal fließend
30° < 45°
4
Schwer fließend
45° < 60°
5
Zusammenhaftend
> 60°
6
Nicht rutschend,
nicht fließend,
brückenbildend
kein Böschungswinkel vorhanden
18
vgl. Martin, 2009, S. 61
19
vgl. Hoffmann, Krenn, & Stanker, 2006, S. 13
20
Quelle: Hoffmann, Krenn, & Stanker, 2006, S. 12
Terminologie
Seite | 20
Nachfolgend sind einige Schüttgüter und deren Böschungs- bzw. Schüttwinkel
tabellarisch dargestellt:
Tabelle 3: Böschungswinkel
E
und Schüttwinkel
21
Schüttgut
E
[°]
dyn
[°]
Braunkohle
50
35
Asche (Schlacke)
45
35
Gerste
35
25
Kies (nass)
50
35
Kunststoffgranulat
25
5
Mehl
55
50
Zement
45
20
Eine wichtige Kenngröße für Schüttgüter stellt unter anderem die Schüttdichte
ü
dar. Diese ist als Masse einer Raumeinheit zu verstehen (SI-Einheit
³
) und wird in
der Regel in
oder
³
angegeben.
Die Schüttdichte wird wie folgt berechnet:
ü
ü
=
ü
[ ]
ü
[ ]
Gleichung 2: Berechnung der Schüttdichte
schütt
Die Schüttdichte
ü
ist stets kleiner als die Dichte des Materials selbst. Das ist auf
die Hohlräume zwischen den einzelnen Partikeln des Schüttgutes zurückzuführen, die
bei der Berechnung der Schüttdichte berücksichtigt werden.
22
21
Quelle: Martin, 2009, S. 61
22
vgl. Schulze, 2009, S. 20
Terminologie
Seite | 21
Um eine ungefähre Größenvorstellung zu bekommen, sind in der nachfolgenden
Tabelle 4 einige Schütt- und Materialdichten von verschiedenen Materialien beispielhaft
aufgelistet:
Tabelle 4: Material- und Schüttdichten
23
Schüttgut
Materialdichte
³
Schüttdichte
schütt
³
Braunkohle
0,9
0,7
Asche (Schlacke)
2,5
0,9
Gerste
0,9
0,7
Kies (nass)
2,5
0,7
Kunststoffgranulat
1,3
0,7
Mehl
0,7
0,5
Zement
2,8
1,2
Die Schüttdichte ist eines der wichtigsten Kriterien zur Berechnung der Größe von
Transportgebinden.
24
23
Quelle: Martin, 2009, S. 61
24
vgl. Gysau, 2006, S. 76
Terminologie
Seite | 22
2.2
Verpackungsspezifische Definitionen
Die DIN 55405 definiert die Verpackungsbegriffe für den Aufbau von Verpackungen
wie folgt:
Tabelle 5: Verpackungsbegriffe
25
Verpackungsbegriff
Definitionen
Packstück
Zusammenfassung von Packgut und Verpackung
Packgut
Bezeichnet die zu verpackende Ware.
Packstoff
Der Werkstoff, aus dem das Packmittel besteht.
Packmittel
Das Erzeugnis aus Packstoff, das dazu bestimmt ist, das Packgut zu
umschließen oder zusammen zu halten, damit es lager-, transport-
bzw. verkaufsfähig wird.
Packhilfsmittel
Die Hilfsmittel, die zusammen mit den Packmitteln zum Verpacken
und Verschließen dienen.
Verpackung
Oberbegriff für die Gesamtheit der Pack- und Packhilfsmittel
Der Verpackungsbegriff in der DIN 55405 (siehe Tabelle 5) ist sehr allgemein gehalten.
In der Verpackungsverordnung (VerpackV) ist dieser wie folgt definiert:
Verpackungen sind: ,,[a]us beliebigen Materialien hergestellte Produkte zur
Aufnahme, zum Schutz, zur Handhabung, zur Lieferung oder zur Darbietung
von Waren, die vom Rohstoff bis zum Verarbeitungserzeugnis reichen können
und vom Hersteller an den Vertreiber oder Endverbraucher weitergegeben
werden." [Herv.d.Verf.]
26
25
Quelle: Schake, 2000, S. 73
26
VerpackV, §3, Art.1 Abs.1
Terminologie
Seite | 23
Die Verpackung wird gebildet aus Packmitteln und Packhilfsmitteln, die aus
verschiedenen Packstoffen bestehen.
Es werden z.
B. folgende Packmittel unterschieden: Flaschen, Beutel, Dosen,
Schachteln, Kisten, Container.
Packhilfsmittel gewährleisten die vollständige Funktion der Verpackung. Zu den
Packhilfsmittel zählen Verschließhilfsmittel (z.
B. Heftklammer, Klebeband,
Umreifungsband), Ausstattungs-, Kennzeichnungs- und Sicherungsmittel (z. B. Etikett,
Warnzettel), Schutzhilfsmittel (z.
B. Trockenmittel, Flammschutzmittel) und
Polstermittel (z. B. Schaumstoffe, Holzwolle).
Im Verpackungsprozess entsteht durch die Vereinigung von Verpackung und Packgut,
eine Packung.
27
Den Zusammenhang der Verpackungsbegriffe zeigt die nachfolgende Abbildung 3:
Abbildung 3: Grundbegriffe des Verpackens
28
27
vgl. Arnold, Isermann, Kuhn, Tempelmeier, & Furmans, 2008, S. 696f.
28
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an: Großmann & Kaßmann, 2007, S. 3
Terminologie
Seite | 24
Die VerpackV unterscheidet unter dem Oberbegriff ,,Verpackungen" verschiedene
Verpackungsarten. Zu nennen und definieren sind die folgenden Verpackungsarten:
Verkaufsverpackungen sind ,,Verpackungen, die als eine Verkaufseinheit angeboten
werden und beim Endverbraucher anfallen. Verkaufsverpackungen im Sinne der
Verordnung sind auch Verpackungen des Handels, der Gastronomie und anderer
Dienstleister, die die Übergabe von Waren an den Endverbraucher ermöglichen oder
unterstützen [...]."
29
Umverpackungen sind ,,Verpackungen, die als zusätzliche Verpackungen zu
Verkaufsverpackungen verwendet werden und nicht aus Gründen der Hygiene, der
Haltbarkeit oder des Schutzes der Ware vor Beschädigung oder Verschmutzung für die
Abgabe an den Endverbraucher erforderlich sind."
30
Transportverpackungen sind ,,Verpackungen, die den Transport von Waren
erleichtern, die Waren auf dem Transport vor Schäden bewahren oder die aus Gründen
der Sicherheit des Transports verwendet werden und beim Vertreiber anfallen."
31
Die Abgrenzung der Verpackungen im Hinblick auf das Einsatzkriterium zwischen der
Verkaufsverpackung, Umverpackung und Transportverpackung erweist sich als
schwierig, da der Einsatz vom Umgang mit der Verpackung abhängt. Eine typische
Transportverpackung kann zu einer Verkaufsverpackung werden und umgekehrt.
Überwiegend dient die Transportverpackung dem Transport, die Umverpackung der
Bündelung von Einzelverpackungen und die Verkaufsverpackung der Verwendung
durch den Endverbraucher.
32
Die VerpackV unterscheidet eine weitere Verpackung nach dem Verwendungszweck.
Mehrwegverpackungen sind ,,Verpackungen, die dazu bestimmt sind, nach Gebrauch
mehrfach zum gleichen Zweck wiederverwendet zu werden."
33
29
VerpackV, §3 Abs.1 Art.2
30
VerpackV, §3 Abs.1 Art.3
31
ebd.
32
vgl. Lange, 1998,S. 21
33
VerpackV, §3 Abs. 3
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842811904
- DOI
- 10.3239/9783842811904
- Dateigröße
- 7.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Bremerhaven – Ingenieurswesen, Studiengang Transportwesen /Logistik
- Erscheinungsdatum
- 2011 (März)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- fibc flexible verpackung schüttgut mehrweg
- Produktsicherheit
- Diplom.de