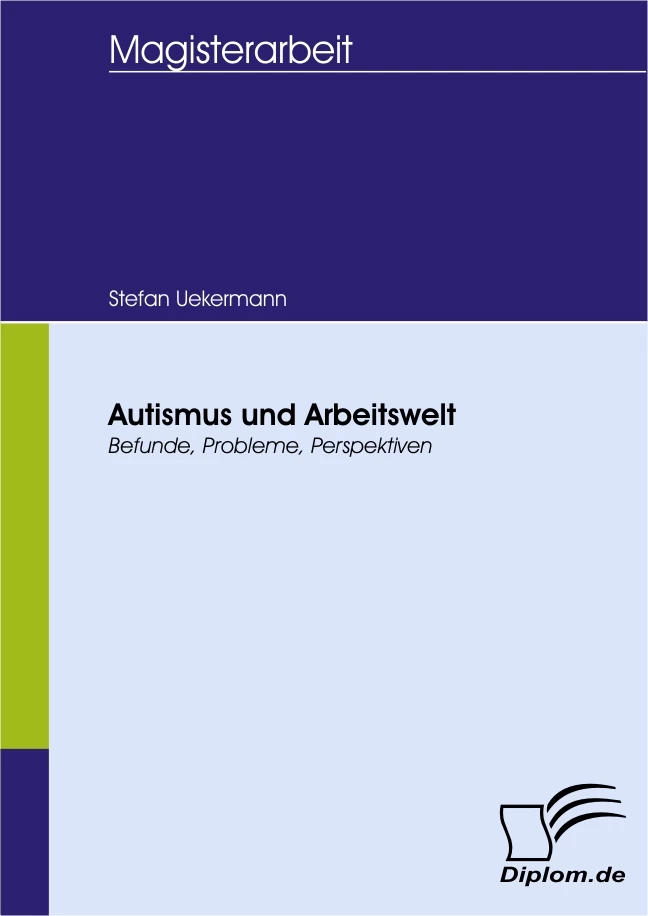Autismus und Arbeitswelt
Befunde, Probleme, Perspektiven
Zusammenfassung
1988 kam der Film Rain Man von Barry Levinson in die amerikanischen Kinos. Der autistische Raymond wird in diesem Film von seinem Bruder Charlie auf eine Reise durch die USA mitgenommen. Raymond ist ein Savant, ein Inselbegabter, der extrem schnell rechnen und zählen kann und ein außergewöhnliches Erinnerungsvermögen besitzt. Mit Hilfe dieser Fähigkeit gewinnen die beiden alle Black-Jack Spiele in einem Casino in Las Vegas.
Seit diesem Film ist Autismus in der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Dennoch wissen die meisten Menschen kaum etwas über Autismus. Aber auch in der wissenschaftlichen Diskussion ist Autismus nur schwer zu definieren. Autismus ist eine Krankheit, die ein sehr breites Spektrum an Symptomen zulässt und bei der zudem noch eine Vielzahl an Komorbiditäten in Erscheinung treten können. Autismus ist nicht heilbar, aber man kann versuchen die autistischen Erscheinungen einzudämmen und mit autistischen Verhaltensweisen kontrollierter umzugehen. Autismus beginnt in den meisten Fällen bereits im Kindesalter und ist ständiger Bestandteil des gesamten Lebens.
Die Formen und Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation behinderter Menschen sind sehr vielfältig und sind abhängig von dem individuellen Leistungsvermögen der Rehabilitanden. Der Gesetzgeber unterscheidet in den meisten beruflichen Förderungsmöglichkeiten nicht nach Art und Schwere der Behinderung. Somit stehen die meisten beruflichen Integrationsmaßnahmen auch Menschen mit autistischen Beeinträchtigungen zur Verfügung. Die Komplexität der autistischen Erscheinungen erfordern jedoch eine möglichst genaue Diagnose und ein umfassendes Assessment der persönlichen Stärken und Beeinträchtigungen. Die Chance auf eine berufliche Integration ist bei Menschen mit milden Formen von Autismus relativ groß, wenn ihre Stärken und Beeinträchtigungen ersichtlich sind und sie gezielt gefördert werden.
Wie werden Autisten beschult? Auf welche Probleme stoßen Autisten im Schulalltag und welche Lösungsansätze gibt es? Wie sehen die Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation von Autisten in Deutschland aus? Welche Hilfen gibt es und welche sind effektiv? Welche Rahmenbedingungen müssen vorhanden sein, damit berufliche Rehabilitation bei Autisten funktioniert? Worauf muss bei der Rehabilitation autistischer Menschen geachtet werden?
Um diese Fragen beantworten zu können, widme ich mich vorerst der autistischen Erscheinungen. Was ist Autismus? Woher kommt […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Was ist Autismus ?
2.1 Historische Autismusforschung
2.1.1 Leo Kanner und Hans Asperger
2.1.2 Autismusforschung in den 50er und 60er Jahren
2.1.3 Prävalenz
2.2 Symptomatik und Klassifikation
2.2.1 Triade der Beeinträchtigung
2.2.2 DSM-IV und ICD-10
2.2.3 Ausblick
2.3 Ursachen für Autismus
2.3.1 Genetische Einflüsse
2.3.2 Neurobiologische Einflüsse
2.3.3 Psychologische Theorien
2.4 Therapie
2.4.1 Verhaltenstherapeutische Ansätze
2.4.2 Körperbezogene Therapieansätze
2.4.3 weitere Therapieansätze
2.4.4 Exkurs - Sabine Bonnaire
3. Autismus und Schule
3.1 Situation in Deutschland
3.2 Probleme und Lösungsstrategien im Schulalltag
3.2.1 Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion
3.2.2 Beeinträchtigungen der sozialen Kommunikation
3.2.3 Eingeschränkte Interessen und stereotypes Verhalten
3.3 Empfehlungen des autismus Deutschland e.V.
4. Autismus und Arbeitswelt
4.1 Berufsausbildung
4.1.1 Überbetriebliche Ausbildung im Berufsbildungswerk (BBW)
4.1.2 Ausbildung von Autisten in den BBW
4.1.3 Anzahl der autistisch beeinträchtigten Rehabilitanden in den BBW
4.1.4 Weitere Einrichtungen der Berufsvorbereitung und Ausbildung
4.2 Geschützte und teilgeschützte Arbeitsplätze
4.2.1 Probleme und Chancen
4.2.2 Leitlinien des autismus Deutschland e.V.
4.3 Unterstützungssysteme zur Integration auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
4.3.1 Assessmentverfahren zur Diagnose erwachsener Autisten
4.3.2 Berufsrelevante Diagnosedokumentationen
4.3.3 Integrationsamt und Integrationsfachdienste
4.3.4 Unterstütze Beschäftigung (UB)
4.3.5 Arbeitsassistenz
4.3.6 Projekt Autismus III – Persönliches Budget
4.4 Berufliche Integration von Autisten im Ausland
4.5 Arbeitsweltbezogene Empfehlungen
4.5.1 Arbeitsplatzgestaltung
4.5.2 Soziale Interaktion mit autistischen Mitarbeitern
5. Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Erklärung
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 - Ein Kind mit Autismus ordnet seine Spielsachen im Bett (Frith, 2003)
Abbildung 2 - the aloof, the passive, the odd (Frith, 2003)
Abbildung 3 - Autistisches Spektrum als tiefgreifende Entwicklungsstörung (Dodd, 2005)
Abbildung 4 - "Elevated Square"
Abbildung 5 - Möglichkeiten der beruflichen Integration von Autisten (Paul, 2009)
Abbildung 6 - Typischer Aufbau eines BBW
Abbildung 7 - Verteilung der Behinderungsarten in den BBW (Neumann, Lenske, Werner, & Hekmann, 2010)
Abbildung 8 - BBW-Absolventen nach Art der Behinderung und Ausbildungsbereich in Prozent
(Neumann, Lenske, Werner, & Hekmann, 2010)
Abbildung 9 - Typischer Aufbau einer WfbM
1. Einleitung
1988 kam der Film „Rain Man“ von Barry Levinson in die amerikanischen Kinos. Der autistische Raymond wird in diesem Film von seinem Bruder Charlie auf eine Reise durch die USA mitgenommen. Raymond ist ein Savant, ein Inselbegabter, der extrem schnell rechnen und zählen kann und ein außergewöhnliches Erinnerungsvermögen besitzt. Mit Hilfe dieser Fähigkeit gewinnen die beiden alle Black-Jack Spiele in einem Casino in Las Vegas.
Seit diesem Film ist Autismus in der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Dennoch wissen die meisten Menschen kaum etwas über Autismus. Aber auch in der wissenschaftlichen Diskussion ist Autismus nur schwer zu definieren. Autismus ist eine Krankheit, die ein sehr breites Spektrum an Symptomen zulässt und bei der zudem noch eine Vielzahl an Komorbiditäten1 in Erscheinung treten können. Autismus ist nicht heilbar, aber man kann versuchen die autistischen Erscheinungen einzudämmen und mit autistischen Verhaltensweisen kontrollierter umzugehen. Autismus beginnt in den meisten Fällen bereits im Kindesalter und ist ständiger Bestandteil des gesamten Lebens.
Die Formen und Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation behinderter Menschen sind sehr vielfältig und sind abhängig von dem individuellen Leistungsvermögen der Rehabilitanden. Der Gesetzgeber unterscheidet in den meisten beruflichen Förderungsmöglichkeiten nicht nach Art und Schwere der Behinderung. Somit stehen die meisten beruflichen Integrationsmaßnahmen auch Menschen mit autistischen Beeinträchtigungen zur Verfügung. Die Komplexität der autistischen Erscheinungen erfordern jedoch eine möglichst genaue Diagnose und ein umfassendes Assessment der persönlichen Stärken und Beeinträchtigungen. Die Chance auf eine berufliche Integration ist bei Menschen mit milden Formen von Autismus relativ groß, wenn ihre Stärken und Beeinträchtigungen ersichtlich sind und sie gezielt gefördert werden.
Wie werden Autisten beschult? Auf welche Probleme stoßen Autisten im Schulalltag und welche Lösungsansätze gibt es? Wie sehen die Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation von Autisten in Deutschland aus? Welche Hilfen gibt es und welche sind effektiv? Welche Rahmenbedingungen müssen vorhanden sein, damit berufliche Rehabilitation bei Autisten funktioniert? Worauf muss bei der Rehabilitation autistischer Menschen geachtet werden?
1 Eine Komorbidität ist ein zusätzlich zu einer Grunderkrankung vorliegendes, diagnostisch abgrenzbares Krankheits- oder Störungsbild.
Um diese Fragen beantworten zu können, widme ich mich vorerst der autistischen Erscheinungen. Was ist Autismus? Woher kommt Autismus? Wie kann Autismus festgestellt und therapiert werden? Erst wenn man die Besonderheiten des Autismus verstehen kann, werden einem die Probleme, auf die Autisten im Rahmen ihrer beruflichen Rehabilitation stoßen, bewusst. Hinsichtlich dieser Probleme untersuche ich im Anschluss die arbeitsweltbezogenen Möglichkeiten der Rehabilitation. Dabei skizziere ich verschiedene Integrationsmöglichkeiten und untersuche sie bezüglich der spezifischen Chancen und Probleme von Autisten.
2. Was ist Autismus?
Es gibt sehr unterschiedliche Formen des Autismus. Grundsätzlich kann man sagen, dass es Menschen, die Autismus haben, schwer fällt bzw. teilweise für sie beinahe unmöglich ist, die Welt in der sie leben und ihre Mitmenschen zu verstehen. Der Begriff Autismus würde aus dem griechischen übersetzt etwa „Selbstheit“ bedeuten. Dieser Begriff wirkt sehr treffend, da es scheint, dass Autisten sich in erster Linie mit sich selber oder Gegenständlichem beschäftigen und die Belange anderer Menschen für sie uninteressant bzw. nicht zu verstehen sind. Autismus nur über den Begriff selber zu definieren reicht sicherlich nicht aus. Hans Asperger, auf den ich noch zu sprechen komme, beschreibt im ersten Kapitel seiner Habilitation „Die ‚Autistischen Psychopathen‘ im Kindesalter“ die Problematik von Definition und Namensgebung bezüglich der psychischen Erscheinungsformen von Menschen.
„Jeder Mensch ist ein einmaliges, unwiederholbares, unteilbares Wesen („Individuum“), darum auch letztlich unvergleichbar mit anderen. In jedem Charakter finden sich einander scheinbar widersprechende Züge – gerade aus Gegensätzen und Spannungen lebt ja das Leben.“ (Asperger, 1943)
Autismus kann je nach Erscheinungsform von absoluter Teilnahmslosigkeit, Apathie und extremster Abkapselung zur Umwelt (zum Beispiel beim frühkindlichen Autismus) mit schwerer geistiger Behinderung und einer Vielzahl von Komorbiditäten bis zum für Laien unauffälligen sozialen Verhalten reichen (Asperger-Syndrom). Der Übergang von dieser leichten Autismuserscheinung zum kontaktscheuen gesunden Menschen muss als ebenso fließend betrachtet werden. Aufgrund dieser unterschiedlich schweren Erscheinungsformen von Autismus wird teilweise die Meinung vertreten, „Autismus komme in
der allgemeinen Bevölkerung in ‚beliebiger Verdünnung‘ vor“ (Poustka, Bölte, FeineisMatthews, & Schmötzer, 2004). Das heißt Autismus ist im Grunde ein Persönlichkeitsmerkmal, welches jeder Mensch in unterschiedlicher Ausprägung aufweist. Die willkürliche Grenzziehung zwischen normal und abnormal bei einer Autismusdiagnose spricht zwar dafür, aber die Annahme, autistische Anteile seien in jedem Menschen vorhanden, können die Situation der Betroffenen verschärfen, da psychische Störungen immer massive Beeinträchtigungen in der Lebensführung mit sich bringen. (Poustka, Bölte, Feineis-Matthews, & Schmötzer, 2004)
2.1 Historische Autismusforschung
1911 benutzte der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler als erster den Begriff Autismus, um mit ihm „ein Grundsymptom der Schizophrenie“ zu beschreiben, bei der die Erkrankten sich in eine gedankliche Binnenwelt zurückzogen. Die Erkrankten nehmen zunehmend weniger Kontakt zu Mitmenschen auf und ihre Binnenwelt bekommt ein krankhaftes Übergewicht gegenüber der Umwelt (Remschmidt, 2008). Bleuler beschrieb damit allerdings noch nicht das gesamte Krankheitsbild, welches wir heute unter Autismus verstehen. Autismus war für ihn lediglich der Begriff für ein Symptom der schizophrenen Erkrankung. Aber es gibt Parallelen zwischen Bleulers Diagnostik und dem heutigem Verständnis von Autismus, die vor allem im sozialen Rückzug bzw. sozialem Verhalten liegen.
2.1.1 Leo Kanner und Hans Asperger
Aufgrund von Bleulers Forschungsarbeit benutzten Leo Kanner, ein Kinderarzt aus Österreich, der in den USA arbeitete und Hans Asperger, ein Wiener Arzt unabhängig voneinander den Begriff Autismus als eigenständige Verhaltensform für von ihnen untersuchte autistische Störungsbilder bei Kindern. Leo Kanner beschrieb 1943 in seinem Artikel „Autistische Störung des affektiven Kontakts“ 11 Kinder die von Geburt an unfähig waren, sich in normaler Weise mit Personen oder Situationen in Beziehung zu setzen. Die Kinder waren unfähig den biologisch vorgesehenen Kontakt mit anderen Menschen herzustellen. Zudem konnten sie Veränderungen in ihrer Umwelt nur schwer oder nicht ertragen und haben mehr Interesse an Gegenständen als an Menschen gezeigt
(Kühn, 2008). Neben diesen Schwierigkeiten beschrieb Kanner auch Behinderungen ihrer kommunikativen Fähigkeiten. Drei der Kinder sprachen gar nicht; bei den anderen Kindern beobachtete Kanner Auffälligkeiten wie Echolalie2, die Umkehr von Personalpronomina oder eine Reizüberempfindlichkeit. Kanners Beschreibungen sind heute zu weiten Teilen als frühkindlicher Autismus oder Kanner-Syndrom bekannt. Jedoch werden mit der heute üblichen Definition des Kanner-Autismus nicht alle Annahmen von Kanner übernommen. So nahm Kanner an, dass die von ihm beschriebenen Kinder nicht geistig behindert sind, weil sie für ihn einen Anschein von Weisheit hatten. Weiterhin ging er zeitweise davon aus, dass das Verhalten der Eltern für Autismus ursächlich ist, obgleich er anfänglich und auch später Autismus als angeborene Störung verstand (Poustka, Bölte, Feineis-Matthews, & Schmötzer, 2004).
Hans Asperger schrieb 1943 ohne von Kanners Artikel zu wissen seine Habilitation an der Wiener Universitätsklinik mit dem Titel „Die ‚Autistischen Psychopathen‘ im Kindesalter“. Er beobachtete vier Jungen die in die Klinik eingewiesen worden sind. Drei von ihnen wurden als „schulunfähig“ von der Schule in die Klinik eingewiesen. Auch Asperger ging davon aus, Autismus sei eine extreme Variation eines normalen Persönlichkeitszuges. (Poustka, Bölte, Feineis-Matthews, & Schmötzer, 2004). Asperger stellte „das Gemeinsame, das Typische“ seiner untersuchten Kinder heraus und fasste es unter sechs Gesichtspunkten zusammen (Asperger, 1943):
1. Das Körperliche und die Ausdruckserscheinungen
Auffallend sei, dass die Kinder schnell das „Babyhafte“ verlieren würden und feine ausgearbeitete Gesichtszüge entwickelt hätten.3 Kommunikation über den Blick sei mit ihnen kaum möglich, auch sei es nur schwerlich möglich zu erkennen, ob die Kinder einen Gegenstand oder Menschen fokussiert haben oder doch in die Ferne schauen. Sie hätten einen „verlorenen Blick“ und ebenso sei die Mimik und Gestik „schwach und leer“. Bewegungen würden keinen Ausdruckswert besitzen und eher Bewegungsstereotypien sein. In der Sprache gäbe es zwischen den Kindern große
2 Echolalie bezeichnet einen krankhaften Zwang, Worte und Aussagen des Gesprächspartners selbst zu wiederholen.
3 Laut Uta Frith besitzen nicht wenige Kinder mit Autismus eine eindringliche und außerweltliche Schönheit. Ebenso sprechen Maureen Aarons und Tessa Gittens vom „legendär attraktiven Aussehen“ von Kindern mit Autismus, aufgrund dessen die Eltern oft nur schwerlich eine schwerwiegende Entwicklungsstörung ihres Kindes akzeptieren können. (Frith, 2003) (Aarons & Gittens, 2005)
Unterschiede in Modulation und Lautstärke, aber die Sprache würde bei allen Kindern unnatürlich und nicht zielgerichtet wirken.
2. Die „autistische Intelligenz“
Die Sprache der Kinder sei originell. Zwar sei es im Kleinkindalter typisch, dass neue Wörter erfunden werden, die zudem auch noch überaus trefflich erscheinen, aber im Normalfall würden Kinder diese Originalität verlieren. Autistische Kinder würden aber weiterhin frei gestaltete Ausdrücke erfinden und benutzen. Auffallend sei auch ihr großes Interesse in einem ausgewählten Spezialgebiet, wobei sie sich das Wissen selber aneignen und kaum durch Lehre zu begeistern sind. Asperger beobachtete auch ein großes Kunstverständnis bei seinen Patienten.4 Im Zuge dessen spricht Asperger auch von einer „psychopathischen Klarsichtigkeit“. Autistische Kinder hätten aufgrund ihrer Distanz zur Umwelt die Fähigkeit, diese sehr klar zu erfassen und zu beurteilen. Sie würden im Vergleich zu gleichaltrigen nichtautistischen Kindern ein ebenso klares Bild von sich selber haben. Vegetative Automatismen würden von den autistischen Kindern teilweise sehr bewusst wahrgenommen und analysiert werden. Diese Abstraktionsfähigkeit sei eine Voraussetzung zu wissenschaftlicher Leistung und damit im günstigen Fall auch eine Voraussetzung zum Berufseinstieg. Leider würden diese Vorteile aber nur in den wenigsten Fällen die autistischen Wesenszüge überwiegen.
Trotz der besonderen autistischen Intelligenz würde das schulische Lernen jedem Autisten mehr oder weniger schwer fallen. Einfache Rechenaufgaben würden teilweise in schwierigen, komplizierten und eigenen Rechenschritten gelöst. Lesen und Schreiben würden teilweise nur sehr schwer erlernt, es sei denn, Lesen oder Schreiben gehöre zum Interessengebiet des Autisten. Asperger nennt es die „Störung der aktiven Aufmerksamkeit“, welche keine typische Konzentrationsstörung sei, sondern eher ein In-sich-gekehrt-sein, welches Aufgaben und Erwartungen von außen ausschließe.
3. Verhalten in der Gemeinschaft
4 Heute wissen wir, dass autistische Kinder Bilder und Gemälde zutreffend beschreiben können, ihnen aber die Fähigkeit fehlt, Emotionen in Gesichtern in den Bildern und Gemälden lesen zu können. (Vgl. Frith, 2003)
Asperger sieht in der Einengung der Beziehungen zur Umwelt die „Grundstörung der Autistischen Psychopathen“. Ihre Isoliertheit und Spontanität würde in den Familien immer wieder zu Konflikten führen. Dennoch sei es hier den Eltern noch möglich, ihre Kinder lange Zeit spielen zu lassen. Die Kinder seien dann in ihrer Spielwelt oder dem Gegenstand ihres Interesses vollständig versunken. Reize von außen würden nicht wahrgenommen oder aber störend wahrgenommen, auf die die Kinder dann extrem aggressiv reagierten. Gerade in der Schule, in der nicht gespielt werden kann, wenn man möchte, würden die autistischen Kinder äußeren Zwängen unterliegen und müssten „die Freiheit des spontanen Impulses, des spontanen Interesses“ ablegen, was ihnen nicht oder nur sehr schwer möglich ist. Aufgrund dessen würden die Kinder gerade mit der Einschulung das erste Mal in heilpädagogische Beratungsstellen kommen, da die Eltern bis zu diesem Zeitpunkt oftmals mit den autistischen Eigenheiten ihres Kindes weitestgehend zurechtkämen. Weiterhin spricht Asperger von den Hänseleien in der Schule. Die autistischen Kinder seien aufgrund ihres autistischen Verhaltens schon von Anfang an als Außenseiter und Sonderlinge identifiziert. Im günstigsten Fall könnten die Kinder aufgrund ihrer Intelligenzleistung oder aufgrund von besonders „rücksichtslosem Losgehen“ eine gewisse Art von Achtung gewinnen, welche aber immer mit Spott gemischt sei.
4. Trieb- und Gefühlsleben der Autistischen
Asperger spricht im Hinblick auf die Sexualität der geschilderten Kinder von einem uneinheitlichen, aber niemals normalen Bild. Sie zeigten entweder ein Desinteresse an Sexualität oder exzessive Masturbation, begleitet von fehlendem Schuld- und Schamgefühl. Weiterhin seien sadistische Züge beobachtet worden, welches gegensätzlich zu ihrem teilweise abnormem Angstzuständen stünde. Gegensätzlichkeit sei ohnehin symptomatisch für die Trieb- und Gefühlswelt der Autisten. Geschmackssinn, Tastsinn, Hörsinn seien durchweg gestört. So gäbe es Kinder, die ausgesprochen überempfindlich gegen Geräusche und Lärm seien und dennoch seien sie, wenn sie in ihrer Welt versunken sind, völlig unempfindlich Lärm gegenüber. Auf der Gefühlsebene gäbe es bei den Kindern einen „ausgesprochenen Gefühlsdefekt“. Sie seien arm an Zärtlichkeit und seien teilweise boshaft und grausam. Asperger sei jedoch überrascht von den starken und unnatürlich langanhaltenden Heimwehreaktionen der Kinder. Daher könne man nicht von einer quantitativen
„Gefühlsarmut“ sprechen, sondern von einem „qualitativem Anderssein, einer Disharmonie an Gefühl, an Gemüt, oft voll überraschender Widersprüche“, wodurch diese Kinder charakterisiert seien. Weitere Besonderheiten der Gefühlsebene seien extreme Egozentrik, unübertroffene Respektlosigkeit, das Fehlen von Fremdheitsgefühl und Humorlosigkeit.
5. Erbbiologisches
Asperger ist war sich sicher, dass Autismus vererbt wird. Er betont, dass bei jedem von mehr als 200 beobachteten Kindern in der Verwandtschaft autistische Züge und oft sogar Verwandte mit dem voll ausgeprägtem Bild des Autistischen Psychopathen zu finden sei. Ferner gibt er den Hinweis, dass jeder autistische Patient männlichen Geschlechts sei. Das ins Extreme gesteigerte Verhalten der Autisten beruhe auf eine typisch männliche Intelligenz. Abstraktion, Logik, präzises Denken und Formulieren läge „viel mehr in den Möglichkeiten des Knaben“. Schließlich trennt Asperger die Schizophrenie vom Autismus. Autismus habe genetisch nichts mit der Schizophrenie zu tun.
6. Soziale Wertigkeit der Autistischen Psychopathen
Autismus sei keine prozesshafte Krankheit. Das Krankheitsbild würde sich nicht ändern, dennoch stelle sich eine Anpassung an die Umwelt heraus. Die Spezialinteressen würden „vernünftiger“ durch die Wahl der Objekte, ihrer Ordnung und der geistigen Verarbeitung. Lediglich bei Autisten mit einer „ausgesprochen intellektuellen Minderwertigkeit“ komme es zu keiner Anpassung.
Autisten mit intaktem Intellekt und ganz besonders überdurchschnittlich gescheite Autisten würden eine „gute Berufsleistung“ erbringen und damit käme es auch zu einer sozialen Einordnung. Asperger geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass oftmals „niemand als gerade diese autistischen Menschen gerade zu solchen Leistungen befähigt“ seien. Verglichen mit normalen Jugendlichen im Übergang Schule-Beruf seien Autisten bereit mit „gesammelter Energie und selbstverständlicher Sicherheit“ ihren Weg zu gehen, „zu dem sie meist schon von Kind an nach ihren Anlagen vorbestimmt erscheinen“. Berufseinstellung sei ein Zwang zur Einseitigkeit, ein Aufgeben von Möglichkeiten, an dem manche Jugendliche nur scheitern
würden, weil sie in verschiedene Richtungen begabt seien und daher nicht in der Lage seien, sich für eine Richtung, für einen Weg entscheiden könnten.
Laut Brita Schirmer sei die Habilitationsschrift jedoch nicht die erste Schilderung Aspergers über den autistischen Psychopathen. Bereits 1938 soll er im Rahmen eines Vortrags über die autistischen Psychopathen referiert haben, der in der Wiener Klinischen Wochenzeitschrift publiziert wurde. Kanner, von dem vermutet wird, er habe keine Kenntnis von Aspergers Beobachtungen gehabt, schreibt 1943 „Since 1938, there have come to our attention a number of children whose condition differs so markedly and uniquely from anything reported so far, that each case merits – and, I hope, will eventually receive – a detailed consideration of its fascinating peculiarities.” Ob für Kanner möglicherweise das Jahr 1938 ausschlaggebend war, weil er Aspergers Vortrag kannte, kann allerdings nicht bestätigt werden (Schirmer, 2003).
Anders als die Arbeit von Leo Kanner fand Aspergers Untersuchung lange Zeit kaum Beachtung. Im Gegensatz zu Kanner verfasste Asperger seine Habilitation in deutscher Sprache. Erst durch die englische Zusammenfassung von Dr. Lorna Wing 1981 und ihre Beschreibung 34 eigener Fälle wurde seine Arbeit international bekannt und Aspergers Schrift wurde 1991 von Uta Frith in englischer Sprache publiziert. Lorna Wing ersetzte Aspergers Begriff des autistischen Psychopathen erstmals mit dem heute üblichen Terminus „Asperger-Syndrom“.
Ob Asperger und Kanner die ersten klinischen Berichte zu Autismus lieferten, kann man nicht eindeutig bestimmen. Bleuler selbst wies bei seinen Ausführungen auf die Aufzeichnung von verschiedenen französischen Kollegen hin, die das Phänomen Autismus bereits vor ihm beschrieben haben (Schirmer, 2003). 1908 schilderte der Pädagoge Theodor Heller Fälle von Kindern in seiner Erziehungsanstalt für geistig abnorme und nervöse Kinder in Wien-Grinzing. Nach zunächst unauffälligem Heranwachsen bis zum Alter von 3-4 Jahren trat bei einigen Kindern eine körperliche und geistige Regression zum Vorschein, die er als „dementia infantilis“ bezeichnete. Die beschriebenen Störungen sind einer schweren Form von Autismus sehr ähnlich. 1926 stellte die russische Neurologin Grunja Jefimowna Sucharewa unter der Bezeichnung „schizoide Psychopathie“ Fälle mit sehr ähnlicher Symptomatik dar (Poustka, Bölte, FeineisMatthews, & Schmötzer, 2004). 1930 schrieb die Psychoanalytikerin Melanie Klein
über den Jungen Dick, den sie in ihrem Beitrag „Die Bedeutung der Symbolbildung für die Ich-Entwicklung“ vorstellte. Aus heutiger Sicht würde man Dick als autistisch diagnostizieren und nicht wie Klein als schizophren (Tustin, 2008).
2.1.2 Autismusforschung in den 50er und 60er Jahren
1952 erscheint die erste Version des „Diagnostic and statistical Manual – Mental Disorders“ (Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen; DSMI), herausgegeben von der American Psychatric Association in Washington (Amerikanisch Psychatrische Vereinigung). Autismus, hier das Kanner-Syndrom, wurde damit zum ersten Mal in ein Klassifikationssystem aufgenommen. Autismus wurde in dem DSM-I noch nicht als eigenständige psychische Störung verstanden, sondern als eine Art der Schizophrenie. Das DSM-I unterschied die Kindheitsschizophrenie von anderen Schizophrenietypen hinsichtlich des Auftretens der schizophrenischen Reakationen.
„000-x28 Schizophrenic reaction, childhood type
Here will be classified those schizophrenic reactions occurring before puberty. The clinical picture may differ from schizophrenic reactions occurring in other age periods because of the immaturity and plasticity of the patient at the time of onset of the reaction. Psychotic reactions in children, manifesting primarily autism, will be classified here. Special symptomatology may be added to the diagnosis as manifestations. (DSM-I, 1952)“
Vier Jahre später formulierte Leo Kanner mit Hilfe von Dr. Leon Eisenberg die Ergebnisse seiner Studie von 1943 neu. Im ersten Teil ihres Artikels wiederholten und bestätigten sie die 5 wichtigsten Ergebnisse der Studie:
1. Die Unfähigkeit der Kinder eine gewöhnliche Beziehung zu anderen und zu Situationen aufzubauen,
2. die Unfähigkeit Sprache zur adäquaten Kommunikation zu nutzen,
3. der angstvolle und zwanghafte Wunsch zur Gleicherhaltung,
4. die Faszination für Objekte und der feinmotorische Umgang mit ihnen und
5. die guten kognitiven Potenziale.
Kanner und Eisenberg entschieden sich dazu, dass eine extreme Selbstisolation und das zwanghafte Beharren auf Gleicherhaltung für eine Autismusdiagnose vorhanden sein müssen und obwohl der eigentümliche und defizitäre Sprachgebrauch ein augenscheinliches Merkmal sei, läge dies doch eher in der Störung der sozialen Beziehungen begründet. In mehreren Passagen des Artikels weisen Kanner und Eisenberg auf die emotional eisigen Eltern der Kinder hin. Zwar geben sie zu, dass 10% der Eltern nicht diesem Bild entsprächen, aber sie sagen auch, dass man nicht um die Schlussfolgerung umher käme, die emotionalen Umstände im Elternhaus seien maßgeblich für die Entstehung von Autismus. Gegen Ende des Artikels räumen Kanner und Eisenberg dann aber noch ein, dass es eine geringe Wahrscheinlichkeit der genetischen Vererbung von Autismus gäbe (Long, 2007).
Diesen psychogenetischen Ansatz bezüglich der Entstehung von Autismus vertrat in den 60er Jahren auch der Psychoanalytiker und Kinderpsychologe Bruno Bettelheim. Autismus sei die Folge einer Störung des frühkindlichen Interaktionsprozesses mit der Mutter. Er war der Auffassung, Autismus sei begründet in Erziehungsfehlern während der ersten zwei Lebensjahre des Kindes (Rödler, 1983). Bettelheim erkannte wie auch schon seine Vorgänger, aber ebenso ging er davon aus, dass die Eltern autistischer Kinder zwar häufig sehr gebildet schienen, aber dass die Eltern es seien, welche nicht in der Lage wären eine Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen. In diesem Zusammenhang beschrieb er das Verhalten, angelehnt an seine Erfahrungen im KZ Dachau und Buchenwald, als typisch für Menschen, die besonders lange und nachhaltig gelitten haben. Trotz des Protestes einiger Wissenschaftler5, hielt sich dieser Ansatz relativ lange in der wissenschaftlichen Diskussion über das Entstehen von Autismus und das hatte schwerwiegende Folgen. Bettelheim, Kanner und andere Verfechter des psychogenetischen Ansatzes prägten dadurch den Begriff der „Kühlschrankmutter“. Die Stigmatisierung der Eltern, insbesondere der Mutter, endete allzuoft in Schulgefühlen der Eltern. Man kann davon ausgehen, dass viele Eltern daher einer Diagnose ihrer autistischen Kinder aus dem Weg gingen.
5 Neben anderen Wissenschaftlern ging der amerikanische Psychologe Bernard Rimland von einer genetischen Prädisposition von Autismus aus. Bernard Rimland beriet Dustin Hoffman für seine Rolle als Autist im Film „Rain Man“.
2.1.3 Prävalenz
Zwar kann man kaum auf verlässliche Daten zurückgreifen, da den Querschnisttstudien unterschiedliche Definitionen und Methoden zu Grunde liegen und sie zudem und sie aufgrund der geringen Anzahl der jeweilig untersuchten Fälle nur wenig repräsentativ sind, aber es lässt sich abzeichnen, dass die Zahl der Autismus-Fälle seit Jahren kontinuierlich ansteigt. Begründen kann man dies in den neu geschaffenen Diagnosen, vor allem im Bereich des Asperger-Syndroms und andere milderer Autismuserscheinungen. Derzeit geht man davon aus, dass etwa 62 von 10000 Menschen von autistischen Beeinträchtigungen betroffen sind, von denen mindestens 21 dem Kanner- und ca. zehn dem Aspergersyndrom zuzuordnen sind. Das MännerFrauen-Verhältnis beträgt etwa 5:1. (Baumgartner, Dalferth, & Vogel, 2009).
2.2 Symptomatik und Klassifikation
Um Autismus benennen zu können, systematisch zu erforschen und die Beobachtungsergebnisse mittelbar und vergleichbar zu machen, muss, wie bei jedem anderen Untersuchungsphänomen, eine Klassifikation vorgenommen werden. Eine Klassifikation bei psychischen Störungen stellt sich aber oftmals als schwierig dar. Kritiker meinen, es sei prinzipiell fragwürdig, ob eine Klassifikation psychischer Störungen der Individualität des Patienten gerecht werden kann. Teilweise wird sogar behauptet, dass eine Klassifikation eine dem Patienten schädigende Etikettierung ihrer Verhaltensstörung sei, welche erst aufgrund der daraus resultierenden Verhaltensweisen ihrer Mitmenschen zu den spezifischen Lebensschwierigkeiten des Patienten führt (Möller, 1989). Eine solch radikale Annahme scheint zwar einerseits in ihrer Gänze unhaltbar, unbestreitbar ist jedoch, dass Autismus in unserer Gesellschaft derzeit noch einen recht negative Konnotation aufweist, welche sicherlich manch Probleme des Autisten erst hervorruft bzw. verstärkt6. Weiterhin sind die fließenden Übergänge unterschiedlicher Formen der autistischen Störung, das unzureichende Wissen über die Entstehungsgeschichte und die Komplexität der Erscheinungsbilder überaus problematisch hinsichtlich einer der Sache gerecht werdenden Klassifikation (Möller, 1989). Besonders im Bereich der autistischen Erscheinungsformen wirkt sich das problematisch bezüglich einer Klassifikation aus.
6 Gerade Asperger-Autisten wird oft mit Skepsis und falschen Informationen entgegengetreten. Die Mitmenschen entwickeln daher besondere Verhaltensweisen im Umgang mit Asperger-Autisten, welche die Unsicherheiten in ihrem sozialen Verhalten verstärken können.
Daher müsste man eine Klassifikation autistischer Erscheinungsformen eher als Typenbildung begreifen. Typen sind theoretische Konstrukte, welche in der Realität nicht vorkommen sondern Abstraktionen real vorkommender Gegebenheiten sind. Eine Typologie wird eben diesen Gegenstandsbereichen gerecht, welche eine scharfe Trennung und eine gewisse Randschärfe nicht zulassen. Bei einer Typologie kann man zwischen Extremtypen und Häufungstypen unterscheiden. Extremtypen sind die Bezeichnungen für die Extreme einer Variationsreihe (Möller, 1989). Im Untersuchungsfeld Autismus ist eine solche Art der Klassifizierung sinnvoll, da die Bandbreite autistischer Erscheinungsformen groß ist und teilweise ja sogar behauptet wird, die autistischen Besonderheiten seien sogar mit unterschiedlichen Ausprägungsgraden in jedem Menschen vorhanden.
Trotz dieser Schwierigkeiten ist eine Klassifikation von psychischen Verhaltensauffälligkeiten wichtig. Erst aufgrund der Klassifikationen lässt sich eine zielgerichtete Forschung betreiben und die daraus entstehenden Therapieansätze rational und empirisch begründbar einsetzen. Die international anerkannten Klassifikationssysteme für Krankheiten und psychische Störungen sind die „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD) und das Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen (DSM). Dennoch kann eine Klassifikation, wie sie das DSM (DSM-IV) in der vierten Version und die ICD in der zehnten Version (ICD-10) vornehmen, nicht den Autismus als Ganzes umfassend beschreiben. Zur Beschreibung der Symptomatik und des Erscheinungsbildes von Autismus gehe ich daher genauer auf die Triade der Beeinträchtigungen ein, da sie für alle Erscheinungsformen aus dem autistischen Spektrum im Sinne einer Typenbeschreibung gültig ist. Lediglich der Schwerpunkt und die Ausprägungen der Merkmale der Triade verschieben sich. Im Anschluss daran stelle ich in Kürze die Klassifikationen von Autismus des ICD-10 und des DSM-IV vor.
2.2.1 Triade der Beeinträchtigung
1979 beschrieb Professor Michael Rutter vom Londoner „Institut of Psychiatry“ drei Symptome auf Grundlage seiner Arbeit mit autistischen Kindern. Erstens haben seine Untersuchungen gezeigt, dass die Kinder unfähig sind, soziale Beziehungen aufzubauen, zweitens wiesen sie eine retardierte sprachliche Entwicklung auf und drittens beschrieb er das ritualistische und zwanghafte Verhalten in Verbindung mit stereotypen Bewegungen und Gesten. Weiterhin erläuterte er, dass autistische Kinder sich nicht trostsuchend an die Mutter wenden, aber sie sich dennoch fremden Menschen ebenso bereitwillig nähern, wie ihnen vertraute Menschen. Die autistischen Kinder würden die Gefühle und Interessen anderer Menschen gar nicht wahrnehmen und wären auch nicht fähig kooperativ mit anderen zu spielen (Dodd, 2005).
Im selben Jahr Lorna Wing und Judith Gould untersuchten Kinder unter 15 Jahren in Camberwell, ein Bezirk in London. Sie führten aufgrund dieser Untersuchungen den Begriff der „Triade von Beeinträchtigungen“ in die Autismusforschung ein. Sie stellten fest, dass es eine grundlegende soziale Störung bei den Kindern gibt. Die „autistische Triade“ umfasst nach Wing und Gould:
- eine Beeinträchtigung der sozialen Interaktion
- eine Beeinträchtigung der sozialen Kommunikation
- eine Beeinträchtigung der sozialen Phantasie
Die Beeinträchtigung der sozialen Interaktion umfasst Beziehungen zu anderen Personen, Dingen und Ereignisse und die Interaktion mit diesen und weiterhin Fähigkeiten wie Teilen, abwechselnd Reden und die Bearbeitung von Aufgaben. Die soziale Kommunikation ist in allen Bereichen gestört, also im verbalen, wie im non-verbalen Bereich. Die Beeinträchtigung der sozialen Phantasie meint eingeschränkte Interessen und repetitives Verhalten (Dodd, 2005; Kühn, 2008; Frith, 2003).
Mit der Triade der Beeinträchtigung, die bei jedem Autisten zu finden ist und aufgrund der Tatsache, dass diese Beeinträchtigungen in ihrer Qualität absolut individuell sind und sich im Verlauf der Krankheit in ihrer Qualität verändern können, müsse man den Begriff Autismus laut Wing und Gould neu definieren. Daher führte Lorna Wing 1988 den Begriff des „Autistischen Kontinuums“ ein, den sie 1996 in das „Autistische Spektrum“ – ASD (Autistic spectrum disorders) umwandelte (Dodd, 2005). Dieser Begriff ist
auch heute noch üblich, da die spezifischen Charakteristika von Autismus in einer großen Vielfalt und Heteroginität erscheinen.
Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion
Bereits im frühen Kindesalter sind fehlender Blickkontakt und fehlende Aufmerksamkeit bzgl. anderer Personen. Die Kinder reagieren kaum auf die Spielchen, die Erwachsene mit Kleinstkindern machen. Autistische Kinder imitieren nur sehr selten das Verhalten der Erwachsenen, was Kinder normalerweise tun. Ein Lächeln als Ausdruck der Teilhabe und Freude an der Kommunikation mit den Erwachsenen oder auch mit anderen Kleinkindern kann man selten bis niemals beobachten. Will ein Erwachsener die Aufmerksamkeit des Kindes mittels Zeigen auf einen bestimmten Gegenstand oder eine Person lenken, reagiert das autistische Kind entweder gar nicht oder scheint ungeheuer fasziniert von dem zeigenden Finger zu sein. Auch wenn diese Kinder selber in der Lage sind, auf Dinge von ihrem Interesse zu zeigen, um sie zu bekommen, bauen sie damit keinerlei soziale Beziehung zu ihrem Gegenüber auf (Bregmann, 2005). Dass autistische Kinder aufgrund ihrer sozialen Beeinträchtigung kaum einen anhaltenden Kontakt zu anderen aufbauen können, heißt nicht, dass sie es nicht wünschen. Einige Autisten bemerken bereits als Kind, dass sie „anders“ sind als die anderen Kinder. Susanne Schäfer, eine Autorin mit schwerer Mehrfachbehinderung (unter anderem Diagnose Autismus), schreibt in ihrem Buch „Sterne, Äpfel und rundes Glas – Mein Leben mit Autismus“:
„Die Mutter hatte manchmal Treffen mit anderen Müttern von Kleinkindern aus der Nachbarschaft, sogenannten `Baby-Kaffeeklatsch´. Während sie quatschten, spielte ich mit allen Babies, auch wenn meine Eltern immer quengelten, ich solle lieber mit `Meinesgleichen´ spielen. Aber der Abstand zu den Gleichaltrigen wurde immer größer und das fiel sogar mir allmählich auf.“ (Schäfer, 2009)
Sogar erwachsene Autisten mit einer nur sehr milden Ausprägung ihrer autistischen Störung und normaler sprachlicher Entwicklung, so wie Asperger-Autisten, finden es schwierig soziale Verhaltensweisen zu verstehen und adäquat anzuwenden. Daniel Tammet, ein britischer Savant mit Asperger-Syndrom erinnert sich in an seine Kindheit und seine Beziehung zu seinen zwei Jahre jüngeren Bruder, die er im Nachhinein wie folgt beschreibt:
„Ich hatte keine starken Gefühle für meinen Bruder und wir lebten nebeneinander her. Er spielte häufig im Garten, während ich in meinem Zimmer blieb, und wir spielten kaum je zusammen. Wenn wir es doch einmal taten, war es kein gemeinsames Spiel – ich hatte nie den Wunsch, meine Spielsachen oder Erlebnisse mit ihm zu teilen. Rückblickend kommen mir diese Gefühle heute ein wenig fremd und seltsam vor. Heute verstehe ich das Prinzip der Gegenseitigkeit, dass man gemeinsame Erfahrungen macht. Obwohl ich es manchmal immer noch schwierig finde, mich zu öffnen und mich mitzuteilen, sind die dazu notwendigen Gefühle eindeutig in mir vorhanden. Vielleicht waren sie das schon immer, aber ich brauchte eine gewisse Zeit, um sie zu entdecken und zu verstehen.“ (Tammet, 2008)
Beeinträchtigung der sozialen Kommunikation
Die zweite Beeinträchtigung der Triade ist die Beeinträchtigung der sozialen Kommunikation. Obwohl die sprachlichen Fähigkeiten innerhalb des autistischen Spektrums stark variieren, von absolutem Fehlen sprachlicher Entwicklung bis hin zur Anwendung hoch komplexer und elaborierter Sprache, sind signifikante Beeinträchtigungen hinsichtlich der Pragmatik und Semantik7 unter nahezu allen Menschen mit Autismus vorhanden. Kommunikation wird bei den vielen Menschen mit Autismus fast ausschließlich benutzt, um Wünsche und Wille auszudrücken und nur in seltenen Bereichen zum Ausdruck von Freude, Erfahrungen und Gefühle. Bezeichnend für autistischen Sprachgebrauch sind ebenso stereotype oder eigentümliche Äußerungen, wie Wortneubildungen (welche bei normalen Kindern auch üblich ist, mit dem Heranwachsen aber verschwindet), Vertauschen der Personalpronomina, oder Echolalie. Selbst bei unauffälliger Sprache ist oftmals eine Störung der Kommunikation vorhandeln. So fehlt oftmals die Fähigkeit, eine Konversation zu beginnen oder aufrecht zu erhalten. Subtile und indirekte Kommunikation (Metaphern, Witze, Ironie) und non-verbale Kommunikation, wie Gestik und Mimik, wird weder genutzt noch richtig gedeutet. Da sich Autisten nur schlecht in die Gedanken anderer hineinversetzen können8, kommt es oft vor, dass ein Gespräch mit einem Autisten sprunghaft und abschweifend ist. Es scheint fast so, als
7 Pragmatik und Semantik sind linguistische Disziplinen, welche sich mit dem Bedeutungsinhalt von Aussagen beschäftigen, also dem „Gemeinten“ im Kontext zum „Gesagten“.
8 Siehe „Theory of Mind“ in Kapitel 2.3.3
würden sie davon ausgehen, dass ihr Gegenüber genau weiß, was der Autist denkt, welchen Standpunkt er vertritt und welche Erfahrungen er gemacht hat, obwohl exakt diese Fähigkeiten im Autistischen Spektrum gewöhnlicher weise fehlen (Bregmann, 2005).
Eines der von Kanner untersuchten Kinder, der Junge der sich am weitesten aus dem Autismus heraus entwickelt hat, sollte mehr als zehn Jahre später eine Rede bzgl. eines anstehenden Matches des Football-Teams seines Colleges halten. Anstatt seine Mannschaft und das Publikum anzufeuern, teilte er den Zuhörern mit, dass er von einer Niederlage des Teams ausgeht. Er konnte die Buhrufe und das Missfallen des Publikums nicht verstehen. Er sagte ja schließlich die Wahrheit, wie sich später herausstellte (Long, 2007).
Eingeschränkte Interessen und stereotypes Verhalten
Zum dritten Bereich der Triade zählen alle stereotypen und ritualisierten, zwanghaften Handlungen, die Autisten teilweise ausführen. Die Handlungen sind für gewöhnlich nicht funktional in den Augen der Mitmenschen. Für Autisten hingegen haben solche Handlungen eine ganz besondere, wenn auch unbewusste, Bedeutung. Die Stereotypien und Rituale bringen Sicherheit in die unübersichtliche und teilweise feindlich erscheinende Umwelt für den Autisten. So müssen zum Beispiel Spielsachen vom autistischen Kind in eine besondere Ordnung und Reihenfolge gebracht werden, bevor das autistische Kind bereit ist ins Bett zu gehen (siehe Abb. 1). Weitere Beispiele sind, das ständige Ein- und Ausschalten des Lichts oder das wiederholte Öffnen und Schließen von Schränken und Türen. Hinzu können verschiedene repetitive Bewegungsabläufe kommen, wie z.B. Fingerschnippen, Winken, Hüpfen oder Kopfschütteln. Selbst kleine Veränderungen dieser verinnerlichten Strukturen können bei Autisten heftige emotionale Reaktionen hervorrufen. Susanne Schäfer hierzu:
„Kleine Dinge ordnen, das habe ich mein Leben lang zum Überleben gebraucht. Geordnete kleine Dinge wirken dem Chaos im Großen entgegen. Wenn ich meine kleinen Details kontrolliere, dann ist es nicht ganz so schlimm, daß ich das Gesamte nicht überblicken kann.“ (Schäfer, 2009)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 - Ein Kind mit Autismus ordnet seine Spielsachen im Bett (Frith, 2003)
Ein weiterer Aspekt dieses Bereiches der Triade der Beeinträchtigung sind die besonderen Inter essen autistischer Menschen. Oft gibt es ein ungewöhnliches Interesse an Tei l aspekten von Dingen. Erwachsene nicht autistische Menschen verlassen sich in erster Linie auf ihre visuelle und auditive Wahrnehmung, um ihre Umwelt zu erfassen. Besonders bei Aut isten mit Kanner-Syndrom kann man hingegen beobachten, wie der A u tist einzelne Aspekte von Gegenständen sensorisch exzessiv wahrnimmt. Das Fühlen
der Struktur eines Balles, das Riechen an Papier, aber auch das Ertasten von verschi
mit dem Mund
densten Gegenständen kann über lange Zeit mit erstaun licher Faszinati-
on durchgeführt werden. Häufig wird dabei der symbolische, funktionale oder emoti o nale Sinn des Gegenstandes nicht erfasst. Spielzeugautos werden nach Farben sortiert. I m gewöhnlichen Sinn wird damit jedoch nicht gespielt . Bilder können bis ins kleinste Detail analysiert werden, die Situation des gesamten Bildes wird allerdings nicht erfasst. Ab hängig von den kognitiven Fähigkeiten und der Motivation des Autisten, können aus diesen Interessen ko m plexe Themenbereiche entstehen, denen sich der Autist akribisch
für sie aufwendet. In einigen Fällen
widmet und viel Zeit können sie zu weltweit aner-
kannten Experten in dem bestimmten Themengebiet werden . Ein weiterer bemerken s-
werter Aspekt der sensorischen Wahrnehmung von Autisten ist eine sensorische Hyper-
sensibilität. n-
Selbst kleinste Reize können einen Autisten in höchste Aufregung und U behagen bringen. (Bregmann, 2005).
The aloof, the passive, the odd
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 - the aloof, the passive, the odd (Frith, 2003)
Hinsichtlich der sozialen Beeinträchtigungen bei Autisten unterschieden Wing und Gould zwischen drei qualitativ verschiedenen Typen, the aloof (unnahbar, fern), the kwürdig, eigentümlich).
passive und the odd (mer
Ein „aloof“ Kind macht den Anschein eines Kindes in einem Glaskäfig. Kinder diesen Typus reagieren kaum auf ihre soziale Umgebung. Sie kommunizieren nicht verbal und -
nur in seltenen Fällen non verbal, wenn sie z.B. etwas essen oder trinken wollen. Diese
Kinder spielen nicht mit anderen Kindern, können sich aber stundenlang auf
Gegenstände ihres Interesses konzentrieren, wie zum Beispiel ein Computerspiel oder
er sie
Murmeln. Zwar können diese Kinder in die Augen ihres Gegenüber starren, ab stellen damit keinen Blickkontakt her, sondern sehen in den Augen eher ein faszinierendes Objekt, das es zu untersuchen gilt.
Kinder des Typus „the passive“ tun was ihnen gesagt wird. Scheinbar gleichgültig
akzeptieren sie die sozialen Annäherungen anderer. Sie leben in Routinen zu denen
auch ihre sozialen Kontakte zählen. Emotionale Freundschaften im üblichen Sinn wird
Diese
man bei ihnen kaum finden. Kinder nutzen Sprache zur Kommunikation, es fehlt
ihnen dabei allerdings das Verständnis für die sozialen Besonderheiten menschlicher
Kommunikation, wie Ironie, Witz oder Metaphern. Für gewöhnlich verstehen sie nur die Sachebene der Kommunikation.9 Ihre Passivität und Gleichgültigkeit verlieren diese Kinder allerdings sehr schnell, wenn die ihnen bekannten Routinen verändert werden. Die emotionale Reaktion darauf sind Weinanfälle, Wutausbrüche oder sonstiges aggressives Verhalten.
„The odd“ beschreibt den Typus der sozialen Beeinträchtigung, welcher sich darin äußert, dass diese Kinder keinerlei Scheu vor anderen Menschen haben. Sie sind gerne mit anderen Menschen zusammen, berühren sie und schmiegen sich sogar an Fremde an. Sie sind nicht in der Lage zu entscheiden, ob ihr verhalten unangebracht oder ungewollt ist und können nicht nachvollziehen, dass ihr distanzloses Verhalten bei den Mitmenschen auf Unverständnis stoßen kann.
Weiterhin stellten Wing und Gloud fest, dass viele der untersuchten Kinder von einem Typus in einen anderen gewechselt sind. Es gibt einen starken Trend, dass die „aloof“ Kinder zum „passive“ oder „odd“ Typus wechseln, es sei denn, sie weisen eine schwere Lernbehinderung auf. Laut Uta Frith zeigt diese Erkenntnis, dass alle drei Typen sozialer Beeinträchtigung aus der gleichen grundlegenden Unfähigkeit heraus entstehen, der Unfähigkeit soziale Beziehungen aufzubauen (Frith, 2003).
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842811171
- DOI
- 10.3239/9783842811171
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover – Erwachsenenbildung und Berufspädagogik, Berufspädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2011 (Februar)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- autismus arbeit rehabilitation wfbm
- Produktsicherheit
- Diplom.de