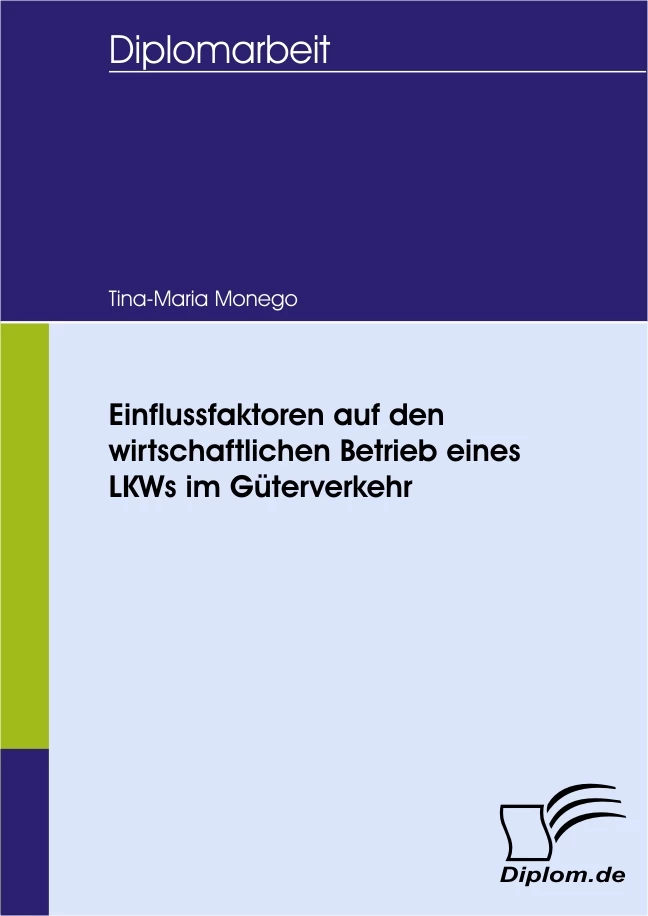Einflussfaktoren auf den wirtschaftlichen Betrieb eines LKWs im Güterverkehr
Zusammenfassung
Problemdefinition und Zielsetzung:
Transportbranche kämpft gegen Absturz, Großinsolvenzen in der Transportbranche und Güterbeförderung bricht um 20% ein: Solche und ähnliche Schlagzeilen kennzeichneten das Jahr 2009. Das Transportgewerbe kämpft gegen den Konjunkturabschwung und befindet sich mitten in der Krise, mit einem noch nicht absehbaren Ende. Das Transportvolumen auf österreichischen Straßen ist so niedrig wie vor zehn Jahren. Eine Untersuchung des Verkehrsclub Österreich hat ergeben, dass auf der Westautobahn bei Haid die Anzahl der passierenden LKWs je Werktag in Höhe von 15.400 innerhalb des letzen Jahres um 11% gesunken ist. Der Knoten Haid ist das in Österreich am stärksten befahrene Autobahnteilstück in Bezug auf Schwerfahrzeuge über 7,5t.
Im Jahr 2008 waren in Österreich 4.288 Betriebe im fuhrgewerblichen Straßenverkehr tätig und beschäftigten insgesamt 72.970 Arbeitnehmer. Aufgrund der Wirtschaftskrise gab es in diesem Jahr in Summe 415 Gesamtinsolvenzen in dieser Branche.
Mit den Auftragseinbrüchen und der EU-Osterweiterung hat in den letzten Jahren eine Preisschlacht im Transportgewerbe begonnen. Die Unternehmen durchforsten ihre Kostenpositionen und versuchen diese wenn möglich zu senken.
An diesem Punkt setzt diese Arbeit an. Mittels persönlicher Interviews mit Mitarbeitern und Unternehmern im Transportgewerbe und mit Hilfe von Literaturrecherche und Studien werden die Einflussfaktoren, die auf den wirtschaftlichen Betrieb eines LKWs im Güterverkehr einwirken, aufgezeigt.
Jede Kostenposition, die den Betrieb eines LKWs betrifft, wird untersucht und die von den befragten Unternehmen gesetzten Einsparungsmaßnahmen erläutert.
Ziel der Arbeit ist das Aufzeigen und Erläutern der Faktoren, die den wirtschaftlichen Betrieb eines LKWs im Güterverkehr beeinflussen sowie die in der Praxis eingesetzten Maßnahmen um die Kosten je Fahrzeug zu senken.
Aufbau der Arbeit:
Nach der Problemdefinition und Zielsetzung in diesem Kapitel folgt im zweiten Kapitel eine Abgrenzung einiger in dieser Arbeit verwendeten Begriffe sowie Entwicklungen und Trends im Güterverkehr.
Das Kapitel 3 enthält den spezifischen Teil dieser Arbeit. Zu Beginn wird die Kostenstruktur eines LKWs im Überblick skizziert. Dies ist unterteilt in einen theoretischen Teil der Kostenrechnung im Allgemeinen und einen praktischen Teil. Der Abschnitt Kostenstruktur in der Praxis enthält Kalkulationen zur Kostenstruktur eines LKWs mit […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Problemdefinition und Zielsetzung
1.2. Aufbau der Arbeit
1.3. Danksagung
2. Entwicklungen und Trends im Güterverkehr
2.1. Güterverkehr
2.2. Formen des Güterverkehrs
2.3. Straßengüterverkehr
2.4. Wirtschaftlichkeit
2.5. Kostenrechnung
3. Kostenstruktur und Einflussfaktoren
3.1. Kostenstruktur im Überblick
3.1.1. Modell einer Erfolgsrechnung eines Transportunternehmens
3.1.2. Kostenstruktur in der Praxis
3.2. Fahrerkosten
3.3. Aus- & Weiterbildungskosten
3.3.1. Rationellen Fahrverhalten auf der Grundlage der Sicherheitsregeln
3.3.2. Optimierung des Treibstoffverbrauchs
3.3.3. LKW-Ladungssicherung
3.3.4. Anwendung der Vorschriften
3.3.5. Gesundheit, Verkehrs- und Umweltsicherheit
3.4. Treibstoffkosten
3.4.1. Kosten beim Treibstoffkauf
3.4.2. Treibstoffverbrauch
3.5. Servicekosten
3.5.1. Reparatur- und Wartungskosten
3.5.2. Reifenkosten
3.6. Beschaffung und Finanzierung
3.6.1. Idealer Wiederbeschaffungszeitpunkt
3.6.2. Beschaffung
3.6.3. Finanzierung
3.6.4. AfA und planmäßige Abschreibung
3.6.5. Ausflaggung und Kfz-Steuer
3.7. Versicherung
3.7.1. Versicherungsarten
3.7.2. Pilotstudie: Fahrsicherheitstraining
3.7.3. Gewinnbeteiligung
3.8. Maut
3.9. Compliance
3.9.1. Kosteneinsparung bei Personalkosten
3.9.2. Bußgeldkatalog
3.9.3. Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten
3.9.4. Umgehung des Wochenend-Fahrverbots
3.9.5. Kosteneinsparung zu Lasten der Sicherheit
4. Modelle zum wirtschaftlichen Einsatz von LKWs
4.1. 1-Schicht-Modell
4.2. 2-Schicht-Modell
4.3. Sattel-Swapping
4.4. Zwei-Fahrer-Modell
4.5. Kooperationen und Frachtbörsen
4.6. Advanced-Truckload-Netzwerke (ATLF)
4.7. E.L.V.I.S. Full Load Network
4.8. Die Rollende Landstraße (RoLa)
5. Resümee
5.1. Zusammenfassung
5.2. Ausblick
6. Anhang
7. Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Entwicklung Güterverkehr
Abbildung 2: Transportkette
Abbildung 3: Aufbau von Transportketten
Abbildung 4: Häufigste LKW-Typen
Abbildung 5: Aufliegerarten
Abbildung 6: WAB Abbildung 7: Container
Abbildung 8: EuroCombi und Straßenlänge
Abbildung 9: Grafik - Kostenstruktur
Abbildung 10: Ishikawa-Diagramm – Einflussfaktoren auf die Kostenstruktur
Abbildung 11: Fahrtechniktraining
Abbildung 12: Vorfallspyramide
Abbildung 13: Betriebstankstelle
Abbildung 14: Tankkarten
Abbildung 15: Optionsdarstellung
Abbildung 16: Veränderte Aerodynamik bei LKWs
Abbildung 17: Dachspoiler
Abbildung 18: ECO-Spin Treibstoffoptimierer
Abbildung 19: Reifen an der Lenkachse, Antriebsachse, Anhänger
Abbildung 20: Reifenluftdruck Abbildung 21: Nachschneiden
Abbildung 22: Angebot-Leasingvertrag
Abbildung 23: Angebot Kreditfinanzierung
Abbildung 24: Arbeitskostenvergleich
Abbildung 25: Kfz-Steuer in Europa
Abbildung 26: Mautportal
Abbildung 27: Tacho-Schaublatt
Abbildung 28: Systemkomponenten Digitaler Tacho
Abbildung 29: Beispiel einer schlechten Ladungssichtung und möglicher Folgen
Abbildung 30: Merkmale von Advanced Truckload Unternehmen
Abbildung 31: RoLa Verbindungen
Abbildung 32: Anzahl der beförderten LKWs
Abbildung 34: Strategische Optionen
Berechnungsverzeichnis
Berechnung 1: Variablen der Kostenkalkulation
Berechnung 2: Fahrzeugkosten
Berechnung 3: Lohnkalkulation
Berechnung 4: Gesamtkostenkalkulation
Berechnung 5: Kostenstruktur
Berechnung 6: Idealer Wiederbeschaffungszeitpunkt
Berechnung 7: Lineare Abschreibung
Berechnung 8: Degressive Abschreibung
Berechnung 9: Leistungsabschreibung
Berechnung 10: Mautkosten allgemein
Berechnung 11: Mautvergleich 3 Achsen zu 4 Achsen
Berechnung 12: Mautvergleich EURO III zu EURO V
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Deckungsbeitragsrechnung
Tabelle 2: EU-Lenkerarbeitszeit-Richtlinien
Tabelle 3: Schadenkostendeckung
Tabelle 4: Auswertung eines ECO-Trainings
Tabelle 5: Spritersparnis durch ECO-Training
Tabelle 6: Daten aus einem Leistungsdiagramm
Tabelle 7: Kreditfinanzierung
Tabelle 8: Leasingfinanzierung
Tabelle 9: Vergleich Fahrerkosten
Tabelle 10: Gewinnbeteiligung
Tabelle 11: Mauttarife
Tabelle 12: Sondermauttarife
Tabelle 13: Auszug Kummer-Tabelle
Tabelle 14: Gegenüberstellung Entlohnsysteme
Tabelle 15: Kosten und deren Einflussfaktoren im Überblick
1. Einleitung
1.1. Problemdefinition und Zielsetzung
"Transportbranche kämpft gegen Absturz"[1], "Großinsolvenzen in der Transportbranche"[2] und "Güterbeförderung bricht um 20% ein"[3]: Solche und ähnliche Schlagzeilen kennzeichneten das Jahr 2009. Das Transportgewerbe kämpft gegen den Konjunkturabschwung und befindet sich mitten in der Krise, mit einem noch nicht absehbaren Ende. Das Transportvolumen auf österreichischen Straßen ist so niedrig wie vor zehn Jahren. Eine Untersuchung des "Verkehrsclub Österreich" hat ergeben, dass auf der Westautobahn bei Haid die Anzahl der passierenden LKWs je Werktag in Höhe von 15.400 innerhalb des letzen Jahres um 11% gesunken ist.[4] Der Knoten Haid ist das in Österreich am stärksten befahrene Autobahnteilstück in Bezug auf Schwerfahrzeuge über 7,5t.[5]
Im Jahr 2008 waren in Österreich 4.288 Betriebe im fuhrgewerblichen Straßenverkehr tätig und beschäftigten insgesamt 72.970 Arbeitnehmer. Aufgrund der Wirtschaftskrise gab es in diesem Jahr in Summe 415 Gesamtinsolvenzen in dieser Branche.[6]
Mit den Auftragseinbrüchen und der EU-Osterweiterung hat in den letzten Jahren eine Preisschlacht im Transportgewerbe begonnen. Die Unternehmen durchforsten ihre Kostenpositionen und versuchen diese wenn möglich zu senken.
An diesem Punkt setzt diese Arbeit an. Mittels persönlicher Interviews mit Mitarbeitern und Unternehmern im Transportgewerbe und mit Hilfe von Literaturrecherche und Studien werden die Einflussfaktoren, die auf den wirtschaftlichen Betrieb eines LKWs im Güterverkehr einwirken, aufgezeigt.
Jede Kostenposition, die den Betrieb eines LKWs betrifft, wird untersucht und die von den befragten Unternehmen gesetzten Einsparungsmaßnahmen erläutert.
Ziel der Arbeit ist das Aufzeigen und Erläutern der Faktoren, die den wirtschaftlichen Betrieb eines LKWs im Güterverkehr beeinflussen sowie die in der Praxis eingesetzten Maßnahmen um die Kosten je Fahrzeug zu senken.
1.2. Aufbau der Arbeit
Nach der Problemdefinition und Zielsetzung in diesem Kapitel folgt im zweiten Kapitel eine Abgrenzung einiger in dieser Arbeit verwendeten Begriffe sowie Entwicklungen und Trends im Güterverkehr.
Das Kapitel 3 enthält den spezifischen Teil dieser Arbeit. Zu Beginn wird die Kostenstruktur eines LKWs im Überblick skizziert. Dies ist unterteilt in einen theoretischen Teil der Kostenrechnung im Allgemeinen und einen praktischen Teil. Der Abschnitt "Kostenstruktur in der Praxis" enthält Kalkulationen zur Kostenstruktur eines LKWs mit Durchschnittsdaten aus diversen geführten Interviews mit Frächtern für diese Arbeit. Auf die einzelnen Kostenarten dieser Kalkulationen wird im Verlauf der ganzen Arbeit fortwährend Bezug genommen.
Im folgenden Teil dieses Kapitels wird im Einzelnen auf die diversen anfallenden Kosten eingegangen und die Faktoren, welche diese Kosten beeinflussen erläutert und die in der Praxis gesetzten Maßnahmen zur Kostenreduktion aufgezeigt.
Das Kapitel 4 gibt zeigt unterschiedliche Einsatzmodelle von LKWs im Güterverkehr und neue zukünftige Konzepte.
Die gesamte Arbeit gibt einen Einblick in die in der Praxis umgesetzten Maßnahmen und dokumentiert deren Auswirkungen. Aufgrund des Umfanges dieser Thematik werden einige Faktoren nur sehr kurz bearbeitet.
Das abschließende Resümee spiegelt eine Zusammenfassung wieder und gibt einen möglichen Ausblick in die Zukunft.
Um diese Arbeit umsetzten zu können, wurde mit sieben, für diese Arbeit repräsentativen, oberösterreichischen Transportunternehmen, deren Angestellten und Fahrern gesprochen, sowie Interviews mit Mitarbeitern von der Arbeiterkammer, ÖAMTC, Versicherung, Bankinstituten, LKW-Herstellerfirmen, Reifenherstellern, Herstellern von Tankanlagen und der Polizei geführt. Da viele Informationen und Daten sehr vertraulich sind und unter Umständen negative Auswirkungen auf die Befragten haben könnten, werden diese Teile der Arbeit anonymisiert wiedergegeben.
1.3. Danksagung
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Personen bedanken, die mich bei der Erarbeitung dieser Diplomarbeit unterstützt haben.
Ein besonderer Dank gilt den für diese Arbeit befragten Personen aus Transportunternehmen, Arbeiterkammer, LKW-Herstellerfirmen, Reifenherstellern, Hersteller für Tankanlagen, der Polizei, Bankinstituten, Versicherungen und dem ÖAMTC, welche mir zahlreiche Hintergrundinformationen, Daten und Fakten vertraulich übertragen haben.
Ein weiterer Dank gilt Herrn Univ. Prof. Dr. Günther Zäpfel dem Institutsvorstand und dem Initiator dieser Arbeit, Herrn Mag. Dr. Bartosz Piekarz, der mich bei der Ausführung und Umsetzung dieser Arbeit unterstützt hat.
Abschließend möchte ich mich noch bei meiner Familie und meinen Freunden herzlich bedanken, die mich im Verlaufe des gesamten Studiums tatkräftig Unterstützt haben.
2. Entwicklungen und Trends im Güterverkehr
Dieses Kapitel gibt einen Einblick in den derzeitigen Güterverkehr sowie dessen Entwicklung und Trends. Speziell im Punkt Straßengüterverkehr werden für diese Arbeit notwendige Definitionen erläutert und ein kurzer Überblick zum Thema dargelegt. Zum Abschluss werden die Be-griffe Wirtschaftlichkeit und Kostenrechnung kurz behandelt.
2.1. Güterverkehr
Der Güterverkehr ist ein wesentlicher Bestandteil der Logistik und bezeichnet die Beförderung von Gütern aller Art.
Um Logistik zu definieren, wird oft die Seven-Rights-Definition von Plowman (1964) herangezogen:
"Logistik heißt, die Verfügbarkeit des richtigen Gutes, in der richtigen Menge, im richtigen Zustand, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, für den richtigen Kunden, zu den richtigen Kosten zu sichern."
Der Güterverkehr (auch: Transport) hat in der Logistik immer etwas mit Ortsveränderung zu tun. Die Transportlogistik beschäftigt sich mit der Verteilung von Gütern zwischen verschiedenen Orten innerhalb eines Logistiknetzwerkes.[7]
Das komplette Transportsystem beinhaltet die Elemente Transportgut, Transportmittel und den Transportprozess. Das Ergebnis der Leistungserstellung ist die Ortsveränderung der Güter infolge des Transportes. Die Transportleistung wird in Tonnenkilometer (tkm) gemessen. An den Gütern erfolgt während des Transportes keine Manipulation. Als Leertransport wird ein Transportprozess bezeichnet, der ohne Güter durchgeführt wird.[8]
Die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen ist im Güterbeförderungsgesetzt geregelt und unterscheidet zwischen:[9]
- gewerbsmäßiger Güterbeförderung im innerstaatlichen Verkehr
- gewerbsmäßiger Güterbeförderung im grenzüberschreitenden Verkehr
- Werkverkehr
Die Entwicklung des Güterverkehrs ist sehr stark an die Entwicklung der Wirtschaft und deren Prozesse in der Wertschöpfungskette gebunden. Unter anderem aufgrund der Reduzierung der Fertigungstiefe, also der Auslagerung von Arbeitsschritten an Zulieferern in der Industrie, ist die Transportleistung in den letzten zehn Jahren um ca. 31% gestiegen.
Ein weiterer Grund für die Veränderungen im Güterverkehr war der Umstieg auf moderne Logistikkonzepte wie die produktionssynchrone Beschaffung Just-in-time (JIT) sowie eine reduzierte Lagerhaltung. Diese neuen Konzepte erfordern eine hohe Qualität der Transportleistung, eine hohe Termintreue, schnelle Transporte mit geringem Volumen sowie eine hohe Transportfrequenz. Die unten angeführte Grafik zeigt die Auswirkungen im Güterverkehr seit 1950 die als Logistikeffekt bezeichnet werden.[10]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Entwicklung Güterverkehr[11]
Die Grafik zeigt die prozentuelle Aufteilung der erbrachten Transportleistung der unterschiedlichen Verkehrsträger in den letzten Jahrzehnten. Die Transportleistung wird in Tonnenkilometern gemessen und ergibt sich aus der Multiplikation aus der zurückgelegten Strecke mit dem transportierten Gewicht. Aus der Grafik lässt sich entnehmen, dass der Schienenverkehr Ende der 60iger Jahre die Monopolstellung verloren hat und zurzeit der Straßengüterverkehr mit einem Anteil von 70 Prozent stark dominiert. Auf die Eisenbahn entfallen 16% und auf die Pipeline 12% Anteil am Güterverkehrsaufkommen, wobei aufgrund von Umweltaspekten die Schienengüterverkehrleistung leicht steigend ist.
Durch die EU-Osterweiterung und der Öffnung nationaler Märkte wurde das Absatz- und Beschaffungsgebiet erweitert und viele Unternehmen haben ihre Produktionsstätten in den Osten verlagert und dadurch das Transportaufkommen gesteigert.
2.2. Formen des Güterverkehrs
Der Güterverkehr erfolgt durch die verschiedenen Verkehrsträger Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt, Luftverkehr und Rohrleitungsverkehr. Entscheidend für die Auswahl des Transportmittels folgende Punkte:[12]
- Maße der Ladung: Wird der Transport als Ladungs- oder Stückgutverkehr abgewickelt? Größe, Gewicht, Volumen
- Terminvorgaben: Wie schnell muss die Ladung beim Empfänger sein? Transportgeschwindigkeit des Verkehrsmittels
- Zuverlässigkeit: Wie pünktlich kann der Transportvorgang ausgeübt werden?
- Transportentfernung: Kann der Transport am Landweg durchgeführt werden?
- Sicherheit: Wie groß ist die Unfallhäufigkeit von Transporten und die Schadenshöhe?
- Kosten: Wie teuer ist der Transport mit dem jeweiligen Transportmittel?
Der Warentransport vom ersten Abgangsort (Quelle) bis zum letzten Empfangsort (Senke) wir als Transportkette bezeichnet. Je nach dem ob die Transportkette eingliedrig (ohne Wechsel des Transportmittels oder mehrgliedrig (mit Wechsel des Verkehrsmittels) erfolgt, lässt sich die Transportstrecke in Vorlauf, Hauptlauf und Nachlauf unterteilen. Hauptsächlich wird diese Unterteilung beim Transport von Stückgut angewendet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Transportkette[13]
Der Transport vom Absender (A) zu einem Speditionsumschlagspunkt (SUP) wird als Vorlauf bezeichnet. Am Speditionsumschlagspunkt werden die unterschiedlichen Sendungen gebündelt und zu einem weiteren SUP in der Nähe der Empfänger (E) transportiert. Dies wird als Hauptlauf bezeichnet. Im Nachlauf erfolgt die Feinverteilung der Sendungen an die Empfänger.[14]
Die nächste Abbildung zeigt weitere Anwendungen in der Transportkette:[15]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Aufbau von Transportketten[16]
Auf längeren Transportstrecken rentiert sich unter gewissen Voraussetzungen, ab ca. 600 km, das System des Kombinierten Verkehrs. Dabei findet der Vorlauf und der Nachlauf auf der Straße mittels LKW statt und der Hauptlauf per Schiff oder Eisenbahn. Beim Kombinierten Verkehr werden komplette Ladungseinheiten mit unterschiedlichen Verkehrsträgern befördert ohne das Transportgefäß des Ladegutes zu wechseln.
- Huckepackverkehr: Lastzüge, Sattelkraftfahrzeuge und Sattelanhänger werden auf spezielle Eisenbahnwägen verladen und auf der Schiene transportiert (Rollende Landstraße). Ab dem Zielbahnhof setzt der LKW den Transport zum Endkunden wieder auf der Straße fort. Beim begleiteten Kombinierten Verkehr fahren die LKW-Fahrer in einem angehängten Waggon mit.[17]
- Roll-on/Roll-off-Verkehr (RORO): Wie beim Huckepackverkehr mit der Bahn fahren die LKWs über eine Laderampe auf ein Schiff und werden auf dem Seeweg zum Zielhafen transportiert. Der Nachlauf erfolgt wieder auf der Straße.
- Trajektverkehr: Dabei werden Güterwagen der Bahn auf ein Fährschiff verladen, welche extra mit Schienen ausgestattet sind und mit dem Schiff zum nächsten Hafen befördert.
- Behälter-/Containerverkehr: Speziell genormte Behälter, Wechselträger und Container werden mit unterschiedlichen Verkehrsträgern umgeschlagen.
2.3. Straßengüterverkehr
Der Straßengüterverkehr gilt als wichtigste Transportart im Güterverkehr. Gemäß einer Verkehrsprognose des deutschen Bundesverkehrswegeplans wird sich die Verkehrsleistung im Straßengüterverkehr im Zeitraum von 1997 bis 2015 um 64 Prozent steigern und somit auch in Zukunft die Hauptlast im Güterverkehr tragen.
Der Straßengüterverkehr wird hauptsächlich mit einem LKW durchgeführt und lässt sich idealtypisch in drei Typen unterscheiden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Häufigste LKW-Typen[18]
Die Abmessungen eines LKWs sind im österreichischen Kraftfahrrecht § 4 geregelt. LKWs dürfen maximal 4 m hoch sein und 2,55 m breit, außer Kühlfahrzeug mit einer maximalen Breite von 2,6 m. Die Länge eines Sattelkraftfahrzeugs darf 16,5 m nicht überschreiten und die eines Kraftwagen mit Anhänger 18,75 m. Das höchstzulässige Gesamtgewicht eines Sattelkraftfahrzeug ist mit 40 t begrenzt und ein LKW im Vorlauf- und Nachlaufverkehr mit einem Container oder einem Wechselaufbau (WAB) mit 44t.[19]
Folgende Aufliegerarten sind bei Sattelkraftfahrzeugen häufig zu finden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Aufliegerarten[20]
Abgesehen von der Transportkapazität sind die Investitions- und Betriebskosten, Beladungsmöglichkeiten und die Flexibilität Entscheidungsfaktoren. So bietet ein Hängerzug einerseits den Vorteil eines größeren Transportvolumens (bis zu 5 Paletten mehr), als auch die Möglichkeit bei einer innerstädtischen Belieferung den Hänger an einer geeigneten Stelle abzustellen. Andererseits ist die Beladzeit länger als bei einem Sattelzug und somit die Einsatzkosten höher.
Die Auflieger können mit Planen oder einem Kofferaufbau ausgestattet werden. Der Vorteil eines Koffers liegt in der höheren Transportsicherheit bei der Beförderung bzw. gegen Diebstahl. Für einen Kühlauflieger ist ein Kofferaufbau technisch notwendig. Ein Planenauflieger hingegen bietet eine vereinfachte Beladung, da nicht nur hinten, sondern auch seitlich und von oben ein Zugang möglich ist.
LKWs können neben den festen Aufbauten auch mit austauschbaren Ladehilfsmitteln wie Containern oder Wechselaufbauten (WAB) eingesetzt werden. Wechselaufbauten sind wie Container austauschbare Behälter, die aufgrund der speziellen Norm (DIN EN 284) auf LKWs, aber auch auf Eisenbahnwägen befördert werden können. Ein WAB verfügt im Gegensatz zu einem Container (ISO 668 – Maße in Fuß gemessen) vier ausklappbare Stützen, um vom LKW unterfahren werden können, und somit ohne jegliche Hilfe von außen aufgenommen werden können. Somit kann ein WAB entkoppelt vom Fahrer per Bahn transportiert werden und optimiert somit Umschlagprozesse. Aufgrund der Stützen ist ein WAB nicht stapelbar wie ein Container und kann somit nicht im internationalen Schiffverkehr eingesetzt werden.[21]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenAbbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: WAB[22] Abbildung 7: Container[23]
Der Straßengüterverkehr unterscheidet sich in gewerblicher Güterverkehr und Werkverkehr. Als gewerblicher Güterverkehr wird die geschäftsmäßige oder entgeltliche Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen bezeichnet.[24]
Gemäß österreichischem Güterbeförderungsgesetz § 10 liegt Werkverkehr vor wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:[25]
- Die beförderten Güter müssen Eigentum des Unternehmens oder von ihm verkauft, gekauft, vermietet, gemietet, erzeugt, gewonnen, bearbeitet oder ausgebessert werden oder worden sein.
- Die Beförderung muss der Heranschaffung der Güter zum Unternehmen, ihrer Fortschaffung vom Unternehmen, ihrer Überführung innerhalb oder - zum Eigengebrauch - außerhalb des Unternehmens dienen.
- Die für die Beförderung verwendeten Kraftfahrzeuge müssen vom eigenen Personal des Unternehmens geführt werden.
- Die die Güter befördernden Kraftfahrzeuge müssen dem Unternehmen gehören, von ihm auf Abzahlung gekauft worden sein oder gemietet sein. Dies gilt nicht bei Einsatz eines Ersatzfahrzeuges für die Dauer eines kurzfristigen Ausfalls des sonst verwendeten Kraftfahrzeugs.
- Die Beförderung darf nur eine Hilfstätigkeit im Rahmen der gesamten Tätigkeit des Unternehmens darstellen.
Der Straßengüterverkehr steht in den letzten Jahren unter zunehmender Kritik und ist mit einigen Problemstellungen behaftet. Kritisiert werden unter anderem die Umweltbelastung durch Energieverbrauch, Schadstoffausstoß, Lärmentwicklung, Verkehrsüberlastung und die Beschädigung der Straßenbeläge. Die Probleme mit der der Straßengüterverkehr zu kämpfen hat sind die eingeführten Mautkosten in den meisten europäischen Ländern, die Wettbewerbsverzerrung seit der EU-Ost-Erweiterung, die steigenden Treibstoffpreise und die hohe Mineralölsteuer, die neu eingeführten Lenk- und Ruhezeiten und Arbeitszeitregelungen von Fahrern, die Einführung des Digitalen-Tachos sowie der akute Fahrermangel und die neuen Umweltschutz und CO2 Richtlinien.[26]
Für die Zukunft der Transportlogistik gibt es unterschiedlichste innovative Konzepte und Lösungsvorschläge. Eine Variante um den steigenden Straßengüterverkehr in Zukunft bewältigen zu können bietet der Einsatz von EuroCombis (Gigaliner). Der EuroCombi wird bereits seit vielen Jahren in Skandinavien eingesetzt und in anderen europäischen Ländern getestet. Im Gegensatz zu einem normalen LKW-Zug hat ein EuroCombi eine Länge von 25,25 m und ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von 60t. Durch das höhere Ladevolumen können mehr Güter mit gleichzeitig weniger Verkehrsaufkommen und daher mit weniger Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen transportiert werden und 25% an Verkehrsraum eingespart werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: EuroCombi und Straßenlänge[27]
In Österreich und anderen europäischen Ländern wird die Einführung der Gigaliner jedoch stark kritisiert. So soll durch die Übergrößen der LKWs die Verkehrssicherheit enorm gefährdet sein, mehr Staus durch längere Überholzeiten entstehen und erhebliche Investitionen in Autobahnen, Brücken, Tunnels und Parkplätze nötig werden.
Michael Kubenz, Präsident des Deutschen Speditions- und Logistikverbandes, setzt in der Zukunft weiterhin auf alternative Treibstoffe, so genannte Biotreibstoffe der zweiten Generation und hofft auf eine bleibende Befreitheit der Mineralölsteuer und weitere steuerliche Förderungen.[28]
Ein derzeitiges Forschungsprojekt ist die Umsetzung des amerikanischen "Advanced-Truckload-Geschäftsmodells" in Europa. In den USA haben sich die führenden Transportunternehmen zusammengeschlossen und konnten durch effizientes Flottenmanagement, moderne Kommunikations- und Dispositionssysteme, durchkonstruierte Netzstrukturen, neue Fahrereinsatzstrategien und weiteren Zusatzleistungen ihren Gewinn enorm steigern.[29] Schwierigkeiten bei der Umsetzung in Europa ergeben sich bislang dadurch, dass im Gegensatz zu amerikanischen Firmen, die teilweise mehr als 8.000 LKWs pro Unternehmen einsetzen, die europäische Unternehmerstruktur großteils maximal 10 LKWs besitzen. Deshalb ist es nur sehr schwer möglich, die amerikanische Industrialisierung mit standardisierter Leistungserstellung in Europa umzusetzen.[30]
Ein bereits umgesetztes Kooperationsmodell ist E.L.V.I.S. (Europäischer Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure Aktiengesellschaft). Dabei haben sich bis jetzt ca. 80 mittelständische Unternehmen im Ladungsverkehr zusammengeschlossen und die Flotte von ca. 8.500 LKWs wird zentral gesteuert. Durch den Zusammenschluss können die Kapazitäten gesteigert werden und die Leerkilometer werden reduziert. Diese Kooperationsmodell wird im Kapitel 4.7. näher behandelt.
2.4. Wirtschaftlichkeit
Der Straßengüterverkehr befindet sich zurzeit unter anderem aufgrund der Finanzkrise, der EU-Ost-Erweiterung, der steigenden Treibstoffpreise und der veränderten Wettbewerbsstruktur in einem Dilemma. Gerade in diesen Zeiten steht das wirtschaftliche Handeln eines Unternehmens im Vordergrund. In der Fachliteratur wird der Begriff "Wirtschaftlichkeit" recht unterschiedlich definiert. Deshalb werden hier zwei gängige Definitionen erläutert.
Wirtschaftlichkeit bedeutet gemäß Lechner/Egger/Schauer, mit vorhandenen Mitteln einen möglichst großen Bedarfsdeckungseffekt (Maximumprinzip) zu erlangen oder dies mit einem möglichst geringen Mitteleinsatz (Minimumprinzip) zu erreichen. In diesem Wirtschaftlichkeitsbegriff steckt nur die Art der Sparsamkeit, mit der das Unternehmen seine Leistungen erstellt und nicht die möglichen Einnahmen die das Unternehmen erzielen kann.[31]
Zäpfel definiert die Wirtschaftlichkeit als Verhältnis von wertmäßiger Leistung zu Kosten.[32]
Wirtschaftlichkeit = Leistung / Kosten
Im Sinne der vorliegenden Diplomarbeit, bei der die Einflussfaktoren auf den wirtschaftlichen Betrieb eines LKWs im Güterverkehr betrachtet werden, kann Wirtschaftlichkeit als Verhältnis von gefahrenen Kilometern zu den Kosten definiert werden.
Wirtschaftlichkeit = Kilometerleistung des LKWs (km) / Kosten (€)
Bezug nehmend auf die oben angeführte Formel, wird in dieser Arbeit erläutert, welche Möglichkeiten bestehen, um die gefahrenen Kilometer zu erhöhen (damit sind die Last-Kilometer gemeint und nicht die Leerkilometer) und gleichzeitig die entstehenden Kosten zu senken.
2.5. Kostenrechnung
Kosten werden vereinfacht als Werteinsatz zu Leistungserstellung bezeichnet.
Die Kostenrechnung hat unter anderem folgende Aufgaben:[33]
- Sie dient der Preisbildung und der Preiskontrolle.
Bilden bzw. verändern sich die Preise am Markt kann kontrolliert werden, wie sich die Kosten im Unternehmen gegenüber den Preisen am Markt verhalten.
- kalkulatorische Ergebnisermittlung
- Kontrolle der innerbetrieblichen Wirtschaftlichkeit
In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird die Kostenrechnung in drei Stufen unterteilt:
Kostenartenrechnung: Welche Kosten sind in welcher Höhe angefallen?
Kostenstellenrechnung: Wo sind die Kosten angefallen?
Kostenträgerrechnung: Wofür sind die Kosten angefallen?[34]
Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben der Kostenrechnung werden in der Praxis unterschiedliche Systeme zur Berechnung angewendet. Eine Unterscheidung bilden die Voll- und Teilkostenrechnung in Art und Umfang der Kalkulation.
Die Vollkostenrechnung differenziert zunächst die Kostenarten in Einzel- und Gemeinkosten und überträgt mit Hilfe der Kostenstellenrechung die Verrechnungssätze der Gemeinkosten auf die Kostenträger.
Die Teilkostenrechnung, die wiederum in unterschiedliche Systeme eingeteilt werden kann, berücksichtigt im Gegensatz zur Vollkostenrechnung in der Regel nur die Einzelkosten und die variablen Kosten und unterlässt die Fix- sowie Gemeinkosten.[35]
3. Kostenstruktur und Einflussfaktoren
Dieses Kapitel enthält den spezifischen Teil dieser Arbeit. Es gibt einen Einblick auf die diversen anfallenden Kosten und die Faktoren, welche diese Kosten beeinflussen und zeigt die in der Praxis gesetzten Maßnahmen zur Kostenreduktion.
3.1. Kostenstruktur im Überblick
In diesem Abschnitt wird die Kostenstruktur eines Transportunternehmens untersucht und die aus den Interviews gewonnenen Kostendaten berechnet und die Kostenstruktur sowie deren Einflussfaktoren im Überblick analysiert.
3.1.1. Modell einer Erfolgsrechnung eines Transportunternehmens
In der praxisbezogenen Fachliteratur für die Transportwirtschaft wird eine einfache Teilkostenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung empfohlen. Da das Schlüsselungsproblem von Gemeinkosten in der reinen Vollkostenrechnung Schwächen aufweist, wird meist eine modifizierte Vollkostenrechnung mit hierarchisch verschobenen Gemeinkosten durchgeführt.[36]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Deckungsbeitragsrechnung[37]
Die oben angeführte Tabelle zeigt einen Vorschlag für eine Deckungsbeitragsrechnung im gewerblichen Straßengüterverkehr aus der Literatur.
Diese Vorlage für die Deckungsbeitragsrechnung beginnt mit den Erlösen pro Sendung bzw. Tour. Da die Erlöse für diese Diplomarbeit nicht von relevanter Bedeutung sind, wird auf diesen Punkt nicht näher eingegangen. Statt beschäftigungsabhängigen und beschäftigungsunabhängigen, also variablen und fixen Kosten, werden diese hier (analog Riebel P. 1990) als Leistungs- und Bereitschaftskosten angeführt. Nach Abzug von den Erlösen ergibt dies den Deckungsbeitrag I bzw. II des Auftrags. Um den Deckungsbeitrag III zu erhalten werden die sonstigen Bereitschaftskosten wie Kfz-Steuer und zeitabhängige Abschreibung, als Periodengemeinkosten, abgezogen. Das Ergebnis ist ein auftrags- oder tourenspezifischer Deckungsbeitrag je Fahrzeug. In den Periodeneinzelkosten werden die Personal- und Sachkosten der Disponenten, die nicht direkt einem Fahrzeug zurechenbaren Kosten in der Werkstatt usw. angeführt. Subtrahiert man schlussendlich die Periodeneinzel- und Gemeinkosten wie Kosten für die Unternehmensleitung, Sozialeinrichtungen, Steuerberatungskosten etc., erhält man den Unternehmenserfolg vor Steuern. Die Deckungsbeitragsrechnung liefert im Hinblick auf diese Arbeit relevante Informationen über Preisuntergrenzen und die für kalkulatorische Zwecke unterschiedenen kilometer- und zeitabhängigen Kosten die Kilometer- und Tagessätze.[38]
3.1.2. Kostenstruktur in der Praxis
Die Kostenstruktur eines LKWs im Güterverkehr ist von sehr vielen Faktoren abhängig. Abgesehen von den Einflussfaktoren, die in dieser Arbeit genauer untersucht und beschrieben werden, beeinflussen Größen wie der Einsatz im Nationalen- oder Fernverkehr, im Gewerblichen- oder Werkverkehr und weiter mehr, die Kostenstruktur sehr stark. Dementsprechend relevant ist der Unterschied bei Kalkulationen verschiedener Fahrzeugtypen. Um im Speziellen bei der Kostenkalkulation und bei der Erstellung der Kostenstruktur durchschnittliche Vergleichswerte zu erhalten, wird im folgenden Teil der Arbeit, solange nicht explizit erwähnt, von einem Sattelkraftfahrzeug (bestehend aus einem Sattelzugfahrzeug und einem Sattelanhänger) im gewerblichen Verkehr ausgegangen, mit einem Gesamtgewicht von 40 Tonnen. Beim Sattelanhänger handelt es sich um einen Tautliner (Schiebeplanenauflieger) mit einer Länge von 13,6m und drei Achsen. Nachfolgend werden diese als Lkw im Gesamten, Zugmaschine und Auflieger bezeichnet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 9: Tautliner[39]
Die angeführte Kostenkalkulation besteht aus Durchschnittswerten, die während der Recherche von den befragten Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden. Die Kalkulation besteht aus den Teilen Kalkulation der Fahrzeugkosten, Lohnkalkulation und Gesamtkalkulation und wird u.a. von den nachstehenden kilometer- und zeitabhängigen Variablen beeinflusst:
Variablen der Kostenkalkulation
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Berechnung 1: Variablen der Kostenkalkulation
Der oben angeführte Treibstoffpreis ist der Mittelwert aus historischen Treibstoffpreisen 2009 abzüglich 20% Mehrwertsteuer.[40]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Berechnung 2: Fahrzeugkosten
Der in den Kostenträgerfixkosten enthaltene Restwert und die kalkulatorische Abschreibung werden in den interviewten Unternehmen sehr unterschiedlich berechnet. Der hier angeführte Restwert wurde mit 15% vom Anschaffungswert berechnet und die kalkulatorische Abschreibung wurde linear durchgeführt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Berechnung 3: Lohnkalkulation
Die Lohnkalkulation wurde nach Richtlinien der WKO[41] berechnet und die Lohnsätze nach Bestimmungen des Kollektivvertrages für das Güterbeförderungsgewerbe für Arbeiter von 2009 herangenommen.[42] Ein Fahrer eines Sattelkraftfahrzeugs mit einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 10 Jahren erhält einen Normal-Stundenlohn von € 7,90. Überstunden die während der Normalarbeitszeit getätigt werden erhalten einen Überstundenzuschlag von 50% und Nachtüberstunden zwischen 20 und 5 Uhr werden mit einem Zuschlag von 100% honoriert.
Die 93% für die Lohnnebenkosten (LNK) und den Dienstgeberanteil (DGA) setzten sich wie folgt zusammen:
- Bezahlte Nichtanwesenheitszeiten (23%): Dieser Wert ist betriebsindividuell und setzt sich zusammen durch gesetzliche Feiertage, zusätzliche arbeitsfreie Tage, Urlaub, Krankenstand und sonstige Arbeitsverhinderungen
- Sonderzahlungen (20,5%): 4,33 Wochenbezüge für Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration
- Sozialabgaben (42,3%): Dienstgeberanteil Sozialversicherung, Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds und Dienstgeberzuschlag, Kommunalsteuer
- Abfertigungskosten (3,9%): Betriebsindividueller Durchschnittswert
- Sonstige Nebenkosten (3,3%): Betriebsindividueller Durchschnittswert für Berufsausbildungskosten, freiwilliger Sozialaufwand etc.
Da LKW-Fahrer ihre Tätigkeit nicht am Dienstort verrichten erhalten sie Tages-(TG) und Nächtigungsgelder (NG). Das Taggeld für die Tätigkeit im Inland beträgt laut Kollektivvertrag
€ 26,16 pro Kalendertag und der Fahrer erhält aliquot für jede angefangene Stunden 1/12. Für eine Nächtigung auswärts erhält der Fahrer € 15.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Berechnung 4: Gesamtkostenkalkulation
Die Gesamtkostenkalkulation wurde in zeit- und kilometerabhängige Kosten unterteilt, sowie die Verwaltungs- bzw. sonstige Kosten als Gemeinkosten angeführt. Des Weiteren wurden die Berechnungen für ein gesamtes Jahr, pro Kilometer und pro Einsatztag durchgeführt. Aus dieser Kalkulation ergibt sich folgende Kostenstruktur eines LKWs:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Berechnung 5: Kostenstruktur
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 10: Grafik - Kostenstruktur
Wie aus dieser Tabelle sehr gut ersichtlich, sind die Kosten für FahrerInnen[43] und Treibstoff jeweils mit über 30% Anteil an den Gesamtkosten sehr dominant. Der restliche Teil dieser Arbeit wird sich damit beschäftigen, in wie weit die einzelnen Kostenarten minimiert werden können bzw. auch welche Einflussfaktoren auf die unterschiedlichen Kosten einwirken. Um einen übersichtlichen Einblick zu erhalten, welche Faktoren die Kosten beeinflussen wird folgendes detaillierte Modell angeführt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 11: Ishikawa-Diagramm – Einflussfaktoren auf die Kostenstruktur
Im Fischgrätendiagramm "Kosten/Einflussfaktoren" werden die Kostenarten am Ende jeder Gräte in einem rechteckigen Kästchen gezeigt. Die Kosten die durch bzw. von den Fahrern beeinflusst werden können, sind rot markiert, die restlichen Kosten, die hauptsächlich vom Unternehmen allein verändert werden können sind blau gekennzeichnet. Der Punkt "Compliance" ist kein direkter Kostenpunkt, sondern die Art und Weise, in wie fern das Unternehmen und die Fahrer versuchen, mit teils illegalen Mitteln die Kosten zu reduzieren.
3.2. Fahrerkosten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Fahrer ist wohl der wichtigste Faktor im Betrieb eines Transportunternehmens. Dieser Meinung sind jedoch nicht alle Unternehmer. Im Bezug auf die Kostenstruktur eines LKWs ist er es gewiss, da bei allen Unternehmen in Österreich der Faktor Fahrer die meisten Kosten verursacht.
In Österreich ist der Lohn der Fahrer gesetzlich an den Kollektivvertrag für das Güterbeförderungsgewerbe für Arbeiter gebunden. Für Fahrer die im Werksverkehr beschäftigt sind, gilt teilweise der Kollektivvertrag für Handelsarbeiter. Die Lohnkategorien sind einerseits nach Länge der Betriebszugehörigkeit und andererseits nach Art der Ausbildung und nach Art des zu lenkenden Fahrzeuges gestaffelt. Des Weiteren sind im Kollektivvertrag die Tages- und Nächtigungsgelder und die Erschwernis-, Gefahren- und Schmutzzulagen geregelt.
Der Lohn für das Fahrpersonal ist unterteilt in Normalstundenlohn und eine Entlohnung für geleistete Überstunden. Überstunden liegen vor, wenn entweder die tägliche oder die wöchentliche Normalarbeitszeit überschritten werden. Der Überstundenzuschlag beträgt 50% für Überstunden in der Normalarbeitszeit zwischen 5 Uhr und 20 Uhr und außerhalb dieser Zeit 100%.[44]
Des Weiteren erhält der Fahrer aufgrund des erhöhten Lebensaufwandes bei Fahrtätigkeit außerhalb des Dienstortes Tages- und Nächtigungsgelder. Diese variieren je nach Aufenthaltsort. Darüber hinaus stehen dem Fahrer unter bestimmten Umständen Erschwernis-, Gefahren- und Schmutzzulagen zu.
Mit April 2007 trat ein neues Gesetz zur Arbeitszeitregelung in Kraft. Die so genannten "EU-Lenkarbeitszeit-Richtlinie" schreibt folgende Rahmenbedingungen für Lenker vor:
EU-Lenkerarbeitszeit-Richtlinien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: EU-Lenkerarbeitszeit-Richtlinien[45]
Die neuen Rechtsregelungen haben bei vielen Fahrern für einige Verwirrung gesorgt und die LKW-Disposition mit neuen, erschwerten Aufgaben versorgt. Abgesehen davon bewirkten die Regelungen eine Transportkostensteigerung von ca. 9,4%. Dies ist zurückzuführen auf die Reduzierung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit auf 48 Stunden und die eingeschränkte Flexibilität der zeitlichen Lage von Ruhezeiten. Die Zeitfenster in der das Fahrpersonal arbeiten darf, lassen sich nun schwieriger mit den Zeitfenstern für Güterannahme und Verladung vereinbaren.[46]
Grundsätzlich ist der Fahrer für die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten verantwortlich und wird bei Vergehen entsprechend bestraft. Werden die Überschreitungen jedoch aufgrund von zu engen Terminplanungen durch die Disponenten veranlasst, wird der Verantwortliche mit zur Rechenschaft gezogen.[47]
Einsparungen bei den Fahrerkosten können auf legalem Wege nur sehr schwer durchgeführt werden. In wirtschaftlich schlechteren Zeiten werden in den Unternehmen als erstes die Stammfahrer so eingeteilt, dass sie weniger bis keine Überstunden leisten können bzw. für bestimmte Touren kurzfristig Ersatzfahrer engagiert.
Speziell bei den Fahrerkosten werden in der Praxis auf illegalem Wege Kosten zu Lasten der Lenker eingespart. Dies wird durch leistungsabhängige Bezahlung, Entlohnung eines niedrigeren Kollektivvertrages, Auftragsvergabe an Schwarzfahrer oder Ausländer, Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen, Anstellen von Fahrern in "prekären" Beschäftigungsverhältnissen oder Einbehaltung des Lohnes, sowie Lohnabzüge für Vergehen ausgeführt. In manchen Betrieben grenzt dies an "Moderne Sklaverei". Darauf wird aber im Kapitel 3.9. "Compliance" näher eingegangen.
Fast alle der sieben befragten Unternehmen geben an, dass ihre Fahrer den ihnen zustehenden Kollektivnormallohn erhalten bzw. teilweise einen leicht erhöhten Lohn. In zwei Unternehmen erhalten die Fahrer im Fernverkehr, also im grenzüberschreitenden Verkehr, einen leistungsabhängigen Lohn gemäß gefahrener Kilometer. Ein anderes Unternehmen bezahlt unabhängig von der Anzahl der geleisteten Überstunden einen Pauschallohn. In einem anderen Betrieb, in denen die Fahrer auf Werkverkehrbasis arbeiten, erhalten diese zusätzlich zum Kollektivlohn inkl. aller Überstunden und Diäten eine Prämie gemäß Art und Größe der Ladung.
Jene Firmen, die Geschäftsstellen im Ausland eröffnet haben, setzten dort Fahrer aus den jeweiligen Ländern ein, da dort die Personalkosten um vieles geringer sind als in Österreich und dies meist auch der Hauptgrund ist für das Ausflaggen der Fahrzeuge. Näheres dazu im Kapitel 3.6. "Finanzierung".
[...]
[1] Kurier,07.10.2009, S. 14-15
[2] http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/art467,152032 , 15.04.09
[3] http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/508685/index.do?from=suche.intern.portal 16.09.2009
[4] http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/501796/index.do?from=suche.intern.portal, 12.08.09
[5] vgl. http://www.bundespolizei.gv.at (10.05.2010)
[6] vgl. WKÖ (2009) S. 5
[7] vgl. Kubenz (2008), S. 231
[8] vgl. Gleißner, Femerling (2008), S. 40
[9] vgl. Klemens (1995), S. 1
[10] vgl. Gleißner, Femerling (2008), S. 41
[11] http://www.bgl-ev.de/images/daten/verkehr/modalsplittkm.gif (14.04.2005)
[12] vgl. Gleißner, Femerling (2008), S. 43
[13] Gleißner, Femerling (2008), S. 68
[14] vgl. a.a.O., S. 68
[15] vgl. a.a.O., S. 68
[16] Gleißner, Femerling (2008), S. 69
[17] vgl. Frindik (2008), S. 736f.
[18] Piekarz (2008), S. 24
[19] vgl. Wegrath, KFG (2006), S. 52
[20] Piekarz (2008), S. 25
[21] vgl. Cadenes A. (2008), S. 727
[22] http://www.scheuwimmer.at/ (20.04.2010)
[23] http://www.logismarket.ch/ (20.04.2010)
[24] vgl. Gleißner, Femerling (2008), S. 69
[25] Klemens (1995), S. 17
[26] vgl. Kubenz (2008), S. 234ff.
[27] a.a.O. S. 239
[28] vgl. Kubenz (2008), S. 240
[29] vgl. Wollenweber (2009), S. 40f.
[30] vgl. Kubenz (2008), S. 241f.
[31] vgl. Lechner/Egger/Schauer (2006), S. 73
[32] vgl. Zäpfel (2001), S. 40
[33] vgl. Lechner/Egger/Schauer (2006), S. 809
[34] vgl. Lechner/Egger/Schauer (2006), S. 809ff.
[35] vgl. Aberle (2003), S. 289ff.
[36] vgl. Aberle (2003), S. 302
[37] Aberle (2003), S. 305
[38] vgl. Aberle (2003), S. 302ff.
[39] www.transports-leau.com (10.05.2010)
[40] vgl. http://www.bmwfj.gv.at/EnergieUndBergbau/Energiepreise/Seiten/MonitorTreibstoff.aspx?Report=9 (07.02.2010)
[41] vgl. http://portal.wko.at/wk/dok_detail_file.wk?AngID=1&DocID=407707&DstID=3151&StID=203977
[42] vgl. http://www.wu.ac.at/ar/materialien/greifeneder/lv1712/kv.pdf
[43] Die gleichberechtigte Nennung von weiblicher und männlicher Form wie an dieser Stelle wird aus Gründen der Lesbarkeit nicht in der gesamten Arbeit verwendet. Sofern im Text nicht anders erwähnt, sind im Folgenden mit einer männlichen Form immer beide Geschlechter angesprochen.
[44] vgl. http://www.wu.ac.at/ar/materialien/greifeneder/lv1712/kv.pdf
[45] WKO (2007)
[46] vgl. Klaus/Fischer/Prockl (2007), S. 5
[47] vgl. Kerler (2003), S. 185
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842809758
- DOI
- 10.3239/9783842809758
- Dateigröße
- 2.8 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johannes Kepler Universität Linz – Produktions- und Logistikmanagement, Sozialwirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2011 (Januar)
- Note
- 1
- Schlagworte
- güterverkehr einflussfaktoren kostenstruktur wirtschaftlichkeit
- Produktsicherheit
- Diplom.de