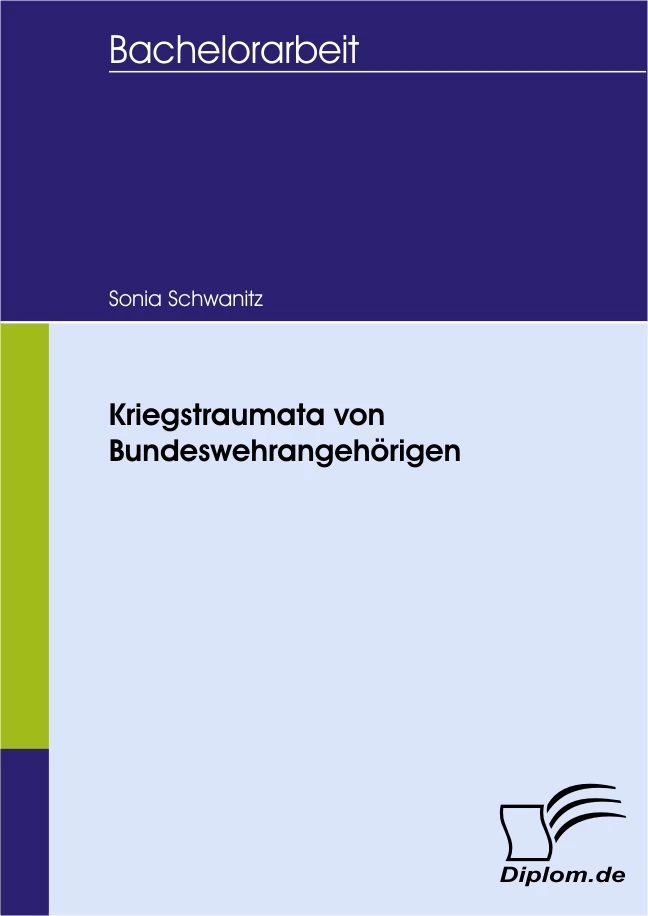Kriegstraumata von Bundeswehrangehörigen
Zusammenfassung
Mit dem Ende des Kalten Krieges und somit auch dem Ende der weltpolitischen Bipolarität hat sich sowohl das Aufgabenspektrum als auch das Anforderungsprofil der Bundeswehr wesentlich verändert. Es hat sich ein Funktionswandel vollzogen: Während bis 1989 noch die Landesverteidigung und die Beistandsleistungen im NATO-Rahmen als zentrale Aufgaben für die Angehörigen der Bundeswehr zu nennen sind, so entwickelt sich die Bundeswehr nach der Beendigung des Ost-West-Konfliktes zu einer Interventionsarmee. Gegenwärtig ist Deutschland weltweit mit 6.740 Bundeswehrsoldaten , an insgesamt zwölf Missionen beteiligt. Dabei stellt die UNO-mandatierte International Security Assistance Force in Afghanistan (ISAF) mit 4.360 Bundeswehrsoldaten mehr als die Hälfte des insgesamt eingesetzten Personals. Die Soldaten der Bundeswehr, befinden sich dabei aktuell sowohl in bewaffneten militärischen Konflikten, also klassischen Kampfeinsätzen, als auch in friedenssichernden, friedenserhaltenden oder friedensschaffenden Einsätzen, so genannten Peacekeeping-Missionen.
Neben der Landesverteidigung dienen die Auslandseinsätze nun also auch außen- und sicherheitspolitischen Zielen, wie dem Schutz der Menschenrechte und der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Daher ist die Bundeswehr schon seit Januar 2002 in Afghanistan im Einsatz. Dort sind besondere Umstände gegeben, die mit extremen Belastungen der Soldaten einhergehen. Zu nennen ist dabei vor allem die Art der Kriegsführung, die als asymmetrisch zu bezeichnen ist, da die aufeinandertreffenden Parteien, Taliban auf der einen und die NATO auf der anderen Seite, wesentliche Unterschiede hinsichtlich ihrer Waffenausrüstung und Strategie zeigen. Diese Art der Kriegsführung ist durch terroristische Aktionen, wie Selbstmordattentate, Angriffe gegen einheimische Zivilisten und Soldaten, ausländische Truppen und internationale Hilfsorganisationen, gekennzeichnet und führt damit zu einem enormen subjektiven Gefährdungsgefühl, aber auch zu einer tatsächlich vorhandenen Bedrohung von Leib und Leben der Soldaten. Des Weiteren erlangen die Soldaten Eindrücke von Not und Elend innerhalb der Bevölkerung, sehen Zerstörungen und Gewaltanwendung im Einsatzland.
Vor diesem Hintergrund sind die Soldaten in den Auslandseinsätzen extremen psychischen Belastungen ausgesetzt. In der Folge dieser extremen Belastungen in den Auslandseinsätzen häufen sich inzwischen die Berichte über traumatisierte Soldaten, die aus […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Posttraumatische Belastungsstörung
2.1 Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung
2.2 Ätiologie der Posttraumatischen Belastungsstörung
2.3 Epidemiologie der Posttraumatischen Belastungsstörung
3 Traumatische Erfahrungen im Kriegsgebiet
3.1 Kriegserfahrungen und Kriegshandlungen als potentiell traumatisierende Ereignisse
3.2 Peritraumatische Reaktion
3.3 Risikofaktoren
3.4 Schutzfaktoren
4 Therapie der Posttraumatischen Belastungsstörung
4.1 Psychotherapie im Rahmen der Bundeswehr
4.2 Sozialarbeiterische Begleitung von traumatisierten Menschen
5 Ausblick
Quellenverzeichnis
Selbstständigkeitserklärung
1 Einleitung
Mit dem Ende des Kalten Krieges und somit auch dem Ende der weltpolitischen Bipolarität hat sich sowohl das Aufgabenspektrum als auch das Anforderungsprofil der Bundeswehr wesentlich verändert (vgl. Bredow 2006: 315). Es hat sich ein Funktionswandel vollzogen: Während bis 1989 noch die Landesverteidigung und die Beistandsleistungen im NATO-Rahmen als zentrale Aufgaben für die Angehörigen der Bundeswehr[1] zu nennen sind, so entwickelt sich die Bundeswehr nach der Beendigung des Ost-West-Konfliktes zu einer Interventionsarmee (vgl. Rauch 2006: 46). Gegenwärtig ist Deutschland weltweit mit 6.740 Bundeswehrsoldaten[2], an insgesamt zwölf Missionen[3] beteiligt. Dabei stellt die UNO-mandatierte International Security Assistance Force in Afghanistan (ISAF) mit 4.360 Bundeswehrsoldaten mehr als die Hälfte des insgesamt eingesetzten Personals (vgl. Jaberg et al. 2009: 14).[4] Die Soldaten der Bundeswehr, befinden sich dabei aktuell sowohl in bewaffneten militärischen Konflikten, also klassischen Kampfeinsätzen, als auch in friedenssichernden, friedenserhaltenden oder friedensschaffenden Einsätzen, so genannten Peacekeeping-Missionen (vgl. Biesold/Barre 2009: 462).
Neben der Landesverteidigung dienen die Auslandseinsätze nun also auch außen- und sicherheitspolitischen Zielen, wie dem Schutz der Menschenrechte und der Bekämpfung des internationalen Terrorismus (vgl. Rauch 2006: 140). Daher ist die Bundeswehr schon seit Januar 2002 in Afghanistan im Einsatz. Dort sind besondere Umstände gegeben, die mit extremen Belastungen der Soldaten einhergehen. Zu nennen ist dabei vor allem die Art der Kriegsführung, die als asymmetrisch[5] zu bezeichnen ist, da die aufeinandertreffenden Parteien, Taliban auf der einen und die NATO auf der anderen Seite, wesentliche Unterschiede hinsichtlich ihrer Waffenausrüstung und Strategie zeigen (vgl. Krech 2004: 9). Diese Art der Kriegsführung ist durch terroristische Aktionen, wie Selbstmordattentate, Angriffe gegen einheimische Zivilisten und Soldaten, ausländische Truppen und internationale Hilfsorganisationen, gekennzeichnet und führt damit zu einem enormen subjektiven Gefährdungsgefühl, aber auch zu einer tatsächlich vorhandenen Bedrohung von Leib und Leben der Soldaten (vgl. Biesold/Barre 2009: 462). Des Weiteren erlangen die Soldaten Eindrücke von Not und Elend innerhalb der Bevölkerung, sehen Zerstörungen und Gewaltanwendung im Einsatzland.
Vor diesem Hintergrund sind die Soldaten in den Auslandseinsätzen extremen psychischen Belastungen ausgesetzt.
In der Folge dieser extremen Belastungen in den Auslandseinsätzen häufen sich inzwischen die Berichte über traumatisierte Soldaten, die aus dem Irak oder aus Afghanistan zurückkehren. Erste Verfilmungen von Einzelschicksalen werden im deutschen Fernsehen ausgestrahlt, erregen Aufsehen und lassen eine Diskussion über den Einsatz in Afghanistan aber vor allem über die aus ihm resultierenden psychischen Belastungen für die Soldaten entstehen. Besondere Aufmerksamkeit kam dann dem Film „Willkommen zu Hause“ zu. Er zeigt einen jungen Soldaten, der aus seinem Auslandseinsatz in Afghanistan zurückkehrt, er hatte im Einsatz einen Anschlag der Taliban miterlebt und vermeintlich unbeschadet überlebt. Äußerlich unversehrt kann er sich trotz enormer Bemühungen nicht in den deutschen Alltag einfinden und wirkt auf seine Umgebung befremdlich, als er auf seiner Willkommensfeier gegrilltes Fleisch riecht und sich daraufhin übergeben muss. Fragen zu seinem Einsatz geht er aus dem Weg, immer mehr entfernt er sich von seiner Familie und seiner Freundin. Er erscheint ihnen gefühlskalt und desinteressiert, sodass seine Freundin ihm vorwirft: "Du bist wie ein Fremder" (vgl. Huber 2009).
Warum kann sich der junge Soldat in seiner Heimat nicht wieder einfinden? Was ist das für eine Störung, die offensichtlich aus dem Erleben extremer Ereignisse resultiert?
Erst im Jahr 1980 wurde ein neues krankheitswertiges Syndrom in das DSM III-System aufgenommen, das die psychischen Folgen extremer Belastungserlebnisse beschreibt: die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Diese Störung gilt innerhalb der Fachdiskussion als „Prototyp“ krankheitswertiger Extrembelastungs- und Traumafolgen (vgl. Maercker/Ehlert 2001: 13). Daher soll in der vorliegenden Arbeit die Darstellung dieses Störungsbildes erfolgen und nicht etwa die Darstellung der anderen Traumafolgestörungen, wie z. B. die akute Belastungsreaktion oder die körperlichen Beschwerden und Krankheiten[6], die aus dem psychischen Trauma entstehen können. Die Klassifikation der PTBS in eine übergeordnete Gruppe psychischer Störungen ist kontrovers diskutiert. Im ICD-System wird die PTBS in die Gruppe der Belastungsstörungen eingeordnet, im DSM-System dagegen zur Gruppe der Angststörungen gerechnet (vgl. Maercker 2009: 26 f). Die PTBS begründet im Vergleich zu anderen psychischen Störungen eine ätiologische Sonderstellung, da sie einen externen Reiz als Kriterium für eine Diagnose nennt (A-Kriterim).
Das Forschungsfeld der „Psychotraumatologie“ beschäftigt sich mit eben dieses Folgen lebensbedrohlicher Ereignisse. Die bundeswehreigene Forschung zu diesem Thema wird seit 2009 durch den Fachbereich Psychische Gesundheit am Institut für den medizinischen Arbeits- und Umweltschutz in Berlin wahrgenommen, ein prominentes Forschungsprojekt stellt dabei die „Dunkelziffer-Studie“ dar. Diese soll „eine wissenschaftlich fundierte Abschätzung der Größenordnung einsatzbedingter psychischer Erkrankungen ermöglichen und deren Einflussfaktoren aufzeigen“ (Bundeswehr 2010).[7] Die Forschung in diesem Gebiet wird also inzwischen intensiv betrieben, und das nicht ausschließlich in Deutschland (vgl. Maercker/Ehlert 2001: 12). In anderen Ländern, vor allem in den USA, hat die Forschung zu den psychischen Folgen von militärischen Auslandseinsätzen auf Soldaten bereits ausführliche Ergebnisse vorzuweisen. So zeigten die amerikanischen Forscher um Dr. Karen Seal in einer „Studie an 289.328 USamerikanischen Armeeangehörigen, die von 2002 bis 2008 im Irak oder in Afghanistan eingesetzt waren, erschreckende Zahlen: 21,8 % (also 90 000 Menschen!) litten an einer PTBS []“ (Lukowski 2010). Die gegenwärtige Situation in Deutschland hinsichtlich der Anzahl von Betroffenen ist nicht abschließend geklärt, der Wehrbeauftragte Reinhold Robbe fasst die ersten Erkenntnisse zusammen:
„Die Anzahl der an PTBS erkrankten Soldatinnen und Soldaten hat sich seit Beginn der Auslandseinsätze der Bundeswehr kontinuierlich erhöht. 2009 sind insgesamt 466 Soldatinnen und Soldaten mit der Diagnose PTBS behandelt worden. Damit hat sich die Anzahl der PTBS-Erkrankten gegenüber 2008 mit 245 Fällen nochmals deutlich fast verdoppelt. Fast 90 Prozent der PTBS-Fälle (418) entfallen auf Soldaten des ISAF-Kontingents“ (Robbe 2009).
Für den Anstieg gebe es zwei wesentliche Gründe, so Robbe, zum einen trügen die erhöhte Zahl der Soldaten im Einsatz und zum anderen die Zunahme der Einsatzintensität und die kriegsähnlichen Verhältnisse in Afghanistan zum Anstieg der PTBS-Erkrankten bei (vgl. Robbe 2009). Dazu ergänzen die amerikanischen Forscher:
„Die steigende Zahl der Diagnosen wird auf mehrere Faktoren zurückgeführt: Gefährliche und verwirrende Wesen des Krieges im Irak und in Afghanistan ohne definierte Fronten, die schwindende öffentliche Unterstützung und damit verbundene sinkende Moral der Soldaten, unberechenbare Bedrohungslagen und zunehmende Sensibilisierung der Öffentlichkeit für PTBS“ (Eggen 2009).
Fraglich ist nun, wie sich diese Situation in Deutschland entwickeln wird, vor allem vor dem Hintergrund der wesentlich höheren PTBS-Raten, die in anderen Ländern gefunden wurden.
Erkenntnisinteresse und Erarbeitungsgegenstand dieser Arbeit leiten sich nun von der Frage zur gesellschaftlichen Brisanz und zur wissenschaftlichen Relevanz her:
- Wie entsteht aus dem Erleben extremer Ereignisse, im Kontext von Kriegserfahrungen, eine PTBS?
Daraus resultierend ergeben sich Fragen:
- Welches Störungsbild ergibt die PTBS?
- Welche Situationen können in einem Kriegsgebiet traumatisch sein?
- Was macht das Ereignis traumatisch?
- Welche Therapien stehen zur Behandlung der PTBS zur Verfügung?
In der vorliegenden Arbeit mit dem Thema „Kriegstraumata von Bundeswehrangehörigen“ soll der Frage nachgegangen werden was die PTBS ausmacht und wie sie sich im Kontext der Erfahrungen von Bundeswehrangehörigen entwickeln kann und sich dann äußert.
Entsprechend der Fragestellung beginnt diese Arbeit mit der Darstellung des Störungsbildes der PTBS im zweiten Kapitel. Dafür sollen in Kapitel 2.1 zunächst die Kernsymptome der Störung beschrieben werden, im anschließenden Kapitel 2.2 werden dann diese Symptome auf ihre Ätiologie überprüft. Für ein umfassendes Verständnis der Krankheit wird im Kapitel 2.3 die Verbreitung der Störung in der Allgemeinbevölkerung und in Risikopopulationen genannt, zudem werden hier die Differentialdiagnosen zur PTBS und die komorbiden Störungen gezeigt. Im Fokus des dritten Kapitels steht dann die Beantwortung der Frage, warum es einigen Menschen gelingt, trotz der schädlichen Einwirkung eines traumatischen Ereignisses keine PTBS zu entwickeln und anderen nicht. Dazu wird zunächst im Kapitel 3.1 die traumatische Situation selbst definiert und kategorisiert. Danach werden Kriegserfahrungen und Kriegshandlungen auf ihr traumatisierendes Potential hin untersucht. Im Anschluss findet die Darstellung der peritraumatischen Reaktionen (Kapitel 3.2), der Risikofaktoren (Kapitel 3.3) und der Schutzfaktoren (Kapitel 3.4) statt. Im vierten Kapitel werden dann abschließend Interventionsmöglichkeiten nach der Diagnose einer PTBS aufgezeigt. Dabei werden zunächst die Psychotherapie im Rahmen der Bundeswehr (Kapitel 4.1) und dann anschließend die Sozialarbeiterische Begleitung von traumatisierten Menschen (Kapitel 4.2) gezeigt.
2 Posttraumatische Belastungsstörung
Im diesem Kapitel soll die Störung beschrieben werden, die aus dem Erleben von extremen Situationen entstehen kann: die PTBS. Hier sollen zunächst die Symptome der Störung beschrieben werden (Kapitel 2.1), um dann die Ätiologie der Krankheit zu erklären. Dabei sollen die entscheidenden Mechanismen aufgezeigt werden, welche die PTBS-Symptome erzeugen und aufrechterhalten (Kapitel 2.2). Abschließend soll dann die Prävalenz der PTBS, die Differentialdiagnosen zur PTBS und die komorbiden Störungen zur PTBS dargestellt werden (Kapitel 2.3).
In dem Kapitel (V) F43 der ICD-10 werden Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen klassifiziert. Dort heißt es: Die PTBS entsteht „immer als direkte Folge der akuten schweren Belastung oder des kontinuierlichen Traumas“ (ICD-10, Dilling/Mombour/Schmidt 2008: 181). Das belastende Ereignis ist als primärer und ausschlaggebender Kausalfaktor zu sehen, ohne dessen Einwirkung die Störung nicht entstehen kann (vgl. ebd.: 181). Zur Diagnose der PTBS muss dieses auslösende Trauma durch die Berichte des Betroffenen[8] oder andere Belege objektivierbar sein (Boos/Müller 2006: 825).
2.1 Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung
Ein Angehöriger der Bundeswehr beschreibt seinen Zustand nach einem Selbstmordanschlag gegen einen Bundeswehrbus der ISAF-Schutztruppe in Kabul folgendermaßen:
„Das, was um mich herum geschah, nahm ich zwar auf, oftmals berührte es mich aber nicht einmal. Die Bilder, die ich ständig im Kopf hatte, ließen mich nahezu gefühlskalt. [] Das was mir wichtig und lieb war, schien mir plötzlich fremd und unheimlich. [] Hobbys und soziale Kontakte spielten keine Rolle mehr. [] Nach dem Anschlag fing ich an, mich über ganz banale Dinge aufzuregen [], und wurde sehr leicht reizbar []. Bestimmte Schlag- oder Schlüsselwörter, wie der 7.6. [Datum des Anschlages, S.S.], Anschlag, Bus, Afghanistan oder Kabul, riefen mich sofort auf den Plan. [] Anfangs konnte ich schlecht schlafen []. Es gab verschiedene alltägliche Situationen, in denen ich mich von der einen auf die andere Sekunde an diese Sekunden während des Anschlags, die mir wie Stunden vorkamen, zurückerinnerte. [] Grundsätzlich ging ich jeder Frage, die in Richtung Selbstmordanschlag zielen hätte können, aus dem Weg“ (Betroffener F. 2009: 123-125).
In diesem Bericht werden die drei Hauptsymptomgruppen der PTBS beschrieben: Intrusionen, Vermeidung/Numbing und Hyperarousal. Diese und die Einzelsymptome bzw. –beschwerden der PTBS sollen nun im Folgenden dargestellt werden (vgl. Maercker 2009: 17 f).
Die Intrusionen sind ein charakteristisches Symptom der PTBS. Intrusive Erinnerungen können Bilder, Gedanken und Wahrnehmungen sein, die einen Aspekt des Traumas symbolisieren (vgl. von Hinckeldey/Fischer 2002: 31). Dabei geschieht das intrusive Wiedererleben des traumatisierenden Ereignisses vorrangig in Form von sensorischen Eindrücken, seltener in Form von Gedanken (vgl. Ehlers 1999: 15). Ungewollt und schwer kontrollierbar treten diese belastenden Erinnerungen oder Erinnerungsfragmente des traumatischen Ereignisses in Form von (Alb-) Träumen oder Flashbacks auf (vgl. Boos/Müller 2006: 825). So berichtet auch der Betroffene F. des Selbstmordanschlags: „Es gab verschiedene alltägliche Situationen, in denen ich mich von der einen auf die andere Sekunde an diese Sekunden während des Anschlags, die mir wie Stunden vorkamen, zurückerinnerte“. Der Betroffene erlebt dann die „gleichen sensorischen Eindrücke (z. B. Bilder, Geräusche, Geschmack, Körperempfindungen) und gefühlsmäßigen und körperlichen Reaktionen wie während des Traumas“ (Ehlers 1999: 3). Mit den Intrusionen gehen dann auch physiologische Reaktionen einher, dazu gehören „unwillkürliche Körperreaktionen wie Schwitzen, Zittern, Atembeschwerden, Herzklopfen oder -rasen, Übelkeit oder Magen-Darm-Beschwerden“ (Maercker 2009: 17). Die wiederkehrenden Träume verlaufen oft über Jahre nach dem gleichen Muster, dabei können sie sowohl realitätsnahe als auch sehr verzerrte Erinnerungen (Erinnerungsfragmente) beinhalten.
Die Flashbacks (Nachhallerlebnisse) sind durch ihre Plötzlichkeit und Lebendigkeit geprägt (vgl. ebd.: 17). Die Betroffenen haben das Gefühl, das Trauma erneut zu durchleben, da sie die gleichen Gefühle und Wahrnehmungserinnerungen wie während des Traumas durchleben (vgl. von Hinckeldey/Fischer 2002: 31). Die Intensität des Wiedererlebens reicht dann „von Einzelerinnerungen bis zum Überwältigtwerden von der Erinnerung“ (vgl. Maercker 2009: 17). Von diesem Wiedererleben des Traumas geht dann für den Betroffenen in der Gegenwart weiterhin/wieder eine Gefahr aus (vgl. Boos/Müller 2006: 826).
Zur zweiten Symptomgruppe gehören Vermeidung und Numbing. Die Vermeidung von Reizen, Situationen, Personen oder Aktivitäten, die mit dem traumatischen Erlebnis in Verbindung stehen bzw. in Verbindung gebracht wurden, werden von den Betroffenen vermieden. Sie entziehen sich insbesondere Aktivitäten oder Situationen, die bei ihnen Erinnerungen an das traumatisierende Ereignis hervorrufen könnten. Diese symbolisierenden Auslöser für belastende Erinnerungen sind bei dem Betroffenen F. des Selbstmordattentats: „der 7.6., Anschlag, Bus, Afghanistan oder Kabul“, können aber auch z. B. Jahrestage oder Darstellungen des Schicksals anderer sein (vgl. Maercker 2009: 17). Auch das Verbalisieren des Geschehenen soll unbedingt vermieden werden, wie die weitere Aussage des Betroffenen F. belegt: „Grundsätzlich ging ich jeder Frage, die in Richtung Selbstmordanschlag zielen hätte können, aus dem Weg“ (vgl. Ehlers 1999: 3).
Des Weiteren sollen Gedanken an das Trauma vermieden werden, z. B. in Form von eigenen Gedankenstoppversuchen oder Selbstkommentaren (vgl. Maercker 2009: 17). Trotz der intensiven Bemühungen, die Gedanken zu vermeiden, gelingt es den Betroffenen in den meisten Fällen nicht, die Erinnerungen an das Trauma zu verdrängen. Allerdings kann „extremes Bemühen oder bestimmte automatisierte (unbewusste) Einstellungen, die bedrängenden Erinnerungen abzuschalten, im Resultat zu dissoziativen Zuständen wie Teilamnesien führen“ (Maercker 2009: 18). Die Betroffenen können sich dann in der Folge an wichtige Aspekte des Traumas nicht mehr erinnern (vgl. Boos/Müller 2006: 825).
Das intrusive Wiedererleben einerseits und das Vermeiden von traumabezogenen Reizen andererseits scheint hier zunächst konträr, ist aber bei beiden Symptomen Ausdruck der Nicht-Beeinflussbarkeit ihres Auftretens durch den Betroffenen:
„Dieser Wechsel von unkontrollierbarem Wiedererleben des Traumas und der Unterdrückung traumabezogener Erinnerungen wird auch als die `Alles oder Nichts` Antwort auf das Trauma bezeichnet und scheint zum großen Teil ohne bewusste Einflussmöglichkeit durch die Betroffenen abzulaufen“ (von Hinckeldey/Fischer 2002: 31).[9]
Mit Numbing ist die Abflachung der allgemeinen Reagibilität gemeint, die Betroffenen zeigen ein deutlich vermindertes Interesse an wichtigen Aktivitäten des täglichen Lebens, sie beklagen eine Beschädigung ihrer Gefühlswelt, alle eigenen Gefühle erscheinen ihnen nivelliert (vgl. Maercker 2009: 18). Unter Numbing sind dann aber auch das anhaltende Gefühl der Entfremdung von anderen Menschen sowie der allgemeine soziale Rückzug zu fassen. Dieses Gefühl der Entfremdung entsteht vorrangig gegenüber Personen, die nicht das gleiche traumatisierende Ereignis erlebt haben, da die Betroffenen eine unüberwindliche Kluft zwischen sich und den anderen (auch Familienmitgliedern) empfinden (vgl. ebd.: 17). Der Betroffene F. berichtet: „Das was mir wichtig und lieb war, schien mir plötzlich fremd und unheimlich. [] Hobbys und soziale Kontakte spielten keine Rolle mehr“. Auch Zukunftspläne werden nicht mehr gemacht, da die Betroffenen das Gefühl haben „das Trauma bzw. seine Verursacher haben Jahre (oder `die beste Zeit`) des Lebens zerstört“ und diese Lebenszeit ist unwiederbringlich verloren (vgl. ebd.: 18).
Die dritte Symptomgruppe umfasst dann die Symptome gesteigerter Erregung, Hyperarousal. Dazu zählen zunächst Einschlaf- und Durchschlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten, welche mit den oben dargstellten (Alp-)Träumen und Flashbacks im Zusammenhang stehen können, aber auch als Resultat der gesenkten Erregungsschwelle des autonomen Nervensystems zu sehen sind (vgl. ebd.: 19). Tagsüber sind die Betroffenen „hypervigilant bzw. erhöht wachsam gegenüber allen möglichen Reizen“, da sie ein ständiges und unrealistisches Gefährdungsgefühl haben (vgl. Maercker 2009: 18 f). Mit dieser übermäßigen Wachsamkeit geht dann auch eine übermäßige Schreckhaftigkeit einher, die schon durch geringfügige körperliche Berührungen oder durch Geräusche ausgelöst werden kann (vgl. ebd.: 19). Die Betroffenen sind außerdem erhöht reizbar, wie auch die Aussage des Betroffenen bestätigt: „Nach dem Anschlag fing ich an, mich über ganz banale Dinge aufzuregen [], und wurde sehr leicht reizbar“.
Diese drei dargstellten Symptomgruppen Intrusionen/Wiedererleben, Vermeidung/Numbing und Hyperarousal sollen nun im folgenden Kapitel auf ihre Ursache überprüft werden.
2.2 Ätiologie der Posttraumatischen Belastungsstörung
Die Symptome der PTBS treten in den meisten Fällen zeitnah nach dem traumatischen Ereignis auf, nämlich üblicherweise innerhalb der ersten Monate. Nur bei elf Prozent der Betroffenen liegt ein verzögerter Beginn vor. Innerhalb des ersten Jahres remittieren ca. 50 Prozent der Fälle ohne eine Behandlung, bei ungefähr einem Drittel der Betroffenen entwickelt sich nach der Traumatisierung ein chronischer Verlauf der PTBS.
Nun stellt sich die Frage, wie es zu einer Chronifizierung der PTBS kommt. Zur Erklärung der Ätiologie der PTBS soll hier das „Modell der chronischen Posttraumatischen Belastungsstörung“ von Ehlers und Clark[10] verwendet werden. Im Folgenden sollen die drei wesentlichen Mechanismen der PTBS, die diese entstehen lassen und aufrechterhalten, nämlich
a) die Art des Traumagedächtnisses,
b) die negative Interpretation des Traumas und/oder seiner Konsequenzen und
c) die dysfunktionalen Verhaltensweisen
dargestellt werden (vgl. Ehlers 1999: 22). Ehlers und Clark erklären die Entstehung einer chronischen PTBS damit, dass „die Betroffenen das traumatische Ereignis und/oder seine Konsequenzen so verarbeiten, dass sie eine schwere gegenwärtige Bedrohung wahrnehmen“ (ebd.: 13) [Hervorhebung im Original]. Zudem soll in diesem Kapitel geklärt werden, wie sich die weiteren Kernsymptome der PTBS entwickeln: Wie kommt es zum intrusiven Wiedererleben? Wie kommt es zur Wahrnehmung einer gegenwärtigen Bedrohung, obwohl das Ereignis in der Vergangenheit liegt?
a) Die Art des Trauma-Gedächtnisses
Zur Beantwortung der Frage, wie es zum intrusiven Wiedererleben kommt, muss nun zunächst der Unterschied zwischen dem autobiografischen Gedächtnis und dem Traumagedächtnis erklärt werden, da in dem Modell nach Ehlers und Clark dem empirischen Wissenstand, dass traumatische Erfahrungen im Gedächtnis anders abgespeichert werden als nicht-traumatische, entsprochen wird (vgl. Boos/Müller 2006: 832). Nach Ehlers und Clark erklärt sich das intrusive Wiedererleben durch die Art, wie das Trauma enkodiert und im Gedächtnis abgespeichert wird (vgl. Ehlers 1999: 16).
Das autobiografische Gedächtnis (auch episodisches Gedächtnis), das Informationen über autobiografische Ereignisse und Fakten beinhaltet und das semantische Gedächtnis, welches Faktenwissen und das Wissen über allgemeine Zusammenhänge beinhaltet, werden als explizite Gedächtnisformen bezeichnet (von Hinckeldey/Fischer 2002: 81). Autobiografische Erinnerungen werden hier normalerweise in geordneter und abstrahierter Form abgespeichert, dabei werden die Ereignisse in die Wissensstruktur des autobiografischen Gedächtnisses eingeordnet und nach persönlich relevanten Themen und Zeitperioden sortiert. Um diese Erinnerungen abzurufen, werden dann Suchstrategien verwendet. Der Abruf kann aber auch über entsprechende Stimuli, die mit dem Ereignis assoziiert sind, erfolgen. Die resultierende Erinnerung beinhaltet dann sensorische Informationen, die allerdings gemeinsam mit den abstrahierten Informationen über die Art der Ereignisse abgerufen wird (vgl. Ehlers 1999: 16 f). Das Erinnern, der in dieser Art abgespeicherten Erlebnisse, „geht dann mit der Bewusstheit einher, dass man sich an sich selbst an bestimmten Orten und zu einer bestimmten Zeit erinnert (autonoetisches Gedächtnis)“ (Boos/Müller 2006: 826). Auch Funktionen wie Wahrnehmungen, Emotionen und Emotionsregulation laufen explizit ab, das heißt „mit Beteiligung des Bewusstseins, mit darauf fokussierter Aufmerksamkeit, mit willentlicher Kontrolle, mit dem Gefühl, dass man selbst es ist, der das jetzt erlebt“ (Maercker/Rosner 2006: 13).
Bei Gefahr wird dann ein „Überlebensprogramm“ aktiviert, das bei realen Bedrohungen lebensrettend ist, da es sofortige Anpassungsreaktionen, wie Flucht oder Gegenwehr, auslöst. Hier werden die erhaltenen Informationen und Sinneseindrücke innerhalb kürzester Zeit „zum Hypothalamus und von dort [] zu Strukturen des Limbischen Systems projiziert, wo sie auf ihre emotionale Bedeutung hin abgetastet und als `lebensgefährlich`, `Notfall` beurteilt werden“ (Teegen 2003: 25). Daraus resultiert eine Ausschüttung von Stresshormonen und Neurotransmittern, da der gesamte Organismus in Alarmzustand versetzt wurde (vgl. ebd.: 25). Neurobiologische Modelle gehen bei der Erklärung von Traumafolgen von einer zentralen Bedeutung von Amygdala[11] und Hippokampus aus:
„Ein traumatisches Ereignis stellt einen extrem intensiven aversiven Reiz dar, der zu einer sehr starken unmittelbaren Reaktion der Amygdala und dort zu einer schwer wieder zu löschenden Konditionierung an die mit dem Ereignis verbundenen visuellen, akustischen und anderen Sinnesreize führt“ (Maercker/Rosner 2006: 14).
Parallel zu diesem Geschehen kann dann auch der Hippokampus seine Aufgabe der „Erinnerungskonsolidierung im expliziten Modus [] nicht ausführen“ (ebd.: 14). Was u. a. darin begründet ist, dass infolge andauernder Stresssituationen, wie z. B. Kampfsituationen, eine Kette sich gegenseitig verstärkender Reaktionen erzeugt wird, die „kognitive Strukturen mit ihrer ordnenden Filterfunktion massiv hemmen, die Informationsverarbeitung beeinträchtigen und mentale Spuren des Ereignisses spezifisch formen [können, S.S.]“ (Teegen 2003: 25). Zudem setzt dann bei extremer Bedrohung ein dissoziativer Schutzmechanismus ein, der mittels betäubender körpereigner Opiate vor der Flut überwältigender Informationen, Gefühlen und Schmerzen schützen soll (vgl. ebd.: 25).
Die in dieser Art „eingravierten Gedächtnisspuren“ können dann in der Folge leicht aktiviert werden, allerdings in der impliziten Gedächtnisform (vgl. Maercker/Rosner 2006: 14). Diese ist durch die direkte Anbindung an Sinnesmodalitäten geprägt und nicht wie das explizite Gedächtnis an das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit. Dabei sind implizite Prozesse schwer veränder- und kontrollierbar (ebd.: 13). Innerhalb des Trauma-Gedächtnisses wird das traumatische Ereignis dann ungenügend elaboriert (d.h. in seiner Bedeutung verarbeitet) und ebenfalls ungenügend mit dem autobiografischen Gedächtnis verknüpft (vgl. Steil/Rosner 2009: 27). Daher wird es dementsprechend „ungenügend in seinen Kontext von Zeit, Raum, vorangegangenen und nachfolgenden Informationen und anderen autobiografischen Erinnerungen integriert []“ (Ehlers 1999: 17). Unter der extremen Belastung werden sinnliche Eindrücke ohne Zusammenhang festgehalten, sodass das Trauma-Gedächtnis im Gegensatz zum autobiografischen Gedächtnis dekontextualisierte, fragmentierte und desorganisierte Erinnerungen beinhaltet (vgl. Teegen 2003: 25). Für die Betroffenen ergibt sich dann die Schwierigkeit das traumatische Erlebnis willentlich abzurufen, sowie einzelne Details und die Reihenfolge der Ereignisse zu erinnern (vgl. Ehlers 1999: 15) [Hervorhebung S.S.].
Die Abspeicherung des Traumas in der impliziten Gedächtnisform erklärt, warum während eines Flashbacks die zeitliche und räumliche Orientierung gänzlich verloren geht: „der Betreffende `erinnert sich also nicht` an das Trauma, sondern ist wieder damals und dort“ (Boos/Müller 2006: 826). Die Betroffenen erleben ungewollt und lebhaft die „Emotionen in Originalform“, d.h. sie werden nicht als Erfahrung in der Vergangenheit erlebt, sondern als gegenwärtiges Geschehen (vgl. Ehlers 1999: 15) [Hervorhebung S.S.]. Werden dem Betroffenen nach dem traumatischen Ereignis zusätzliche, ergänzende oder widersprechende Informationen über das Geschehen gegeben, so ist er auch dann nicht fähig diese mit seinem Erleben in Verbindung zu bringen, bzw. seine Wahrnehmung des traumatischen Erlebnisses zu revidieren (vgl. ebd.: 16). Traumabezogene Gedächtnisinhalte sind somit einer Modifikation durch Erfahrung nicht zugänglich, da sie im impliziten Gedächtnis gespeichert sind (vgl. von Hinckeldey/Fischer 2002: 111).
Als Folge der oben erklärten Abspeicherung des Traumas im impliziten Gedächtnis ist dann auch die leichte Auslösung des Wiedererinnerns zu sehen. Nach Ehlers und Clark ist sie durch die „starke[n, S.S.] assoziative[n, S.S.] Gedächtnis-Verbindungen“ zu erklären (Ehlers 1999: 17). Diese „besonders starke[n, S.S.] Reiz-Reiz (S-S) und Reiz-Reaktion (S-R) Assoziationen für die mit dem traumatischen Erlebnis verbundenen Reize“ stellen so genannte Konditionierungsprozesse dar und begründen das leicht auslösbare Wiedererleben (vgl. Ehlers 1999: 17). Bei diesen Konditionierungsprozessen wird „ein neuer, initial neutraler Stimulus, z. B. ein Ton- oder Lichtsignal als konditionierter Stimulus (CS) ausgewählt. Wenn dieser Stimulus mit einem aversiven unkonditionierten Stimulus (US), z. B. einem Schmerzreiz, gekoppelt wird, wird der CS zum Trigger für eine konditionierte Reaktion (CR), die sich z. B. in einer Angstreaktion ausdrücken kann“ (Schmahl 2009: 58).
Auslösende Reize für die Intrusionen müssen dabei nicht im direkten Zusammenhang mit dem Trauma stehen, es sind vielmehr Reize,
„die zeitlich mit dem Trauma assoziiert sind. Typische Beispiele hierfür sind externe Reize, die kurz vor oder während des traumatischen Ereignisses wahrgenommen wurden, [], ähnliche emotionale Zustände [] oder andere ähnliche interne Reize“ (Ehlers 1999: 16).
Diese Reize gelten für die Betroffenen rückwirkend als „Vorhersager“ des traumatischen Ereignisses, sodass sie insofern vermeintlich einen hohen Informationsgehalt aufweisen. Die Reize werden dann mit einer schweren Bedrohung des Selbst gekoppelt und können in der Folge intrusives Wiedererleben hervorrufen (vgl. Ehlers 1999: 17).
Als Beispiel für diese Reiz-Reaktion-Assoziation soll hier ein Auszug aus dem Bericht des oben bereits genannten Betroffenen F. verwendet werden:
„Besonders schwer fiel es mir, meine alte Laufstrecke in einem wunderschönen und dicht bewachsenen Hochwald zu laufen wie in alten Tagen. Immer, wenn ich an eine ganz bestimmte Stelle kam, oft schon viele Meter vorher, lief in mir genau dieser Film [die Szene des Anschlags, S.S.]“ (Betroffener F. 2009: 127).
An diesem Beispiel wird ersichtlich, dass eine klassische Konditionierung von Angst erfolgt ist: Nach dem Selbstmordanschlag hat sich der Betroffene F. davor gefürchtet an eine bestimmte Stelle seiner alten Laufstrecke (konditionierter Reiz) zu laufen, weil ihn diese an den Selbstmordanschlag erinnert (unkonditionierter Reiz). Es wurde also der initiale neutrale Reiz der bestimmten Stelle an den aversiven unkonditionierten Reiz der wiederkehrenden belastenden Erinnerung gekoppelt, sodass die bestimmte Stelle zum Trigger für die konditionierte Reaktion (Angstreaktion) wurde. Ausgehend von dieser konditionierten Angst hat der Betroffene F. Vermeidungsreaktionen entwickelt. „Diese werden durch die Verminderung der Angst aufgrund des Fehlens des konditionierten Reizes negativ verstärkt“ (Davison/Neale/Hautzinger 2007: 194).[12] Diese Verstärkung der Vermeidungsstrategie durch das kurzzeitige Ausbleiben der Angst ist dann als operante Konditionierung zu bezeichnen.
Wie am folgenden Bespiel ersichtlich werden soll, sind sich die Betroffenen allerdings nicht immer darüber bewusst, welche Auslöser die Assoziationen hervorrufen[13]: „Ohne jeglichen Grund fing ich an zu weinen und suchte nach Einflüssen, die mich dazu bewegten – es gab sie nicht“ (Betroffener F. 2009: 127). Der Betroffene zeigt hier Emotionen, die ohne für ihn ersichtlichen Grund auftreten, sodass anzunehmen ist, dass für ihn die Identifikation derjenigen Reize, die während des Traumas tatsächlich vorhanden waren, von der aktuellen Reizkonstellation erschwert ist (vgl. Ehlers 1999: 17). Dieser Vorgang der erschwerten Identifikation von Reizen wird als „Priming“ bezeichnet. Ehlers und Clark gehen dabei davon aus, dass bei der PTBS ein besonders starkes Priming für traumabezogene Reize vorliegt, was zur Folge hat, dass die die Intrusionen auslösende Reize besonders schnell wahrgenommen werden (vgl. Ehlers ebd.: 18).
Die Unfähigkeit, die traumatische Erfahrung willentlich zu erinnern, wird dann noch durch die Unfähigkeit, das Erlebte zu verbalisieren, verstärkt. Wie kommt es dazu? „Neurobiologische Untersuchungen an PTBS-Patienten zeigen verstärkte Aktivitäten der rechten Hemisphäre und des rechten Assoziationsbereiches des Kortex, wie es bei emotionaler Erregung typisch ist“ (Hausmann 2006: 120). Gleichzeitig ist in der linken Hemisphäre der Bereich vermindert aktiv, der u. a. Erlebnisse in kommunizierbare Sprache übersetzt. Werden diesen beiden Erkenntnisse zusammen geführt, so ergibt sich, dass „Menschen mit PTBS die verschiedenen Sinneseindrücke (visuell, auditiv, sensorisch, olfaktorisch etc.) emotional aufgeladen erleben, während ihre Fähigkeit, das Erlebte in Sprache zu fassen, reduziert ist“ (ebd.: 120). Die Betroffen sind dann in der Folge nicht dazu fähig ein persönliches Narrativ zu entwickeln, da sie ihre Erinnerungen nicht auf „normalem Weg“ abrufen können. Sie erleben stattdessen Erinnerungen als „Affektzustände oder in verschiedenen Sinnesmodalitäten“ (von Hinckeldey/Fischer 2002: 111).
Zusammenfassend kann also herausgestellt werden, dass das traumatische Ereignis im impliziten Gedächtnis übermäßig gut und gleichzeitig im expliziten Gedächtnis defizitär eingespeichert wird (vgl. Maercker/Rosner 2006: 13). Daher weist die Erinnerung keinen zeitlichen Kontext auf und kann auch nicht mit späteren Informationen verbunden werden. Das intrusive Wiedererleben wird als Resultat der Abspeicherung des Traumas in der impliziten Gedächtnisform erklärt, es kann daher auch durch verschiedene Reize leicht ausgelöst werden, zudem ist der semantische Abrufweg relativ schwach. Außerdem führen die ungenügende Elaboration des traumatischen Ereignisses im Gedächtnis und die ungenügende Verknüpfung mit dem autobiografischen Gedächtnis zusammen mit den Priming- und Konditionierungsprozessen zur leichten Auslösung von intrusivem Wiedererleben (Steil/Rosner 2009: 27). Der Unterschied zwischen traumatischen und nicht-traumatischen Erinnerungen ist dann also, dass es bei nicht-traumatischen Erinnerungen nicht zum Wiedererleben des Ereignisses in verschiedenen Sinnesmodalitäten kommt, dass es keine Alpträume oder Flashbacks im Bezug auf das Ereignis gibt und dass nicht versucht wird die Erinnerungen an das Ereignis zu unterdrücken (vgl. van der Kolk 1996: 279-302, zit. nach von Hinckeldey/Fischer 2002: 114) [Hervorhebung S.S.].
[...]
[1] Mit Angehörigen der Bundeswehr sollen im Folgenden die Soldaten gemeint sein, die ein oder mehrmals an einem Auslandseinsatz teilgenommen haben.
[2] In der vorliegenden Arbeit wird zur besseren Lesbarkeit lediglich das generische Maskulinum verwendet. Diese Formulierung schließt diskriminierungsfrei die weiblichen Beteiligten mit ein. In den Auslandseinsätzen der Bundeswehr gibt es einen Frauenanteil von fünf bis sechs Prozent. Allgemeine Aussagen über Einsatzsoldaten beziehen selbstredend auch die Frauen ein.
[3] Zu nennen sind die Einsätze in Bosnien-Herzegowina, DR Kongo, Kosovo, Afghanistan, Sudan, Georgien, an der Küste vor Somalia und am Horn von Afrika (vgl. Jaberg/Biehl/Mohrmann/Tomforde 2009: 14 f).
[4] Stand der Zahlen: 02.06.2010
[5] Asymmetrisch im Vergleich zu symmetrischen Kriegen wie dem Kalten Krieg („Gleichgewicht des Schreckens“) (vgl. Krech 2004: 9).
[6] Siehe dazu vertiefend: Shalev 2009: Traumatischer Stress, Körperreaktionen und psychische Störungen, S.27-47.
[7] Weitere Forschungsergebnisse sind zur Veröffentlichung angenommen, vier Arbeiten wurden bei Fachzeitschriften zur Diskussion eingereicht und für sechs Publikationen ist die Veröffentlichung für das Jahr 2010 geplant (vgl. Bundeswehr 2010).
[8] Gemeint ist ein von einer Traumatisierung Betroffener; im Folgenden für den besseren Lesefluss nur noch „Betroffener“.
[9] Die Autoren erklären die nach ihrer Ansicht für das PTBS charakteristische bidirektionale Symptomatik als einen neurobiologischen Anpassungsmechanismus auf extreme Belastungen: „Wenn die Sensibilisierung eines neurobiologischen Systems eine bestimmte Grenze erreicht, reagiert das System mit einer Art Gegensteuerung und beginnt zu oszillieren, um weitere Überlastung zu vermeiden“ (Hinckeldey/Fischer 2002: 108).
[10] „In Studien, die das Modell zusammenfassend untersuchten, wurden [] positive Belege gefunden, z.B., dass die zentralen Modellvariablen spezifisch nur für die PTBS und nicht gleichfalls bei Depressionen und Phobien Traumatisierter zu finden sind“ (Maercker 2009a: 45).
[11] Die Amygdala ist als „Einfallstor“ für aversive Reize, wie Angst oder Schrecken, zu verstehen (vgl. Maercker/Rosner 2006: 15).
[12] „Diese Ansicht [PTBS als Beispiel für die Zwei-Faktoren-Theorie der Angst, S.S.] wird zunehmend durch Befunde bestätigt [] ebenso die damit zusammenhängenden kognitiv-verhaltensorientierten Theorien, die den subjektiven Verlust an Kontrolle und Vorhersehbarkeit herausstellen“ (Davison/Neale/Hautzinger 2007: 194).
[13] Ehlers bezeichnet dies als „Emotion ohne Erinnerung“ (Ehlers 1999: 16).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842809734
- DOI
- 10.3239/9783842809734
- Dateigröße
- 586 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel – Sozialwesen, Soziale Arbeit
- Erscheinungsdatum
- 2011 (Januar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- trauma belastungsstörung resilienz vulnerabilität
- Produktsicherheit
- Diplom.de