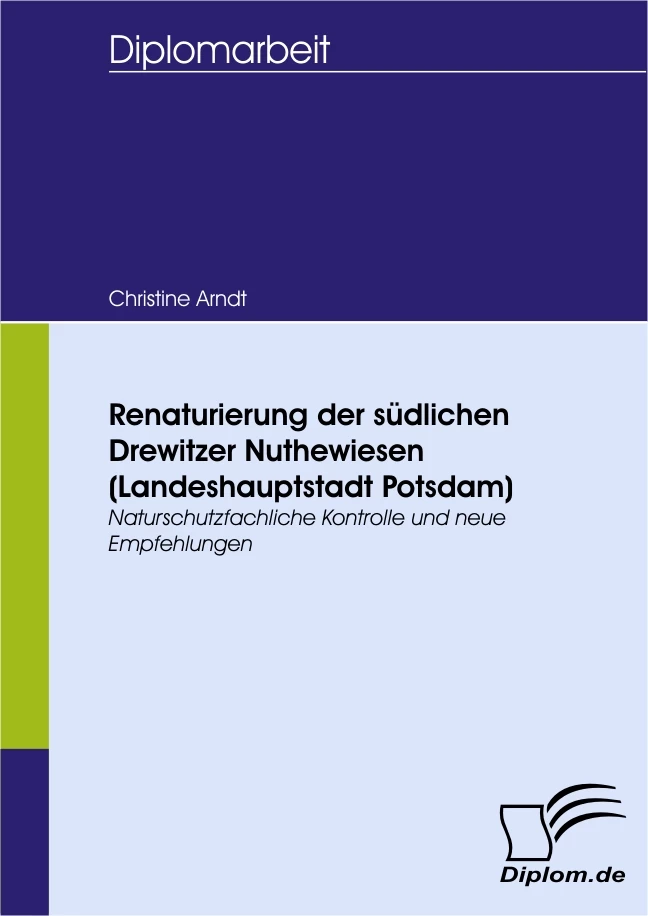Renaturierung der südlichen Drewitzer Nuthewiesen (Landeshauptstadt Potsdam)
Naturschutzfachliche Kontrolle und neue Empfehlungen
©2009
Diplomarbeit
90 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
1.1, Veranlassung:
Die Nuthe ist ein brandenburgischer Fluss, der bei Niedergörsdorf im Fläming entspringt. Sie gehört zum Einzugsgebiet der Havel, in welche sie nach etwa 65 km Fließstrecke inmitten der Landeshauptstadt Potsdam mündet. Ihr eigenes Einzugsgebiet nimmt eine Fläche von ca. 1.900 km² ein. Zwischen 1772 und 1934 wurde vor allem der Unterlauf der Nuthe in drei großen Meliorationsperioden zunächst begradigt, anschließend die noch vorhandenen Altarme abgetrennt und letztlich vertieft sowie deichähnlich verwallt. Dadurch hat sie heutzutage den Charakter eines Kanals. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden ihre Ufer zudem mit Pappelreihen bepflanzt, die größtenteils bis heute erhalten sind. Hinzu kommt, dass der mittlere Abfluss der Nuthe in den letzten zwei Jahrzehnten nochmals deutlich gesunken ist. Die Ursachen hierfür liegen vermutlich im fehlenden Abfluss aus den Rieselfeldern und in geringeren Niederschlägen.
Die Grundwasserstände in der Umgebung der Nuthe sind wiederum direkt von deren Wasserstand abhängig. Daher sind die Grundwasserflurabstände in den letzten Jahrzehnten deutlich größer geworden, was zu einer Austrocknung der Wiesen geführt hat. Da dies negative Folgen in vielen Bereichen nach sich zog, wurde beschlossen, einen Teil des Alten Nuthelaufes im Potsdamer Ortsteil Drewitz zu renaturieren. Unter einer Renaturierung versteht man hierbei die Überführung von ge- oder zerstörten Ökosystemen in einen naturnäheren Zustand. Die Hauptziele dieser Renaturierung waren die Wiederherstellung eines naturnahen Fließgewässers parallel zur kanalisierten Nuthe, die Anhebung der Grundwasserstände innerhalb der Wiesen und die Förderung der Nass- und Feuchtwiesen. Die Planungen zur Renaturierung wurden von der Euromedien Babelsberg GmbH in Auftrag gegeben, welche aufgrund von Eingriffen in der Medienstadt Babelsberg zu kompensierenden Ersatzmaßnahmen verpflichtet war. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgte in den Jahren 2003 bis 2005.
In der vorliegenden Diplomarbeit soll eine Einschätzung des Erfolges der Renaturierung vorgenommen werden. Dazu wird der Zustand der Drewitzer Nuthewiesen vor der Renaturierung, welcher vor allem durch das Ingenieurbüro Linder umfangreich erfasst wurde, mit der heutigen Situation verglichen. In Übereinstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde der Landeshauptstadt Potsdam (UNB) und dem Ingenieurbüro Linder wird das Untersuchungsgebiet weitgehend identisch mit dem […]
1.1, Veranlassung:
Die Nuthe ist ein brandenburgischer Fluss, der bei Niedergörsdorf im Fläming entspringt. Sie gehört zum Einzugsgebiet der Havel, in welche sie nach etwa 65 km Fließstrecke inmitten der Landeshauptstadt Potsdam mündet. Ihr eigenes Einzugsgebiet nimmt eine Fläche von ca. 1.900 km² ein. Zwischen 1772 und 1934 wurde vor allem der Unterlauf der Nuthe in drei großen Meliorationsperioden zunächst begradigt, anschließend die noch vorhandenen Altarme abgetrennt und letztlich vertieft sowie deichähnlich verwallt. Dadurch hat sie heutzutage den Charakter eines Kanals. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden ihre Ufer zudem mit Pappelreihen bepflanzt, die größtenteils bis heute erhalten sind. Hinzu kommt, dass der mittlere Abfluss der Nuthe in den letzten zwei Jahrzehnten nochmals deutlich gesunken ist. Die Ursachen hierfür liegen vermutlich im fehlenden Abfluss aus den Rieselfeldern und in geringeren Niederschlägen.
Die Grundwasserstände in der Umgebung der Nuthe sind wiederum direkt von deren Wasserstand abhängig. Daher sind die Grundwasserflurabstände in den letzten Jahrzehnten deutlich größer geworden, was zu einer Austrocknung der Wiesen geführt hat. Da dies negative Folgen in vielen Bereichen nach sich zog, wurde beschlossen, einen Teil des Alten Nuthelaufes im Potsdamer Ortsteil Drewitz zu renaturieren. Unter einer Renaturierung versteht man hierbei die Überführung von ge- oder zerstörten Ökosystemen in einen naturnäheren Zustand. Die Hauptziele dieser Renaturierung waren die Wiederherstellung eines naturnahen Fließgewässers parallel zur kanalisierten Nuthe, die Anhebung der Grundwasserstände innerhalb der Wiesen und die Förderung der Nass- und Feuchtwiesen. Die Planungen zur Renaturierung wurden von der Euromedien Babelsberg GmbH in Auftrag gegeben, welche aufgrund von Eingriffen in der Medienstadt Babelsberg zu kompensierenden Ersatzmaßnahmen verpflichtet war. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgte in den Jahren 2003 bis 2005.
In der vorliegenden Diplomarbeit soll eine Einschätzung des Erfolges der Renaturierung vorgenommen werden. Dazu wird der Zustand der Drewitzer Nuthewiesen vor der Renaturierung, welcher vor allem durch das Ingenieurbüro Linder umfangreich erfasst wurde, mit der heutigen Situation verglichen. In Übereinstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde der Landeshauptstadt Potsdam (UNB) und dem Ingenieurbüro Linder wird das Untersuchungsgebiet weitgehend identisch mit dem […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Christine Arndt
Renaturierung der südlichen Drewitzer Nuthewiesen (Landeshauptstadt Potsdam)
Naturschutzfachliche Kontrolle und neue Empfehlungen
ISBN: 978-3-8428-0863-8
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2011
Zugl. Universität Potsdam, Potsdam, Deutschland, Diplomarbeit, 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2011
ii
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ... ii
Verzeichnisse der Abbildungen und Tabellen ... iii
Abkürzungen ... iv
1
Einleitung ... 1
1.1
Veranlassung ... 1
1.2
Das Untersuchungsgebiet ... 2
1.3
Renaturierungsziele ... 11
1.4
Voruntersuchungen ... 13
1.4.1
Flora 1997 ... 13
1.4.2
Biotoptypen 1999 ... 14
1.5
Monitoring auf Dauerflächen 2005-2009 ... 16
1.6
Aufgabenstellung ... 17
2
Erfolgskontrolle der Nuthe-Renaturierung ... 18
2.1
Methodik ... 18
2.1.1
Naturschutzfachliche Erfolgskontrolle ... 18
2.1.2
Biotopkartierung in Brandenburg ... 19
2.1.3
Kartierung 2009 ... 21
2.2
Ergebnisse ... 24
2.2.1
Flora 2009 ... 24
2.2.2
Biotoptypen 2009 ... 25
2.2.3
Vergleich mit Voruntersuchungen und Monitoring ... 28
2.3
Bewertung ... 32
2.4
Teilzusammenfassung ... 35
3
Entwicklungskonzept ... 36
3.1
Methodik ... 36
3.2
Die nördlichen Drewitzer Nuthewiesen ... 37
3.3
Szenarien der Gebietsentwicklung ... 39
3.3.1
völlige Nutzungsaufgabe... 39
3.3.2
Extensivierung der Nutzung... 41
3.3.3
Beibehaltung der jetzigen Nutzung ... 43
3.3.4
Intensivierung der Nutzung ... 43
3.4
Empfehlungen zur weiteren Gebietsbehandlung ... 45
3.4.1
Leitbilder und Entwicklungsziele ... 45
3.4.2
Aktuelle Empfehlungen ... 49
4
Zusammenfassung ... 57
5
Danksagung
... 58
6
Literaturverzeichnis ... 59
iii
Verzeichnisse der Abbildungen und Tabellen
Abbildungen
Abbildung 1: Lage des Untersuchungsgebietes (rot) und der Erweiterung (blau) ... 2
Abbildung 2: Grundwasser-Messstelle 3644 1981 (Wohngebiet Drewitz) ... 5
Abbildung 3: Übersichtskarte der Gewässer und Straßen ... 6
Abbildung 4: Fischtreppe an der Mündung des Silbergrabens in die Nuthe ... 7
Abbildung 5: Ausschnitt des FFH-Gebietes ,,Nuthe, Hammerfließ, Eiserbach" (grün)
sowie die Trinkwasserschutzzonen I (dunkelblau), II (mittelblau) und III
(hellblau) ... 10
Abbildung 6: Teich südlich des Forum-Geländes im Juni 2009 ... 33
Abbildung 7: abgestorbener Baum am Verteilergraben West ... 52
Tabellen
Tabelle 1: Zusammenfassung der Florenliste 1997 ... 13
Tabelle 2: Biotoptypen 1999 ... 15
Tabelle 3: Hauptbiotoptypen 2009 ... 25
Tabelle 4: Begleitbiotoptypen 2009 ... 26
Tabelle 5: Gegenüberstellung der Biotoptypen von 1999 und 2009 ... 30
iv
Abkürzungen
BbgNatSchG
Brandenburgisches Naturschutzgesetz
BbgWG
Brandenburgisches Wassergesetz
BNatSchG
Bundesnaturschutzgesetz
et al.
und andere
FFH
Flora-Fauna-Habitat
LBGR
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg
LGB
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
LUA
Landesumweltamt
MLUR
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung
MLUV
Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz
MUNR
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
Renaturierung der Nuthewiesen
1
1
Einleitung
1.1
Veranlassung
Die Nuthe ist ein brandenburgischer Fluss, der bei Niedergörsdorf im Fläming entspringt. Sie
gehört zum Einzugsgebiet der Havel, in welche sie nach etwa 65 km Fließstrecke inmitten der
Landeshauptstadt Potsdam mündet. Ihr eigenes Einzugsgebiet nimmt eine Fläche von ca.
1.900 km² ein. Zwischen 1772 und 1934 wurde vor allem der Unterlauf der Nuthe in drei gro-
ßen Meliorationsperioden zunächst begradigt, anschließend die noch vorhandenen Altarme
abgetrennt und letztlich vertieft sowie deichähnlich verwallt. Dadurch hat sie heutzutage den
Charakter eines Kanals. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden ihre Ufer zudem mit
Pappelreihen bepflanzt, die größtenteils bis heute erhalten sind. Hinzu kommt, dass der mittle-
re Abfluss der Nuthe in den letzten zwei Jahrzehnten nochmals deutlich gesunken ist. Die Ur-
sachen hierfür liegen vermutlich im fehlenden Abfluss aus den Rieselfeldern und in geringe-
ren Niederschlägen (L
INDER
2005).
Die Grundwasserstände in der Umgebung der Nuthe sind wiederum direkt von deren Wasser-
stand abhängig. Daher sind die Grundwasserflurabstände in den letzten Jahrzehnten deutlich
größer geworden, was zu einer Austrocknung der Wiesen geführt hat. Da dies negative Folgen
in vielen Bereichen nach sich zog, wurde beschlossen, einen Teil des Alten Nuthelaufes im
Potsdamer Ortsteil Drewitz zu renaturieren. Unter einer Renaturierung versteht man hierbei
die Überführung von ge- oder zerstörten Ökosystemen in einen naturnäheren Zustand (P
FA-
DENHAUER
&
H
EINZ
2004). Die Hauptziele dieser Renaturierung waren die Wiederherstellung
eines naturnahen Fließgewässers parallel zur kanalisierten Nuthe, die Anhebung der Grund-
wasserstände innerhalb der Wiesen und die Förderung der Nass- und Feuchtwiesen (L
INDER
2005). Die Planungen zur Renaturierung wurden von der Euromedien Babelsberg GmbH in
Auftrag gegeben, welche aufgrund von Eingriffen in der Medienstadt Babelsberg zu kompen-
sierenden Ersatzmaßnahmen verpflichtet war. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgte in den
Jahren 2003 bis 2005.
In der vorliegenden Diplomarbeit soll eine Einschätzung des Erfolges der Renaturierung vor-
genommen werden. Dazu wird der Zustand der Drewitzer Nuthewiesen vor der Renaturie-
rung, welcher vor allem durch das Ingenieurbüro Linder umfangreich erfasst wurde, mit der
heutigen Situation verglichen. In Übereinstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde der
Landeshauptstadt Potsdam (UNB) und dem Ingenieurbüro Linder wird das Untersuchungsge-
biet weitgehend identisch mit dem Renaturierungsgebiet sein.
Renaturierung der Nuthewiesen
2
1.2
Das Untersuchungsgebiet
Lage und Spezifik
Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind die Drewitzer Nuthewiesen, welche zur naturräum-
lichen Großeinheit der Mittelbrandenburgischen Platten und Niederungen, speziell zur Haupt-
einheit der Nuthe-Notte-Niederung gehören, die sich vom Baruther Urstromtal im Süden bis
zum Brandenburg-Potsdamer Havelgebiet im Norden erstreckt (S
CHOLZ
1962). Sie befinden
sich im Süden der Stadt Potsdam zwischen dem Potsdamer Ortsteil Drewitz und dem Gewer-
begebiet Potsdam-Süd bzw. dem Ortsteil Bergholz-Rehbrücke der Gemeinde Nuthetal. Zwi-
schen den Ortsteilen verläuft eine Straße der Nuthedamm welcher die Wiesen in einen
nördlichen und einen südlichen Bereich zerteilt (siehe Abbildung 1).
Abbildung 1: Lage des Untersuchungsgebietes (rot) und der Erweiterung (blau)
1
1
Digitale Topographische Karte 1 : 10.000 (DTK 10), herausgegeben von der LGB (www.geobasis-bb.de)
Renaturierung der Nuthewiesen
3
Die südlichen Drewitzer Nuthewiesen stellen zusammen mit einem Teil der südlich angren-
zenden Dürrewiesen, welche bereits zur Gemeinde Nuthetal des Landkreises Potsdam-
Mittelmark zählen, das Projektgebiet der Renaturierung und somit auch das Hauptunter-
suchungsgebiet dar. Dieses wird im Westen von der kanalisierten Nuthe, im Osten durch den
Ortsteil Drewitz sowie einen Wirtschaftsweg und im Süden durch eine Trinkwasserleitung
quer durch die Wiesen begrenzt. Etwa in der Mitte der östlichen Begrenzung befinden sich
große Hallen, die zu DDR-Zeiten als Lager der ,,Forum-Handelsgesellschaft"
2
errichtet wur-
den und heute von der Getränke Lehmann GmbH genutzt werden (J
OPKE
2004). Die nördli-
chen Drewitzer Nuthewiesen tragen in dieser Arbeit hingegen die Bezeichnung ,,Erweiterung"
und werden erst für die Empfehlungen zur weiteren Gebietsbehandlung in Kapitel 3 näher be-
trachtet.
Geologie und Böden
Die Nutheniederung hat ihr heutiges Erscheinungsbild vor allem den Vergletscherungen im
Pleistozän und den anschließenden Prozessen im Holozän zu verdanken. Insbesondere das
Brandenburger Stadium der größte Eisvorstoß während der Weichselkaltzeit hat einen
entscheidenden Beitrag dazu geleistet. Nach dem Rückzug des Eises wurde das Schmelzwas-
ser zunächst über das Baruther Urstromtal in Richtung Nordwesten abgeführt, wobei die heu-
tige Nutheniederung einen Abzweig Richtung Norden darstellt. Demzufolge besteht die Nie-
derung hauptsächlich aus glazifluvialen Sanden, die auf den Geschiebesanden und -lehmen
der vorangegangenen Kaltzeiten abgelagert wurden (S
CHOLZ
1962). Im Holozän begannen
schließlich vernässte Mulden und Altgewässer zu verlanden, woraufhin sich eine mehr oder
weniger dicke Mudde-Schicht absetzte, die in diesem Fall wiederum Voraussetzung für die
Torfbildung war (L
INDER
2005).
Heute sind im Untersuchungsgebiet drei typische Bodenformen an der Oberfläche zu finden
(L
INDER
2001):
-
Quellfähiger Torf, mit Mudde unterlagert
-
Stark zersetzter Torf, größtenteils mit Mudde unterlagert
-
Überwiegend mineralischer Boden
2
im Folgenden als ,,Forum-Gelände" bezeichnet
Renaturierung der Nuthewiesen
4
Da die Mudde meist mehrere Dezimeter mächtig und kaum wasserdurchlässig ist, wirkt sie
wie eine Sperrschicht zwischen den Torfen und dem darunterliegenden Sand. Weist die Mud-
de-Schicht jedoch Lücken auf, ist die Wasserdurchlässigkeit deutlich erhöht, was zu einer
verstärkten Austrocknung der Torfe beiträgt.
Bei den überwiegend mineralischen Böden handelt es sich entweder um höhere Stellen inner-
halb der Moorböden, bei denen aufgrund des höheren Grundwasserflurabstandes der Torf
komplett zersetzt ist, oder um Talsandinseln, die gar nicht erst mit Torfen überlagert waren.
Letztere kann man auf der Bodenschätzungskarte
3
als kleine Flecken innerhalb der ausge-
dehnten Moorböden erkennen. Das einstige Dorf Drewitz, welches heute zur Landeshaupt-
stadt Potsdam gehört, befindet sich ebenfalls auf einer solchen Talsandinsel.
Hydrologie
Die kanalisierte Nuthe ist ein Landesgewässer I. Ordnung ist und wird somit vom Landesum-
weltamt Brandenburg verwaltet (M
ELIOR
1996). Ihre Wasserstände liegen für gewöhnlich
deutlich tiefer als die Grundwasserstände auf den angrenzenden Wiesen, weshalb die Nuthe
über den gesamten Verlauf als Vorfluter des Grundwassers fungiert. Daher existiert östlich
der Nuthe ein Grundwasserstrom in west- bis nordwestliche Richtung (L
INDER
2005). Zudem
besteht durch die lückige Mudde-Schicht eine hydraulische Verbindung zwischen dem
Moorwasser und dem Grundwasserleiter (K
RAFT
2002).
Am südöstlichen Rand des Untersuchungsgebietes befinden sich mehrere Brunnen des Was-
serwerkes Rehbrücke, welche für die Trinkwassergewinnung genutzt werden. Aufgrund der
dortigen Grundwasserförderung ist im Laufe der Zeit ein Grundwasser-Absenkungstrichter
entstanden, der den beschriebenen Grundwasserstrom beeinträchtigt und in diesem Bereich
über 100 m in das Untersuchungsgebiet hineinreicht (GCI 1997). Sollte die Fördermenge des
Grundwassers erhöht werden, ist trotz des erhofften Grundwasseranstiegs durch die Renatu-
rierung mit einer weiteren Ausdehnung dieses Trichters zu rechnen.
Um die Auswirkungen der Renaturierung auf den Grundwasserstand zu untersuchen, wurde
eine Auswertung der Grundwasserpegel in der Umgebung des Untersuchungsgebietes in Be-
tracht gezogen (Messstellen 36441946, 36441950, 36441951 und 36449181). Es stellte sich
jedoch heraus, dass der Abstand von mehr als einem Kilometer zwischen den Messstellen und
dem Projektgebiet zu groß ist, um dort eine Wirkung zu erkennen. Diese Messstellen sind le-
3
Bodenschätzungskarte 1 : 25.000, herausgegeben vom LBGR
Renaturierung der Nuthewiesen
5
diglich dazu geeignet, die erheblichen Schwankungen des Grundwasserspiegels im Jahresver-
lauf zu veranschaulichen (siehe Abbildung 2). Aussagen über die aktuelle Grundwasserdyna-
mik und vor allem über die Grundwasserflurabstände sind somit im Rahmen dieser Arbeit
nicht möglich. Ausführliche Beschreibungen dieser Faktoren aus der Zeit vor der Renaturie-
rung findet man in L
INDER
(2001) und in L
INDER
(2005). Dort wurde unter anderem festge-
stellt, dass der Grundwasserspiegel im Jahresverlauf Schwankungen von teilweise mehr als
einem Meter aufweist.
Abbildung 2: Grundwasser-Messstelle 3644 1981 (Wohngebiet Drewitz)
4
Im Hinblick auf die Oberflächengewässer gibt es im Gebiet viele Fließgewässer unterschied-
licher Größe und ein paar perennierende
5
Stillgewässer, zu denen auch ein kleiner Rest des
Nuthealtarms gehört (siehe Abbildung 3). Das wohl markanteste Fließgewässer ist die kanali-
sierte Nuthe, welche die westliche Grenze des Gebietes darstellt. Auf der 5-stufigen Skala des
Fließgewässerschutzsystems wurde ihr lediglich die Stufe 4 zugewiesen, wobei nur Gewässer
mit den Schutzwertstufen 1 bis 3 als sensibel gelten (LUA 1998a). In die Nuthe mündet im
Süden ein schmales Nebenfließ (Stöcker). Kurz vor dessen Mündung zweigt seit der Renatu-
rierung ein neuer Bach Richtung Nordosten ab, der aufgrund seines Anschlusses an die ,,Alte
Nuthe Süd" als ,,Verbindungsgraben Süd" bezeichnet wird. Zwischendurch kreuzt er den
,,Graben B", einen Bestandteil des östlich davon gelegenen ,,Dürrewiesengrabensystems". Der
4
Quelle: LUA (Referat RW5)
5
,,Perennierend" bedeutet in diesem Zusammenhang ,,ständig wasserführend".
Renaturierung der Nuthewiesen
6
Dürrewiesengraben selbst, von dem nach Osten hin vier Stichgräben abzweigen, wurde durch
den Verbindungsgraben Süd-Ost an das Nordende der Alten Nuthe Süd angeschlossen. Kurz
hinter diesem Zusammenfluss zweigt wiederum der Verteilergraben West in Richtung Westen
ab, der ebenfalls einen sommertrockenen Stichgraben besitzt und erst hinter der Umgehungs-
straße wieder in den Silbergraben mündet.
Abbildung 3: Übersichtskarte der Gewässer und Straßen
Parallel dazu verläuft der Verbindungsgraben Ost, der als Ersatz für den durch das Forum-
Gelände verfüllten und überbauten Abschnitt der Alten Nuthe geschaffen wurde (M
ELIOR
1996), bis zur Alten Nuthe Nord, wobei ein Großteil des Wassers vorher in den Silbergraben
geleitet wird. Erst nach einer zweimaligen Aufteilung und erneuten Zusammenführung des
Silbergrabens besteht wieder eine Verbindung zur Alten Nuthe Nord, die im Sommer aller-
dings trocken fällt. Ein ebenfalls sommertrockener Graben führt von der Alten Nuthe Nord
unter dem Nuthedamm hindurch zu den Gräben der Nördlichen Drewitzer Nuthewiesen. Die
Alte Nuthe Nord und der Silbergraben verbinden sich schließlich kurz vor dem Nuthedamm
zu einem Graben, der über eine Fischtreppe aus Feldsteinen in die kanalisierte Nuthe mündet
(siehe Abbildung 4). Außerdem befinden sich im Verlauf des Gewässers mehrere Sohl-
schwellen.
Renaturierung der Nuthewiesen
7
Abbildung 4: Fischtreppe an der Mündung des Silbergrabens in die Nuthe
Klima
Potsdam gehört mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 8,7 °C und einem mittleren Jah-
resniederschlag von etwa 590 mm (Deutscher Wetterdienst, jeweils Reihe 1961/90)
6
zu einem
Übergangbereich, der sowohl von ozeanischem als auch von kontinentalem Klima beeinflusst
wird. Anhand der Klimaklassifikation nach Köppen (in M
ALBERG
2007) lässt sich die Stadt
und somit auch das Untersuchungsgebiet in die Kategorie Cfb einstufen. Darunter versteht
man ein warmgemäßigtes Klima ohne Trockenzeit und mit warmen, aber nicht heißen Som-
mern.
Kleinklimatisch betrachtet ergeben sich jedoch leichte Unterschiede zwischen dem Stadt-
gebiet und der Nutheniederung. So ist in Niederungen in der Regel die Verdunstung deutlich
6
www.dwd.de
Renaturierung der Nuthewiesen
8
erhöht, da der Abstand zum Grundwasser geringer ist. In der Nutheniederung dürfte dieser
Abstand durch die Renaturierung auch im Sommer nur noch wenige Dezimeter betragen, so
dass insbesondere in der warmen Jahreszeit mehr Wasser verdunstet, als Niederschlag fällt.
Das Gebiet kann somit als hydrologisches Zehrgebiet mit negativer klimatischer Wasserbilanz
angesehen werden (L
INDER
2005), was wiederum Auswirkungen auf die Grundwasserneubil-
dung hat.
Letztendlich stellen die Drewitzer Nuthewiesen ein Kaltluftentstehungsgebiet dar. Diese
Funktion wird durch mehr offene Wasserflächen und einen höheren Grundwasserstand be-
günstigt. Je nach Ausdehnung bzw. Ausrichtung entwickeln sich solche Gebiete zu Frischluft-
schneisen, die eine große stadtklimatische Bedeutung haben. Die Nutheniederung wird jedoch
von einigen Verkehrstrassen gekreuzt, die wie Barrieren wirken und somit den Luftstrom un-
terbrechen. Die Siedlungsgebiete in der Nähe der Niederung profitieren trotzdem von den
günstigen klimatischen Bedingungen.
Flora und Fauna
Die heutige Nutheniederung im Bereich nördlich von Saarmund wird hauptsächlich durch
große Grünlandflächen gekennzeichnet, die durch anthropogene Nutzung entstanden. Im Ge-
gensatz zur potentiellen natürlichen Vegetation im Untersuchungsgebiet wäre das
,,Schwarzerlenniederungswald im Komplex mit Traubenkirschen-Eschenwald" (H
OFMANN
&
P
OMMER
2005) sind Bäume nur in kleinen Gruppen oder als Saum entlang der Gewässer
vorhanden.
Im eigentlichen Untersuchungsgebiet kommen viele verschiedene Biotope vor, in denen eine
große Zahl von Pflanzenarten leben. Eine detaillierte Beschreibung der aktuellen Biotope fin-
det man in den Anlagen 4 und 5. Aufgrund der hohen Biodiversität bieten diese Flächen auch
Lebensraum für zahlreiche Tierarten. Eine Erfassung der Tierwelt erfolgte im Rahmen der
vorliegenden Arbeit zwar nicht, trotzdem konnten einige besonders interessante Arten be-
obachtet werden. Eine dieser Arten ist der Eisvogel (Alcedo atthis), der 2009 zum Vogel des
Jahres gekürt wurde und als Indikator für gesunde Gewässer gilt
7
. Desweiteren lebt seit eini-
gen Jahren wieder eine Biber-Familie an der Nuthe (S
ELL
2009), deren Revier sich bis ins Un-
tersuchungsgebiet erstrecken könnte.
7
http://www.nabu.de/aktionenundprojekte/vogeldesjahres/2009-eisvogel/10120.html
Renaturierung der Nuthewiesen
9
Nutzung
Der Großteil der südlichen Drewitzer Nuthewiesen wird zurzeit von der agro Saarmund e.G.
8
als Mähwiese oder Weide genutzt. Die Beweidung erfolgt dabei in Form der Mutterkuhhal-
tung im Umtriebsverfahren, d.h. die gesamte Rinder-Herde wird nach einer relativ kurzen
Zeitspanne (bis zu mehreren Wochen) auf eine andere Weide umgesetzt. Eine Düngung er-
folgt laut Aussage von Herrn Naujoks (Vorstandsvorsitzender der agro Saarmund e.G.) nicht,
allerdings wird bei Beweidung Heu zugefüttert. Die Wasserversorgung der Tiere wird über
Rammfilter mit angeschlossenen Viehtränken sichergestellt. Diese Filter werden bis zu 6 m
tief in den Boden gebohrt und erst umgesetzt, wenn die Wasserzufuhr versiegt (N
AUJOKS
,
pers. Mittelung)
Den Südwesten nutzt die Familie Killat aus Bergholz-Rehbrücke in ähnlicher Form. Das
heißt, auf Düngung wird zwar laut Aussage von Herrn Killat verzichtet, nicht aber die Zu-
fütterung von Heu. Allerdings stehen die Rinder hier das ganze Jahr über auf der gleichen
Weide, was man als ,,Dauerbeweidung" bezeichnet. Hinzu kommt eine Beweidung durch
Pferde entlang der kanalisierten Nuthe zwischen der Stöcker und dem Gelände des ehemali-
gen ,,Biergartens zur Burgklause".
Weitere Nutzungen bestehen durch das Wasserwerk Rehbrücke (siehe Abschnitt ,,Hydrolo-
gie" in diesem Kapitel) und die Anwohner aus den benachbarten Wohngebieten, die hier
hauptsächlich ihre Hunde ausführen. Zudem wird das Gebiet nach wie vor von einer Hoch-
spannungsleitung durchquert. Die oberirdischen Versorgungsleitungen zum Forum-Gelände
wurden bereits entfernt oder verlaufen nur noch unterirdisch, was zu einer Aufwertung des
Landschaftsbildes beiträgt.
Schutzgebiete
Das gesamte Untersuchungsgebiet und dessen Erweiterung sind Bestandteile des Land-
schaftsschutzgebietes ,,Nuthetal-Beelitzer Sander" und somit gesetzlich geschützt. Das
Schutzgebiet hat eine Gesamtgröße von 41.671 ha und erstreckt sich vom Fläming im Süden
bis zur Mündung der Nuthe in die Havel im Norden.
Desweiteren gehören Teile des Gebietes zum FFH-Gebiet ,,Nuthe, Hammerfließ, Eiserbach",
welches zwar im Jahr 2004 nach Brüssel gemeldet, aber bisher noch nicht bestätigt wurde
8
http://freenet-homepage.de/agro-saarmund/
Renaturierung der Nuthewiesen
10
(Landesumweltamt Brandenburg, Schutzgebietskataster). Welche Gebietsteile das sind, wird
aus Abbildung 5 ersichtlich. Das FFH-Gebiet hat eine Gesamtgröße von 815 ha
9
, wovon etwa
33 ha im eigentlichen Untersuchungsgebiet liegen (entspricht einem Anteil am Unter-
suchungsgebiet von knapp 36 %) und weitere 19 ha zur Erweiterung gehören.
Zudem wurde um die Brunnen des Wasserwerkes Rehbrücke ein Trinkwasserschutzgebiet mit
drei Schutzzonen ausgewiesen, die ebenfalls in der Abbildung 5 dargestellt sind. Die Schutz-
zone I, in der jegliche Nutzung untersagt ist, beschränkt sich auf wenige Meter rund um die
einzelnen Brunnen und liegt somit nicht im Untersuchungsgebiet. In der Schutzzone II ist
hingegen eine extensive Nutzung möglich, wobei jedoch keine Verunreinigungen in das
Grundwasser gelangen dürfen. Die Schutzzone II umfasst maximal das gesamte Einzugsge-
biet der Trinkwasserbrunnen.
Abbildung 5: Ausschnitt des FFH-Gebietes ,,Nuthe, Hammerfließ, Eiserbach" (grün) sowie
die Trinkwasserschutzzonen I (dunkelblau), II (mittelblau) und III (hellblau)
10
9
laut Steckbrief der Natura 2000 Gebiete unter www.bfn.de
10
Schutzgebietsinformation des LUA (http://luaplims01.brandenburg.de/Naturschutz_www/viewer.htm),
DTK 10 der LGB (www.geobasis-bb.de)
Renaturierung der Nuthewiesen
11
1.3
Renaturierungsziele
11
Eine Renaturierung ist nur dann sinnvoll, wenn sie nicht nur die Wiederansiedlung oder Stabi-
lisierung einzelner Arten zum Ziel hat, sondern der gesamten Lebensgemeinschaft zugute
kommt (P
FADENHAUER
&
H
EINZ
2004). Demzufolge lassen sich auch für die Nuthe-
Renaturierung mehrere Teilziele formulieren, die größtenteils aufeinander aufbauen und im
Folgenden kurz erklärt werden.
Wiederherstellung der ,,Alten Nuthe" als Fließgewässer
Neben der kanalisierten Nuthe existierten noch immer Reste des Nuthe-Altlaufes, der zu ei-
nem 2,5 km langen naturnahen Nebenlauf gestaltet werden sollte. Dazu mussten die vorhan-
denen Gewässer entschlammt und einige neue Gräben angelegt werden, wobei die vorhande-
nen Gräben in das System mit eingebunden werden sollten. Der Wasserstand dieses neuen
Fließes soll etwa 1 m über dem der Nuthe liegen, um es von den starken Schwankungen in der
Nuthe zu entkoppeln. Dies wird dadurch ermöglicht, dass das neue Fließgewässer nicht direkt
von der Nuthe, sondern von der Stöcker gespeist wird. Die Stöcker zweigt nämlich bereits
oberhalb von zwei Nuthe-Wehren von dieser ab und ist außerdem weniger stark reguliert, so
dass sie im bzw. am Untersuchungsgebiet einen deutlich höheren Wasserstand als die kanali-
sierte Nuthe führen kann.
Desweiteren muss die Fließgeschwindigkeit des neuen Gewässers groß genug sein, um einer-
seits seiner Verschlammung vorzubeugen und andererseits die Gewässerfauna zu lenken, wel-
che sich bei ihren Wanderungen an der Strömung orientiert (Z
AHN
2008).
Anhebung des Grundwasserstandes innerhalb der Nuthewiesen
Der Grundwasserflurabstand sollte durch die Renaturierung ganzjährig nicht größer als 40 cm
sein, um die Niedermoorböden vor der Austrocknung und somit der Zersetzung weitgehend
zu bewahren. Dies ist nur möglich, indem man den Grundwasserstrom in Richtung Nuthe
stoppt oder zumindest verlangsamt, was durch den höheren Wasserstand der vorgelagerten
Fließe gegenüber der Nuthe erreicht werden sollte.
11
M
ELIOR
1996, L
INDER
2001 und L
INDER
2005
Renaturierung der Nuthewiesen
12
Eindämmung der Zersetzungsprozesse der Niedermoorböden
Die typischen Böden der Niedermoore sind in erster Linie Torfe, die bei Austrocknung zer-
setzt werden. Zu den negativen Folgen gehören der Austrag von organischen Zersetzungspro-
dukten ins Grund- und Oberflächenwasser bzw. deren Anreicherung in den Böden und eine
unerwünschte Umwandlung der Vegetation aufgrund der verschlechterten Bodeneigenschaf-
ten. Dieser Vorgang ist nur vollständig aufzuhalten, wenn das Gebiet ganzjährig mit Wasser
überstaut wird und somit keine Luft in den Boden gelangen kann. Da die Wiesen in diesem
Fall kaum noch wirtschaftlich nutzbar wären, wurde als Kompromiss der oben genannte ma-
ximale Grundwasserflurabstand festgelegt, bei dem die Nutzungen nicht beeinträchtigt wären
und die Torfzersetzung trotzdem auf ein sehr niedriges Niveau beschränkt wird. Eine Über-
stauung der Wiesen im Winter ist allerdings aus ökologischer Sicht ausdrücklich erwünscht.
Förderung der Biotop-und Artenvielfalt
Neben der Schaffung eines Fließgewässer-Biotopverbundes sollte die Renaturierung auch zu
einer Weiterentwicklung und Ausbreitung der Nass- und Feuchtwiesen beitragen. Deswei-
teren sollten die Fließ- und Stillgewässerbiotope gefördert und der Schutz von seltenen oder
gefährdeten Arten durch Gewässerrandstreifen gewährleistet werden. Da breite Randstreifen
in der heutigen Agrarlandschaft aber in der Regel kaum möglich sind, sollten zusätzlich 12
Refugialflächen größerer Ausdehnung eingerichtet werden, die als Biotopschutzflächen bzw.
aufgrund ihrer Anordnung in regelmäßigen Abständen als Trittsteinbiotope fungieren. Ein be-
sonderes Augenmerk lag zudem auf dem Schutz und der Förderung von FFH-
Lebensraumtypen.
Regenerierung des Landschaftswasserhaushaltes
Der Erhalt der Niedermoorböden ist auch deshalb wichtig, weil diese bei einem Wasserüber-
schuss, zum Beispiel durch Überschwemmungen, und durch ihre Quellfähigkeit wie ein
Schwamm wirken und das Wasser anschließend nur langsam abgeben. Sie sind somit zur
Verbesserung des Wasserrückhaltes enorm wichtig.
Nach Umsetzung der Maßnahmen sollte außerdem ein Monitoring durchgeführt werden, für
das eine vorläufige Gesamtlaufzeit von 10 Jahren angesetzt wurde. Dadurch sollte eine Ein-
schätzung über die Auswirkungen dieser Maßnahmen ermöglicht werden.
Renaturierung der Nuthewiesen
13
1.4
Voruntersuchungen
Schon vor der Renaturierung wurde das Projektgebiet intensiv auf seine abiotischen und
biotischen Parameter hin untersucht. Bereits in der ersten Hälfte der 1990er Jahre entstand ein
Gutachten zu den Potsdamer Nuthewiesen, an dem viele Sachverständiger des Naturschutz-
bundes (NABU) mitgewirkt haben (K
ÜHLING
, pers. Mitteilung). Desweiteren erfolgte in den
Jahren 1995 bis 1999 eine Erfassung der Vegetation und Biotoptypen durch das Ingenieur-
büro Linder. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden im Folgenden zusammengefasst
(L
INDER
2000 und L
INDER
2001).
1.4.1
Flora 1997
Im Zuge der floristischen Erhebung in den Jahren 1995-1997 wurden durch das Ingenieurbüro
Linder zunächst Listen der Farn- und Blütenpflanzen erstellt. Dazu wurde das 87,2 ha große
Untersuchungsgebiet in 9 Teilflächen untergliedert, auf denen die Häufigkeit der jeweils vor-
kommenden Pflanzen anhand einer offensichtlich selbst entworfenen 5-stufigen Skala ge-
schätzt wurde: 1 = sehr selten, 2 = selten, 3 = zerstreut, 4 = verbreitet, 5 = gemein. Die so er-
haltenen Einzellisten wurden anschließend zu einer Gesamtartenliste zusammengestellt, wo-
bei die Gliederung in die Teilflächen erhalten blieb. Außerdem beinhaltet diese Gesamtarten-
liste eine Aussage über den Gefährdungsgrad der jeweiligen Pflanzen laut der Roten Liste von
Brandenburg (B
ENKERT
&
K
LEMM
1993).
Tabelle 1: Zusammenfassung der Florenliste 1997
(Quelle: L
INDER
2000)
Bezeichnung der Teilfläche
Artenzahl
Zahl der gefähr-
deten Arten
1: Dürrewiesengrabensystem, Graben ,,B"
162
16
2: Silbergraben
124
11
3: Verfallener Silbergraben
96
7
4: Alter Nuthelauf (Alte Nuthe)
153
12
5: Damm der kanalisierten Nuthe
190
5
6: Stöckerfließ
118
4
7: Nördliche Wiesen (nördl. des Stauwalls)
147
10
8: Mittlere Wiesen (zw. den Stauwällen)
142
7
9: Südliche Wiesen (südl. des Stauwalls)
152
12
Renaturierung der Nuthewiesen
14
Insgesamt konnten demnach 339 Farn- und Blütenpflanzen im Gebiet nachgewiesen werden.
Die Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Anzahl der Arten je Teilfläche und den Anteil der
Arten, die bezüglich der Roten Liste des Landes Brandenburg gefährdet sind.
Demzufolge ist die Artenvielfalt auf dem Damm entlang der kanalisierten Nuthe am größten
und am verfallenen Silbergraben am geringsten. Weiterhin weisen sämtliche Wiesen, der Alte
Nuthelauf und das Dürrewiesen-Grabensystem recht hohe Artenzahlen auf.
Es wurden insgesamt 32 Arten gefunden, die nach der Roten Liste von Brandenburg als ge-
fährdet gelten. Davon galten 4 Arten als stark gefährdet (Ranunculus lingua, Selinum carvifo-
lia, Teucrium scordium, Viola persicifolia) und eine Art ist sogar vom Aussterben bedroht
(Taraxacum palustre agg.). Im artenreichen Dürrewiesengrabensystem ist der Anteil der ge-
fährdeten Arten am höchsten.
1.4.2
Biotoptypen 1999
Die Kartierung der Biotoptypen erfolgte mit Hilfe der Kartierungsanleitung des Landesum-
weltamtes Brandenburg von 1995 und der Verwaltungsvorschrift des ehemaligen MUNR von
1998 zum Vollzug der §§ 32, 36 des BbgNatSchG. Das allgemeine Vorgehen bei einer Bio-
topkartierung wird im Kapitel 2.1.2 beschrieben.
Bei dieser im Mai 1999 durchgeführten Kartierung wurden insgesamt 20 Biotoptypen festge-
stellt, von denen 8 mit einem Flächenanteil von knapp 31 % nach § 32 BbgNatSchG geschützt
sind. Das bedeutet, dass sie weder zerstört noch erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt wer-
den dürfen, wozu auch die Nutzungsintensivierung zählt. Den größten Anteil an der Fläche
haben mit etwa 25 % die Feuchtweiden, dicht gefolgt von den Feuchtwiesen (~ 22 %), den
Frischwiesen (~ 19 %) und den Frischweiden (~ 18 %). In der folgenden Tabelle sind sämt-
liche Biotoptypen aufgelistet. Die Bezeichnungen und Codes der Biotoptypen wurden teilwei-
se an die aktuelle Fassung der Kartierungsanleitung angepasst (Z
IMMERMANN
et al. 2007),
die Aussagen zu Schutz, Gefährdung und Größe wurden jedoch komplett aus L
INDER
(2000)
übernommen. Ein Kreuz in der Spalte Gefährdung bedeutet, dass der jeweilige Biotoptyp der
Kartierungsanleitung zufolge gefährdet ist. Eine genauere Einteilung in die Gefährdungskate-
gorien erfolgte 1999 jedoch nicht.
Renaturierung der Nuthewiesen
15
Tabelle 2: Biotoptypen 1999
(Quelle: L
INDER
2000)
Ziffern-
code
Buch-
staben-
code
Bezeichnung
Schutz Gefähr-
dung
Größe
in ha
01111
FBU
Bäche und kleine Flüsse, naturnah, unbeschattet
§
x
0,07
01123
FFO
Fluss, vollständig begradigt oder kanalisiert
-
-
2,71
0113002 FGxxT
Graben, trockengefallen oder nur stellenweise
wasserführend
-
-
0,93
01210
FR
Röhrichtgesellschaften an Fließgewässern
§
-
0,13
02110
SFA
Altarme von Fließgewässern
§
x
1,94
02131
SPU
temporäres Kleingewässer, naturnah, unbeschattet
-
-
0,03
02150
ST
Teiche
-
-
0,12
05103
GFR
Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte
§
x
19,37
05105
GFW
Feuchtweiden
-
x
22,21
05106
GFF
Flutrasen
(§)
x
3,43
05111
GMW
Frischweiden
-
x
15,77
05112
GMF
Frischwiesen
-
x
16,33
051222
GTKS
Sand- (Halb-)Trockenrasen
§
x
1,06
05131
GAF
Grünlandbrachen feuchter Standorte
§
-
0,66
05132
GAM
Grünlandbrachen frischer Standorte
-
-
0,53
05150
GI
Intensivgrasland
-
-
0,26
07101
BLF
Weidengebüsch nasser Standorte
§
x
0,11
07110
BF
Feldgehölze
-
x
0,17
07142
BRR
Baumreihen
-
-
0,16
07150
BE
Solitärbäume und Baumgruppen
-
-
1,52
Aus dieser Tabelle kann man unter anderem entnehmen, dass die meisten Biotoptypen zu-
meist deutlich kleiner als 4 ha sind, was einem Anteil von maximal 5 % entspricht.
Im Rahmen eines Schutzwürdigkeitsgutachtens zum FFH-Gebietsvorschlag Südliche Drewit-
zer und Saarmunder Nuthewiesen wurden zudem folgende Lebensraumtypen des Anhang I
der FFH-Richtlinie im Untersuchungsgebiet nachgewiesen (in L
INDER
2001):
-
3260: Unterwasservegetation in Fließgewässern der Submontanstufe und der Ebene
-
6410: Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden und Lehmboden
-
6510: Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis u. Sanguisorba officinalis)
-
*91E0: Erlen-Eschenwald an Fließgewässern
Ein Sternchen (*) steht dabei für prioritäre Lebensraumtypen, ,,für deren Erhaltung der Ge-
meinschaft [...] besondere Verantwortung zukommt" (R
AT DER
E
UROPÄISCHEN
G
EMEIN-
SCHAFT
1992).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783842808638
- DOI
- 10.3239/9783842808638
- Dateigröße
- 4.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Potsdam – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Studiengang Geoökologie
- Erscheinungsdatum
- 2011 (Januar)
- Note
- 2,3
- Schlagworte
- renaturierung biotopkartierung erfolgskontrolle naturschutz kontrolle
- Produktsicherheit
- Diplom.de