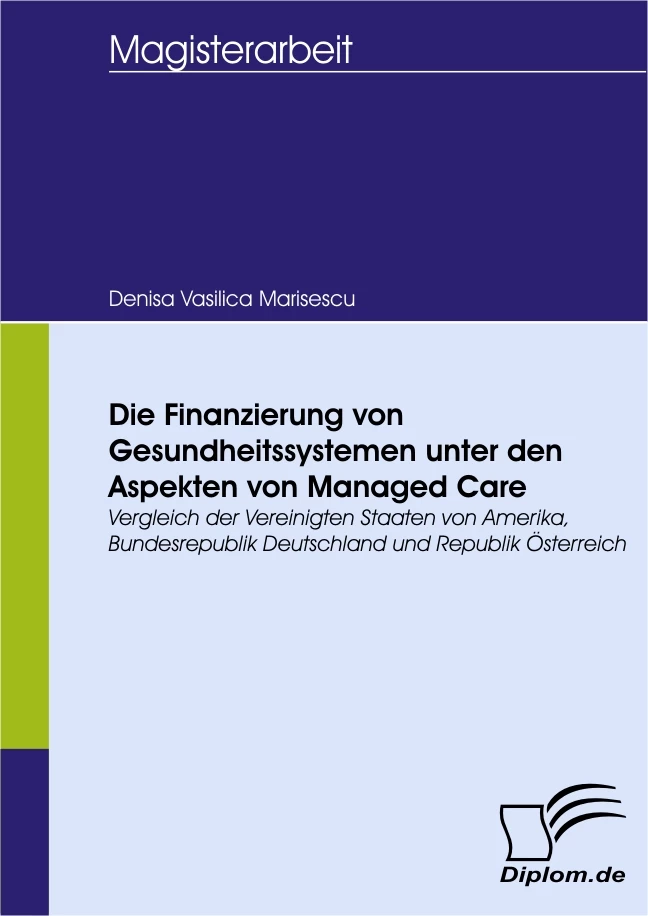Die Finanzierung von Gesundheitssystemen unter den Aspekten von Managed Care
Vergleich der Vereinigten Staaten von Amerika, Bundesrepublik Deutschland und Republik Österreich
Zusammenfassung
In erster Linie ist es auf historische und kulturelle Begebenheiten zurückzuführen, dass es zur Diversifikation der Gesundheitssysteme kam. Trotz ihrer Unterschiede müssen sie sich ähnlichen Herausforderungen stellen. In jedem System trägt der demografische Wandel, der Anstieg chronischer Erkrankungen, die Entwicklung von Medikamentenkosten, der medizinisch-technische Fortschritt etc. auf die eine oder andere Weise zum Kostenanstieg bei. Das österreichische Gesundheitswesen stellt in dieser Hinsicht keine Ausnahme dar und muss in Zukunft diese und weitere Herausforderungen bewältigen.
Die Lösungsansätze, die zum Ziel der langfristigen Finanzierung des Gesundheitsystems führen, sind vielfältig. Einer von ihnen ist der Weg des Wettbewerbs. Der wissenschaftliche Beirat des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie geht davon aus, dass die Schaffung von wettbewerblichen Strukturen grundsätzlich zur Verringerung von Über-, Unter- und Fehlversorgung führen kann. Im wettbewerblichen Umfeld ist das Konzept Managed Care, das auf eine effiziente Steuerung der Kosten und der Qualität im Gesundheitswesen abzielt, entstanden. Vor diesem Hintergrund wurde das Thema dieser Arbeit entwickelt: Die Finanzierung von Gesundheitssystemen unter den Aspekten von Managed Care. Den zentralen Fokus bildet das österreichische Gesundheitswesen. Ziel der Arbeit ist die Beantwortung der Frage, ob Managed Care - Ansätze in Österreich vorzufinden sind und wenn ja, wie diese implementiert wurden. Bevor dieser Punkt in Kapitel sechs näher erläutert wird, werden in den vorausgehenden Kapiteln jene Grundlagen und Grundbegriffe, die zum Gesamtverständnis des Themas von essentieller Bedeutung sind, herausgearbeitet.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Kategorisierung von Gesundheitssystemen nach Finanzierungsquellen, mit den Gründen des Reformbedarfs im österreichischen Gesundheitswesen sowie mit dem Wettbewerb innerhalb des Gesundheitswesens. Da seit der Etablierung von Managed Care eine grosse Anzahl von Fachliteratur verfasst wurde, zielt das dritte Kapitel darauf ab, eine Übersicht der Managed Care-Landschaft beschreibend wiederzugeben.
Das US-amerikanische Gesundheitssystem, das als Geburtsstätte des Managed Care angesehen wird, ist Hauptthema des vierten Kapitels. Dargestellt werden die Umsetzung sowie die Auswirkungen dieses Konzepts für das amerikanische System. Die relative Systemnähe des deutschen Gesundheitswesens zum […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
I. Vorwort
III. Tabellenverzeichnis
IV. Abbildungsverzeichnis
V. Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Gesundheitssysteme, Reformbedarf, Wettbewerb
2.1. Gesundheitssysteme nach Finanzierungsquellen
2.1.1. Das staatliche Gesundheitssystem (Beveridge-Modell)
2.1.2. Das Sozialversicherungssystem (Bismarck-Modell)
2.1.3. Das privatwirtschaftliche Versicherungssystem
2.2. Reformbedarf-Fokus Österreich
2.2.1. Entwicklung der Gesundheitsausgaben Österreichs
2.2.1.1. Österreich im internationalen Vergleich
2.2.1.2. Österreich auf nationaler Ebene
2.2.2. Ursachen des Finanzierungsproblems
2.2.2.1. Beitragseinnahmenerosion
2.2.2.2. Medikamentenkostenentwicklung
2.2.2.3. Technologischer Wandel
2.2.2.4. Demografische Entwicklung
2.3. Der Wettbewerb auf dem Gesundheitsmarkt
2.3.1. Besonderheiten des Gesundheitsmarktes
2.3.1.1. Öffentliche Güter und Externalitäten
2.3.1.2. Informationsasymmetrien
2.3.1.3. Verteilungsungerechtigkeit
2.3.2. Wettbewerb im System der Sozialversicherung
2.3.2.1. Wettbewerb der Krankenkassen um Versicherte-Versicherungsmarkt
2.3.2.2. Wettbewerb der Leistungserbringer um Patienten-Behandlungsmarkt
2.3.2.3. Wettbewerb der Leistungserbringer und Krankenkassen-Leistungsmarkt
2.3.2.4. Ausschnitt aus dem derzeitigen Wettbewerb in der sozialen Krankenversicherung
2.3.2.5. Ergebnisse des Wettbewerbs in der sozialen Krankenversicherung
3. Managed Care
3.1. Definition von Managed Care
3.2. Die Entstehung von Managed Care
3.3. Managed Care-Organisationen, Managed Care-Instrumente und Beteiligte
3.4. Managed Care-Organisationen
3.4.1. Versicherungsorientierte Managed Care-Organisationen
3.4.1.1. Health Maintenance Organizations
3.4.1.2. Point-of-Service-System
3.4.2. Anbieterorientierte Managed Care-Organisationen
3.4.2.1. Prefered Provider Organization
3.4.2.2. Provider Sponsored Organization
3.4.2.3. Networks
3.4.2.4. Integrated Delivery System
3.4.2.5. Physicians Hospital Organization
3.4.3. Institutionen im Managed Care
3.5. Managed Care-Instrumente
3.5.1. Instrumente zur Steuerung auf der Anbieterseite
3.5.1.1. Vertragsgestaltung-Selektives Kontrahieren
3.5.1.2. Vergütungssysteme
3.5.1.3. Vergütungsformen ambulant erbrachter Leistungen
3.5.1.4. Vergütungsformen stationär erbrachter Leistungen
3.5.2. Instrumente zur Steuerung auf der Nachfrageseite
3.5.2.1. Vertragsgestaltung vorvertraglicher Risiken
3.5.2.2. Vertragsgestaltung nachvertraglicher Risiken
3.5.2.3. Monitoring-oder Kontrollinstrumente
3.5.3. Instrumente der Qualitäts- und Kostensteuerung
3.5.3.1. Verbesserung der Koordination und Kontrolle der Leistungsgestaltung
3.5.3.2. Qualitäts- und Kostensteuerung auf der Seite der Leistungserbringer
3.6. Auswirkung-Managed Care
4. Vereinigte Staaten von Amerika
4.1. Entwicklung und Struktur des Gesundheitssystems
4.2. Systeme der Krankenversicherung
4.2.1. Staatliche Versicherungsprogramme
4.2.1.1. Medicare
4.2.1.2. Medicaid
4.2.2. Reine Privatversicherung
4.2.3. Nichtversicherte
4.3. Ausgaben und Finanzierung des Gesundheitssystems
4.3.1. Entwicklung der Ausgaben
4.3.2. Entwicklung der Ausgaben nach Leistungungsarten
4.3.3. Ursachen für die Entwicklung der Ausgaben
4.3.4. Finanzierung der Ausgaben
4.3.5. Die künftige Entwicklung der Ausgaben
4.3.6. Strategien zur Kosteneindämmung
4.4. Managed Care-private und staatliche Pläne
4.4.1. Managed Care-private Pläne
4.4.2. Managed Care-staatliche Pläne
4.4.2.1. Medicare
4.4.2.2. Medicaid
4.5. Auswirkung Managed Care
4.5.1. Kosteneffizienz von Managed Care
4.5.2. Qualität im Managed Care
4.5.3. Zufriedenheit der Patienten
4.5.4. Zufriedenheit der Leistungserbringer
4.6. Zukunft und Trends
5. Deutschland
5.1. Entwicklung und Struktur des Gesundheitssystems
5.2. System der Krankenversicherung
5.3. Ausgaben und Finanzierung
5.3.1. Entwicklung der Ausgaben
5.3.2. Entwicklung der Ausgaben nach Leistungen
5.3.3. Finanzierung der Ausgaben
5.3.4. Strukturreformen im deutschen Gesundheitssystem
5.4. Managed Care im deutschen Gesundheitssystem
5.4.1. Managed Care-Besondere Versorgungsformen
5.4.1.1. Strukturverträge nach § 73a SGB V
5.4.1.2. Modellvorhaben nach §§ 63-65 SGB V
5.4.1.3. Hausarztzentrierte Versorgung § 73 b SGB V
5.4.1.4. Besondere ambulante ärztliche Versorgung § 73 c SGB V
5.4.1.5. Integrierte Versorgung § 140 a-h SGB V
5.4.1.6. Strukturierte Behandlungsprogramme (§ 137 g SGB V)
5.4.2. Einsatz von Managed Care-Instrumenten
5.4.2.1. Instrumente der Steuerung auf der Anbieterseite
5.4.2.2. Instrumente zur Steuerung auf der Nachfrageseite
5.4.2.3. Instrumente der Qualitäts- und Kostensteuerung zur Verbesserung der Koordination und Kontrolle der Leistungsgestaltung
5.4.2.4. Instrumente der Qualität- und Kostensteuerung auf der Seite der Leistungserbringung
5.5. Auswirkung der Managed Care-Elemente
5.5.1. Auswirkung-Krankenkassen
5.5.2. Auswirkungen-Wettbewerb
5.5.3. Auswirkung-Versicherte
5.5.4. Auswirkung-neue Versorgungsformen
5.6. Zukunft und Trends
6. Österreich
6.1. Entwicklung und Struktur des Gesundheitssystems
6.2. System der Krankenversicherung
6.3. Ausgaben und Finanzierung
6.3.1. Entwicklung der Ausgaben
6.3.2. Finanzierung der Ausgaben
6.3.3. Fragmentierung des Finanzierungsystems
6.3.4. Reformen im österreichischen Gesundheitssystem
6.4. Managed Care im österreichischen Gesundheitssystem
6.4.1. Managed Care-Perspektiven-Reformpool-Projekte
6.4.2. Managed Care-Integrierte Versorgung
6.4.3. Einsatz von Managed Care-Instrumenten
6.4.3.1. Instrumente zur Steuerung auf der Anbieterseite
6.4.3.2. Instrumente zur Steuerung auf der Nachfrageseite
6.4.3.3. Instrumente der Qualitäts- und Kostensteuerung zur Verbesserung der Koordination und Kontrolle der Leistungsgestaltung
6.4.3.4. Instrumente der Qualität- und Kostensteuerung auf der Seite der Leistungserbringung
6.5. Auswirkung der Reformpool-Projekte und Managed Care-Elemente
6.5.1. Auswirkung der Reformpool-Projekte
6.5.2. Auswirkung Managed Care-Instrumente
6.5.2.1. Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung
6.5.2.2. Selbstbeteiligung
6.5.2.3. Disease Management-Programm „Therapie aktiv“
6.5.2.5. Case Management
6.5.2.6. e-Card
6.6. Zukunft und Trends
7. Schlussfolgerungen
8. Quellenverzeichnis
8.1. Literatur
8.2. Literatur mit Online-Quelle
8.3. Online-Quellen
8.4. Schriftverkehr per Email
9. Anhang
I. Vorwort
Für meine Eltern
Für meine Großmutter
Für meine Schwester
Für meine Freunde
Für MICH
In dieser Arbeit wurde im Interesse besserer Lesbarkeit auf die Verwendung von Doppelformen oder anderen Kennzeichnungen der Trennung in männliche und weibliche Personen (z. B. der/die Arzt/Ärztin) verzichtet. Alle im Text verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf beide Geschlechter.
Folgende Begriffe werden in dieser Arbeit als Synonyme verwendet: „Intramural“ = „ambulanter Bereich“, „extramural“ = „stationärer Bereich“.
Englischsprachige Fachausdrücke wurden übernommen, sofern sie auch in der deutschsprachigen Fachliteratur verwendet werden (z. B. Health Maintenance Organization) oder, wenn durch eine Übersetzung ins Deutsche, die Bedeutung nicht eindeutig wiedergegeben werden konnte (z. B. Utilization Review).
Denisa-Vasilica Marisescu
III. Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Vor- und Nachteile des Beveridge-Modells
Tabelle 2: Vor- und Nachteile des Bismarck-Models
Tabelle 3: Vor- und Nachteile des privatwirtschaftlichen Versicherungssystems
Tabelle 4: Gesundheitsausgaben 1995-2006
Tabelle 5: Managed Care-Elemente in den besonderen Versorgungsformen
Tabelle 6: Gesundheitsausgaben in Österreich laut System of Health Accounts 1995-2007 in € Mio
Tabelle 7: Reformpool-Projektliste mit Projektbeschreibung
IV. Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Modelle von Gesundheitssysteme nach Finanzierung und Bereitstellung
Abb. 2: Das Spektrum der staatlichen Finanzierungsregelungen
Abb. 3: Ausgaben der sozialen Krankenversicherung 2008 – Gesamtausgaben € 13.765 Mio. (100%)
Abb. 4: Entwicklung der Beitragseinnahmen der KV im Vergleich zum BIP 1997-2008 in Prozent
Abb. 5: Steigerung wichtiger Positionen in der Krankenversicherung 1997-2007 in Prozent
Abb. 6: Fiktion der Beitrags- und Leistungsströme hochgerechnet auf die Bevölkerungsstruktur des Jahres 2030
Abb. 7: Wettbewerb im Gesundheitswesen
Abb. 8: Managed Care-Organisationen und Managed Care-Instrumente
Abb. 9: Krankenversicherungsschutz nach Art der Versicherung in Prozent
Abb. 10: Nationale Gesundheitsausgaben in Mio. 2003-2015
Abb. 11: Durschnittliches Wachstum der nationalen Gesundheitsausgaben 1993-2007 in Prozent
Abb. 12: Durschnittliches Wachstum der Gesundheitsausgaben nach Leistungsarten 1993-2007 in Prozent
Abb. 13: Verteilung der eintragenen versicherten Arbeitnehmer in unterschiedlichen Gesundheitsplänen 1988-2007 in Prozent
Abb. 14: Managed Care-Elemente in deutschen Gesundheitswesen
Abb. 15: Gesundheitsausgaben laut „System of Health Accounts“ der OECD 2007 in Prozent – Gesamtausgaben € 27.453 Mio. (100%)
Abb. 16: Integrierte Versorgung in Österreich nach CCIV
Abb. 17: Managed Care-Umfeld und Traditionelles System
V. Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
In erster Linie ist es auf historische und kulturelle Begebenheiten zurückzuführen, dass es zur Diversifikation der Gesundheitssysteme kam. Trotz ihrer Unterschiede müssen sie sich ähnlichen Herausforderungen stellen (Wehkamp 2006). In jedem System trägt der demografische Wandel, der Anstieg chronischer Erkrankungen, die Entwicklung von Medikamentenkosten, der medizinisch-technische Fortschritt etc. auf die eine oder andere Weise zum Kostenanstieg bei. Das österreichische Gesundheitswesen stellt in dieser Hinsicht keine Ausnahme dar und muss in Zukunft diese und weitere Herausforderungen bewältigen.
Die Lösungsansätze, die zum Ziel der langfristigen Finanzierung des Gesundheitsystems führen, sind vielfältig. Einer von ihnen ist der Weg des Wettbewerbs. Der wissenschaftliche Beirat des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie geht davon aus, dass die Schaffung von wettbewerblichen Strukturen grundsätzlich zur Verringerung von Über-, Unter- und Fehlversorgung führen kann (BMWI 2006, S. 7). Im wettbewerblichen Umfeld ist das Konzept Managed Care, das auf eine effiziente Steuerung der Kosten und der Qualität im Gesundheitswesen abzielt, entstanden. Vor diesem Hintergrund wurde das Thema dieser Arbeit entwickelt: „Die Finanzierung von Gesundheitssystemen unter den Aspekten von Managed Care". Den zentralen Fokus bildet das österreichische Gesundheitswesen. Ziel der Arbeit ist die Beantwortung der Frage, ob Managed Care - Ansätze in Österreich vorzufinden sind und wenn ja, wie diese implementiert wurden. Bevor dieser Punkt in Kapitel sechs näher erläutert wird, werden in den vorausgehenden Kapiteln jene Grundlagen und Grundbegriffe, die zum Gesamtverständnis des Themas von essentieller Bedeutung sind, herausgearbeitet.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Kategorisierung von Gesundheitssystemen nach Finanzierungsquellen, mit den Gründen des Reformbedarfs im österreichischen Gesundheitswesen sowie mit dem Wettbewerb innerhalb des Gesundheitswesens.
Da seit der Etablierung von Managed Care eine grosse Anzahl von Fachliteratur verfasst wurde, zielt das dritte Kapitel darauf ab, eine Übersicht der Managed Care-Landschaft beschreibend wiederzugeben.
Das US-amerikanische Gesundheitssystem, das als Geburtsstätte des Managed Care angesehen wird, ist Hauptthema des vierten Kapitels. Dargestellt werden die Umsetzung sowie die Auswirkungen dieses Konzepts für das amerikanische System.
Die relative Systemnähe des deutschen Gesundheitswesens zum österreichischen und die eingeleiteten Reformen der letzten Jahre waren ausschlaggebend für die Gestaltung des fünften Kapitels.
Die Schlussfolgerungen der Arbeit können dem siebten Kapitel entnommen werden.
2. Gesundheitssysteme, Reformbedarf, Wettbewerb
Der erste Teil dieses Kapitel beschreibt die Typologisierungen der Gesundheitssysteme, ihre Finanzierung, Steuerung sowie ihre Vorteile und Nachteile. Der zweite Teil geht auf die Frage des Reformbedarfs im Gesundheitswesen mit dem Fokus auf Österreich ein. Die Gesundheitsausgaben und die Ursachen für deren Anstieg können in diesem Rahmen nur skizziert werden. Der dritte Abschnitt bespricht die Besonderheiten des Gesundheitsmarktes sowie die Chancen und Risiken, die ein Wettbewerb mit sich bringt.
2.1. Gesundheitssysteme nach Finanzierungsquellen
Obwohl kein Gesundheitssystem dem anderen gleicht, werden in der Literatur für ein besseres Verständnis auf der Basis gemeinsamer Charakteristiken Typologien mit Strukturmerkmalen erstellt. Diese geben eine simplifizierte Sichtweise der komplexen Realität wieder und verhelfen zur Analyse einzelner Systeme (Blank und Burau 2004, S. 23). Den Grund für die Entstehung der verschiedenen Krankenversorgungssysteme sieht Laimböck (2000) im mangelhaften Weltmarkt. Die Abwesenheit von Marktbeziehungen zwischen den Gesundheitssystemen führe zur asynchronen Entwicklung (Laimböck 2000, S. 116f). Weitere Einflussfaktoren können das politische System, die kulturellen Rahmenbedingungen, der demografische Kontext, der einzigartige, historische Hintergrund und die sozialen Strukturen sein (Blank und Burau 2004, S. 22).
Drei Systeme lassen sich identifizieren (siehe Abbildung 1):
- das staatlich finanzierte Gesundheitssystem, National Health System, NHS (Beveridge-Modell),
- das Sozialversicherungssystem, korporatistische SVS (Bismarck-Modell) und
- das privatwirtschaftliche Versicherungssystem.
Abb. 1: Modelle von Gesundheitssysteme nach Finanzierung und Bereitstellung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Blank und Burau 2004, S. 24
2.1.1. Das staatliche Gesundheitssystem (Beveridge-Modell)
Das National Health System (NHS) oder Beveridge-Modell ist das staatliche und steuerfinanzierte Gesundheitssystem (Blank und Burau 2004, S. 24; Laimböck 2000, S. 131). Die Versorgung mit Gesundheitsleistungen im NHS-System wird aus direkten, indirekten bzw. zweckgebundenen Steuergeldern finanziert, wie z. B. in Dänemark, Finnland, Norwegen, Italien, Spanien und Schweden (Donaldson und Gerard 2005, S. 64; Mossialos 2002, S. 39). Die Bereitstellung der Gesundheitsleistungen in diesem Modell obliegt ausschliesslich dem Staat, der entweder die Produktionsfaktoren besitzt oder über ihre Bereitstellung verfügt bzw. sie kontrolliert (Donaldson und Gerard 2005, S. 64ff). Leistungen können auch von privaten Anbietern eingekauft werden (Schwartz et al. 2007, S. 41f).
In einem steuerfinanzierten System beruht die Umverteilung auf zwei Indikatoren, nämlich dem individuellen Wohlergehen/ Gesundheitsstatus und dem Einkommen. In diesem Zusammenhang muss auf zwei Steuerungsprobleme, die adverse Selektion und den Moral Hazard, hingewiesen werden (Donaldson und Gerard 2005, S. 64).
Adverse Selektion (negative Qualitätskonkurrenz) entsteht, wenn gute und schlechte Risiken einer Risikogruppe gebündelt werden. Da Versicherte ihr eigenes Risiko besser kennen und Versicherungen ihren Beitragssatz auf der Grundlage des durchnittlichen Risikos kalkulieren, werden Versicherte, die gute Risiken darstellen (die gesünder sind), versuchen, aus dieser Versicherung auszutreten. Sind sie erfolgreich, ist die Versicherung gezwungen ihre Beiträge neu zu kalkulieren, d.h. höher anzusetzen (Rachold 2000, S. 30). Das System der direkten Besteuerung beseitigt das Problem der adversen Selektion durch die Abwesenheit des Wettbewerbs der finanziellen Zwischenhändlern (Donaldson und Gerard 2005, S. 64). Hier werden die Versicherungsprämien vom erwarteten Risikolevel getrennt und in Pflichtprämien umgewandelt. Auf diese Weise verteilt ein Steuersystem die Mittel von den Personen mit ex-ante niedriger Krankheitserwartung zu jenen mit einer höheren (Donaldson und Gerard 2005, S. 64f).
Die Gesundheitsleistungen in diesem System sind für Versicherte bis auf gewisse Zuzahlungen zum Nulltarif erhältlich (Donaldson und Gerard 2005, S. 64). Damit ist gemeint, dass kein Zusammenhang zwischen in Anspruchnahme von Leistung und Kosten besteht (Rachold 2000, S. 21). Das Problem entsteht, dass bei Versicherungsschutz keine Anreize bestehen den Eintritt eines schädigenden Ereignisses z. B. durch Vorsichtsmaßnahmen zu verhindern. Dieses Phänomen bezeichnet die Versicherungsökonomie als Moral Hazard (Rachold 2000, S. 31). Um diesen zu Kontrollieren werden Instrumente, wie Wartelisten, Wartezeiten oder das Primärarztsystem, also die Konsultation des Allgemeinmediziners eingesetzt (z. B. in Großbritannien) (Donaldson und Gerard 2005, S. 64f; Hajen et al. 2006, S. 73).
Tabelle 1 geht genauer auf die Vor- und Nachteile des Modells ein.
Tabelle 1: Vor- und Nachteile des Beveridge-Modells
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schwartz et al. 2007, S. 42
2.1.2. Das Sozialversicherungssystem (Bismarck-Modell)
Der zweite Typ von Gesundheitssystemen, in den der Staat eingreift, ist die Sozialversicherung, auch Bismarck-Modell genannt. Systeme der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wurden, von Deutschland ausgehend, in Österreich, der Schweiz, Belgien, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden eingerichtet (Laimböck 2000, S. 120; Blank and Burau 2004, S. 24; McDaid 2003, S. 167). Trotz signifikanter Unterschiede in der Systemorganisation der Länder baut dieses Konzept auf das Solidaritätsprinzip auf (Blank und Burau 2004, S. 66). Dieses zeichnet sich durch die Erhebung von einkommensabhängigen Beiträge, die beitragsfreie Mitversicherung von Familienangehörigen sowie die altersunabhängigen Beiträge aus (Rachold 2000, S. 21). Charakteristisch für das System ist die abdeckende, universale Krankenversicherung im Rahmen der Sozialhilfe (Blank und Burau 2004, S. 66).
Im Sozialversicherungssystem (SV-System) werden Prämien in Form der Sozialversicherungssteuer von jedem Arbeitgeber und Arbeitnehmer erhoben. Die Beiträge können einheitlich im ganzen Land oder der Region, oder variabel gemäß dem Einkommen, dem gewählten Krankenversicherungsfond oder der Krankenkasse, sein. Eingehoben werden die Pflichtbeiträge vom Nationalen Fond (Niederlanden), individuellen Krankenversicherungsfonds bzw. Krankenkassen (Deutschland und Österreich) oder vom Verband der Krankenversicherungsfonds (Frankreich). Risikoausgleichungsmechanismen werden oft aufgestellt, um sicher zu stellen, dass Krankenkassen weder Verluste noch übermäßigen Profit durch den Anteil an Individuen mit hohen oder niedrigen Risiken zeichnen müssen (Donaldson und Gerard 2005, S. 67f).
Wenn meist das Sozialversicherungssystem ein Pflichtsystem ist, bestehen dennoch Ausnahmen. In den Niederlanden beispielsweise erhalten Personen, die eine bestimmte Einkommensgrenze überschreiten, keine Sozialversicherung: Sie können sich jedoch freiwillig versichern (McDaid 2003, S. 167).
In Deutschland besteht die Möglichkeit, für Besserverdienende aus der Sozialversicherung auszutreten und eine private Krankenversicherung abzuschließen. Zahlreiche Sozialversicherungssysteme sind auf zusätzliche Fonds der allgemeinen Besteuerung angewiesen, um die Beiträge für bedürftige Gruppen wie Arbeitslose, Pensionisten und neuerdings Flüchtlinge zu decken (McDaid 2003, S. 167). Die Bereitstellung von Leistungen ist weitgehend privat, obwohl sich einige Faktoren der Produktion und der Bereitstellung in öffentlichen Händen befinden, z. B. Krankenhäuser in Deutschland, Japan, den Niederlanden und in Österreich (Blank und Burau 2004, S. 24).
Der Wettbewerb kann in diesem System unter den finanziellen Zwischenhändlern mittels staatlicher risikoausgleichender Subventionen stattfinden. Weitere Vorteile des Wettbewerbs zwischen den Leistungserbringern können erlangt werden, da die staatliche Versicherung als der kollektive Einkäufer von Dienstleistungen im Auftrag der Gemeinschaft agiert (z. B. in Kanada) (Donaldson und Gerard 2005, S. 68).
Details über die Vor- und Nachteile diese Systems können der Tabelle 2 entnommen werden.
Tabelle 2: Vor- und Nachteile des Bismarck-Models
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schwartz et al. 2007, S. 43
2.1.3. Das privatwirtschaftliche Versicherungssystem
Das private Versicherungsmodell oder die Konsumentensouveränität stellen das andere Extrem dar, in welchem die Marktkräfte das Sagen haben. Der Staat mischt sich nur im geringen Maße in die direkte Finanzierung oder die Bereitstellung von Gesundheitsleistungen ein. Das Modell ist am deutlichsten in den USA und war bis vor Kurzem in Australien zu beobachten. Andere Gesundheitssysteme können durchaus Elemente des privaten Versicherungsmodells oder der Konsumentensouveränität, wie z. B. die Schweiz einsetzen (Blank und Burau 2004, S. 24). Im Modell der Schweiz sieht der Staat eine allgemeine Versicherungspflicht vor. Ansonsten unterliegt der Gesundheitsmarkt dem Wettbewerb (Schwartz et al. 2007, S. 44).
Charakteristisch für dieses Modell ist das Einkaufen privater, risikoorientierter Versicherungen (Blank und Burau 2004, S. 24). Dabei erhält der Konsument eine zentrale Rolle in der Auswahl seiner Versicherung nach Art und Ausmaß, nach Bedarf und Finanzierungsmöglichkeit. Die reine Privatversicherung sieht nur die Deckung spezifischer Krankheitsrisiken des Konsumenten sowie der Folgekosten der Gesundpflege vor. Der staatliche Eingriff beschränkt sich in diesem Fall auf die steuerliche Befreiung der Prämien (Donaldson und Gerard 2005, S. 60ff).
Auf der Seite der Anbieter, auf dem Markt der Privatversicherungen, enwickelte sich mit der Zeit eine oligopolistische Struktur, die Anreize der Zusammenarbeit zur Verbesserung ihrer Position und zur Erhaltung/ Anhebung der Prämien setzt (Donaldson und Gerard 2005, S. 60ff).
Die Erbringung von Gesundheitsleistungen und anderer Produktionsfaktoren befindet sich in privater Hand. Der Ausschluss bestimmter Bevölkerungsschichten aus dem System ist unvermeidbar. Folglich sind Arme, medizinisch Notleidende und chronisch Kranke in diesem System nicht berücksichtigt und von der Wohltätigkeit anderer abhängig. Die Antwort ist ein staatliches Sicherheitsnetz für diese Gruppen (Bedürftige, Arme, Alte, Jugendliche). In den USA heißen diese Programme Medicare und Medicaid (Blank und Burau 2004, S. 25; Donaldson und Gerard 2005, S. 60). In der Schweiz erfolgt der Ausgleich durch direkte staatliche Subventionierungen (Schwartz et al. 2007, S. 44).
Geich den anderen Modellen muss dieses ebenfalls das Problem Moral Hazard bekämpfen. Dieses führte zur Aufstellung eines sehr komplexen Systems von Selbstbeteiligung und Zuzahlung (Managed Care Beispiele siehe Kapitel 3.5.2.2.). Das Hauptziel liegt darin, die finanzielle Last auf die Konsumenten zu übertragen oder zumindest die „unnötige“ Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen zu reduzieren (Donaldson und Gerard 2005, S. 61f).
Auf der Leistungserbringerseite kämpft das System mit der Präsenz der angebotsinduzierten Nachfrage (Beeinflussung der Nachfrage durch den Leistungserbringer). Eine Kostendämpfung kann teilweise durch Kostenteilung erreicht werden (Donaldson und Gerard 2005, S. 61f).
Tabelle 3 stellt die Vor- und Nachteile dieses Modells zusammenfassend dar.
Tabelle 3: Vor- und Nachteile des privatwirtschaftlichen Versicherungssystems
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schwartz et al. 2007, S. 44
Anschliessend an die Skizzierung der drei Kategorien von Gesundheitssystemen, bietet Abbildung 2 die Möglichkeit das breite Spektrum der staatlichen Finanzierungsregelungen und somit der Gesundheitswesen zu betrachten. Diese zu vergleichen ist Hauptaufgabe der Gesundheitssystemforschung, die dabei auf zwei Problemfelder stößt: Zum einen das Bewertungsproblem, das die Definition allgemein akzeptierter Bewertungskriterien betrifft und zum anderen das Zurechnungsproblem, welches die Abgrenzung der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems von anderen Faktoren umfasst. Daher stehen die Ergebnisse internationaler Studien immer in Diskussion (Hajen et al. 2006, S. 253ff). Appelby fasste die Situation bereits 1992 trefflich zusammen: ’All health-care systems are pluralistic with respect to financing (and organisation) with tendencies to one method rather than another (Appleby, 1992: 10).’ (Blank und Burau 2004, S. 25).
Abb. 2: Das Spektrum der staatlichen Finanzierungsregelungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Irvine 2003, S. 118
2.2. Reformbedarf-Fokus Österreich
Das österreichische Gesundheitssystem zählt gemäß der erwähnten Kategorisierung zu den Sozialversicherungssystemen. Finanzielle Ressourcenknappheit, sich verändernde Erwartungen der Patienten (Kunden) an das Gesundheitswesen, medizinischer Fortschritt sowie Verschiebungen in der demografischen Entwicklung der Bevölkerung sind nur einige der Herausforderungen, die angepackt werden müssen.
2.2.1. Entwicklung der Gesundheitsausgaben Österreichs
Bevor die Ursachen des Finanzierungsproblems der sozialen Krankenversicherung im Kapitel 2.2.2. besprochen werden, widmet sich dieser Unterabschnitt den Gesundheitsausgaben. Diese werden auf internationaler sowie nationaler Ebene (Ausgaben der sozialen Krankenversicherung) kurz dargestellt. Eine Gesamtbetrachtung der Gesundheitsausgaben in Österreich befindet sich im Kapitel 6.3.
2.2.1.1. Österreich im internationalen Vergleich
Die Gesundheitsausgaben des Jahres 2007 machten rund € 27.453 Mio. aus. In Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) belaufen sich diese für dasselbe Jahr auf 10,1 % wobei 7,7 % den öffentlichen und 2,4 % den privaten Gesundheitsausgaben zuzurechnen sind (Statistik Austria 2009a, S. 74).
Österreich liegt damit über dem OECD-Durchschnitt von 8,9 % (2007). Den Spitzenplatz im Jahr 2007 nehmen die USA mit 16 % des BIP ein, gefolgt von Frankreich 11 %, der Schweiz 10,8 % und Deutschland 10,4 % (OECD 2009c).
Ebenfalls im Bereich der medizinisch technischen Geräten liegt Österreich im internationalen Vergleich weit vorne. Österreich kommt mit 29,8 Computertomografie-Scannern (CT) pro eine Mio. Einwohner (OECD-Durchschnitt 20,2 CT, 2007) auf einen der ersten Rangplätze. Weites standen in Österreich 1996 ein Magnetoresonanztomografen (MRI) pro 7 Mio. Einwohner zu Verfügung. 2007 waren es 17,7 MRI. Nur Japan, die Vereinigten Staaten, Italien und Island weisen mehr MRI-Einheiten pro Kopf auf (OECD 2009c).
2.2.1.2. Österreich auf nationaler Ebene
2008 beliefen sich die Ausgaben der sozialen Krankenversicherung auf € 13.765 Mio., für 2007 auf € 13.178 Mio. und für das Jahr 2006 auf € 12.383 Mio. Die jährliche Steigerung der Ausgaben von 2006 auf 2007 betrug 6,4 % (eigene Berechnungen (Jahr 2007 - Jahr 2006)/ Jahr 2006*100=6,4 %) und von 2007 auf 2008 4,6 % (Statistik Austria 2007, S. 49; Hauptverband 2009b, S. 15; Grillitsch 2009, S. 60).
Die einzelnen Ausgabenposten des Jahres 2008 verteilen sich zu 28 % auf Spitäler, 24 % auf Ärzte, 22 % auf Medikamente, 2,5 % auf Früherkennung, 0,8 % auf Gesundheitsförderung, und der Rest entfällt auf Zahnärzte, Mutterschaftsleistungen, Krankengeld, Transportkosten und Abschreibungen (siehe Abbildung 3) (Hauptverband 2009b, S. 15; Grillitsch 2009, S. 60).
Der gesamte Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand betrug 2007 2,3 % des Budgets (Grillitsch 2008, S. 229). Verglichen mit 3,76 % aus dem Jahr 2000 sind diese eindeutig zurückgegangen. Für 2008 sind diese auf 2,8 % leicht angestiegen (Grillitsch 2008, S. 233; Grillitsch 2009, S. 60).
Abb. 3: Ausgaben der sozialen Krankenversicherung 2008 – Gesamtausgaben € 13.765 Mio. (100%)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehung an Hauptverband 2009b, S. 15
2.2.2. Ursachen des Finanzierungsproblems
Die Finanzierung des österreichischen Gesundheitswesens erfolgt im Kern durch die soziale Krankenversicherung (Probst 2004, S. 107). Von den 76,4 % der öffentlichen Gesundheitsausgaben, entfallen ca. 50 % auf diese (Statistik Austria 2009a, S. 74). Trotz der Steigerung der Einnahmen im Jahr 2008 gegenüber 2007 um 6,6 % auf € 13.684 Mio. werden diese von den Ausgaben in Höhe von € 13.765 Mio. überschritten (Hauptverband 2009b). Zahlreiche Faktoren sowie gesetzliche Maßnahmen (z. B. die Ausweitung des Leistungskatalogs) sind dafür verantworlich (Probst 2004, S. 110ff; Hofmarcher und Rack 2006, S. 217). Die nachfolgende Analyse konzentriert sich auf vier dieser Faktoren: die Beitragseinnahmenerosion, die Medikamentenkostenentwicklung, den technologischen Wandel und die Herausforderung der demografischen Entwicklung (Probst 2004, S. 110).
2.2.2.1. Beitragseinnahmenerosion
Die Beitragseinnahmen spielen in jenen Ländern mit Sozialversicherungssystem, die ihre Krankenversicherung auf diese Weise finanzieren eine besondere Rolle. Beitragseinnahmenerosion meint, dass der Behandlungsbedarf der Bevölkerung aus einem relativ gesunkenen Lohnvolumen finanziert werden muss. Die Ursache liegt in der rückläufigen Entwicklung des Einkommensanteils aus unselbstständiger Arbeit am Volkseinkommen, der Lohnquote (Schneider 2007, S. 2; Zechmeister 2004, S. 3). Das bedeutet, dass die Lohn- und Gehaltssumme langsamer als das Bruttoinlandsprodukt wächst. Folglich sinkt der prozentuelle Anteil des Erwerbseinkommens, der in Form von Beiträgen an die Sozialversicherung abgeführt wird (Probst 2004, S. 110).
Abbildung 4 verdeutlicht die Entwicklung der Beitrageinnahmen der Krankenversicherung im Vergleich zum BIP im Zeitraum 1997 bis 2008. Die Einnahmen der Krankenkassen zeigen einen Rückstand von 4,1 % gegenüber der Steigerung des BIPs. Stark vereinfacht, kann schlussgefolgert werden, dass wenn sich die Beitragseinnahmen in den letzten Jahren parallel zum BIP entwickelt hätten die Krankenkassen schwarze Zahlen (keine Schulden) schreiben könnten (Probst 2002, S. 42f; Probst 2010).
Abb. 4: Entwicklung der Beitragseinnahmen der KV im Vergleich zum BIP 1997-2008 in Prozent
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Probst 2010
2.2.2.2. Medikamentenkostenentwicklung
Im Zeitraum von 1997 bis 2007 stiegen die Medikamentenkosten um das Dreieinhalbfache der Beitragseinnahmen, Abbildung 5 (Probst 2010). Die öffentlichen Kosten im Arzneimittelsektor machten im Jahr 2008 3.017 Mio. Euro oder 22 % der Krankenversicherungsausgaben aus (Hauptverband 2009b, S. 15). Damit ist dieser Sektor nach der Anstaltspflege und der ärztlichen Hilfe der drittgrößte Ausgabeposten der sozialen Krankenversicherung. Ein Plus von 7,4 % der Ausgaben der Arzneimittel von 2007 auf 2008 wurde verzeichnet (Hauptverband 2009b, S. 10).
Abb. 5: Steigerung wichtiger Positionen in der Krankenversicherung 1997-2007 in Prozent
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Probst 2010
Im internationalen Vergleich liegt Österreich mit 13,3 % (2007) der Gesundheitsausgaben für Medikamente unter dem OECD-Durchschnitt von 17,1 %. In den vergangenen zehn Jahren stieg, wie in vielen OECD-Ländern, auch in Österreich der Anteil der Arzneimittelkosten an den gesamten Gesundheitsausgaben (OECD 2009c).
Die Steigerung der Heilmittelkosten der sozialen Krankenverischerung sind bedingt durch Mengeneffekte und Struktureffekte. Die Mengeneffekte stellen die Anzahl der verschriebenen Medikamente dar, die 2008 60 % der Steigerung ausmachten (Kandlhofer 2008, S. 9).
Die Struktureffekte, die im selben Jahr 37,4 % der Erhöhung erklären, beziehen sich auf neue Medikamente, die auf dem Markt gekommen sind. Der Rest, 2,6 %, sind das Ergebnis des gemischten Effektes (Kandlhofer 2008, S. 9).
Den hohen Preis teurer Medikamente begründen Pharmafirmen mit den hohen Forschungsaufwendungen (Laimböck 2009, S. 84). Allerdings betragen die Herstellungskosten der Medikamente nur 3-20 % des Verkaufspreises. Der Rest ist Profit der Pharmafirmen (Laimböck 2009, S. 85). Die staatlich garantierte Patentschutzfrist von 15-20 Jahren, Anreiz für die Erforschung neuer Wirkstoffe, nutzt die Pharmaindustrie um bedeutende Gewinne zu erzielen (Laimböck 2009, S. 83). Demnach können Medikamente unter Patentschutz 23-mal so teuer wie Medikamente ohne Patentschutz (Laimböck 2009, S. 88).
Nach dem Ablauf des Patentschutzes können dieselben Medikamenten von anderen Herstellern als Generika angeboten werden. Der preisliche Unterschied kann bis zu 90 % ausmachen. Der Generika-Anteil am Apothekenmarkt in Österreich erhöhte sich von 7,4 % im Jahr 2000 auf 25 %, wobei diese nur 14,5 % der Kosten im Jahr 2007 ausmachten (Laimböck 2009, S. 92). Berechnungen ergaben, dass ein verstärkter Generikaeinsatz zu jährlichen Einsparungen von rund € 30-40 Mio. führen könnten (Österreichische Apothekerkammer 2009, S. 62).
Aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Krankenkassen haben die öffentlichen Apotheken einen Finanzierungsbeitrag von rund € 25 Mio. für die Jahre 2008 bis 2010 zur Sanierung der Krankenkassen zugesagt (Österreichische Apothekerkammer 2009, S. 53).
2.2.2.3. Technologischer Wandel
Gemäß den zahlreichen makroökonomischen Studien spielt der technologische Wandel eine wichtige Rolle beim Anstieg der Gesundheitsausgaben. Ihm wird bis zu 50 % der Wachstumsrate zugerechnet. Dieser wiederspiegelt sich in der Einführung neuer oder modifizierter Technologien, der Intensität der Nutzung vorhandener Technologien oder der erweiterten Anwendung dieser neuen Technologien (OECD 2003, S. 198).
In den meisten OECD-Ländern hat es vor allem bei den kostenintensiven diagnostischen Technologien (z. B. CT und MRI) einen Schub gegeben (Rauner 2008, S. 948). Wie im Kapitel 2.2.1.1. erwähnt, befindet sich Österreich in bezug auf Computertomografie-Scannern (CT) und Magnetoresonanztomografen (MRI) im OECD-Vergleich ganz weit oben (OECD 2009c).
Das rapide Wachstum kann ebenso bei der Anwendung vieler chirurgischer Eingriffe wie z. B. beim Grauen Star, Knie- und Hüftgelenkersatz und den Eingriffen am Herz verzeichnet werden (Streissler 2004, S. 23).
Nicht zu vernachlässigen ist die Tatsache, dass die Verbreitung der neuen Technologien angebotsinduziert stattfindet. Das bedeutet, dass diese auch dann vom Leistungsanbieter offeriert werden, obwohl sie nur wenig zur Verbesserung des Gesundheitszustandes beitragen (Henke und Schreyögg 2004, S. 41; Laimböck 2009, S. 47).
Gleichzeitig haben die Erfindungen, Innovationen und Imitationen von Technologien die Effizienz der Erbringung von Gesundheitsleistungen bedeutend verbessert. Die endoskopische Chirurgie hat z. B. einen deutlichen Beitrag zur Senkung der Kosten geleistet. Zusätzlich hat der technologische Fortschritt einen Einfluss auf die Lebenserwartung und die Arbeitsfähigkeit der Bevölkerung. Ein besseres Gesundheitswesen führt auch zu gesünderen Arbeitskräften und zu höherer Produktivität. Somit kann die ökonomische Wachstumsrate eines Landes erhöht werden (Henke und Schreyögg 2004, S. 41).
Trotz der Vorteile wird langfristig die öffentliche Hand eine stärkere Rolle bei der Kosten-Nutzen-Evaluation von neuen Technologien einnehmen müssen, um die Ausgabendynamik zu begrenzen (Streissler 2004, S. 23).
Das Health Technology Assessment (HTA) ist ein Instrument zur transparenten systematischen Evaluierung und Bewertung bereits eingeführter und neuer medizinischer Technologien inklusive Arzneimittel und Medizinprodukte (d. h. Verfahren, Leistungen, Prozeduren etc.). Organisationsstrukturen, in denen medizinische Leistungen erbracht werden, können ebenfalls anhand von diesem bewertet werden. In vielen Ländern (z.
B. Deutschland) sind HTA-Institutionen zur Beratung politischer Entscheidungsträger im Gesundheitswesen bereits seit Jahren etabliert (Antony et al. 2009, S.1).
In den Jahren 2007 und 2008 hat das Bundesministerium für Gesundheit die Gesundheit Österreich GmbH/ das Bundesinstitut für Qualität im Gesundheitswesen (GÖG/ BIQG) mit diversen Projekten im Bereich HTA beauftragt. Dazu zählen die internationale Bestandserhebung (GÖG/ BIQG 2008), die Entwicklung von Grundlagen für eine nationale HTA-Strategie, eine Methodensammlung und ein Prozesshandbuch für HTA, ein Internetführer „HTA im Netz“, die Förderung von internationaler Vernetzung und Kooperationen im Bereich HTA sowie die Erstellung von HTA-Berichten und Quick Assessments (Antony et al. 2009, S. 52).
Seit Ende 2008 steht ein Erstentwurf der nationalen HTA-Strategie, welcher von der GÖG/ BIQG-HTA im Auftrag des BMG inhaltlich entwickelt und organisatorisch betreut wurde (Antony 2009, S. 52). Dieser steht in einer ständigen Weiterentwicklung. Einzelne Schritte bedürfen inhaltlichen Präzisierungen (z. B. Prozess der Themenfindung und -priorisierung), andere Punkte konnten ansatzweise bereits umgesetzt werden (z. B. Erstangebot an Schulungen) bzw. wurden teilweise umgesetzt (Einrichtung von Gremien und Zuweisung von Aufgaben) (Antony et al. 2009, S. 53).
Trotz erster Erfolge bleit HTA in Österreich rechtlich nicht verankert. Entscheidungen über das Angebot öffentlich finanzierter Gesundheitsleistungen werden somit nicht anhand von HTA getroffen. Teilaspekte der klassischen HTA-Inhalte wie Wirksamkeit oder Sicherheit lassen sich jedoch in den rechtlichen Regelungen wiederfinden. Effizienz oder Kosten-Nutzen-Relation sind nur vereinzelt als Kriterien für die Erstattung bzw. Abrechenbarkeit von Leistungen festgeschrieben. Gesundheitsökonomische Evaluationen werden zumeist nicht gefordert. In den derzeit bestehenden Regelungen von Entscheidungsprozessen zeigt sich die starke Ausrichtung an der (sektoralen) Zuständigkeit der Finanzierungsträger (siehe Kapitel 6.1.) (Antony et al. 2009, S. 31f). Das Instrument wird von politischen Entscheidungsträgern wenig eingesetzt, wobei die Nutzung zumeist nicht systematisch erfolgt. Handlungsbedarf besteht ebenfalls hinsichtlich der Transparenz in den Entscheidungsprozessen (Antony et al. 2009, S. 36).
2.2.2.4. Demografische Entwicklung
Die finanziellen Schwierigkeiten der österreichischen Krankenversicherung können derzeit nicht auf die demografische Entwicklung zurückgeführt werden (Probst 2004, S. 113). Die demografische Herausforderung besteht jedoch darin, dass die höhere Lebenserwartung im Zusammenhang mit einer niedrigen Geburtenrate zu einer Überalterung der Bevölkerung und somit zu Veränderungen in der Leistungsinanspruchnahme führen werden (Henke und Schreyögg 2004, S.15f; Schmandlbauer 2006, S. 10). Zahlreiche industrialisierte Länder wie Deutschland, Japan, Frankreich, Niederlanden etc. müssen sich dieser Herausforderung schon jetzt stellen (Henke und Schreyögg 2004, S.15f; Rauner 2008, S. 949).
Probst zeigt in seiner Modellrechnung aus dem Jahr 2002, ohne Anspruch auf eine Prognose, wie sich die Beitrags- und Leistungsströme entwickeln könnten, wenn sich das österreichische Gesundheitswesen der demografischen Entwicklung nicht stellt (siehe Abbildung 6) (Probst 2004, S.113f).
Die grünen Pfeile stellen die von der jeweiligen Bevölkerungsgruppe gezahlten Beiträge dar, die roten zeigen die Kosten der konsumierten Leistungen der sozialen Krankenversicherung (Probst 2004, S.113f).
Abb. 6: Fiktion der Beitrags- und Leistungsströme hochgerechnet auf die Bevölkerungsstruktur des Jahres 2030
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Probst 2004, S. 113
Aus den Daten der Statistik Austria in Bezug auf die Entwicklung der Bevölkerungszahl und -struktur in Österreich geht hervor, dass die Bevölkerung parallel zu ihrem Wachstum altern wird (Statistik Austria 2009b, S. 50).
Die Anzahl der Jugendlichen und Kinder, die 15,2 % (2008) der Gesamtbevölkerung ausmachen, wird bis 2030 um 4 % sinken. Gleichzeitig wird die Zahl der Erwerbstätigen im Alter zwischen 15 und 60 Jahren von 62,2 % (2008) auf 54,8 % im Jahr 2030 zurückgehen (Statistik Austria 2009b, S. 50).
Der Prozentsatz der über 60-Jährigen liegt bei 22,6 % (1,8 Mio.) (2008) und wird im Jahr 2030 den Wert von 49 % erreichen. Der Anstieg, der über 75-Jährigen wird besonders stark sein (Statistik Austria 2009b, S. 51).
Im Jahr 2008 umfasste diese Bevölkerungsgruppe 662.000 Personen. Laut Prognose wird sie bis 2030 um 54 % steigen und dann einen Anteil von 1,02 Mio. Personen ausmachen (Statistik Austria 2009b, S. 51).
Diese Entwicklung wird zu einer Veränderung in der Leistungsinanspruchnahme und somit zur Steigerung der Kosten und gleichzeitig der Ausgaben führen. Hofmarcher und Röhrling (2003) haben in ihrer Studie zur Vorausschätzung der Gesundheitsausgaben in Österreich errechnet, dass ein Anstieg von einem Prozent der Gruppe der über 65-Jährigen zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Gesundheitsausgaben pro Kopf um 1,8 % führen wird (Hofmarcher und Röhrling 2003, S. 18). Schätzungen des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger weisen für die Gruppe der über 80-Jährigen 6-mal so hohe durschnittliche Gesundheitskosten pro Kopf auf als für die 20 - 29-Jährigen (Schmandlbauer 2006, S. 10). Mit steigendem Alter nehmen die Krankenhausaufenthaltsdauer aufgrund von Begleitkrankheiten sowie der Interventionen zu. Gleiches konnte im Falle des Medikamentenbedarfs beobachtet werden (Endel 2009, S. 7ff).
Weiter beweisen internationale Studien, dass sich ein großer Teil der Gesundheitsausgaben auf die letzten Jahre und Monate vor dem Tod des Patienten konzentrieren. Für Österreich ergibt sich folgendes: 80 % der Kosten, die im stationären Sektor anfallen sowie rund 58 % derer im ambulanten Sektor werden von Patienten im letzten Lebensjahr vor ihrem Tod verursacht (Czypionka et al. 2007b, S. 9).
All diese Faktoren der demografischen Veränderung werden das österreichische Gesundheitssystem vor zusätzliche Herausforderungen stellen, allen voran den Bereich der Mittelaufbringung (Probst 2004, S. 113; Endel 2009, S. 13).
Die Beitragseinnahmenerosion, die Medikamentenkostenentwicklung, der technologische Fortschritt sowie die demographische Entwicklung tragen dazu bei die Fiananzierungsproblematik der sozialen Krankenversicherung insbesondere in Zukunft aktuell zu halten. Darüberhinaus tragen die Organisations- und Finanzierungsstruktur des österreichischen Gesundheitssystems dazu bei, dass Unter-, Über- oder Fehlversorung entstehen (siehe Kapitel 6.3.1.). Als Beispiel kann die strikte Trennung zwischen intramuralem (ambulant) und extramuralem (stationär) Bereich angeführt werden. Die Folge der desintegrierten Versorgung von Praxen, Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen führt zu Mehrkosten durch Doppeluntersuchungen und zu medizinischen Nachteilen mangels Koordination der Behandlungen (Laimböck 2009, S. 32).
Mit den entsprechenden Anreizen und Kontrollen könnte z. B. der stationäre Bereich in Österreich um mindestens 15 % reduziert werden ohne dabei die Qualität zu beeinträchtigen (Laimböck 2009, S. 44).
Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in Deutschland merkt an, dass der Schlüssel zu Verringerung von Über-, Unter- und Fehlversorgung und mehr Effizienz die Schaffung wettbewerblicher Strukturen sei. Dies würde den Teilnehmern auf dem Gesundheitsmarkt mehr Anreize für Wirtschaftlichkeit geben (BMWI 2006, S. 7).
Welcher Wettbewerb im sozialen Versicherungssystem möglich ist, welche Länder diesen bereits eingeführt haben und die derzeitigen Ergebnisse werden im Folgekapitel erläutert.
2.3. Der Wettbewerb auf dem Gesundheitsmarkt
Bis zu einem bestimmten Grad erfährt fast jedes Gesundheitssystem weltweit einen staatlichen Eingriff. Völlig unregulierte Märkte im Gesundheitswesen sind daher sehr selten. Zwar werden die Lösungen des freien Marktes (Wettbewerb) für effizient gehalten, gültig ist das hingegen nicht für alle Wirtschaftsgüter (Donaldson and Gerard 2005, S. 15).
„Gibt es im Wirtschaftsbereich Gesundheitswesen Besonderheiten, die es verbieten, Markt- und Wettbewerb als Steuerungsprinzip ohne Weiteres einzusetzen, oder wird es Zeit die alten Zöpfe einer staatsinterventionistischen Regulierung des Gesundheitswesens endlich abzuschneiden ...“ (Hajen et al. 2006, S. 47).
2.3.1. Besonderheiten des Gesundheitsmarktes
In der Literatur wird auf zahlreiche mögliche Marktfehler im Gesundheitswesen hingewiesen, die zum Marktversagen führen. Ein Marktversagen liegt immer dann vor, wenn die Voraussetzungen des vollkommenen Marktes nicht erfüllt sind (Hajen et al. 2006, S. 57). Es muss gegeben sein, dass z. B. der Anbieter und Nachfrager unabhängig von einander handeln, dass der Nachfrager vollständig informiert ist und rational handelt, dass die Kosten und der Nutzen auf den jeweiligen Käufer und Verkäufer anfallen und nicht beim Dritten etc. (Hajen et al. 2006, S. 51).
Folgende Vier sind die wichtigsten Marktfehler im Gesundheitsmarkt: Öffentliche Güter und Externalitäten, Informationsasymmetrien, Marktmacht und Verteilungsungerechtigkeit (Hajen et al. 2006, S. 57; Breyer et al. 2005, S. 174).
2.3.1.1. Öffentliche Güter und Externalitäten
Die Kollektivguteigenschaft der öffentlichen Güter führen zu externen Effekten (Externalitäten) (Breyer et al. 2005, S. 179; Hajen et al. 2006, S. 58). Das Kollektivgut oder öffentliche Gut zeichnet sich dadurch aus, dass jeder in der Gesellschaft dieselbe Einheit von diesem nutzen und dass niemand von dessen Nutzung augeschlossen werden kann (Breyer et al. 2005, S. 176). Daher entfallen Nutzen und Kosten auf Personen (Trittbrettfahrer), die mit der Kauf-/ Verkaufsentscheidung nichts zu tun haben (Breyer et al. 2005, S. 179; Hajen et al. 2006, S. 58). Als Beispiel kann die Impfung angeführt werden. Diese schützt nicht nur den Geimpften sondern auch jene Personen, die selbst keine erhalten haben (Breyer et al. 2005, S. 179; Hajen et al. 2006, S. 59).
2.3.1.2. Informationsasymmetrien
Fehlende Markttransparenz und Konsumentensouveränität verhindern, dass die Marktteilnehmer ausreichend und in gleichem Maße informiert sind. Dieses beeinflusst das Arzt-Patienten-Verhältnis und steuert womöglich auf eine angebotsinduzierte Nachfrage und adverse Selektion (siehe Kapitel 2.1.1.) zu (Hajen et al. 2006, S. 64; Hajen et al. 2006, S. 73). Bei der angebotsinduzierten Nachfrage wird die Nachfrage nach ärztlichen Leistungen durch den Leistungsanbieter aufgrund des Informationsvorsprungs erhöht (Hajen et al. 2006, S. 71). Hofmarcher et al. (2004) fanden in ihrer Studie über die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen in der Europäischen Union Hinweise auf Marktversagen in den neuen EU-Mitgliedsändern. Weiter zeigt die Studie, dass eine hohe Arztdichte zu einer erhöhten Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen führt (Hofmarcher et al. 2004, S. 1ff).
2.3.1.3. Verteilungsungerechtigkeit
Ein Markt in dem Wettbewerb stattfindet, selektiert wer in den Genuß eines Gutes kommt und wer nicht. Das bedeutet, dass der Markt Personen benachteiligt oder bevorzugt (Hajen et al. 2006, S. 5). Zum Beispiel kann HIV-Infizierten und AIDS-Kranken die Behandlung verweigert werden, wenn die Betroffenen nicht dafür bezahlen können oder wollen. Hier differenziert der Markt, verteilt unterschiedlich Lebenschancen, wodurch Ungleichheiten verstärkt werden (Hajen et al. 2006, S. 56f).
Die eben erwähnten Marktfehler zeigen, dass Markt- und Wettbewerbsprinzipien nur eingeschränkt einsetzbar sind (Hajen et al. 2006, S. 87). Der staatliche Eingriff beruht auf dem Gerechtigkeitsempfinden und im System der Sozialversicherung auf dem Solidaritätsprinzip (siehe Kapitel 2.1.2.) (Breyer et al. 2005, S. 187; Saltman 2004, S. 170). Gleichzeitig führt dieser Eingriff nicht notwendigerweise zu einer effizienteren Produktion. Trotz der genannten Besonderheiten kann Wettbewerb ein belebendes Element sein und die Wirtschaftlichkeit der Versorgung vorantreiben (Hajen et al. 2006, S. 87).
Der Wettbewerb in den unterschiedlichen Gesundheitssystemen wurde im Kapitel 2.1. kurz angeschnitten. Um das Informationsspektrum der vorliegenden Arbeit einzugrenzen, geht der folgende Abschnitt auf den Wettbewerb in der Sozialversicherung ein. Die Logik für einen Wettbewerb im Sozialversicherungssystem liefert die Theorie der „managed competion“ von Enthoven, die besagt, dass ein regulierter Wettbewerb zum effizienteren Ressourceneinsatz, einer Einschränkung der Gesundheitsausgaben und zur Qualitätsverbesserung führen wird (Saltman 2004, S. 174).
2.3.2. Wettbewerb im System der Sozialversicherung
Im Allgemeinen ergeben sich im Gesundheitswesen Interaktionen zwischen drei Teilnehmern: dem Versicherten/ Patienten, dem Leistungserbringer und der Krankenversicherung (Kumpmann 2008, S. 218; Cassel et al. 2006, S. 23).
Abb. 7: Wettbewerb im Gesundheitswesen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Cassel et al. 2006, S. 23
Abbildung 7 zeigt, dass der Wettbewerb auf unterschiedlichen Ebenen/ Märkten stattfinden kann:
- zwischen den Krankenversicherungen (Krankenkassen), um Versicherte auf dem Versicherungsmarkt zu gewinnen,
- zwischen Leistungserbringern um Verträge mit Krankenkassen auf dem Leistungsmarkt und
- zwischen Leistungserbringern um Patienten auf dem Behandlungsmarkt.
Kostensenkungen und Qualitätssteigerungen werden als positive Effekte erwartet (Kumpmann 2008, S. 218; Saltman 2004, S. 171; Nuscheler 2005, S. 29; Cassel et al. 2006, S. 23).
Derzeit findet in Österreich keine Art von Wettbewerb statt (Saltman 2004, S. 182). Länder wie die Niederlande, Belgien, Israel und Deutschland haben diesen mit dem Ziel eines effizienteren Ressourceneinsatzes, der Einschränkung der Gesundheitsausgaben und der Qualitätsverbesserung eingeführt (Saltman 2004, S. 170; Saltman 2004, S. 175f; Nuscheler 2005, S. 29; Kumpmann 2008, S. 221). Die Schweiz wird hier nicht erwähnt, da sie nur über eine Pflichtversicherung verfügt und ansonsten der Gesundheitsmarkt dem Wettbewerb unterliegt.
2.3.2.1. Wettbewerb der Krankenkassen um Versicherte-Versicherungsmarkt
Die Voraussetzungen für diesen Wettbewerb sind, dass Versicherte ihre Kasse frei wählen können und die Kasse selbst die Beitragshöhe bestimmen kann und über Entscheidungsfreiheiten bezüglich Leistungen, wie dem Umfang und der Ausgestaltung des Leistungskatalogs sowie der Auswahl der Leistungserbringer verfügt. Der Output seitens der Krankenkassen sollte ein präferenzkonformes Angebot, gute Qualität und niedrige Kosten in der Gesundheitsversorgung sein (Kumpmann 2008, S. 218; Nuscheler 2005, S. 29). Allerdings schränkt der gesetzlich vorgeschriebene Mindestleistungskatalog im System der sozialen Krankenversicherung die Variationen des Leistungsumfang ein (Kumpmann 2008, S. 218).
In diese Richtung bewegt sich das Modell Managed Care. Es zeigt, dass Krankenkassen die Finanzierungs- und die Leistungserbringerfunktion erfolgreich verbinden können. Sie bieten ihren Mitgliedern nicht nur die Kostenübernahme, sondern ein Gesamtkonzept von Leistungen und Versorgungsformen, das ihnen ermöglicht sich von Angebot anderer Kassen zu unterscheiden (Kumpmann 2008, S. 218).
2.3.2.2. Wettbewerb der Leistungserbringer um Patienten-Behandlungsmarkt
Ein Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern ist möglich, jedoch stark reguliert. Ein preisbezogener Wettbewerb zumeist nicht möglich, daher orientiert sich der Wettbewerb auf den Zugang, den Ort der Niederlassung und Qualität (Nuscheler 2005, S. 20). Die Qualitätssteigerung ließe sich durch die Erhöhung der Markttransparenz erreichen, wie z. B. durch Patientenorganisationen, Krankenkassen oder Ärztevereinigungen, die Informationen über Leistungserbringer veröffentlichen. Hingegen besteht weniger Anreiz zur Kosteneinsparung wegen des fehlenden Preiswettbewerbs (Kumpmann 2008, S. 218).
Die freie Ärztewahl bringt einen Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern hervor. Sie wird jedoch deshalb kritisiert, weil im Falle einer Diagnose und Therapie, die mehrere Dienstleister erfordert, diese untereinander zu schlecht abgestimmt sind. Als Alternative werden Hausarztmodelle vorgeschlagen (Kumpmann 2008, S. 218).
2.3.2.3. Wettbewerb der Leistungserbringer und Krankenkassen-Leistungsmarkt
Diese Form des Wettbewerbs würde die Konkurrenz der Leistungserbringer und der Krankenkassen um die Vergabe von Versorgungsaufträgen einleiten, wenn kein „Kontrahierungszwang“ (Pflicht der gesetzlichen Krankenkassen neue Mitglieder unabhängig von deren Alter, Gesundheitszustand und ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit aufzunehmen) herrschen würde und die Krankenkassen selektive Verträge (auswählen bzw. ausschließen) mit den Leistungserbringern eingingen (Kumpmann 2008, S. 218; Cassel et al. 2006, S. 24f; Gabler Wirtschaftslexikon 2010a). Ein System selektiver Verträge setzt einen rechtlichen und administrativen Rahmen voraus. Dieser müsste die hohen Transaktionskosten der Vertragsverhandlungen zwischen Krankenkassen und individuellen Leistungserbringern (zentrale Kollektivverhandlungen) ausgleichen (Kumpmann 2008, S. 218). Wenn kein Wettbewerb über den Preis möglich ist, könnte wenigstens ein Qualitätswettbewerb der angebotenen Leistungen stattfinden (Saltman 2004, S. 177).
2.3.2.4. Ausschnitt aus dem derzeitigen Wettbewerb in der sozialen Krankenversicherung
Zurzeit konkurrieren lediglich niederländische, belgische, israelische, schweizerische und deutsche Krankenkassen um Versicherte. Die Festlegung des Beitragssatzes durch die Krankenkassen ist nur in den Niederlanden und in der Schweiz möglich. In Deutschland ist das Modell 2009 ausgelaufen (siehe Kapitel 5.2.). In allen genannten Ländern werden der Leistungskatalog und die Ärztevergütung zentral festgelegt, wobei meistens die Kassen Ärzte unter Vertrag nehmen. Die Niederlande und Israel erlauben selektive Verträge der Kassen mit Leistungserbringern (Kumpmann 2008, S. 221).
Deutschland und die Schweiz bieten Versorgungsformen ohne freie Arztwahl bei Beitragsermäßigungen an. Über den Service und die Verwaltung wird versucht, Kosteneinsparungen und Qualitätsverbesserungen zu erzielen (Kumpmann 2008, S. 221).
Die freie Wahl des Arztes (in der Praxis und im Krankenhaus) ermöglicht den Wettbewerb der Leistungserbringer um Patienten. Der direkte Zugang zu Fachärzten ist in Deutschland, Belgien und der Schweiz indessen garantiert. Allerdings befinden sich in Deutschland und der Schweiz Vertragsformen mit beschränkter Arztwahl. Der Zugang zum Facharzt ist in den Niederlanden im Rahmen des Primärarztmodells an die Überweisung des Allgemeinmediziners gebunden (Kumpmann 2008, S. 221).
2.3.2.5. Ergebnisse des Wettbewerbs in der sozialen Krankenversicherung
Wegen der beschränkten Möglichkeiten der Krankenkassen (Deutschland), kostensenkende Maßnahmen zu ergreifen, beschränkt sich die Frage der Kostendämpfung auf Verwaltungsausgaben. Eine mangelhafte Anzahl von validen Daten erschwert einen internationalen Vergleich. Deshalb werden die Landesdaten im Zeitverlauf betrachtet (Kumpmann 2008, S. 221).
Die Niederlande vermelden seit dem Kassenwettbewerb einen Rückgang der Verwaltungskosten. Nur in Deutschland stiegen sie seit der Einführung der Wahlfreiheit der Krankenkassen im Jahr 1997 an. Begründet werden sie mit der komplizierten Struktur des Gesundheitswesens, der Einführung der Krankenhausvergütung (G-DRG, German Diagnosis Related Groups) (siehe Kapitel 5.3.) den neuen Versorgungsformen (Integrierte Versorgung, Disease Management-Programmen usw.) (siehe Kapitel 5.4.1.) und den Marketingmaßnahmen zur Anwerbung der Durchführung des Risikostrukturausgleichs (Kumpmann 2008, S. 221).
Die gesetzliche Freiheit, selektive Verträge einzugehen, unterbleibt oft und wird damit begründet, dass den meisten Versicherten ihre Bindung an ihren Arzt (Hausarzt) wichtiger sei als die an den Versicherer (Kumpmann 2008, S. 222).
Der Wettbewerb der Leistungserbringer um Kranke entfällt, wenn Ärzte zentral vertreten sind, wie z. B. in Israel. Die EUROCOM-Studie (Vergleichende Studie zur Hausarzt-Patient-Kommunikation in sechs europäischen Ländern) sowie die EUROPED-Studie (Europäische Gemeinschaftsstudie zur Evaluation von Patientenbedürfnissen in 15 Ländern) zeigen, dass der Wettbewerb der Leistungserbringer um Patienten einen Leistungsanreiz darstellt und dass die Patienten in Ländern ohne Primärarztsystem (Deutschland, Belgien) mit ihren Hausärzten zufriedener sind (Bahrs 2003, S. 18; GeMeKo 2004, S.1; Kumpmann 2008, S. 222).
Die Effizienz des Wettbewerbs in der sozialen Krankenversicherung bleibt aus. Der erste Grund ist der Verteilungsschlüssel nach welchem die Kassen ihr Geld zugewiesen bekommen. Dieser basiert auf Durschnittskosten und spornt die Krankenkassen an ihre Versicherten nach Risikolevel auszuwählen. Folglich muss jedes Jahr ein Kostenaugleich zwischen Krankenkassen statt finden. Den zweiten Grund liefert der unvollständige Übergang der Krankenkassen vom Versorger zum wirklichen Einkäufer von Leistungen. Die Versorgung wird noch immer ungleichmäßig, strikt organisiert und öffentlich kontrolliert. Hinzu kommen hohe Transaktionskosten im System aufgrund der anfallenden Marketingkosten der Krankenkassen (Saltman 2004, S. 180f).
Insgesamt leidet die Aufrechterhaltung der Gerechtigkeit. Da Krankenkassen ihre Konsumenteninformationen ihrer Marketingstrategie anpassen dürfen, können Gruppen wie Ältere und chronisch Kranke gezielt umgangen werden (Saltman 2004, S. 181f).
Der Wettbewerb im System der Sozialversicherung stößt auf die Komplexität der Struktur des Gesundheitswesens, das sozialpolitische Ziel einer vom Einkommen unabhängigen Gesundheitsversorgung für Alle und dem entsprechend regulierenden Mechanismus (hinsichtlich der Eintragung ohne Zulassungsvoraussetzungen, den Risikoausgleichmechanismen, obligatorischen Vertragsabschluss mit allen Leistungserbringern, Pflichtversicherung für alle oder den meisten Bürgern etc.) (Kumpmann 2008, S. 223; Saltman 2004, S. 179).
Kumpmann schlägt vor, mehr in Richtung detailorientierter Lösungen mit einer Kombination der Vorteile verschiedener Wettbewerbsmodelle zu gehen. Beispiele gibt es ausreichend: Modelle mit beschränkter Arztwahl (Managed Care, Hausarztmodelle), Modelle ohne Einschränkung wie medizinische Netzwerke oder die stärkere Einbeziehung von Krankenhäusern in die ambulante Versorgung (Kumpmann 2008, S. 223). In diese Richtung bewegt sich die österreichische Ärztekammer mit dem Vorschlag Managed Care-Strukturen im Gesundheitswesen einzuführen (ÖÄK 2008).
Managed Care ist ein Modell des regulierten Wettbewerbs im Gesundheitswesen und ein Modell neuer Beziehungen zwischen den Leistungserbringern, Beitragszahlern und Versicherten (Hable 2002, S. 14). Die Organisation von Managed Care verlangt nach marktgetriebenen Lösungen für Probleme, für die Kosteneindämmung und für den Zugang und Qualität der Versorgung (Hable 2002, S. 28). Zugleich ist Managed Care der Versuch einer sozialen und politischen Neuordnung im Gesundheitswesen, die die klare Grenze zwischen Medizin und Wirtschaft zum Verschwimmen bringt (Hable 2002, S. 28). Deshalb werden im nächsten Kapitel die Entstehungsgeschichte, die Umsetzung und die Ergebnisse von Managed Care beleuchtet.
3. Managed Care
Um das Thema Managed Care hat sich eine umfangreiche und komplexe Literatur entwickelt. Dieses Kapitel hat das Ziel, eine leichte und verständliche Zusammenfassung von Managed Care zu geben. So soll eine schnelle Orientierung in der Managed Care-Landschaft möglich sein.
3.1. Definition von Managed Care
Managed Care ist kein Synonym für das amerikanische Gesundheitswesen. Tatsache bleibt, dass in den USA die meisten Managed Care-Instrumente und -Organisationsformen entwickelt wurden (Amelung 2007, S. 8). Im Laufe der Zeit entstanden zahlreiche unterschiedliche Definitionen, die gemäß dem Verständnis und der Herkunft des Autors unterschiedlich ausfallen. In dieser Arbeit werden drei von ihnen zitiert.
Definition aus der amerikanischen Literatur
„’Managed care is a system that integrates the efficient delivery of your medical care with payment of the care. In other words, managed care includes both the financing and delivering of care.’ (Cafferky et al. 1997, S.3f.)“ (Amelung 2007, S. 6).
Definition aus der deutschen Literatur
„’In den USA ist Managed Care ein Überbegriff für eine nicht solidarisch finanzierte, kommerzialisierte versicherungsrechtliche Form medizinischer Dienstleitungsprozesse in der Regel für Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen. In Deutschland versteht man unter Managed Care kontext- und systemabhängig lediglich Elemente zur zielgerichteten Steuerung medizinischer Versorgungsabläufe unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten’. (Schluckebier 2003, S. 42)“ (Amelung 2007, S. 7).
Definition von Professor Amelung
„Managed Care ist die Anwendung von Management-Prinzipien, die zumindest partielle Integration der Leistungsfinanzierung und -erstellung, sowie das selektive Kontrahieren der Leistungsfinanzierer mit ausgewählten Leistungserbringern. Ziel ist die effiziente Steuerung der Kosten und Qualität im Gesundheitswesen.“ (Amelung 2007, S. 7f).
Das wesentliche Merkmal von Managed Care ist die effiziente Steuerung der Leistungserstellung im Gesundheitswesen. Die Erhöhung der Versorgungsqualität bei gleichzeitiger Kostensenkung sollen durch die Anwendung und Durchsetzung von Managementprinzipien und Instrumente erreicht werden (Rachold 2000, S. 53).
Die Entstehung von Managed Care, die Organisationsformen und die konkreten Instrumente, anhand von Beispielen aus den USA, sind Thema der folgenden Unterkapitel.
3.2. Die Entstehung von Managed Care
Die USA der 1920er und 1930er Jahre sind die Geburtsstätte erster Managed Care-Modelle, sogenannter Prepaid Group Practices (PGPs). Die Prepaid Group Practice ist die unmittelbare Vorgängerin der Health Maintenance Organization (HMOs) (Amelung 2007, S. 45; Kongstevdt 1996, S. 4). Bis in die 1970er Jahre erreichten Gruppenpraxen landesweit weniger als 1,5 % der Bevölkerung (Neuffer 1997, S. 118). Die Entwicklungen der Jahre 1950, 1960 und 1970 wie steigende Versicherungsprämien der traditionellen Krankenversicherungen und steigende Kosten der staatlich finanzierten Gesundheitsversicherungsprogramme für Ältere bzw. sozial Schwächere (Medicare und Medicaid, die Mitte der 1960er Jahre eingeführt wurden) leiteten eine bedeutende Veränderung ein. Diese mündete 1973 unter der Nixon-Administration im Gesetz „Health Maintenance Organization Act (HMO-Act)“ (Neuffer 1997, S. 118f; Wiechmann 2003, S. 52).
Dabei wurde die Basis der modernen Managed Care-Modelle gesetzt. Mit dem Ziel, die HMOs zu stärken, wurde die Zuteilung von staatlichen Fördermitteln zur Gründung und zum Aufbau von Managed Care-Organisationen (MCO) sowie die Verpflichtung der Arbeitgeber, ihren Angestellten alternative Formen von Krankenversicherung anzubieten, gesetzlich festgelegt. Der Gesetzgeber beabsichtigte durch die Kostenvorteile der HMOs, die traditionelle Krankenversicherung unter Wettbewerbsdruck zu setzen, um eine effizientere Versorgung zu erreichen (Neuffer 1997, S. 119; Wiechmann 2003, S. 52). Die Förderung des Wettbewerbs im Gesundheitswesen unter der Reagan-Administration, gekoppelt an das Auslaufen der staatlichen Subventionen in den 80er Jahren, führte zur Umwandlung vieler MCO von gemeinnützigen in profitorientierte Unternehmen (Neuffer 1997, S. 121; Wiechmann 2003, S. 52). Das Kapitel „4.4. Managed Care-private und staatliche Pläne“ bietet ausführlichere Informationen und genaue statistische Daten dazu.
3.3. Managed Care-Organisationen, Managed Care-Instrumente und Beteiligte
Abbildung 8 stellt die Managed Care-Organisationen (MCO) in ihrer wesentlichen Form dar. Sie unterscheiden sich in der Art der Zusammenarbeit zwischen den Leistungserbringern sowie in der Struktur und den Prozessen der Versorgung (Wiechmann 2003, S. 49; Amelung 2007, S. 47). Die einzelnen Punkte der Abbildung 8 werden in den anschliessenden Unterkapiteln des dritten Teils dieser Arbeit näher erläutert.
Abb. 8: Managed Care-Organisationen und Managed Care-Instrumente
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wiechmann 2003, S. 51
Die Beteiligten in diesem System (Managed Care-Umfeld) sind die Versicherten, die Leistungserbringer und die Leistungsfinanzierer (Krankenversicherung). Die Ausgestaltung der Vertragsbeziehungen und Versorgungsprozesse zwischen ihnen werden mittels Managed Care-Instrumente geregelt (Wiechmann 2003, S. 50).
Gemäß seinen Bedürfnissen kann der Versicherte in diesem System zwischen differenzierten Leistungsangeboten auswählen. Seiner Konsumentensouveränität stehen hohe Informationskosten und eine hohe Marktintransparenz der Gesundheitsleistungen gegenüber. Das Verhältnis Versicherter (Patient)-Leistungserbringer verändert sich, weil der Leistungserbringer seine eigenen und die Interessen des Leistungsfinanzierers vertreten muss (Amelung 2007, S. 10). Je nach Versicherungsform bekommt der Versicherte entweder direkt die benötigte Gesundheitsleistung oder deren Kosten erstattet (zum Teil oder gesamt) (Weiner et al. 2001, S. 3).
Der Leistungsfinanzierer erhält im Managed Care-Umfeld eine aktive Rolle. Hier wird eine managementorientierte Administration des Versicherungsverhältnisses übernommen sowie steuernd eingegriffen und selektiv kontrahiert (Amelung 2007, S. 10). Sowohl der Staat als auch der Arbeitgeber können Sponsoren sein (Weiner et al. 2001, S. 4).
Leistungserbringer sind einzelne Ärzte, Krankenschwestern und Institution, die die medizinische Behandlung der Versicherten übernehmen (Weiner et al. 2001, S. 4). Ihre Entscheidungskompetenz wird durch den Leistungsfinanzierer eingeschränkt (Amelung 2007, S. 10).
Neue Organisationsformen wie die Management Service Organization (MSO) und Physician Practice Management Organization (PPMO) bieten managementorientierte Beratungen und die Übernahme der Teilfunktionen im Leistungserstellungsprozess an, beispielsweise Leistungen im medizinischen Prozess, z. B. Utilization Review, oder im klassischen Managementbereich die Steuerung eines Netzwerks (Amelung 2007, S. 9ff).
Die Rolle des Staates verändert sich. Sie reduziert sich auf die Schaffung von wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen und die Sicherstellung einer externen Qualitätskontrolle (Amelung 2007, S. 12).
3.4. Managed Care-Organisationen
Die zahlreichen Managed Care-Organisationsformen integrieren Versicherung und Leistungserbringung im unterschiedlichen Maß und setzen dementsprechend Managed Care-Instrumente ein (Amelung 2007, S. 45). Diese Arbeit bezieht sich auf die reine Form der einzelnen Modelle.
3.4.1. Versicherungsorientierte Managed Care-Organisationen
Zu den versicherungsorientierten Manged Care-Organisationen zählen die weiter unten genannten Health Maintenance Organizations und das Point-of-Service-System.
3.4.1.1. Health Maintenance Organizations
Die Staff-, Group-, Network- und Individual Practice Associations (IPA)-HMOs zählen zu den HMO-Modellen. Die ursprüngliche Form von HMO erbringt sämtliche Versicherungs-, Finanzierungs- und Versorgungsaufgaben selbst. In der Zwischenzeit gliedern abgestufte Mischformen von HMOs teilweise die Finanzierungs- und Versicherungsfunktionen an andere Krankenversicherungen aus und gehen Kooperationen mit externen Leistungsanbietern ein (Wiechmann 2003, S. 53). Die HMOs sind keine reine Finanzierungsstelle, sie greifen mittels der Managed Care-Instrumenten aktiv in den Leistungserstellungsprozess ein (Amelung 2007, S. 49).
3.4.1.1.1. Staff-HMO
Leistungserbringung und Finanzierung sind an einer Stelle gebündelt (Amelung 2007, S. 53). Die zentralen MCO-eigenen Behandlungszentren ermöglichen den direkten Kontakt untereinander und die Nutzung der homogenen technischen Ausstattung. Der Versicherte erhält die gesamte medizinische Versorgung an einem Ort/ Behandlungszentrum. Hohe Investitions- und fixe Betriebskosten für die Behandlungszentren und die Ärztegehälter (Festgehälter und leistungsabhängige Boni), die Einschränkung der Wahlmöglichkeiten für die Versicherten sowie eine schwächere Vertrauensbasis der Versicherten in die Belegschaft spiegeln die negative Seite wider (Rachold 2000, S. 78; Wiechman 2003, S. 54; Neuffer 1997, S. 148; Amelung 2007, S. 54). Die Anzahl der Staff-HMOs ist von 36 Staff-HMOs in 1997 auf 12 in 2007 geschrumpft (Amelung 2007, S. 54; Sanofis Aventis HMO/PPO Digest 2008, S. 8).
3.4.1.1.2. Group-HMO
Die Group-HMO schließt einen Vertrag exklusiv mit einer rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen Arztgruppe ab (Amelung 2007, S. 56; Neuffer 1997, S. 148). Die Entlohnung der Arztgruppe findet in Form einer Kopfpauschale oder Einzelleistungsvergütung statt. Die Kehrseite für den Versicherten ist die begrenzte Auswahl der Ärzte und der dezentralen Behandlungseinrichtungen (Neuffer 1997, S. 148). Von 94 Goup-HMOs in 1997 gab es 2007 noch 34 (Amelung 2007, S. 57; Sanofis Aventis HMO/PPO Digest 2008, S. 8).
3.4.1.1.3. IPA-HMO
Verträge werden zwischen einer oder mehreren Independent Practice Organizations (IPAs), einer rechtlich eigenständigen Gruppe wirtschaftlich unabhängiger Haus- und Fachärzte und einer oder mehreren HMOs abgeschlossen (Wiechmann 2003, S. 54). Im Außenverhältnis werden die IPAs meistens über eine Kopfpauschale honoriert. Im Innenverhältnis werden die meisten Ärzte entweder über Kopfpauschale, Einzelleistungsvergütung oder Mischformen vergütet (Amelung 2007, S. 59). Über Vereinheitlichungen (z. B. EDV-Bereich) lassen sich Leistungserbringer und Versicherte lenken. IPAs benötigen relativ geringe Investitionen (Ärzte behalten ihre Praxis) und sind dank des einheitlichen Ansprechpartners kostengünstig zu steuern (Neuffer 1997, S. 147; Amelung 2007, S. 57). Der Verwaltungskostenanteil liegt mit 12 % unter den branchenüblichen 15 % (Amelung 2007, S. 68).
Die höhere Marktmacht der IPA hat eine negative Auswirkung auf die MCO, denn diese müssen unter Umständen Zugeständnisse bei Konditionen machen. Ein Beispiel wäre den Ärzten eine erweiterte Behandlungsfreiheit einzuräumen (Amelung 2007, S. 59; Neuffer 1997, S. 148). Der Vorteil für die Versicherten ist die große Auswahl an Ärzten (Amelung 2007, S. 59). Die IPAs stellen den am schnellsten wachsenden Modelltyp der HMOs dar. 2007 gab es 238 IPAs im Vergleich zu 34 Group-HMOs, 12 Staff-HMOs und 159 Network-HMOs (Sanofis Aventis HMO/PPO Digest 2008, S. 8).
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842807990
- DOI
- 10.3239/9783842807990
- Dateigröße
- 2.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Wien – Wirtschaftswissenschaften, Internationale Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2010 (Dezember)
- Note
- 2
- Schlagworte
- managed care österreichisches gesundheitssystem deutsches integrierte versorgung amerikanisches
- Produktsicherheit
- Diplom.de