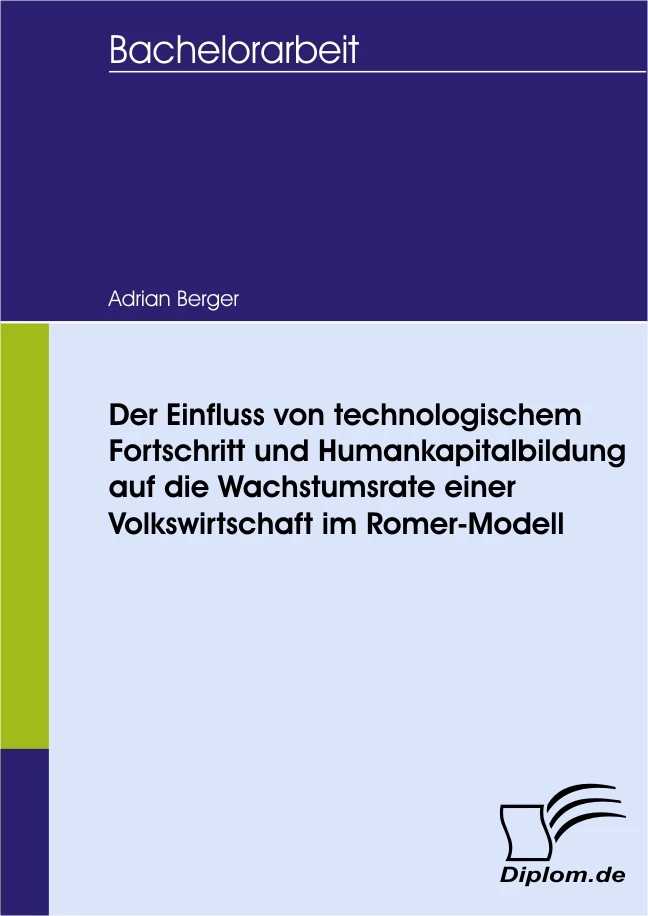Der Einfluss von technologischem Fortschritt und Humankapitalbildung auf die Wachstumsrate einer Volkswirtschaft im Romer - Modell
©2010
Bachelorarbeit
50 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Wachstum stellt einen der zentralen Bausteine in verschiedensten Bereichen des Lebens dar, mit denen jede Person tagtäglich konfrontiert wird. Es wird zum Beispiel als Begründung für eine Vielzahl von wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen genutzt oder um bestimmte Handlungen innerhalb von Unternehmen zu rechtfertigen.
Wie entsteht Wachstum? Worauf baut es auf? Und warum wachsen einige Volkswirtschaften schneller als andere?
Genau diese Fragen will die vorliegende Ausarbeitung versuchen zu beantworten. Anhand der wissenschaftlichen Arbeit Endogenous Technological Change von Paul Michael Romer aus dem Jahr 1990 sollen Antworten auf diese Fragestellungen gefunden werden. Das Innovationsmodell Romers wird als eine der bahnbrechendsten Arbeiten der jüngeren Wachstumstheorie angesehen. Paul Romer selbst zählte laut Time Magazine zu einem der 25 einflussreichsten Amerikaner Ende der 90er Jahre. Der Kernpunkt dieses Modells stellt die Erklärung des technologischen Fortschritts auf Basis der Humankapitalbildung aus dem Modell heraus in den Mittelpunkt. Dieser Anstoßpunkt diente und dient weiterhin als Grundlage für eine Vielzahl von weiteren Modellbildungen innerhalb der neuen endogenen Wachstumstheorie.
Im zweiten Abschnitt dieser Bachelorarbeit soll ein kurzer zeitgeschichtlicher Überblick gegeben werden. Von der exogenen Wachstumstheorie mit den klassischen Vertretern wie Harrod und Domar über den Neoklassiker Solow soll ein Übergang zur Neuen, der endogenen, Wachstumstheorie, mit den Modellen von Rebelo, Uzawa und Lucas sowie Aghion und Howitt geschaffen werden.
Im dritten Abschnitt wird das Kernmodell von Paul Romer und dessen Gleichgewichtsberechnung dargestellt. Ein besonderes Augenmerk wird in diesem Bereich auf das Humankapital sowie den technologischen Fortschritt innerhalb einer Volkswirtschaft gerichtet. Da Romers Arbeit aus Kritik an der exogenen Wachstumstheorie entstand, wird auch hier großen Wert auf eine kritische Würdigung des betrachteten Modells gelegt.
Im vierten und inhaltlich abschließenden Abschnitt findet das Modell von Paul Romer seine Anwendung und soll als Grundlage für realistische Aussagen über das unterschiedliche Wachstum von Volkswirtschaften sowie Empfehlungen für eine wachstumsgerechte Wirtschaftspolitik fungieren. Abgerundet werden die Untersuchungen dieses Kapitels mit einer Stellungnahme zu den aktuellsten, von Romer untersuchten Entwicklungen. Den Abschluss bildet das […]
Wachstum stellt einen der zentralen Bausteine in verschiedensten Bereichen des Lebens dar, mit denen jede Person tagtäglich konfrontiert wird. Es wird zum Beispiel als Begründung für eine Vielzahl von wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen genutzt oder um bestimmte Handlungen innerhalb von Unternehmen zu rechtfertigen.
Wie entsteht Wachstum? Worauf baut es auf? Und warum wachsen einige Volkswirtschaften schneller als andere?
Genau diese Fragen will die vorliegende Ausarbeitung versuchen zu beantworten. Anhand der wissenschaftlichen Arbeit Endogenous Technological Change von Paul Michael Romer aus dem Jahr 1990 sollen Antworten auf diese Fragestellungen gefunden werden. Das Innovationsmodell Romers wird als eine der bahnbrechendsten Arbeiten der jüngeren Wachstumstheorie angesehen. Paul Romer selbst zählte laut Time Magazine zu einem der 25 einflussreichsten Amerikaner Ende der 90er Jahre. Der Kernpunkt dieses Modells stellt die Erklärung des technologischen Fortschritts auf Basis der Humankapitalbildung aus dem Modell heraus in den Mittelpunkt. Dieser Anstoßpunkt diente und dient weiterhin als Grundlage für eine Vielzahl von weiteren Modellbildungen innerhalb der neuen endogenen Wachstumstheorie.
Im zweiten Abschnitt dieser Bachelorarbeit soll ein kurzer zeitgeschichtlicher Überblick gegeben werden. Von der exogenen Wachstumstheorie mit den klassischen Vertretern wie Harrod und Domar über den Neoklassiker Solow soll ein Übergang zur Neuen, der endogenen, Wachstumstheorie, mit den Modellen von Rebelo, Uzawa und Lucas sowie Aghion und Howitt geschaffen werden.
Im dritten Abschnitt wird das Kernmodell von Paul Romer und dessen Gleichgewichtsberechnung dargestellt. Ein besonderes Augenmerk wird in diesem Bereich auf das Humankapital sowie den technologischen Fortschritt innerhalb einer Volkswirtschaft gerichtet. Da Romers Arbeit aus Kritik an der exogenen Wachstumstheorie entstand, wird auch hier großen Wert auf eine kritische Würdigung des betrachteten Modells gelegt.
Im vierten und inhaltlich abschließenden Abschnitt findet das Modell von Paul Romer seine Anwendung und soll als Grundlage für realistische Aussagen über das unterschiedliche Wachstum von Volkswirtschaften sowie Empfehlungen für eine wachstumsgerechte Wirtschaftspolitik fungieren. Abgerundet werden die Untersuchungen dieses Kapitels mit einer Stellungnahme zu den aktuellsten, von Romer untersuchten Entwicklungen. Den Abschluss bildet das […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Adrian Berger
Der Einfluss von technologischem Fortschritt und Humankapitalbildung auf die
Wachstumsrate einer Volkswirtschaft im Romer - Modell
ISBN: 978-3-8428-0727-3
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2011
Zugl. Universität Bremen, Bremen, Deutschland, Bachelorarbeit, 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2011
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ... II
Abbildungsverzeichnis ... IV
Symbolverzeichnis ... V
1. Einleitung: Problemstellung und -behandlung ... 1
2. Inhaltliche und zeitgeschichtliche Einordnung ... 2
2.1 Vergleich der endogenen und exogenen Wachstumstheorie ... 2
2.1.1 Die exogene Wachstumstheorie am Beispiel des Solow Modells ... 2
2.1.2 Ursprung der endogenen Wachstumstheorie ... 3
2.2 Wichtige Modelle der endogenen Wachstumstheorie im Überblick... 4
2.2.1 Modelle mit konstantem Technologieparameter ... 5
2.2.1.1 Uzawa - Lucas Modell (1965 / 1988) ... 5
2.2.1.2 AK Modell (1991) ... 6
2.2.2 Modellbeispiel mit variablen Technologieparameter nach Aghion & Howitt ... 7
3. Beschreibung des Romer - Modells ... 8
3.1 Grundlegende Annahmen des Modells ... 8
3.2 Die Angebotsseite ... 11
3.2.1 Der Forschungssektor ... 11
3.2.1 Der Zwischenproduktsektor ... 13
3.2.2 Der Endproduktsektor ... 16
3.3 Die Nachfrageseite - Konsumentenverhalten im Romer Modell ... 17
3.4 Theoretische Gleichgewichtsbestimmung im Romer Modell ... 19
3.5 Theoretische und empirische Kritikpunkte am Romer - Modell ... 24
4. Anwendung und Realitätsbezug des Romer- Modells ... 25
4.1 Berechnung des Wachstumsgleichgewichts unter verschiedenen Bedingungen ... 26
4.2 Realitätsbezogene Betrachtungen und Ausblick ... 31
4.2.1 Wirtschaftspolitische Empfehlungen ... 31
4.2.2 Ausblick auf Romers weitere Arbeit ... 32
5. Fazit ... 33
6. Anhang ... 35
6.1 Ergänzende Herleitungen ... 35
6.2 Abbildungen und Tabellen ... 37
6.3 Literaturverzeichnis ... 39
Abbildungsverzeichnis
3.1 Eigenschaften verschiedener Güter...10
3.2 Abhängigkeiten zwischen Zins, Humankapital und Wachstumsrate...23
4.1 Gleichgewichtsentwicklung bei Präferenzveränderung...27
4.2 Die Beziehung zwischen Humankapital und Wachstum...28
4.3 Auswirkungen einer Produktivitätssteigerung...29
Symbolverzeichnis
Deutsches Alphabet
A
vorhandenes Wissen bzw. Technologieparameter
A
neu generiertes Wissen
B veränderte Wertpapierhaltung der Konsumenten / Ersparnis
C
Konsum
C
neu generierter Konsum
g
Wachstumsrate
h
durchschnittlicher Bildungsgrad eines Arbeiters als Humankapital
h
neu generierter durchschnittlicher Bildungsgrad eines Arbeiters als Humankapital
h
a
Faktor zur Beschreibung der externen Effekte des Humankapitals
H
Humankapital
H
Y
Humankapital im Endproduktsektor
H
A
Humankapital im Forschungs- & Entwicklungssektor
H
neu generiertes Humankapital
K
Kapital
K
neu generiertes Kapital
L
ungelernte Arbeit
p (x) Preis eines Zwischenproduktes
p (i) Preis des i - ten Zwischenproduktes
P
A
Preis eines Designs
r
Zinssatz
t
Zeitfaktor
U
Nutzenniveau
u
aufgewendete Arbeitszeit im Uzawa Lucas - Modell
w
Humankapitallohn
w
H
A
Humankapitallohn im Forschungssektor
w
H
Y
Humankapitallohn im Endproduktsektor
x
Zwischenprodukt
x (i) i-tes Zwischenprodukt
Y
Produktionsoutput
Y
neu generierter Produktionsoutput
Griechisches Alphabet
Summenzeichen
Produktionselasitzität der Cobb Douglas - Produktionsfunktion
Produktionselasitzität der Cobb - Douglas - Produktionsfunktion
Preiselastizität
Elastizität des Faktors h
a
Uzawa Lucas - Modell
Produktivitätsparameter
L
Produktivitätsparameter im Bildungssektor im Uzawa - Lucas - Modell
1
intertemporale Substitutionselastizität
Grenznutzenelastizität
Ergänzungsvariable / Konstante
Gewinn
Zeitpräferenz
obere Zeitgrenze einer Integralfunktion
Multiplikator
Weitere Symbole
obere Grenze einer Integralfunktion ,,unendlich"
1
1. Einleitung: Problemstellung und -behandlung
Wachstum stellt einen der zentralen Bausteine in verschiedensten Bereichen des Lebens dar,
mit denen jede Person tagtäglich konfrontiert wird. Es wird zum Beispiel als Begründung für
eine Vielzahl von wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen genutzt oder um bestimmte
Handlungen innerhalb von Unternehmen zu rechtfertigen.
Wie entsteht Wachstum? Worauf baut es auf? Und warum wachsen einige Volkswirtschaften
schneller als andere?
Genau diese Fragen will die vorliegende Ausarbeitung versuchen zu beantworten. Anhand der
wissenschaftlichen Arbeit ,,Endogenous Technological Change" von Paul Michael Romer aus
dem Jahr 1990 sollen Antworten auf diese Fragestellungen gefunden werden. Das
Innovationsmodell Romers wird als eine der bahnbrechendsten Arbeiten der jüngeren
Wachstumstheorie angesehen. Paul Romer selbst zählte laut ,,Time Magazine" zu einem der
25 einflussreichsten Amerikaner Ende der 90er Jahre (vgl. Time Magazine, 1997). Der
Kernpunkt dieses Modells stellt die Erklärung des technologischen Fortschritts auf Basis der
Humankapitalbildung aus dem Modell heraus in den Mittelpunkt. Dieser Anstoßpunkt diente
und dient weiterhin als Grundlage für eine Vielzahl von weiteren Modellbildungen innerhalb
der neuen endogenen Wachstumstheorie.
Im zweiten Abschnitt dieser Bachelorarbeit soll ein kurzer zeitgeschichtlicher Überblick
gegeben werden. Von der exogenen Wachstumstheorie mit den klassischen Vertretern wie
Harrod und Domar über den Neoklassiker Solow soll ein Übergang zur ,,Neuen", der
endogenen, ,,Wachstumstheorie", mit den Modellen von Rebelo, Uzawa und Lucas sowie
Aghion und Howitt geschaffen werden.
Im dritten Abschnitt wird das Kernmodell von Paul Romer und dessen
Gleichgewichtsberechnung dargestellt. Ein besonderes Augenmerk wird in diesem Bereich
auf das Humankapital sowie den technologischen Fortschritt innerhalb einer Volkswirtschaft
gerichtet. Da Romers Arbeit aus Kritik an der exogenen Wachstumstheorie entstand, wird
auch hier großen Wert auf eine kritische Würdigung des betrachteten Modells gelegt.
Im vierten und inhaltlich abschließenden Abschnitt findet das Modell von Paul Romer seine
Anwendung und soll als Grundlage für realistische Aussagen über das unterschiedliche
Wachstum von Volkswirtschaften sowie Empfehlungen für eine ,,wachstumsgerechte"
Wirtschaftspolitik fungieren. Abgerundet werden die Untersuchungen dieses Kapitels mit
einer Stellungnahme zu den aktuellsten, von Romer untersuchten Entwicklungen. Den
Abschluss bildet das Fazit, welches die Ergebnisse der vorliegenden Ausarbeitung
zusammenfasst und Resümee zieht.
2
2. Inhaltliche und zeitgeschichtliche Einordnung
Dieses Kapitel widmet sich im ersten Teil dem Überblick über die Entstehung der
neoklassischen, exogenen und der neuen endogenen Wachstumstheorie. Im zweiten Teil
stehen die inhaltlichen Unterschiede innerhalb der endogenen Wachstumstheorie anhand von
ausgewählten Beispielen im Vordergrund und dienen der Überleitung zum eigentlichen
Hauptteil.
2.1 Vergleich der endogenen und exogenen Wachstumstheorie
Die folgenden Beschreibungen dienen dem Grundverständnis des jeweiligen Theoriegebildes.
Als Grundlage der exogenen Wachstumstheorie wird das neoklassische Solow Modell im
ersten Unterpunkt mit einem kurzen Exkurs in die postkeynesianische Wachstumstheorie
dargestellt. Im zweiten Abschnitt werden die erste Arbeit von Romer sowie ihre
Auswirkungen auf die Entstehung und Weiterentwicklung der endogenen Wachstumstheorie
beschrieben. Innerhalb dieser Darstellungen werden mathematische Skizzierungen bewusst
zurückhaltend eingesetzt, da sich vorrangig eher dem inhaltlichen Verständnis zugewandt
werden soll.
2.1.1 Die exogene Wachstumstheorie am Beispiel des Solow Modells
Aus Kritik an der postkeynesianischen Wachstumstheorie, vormerklich durch Harrod und
Domar geprägt, entstand der neoklassische Zweig der exogenen Wachstumstheorie.
Beanstandet wurde, dass zwar Wachstum, welches in Abhängigkeit der Nachfrage entstand,
für essentiell befunden, aber keine Aussagen über das Arbeitskräftewachstum oder eine
spezifische Produktionsfunktion gemacht wurden (vgl. Sala - i - Martin, 1990). Robert M.
Solow entwickelte in Reaktion auf diese Kritik das sogenannte Solow Modell und legte den
Grundstein für die produktionsseitig abhängige neoklassische Wachstumstheorie.
1
Solow geht
dabei in seinem Modell von einer linearen, homogenen Produktionsfunktion mit
abnehmenden Grenzerträgen in Abhängigkeit der variablen und aggregierten Faktoren Kapital
und Arbeit aus (vgl. Solow, 1956). Gerade in der Variabilität dieser Faktoren liegt auch der
grundlegende Unterschied zu den Modellen von Harrod und Domar. Diese verwenden in
ihren Modellen limitationale Produktionsfunktionen, die nicht von einer Substituierbarkeit der
einzelnen Faktoren untereinander ausgehen. Im Solow Modell beinhaltet die
Produktionsfunktion den technischen Fortschritt, dieser wird als exogen gegeben
1
Oftmals wird dieses Modell auch Solow Swan Modell genannt, da Swan nur wenige Monate nach Solow
ein nahezu identisches Modell veröffentlichte (vgl. Swan, 1956).
3
angenommen. Der entstehende Output im Solow Modell kann entweder konsumiert oder
zur Erhöhung des physikalischen Kapitalbestandes genutzt werden, der sich im Laufe der Zeit
abnutzt und demzufolge kontinuierlich ersetzt werden muss. Weitere grundlegende
Annahmen stellen zum einen dar, dass die Individuen in der jeweiligen Volkswirtschaft einen
konstanten Anteil am Einkommen zu Konsumzwecken verwenden und zum anderen, dass die
Bevölkerung konstant wächst. Solow geht des Weiteren in seinem Modell von dem Zustand
der vollkommenen Konkurrenz und Vollbeschäftigung aus (vgl. Rötheli, 1993).
In seiner Arbeit zeigt Solow, dass die gleichgewichtige ,,Steady State" Wachstumsrate
einer Volkswirtschaft bei konstanter Kapitalintensität erreicht wird, jedoch kein langfristiges
Pro - Kopf Wachstum auf Grund der abnehmenden Grenzerträge zustande kommt.
2
Dies
kann nach der betrachteten Sichtweise nur über die Erweiterung exogener Größen, wie den
technologischen Fortschritt oder des Faktors Arbeit geschehen (vgl. Solow, 1956).
Kritisch zu hinterfragen sind in diesem Modell die Annahmen, dass das Wachstum innerhalb
einer Volkswirtschaft durch exogene Größen wie den technologischen Fortschritt oder das
Bevölkerungswachstum bestimmt wird (Bodenhöfer, H. J. & Riedel M., 1998). Diese Kritik
erweist sich als Grundlage der im nächsten Abschnitt vorgestellten endogenen
Wachstumstheorie.
2.1.2 Ursprung der endogenen Wachstumstheorie
Die endogene Wachstumstheorie, auch ,,Neue Wachstumstheorie" genannt, ist seit Mitte der
80er Jahre einer der wohl bedeutendsten Forschungszweige der jüngeren Generation der
Wachstumstheorie. Sie versucht das Wachstum im Gegensatz zur exogenen
Wachstumstheorie innerhalb ihrer verschiedenen Modelle zu erklären. Romer widmete sich in
seiner Arbeit aus dem Jahre 1986 als einer der ersten dieser Problemstellung. Weitere
Arbeiten von Lucas, Rebelo und anderen namhaften Forschern sollten folgen.
In seinem Modell in ,,Increasing Returns and Long - Run Growth" beschreibt Romer ein
volkswirtschaftliches Wachstum basierend auf technologischen Spillovers als positive externe
Effekte (vgl. Romer, 1986). Dabei geht er von einer Produktionsfunktion mit konstanten
Skalenerträgen
aus,
welche
zum
Beispiel
Produktionsfaktoren
wie
das
unternehmensspezifische Wissen beinhaltet. Eben dieses spezifische Wissen erhöht den
bestehenden Wissensstand einer Volkswirtschaft und führt durch dessen Verbreitung zu den
bereits erwähnten positiven externen Effekten (Grieben, 2001). Auch hier wird schon der
Kapitalstockbegriff von Romer sehr weit gefasst, da zu seiner Vergrößerung
2
Steady State beschreibt ein Periodengleichgewicht in dem alle Pro - Kopf Variablen mit der gleichen
konstanten Wachstumsrate wachsen (vgl. Uzawa, 1961, S.123).
4
Sachkapitalinvestitionen mit learning by doing - Effekten ebenso einen Beitrag leisten wie
Investitionen in die Forschung und Entwicklung. Folgernd aus den Ergebnissen stellt sich im
ersten Romer - Modell aus dem Jahre 1986 eine langfristig positive Wachstumsrate des
Pro Kopf Einkommens dar (Unkelbach, 1995).
Die Verfechter der endogenen Wachstumstheorie können seit deren Anfängen trotz hoher
Heterogenität in zwei Gruppen eingeteilt werden:
Die eine Seite erklärt das endogene Wachstum trotz konstantem Technologieparameter. Zu
dieser Gruppe gehören zum Beispiel Modelle wie die von Uzawa Lucas oder das von Sergio
Rebelo.
Die zweite Gruppe widmet sich dem volkswirtschaftlichen Wachstum anhand eines variablen
Technologieparameters. Als Beispiele sind hier, das Aghion Howitt Modell mit vertikaler
Innovationstätigkeit oder das Romer - Modell aus dem Jahr 1990 zu nennen (vgl. Steger,
2003). Letztgenanntes, welches sich mit den horizontalen Innovationstätigkeiten innerhalb
einer Volkswirtschaft beschäftigt, wird im Verlaufe dieser Ausarbeitung noch näher
betrachtet.
Allen Modellen der neuen Wachstumstheorie sind jedoch folgende grundlegende Annahmen
gemeinsam: Zum einen bauen sie alle auf dem neoklassischen Wachstumsmodell auf. Weiter
endogenisieren sie auf ihre individuelle Art und Weise jeweils den technologischen
Fortschritt zum Beispiel durch learning by doing oder Spillover Effekte. Zum anderen
dient ihr als weitere theoretische Grundlage die Industrieökonomik (vgl. Bessau, 2006). Der
letzte Punkt dieser grundlegenden Annahmen wird anhand des im Verlaufe dieser Arbeit
vorgestellten Aghion Howitt Modells noch deutlich gemacht. Einige Ansätze für die
Unterschiede innerhalb der ,,Neuen Wachstumstheorie" gibt der folgende Unterpunkt.
2.2 Wichtige Modelle der endogenen Wachstumstheorie im Überblick
Im Folgenden wird ein Überblick über einige der einflussreichsten Modelle der endogenen
Wachstumstheorie gegeben. In der Darstellung wird dabei in die oben genannten zwei
Gruppen unterschieden. Die eine Gruppe generiert Wachstum trotz konstantem
Technologieparameter, die andere nutzt diesen in seiner Variabilität (vgl. Steger, 2003). Allen
ist an dieser Stelle gemein, dass ihre Inhalte bezüglich der Wachstumsentstehung in
vereinfachter Form dargestellt werden. Die Beschreibung der Modelle soll dem ersten
Verständnis von Wachstum innerhalb der endogenen Wachstumstheorie dienen und zum
eigentlichen Hauptteil, der Beschreibung und Anwendung des Romer Modells aus dem
Jahre 1990, überleiten.
5
2.2.1 Modelle mit konstantem Technologieparameter
In diesem Kapitel werden zwei bekannte Modelle der endogenen Wachstumstheorie
vorgestellt, die das Wachstum einer Volkswirtschaft trotz konstanten technologischen
Fortschritts beschreiben. Zuerst wird das Uzawa Lucas - Modell mit seinen zwei Sektoren
vorgestellt und darauffolgend das AK Modell von Sergio Rebelo.
2.2.1.1 Uzawa - Lucas Modell (1965 / 1988)
Das sogenannte Uzawa Lucas Modell wurde im Jahre 1988 von Robert E. Lucas
entwickelt, der sich stark an dem Modell von Hirofumi Uzawa aus dem Jahre 1965 orientiert
(vgl. Uzawa, 1965). In diesem Zwei Sektoren Modell, bestehend aus dem
Konsumgütersektor sowie dem durch Lucas neu eingeführten Bildungssektor für
Humankapitalausstattung, wird der Einfluss des technischen Fortschritts auf das
Wirtschaftswachstum anhand der Bildung von Humankapital erklärt.
Einer der zentralen Bausteine dieses Modells stellt die Cobb - Douglas - Produktionsfunktion
mit konstanten Skalenerträgen dar. Sie wird wie folgt vereinfacht ausgedrückt:
Y = A K(t)
[u(t) h(t) N(t)]
1-
h
a
(t)
mit , 1, 0 < u 1 sowie A > 0 (2.1)
Die Funktion setzt sich zusammen aus dem Sachkapital K und dem Humankapital, das durch
die Erwerbsbevölkerung N und den durchschnittlichen Bildungsgrad h repräsentiert wird.
Zusätzlich dazu steht der Faktor u für die aufgewendete Zeit im Produktionssektor. Der
Faktor A steht in diesem Fall für den positiv, konstanten Technologieparameter. h
a
bezeichnet
die externen Effekte, ausgehend vom Humankapital. Die einzelnen Faktoren stehen hierbei
jeweils in Beziehung zum jeweiligen Zeitpunkt t (vgl. Lucas, 1988).
Im Technologiesektor, der zweite grundlegende Baustein, führt die Nutzung der vorhandenen
Zeit 1-u aus dem Produktionssektor für Aus- oder Weiterbildungszwecke zur Akkumulation
von Humankapital. Lucas beschreibt diesen Prozess, indem er die Uzawa Rosen
Formulierung in seinem Modell einbringt, die sich wie folgt äußert (vgl. Uzawa, 1965 und
Rosen, 1976):
h t = h (t)
L
[1 u (t)]
(2.2)
h und h stehen an dieser Stelle jeweils für das neu generierte beziehungsweise für das schon
vorhandene Humankapital. Die Pro Kopf Wachstumsrate des Humankapitals erhält man
durch das Dividieren von h (t). Betrachtet man nun unter dieser Voraussetzung wieder die
Produktionsfunktion im Konsumgütersektor, so ist ersichtlich, dass dort zum einen ein
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842807273
- DOI
- 10.3239/9783842807273
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Bremen – 7 Wirtschaftswissenschaften, Studiengang Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2010 (November)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- paul romer humankapital endogene wachstumstheorie neue technologischer fortschritt
- Produktsicherheit
- Diplom.de