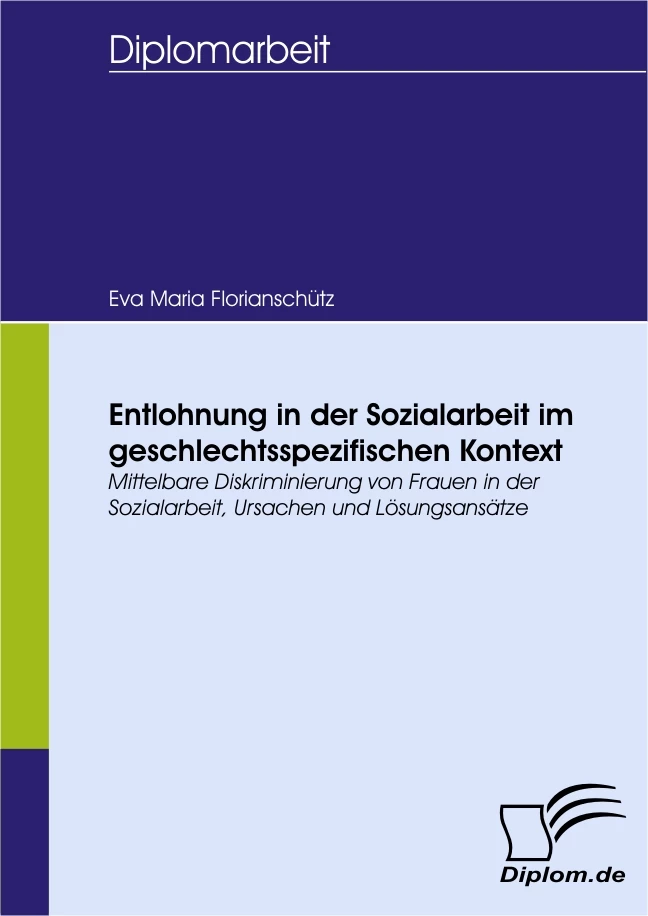Entlohnung in der Sozialarbeit im geschlechtsspezifischen Kontext
Mittelbare Diskriminierung von Frauen in der Sozialarbeit, Ursachen und Lösungsansätze
Zusammenfassung
Geschlechterspezifische Einkommensunterschiede stehen seit einigen Jahren regelmäßig im Blickpunkt der Presse und der Öffentlichkeit. So wurde am 13. April 2010 der sogenannte Equal Pay Day begangen. An diesem Tag haben es die Frauen in Österreich geschafft, das durchschnittliche Jahreseinkommen der Männer aus dem Jahr 2009 zu verdienen. Frauen müssen also im Durchschnitt mehr als dreieinhalb Monate länger arbeiten um ein gleich hohes Einkommen wie die Männer zu erreichen.
Österreich als Mitgliedstaat der Europäischen Union liefert, wie alle anderen Mitgliedstaaten, regelmäßig Datenmaterial über die Einkommenssituation von Frauen und Männern an die Europäische Kommission. Daraus wird eine gesamteuropäische Statistik erstellt. In dieser Statistik nimmt Österreich den vorletzten Platz ein. Das bedeutet, dass Österreich den zweithöchsten Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufweist.
Die vorliegende Arbeit setzt sich im Allgemeinen mit der Einkommenssituation von Frauen in der Europäischen Union und in Österreich auseinander. Im Speziellen wird die Frage untersucht, ob die Entlohnung in der Sozialarbeit für Frauen eine mittelbare Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts darstellt. Die von der Europäischen Union erhoben Faktoren, die zu einem geschlechtsspezifischen Einkommensunterschied führen, werden vorgestellt und die Ursachen dafür erforscht.
Das Kapitel Vom Ehrenamt zur Profession spannt den Bogen mit ausgesuchten, historischen Aspekten der Sozialarbeit bis hin zur aktuellen Situation der in diesem Berufsfeld beschäftigten Personen.
Dem Recht auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit einst und heute ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Es befasst sich u.a. mit der aktuellen Gesetzeslage und erklärt die wichtigsten rechtlichen Begriffe wie beispielsweise mittelbare Diskriminierung.
Mittelbare Diskriminierungen verbergen sich hinter vermeintlich objektiven Kriterien und Bestimmungen. Sie sind also auf den ersten Blick nicht erkennbar. Es bedarf detaillierte Erhebungen und eingehender Analysen, um mittelbare Diskriminierungen feststellen zu können. In Österreich bietet dafür der alle zwei Jahre erstellte Einkommensbericht des Rechnungshofes eine gute Grundlage dafür. Im Einkommensbericht werden als mögliche Ursachen der segregierte Arbeitsmarkt sowie die niedrige Entlohnung in den Bereichen, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind, genannt. […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
INHALT
1. Einleitung
2. Vom Ehrenamt zur Profession
2.1. Aktuelle Situation der Sozialarbeit in Österreich
2.1.1. Statistische Datenerfassung in Österreich
2.1.2. Studierende und Beschäftigte im Bereich der Sozialarbeit in Österreich
2.1.3. Handlungsfelder der Sozialarbeit in Österreich
2.1.4. Öffentliche und private Träger
2.1.5. Beschäftigungsverhältnisse in der Sozialarbeit
2.2. Begriffsbestimmungen
2.2.1. Sozialarbeit
2.2.2. Geschlechtsspezifische Diskriminierung
2.2.3. Entlohnung und Entgelt
2.2.4. Gleiche, gleichartige und gleichwertige Arbeit
2.2.5. Entgeltdiskriminierung – Beschäftigungsdiskriminierung
3. Das Recht auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit
3.1. Historische Aspekte des Rechts auf Gleichbehandlung
3.1.1. Gleichbehandlungsrecht in Österreich
3.1.2. Internationale Verpflichtungen und Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben
3.1.3. Entwicklung des österreichischen Gleichbehandlungsgesetzes
3.2. Der Einfluss des Europäischen Gerichtshofs
3.3. Das Gleichbehandlungsgesetz – (GlBG idF 2008/98)
3.3.1. Geltungsbereich, Ziel und Gleichbehandlungsgebot
3.3.2. Mittelbare Diskriminierung
3.3.3. Positive Maßnahmen
3.3.4. Entlohnungskriterien
3.4. Das Verhältnis des Kollektivvertrages zu anderen Rechtsquellen
4. Geschlechterspezifische Einkommensunterschiede in der Europäischen Union
4.1. Geschlechtsspezifisches Lohngefälle in der EU
4.2. Faktoren - die zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle in der Europäischen Union beitragen
4.2.1. Anhaltende geschlechtsspezifische Differenzen
4.2.2. Beschäftigungsquote von Frauen in der Europäischen Union
4.2.3. Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Frauenbeschäftigungsquote
4.2.4. Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
4.2.5. Teilhabe an Entscheidungsprozessen und Führungsaufgaben
4.3. Ursachen hinter den Faktoren
4.3.1. Ungleichbehandlung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt
4.3.2. Segregation oder der geteilte Arbeitsmarkt
4.3.3. Wertschätzung und Bewertung von Arbeit
4.4. Mittelbare Diskriminierung von Frauen in der EU
5. Geschlechterspezifische Einkommensunterschiede in Österreich
5.1. Zahlen und Daten zum geschlechtspezifischen Lohngefälle in Österreich
5.1.1. Daten des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger
5.1.2. Mikrozensuserhebung
5.1.3. Verdienststrukturerhebung
5.1.4. Lohn- und Einkommenssteuerstatistik der STATISTIK AUSTRIA
5.1.5. Bericht des Rechnungshofes gemäß Bezügebegrenzungsgesetz
5.2. Einkommensbericht des Österreichischen Rechnungshofes
5.2.1. Unselbstständig Erwerbstätige und Bruttojahreseinkommen
5.2.2. Einkommensunterschiede bei vollzeitbeschäftigten Personen
5.2.3. Teilzeit - ein weibliches Phänomen
5.2.4. Betriebszugehörigkeit und Einkommensunterschiede
5.2.5. Bildung und Einkommensunterschiede
5.2.6. Frauenanteil in Berufen und Branchen
5.2.7. Mittelbare Diskriminierung von erwerbstätigen Frauen in Österreich
5.3. Geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede in der Sozialarbeit
5.3.1. Teilzeit und prekäre Beschäftigung in der Sozialarbeit
5.3.2. Analyse der Auswertung des Jobverteilers
6. Ursachen der mittelbaren Diskriminierung in der Sozialarbeit
6.1. Geschlechterrollen, Normen, Werte und Stereotypen
6.1.1. Geschlechterrollen und -stereotypen
6.1.2. Normen
6.1.3. Werte und Arbeitswert
6.2. Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
6.2.1. Wechselwirkung zwischen Einkommen und Erwerbsunterbrechung
6.2.2. Europäische Vorgaben versus staatliche Anreizsysteme
6.2.3. Das Selbstverständnis der Frau als Zuverdienerin
6.3. Sozialarbeit in Österreich im geschlechtsspezifischen Blickwinkel
6.3.1. Wissen und Kompetenzen der Sozialarbeit
6.3.2. Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Sozialarbeit
6.3.3. Mehr Männer in die Soziale Arbeit
7. Gleichwertigkeit, Entlohnungssysteme und Arbeitsbewertung
7.1. Nationaler Aktionsplan zur Gleichstellung der Geschlechter in Österreich
7.1.1. Gleichwertigkeit von Arbeitsplätzen
7.1.2. Wie kann Gleichwertigkeit festgestellt werden?
7.1.3. Anforderungen an Entgeltsysteme – gegen eine Unterbewertung von frauendominierten Berufen
7.1.4. Anforderungskatalog an Entgeltsysteme
7.2. Arbeit neu bewerten
7.2.1. Kriterien der Lohnfindung in Österreich
7.2.2. Focus auf Unterbewertung von Tätigkeiten und Anforderungen
7.2.3. Arbeitsbewertung als Gestaltungselement gegen mittelbare Diskriminierung
7.2.4. Arbeitsbewertung in Kollektivverträgen und in Betrieben
7.2.5. Logik der Arbeitsbewertung
7.3. Konzepte der Arbeitsbewertung
7.3.1. Summarische Arbeitsbewertung
7.3.2. Analytische Arbeitsbewertung
7.3.3. Reihung und Stufung im Arbeitsbewertungsverfahren
7.3.4. Diskriminierungsproblematiken der analytischen Arbeitsbewertung
7.3.5. ABAKABA – ein diskriminierungsfreies Arbeitsbewertungssystem
7.4. Arbeitsbewertung in Kollektivverträgen
7.4.1. Kollektivvertrag der Eisen-/Metallerzeugenden und –verarbeitenden Industrie
7.4.2. Kollektivvertrag für Arbeitnehmerinnen, die bei Mitgliedern der Berufsvereinigung von Arbeitgebern für Gesundheit- und Sozialberufe (BAGS) beschäftigt sind
7.4.3. Vergleich zweier Berufseinsteiger/innen am segregierten Arbeitsmarkt
8. Fazit
9. Literaturverzeichnis
10. Abbildungsverzeichnis
11. Anhang
11.1. Lebenslauf
Vorwort
Die Thematik zu dieser Arbeit ist eng verknüpft mit meiner beruflichen Tätigkeit als Frauensekretärin im Österreichischen Gewerkschaftsbund. Als Mitglied der Gleichbehandlungskommission für die Privatwirtschaft bin ich immer wieder mit mittelbaren Diskriminierungen von Frauen aufgrund des Geschlechts konfrontiert. Daher habe ich mich entschlossen, meine Diplomarbeit dieser Problematik zu widmen.
Das Berufsfeld Sozialarbeit ist ein sehr plakatives Beispiel, um geschlechtsspezifische Diskriminierungen aufzuzeigen. Sozialarbeit ist eine Frauendomäne, niedriger entlohnt und mit einem geringen gesellschaftlichen Stellenwert versehen. Mir ist es wichtig, die Ursachen zu erforschen, aber auch Lösungsansätze zu bieten.
Ich möchte mich bei allen die zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen haben bedanken. Allen voran meiner Familie, die mich während meines gesamten Studiums unterstützt und die „Alltagsarbeit“ weit gehend von mir ferngehalten hat.
Ein besonderes Dankeschön gebührt meiner Betreuerin, Frau FH-Prof.in Dr.in Brigitta Zierer, die mich mit viel Geduld von den ersten Gedanken zu dieser Arbeit bis zu ihrer Fertigstellung begleitet hat.
Nicht zuletzt möchte ich bei meinen beiden Freundinnen Martina Culjak und Susanne Pöschl bedanken. Susanne für ihr engagiertes Korrekturlesen und ihre Verständnisfragen. Martina bin ich sehr verbunden für die anregenden Diskussionen, die mich dazu gebracht haben, mich auf die wesentlichen Inhalte zu konzentrieren. Beide haben dazu beigetragen, die vorliegende Arbeit für den/die Leser/in verständlich und lesbar zu gestalten.
Kurzfassung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit geschlechtsspezifischen Einkommensunterschieden von Frauen, deren Ursache in einer mittelbaren Diskriminierung liegt. Sie gewährt Einblick in die Sozialarbeit von einst bis jetzt. Im Zusammenhang mit dem Recht auf „gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit“ werden einige historische Aspekte dargestellt und die aktuelle Rechtslage erläutert. Es werden die wichtigsten mit der Problematik zusammenhängenden Begriffe erklärt. Die Thematik geschlechtsspezifischen Lohngefälles wird auf den Ebenen der Europäischen Union, Österreich und für den Bereich der Sozialarbeit untersucht. Der segregierte Arbeitsmarkt, gesellschaftliche Geschlechterrollen und –stereotypen stehen ebenso im Focus wie gesellschaftliche Normen und Werte. Im Zusammenhang mit mittelbarer Diskriminierung spielt die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und das Selbstverständnis der Frau als Zuverdienerin eine wichtige Rolle. Der abschließende Teil befasst sich mit Arbeitsbewertung, Entlohnungssystemen und Gleichwertigkeit von Arbeit. Am Beispiel eines Technikers und einer Sozialarbeiterin wird die angewendete Arbeitsbewertung in den betreffenden Kollektivverträgen analysiert und miteinander verglichen.
Abstract
Payment in the field of Social Work in the context of gender
Indirect discrimination of women in Social work - Causes and possible Solutions
The following paper examines the sex specific differences in the overall incomes of women caused by indirect discrimination. It aims to provide a glimpse into the field of Social Work from its beginnings up to now. Regarding the right to "Equal pay for equal work" it covers both historical aspects and the current legal situation. I`ll also attempt to explain the most important terms related to this topic. The topic of the gender pay gap will be examined both on an Austrian and European level with a special focus on the field of social work. There will also be a focus on the segregated job market, gender roles and stereotypes in society as well as social norms and values. Important aspects in covering the topic of indirect discrimination will be the division of labour between the sexes and the internalized self-image of women as subsidiary breadwinners or secondary income earners. The final part covers job evaluation, systems of payment and equality of work. Using the example of a male engineering technician and a female Social worker I´ll compare and analyze the methods of job evaluation in their respective collective wage agreements.
1. Einleitung
Geschlechterspezifische Einkommensunterschiede stehen seit einigen Jahren regelmäßig im Blickpunkt der Presse und der Öffentlichkeit. So wurde am 18. April 2010 der sogenannte „Equal Pay Day“ begangen. An diesem Tag haben es die Frauen in Österreich geschafft, das durchschnittliche Jahreseinkommen der Männer aus dem Jahr 2009 zu verdienen. Frauen müssen also im Durchschnitt mehr als dreieinhalb Monate länger arbeiten um ein gleich hohes Einkommen wie die Männer zu erreichen.
Österreich als Mitgliedstaat der Europäischen Union liefert, wie alle anderen Mitgliedstaaten, regelmäßig Datenmaterial über die Einkommenssituation von Frauen und Männern an die Europäische Kommission. Daraus wird eine gesamteuropäische Statistik erstellt. In dieser Statistik nimmt Österreich den vorletzten Platz ein. Das bedeutet, dass Österreich den zweithöchsten Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufweist.
Die vorliegende Arbeit setzt sich im Allgemeinen mit der Einkommenssituation von Frauen in der Europäischen Union und in Österreich auseinander. Im Speziellen wird die Frage untersucht, ob die Entlohnung in der Sozialarbeit für Frauen eine mittelbare Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts darstellt. Die von der Europäischen Union erhoben Faktoren, die zu einem geschlechtsspezifischen Einkommensunterschied führen, werden vorgestellt und die Ursachen dafür erforscht.
Das Kapitel „Vom Ehrenamt zur Profession“ spannt den Bogen mit ausgesuchten, historischen Aspekten der Sozialarbeit bis hin zur aktuellen Situation der in diesem Berufsfeld beschäftigten Personen.
Dem Recht auf „gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit“ einst und heute ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Es befasst sich u.a. mit der aktuellen Gesetzeslage und erklärt die wichtigsten rechtlichen Begriffe wie beispielsweise „mittelbare Diskriminierung“.
Mittelbare Diskriminierungen verbergen sich hinter vermeintlich objektiven Kriterien und Bestimmungen. Sie sind also auf den ersten Blick nicht erkennbar. Es bedarf detaillierte Erhebungen und eingehender Analysen, um mittelbare Diskriminierungen feststellen zu können. In Österreich bietet dafür der alle zwei Jahre erstellte Einkommensbericht des Rechnungshofes eine gute Grundlage dafür. Im Einkommensbericht werden als mögliche Ursachen der segregierte Arbeitsmarkt sowie die niedrige Entlohnung in den Bereichen, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind, genannt. Sozialarbeit gehört einer solchen „Niedriglohnbranche“, dem Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen an. Diese Branche zeichnet sich durch den höchsten Frauenanteil unter allen Branchen und vielen teilzeitbeschäftigten Frauen aus.
Die Sozialarbeit kämpft seit ihrer Entstehung mit der gesellschaftlichen Akzeptanz ihrer Arbeit. Sie leidet unter ihrer „Allzuständigkeit“ und ist immer wieder dem Vorwurf des nicht- bzw. semi-„professionellen“ Handelns ausgesetzt. Gleichzeitig wird der Sozialarbeit die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Ausbildung abgesprochen. Geschlechterstereotypen, Normen und Werte tragen ihres dazu bei, dass die Sozialarbeit in unserer Gesellschaft wenig Ansehen genießt.
Daher befasst sich das letzte Kapitel dieser Arbeit intensiv mit der Frage, welche Lösungsansätze die Sozialarbeit aus diesem Dilemma befreien können. Im Mittelpunkt stehen Entlohnungssysteme und ihr Einfluss auf die Bewertung von Arbeit. Es werden unterschiedliche Arbeitsbewertungsmethoden vorgestellt und ein Arbeitsbewertungssystem präsentiert, welches die Möglichkeit eröffnet, Arbeit diskriminierungsfrei zu bewerten. Anhand von zwei unterschiedlichen Kollektivverträgen wird aufgezeigt, wie sich die jeweils angewandte Arbeitsbewertungsmethode auf die Entlohnung auswirkt.
Abgerundet wird die vorliegende Arbeit mit einem Vergleich zwischen zwei Berufseinsteigerinnen am segregierten Arbeitsmarkt. Es wird dazu der Einstiegslohn eines Technikers und einer Sozialarbeiterin, beide Absolventen einer Fachhochschule, miteinander verglichen.
Am Ende steht ein Fazit, das sich intensiv mit den Ergebnissen zur Fragestellung der mittelbaren Diskriminierung von Frauen in der Sozialarbeit und möglichen Lösungsansätzen auseinandersetzt.
2. Vom Ehrenamt zur Profession
Der heutige Beruf Sozialarbeiter/in spiegelt in seiner Geschichte die weibliche Dominanz des Tätigkeitsfeldes wider. Sozialarbeit entstand aus dem ehrenamtlichen Engagement des Bürgertums – damals fast ausschließlich ausgeführt durch die mildtätige Arbeit der Frauen. Die Geschichte der Ausbildung ist ebenso durch Frauen geprägt. Die Entwicklung zum Berufsstand ist weiblichem Einsatz und Beharrlichkeit zuzuschreiben
Im 19. Jahrhundert und am Beginn des 20. Jahrhunderts lag die Versorgung von Armen und Kranken zum großen Teil bei privaten, meist konfessionellen Trägern. Die häufig unzulängliche kommunale Armenfürsorge war auf Stiftungsgelder, wohltätige Vereine und private Hilfsmaßnahmen angewiesen. Bereits in den Jahren vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte die traditionelle Armenpflege in den industrialisierten Ländern ausgedient. Es traten andere Formen der gesellschaftlichen Hilfe an die Stelle der privaten Wohltätigkeit. In Österreich wurde die private und kirchliche Wohltätigkeit zu einer Angelegenheit der öffentlichen Verwaltung. 1910 wurde in Wien die Berufsvormundschaft (Vormundschaft des Jugendamtes) für Kinder geschaffen, die von der Vorläuferin der späteren Jugendfürsorgerin, den so genannten Berufspflegerinnen ausgeübt wurde. (vgl. Simon 1995: 15f)
„Berufspflegerin“ konnten nur unbescholtene Personen im Alter zwischen 20 und 40Jahren werden. Sie mussten die Bürgerschule absolvieren, körperlich und geistig in guter Verfassung sein. Sie waren Hilfskräfte des Berufsvormundes. Ihr Dienstverhältnis war provisorisch, und sie standen im Taglohn. Das daraus resultierende Sozialprestige spiegelt sich noch heute im Verhältnis zwischen Sozialarbeitern/innen und Amtsvormündern wider. (vgl. Simon 1995: 16)
Eine bedeutende Pionierin der Sozialarbeit in Österreich war Ilse Arlt. Sie eröffnete 1912 die erste Schule zur Ausbildung von Fürsorgerinnen in Österreich unter dem Namen „Vereinigten Fachkurse für Volkspflege“. Dies war die dritte Ausbildungsstätte dieser Art weltweit. Die Absolventinnen dieser Schule hatten meist eine höhere Vorbildung und wurden spöttisch als "Hofratstöchter" bezeichnet. Sie unterschieden sich sowohl in der Ausbildung als auch in ihrer Herkunft von den Berufspflegerinnen der Jugendämter. Dies führte zu Konflikten innerhalb des Berufsstandes.
Aus den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges entstand die Einsicht, dass die vielschichtigen Probleme nur durch professionell ausgebildete Helfer/Innen zu bewältigen seien. So wurde 1916 die „Social-caritative Frauenschule der katholischen Vereinigung Niederösterreich“ als zweijährige Ausbildungsstätte für Fürsorgerinnen, die damals als Akademie geführt wurde, gegründet. In den folgenden Jahren entwickelten sich Speziallehrgänge sowie die „sozialpädagogische Erzieherschule", eine Vorläuferin der späteren "Institute für Sozialpädagogik". Für Ilse Arlt bedeutete die Ausbildung von Fürsorgerinnen ein wesentlicher Beitrag zu Frauenemanzipation. (vgl. Simon 1995: 17f)
Die Gründung der ersten Ausbildungsstätte für Sozialarbeit in Österreich erfolgte 1918 in der Zeit der Monarchie. Der Erste Weltkrieg und die damit verbundene schlechtere Versorgungslage hatten Massenelend und Hungersnöte mit sich gebracht. Sozialarbeit bedeutete zunächst das Bemühen um eine Sicherstellung der notwendigsten existenziellen Lebensgrundlagen. Gleichzeitig wurden bedeutende Kräfte dafür eingesetzt, Sozialarbeit als professionelles Handeln zu etablieren und die Voraussetzungen für eine entsprechende Ausbildung zu schaffen. Dieser Trend war europaweit zu beobachten. (vgl. Smejkal 1995: 6)
Der Schaffung der städtischen Akademie für soziale Verwaltung in Wien gingen die bereits erwähnten städtischen Fachkurse für Jugendfürsorge voraus. Die Ausbildungsstätte wurde zur Ausbildung und Fortbildung der ehrenamtlich und beruflich in der städtischen Armen- und Wohlfahrtspflege tätigen Organe bestimmt. Die Ausbildungsstätte sollte auch privaten Interessenten offen stehen. Der theoretische und praktische Unterricht umfasste die Fächer Sozialhygiene, Sozialrecht und Sozialpädagogik. In der neuen Akademie sollten Mitarbeiter/innen für gehobene Aufgaben in der Sozial- und Kommunalverwaltung heran gebildet werden. Trotzdem der Besuch der Akademie Männern und Frauen offenstand, entwickelte sie sich zu einer Ausbildungsstätte ausschließlich für Fürsorgerinnen. In den Jahren nach der Gründung der Akademie kam es zu einem Rollenkonflikt zwischen den Fürsorgerinnen als untergeordnete Organe der Verwaltung und der im Entstehen begriffenen Sozialarbeit als eigenständige gehobene Profession. (vgl. Simon 1995: 15)
1921 wurden die einzelnen Kurse der Akademie zusammengeschlossen und in eine zweijährige schulmäßig geführte Ausbildung vereinigt. Es wurden Fürsorger/innen für die Jugendfürsorge und das Gesundheitswesen der Stadt Wien ausgebildet. Bis 1938 trug sie den Namen „städtische Akademie für soziale Verwaltung" und fiel in den Zuständigkeitsbereich des amtsführenden Stadtrates für Wohlfahrtswesen Julius Tandler. Der Sozialmediziner suchte eigentlich Gemeindeschwestern als Hilfskräfte der Ärzte. Die Absolventinnen der Schule von Arlt sahen sich jedoch nicht in dieser Rolle oder als Erfüllungsgehilfinnen der Verwaltung, sondern als Angehörige eines eigenständigen Berufes. In dieser Zeit organisierten sich die Fürsorgerinnen im „Reichsverband der Fürsorgerinnen Österreichs“. Es kam zu Kontroversen mit dem amtsführenden Stadtrat Julius Tandler. Diese eskalierten, als die Fürsorgerinnen die Verteilung des Säuglingswäschepaketes ablehnten. Tandler sah sich damit gezwungen, den Beruf der „Hilfsfürsorgerinnen ohne besondere schulische Vorbildung“ zu schaffen. Die ausgebildeten Fürsorgerinnen wurden fortan Hauptfürsorgerinnen genannt. Sie hatten eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitszeiten als die Hilfsfürsorgerinnen. Dadurch kam es zu großen Spannungen zwischen den beiden Gruppen.
1938 wurden in Österreich die Schulen der Caritas und die Schule Ilse Arlts von den Nationalsozialisten aufgelöst. Die Fürsorgeschule des Landes Steiermark und die Schule der Stadt Wien blieben bestehen. Die Wiener Schule hieß nunmehr „Soziale Frauenschule“. Alle Bestrebungen, einen autonomen Berufsstand zu gründen wurden zunichte gemacht. Aus dem Kreis der früheren Hauptfürsorgerinnen wurden die „Funktionsfürsorgerinnen“ rekrutiert, welche während des Dritten Reiches in der Wohlfahrtspflege zur Erb- und Rassenpflege für deutsche Volksangehörige herangezogen wurden. (vgl. Simon 1995: 18f)
1945 wurde die Schule der Stadt Wien unter der Bezeichnung „Fürsorgeschule der Stadt Wien“ wiedereröffnet. Die Absolventinnen waren wieder Fürsorgerinnen und wurden hauptsächlich in der Jugendfürsorge und Tbc-Fürsorge eingesetzt. Es gab kaum eine Möglichkeit, in einem anderen Bereich zu arbeiten und nur begrenzte Aufstiegsmöglichkeiten. Die Direktorin der Fürsorgeschule war als einzige vollzeitbeschäftigt, alle anderen Lehrer/innen unterrichteten nebenberuflich. Die unterschiedlichen Auffassungen über die Rollen von Fürsorger/innen und Sozialarbeiter/innen sowie die Rivalität zwischen Amtsvormündern und Fürsorge blieb lange erhalten. Das Amt des Vormundes wurde gegenüber der Fürsorgerin aufgewertet. Jugendamtsleiter wurden aus dem Kreis der Amtsvormünder rekrutiert, obwohl sie keine Reifeprüfung und keine Fürsorgeausbildung nachweisen konnten. Die Spaltung der Gruppen der Hilfsfürsorgerinnen versus Hauptfürsorgerinnen schwächte den Berufstand der Fürsorgerinnen. Vielen Hauptfürsorgerinnen wurde ihre nationalsozialistische Vergangenheit zum Verhängnis. Sie wurden außer Dienst gestellt. In der gewerkschaftlichen Vertretung waren die Hilfsfürsorgerinnen maßgeblich. Anstatt ihre Arbeits- und Entgeltbedingungen an die der Hauptfürsorgerinnen anzugleichen wurde deren Bezahlung gesenkt. Der Beruf der Fürsorgerin war nicht nur in der Hierarchie der Institution niedrig bewertet, auch in der Öffentlichkeit war das Image nicht günstig.
In den 1960iger Jahren gab es eine Meinungsumfrage zum Sozialprestige verschiedener Berufe. Unter den 25 angeführten Berufen nahmen Universitätsprofessoren und Ärzte die vorderen Plätze, die Chemischputzerin den letzten und die Fürsorgerin den vorletzten Platz ein. Dieses schlechte Image führte zu massiven Nachwuchsschwierigkeiten in der Ausbildung. Daraus resultierten wiederum geringe Karrierechancen im öffentlichen Dienst. Der rasche Wandel der Gesellschaft und die daraus entstehenden Probleme verlangten nach einer partnerschaftlichen Sozialarbeit statt einer bevormundenden Fürsorge. Auch durch die Einführung von psychologischen und soziologischen Aspekten in der Ausbildung konnten deren Attraktivität nicht gesteigert werden. (vgl. Simon 1995: 20f)
Mit der Einführung des Schulorganisationsgesetzes im Jahr 1962 fand eine Neuordnung des österreichischen Schulwesens statt. Das berufsbildende Schulwesen, zu dem auch die Fürsorgeausbildung gehörte, bekam erstmals eine gesetzliche Grundlage. Bisher wurden diese Schulen von Religionsgemeinschaften oder Landesregierungen zur Nachwuchsrekrutierung betrieben. Aus den „Hauslehranstalten“ wurden die „Lehranstalten für gehobene Sozialberufe“. Die Aufnahme in die Lehrerbildungsanstalt zur pädagogischen Akademie blieb der kleinen und schwachen Gruppe der Sozialarbeiter/innen vorerst versagt. Es lag nicht im Interesse der Schulverwalter, den Status und damit die Ansprüche dieser Berufsgruppe zu heben. Der erste Schritt in Richtung Fachhochschule gelang mit der Umwandlung der Fürsorgeschule in eine „akademieverwandte Lehranstalt“. Der Zugang erfolgt über die Reifeprüfung. Für Nichtmaturanten/innen gab es einen Vorbereitungslehrgang. Die neue Schulform brachte eine relative Aufwertung und es erhöhte sich der Bekanntheitsgrad als "akademieverwandte" Ausbildungsstätte. (vgl. Simon 1995: 21)
Mit der Jugendrevolte der 68er Generation kam auch das Berufsfeld der Sozialarbeit in Bewegung. Es entstanden neue und interessante Aufgaben im Bereich der Sozialarbeit, die nach kreativen Lösungen verlangten. Die Erwachsenfürsorge begann in zunehmendem Maß Sozialarbeiter/innen zu beschäftigen. Im Bereich Jugend und Soziales wurden Kontrollen durch Dienstleistungen ersetzt. Die Sozialarbeit gewann an Attraktivität, und die als „realitätsfremd“ geltende Ausbildung wurde praxisnahe adaptiert. Die Erschließung neuer Arbeitsfelder und neuer Arbeitsmethoden ging einher mit dem steigenden Selbstbewusstsein der Berufsgruppe. Es entstand ein berufspolitisch aktiver, überparteilicher Berufsverband. Die „Arbeitsgemeinschaft der Direktoren“ versuchte eine dreijährige Akademie mit zeitgemäßen Inhalten zu erreichen. 1971 wurde ergänzend die Ausbildungsform für Berufstätige eingeführt. 1976 wurde aus der Lehranstalt für gehobene Sozialberufe die „Akademie für Sozialarbeit“. Da es keinen verbindlichen Lehrplan gab, kam es zu einem Wettstreit zwischen den Akademien. Aus den zahlreichen neuen Ideen und neuen Methoden entwickelten sich neue Arbeitsfelder für die Sozialarbeit. 1987 - nach fast 70 Jahren - fand schließlich die Verlängerung der Ausbildung auf drei Jahre statt. (vgl. Simon 1995: 21ff)
In den 1990er Jahren wurden in Österreich die ersten Fachhochschulen gegründet. Der erste 8-semestrige Diplomstudiengang für „Sozialarbeit“ startete 2001 und löste die Akademien ab. Im Jahr 2007 wurden die ersten 6-semestrigen Bakkalaureatsstudiengänge und aufbauende 4-semestrigen Masterstudiengängen gestartet. In Wien, Krems und Linz werden universitäre postgraduale Master-Studiengänge, vor allem mit Sozialmanagement-Schwerpunk, angeboten. Die Entwicklung der Fachhochschulen für die Sozialarbeit war ein wichtiger Schritt in Richtung Professionalisierung. (vgl. Pantucek 2008: 809)
1996 wurde in der Generalversammlung des „Österreichischen Berufsverbands diplomierter SozialarbeiterInnen“ (OBDS) ein Berufsbild verabschiedet und damit der Grundstein zur Professionalisierung gelegt. Das Berufsbild dient der Orientierung und hat bei Nichteinhaltung - außer einer möglichen Auflösung der Mitgliedschaft im Berufsverband - keinerlei Konsequenzen zur Folge. Seit 1998 gibt es durch den OBDS in Österreich das Bestreben, ein Berufsgesetz einzuführen. Ein solches Gesetz wäre eine gesetzliche Festschreibung der Handlungsfelder und Tätigkeiten von Sozialarbeiter/innen. Auch würde ein solches Gesetz der Qualitätssicherung von Sozialarbeit dienen und eine Abgrenzung zu anderen Berufen ermöglichen. Vielen anderen Berufsgruppen im Sozialbereich ist es bereits gelungen, für ihren jeweiligen Bereich ein Berufsgesetz zu erreichen. Beispiele dafür sind das Psychotherapiegesetz, PsychologInnengesetz oder der Befähigungsnachweis für Lebens- und Sozialberater/innen. (vgl. obds 2004c: 1)
2.1. Aktuelle Situation der Sozialarbeit in Österreich
Bei der Recherche zu der vorliegenden Arbeit wurde festgestellt, dass es in Österreich für den Bereich der Sozialarbeit keine getrennt erhobenen Daten gibt. Die unterschiedlichen Statistiken weisen auch keine einheitlichen Unterteilungen auf. So teilt die STATISTIK AUSTRIA die Fachhochschulen u.a. in einen sozialwissenschaftlichen und einen gesundheitswissenschaftlichen Bereich ein. Werden jedoch von der STATISTIK AUSTRIA die Beschäftigtenzahlen erhoben, so findet eine Einteilung in den Bereich Gesundheit-, Veterinär- und Sozialwesen statt. (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2010a). Da aber alle relevanten Daten für Österreich und in Folge für die Europäische Union von der STATISTIK AUSTRIA erhoben werden, erscheint es sinnvoll, auf dieses Datenmaterial zurückzugreifen. Auch wenn das statistische Datenmaterial sich auf unterschiedliche Bereiche aufteilt, können doch Rückschlüsse auf die Sozialarbeit gezogen werden.
2.1.1. Statistische Datenerfassung in Österreich
Die Bundesstatistik ist ein Informationssystem des Bundes, das Daten über die wirtschaftlichen, demographischen, sozialen, ökologischen und kulturellen Gegebenheiten in Österreich bereitstellt. Die Bundesstatistik umfasst die Erstellung von Statistiken aller Art - einschließlich der damit zusammenhängenden Analysen, Prognosen und statistischen Modelle, die über die Interessen eines einzelnen (Bundes‑)Landes hinausgehen. Ursprünglich wurde die STATISTIK AUSTRIA für Verwaltungszwecke gegründet. Durch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union gab es ein zunehmend öffentliches Interesse an leicht zugänglichem und verständlichem Datenmaterial. Die STATISTIK AUSTRIA sieht sich in einer „Vermittlungsfunktion" beim Zugang zu europäischen Daten und hat eine wichtige Rolle als zentraler nationaler Koordinator im Rahmen der EU-weiten Harmonisierungsvorgänge. ( vgl. STATISTIK AUSTRIA 2010a).
Der nachfolgende Teil des Kapitels gibt Auskunft über die Zahl der Studierenden und Beschäftigten im Bereich der Sozialarbeit. Er soll auch einen Einblick gewähren, wer die Träger bzw. die Finanzgeber der Sozialarbeit sind.
2.1.2. Studierende und Beschäftigte im Bereich der Sozialarbeit in Österreich
Im Jahr 2009 studierten insgesamt 2.911 Personen an einer Fachhochschule für Sozialwissenschaften. 73,65 Prozent davon waren Frauen. Die Fachhochschulen für Sozialwissenschaften werden also überwiegend von Frauen besucht. Daraus kann der Rückschluss gezogen werden, dass auch die Ablöse der Akademien für Sozialarbeit durch die Fachhochschulen nichts an der Frauendominanz in diesem Bereich geändert hat. (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2010b)
Ein ähnliches Bild spiegelt sich in den Beschäftigtenzahlen wider. Im Jahr 2008 waren laut Statistik Austria 330.000 Personen in Gesundheit-, Veterinär- und Sozialwesen beschäftigt. 79,1 Prozent davon waren Frauen. (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2010c)
Die Frauendominanz, sowohl im Bereich der Studierenden als auch der Beschäftigten der Sozialarbeit, trägt somit einen wesentlichen Teil zur Segregation des Arbeitsmarktes bei. Die Segregation des Arbeitsmarktes und seine Auswirkungen auf die geschlechterspezifischen Einkommensunterschiede ist ein zentrales Thema der vorliegenden Arbeit. Selbst innerhalb der Sozialarbeit gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede. So sind Männer und Frauen in unterschiedlichen Handlungsfeldern der Sozialarbeit in unterschiedlicher Zahl vertreten. Dem Thema „geschlechtsspezifische Unterschiede in der Sozialarbeit“ ist im Kapitel sechs der vorliegenden Arbeit ein eigener Abschnitt gewidmet. Es folgt jetzt ein kurzer Überblick über die Handlungsfelder der Sozialarbeit in Österreich.
2.1.3. Handlungsfelder der Sozialarbeit in Österreich
Der Berufsverband der Sozialarbeiter in Österreich definiert aktuell folgende Handlungsfelder für Sozialarbeit in Österreich:
- Handlungsfeld Kinder, Jugendliche, Familie
- Handlungsfeld Alte Menschen
- Handlungsfeld Materielle Grundsicherung
- Handlungsfeld Gesundheit
- Handlungsfeld Straffälligkeit
- Handlungsfeld Beruf und Bildung
- Handlungsfeld Migration und Integration
- Handlungsfeld Internationale Sozialarbeit/Entwicklungsarbeit
(vgl. obds 2004a: 1)
2.1.4. Öffentliche und private Träger
In Österreich gibt es viele staatliche und staatsnahe Institutionen, die für den Bereich der Sozialarbeit eine wichtige Rolle spielen. Einzelne Ministerien fördern gezielt bestimmte Organisationen, die von ihnen mit gesetzlichen Aufgaben betraut werden. Diese Organisationen gehören zwar nicht direkt der Bundesverwaltung an, stehen dieser aber sehr nahe. Nichtstaatliche (private) Träger sind u.a. etwa die Caritas, das Hilfswerk oder die Volkshilfe. Diese haben meist ein Naheverhältnis zu Kirchen oder Parteien. Sowohl die öffentlichen als auch die privaten Träger werden überwiegend, direkt oder indirekt durch die öffentliche Hand finanziert. Relativ wenig Bedeutung hat bislang eine mögliche Eigenfinanzierung durch Spenden oder finanzielle Leistungen der Klienten/innen. (vgl. Pantucek 2008: 808)
2.1.5. Beschäftigungsverhältnisse in der Sozialarbeit
In Österreich sind Sozialarbeiter/innen bei öffentlichen oder freien Trägern beschäftigt.
Im Bereich des öffentlichen Dienstes werden sie als Beamte/innen, Vertragsbedienstete oder Angestellte beschäftigt. Bei den privatrechtlichen Trägern sind sie im Angestelltenverhältnis. Freiberuflich tätige bzw. selbstständige Sozialarbeiter/innen gibt es in Österreich bislang kaum.
Sozialarbeiter/innen arbeiten auch immer öfters in multiprofessionellen Teams (z.B. in Krankenhäusern). Aus Sicht des Berufsverbandes ist zu kritisieren, dass einzelne Träger auch Personen aus anderen Berufsgruppen für sozialarbeiterische Tätigkeiten einsetzen.
Sozialarbeiter/innen sind in Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Wohlfahrt und bei privaten Trägern (meist Vereine) auch in Leitungsfunktionen zu finden. Oftmals sind sie auch im Bereich der Ausbildung- und Weiterbildung für Sozialarbeit tätig. (vgl. obds 2004a: 3)
2.2. Begriffsbestimmungen
Um sich besser mit dem Thema „Entlohnung in der Sozialarbeit im geschlechtsspezifischen Kontext“ auseinander setzen zu können, werden zum besseren Verständnis vorab einige Begriffe definiert und erklärt. Alle Begriffe, die in einem direkten Zusammenhang mit dem Gesetz stehen, werden aus Gründen der besseren Nachvollziehbarkeit im Zuge der Rechtgrundlagen erklärt.
2.2.1. Sozialarbeit
Sozialarbeit versteht sich als Interessensvertretung für Einzelne, Gruppen oder das Gemeinwesen. Sie bietet professionelle Hilfe an, wenn die eigenen Mittel bzw. die gesellschaftlichen Ressourcen nicht ausreichen. Sozialarbeit achtet die Würde des Menschen und strebt soziale Gerechtigkeit unter Berücksichtigung von berufsethischen Standards an. Die Bekämpfung individueller und gesellschaftlicher Ungerechtigkeiten steht im Mittelpunkt der Sozialarbeit. Der Beruf basiert auf einem ganzheitlichen Ansatz, der auf eigener Wissensbasis und eigenen Methoden aufbaut. Die Grundlage für ein professionelles Handeln bilden die Dokumentation und die Reflexion der eigenen Tätigkeit. Sozialarbeit ist eine eigenständige wissenschaftliche Disziplin und bedarf einer einschlägigen erfolgreich absolvierten Ausbildung. (vgl. obds 2004b: 2)
2.2.2. Geschlechtsspezifische Diskriminierung
Geschlechtsspezifische Diskriminierung ist die Ungleichbehandlung einer Frau bzw. einer Gruppe von Frauen, die nicht sachlich gerechtfertigt ist. Sie findet ihre Begründung in der Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht. (vgl. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 2003: 4)
2.2.3. Entlohnung und Entgelt
Entlohnung ist die Bezahlung von erbrachter Arbeitsleistung in Form von Entgelt. Entgelt setzt sich aus einem Grundlohn/Grundgehalt und Vergütungen zusammen, die der/die Arbeitgeber/in dem/der Arbeitnehmer/innen in bar oder in Sachleistungen zahlt. Laut dem Europäischen Gerichtshof sind damit alle gegenwärtigen und zukünftigen Zulagen, Prämien und Bonusse gemeint, die für das Erbringen einer Arbeitsleistung gezahlt werden. (vgl. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 2003: 4)
2.2.4. Gleiche, gleichartige und gleichwertige Arbeit
Unter gleicher Arbeit werden Tätigkeiten verstanden, die identisch bzw. weitgehend gleich sind. Diese Tätigkeiten können auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen oder von verschiedenen Personen verrichtet werden. Es gibt besteht kein Unterschied in der Art der Tätigkeit, dem Arbeitsvorgang und der Arbeitsumgebung. (vgl. Hopf et al. 2009: 245)
Gleichartige Arbeiten sind daran erkennbar, dass sie sich kaum voneinander unterscheiden. In der Gesamtbetrachtung sind die benötigten Ausbildungen und Vorkenntnisse weitgehend übereinstimmend und es gibt kaum Unterschiede hinsichtlich Anstrengung, Verantwortung und Arbeitsbedingungen. (vgl. Hopf et al. 2009: 245)
Bei gleichwertiger Arbeit handelt sich um vollkommen unterschiedliche Tätigkeiten, die äußerlich ungleich, aber doch als gleichwertig zu sehen sind. Es wird geprüft, welche Arbeitsanforderungen für die unterschiedlichen Arbeiten in Bezug auf Können/Fertigkeiten, Anstrengungen, Verantwortung und Umgebungsbedingungen bestehen. Um eine Gleichwertigkeit feststellen zu können, ist es notwendig die vorhandenen Merkmale als Ganzes zu betrachten. (vgl. Hopf et al. 2009: 245)
2.2.5. Entgeltdiskriminierung – Beschäftigungsdiskriminierung
Eine Diskriminierung bei der Entlohnung kann auf zwei Ebenen stattfinden: Einerseits gibt es Entgeltdiskriminierungen und anderseits Beschäftigungsdiskriminierungen. Entgeltdiskriminierung findet dann statt, wenn Frauen und Männer gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten, dafür aber unterschiedlich entlohnt werden.
Eine Diskriminierung bei den Arbeitsbedingungen oder bei Beförderungen (Beschäftigungsdiskriminierung) besteht beispielsweise dann, wenn teilzeitbeschäftigte Personen nur beschränkte Aufstiegsmöglichkeiten haben. In diesem Fall handelt es sich zwar nicht um einen Verstoß gegen das Prinzip des gleichen Entgelts für gleiche oder gleichwertige Arbeit, sondern um einen Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot der Geschlechter. In ihren Auswirkungen führen aber sowohl die Beschäftigungsdiskriminierung als auch die Entgeltdiskriminierungen zu ungleicher beziehungsweise niedrigerer Entlohnung. (vgl. Ranftl et al. 2009: 3f)
Die angeführten Begriffe geschlechtsspezifische Diskriminierungen, Gleichwertigkeit, Entgeltdiskriminierung etc. spielen eine wesentliche Rolle in der gesamten Arbeit. An einigen Stellen werden sie wortwörtlich genannt, manchmal sind sie umschrieben. So basiert das Image der Sozialarbeit in der heutigen Zeit auf dem Bild der Frau aus dem 19. bzw. 20. Jahrhundert. Der damals von Frauen erwarteten Rolle entsprechend sollen diese sich um die Probleme von gesellschaftlich Schwachen kümmern bzw. diese betreuen und dafür möglichst keine finanziellen oder anerkennenden Gegenleistungen erwarten.
Die Sozialarbeit wird bis heute überwiegend - direkt oder indirekt - durch die öffentliche Hand finanziert. Dies führt zu einer Abhängigkeit von der Politik und Bereitschaft soziale Probleme als solche anzuerkennen und die dafür benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Beschäftigten der Sozialarbeit werden somit zu „Bittstellern/innen“. Für sie stehen die Probleme ihrer Klienten/innen im Vordergrund, ihr eigenes Wohlbefinden bzw. existenzielle Grundlage rückt folglich in den Hintergrund. All diese Gründe bieten einen idealen Nährboden für Diskriminierungen. Kaum jemand würde vermuten, dass Menschen die gegen Diskriminierung ankämpfen, selbst von Diskriminierung betroffen sein könnten. Das Recht auf „gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit“ muss auch für die Sozialarbeit gelten.
3. Das Recht auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit
Das Recht auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit hat sowohl national als auch international weit zurückreichende historische Wurzeln. Im Folgenden werden die historischen Rahmenbedingungen der rechtlichen Grundlagen für „gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit“ aufgezeigt. Ebenso wird versucht darzulegen, wie sich internationale Verpflichtungen und gemeinschaftsrechtliche Vorgaben der Europäischen Union auf die nationale Gesetzgebung ausgewirkt haben. Die nachfolgenden Kapitel stellen die aktuelle Rechtslage in Österreich dar. Dazu ist es z.B. erforderlich, die wichtigsten Paragraphen des aktuellen Gleichbehandlungsgesetzes zu kennen.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Gleichbehandlungsgesetz für die Privatwirtschaft. Für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst trat im Jahr 1993 das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GBG) (BGBl. Nr. 100/1993 idgF) für den Bundesdienst in Kraft. (vgl. Bundesministerium für Frauen und Öffentlichen Dienst 2010)
3.1. Historische Aspekte des Rechts auf Gleichbehandlung
Die Forderung „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ besteht schon seit dem 19.Jahrhundert. Sie nahm ihren Ausgang in der damals im Entstehen begriffenen Arbeiterinnenbewegung. Seit damals hat sich vieles verändert - sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene. Im Laufe der letzten Jahrzehnte gab es zahlreiche gesetzliche Veränderungen, welche in Österreich die rechtlichen Voraussetzungen für den Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ geschaffen haben. Die Umsetzung dieses Grundsatzes scheint aber noch immer nicht Realität zu sein. (vgl. Feigl et al. 2009: 22)
3.1.1. Gleichbehandlungsrecht in Österreich
Gemäß Artikel 7 der Österreichischen Bundesverfassung sind alle Staatsbürger und Staatbürgerinnen vor dem Gesetz gleich. Vorrechte aufgrund des Geschlechts werden damit explizit ausgeschlossen. Diese verfassungsrechtlichen Bestimmungen waren bisher im Arbeitsleben kaum von Bedeutung, da nach herrschender Rechtsansicht die Verfassungsrechte nicht unmittelbar zwischen Privaten (z.B. Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in) wirksam werden. Der verfassungsrechtliche Gleichheitsgrundsatz hingegen ist auf die Normen der kollektiven Rechtsgestaltung direkt anzuwenden. Es wurden bislang kaum Folgen für eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts daraus abgeleitet. (vgl. Rebhahn 2005: 37ff)
1998 wurde die grundsätzliche Bestimmung des Art. 7 der Österreichischen Bundesverfassung um einen Absatz mit folgendem Wortlaut erweitert:
„Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zur tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann. Maßnahmen zur Förderung der faktischen Gleichstellung von Frauen und Männern insbesondere durch Beseitigung tatsächlich bestehenden Ungleichheiten sind zulässig.“ (Feigl et al. 2009: 24)
Damit wurde ein ausdrückliches Bekenntnis zur Gleichstellung von Frauen und Männern in den Artikel 7, Abs. 2 der Österreichischen Bundesverfassung aufgenommen. Diese Bestimmung trägt damit zu einer besseren Rechtsumsetzung bzw. -durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes von Frauen und Männern in Österreich wesentlich bei.
3.1.2. Internationale Verpflichtungen und Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben
Österreich hat im Rahmen seiner Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen (UNO) , beim Europarat, bei der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Europäischen Union eine Reihe von völkerrechtlichen Verträgen ratifiziert bzw. gemeinschaftsrechtliche Vorgaben umgesetzt.
Völkerrechtliche Verträge verpflichten die Mitgliedsstaaten, die notwendigen Schritte zur Umsetzung der Vertragsbestimmungen zu schaffen. Es entstehen allerdings keine Konsequenzen, wenn ein Mitgliedsstaat die vorgesehenen Verpflichtungen nicht erfüllt. (vgl. Smutny et al. 2001: 48ff)
Das ILO-Übereinkommen Nr. 100 aus dem Jahr 1951 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit wurde in Österreich bereits 1953 ratifiziert. Bereits 1951 entstand das ILO-Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. Die Ratifizierung fand in Österreich allerdings erst im Jahre 1973 statt. (vgl. Smutny et al. 2001: 48ff)
1982 ratifizierte Österreich die UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung von Frauen. (vgl. Feigl et al 2009: 23f)
Auf europäischer Ebene verpflichtete sich Österreich 1994 erstmals, die wesentlichen Vorschriften des damaligen Gemeinschaftsrechts zur Gleichbehandlung umzusetzen. Die Normen des Gemeinschaftsrechts wurden seither oftmals geändert und wichtige juristische Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes in den Gesetzestext übernommen. (vgl. Rebhahn 2005: 37ff)
Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union am 1.1.1995 sind die geltenden gemeinschaftsrechtlichen Regelungen auf der Ebene des Primär- und Sekundärrechts verbindlich geworden. (vgl. Smutny et al. 2001: 48ff)
Primärrecht ist unmittelbar anwendbares Recht. Das bedeutet, dass diese Bestimmungen unmittelbare Geltung haben und unmittelbare Rechte und Pflichten für natürliche und juristische Personen nach sich ziehen. (vgl. Lengauer 2009: 46ff)
EU-Richtlinien sind Sekundärrecht, d.h. abgeleitetes Recht, und diese sind grundsätzlich nicht unmittelbar anwendbar. Sie müssen von den Mitgliedstaaten innerhalb einer von der Europäischen Union vorgegebenen Frist in das innerstaatliche Recht umgesetzt werden. Die erste EU-Richtlinie zur Entgeltgleichheit von Männern und Frauen wurde bereits 1975 erlassen. (vgl. Smutny et al. 2001: 48ff)
Bereits in den Gründungsverträgen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war der Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ im Primärrecht zu finden. In den nachfolgenden Jahrzehnten wurden die gemeinschaftsrechtlichen Grundsätze aufgrund der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs immer konkreter. So wurde 1975 der Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ um den Bereich der „gleichwertigen“ Arbeit im Primärrecht erweitert. Schon ein Jahr später wurden Bestimmungen vorgegeben, die verhindern sollten, dass der Ehe- und Familienstand einer Person sich negativ auf deren Arbeitsverhältnis auswirken.
Als ein Meilenstein in der Geschichte der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in der Europäischen Gemeinschaft ist die Richtlinie über Teilzeitarbeit aus dem Jahr 1997 zu sehen. Der Europäische Gerichtshof ist zu der Überzeugung gelangt, dass Teilzeitarbeit leicht zu einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts führen kann, da der überwiegende Teil der Teilzeitbeschäftigten weiblich ist. 1999 wurde im Vertrag von Amsterdam das Prinzip „gleicher Lohn für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit“ sowie die Möglichkeit, „positive Maßnahmen“ zu fördern, in Art. 141 EVG (früher Art. 119) verankert. Solche „positiven Maßnahmen“ ermöglichen es, ein bisher benachteiligtes Geschlecht bevorzugt zu behandeln. Dies eröffnet den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union viele Optionen, die Gleichstellung von Frauen und Männern voranzutreiben. So könnten beispielsweise spezielle Förderungen für Bereiche gewährt werden, die von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts betroffen sind. Solche Maßnahmen würde das bisher benachteiligte Geschlecht fördern, ohne dass das bisher bevorzugte Geschlecht eine Diskriminierung geltend machen könnte. (vgl. Feigl et al. 2009: 22ff.)
3.1.3. Entwicklung des österreichischen Gleichbehandlungsgesetzes
Im Jahre 1979 entstand in Österreich das erste Bundesgesetz über die Gleichbehandlung von Frauen in der Arbeitswelt. Mit dem damals beschlossenen Gleichbehandlungsgesetz wurde der Grundstein für die heutige Gesetzeslage gelegt. Das seinerzeit beschlossene Gesetz befasste sich ausschließlich mit der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei der Festsetzung des Entgeltes in der Privatwirtschaft im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis. Seither erfolgten zahlreiche Novellierungen dazu. Als Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft ist die nationale Gesetzgebung in Österreich wesentlich vom Gemeinschaftsrecht geprägt. Die Richtlinien und Verordnungen der EU veranlassen Österreich als Mitgliedsstaat regelmäßig zur Anpassung der nationalen Gesetzgebung. (vgl. Smutny et al. 2001: 57)
1985wurde das bisherige Gleichbehandlungsgesetz im Zuge einer Novellierung in das"Gesetz über die Gleichbehandlung von Frau und Mann im Arbeitsleben" umbenannt. Es fand eine Ausweitung auf die Bereiche der freiwilligen Sozialleistungen sowie der betrieblichen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen statt. Ebenfalls wurde das Gebot der geschlechtsneutralen Stellenausschreibung verankert. Fünf Jahre später, 1990, wurde das Gleichbehandlungsgebot auf alle Aspekte des Arbeitslebens ausgeweitet. Seit diesem Zeitpunkt muss auf die Gleichbehandlung von Frauen und Männer bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses, bei den sonstigen Arbeitsbedingungen und bei der Festsetzung des Entgelts ein besonderes Augenmerk gelegt werden. Des Weiteren darf auch niemand bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung, beim beruflichen Aufstieg, sowie bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses diskriminiert werden. Dass der Grundsatz "gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit" auch bei kollektiven Einstufungsregelungen und Entlohnungskriterien zu beachten ist, fand im Jahr 1992 Eingang in das Gesetz. Die Änderungen der Österreichischen Bundesverfassung 1998 kann in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Beitritt zur Europäischen Union gesehen werden. (vgl. Feigl et al. 2009: 23 ff)
Mit 1. Juli 2004 trat das neue Gleichbehandlungsgesetz in Österreich in Kraft. Mit den Bestimmungen über den Zugang zur Beschäftigung, zur Berufsausbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie zu den Arbeitsbedingungen wurde die Umsetzung der EU-Richtlinie neu formuliert. (vgl. Feigl et al. 2009: 24)
In der Novellierung des Gesetzes im Jahr 2008 fand eine Ausweitung des Diskriminierungsschutzes auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses statt. Arbeitsverträge, die auf Probe abgeschlossen sind, sowie befristete Arbeitsverträge sind nun explizit vom Diskriminierungsschutz bei der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses erfasst. In der Praxis bedeutet dies, dass beispielsweise ein zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis einer schwanger gewordenen Frau bis zum Beginn des Mutterschutzes verlängert werden muss. Darüber hinaus wurden die Bestimmungen über gezielte Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern ausgeweitet. Ebenfalls wurde die vorübergehende Bevorzugung eines Geschlechts beispielshalber beim Zugang zum Beruf neu definiert. (vgl. Feigl et al. 2009: 25)
In den gesetzlichen Änderungen der vergangenen Jahrzehnte sind die Einflüsse auf internationaler und europäischer Ebene gut erkennbar. Schon vor dem Beitritt zur Europäischen Union hat Österreich bei den gesetzlichen Regelungen zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern im Arbeitsleben versucht, Schritt zuhalten. So finden sich Bestimmungen zum Grundsatz „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ auch bei kollektiven Einstufungs- und Entlohnungskriterien bereits 1992 im Gesetz wieder.
Nach diesem Überblick über die wichtigsten Aspekte der historischen Entwicklung der Gesetzeslage zum Thema "gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit" in Österreich wird nun die aktuelle Rechtslage in Österreich dargestellt. Es soll auch aufgezeigt werden, wie sich die internationalen und gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben sowie die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs in der aktuellen Gesetzeslage widerspiegeln.
3.2. Der Einfluss des Europäischen Gerichtshofs
Die Rechtskontrolle bei der Auslegung und Anwendung des Gemeinschaftsrechts in den einzelnen Mitgliedstaaten obliegt dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft (EuGH). Über zweifelhafte, noch nicht entschiedene Fragen der Auslegung des Gemeinschaftsrechtes kann nur der EuGH entscheiden. Seinen Entscheidungen wird rechtsbildende Kraft beigemessen. Daraus folgt, dass aufgrund von Urteilen oftmals nationale Gesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten geändert werden müssen. (vgl. Smutny et al. 2006:80)
Das Gebot der Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen in der Europäischen Gemeinschaft ist eine der wichtigsten Bestimmungen des Primärrechts und wurde in zahlreichen Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für unmittelbar anwendbar erklärt. (vgl. Lengauer 2009: 46ff)
Anhand der Richtlinie 2006/54/EG lässt sich gut nachvollziehen, welchen Einfluss die ständige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH ) auf die Gesetze der Mitgliedstaaten hat. Diese fasst man in allen bisher ergangenen Richtlinien zur Gleichbehandlung und Entgeltgleichheit zusammen. Die Richtlinie 2006/54/EG ist für die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung, da sie explizit darauf hinweist, dass in Folge der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs der Aspekt des "gleichen Entgelts für gleiche oder gleichwertige Arbeit" zu beachten ist.
Im Abs. 8 der Richtlinie 2006/54/EG wird hervorgehoben, dass der EuGH den Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche oder gleichwertige Arbeit gemäß des
Artikels 141 des Amsterdamer Vertrages aus dem Jahr 1999 als einen wichtigen Aspekt des Grundsatzes für die Gleichbehandlung zwischen Männern und Frauen sieht. Der EuGH hat diesen Grundsatz zu einem fixen Bestandteilen seiner ständigen Rechtsprechung im Bereich der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sowie des gemeinschaftsrechtlichen Besitzstandes erklärt. Der gemeinschaftliche Besitzstand ist das gemeinsame Fundament aus Rechten und Pflichten, die für alle Mitgliedstaaten im Rahmen der Europäischen Union verbindlich sind. Der EuGH weist darauf hin, dass die bisherigen Regelungen offensichtlich nicht ausreichend sind, den Grundsatz der Gleichbehandlung von Männer und Frauen zu gewährleisten und schlägt daher vor, weitere Bestimmungen festzulegen. (vgl. Richtlinie 2006/54/EG)
Der Absatz 9 dieser Richtlinie bezieht sich auf gleiche oder gleichwertige Arbeit in unterschiedlichen Bereichen. Die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs verlangt, verschiedene Faktoren wie beispielsweise Art der Arbeit, Ausbildung und auch die Arbeitsbedingungen dahingehend zu prüfen, ob sich der/die Arbeitnehmer/innen in einer vergleichbaren Lage befinden. Damit fordert der EuGH erstmals auf, auch unterschiedliche Arbeiten miteinander zu vergleichen. (Richtlinie 2006/54/EG)
Auch weist der EuGH im Absatz 10 der Richtlinie darauf hin, dass der Grundsatz des gleichen Entgelts unter bestimmten Umständen auch für Männer und Frauen gilt, die nicht bei demselben Arbeitgeber beschäftigt sind. (Richtlinie 2006/54/EG)
Die Absätze 8 bis 10 der Richtlinie 2006/54/EG stellen eine wichtige Grundlage für die verwendete Methode zur Überprüfung der Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit dar. In dieser Richtlinie wird ausdrücklich der Vergleich von unterschiedlichen Arbeiten miteinander legitimiert. Ebenso berechtigt sie den Vergleich von Beschäftigten, die nicht den/die selben/selbe Arbeitgeber/in haben. Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Frage, inwieweit eine mittelbare Diskriminierung von Frauen in der Sozialarbeit stattfindet. Um diese Frage beantworten zu können, ist ein Vergleich der Sozialarbeit mit unterschiedlichen Arbeiten bei unterschiedlichen Arbeitgeber/innen erforderlich. Die Richtlinie 2006/54/EG stellt dafür eine wesentliche Grundlage dar.
Der nächste Abschnitt befasst sich mit dem aktuellen Gleichbehandlungsgesetz in Österreich. Nachstehend werden nur die wichtigsten Paragraphen ganz oder teilweise zitiert, welche für die vorliegende Arbeit bedeutungsvoll sind.
3.3. Das Gleichbehandlungsgesetz – (GlBG idF 2008/98)
Seit der Novellierung im Jahr 2004 dient das aktuelle Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) dem Schutz vor Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters und der sexuellen Orientierung in der Privatwirtschaft. Es ist in mehrere Teile untergliedert. (vgl. Feigl et al. 2009: 24)
Für den Bereich mittelbare Diskriminierung bei gleichwertiger Arbeit, ist der TeilI (Paragraphen1 bis 15) des Gleichbehandlungsgesetzes relevant. Dieser Bereich beinhaltet alle wichtigen Bestimmungen zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt. Ausschlaggebend für die vorliegende Arbeit sind die Paragraphen1 bis 3 und 5, die den Geltungsbereich, das Ziel und den Begriff der mittelbare Diskriminierung bestimmen. Die Paragraphen8 und 11 definieren „positive Maßnahmen“ und legen fest, wie Entlohnungskriterien zu gestalten sind, um als diskriminierungsfrei zu gelten.
3.3.1. Geltungsbereich, Ziel und Gleichbehandlungsgebot
Auszug aus dem Gleichbehandlungsgesetz (GlBG idF 2008/98):
§1.Geltungsbereich
1. Arbeitsverhältnisse aller Art, die auf privatrechtlichem Vertrag beruhen ;
§2.Gleichstellung
Ziel dieses Abschnittes ist die Gleichstellung von Männern und Frauen
§3.GleichbehandlungsgebotimZusammenhangmiteinem Arbeitsverhältnis
Auf Grund des Geschlechtes, insbesondere unter Bezugnahme auf den Ehe- oder Familienstand, darf im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis niemand unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden, insbesondere nicht
1. bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses,
2. bei der Festsetzung des Entgelts,
3. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein Entgelt darstellen,
4. bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung und Umschulung,
5. beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen,
6. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen,
7. bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.“ (Doralt, 2008:348)
Die Paragraphen 1 bis 3 GlBG geben darüber Auskunft, welcher Personenkreis von diesem Gesetz erfasst ist, sowie das Ziel des Gesetzes und dass es im Zusammenhang mit dem Gleichbehandlungsgebot mit einem Arbeitsverhältnis anzuwenden ist. Das genannte Ziel des Gesetzes ist die völlige Gleichstellung von Männern und Frauen in der Arbeitswelt. Der Geltungsbereich umfasst einerseits Arbeitsverhältnisse aller Art, die auf privatrechtlichem Vertrag (z.B. Arbeitsvertrag) beruhen, und anderseits auch einige Bereiche,die im beruflichen Umfeld angesiedelt sind. Das bedeutet, dass vom Gleichbehandlungsgesetz auch der Zugang zu Berufsausbildung, Berufsberatung, aber auch die Bedingungen selbständiger Erwerbstätigkeit erfasst sind.
3.3.2. Mittelbare Diskriminierung
Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Frage, ob Frauen in der Sozialarbeit aufgrund ihres Geschlechts mittelbar diskriminiert werden. Daher folgt nun die gesetzliche Definition des Begriffes „mittelbare Diskriminierung“.
Auszug aus dem Gleichbehandlungsgesetz (GlBG idF 2008/98):
§ 5. Begriffsbestimmungen
(2)“Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, die einem Geschlecht angehören, in besonderer Weise gegenüber Personen des anderen Geschlechtes benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Zieles angemessen und erforderlich.“ (Doralt, 2008: 349)
Mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts muss nicht offensichtlich Bezug auf das Geschlecht nehmen. Es kann ein scheinbar neutrales Kriterium sein, aber dennoch vermag es sich um eine versteckte Diskriminierung handeln. Eine Regelung oder Maßnahme wird dann diskriminierend, wenn es dafür keine sachliche Rechtfertigung (z.B. höher qualifizierter Tätigkeit) gibt. Es spielt auch keine Rolle ob nur eine oder mehrere Personen von der Diskriminierung betroffen sind. (vgl. Rebhahn 2005: 246)
Dazu ein Beispiel : In einem Betrieb wird eine Kinderzulage gewährt. An teilzeitbeschäftigte Personen wird diese Zulage nur aliquot (anteilsmäßig) ausbezahlt. Eine Kinderzulage ist eine Unterstützungsleistung. Es sollen damit die erhöhten Aufwendungen von Personen mit versorgungspflichtigen Kindern gemildert werden. Folglich kann eine Kinderzulage keine arbeitszeitabhängige Leistung sein. Es liegt daher keine sachliche Rechtfertigung für eine Aliquotierung vor.
Wie bereits erwähnt wurde im Jahre 1997 eine Richtlinie erlassen, die explizit eine benachteiligte Behandlung von Teilzeitbeschäftigten verbietet. Diese Richtlinie (97/81/EWG) enthält ein Diskriminierungsverbot von Teilzeitbeschäftigten gegenüber vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten desselben Betriebes. Eine Schlechterstellung von Teilzeitbeschäftigten gegenüber Vollzeitbeschäftigten wäre daher eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Teilzeitbeschäftigung wird in Österreich überwiegend von Frauen ausgeübt, daher kann hier der Rückschluss auf eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gezogen werden. Teilzeitbeschäftigung ist auch in der Sozialarbeit ein weit verbreitetes Phänomen und wird deshalb in einem der nachfolgenden Kapitel behandelt.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842806825
- DOI
- 10.3239/9783842806825
- Dateigröße
- 576 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FH Campus Wien – Sozialarbeit
- Erscheinungsdatum
- 2010 (November)
- Note
- 2
- Schlagworte
- diskriminierung geschlecht sozialarbeit gleichbehandlung entlohnung
- Produktsicherheit
- Diplom.de