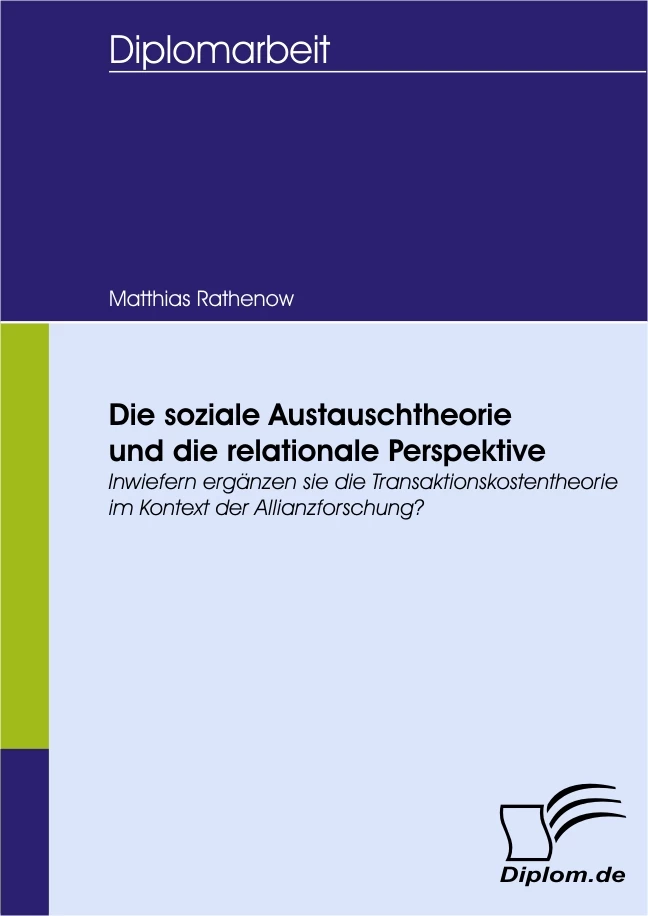Die soziale Austauschtheorie und die relationale Perspektive: Inwiefern ergänzen sie die Transaktionskostentheorie im Kontext der Allianzforschung?
Zusammenfassung
Die steigende Vernetzung der weltweiten Wirtschaftszonen und die daraus resultierenden neuen Möglichkeiten für Unternehmen bewirken eine stetige Zunahme der Wettbewerbsintensität, wodurch eine erkennbare Spezialisierung entlang der Wertschöpfungskette zu verzeichnen ist. Die Entwicklung hat dazu geführt, dass Unternehmen immer mehr mit anderen Unternehmen kooperieren müssen, um wirtschaftlich erfolgreich sein zu können. Für ein erfolgreiches Bilden von Allianzen ist es von elementarer Bedeutung, Partner mit komplementären Ressourcen zu finden, wodurch Synergiepotenziale erzielt werden können, die ein Unternehmen allein nicht erwirtschaften kann.
Die steigende Anzahl von (strategischen) Allianzen hat in den letzten zwanzig Jahren dazu geführt, dass zahlreiche Wissenschaftler die Gründe für die Entstehung von interorganisationalen Formen zu ihrem Untersuchungsgegenstand gemacht haben. Viele der wissenschaftlichen Arbeiten basieren auf der Transaktionskostentheorie, um die Formen, Funktionen und die Effizienz von Kooperationen jeglicher Art zu analysieren. Die einseitige Fokussierung auf die Kostenanalyse von hybriden Organisationsformen ist dabei zentraler Gegenstand der Kritik. Insbesondere die Vernachlässigung sozialer Konstrukte, die Verwendung simplifizierender Annahmen sowie die Ausblendung von Nutzenaspekten werden als eklatante Schwächen identifiziert, Allianzen als komplexe soziale Gebilde vollumfänglich zu analysieren.
Die vorliegende Arbeit setzt an dieser Kritik an, indem sie versucht, mittels der sozialen Austauschtheorie und der relationalen Perspektive, eine konzeptionelle Ergänzung des Transaktionskostenansatzes zu erarbeiten. Dabei besitzen beide Interorganisationstheorien unterschiedliche Schwerpunkte, sodass sie sich sinnvoll ergänzen, basieren aber gleichzeitig auf einem gemeinsamen konzeptionellen Fundament. Die Untersuchung von interorganisationalen Beziehungen erfordert die Einbeziehung ökonomischer und sozialer Konstrukte, weshalb eine Analyse anhand integrativer Ansätze am geeignetsten erscheint. Durch eine Vielzahl von ökonomischen Herausforderungen und mannigfaltigen sozialen Prozessen bilden Allianzen eine komplexe Organisationsform, die anhand einer einzigen Theorie nur unzulänglich erklärt werden kann.
Zu Beginn der Arbeit wird einleitend durch die Vorstellung der strategischen Allianzen der konzeptionelle Rahmen gesetzt, wobei angemerkt sei, dass im Zuge der wissenschaftlichen Untersuchungen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
1.2 Literaturrecherche
2. Strategische Allianzen
3. Die Transaktionskostentheorie
4. Interorganisationstheorien
4.1 Die relationale Perspektive
4.1.1 Quellen von relationalen Renten
4.1.2 Mechanismen zum Aufbau von Imitationsbarrieren
4.1.3 Verteilung der relationalen Renten
4.2 Die soziale Austauschtheorie
4.2.1 Fundamentale Ansätze der sozialen Austauschtheorie
4.2.2 Die wichtigsten Konstrukte der sozialen Austauschtheorie in Bezug auf Allianzen
4.2.3 Die Wirtschaftssoziologie
4.3 Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Interorganisationstheorien
5. Ergänzendes Erklärungspotenzial der Interorganisationstheorien zur Transaktionskostentheorie
5.1 Grenzen und Schwächen der Interorganisationstheorien
5.1.1 Grenzen und Schwächen der sozialen Austauschtheorie
5.1.2 Grenzen und Schwächen der relationalen Perspektive
5.2 Ergänzendes Erklärungspotenzial der Interorganisationstheorien
5.3 Integrativer Ansatz
6. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Determinanten für interorganisationale Wettbewerbsvorteile
Abb. 2: Verteilung relationaler Renten
Abb. 3: Theoretisches Modell klassischer soziologischer Propositionen
Abb. 4: Ergänzendes Erklärungspotenzial der Interorganisationstheorien zum Transaktionskostenansatz
Abb. 5: Integrativer Ansatz
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Schlüsselwörter der Literaturrecherche
Tab. 2: Die wichtigsten Journale für die Literaturrecherche
Tab. 3: Exklusions- und Inklusionskriterien für die Literaturrecherche
Tab. 4: Einführende Literatur für die Diplomarbeit
Tab. 5: Die wichtigsten Autoren für die Literaturrecherche
Tab. 6: Zusammenfassung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten der sozialen Austauschtheorie und der relationalen Perspektive anhand geeigneter Untersuchungsmerkmale
Tab. 7: Zusammenfassung der Konstrukte des integrativen Ansatzes
1 Einleitung
1.1 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
Die steigende Vernetzung der weltweiten Wirtschaftszonen und die daraus resultierenden neuen Möglichkeiten für Unternehmen bewirken eine stetige Zunahme der Wettbewerbsintensität, wodurch eine erkennbare Spezialisierung entlang der Wertschöpfungskette zu verzeichnen ist.[1] Die Entwicklung hat dazu geführt, dass Unternehmen immer mehr mit anderen Unternehmen kooperieren müssen, um wirtschaftlich erfolgreich sein zu können.[2] Für ein erfolgreiches Bilden von Allianzen ist es von elementarer Bedeutung, Partner mit komplementären Ressourcen zu finden, wodurch Synergiepotenziale erzielt werden können, die ein Unternehmen allein nicht erwirtschaften kann.[3]
Die steigende Anzahl von (strategischen) Allianzen hat in den letzten zwanzig Jahren dazu geführt, dass zahlreiche Wissenschaftler die Gründe für die Entstehung von interorganisationalen Formen zu ihrem Untersuchungsgegenstand gemacht haben.[4] Viele der wissenschaftlichen Arbeiten basieren auf der Transaktionskostentheorie, um die Formen, Funktionen und die Effizienz von Kooperationen jeglicher Art zu analysieren.[5] Die einseitige Fokussierung auf die Kostenanalyse von hybriden Organisationsformen ist dabei zentraler Gegenstand der Kritik. Insbesondere die Vernachlässigung sozialer Konstrukte, die Verwendung simplifizierender Annahmen sowie die Ausblendung von Nutzenaspekten werden als eklatante Schwächen identifiziert, Allianzen als komplexe soziale Gebilde vollumfänglich zu analysieren.[6]
Die vorliegende Arbeit setzt an dieser Kritik an, indem sie versucht, mittels der sozialen Austauschtheorie und der relationalen Perspektive, eine konzeptionelle Ergänzung des Transaktionskostenansatzes zu erarbeiten. Dabei besitzen beide Interorganisationstheorien unterschiedliche Schwerpunkte, sodass sie sich sinnvoll ergänzen, basieren aber gleichzeitig auf einem gemeinsamen konzeptionellen Fundament. Die Untersuchung von interorganisationalen Beziehungen erfordert die Einbeziehung ökonomischer und sozialer Konstrukte, weshalb eine Analyse anhand integrativer Ansätze am geeignetsten erscheint.[7] Durch eine Vielzahl von ökonomischen Herausforderungen und mannigfaltigen sozialen Prozessen bilden Allianzen eine komplexe Organisationsform, die anhand einer einzigen Theorie nur unzulänglich erklärt werden kann.[8]
Zu Beginn der Arbeit wird einleitend durch die Vorstellung der strategischen Allianzen der konzeptionelle Rahmen gesetzt, wobei angemerkt sei, dass im Zuge der wissenschaftlichen Untersuchungen keine strikte Trennung zwischen Allianz- und Netzwerkforschung vorgenommen werden kann.
Im dritten Kapitel wird der Transaktionskostenansatz in seinen Grundzügen dargestellt und erläutert, warum der Ansatz, trotz seiner häufigen Verwendung zur Analyse von Allianzen, zahlreiche Defizite aufweist, die eine angemessene Analyse der zahlreichen Allianzformen nicht zulassen.
Im nächsten Kapitel werden die soziale Austauschtheorie und die relationale Perspektive getrennt voneinander dargestellt, in ihrem konzeptionellen Aufbau bezogen auf Allianzen untersucht. Daran anknüpfend werden beide Theorien einander gegenübergestellt, sodass ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede sichtbar werden.
Im fünften Kapitel wird das Ergänzungspotenzial, das sich aus der vorausgegangenen konzeptionellen Gegenüberstellung beider Theorien ergeben hat, explizit dargelegt. Darüber hinaus werden die einschränkenden Schwächen und Grenzen der sozialen Austauschtheorie und der relationalen Perspektive aufgezeigt. Aufbauend auf dem ergänzenden Erklärungspotenzial der Interorganisationstheorien wird ein integrativer Ansatz erarbeitet, der durch eine konzeptionelle Verknüpfung aller drei Theorien ein ganzheitlicheres Bild zur Analyse von Allianzen darstellt.
Im letzten Kapitel werden die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und Ausblicke auf die zukünftigen Aufgaben der Allianzforschung gegeben.
1.2 Literaturrecherche
Aufbauend auf folgenden Schritten wurde die Literatur für die Arbeit zusammengestellt, um eine systematische und nachvollziehbare Methodik zu gewährleisten:
(1) Zuerst wurde eine Liste von Schlüsselwörtern erstellt, die auf Grundlage der einführenden Literatur aufgebaut wurde. Die Liste beinhaltet insgesamt 20 Schlüsselwörter.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Schlüsselwörter der Literaturrecherche[9]
(2) Die Schlüsselwörter wurden als Grundlage für die „Search strings“ verwendet. Insgesamt wurden 51 „Search strings“ zur Suche gebildet. Exemplarisch dafür stehen: [`Alliance*` AND `trust`], [`Interorg*` AND `routines`], [`Transaction*` AND `asset-specificity`], [`Relation*` AND `rents`], [`Exchange` AND `power` AND `dependence`]
(3) Für die Arbeit wurden nur Artikel aus „peer-reviewed“ Journale verwendet sowie Buchkapitel und Bücher, die als Grundlagen der jeweiligen Theorie essentiell sind. Insgesamt wurden 34 Journale verwendet, wobei 39 von 73 Artikeln aus folgenden sechs Journalen stammt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Die wichtigsten Journale für die Literaturrecherche[10]
(4) EBSCO host (Business Source Premier) wurde primär als Datenbasis für die Literatursuche benutzt. Journale, die nicht verfügbar waren, wurden manuell gesucht. Mittels der gebildeten „Search strings“ wurden der Abstract, der Titel und die Schlüsselwörter, die von den Autoren angegeben wurden, durchsucht. Die angezeigten Artikel wurden daraufhin auf Relevanz untersucht, indem der Abstract und der Titel anhand von Exklusions- und Inklusionskriterien gescannt wurde.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3: Exklusions- und Inklusionskriterien für die Literaturrecherche[11]
Durch Anwendung der Exklusions- und Inklusionskriterien wurden 112 Artikel als relevant identifiziert.
(5) Ergänzend zu der Literatursuche mittels EBSCO host wurde das Schneeballsystem auf die Grundlagenliteratur angewandt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 4: Einführende Literatur für die Diplomarbeit[12]
(6) Des Weiteren wurden Artikel von den wichtigsten Autoren der jeweiligen Theorien gesucht. Die Autoren wurden ermittelt, in dem überprüft wurde, wie oft die Artikel der Autoren zitiert wurden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 5: Die wichtigsten Autoren für die Literaturrecherche[13]
Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass für die Arbeit 73 Artikel, 9 Bücher sowie 6 Buchkapitel verwendet wurden. Von den 73 Artikeln besitzen 39 einen theoretisch-konzeptionellen Kern. 34 Artikel beinhalten empirische Untersuchungen. Die Bücher beziehungsweise Buchkapitel wurden einbezogen, um der Anforderung gerecht zu werden, die verwendeten Theorien in ihrer Konzeption ganzheitlich darzustellen.
2 Strategische Allianzen
Unter den vielfältig vorhandenen hybriden Organisationsformen besitzt die strategische Allianz eine herausragende Stellung in Praxis und Wissenschaft.[14] Die begriffliche Uneinigkeit bei den zahlreichen Kooperationsformen bedarf einer Abgrenzung beziehungsweise Spezifizierung der strategischen Allianz. Gulati definiert strategische Allianzen „ […] as voluntary arrangements between firms involving exchange, sharing, or codevelopment of products, technologies, or services“.[15] Reuer et al. (2010) führen in ihrer Definition noch weitere Merkmale an: die Unabhängigkeit der Organisationen und die Zusammenarbeit unter unvollständigen Verträgen.[16] Das „Strategische“ im Begriff steht für eine längerfristige Qualität der Bindung der Kooperationspartner, die einerseits ihre strategische Bedeutung für die Unternehmen widerspiegelt und andererseits die wechselseitige Abhängigkeit der Unternehmen voneinander darstellt.[17] Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass strategische Allianzen zwischen rechtlich unabhängigen Unternehmen auf Basis unvollständiger Verträge entstehen, um langfristig gemeinsam ihre Ziele zu erreichen.
Die Ursache für das zunehmende Auftreten von Kooperationen, insbesondere von strategischen Allianzen, lässt sich durch die zunehmende Wettbewerbsintensität erklären, die ein Ergebnis der anhaltenden Globalisierung ist.[18] Dieser Effekt zwingt die Unternehmen dazu, sich zu spezialisieren, was den Bedarf an interorganisationalen Beziehungen erheblich gesteigert hat.
Anhand der Stellung der Partner in der Wertschöpfungskette zueinander können Allianzen grundsätzlich in horizontale und vertikale Kooperationen unterteilt werden. Bei horizontalen Allianzen bündeln Unternehmen der gleichen Wertschöpfungsstufe ihre Ressourcen, z.B. im Marketing, Vertrieb oder in der Beschaffung.[19] Meist sind die Unternehmen (potenzielle) Konkurrenten, die sich durch die Kooperation eine Risikominimierung und Effizienzsteigerung erwarten. Bei vertikalen Allianzen werden unterschiedliche Aktivitäten der Wertschöpfungskette kombiniert, um die Kernkompetenzen beider Unternehmen wertstiftend zu nutzen und eine Reduzierung der Kosten zu erzielen.[20]
Um die Entstehung beziehungsweise Existenz von Kooperationen zu erklären, wurde in den letzten zwei Jahrzehnten sehr häufig die Transaktionskostentheorie verwendet,[21] die im folgenden Kapitel vorgestellt wird.
3 Die Transaktionskostentheorie
Die Transaktionskostentheorie stellt den Kern der Neuen Institutionenökonomik dar. Der Ansatz hat sich in den letzten Jahrzehnten als führende Perspektive in der Organisations- und Managementtheorie etabliert.[22] Aufbauend auf den Überlegungen von Commons (1934) und Coase (1937) entwickelte Oliver E. Williamson (1975, 1985) den Transaktionskostenansatz.[23]
Im Mittelpunkt der Theorie steht die Frage nach der effizientesten Form, eine Transaktion durchzuführen, wobei die Transaktion als zentrale Analyseeinheit herangezogen wird.[24] Unter einer Transaktion wird eine Art Austausch, in Form von Gütern oder Dienstleistungen, zwischen zwei oder mehreren Wirtschaftssubjekten verstanden.[25] Williamson ermittelt drei alternative Formen, eine Transaktion zu steuern: Markt, Hybrid und Hierarchie. Jede Steuerungsform impliziert dabei verschiedene Vertragsgestaltungen sowie Koordinations- und Kontrollmechanismen. Ziel ist es, die Organisationsform zu wählen, bei der die Transaktionskosten minimiert werden.[26] Die Kosten, die bei der Koordination des Austausches anfallen, lassen sich in folgender Weise aufschlüsseln: Anbahnungskosten, Vereinbarungskosten, Kontrollkosten und Anpassungskosten, wobei die ersten beiden ex-ante und letztere ex-post entstehen.[27]
Dem Ansatz liegen zwei Verhaltensannahmen zu Grunde, die sich von der neoklassischen Denkweise unterscheiden. Die auf Simon (1961) basierende Annahme der begrenzten Rationalität geht davon aus, dass der Mensch nur eine limitierte kognitive Aufnahmefähigkeit besitzt, um komplexe Sachverhalte richtig zu interpretieren und rational zu handeln.[28] Darüber hinaus wird opportunistisches Verhalten unterstellt, das unter Zuhilfenahme von List und Täuschung den eigenen Nutzen maximiert.[29]
[...]
[1] Vgl. Dyer (1997), S. 535.
[2] Vgl. Kogut (1989), S. 183.
[3] Vgl. Lin/Lin (2010), S. 45.
[4] Vgl. Dyer et al. (2008), S. 137.
[5] Vgl. Zajac/Olsen (1993), S. 131.
[6] Vgl. Gulati (1998), S. 294 f.
[7] Vgl. Kim (2007), S. 1131.
[8] Vgl. Gassenheimer et al. (1998), S. 324.
[9] Selbst erstellte Tabelle.
[10] Selbst erstellte Tabelle.
[11] Selbst erstellte Tabelle.
[12] Selbst erstellte Tabelle.
[13] Selbst erstellte Tabelle.
[14] Vgl. Zentes et al. (2005), S. 5.
[15] Gulati (1998), S. 293.
[16] Vgl. Reuer et al. (2010), S. 6.
[17] Vgl. Zentes et al. (2005), S. 6.
[18] Vgl. ebd., S. 21.
[19] Vgl. Reuer et al. (2010), S. 9.
[20] Vgl. Reuer et al. (2010), S. 10.
[21] Vgl. Judge/Dooley (2006), S. 23.
[22] Vgl. David/Han (2004), S. 39.
[23] Vgl. Williamson (1975), S. 3 f.
[24] Vgl. Williamson (1981), S. 548.
[25] Vgl. Judge/Dooley (2006), S. 24.
[26] Vgl. David/Han (2004), S. 40.
[27] Vgl. Picot (1982), S. 270.
[28] Vgl. Williamson (1981), S. 553.
[29] Vgl. Williamson (1975), S. 26.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842806115
- DOI
- 10.3239/9783842806115
- Dateigröße
- 927 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Freie Universität Berlin – Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2010 (November)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- allianzen transaktionskostentheorie soziale austauschtheorie relational view vertrauen
- Produktsicherheit
- Diplom.de