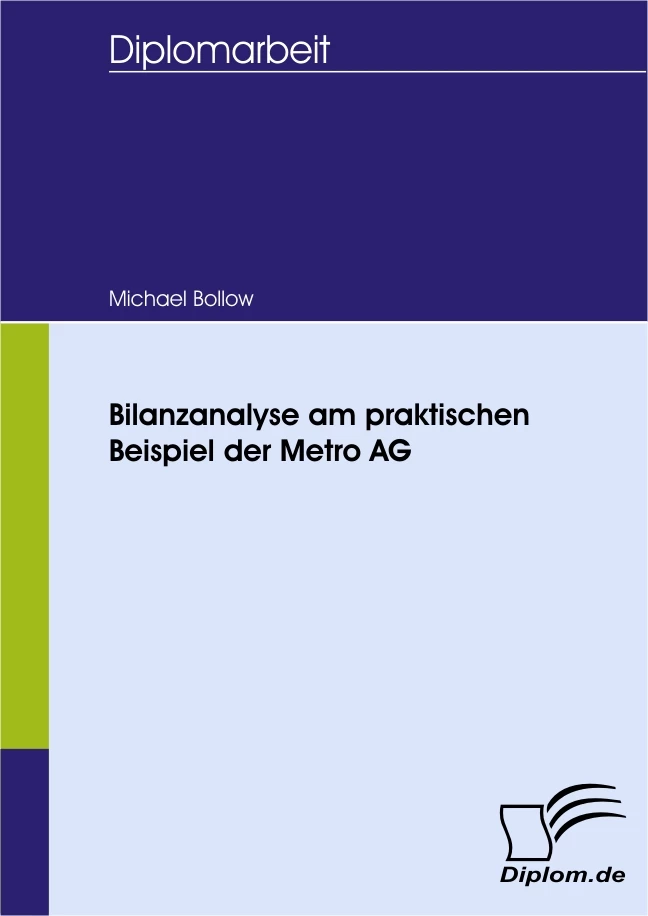Bilanzanalyse am praktischen Beispiel der Metro AG
Zusammenfassung
Unternehmen haben über den Erfolg ihrer Geschäftstätigkeit und ihre wirtschaftliche Situation, insbesondere über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, mindestens einmal jährlich Rechenschaft abzulegen. Instrument dieser Rechenschaftslegung ist der Jahresabschluss. Dieser ist eine wesentliche Grundlage für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und finanziellen Stabilität eines Unternehmens. Ob ein Unternehmensergebnis gut oder schlecht ist, lässt sich nicht ohne Weiteres aus dem Jahresabschluss ablesen, insbesondere nicht aus dem ausgewiesenen Gewinn oder Verlust. Das im Jahresabschluss ausgewiesene Jahresergebnis kann durch ungewöhnliche Einflüsse und vor allem stark durch die Bilanzpolitik des Unternehmens beeinflusst sein. Daher ist eine Analyse des Jahresabschlusses zwingende Voraussetzung, um zuverlässige Erkenntnisse hinsichtlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens zu erhalten.
Seit dem 1. Januar 2005 sind kapitalmarktorientierte Konzernunternehmen mit Sitz innerhalb der Europäischen Union (EU) aufgrund der europäischen IAS-Verordnung verpflichtet, ihren Konzernabschluss nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) zu erstellen. Für europäische Konzernunternehmen, die bisher nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsregeln (US-GAAP) bilanzierten, wurde die Verpflichtung zur Bilanzierung nach IFRS um zwei Jahre verschoben. Die IFRS sind eine Zusammenstellung von Standards, die nach und nach entwickelt worden sind. Dabei handelt es sich nicht um ein Regelwerk mit dem Anspruch auf vollständige Regelung aller Zweifelsfragen. Da ständig neue Standards entwickelt und übernommen werden, wird die Regelungsdichte jedoch zunehmend höher. Die IFRS bieten für die Bilanzanalyse eine deutlich bessere Datengrundlage als das deutsche Handelsgesetzbuch (HGB).
Während im HGB das Vorsichtsprinzip überwiegt, das zu einer Unterbewertung der Vermögenswerte und zu geringeren auszuweisenden Gewinnen führt, hat nach IFRS eine realistische, faire Darstellung zu erfolgen. Die IFRS bemühen sich vor allem viel stärker um Aktualität in der Bewertung durch die vielfache Verwendung von Marktpreisen und Barwertansätzen bei Zukunftswerten. Auch die im deutschen Handelsrecht vorhandene steuerlich beeinflusste Bewertung von Vermögenswerten ist nach IFRS nicht zulässig. Dadurch erhält die Bilanzanalyse eine neue Chance, um die tatsächliche wirtschaftliche und finanzielle Lage von Unternehmen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
1. Einleitende Betrachtung
1.1. Problemstellung und Zielsetzung
1.2. Vorgehensweise
2. Grundlagen der Bilanzanalyse
2.1. Begriff der Bilanzanalyse
2.2. Zweck und Ziel einer Bilanzanalyse
2.3. Arten von Bilanzanalysen
2.3.1. Interne Bilanzanalyse
2.3.2. Externe Bilanzanalyse
2.3.3. Formelle und materielle Bilanzanalyse
2.4. Ablauf einer Bilanzanalyse
2.5. Adressaten einer Bilanzanalyse
2.6. Grenzen der Bilanzanalyse.
3. Bilanzanalyse am praktischen Beispiel der Metro AG
3.1. Rahmenbedingungen
3.1.1. Die Metro AG
3.1.2. Konzernstruktur der Metro AG
3.1.3. Rechnungslegung der Metro AG
3.2. Aufbereitung der Daten des Jahresabschlusses der Metro AG
3.3. Bilanz nach IFRS
3.3.1. Aufbereitung der Bilanz zur Erstellung der Strukturbilanz
3.3.2. Aufbereitung der Aktivaseite der Bilanz
3.3.2.1. Aktive Latente Steuern
3.3.2.2. Rechnungsabgrenzungsposten
3.3.2.3. Übrige Bilanzpositionen
3.3.2.4. Umstrukturierung der Bilanz-Aktivaseite (IAS/IFRS-Abschluss)
3.3.3. Aufbereitung der Passivaseite der Bilanz
3.3.3.1. Passive Latente Steuern
3.3.3.2. Rechnungsabgrenzungsposten
3.3.3.3. Pensionsrückstellungen
3.3.3.4. Übrige Bilanzpositionen
3.3.3.5. Umstrukturierung der Bilanz-Passivaseite (IAS/IFRS-Abschluss)
3.4. Strukturbilanz Metro AG
3.5. Gewinn-und-Verlust-Rechnung nach IFRS
3.5.1. Aufbereitung der Gewinn-und-Verlust-Rechnung
3.5.2. Aufbereitung der GuV/ des Betriebsergebnisses der Metro AG nach dem Umsatzkostenverfahren (IAS/IFRS-Abschluss)
3.5.3. Aufbereitung der GuV/Finanzergebnis der Metro AG
nach dem Umsatzkostenverfahren (IAS/IFRS-Abschluss)
3.5.4. Aufbereitung der GuV/ordentliches Betriebsergebnis der Metro AG (IAS/IFRS-Abschluss)
4. Finanzwirtschaftliche Bilanzanalyse
4.1. Investitionsanalyse
4.1.1. Vermögensintensität
4.1.2. Anlagenintensität
4.1.3. Sachanlagenintensität
4.1.4. Umlaufintensität
4.1.5. Vorratsintensität
4.1.6. Forderungsintensität
4.2. Finanzierungsanalyse
4.2.1. Eigenkapitalquote
4.2.2. Finanzierungskoeffizient
4.2.3. Fremdkapitalquote
4.2.4. Verschuldungsgrad
4.2.5. Rücklagenquote
4.2.6. Selbstfinanzierungsgrad
4.3. Liquiditätsanalyse
4.3.1. Langfristige Fristenkongruenz
4.3.1.1. Deckungsgrad I
4.3.1.2. Deckungsgrad II
4.3.1.3. Deckungsgrad III
4.3.2. Kurzfristige Fristenkongruenz
4.3.2.1. Liquidität ersten Grades
4.3.2.2. Liquidität zweiten Grades
4.3.2.3. Liquidität dritten Grades
4.3.3. Working-Capital-Analyse
4.3.3.1. Net Working Capital
4.3.3.2. Working Capital Ratio
4.4. Cashflow-Analyse
4.4.1. Cashflow-Eigenkapitalrendite
4.4.2. Cashflow-Umsatzrendite
4.5. Kapitalflussrechnung als Bestandteil der Liquiditätsanalyse
5. Erfolgswirtschaftliche Bilanzanalyse
5.1. Gewinnanalyse
5.1.1. Gewinnentwicklung
5.1.2. Umsatzerlöse
5.1.3. Einstandskosten der verkauften Waren (Materialaufwand)
5.1.4. Personalaufwand
5.1.5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
5.1.6. Sonstige betriebliche Erträge
5.1.7. Vertriebskosten
5.1.8. Allgemeine Verwaltungskosten
5.1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen
5.1.10. Zinsaufwand
5.1.11. Steuern
5.2. Rentabilitätsanalyse und Return on Investment
5.2.1. Eigenkapitalrentabilität
5.2.2. Gesamtkapitalrentabilität
5.2.3. Umsatzrentabilität
5.2.4. Return on Investment (ROI)
5.3. Rendite und Börsenbewertung
5.3.1. Ergebnis je Aktie (€).
5.3.2. Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV)
5.3.3. Dividendenrendite
6. Ergebnis und Auswertung der Bilanzanalyse
6.1. Ertragslage
6.2. Finanzlage
6.3. Vermögenslage
Literaturverzeichnis
Webseitenverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
Abbildungsverzeichnis:
Abbildung 1: Rahmenbedingungen der Metro AG
Abbildung 2: Aufbereitungsmaßnahmen der Bilanz-Aktivaseite
Abbildung 3: Aufbereitungsmaßnahmen der Bilanz-Passivaseite
Abbildung 4: Strukturbilanz der Metro AG
Abbildung 5: Struktur-GuV/Betriebsergebnis
Abbildung 6: Struktur-GuV/Finanzergebnis
Abbildung 7: Struktur-GuV/ordentliches Betriebsergebnis
Abbildung 8: Cashflow-Berechnung der Metro AG
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitende Betrachtung
1.1. Problemstellung und Zielsetzung
Unternehmen haben über den Erfolg ihrer Geschäftstätigkeit und ihre wirtschaftliche Situation, insbesondere über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, mindestens einmal jährlich Rechenschaft abzulegen. Instrument dieser Rechenschaftslegung ist der Jahresabschluss.[1] Dieser ist eine wesentliche Grundlage für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und finanziellen Stabilität eines Unternehmens.[2] Ob ein Unternehmensergebnis gut oder schlecht ist, lässt sich nicht ohne Weiteres aus dem Jahresabschluss ablesen, insbesondere nicht aus dem ausgewiesenen Gewinn oder Verlust. Das im Jahresabschluss ausgewiesene Jahresergebnis kann durch ungewöhnliche Einflüsse und vor allem stark durch die Bilanzpolitik des Unternehmens beeinflusst sein.[3] Daher ist eine Analyse des Jahresabschlusses zwingende Voraussetzung, um zuverlässige Erkenntnisse hinsichtlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens zu erhalten.
Seit dem 1. Januar 2005 sind kapitalmarktorientierte Konzernunternehmen mit Sitz innerhalb der Europäischen Union (EU) aufgrund der europäischen IAS-Verordnung verpflichtet, ihren Konzernabschluss nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) zu erstellen. Für europäische Konzernunternehmen, die bisher nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsregeln (US-GAAP) bilanzierten, wurde die Verpflichtung zur Bilanzierung nach IFRS um zwei Jahre verschoben.[4] Die IFRS sind eine Zusammenstellung von Standards, die nach und nach entwickelt worden sind. Dabei handelt es sich nicht um ein Regelwerk mit dem Anspruch auf vollständige Regelung aller Zweifelsfragen. Da ständig neue Standards entwickelt und übernommen werden, wird die Regelungsdichte jedoch zunehmend höher.[5] Die IFRS bieten für die Bilanzanalyse eine deutlich bessere Datengrundlage als das deutsche Handelsgesetzbuch (HGB).
Während im HGB das Vorsichtsprinzip überwiegt, das zu einer Unterbewertung der Vermögenswerte und zu geringeren auszuweisenden Gewinnen führt, hat nach IFRS eine realistische, „faire“ Darstellung zu erfolgen.[6] Die IFRS bemühen sich vor allem viel stärker um Aktualität in der Bewertung – durch die vielfache Verwendung von Marktpreisen und Barwertansätzen bei Zukunftswerten.[7] Auch die im deutschen Handelsrecht vorhandene steuerlich beeinflusste Bewertung von Vermögenswerten ist nach IFRS nicht zulässig.[8] Dadurch erhält die Bilanzanalyse eine neue Chance, um die tatsächliche wirtschaftliche und finanzielle Lage von Unternehmen darzustellen.[9]
Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, den Konzernabschluss der Metro AG, der zum 31.12.2008 nach den IFRS aufgestellt wurde,[10] zu analysieren und dadurch Erkenntnisse über die wirtschaftliche Lage des Konzerns zu gewinnen.
1.2. Vorgehensweise
Der zuvor genannten Zielsetzung folgend ist die Arbeit in sechs Kapitel eingeteilt. Kapitel 2 „Grundlagen der Bilanzanalyse“ beschäftigt sich mit dem Begriff, dem Zweck und dem Ziel der Bilanzanalyse und den verschiedenen Arten von Bilanzanalysen. Des Weiteren wird in Kapitel 2 der Ablauf einer Bilanzanalyse erläutert und es werden mögliche Adressaten vorgestellt sowie die Grenzen einer Bilanzanalyse aufgezeigt. In Kapitel 3 wird eine Bilanzanalyse am praktischen Beispiel der Metro AG durchgeführt. Dabei werden in Kapitel 3 kurz die Rahmenbedingungen für die Bilanzanalyse aufgezeigt und für die eigentliche Bilanzanalyse die Daten des Jahresabschlusses 2008 der Metro AG aufbereitet. In Kapitel 4 wird auf Grundlage der aufbereiteten Daten eine finanzwirtschaftliche Bilanzanalyse und in Kapitel 5 eine erfolgswirtschaftliche Bilanzanalyse anhand von ausgewählten Kennzahlen durchgeführt. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Bilanzanalyse ausgewertet.
2. Grundlagen der Bilanzanalyse
In diesem einführenden Kapitel werden einzelne begriffliche Grundlagen dargestellt. Neben Basisinformationen zur Bilanzanalyse wird der Ablauf einer Bilanzanalyse erläutert, es werden mögliche Adressaten einer Bilanzanalyse vorgestellt und zum Schluss die Grenzen einer Bilanzanalyse aufgezeigt.
2.1. Begriff der Bilanzanalyse
Unter einer Bilanzanalyse versteht man die methodische Untersuchung des aus Bilanz, Gewinn-und-Verlust-Rechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang bestehenden Jahresabschlusses sowie des Lageberichts[11] mit dem Ziel, entscheidungsrelevante Informationen über die gegenwärtige wirtschaftliche Lage und die künftige wirtschaftliche Entwicklung eines Unternehmens zu gewinnen.[12] Somit wird deutlich, dass sich der Begriff „Bilanzanalyse“ auf die Analyse des gesamten Jahresabschlusses bezieht und nicht nur auf die Bilanz. Daher sollte man konsequenterweise von einer „Jahresabschlussanalyse“ sprechen.[13] In Literatur und Praxis hat sich die Bezeichnung Bilanzanalyse für die Analyse des Jahresabschlusses durchgesetzt,[14] weshalb auch ich in dieser Arbeit im Folgenden nicht zwischen beiden Begriffen unterscheiden werde; „Bilanzanalyse“ meint folglich „Jahresabschlussanalyse“. Auf der Basis der vergangenheitsorientierten Daten und Informationen des aktuellen Jahresabschlusses wird versucht, Erkenntnisse über die zu erwartende künftige Entwicklung des Unternehmens zu erlangen.[15]
2.2. Zweck und Ziel einer Bilanzanalyse
Zweck einer Bilanzanalyse ist es, zu erkennen, welche aus den Jahresabschlüssen ersichtlichen Faktoren die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens beeinflusst haben. Ziel einer Bilanzanalyse ist es, Aussagen über die mögliche oder wahrscheinliche zukünftige finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu treffen, um dadurch Hilfen für Kredit-, Investitions-, Personal- und Rationalisierungsentscheidungen zu geben.
Aussagen über die zukünftige finanzielle Entwicklung eines Unternehmens beinhalten die Beurteilung der Finanzkraft, d. h. der statischen und dynamischen Liquidität, und die Beurteilung der Ertragskraft, d. h. der Fähigkeit, in Zukunft Erträge zu erzielen.[16] Das Endziel einer Bilanzanalyse ist es, aufgrund der ermittelten Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wirksame Konsequenzen zu ziehen, um z. B. Krediturteile für kurz- oder langfristige, gesicherte oder ungesicherte Kredite abzugeben, Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Unternehmen, Unternehmensanteilen oder Aktien vorzubereiten, das Management zu beurteilen sowie über seine Entlastung und Weiteranstellung zu entscheiden oder interne Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens zu ergreifen.[17]
2.3. Arten von Bilanzanalysen
Grundsätzlich unterscheidet man folgende Arten von Bilanzanalysen:
- interne Bilanzanalysen,
- externe Bilanzanalysen sowie
- formelle und materielle Bilanzanalysen.
2.3.1. Interne Bilanzanalyse
Interne Bilanzanalysen werden innerhalb eines Unternehmens erstellt. Sie dienen vor allem der Informationsverdichtung, Urteilsbildung und Entscheidungsfindung. Bei der Durchführung interner Bilanzanalysen ist von Vorteil, dass der interne Bilanzanalytiker nicht nur über die im Jahresabschluss publizierten Daten verfügt, sondern auch das gesamte im Unternehmen vorhandene Zahlenmaterial zur Verfügung hat oder beschaffen kann. Aufgrund dieses Materials besteht für den internen Bilanzanalytiker nicht die Notwendigkeit, Wahrheitsfindung zu betreiben.[18]
2.3.2. Externe Bilanzanalyse
Externe Bilanzanalysen werden außerhalb der jeweils bilanzierenden Unternehmen auf der Grundlage der von ihnen für bestimmte Zwecke zur Verfügung gestellten oder veröffentlichten Jahresabschlüsse durchgeführt. Weitere interne Unterlagen und Informationen sind normalerweise nicht vorhanden.[19] Externe Bilanzanalysen dienen vor allem der Informationsverdichtung, Wahrheitsfindung und Urteilsbindung.[20]
2.3.3. Formelle und materielle Bilanzanalyse
Allgemein wird zwischen der formellen und materiellen Bilanzanalyse unterschieden. Die formellen Bilanzanalysen dienen dazu, die formelle Übereinstimmung der Bilanzen einschließlich GuV-Rechnung, Anhang und Lageberichten mit den gesetzlichen Vorschriften festzustellen.[21] Die formelle Bilanzanalyse erübrigt sich im allgemeinen, wenn der Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer geprüft und mit einem Bestätigungsvermerk versehen wurde.[22] Die Aufgabe der materiellen Bilanzanalysen ist es, die Informationen aus dem Jahresabschluss inhaltlich zu analysieren. Dies erfolgt im Rahmen der Substanz- und/oder der Kennzahlenanalyse.[23]
2.4. Ablauf einer Bilanzanalyse
Damit das Ziel der Bilanzanalyse, ein Urteil über die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung des Unternehmens zu fällen, erreicht werden kann, müssen die im Jahresabschluss enthaltenen Daten aufbereitet, in Beziehung gesetzt und mit anderen Daten verglichen werden. Eine vollständige Bilanzanalyse umfasst sechs Schritte:[24]
Der erste Schritt jeder Bilanzanalyse besteht in der Sammlung und Sichtung geeigneten Datenmaterials.[25] Hierzu gehört, dass sich der Bilanzanalyst einen allgemeinen Überblick über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Unternehmens verschafft.[26]
Wichtigste Informationsquellen sind der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, GuV-Rechnung und Anhang, sowie der Lagebericht. Weitere Informationen, die sich der Bilanzanalytiker zunutze machen kann, erlangt er aus den Ansprachen in der Hauptversammlung, durch Pressemitteilungen, aus Veröffentlichungen der Industrie- und Handelskammern und der Verbände, durch Beobachtung der Börsenkurse und durch die Verfolgung der Aktivitäten des Unternehmens.[27]
Der Jahresabschluss entspricht nicht von vornherein den Erfordernissen der weiteren Bilanzanalyse, so dass der Jahresabschluss in einem zweiten Schritt einheitlich erfasst und aufbereitet werden muß.[28] Die Aufbereitung des Zahlenmaterials ist die wichtigste Arbeitsphase im Vorfeld der eigentlichen Analyse, weil von der Sorgfalt und Güte der Aufbereitung letzten Endes die Zuverlässigkeit und Wirklichkeitstreue der Analyseergebnisse abhängen.[29] Hierzu bedarf es eines einheitlichen Erfassungsschemas für die Bilanz und die GuV sowie eines Regelwerkes. Durch die Erfassung der quantitativen Informationen des Jahresabschlusses in einem einheitlichen Erfassungsschema soll die Inanspruchnahme bilanzieller Ansatz- und Bewertungswahlrechte, Ermessensspielräume sowie Sachverhaltsgestaltungen weitgehend egalisiert, das umfangreiche Zahlenmaterial verdichtet und der Jahresabschluss für Vergleiche und somit für eine weitgehende Auswertung durch den Bilanzanalysten vorbereitet werden.[30] Eine derart aufbereitete Bilanz wird als Strukturbilanz bezeichnet.[31] Diese stellt eine unter betriebswirtschaftlichen Aspekten aus dem normierten Jahresabschluss hergeleitete Gegenüberstellung des Vermögens einerseits sowie des Eigen- und Fremdkapitals andererseits dar.[32]
Im dritten Schritt wird das einheitlich erfasste und aufbereitete Zahlenmaterial durch Bildung von Kennzahlen ausgewertet. Letztere sind quantitative Größen, die auf einen bestimmten Informationsbedarf hin gebildet werden und den zu analysierenden Sachverhalt verdichtet wiedergeben sollen.
Damit der Bilanzanalyst die Vermögens-, Finanz- sowie Ertragslage und später auch die Gesamtlage des Unternehmens anhand der Jahresabschlussdaten richtig beurteilen kann, muss er hierzu im vierten Schritt Kennzahlen für die Analyse auswählen und gewichten.
Die im vierten Schritt ausgewählten und gewichteten Kennzahlen sind im fünften Schritt anhand eines Zeit-, eines Betrieb- und eines Soll-Ist-Vergleichs zu beurteilen.
Im sechsten Schritt muss der Bilanzanalyst die aus den Kennzahlenvergleichen gewonnenen Ergebnisse interpretieren und unter Berücksichtigung der qualitativen Informationen zu einem Gesamturteil über die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung des Unternehmens zusammenfassen.[33]
2.5. Adressaten einer Bilanzanalyse
Jedes Unternehmen hat zahlreiche interne und externe Stakeholder, die alle in unterschiedlichem Ausmaß an der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens interessiert sind.[34] Die Bilanzanalyse soll den Informationzielen der am Jahresabschluss interessierten Gruppen genügen. Die IFRS richten sich in den Informationszielen gemäß dem Framework zunächst allgemein an Arbeitnehmer, Kreditgeber, Lieferanten, Kunden, die allgemeine Öffentlichkeit und das Finanzamt.[35]
Arbeitnehmer sind an Informationen über die Stabilität und Rentabilität ihres Arbeitgebers sowie an Informationen über die Fähigkeit des Unternehmens zur Zahlung von Löhnen und Gehältern, Altersversorgungsleistungen und zur Bereitstellung von Arbeitsplätzen interessiert.[36]
Kreditgeber interessieren sich für Informationen, mit denen sie beurteilen können, ob ihre Kredite und die damit verbundenen Zinsen bei Fälligkeit gezahlt werden.[37]
Der Jahresabschluss liefert Hinweise auf die Bonität des Unternehmens. Die Liquidität, der Umsatz sowie die Vermögens- und Kapitalstruktur stellen für die Kreditgeber wichtige Daten dar. Für langfristige Kredite sind die Zukunftsaussichten und die langfristige Ertragskraft des Unternehmens von besonderer Bedeutung.[38]
Lieferanten möchten ebenfalls über die Kreditwürdigkeit des Unternehmens Bescheid wissen. Wenn Lieferungen und Leistungen auf Ziel erfolgen, geht es darum, ob das Unternehmen in der Lage ist, kurz- und langfristig den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen oder nicht.[39]
Auch Kunden sind daran interessiert, ob der Jahresabschluss positiv oder negativ beurteilt wird.[40] Kunden sind an der Fortführung des Unternehmens interessiert, vor allem dann, wenn sie eine langfristige Geschäftsbeziehung zu dem Unternehmen haben und/oder von diesem abhängig sind.[41]
Die allgemeine Öffentlichkeit ist in verschiedener Weise am Analyseobjekt interessiert. So können Unternehmen beispielweise in unterschiedlicher Form einen erheblichen Beitrag zur lokalen Wirtschaft leisten, dazu zählen auch die Zahl der Beschäftigten des Unternehmens und die Unterstützung der lokalen Lieferanten.[42]
Das Finanzamt hat ein besonderes Interesse an den Jahresabschlüssen. Die ausgewiesenen Gewinne sind die Bemessungsgrundlage für die Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbeertragsteuer. Die steuerlichen Vorschriften sollen bezwecken, dass Unternehmen einen möglichst richtigen und gleichmäßigen Periodengewinn ausweisen.[43]
Vornehmliche Adressaten sind allerdings die Kapitalmarktteilnehmer.[44] Diese Gruppe hat bzw. beabsichtigt, dem Unternehmen Kapital zur Verfügung zu stellen. Mit diesem Kapital haftet das Unternehmen gegenüber Dritten. Somit besteht für diese Gruppe ein Verlustrisiko. Gleichzeitig steht den Kapitalmarktteilnehmern der Gewinn aus der Unternehmenstätigkeit zu. Zudem benötigen sie Informationen über die Lage des Unternehmens, um ggf. eine Entscheidung über einen Verkauf ihrer Beteiligung treffen oder durch Ausübung von Stimmrechten die Politik des Unternehmens gestalten zu können.[45] Ihnen wollen die IFRS Informationen liefern, die deren wirtschaftliche Entscheidungen beeinflussen können. Die Ausrichtung auf Investoren wird damit begründet, dass Jahresabschlüsse, die den Informationsbedürfnissen von Investoren genügen, auch für andere Jahresabschlussadressaten nützlich sind.[46]
2.6. Grenzen der Bilanzanalyse
Bevor man mit der Bilanzanalyse beginnt, sollte man sich der Grenzen bei der Durchführung bewusst sein, um von vornherein auszuschließen, dass die Möglichkeiten der Bilanzanalyse falsch eingeschätzt werden.[47] Die Grenzen der Bilanzanalyse sind vor allem für den externen Bilanzanalytiker sehr eng gezogen. Wie die Kleinaktionäre haben auch die Gruppen der Gläubiger und der Arbeitnehmer sowie die übrige Öffentlichkeit keinen Zugang zu betriebinternen Zahlen. Sie sind daher weitgehend auf die veröffentlichten Informationen aus dem Jahresabschluss angewiesen, was für eine zukunftsorientierte Analyse folgende Probleme mit sich bringt:[48]
Die zur Verfügung stehenden Informationen des Jahresabschlusses sind unvollständig.[49] Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung liefern nur quantitative Informationen. Qualitative Aspekte, die für eine Unternehmensbeurteilung erforderlich wären, kennt der externe Bilanzanalytiker meist nicht.
Die Qualität des Managements und der Mitarbeiter, das Image der Unternehmung, die Qualität der Produkte, die Stärke der Konkurrenz sowie das technische und organisatorische Know-how sind wichtige Einflussgrößen für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens, deren Auswirkung eine externer Bilanzanalytiker kaum einzuschätzen vermag. Die Zahlen des Jahresabschlusses sind keine eindeutig definierten Größen. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften sowie -wahlrechte ermöglichen den Ansatz der Vermögenswerte und Rückstellungen oft zu unrealistischen Werten.[50] Die in den Jahresabschlüssen enthaltenen Informationen sind vergangenheitsbezogen und oft nicht mehr aktuell. Ausreichende unterjährige Informationen sind oft nicht vorhanden.[51] Die Informationen des Jahresabschlusses sind in der Regel erst eine geraume Zeit nach dem Bilanzstichtag verfügbar und dadurch zum Zeitpunkt der Analyse oft schon überholt.[52] Bei den Jahresabschlüssen handelt es sich um Nominalwertrechnungen. Zusätzliche Angaben über reale Werte (z. B. Abschreibungen auf Basis von Wiederbeschaffungswerten) fehlen. Die Informationen sind zu global, d. h., Jahresabschlüsse enthalten keine Mengen- und Preisangaben, keine Informationen über schwebende Geschäfte (z. B. den Auftragsbestand) bedingte Verpflichtungen (z. B. Pensionsgeschäfte) sowie selbstgeschaffene oder verbrauchte immaterielle Vermögensgegenstände und in der Regel keine Angaben über die Kapazitätsauslastung. Ebenso fehlen Angaben über Kreditmöglichkeiten und Informationen über finanzielle Auswirkungen von Umweltproblemen.[53] Trotz dieser Bedenken und Schwierigkeiten kann man bei der Unternehmungsbeurteilung auf die Bilanzanalyse nicht verzichten. Sie stellt eine wichtige Komponente der Einschätzung eines Unternehmens dar.[54]
3. Bilanzanalyse am praktischen Beispiel der Metro AG
Im Folgenden wird eine Bilanzanalyse am praktischen Beispiel der Metro AG durchführen. Die Grundlage hierfür ist der Metro - Geschäftsbericht 2008.
3.1. Rahmenbedingungen
Bevor ich den Jahresabschluss aufbereite und analysiere, verschaffe ich mir einen Überblick über das Unternehmen, seine Marktstellung, seine Größenordnung, seine Eigentumsverhältnisse und die Konkurrenzsituation. Diese Rahmenbedingungen sind wichtig für die Bilanzanalyse, da von ihnen Einfluss auf das Gesamtbild des Jahresabschlusses ausgeht.[55] Diese Informationen haben für die Bilanzanalyse eine große Bedeutung und erlauben eine bessere Beurteilung des Unternehmens.[56]
3.1.1. Die Metro AG
Innerhalb von zehn Monaten entsteht durch die Verschmelzung der Handelsunternehmen Asko Deutsche Kaufhaus AG, Kaufhof Holding AG und Deutsche SB-Kauf AG die Metro AG. Sie geht im gleichen Jahr an die Börse. Am 25. Juli 1996 wird die Aktie der Metro AG erstmals im Deutschen Aktienindex (DAX) gelistet. Mit einer Marktkapitalisierung von 12,07 Milliarden D-Mark gehört die Metro AG Ende des Jahres 1996 zu den 20 größten deutschen börsennotierten Unternehmen.[57] Die Metro AG ist heute ein international tätiger Handelskonzern. Mit mehr als 2.200 Standorten in 32 Ländern und rund 290.000 Mitarbeitern ist die Metro AG eines der größten Handelsunternehmen weltweit. Seit 2007 ist das Duisburger Familienunternehmen Haniel mit gut 34 % größter Anteilseigner der Metro AG. Insgesamt halten Haniel, der Unternehmensgründer Otto Beisheim und die Familie Schmidt-Ruthenbeck 68 % an dem Handelsunternehmen.
3.1.2. Konzernstruktur der Metro AG
An der Spitze der Unternehmensgruppe steht die Metro AG mit Sitz in Düsseldorf. Als strategische Management-Holding steuert sie den Konzern. Das operative Geschäft verantworten vier Vertriebslinien, die mit ihren spezifischen Konzepten und teilweise mehreren Vertriebsmarken selbstständig am Markt tätig sind.[58] Die Vertriebsmarke Metro Cash und Carry ist weltweit Marktführer im Selbstbedienungsgroßhandel. Mit den Marken Metro und Makro ist sie die größte und am stärksten internationalisierte Vertriebslinie und in 29 Ländern tätig. Real ist in Deutschland und Polen unter den führenden SB-Warenhäusern. Mit Standorten in Deutschland, Polen, Rumänien, Russland und der Türkei repräsentiert Real das Konzept großflächiger SB-Warenhäuser. Die Vertriebsmarken Media Markt und Saturn sind Europas Nummer eins im Elektrofachhandel. Sie sind in 16 Ländern vertreten und bauen ihre führende Position in Europa konsequent aus. Galeria Kaufhof ist Konzept- und Systemführer im deutschen Warenhaussegment.[59]
3.1.3. Rechnungslegung der Metro AG
Der Konzernabschluss der Metro AG wurde zum 31. Dezember 2008 nach den International Finacial Reporting Standards (IFRS) des International Accounting Standards Board (IASB) aufgestellt. Er berücksichtigt alle zu diesem Zeitpunkt verabschiedeten und in der Europäischen Union verpflichtend anzuwendenden Bilanzierungsstandards und Interpretationen. Der Konzernabschluss entspricht der Vorschrift des § 315 a Handelsgesetzbuch (HGB). Diese bildet die Rechtsgrundlage für die Konzernrechnungslegung nach den internationalen Standards in Deutschland.[60]
Folgende Abbildung zeigt die Rahmenbedingungen der Metro AG:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Rahmenbedingungen der Metro AG, eigene Darstellung
3.2. Aufbereitung der Daten des Jahresabschlusses der Metro AG
Da die in einem Jahresabschluss veröffentlichten Daten nicht von vornherein den Erfordernissen einer Bilanzanalyse gerecht werden, müssen sie für diese Zwecke aufbereitet werden.[61]
Dies geschieht durch Bereinigung, Umbewertung, Saldierung, Aufspaltung, Umgruppierung und Verdichtung der Positionen der Bilanz sowie der GuV-Rechnung.[62]
3.3. Bilanz nach IFRS
Die Bilanz gibt für einen bestimmten Stichtag in Kontoform auf der Aktivaseite eine Übersicht über das betriebliche Vermögen; die Passivaseite zeigt, aus welchen Quellen die betrieblichen Mittel stammen. Die Aktivaseite bezieht sich somit auf die Mittelverwendung, die Passivaseite auf die Finanzierung. Die jeweilige Bilanzierungskonzeption bestimmt den genauen Inhalt. Welche Größen in der Bilanz auszuweisen sind, hängt von der Definition der Größen Vermögen und Schuld ab. Zu Beginn der unternehmerischen Tätigkeit wird eine Eröffnungsbilanz erstellt, zum Abschluss jeden Geschäftsjahres eine Schlussbilanz. Die Bilanz bildet die Basis für die Bilanzanalyse.[63] Nach IFRS gibt es keine vorgeschriebene Struktur der Bilanz; die Zusammenstellung können die Unternehmen in eigener Verantwortung bestimmen. IAS 1 nennt nur wesentliche Grundsätze: Unterscheidung in kurz- und langfristige Vermögenswerte, Unterscheidung in kurz- und langfristige Schulden, Mindestinhalt der Bilanz, Mindestangaben in Bilanz oder Anhang. Gemäß IAS 1.57 ist lediglich zwischen lang- und kurzfristigen Vermögenswerten zu unterscheiden, was im Wesentlichen der Unterscheidung in Umlauf- und Anlagevermögen entspricht.[64]
3.3.1. Aufbereitung der Bilanz zur Erstellung der Strukturbilanz
Im Folgenden werde ich die Daten des Konzernabschlusses 2008 der Metro AG aufbereiten. Aufgrund des Bestätigungsvermerks der KPMG AG vom 02.03.2009 zum Jahresabschluss 2008 ist davon auszugehen, dass die Angaben im Konzernabschluss und im Konzernanhang richtig sind und dass die Buchführung ordnungsgemäß nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erfolgt ist.[65]
3.3.2. Aufbereitung der Aktivaseite der Bilanz
Die Aktivaseite der Bilanz der umfasst die lang- und die kurzfristigen Vermögenswerte.
[...]
[1] Vgl. Gräfer (2008), S. 1.
[2] Vgl. Lichtkoppler/Kostelecky (2007), S. 5.
[3] Vgl. Engel-Bock (2007), S. 15.
[4] Vgl. Werner/Padberg/Kriete (2005), S. 1.
[5] Vgl. Nicolini (2008), S. 16.
[6] Vgl. Engel-Bock (2007), S. 79.
[7] Vgl. Herbst (2006), S. 1.
[8] Vgl. Engel-Bock (2007), S. 79.
[9] Vgl. Herbst (2006), S. 1.
[10] Vgl. Geschäftsbericht Metro Group 2008 (03.10.2009), http://www.metrogroup.de, S. 132.
[11] Vgl. Küting/Weber (2006), S. 5.
[12] Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele (2004), S. 1.
[13] Vgl. Rehkugler/Podding (1990), S. 7.
[14] Vgl. Lichtkoppler/Kostelecky (2007), S. 5.
[15] Vgl. Gräfer (1997), S. 15.
[16] Vgl. Born (2008), S. 4.
[17] Vgl. Born (2008), S. 5.
[18] Vgl. Ditges/Arendt (2005), S. 353.
[19] Vgl. Vollmuth (2009), S. 25.
[20] Vgl. Ditges/Arendt (2005), S.353.
[21] Vgl. Ditges/Arendt (2005), S. 356.
[22] Vgl. Burger (1995), S. 22.
[23] Vgl. Ditges/Arendt (2005), S. 356.
[24] Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele (2003), S. 278.
[25] Vgl. Gräfer (1997), S. 23.
[26] Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele (2003), S. 278.
[27] Vgl. Gräfer (1997), S. 23.
[28] Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele (2003), S. 278.
[29] Vgl. Kerth/Wolf (1986), S. 28.
[30] Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele (2003), S. 278.
[31] Vgl. Wehrheim/Schmitz (2009), S. 146.
[32] Vgl. Schult/Brösel (2008), S. 94.
[33] Vgl. Baetge/Kisch/Thiele (2003), S. 278.
[34] Vgl. Lichtkoppler/Kostelecky (2007), S. 37.
[35] Vgl. Werner/Padberg/Kriete (2005), S. 5.
[36] Vgl. Schult/Brösel (2008), S. 41.
[37] Vgl. ebenda
[38] Vgl. Vollmuth (2009), S. 27.
[39] Vgl. ebenda
[40] Vgl. ebenda
[41] Vgl. Schult/Brösel (2008), S. 41.
[42] Vgl. ebenda
[43] Vgl. Vollmuth (2009), S. 28.
[44] Vgl. Werner/Padberg/Kriete (2005), S. 5.
[45] Vgl. Werheim/Schmitz (2009), S. 146.
[46] Vgl. Werner/Padberg/Kriete (2005), S. 5.
[47] Vgl. Kerth/Wolf (1986), S. 54.
[48] Vgl. Tanski/Kurras/Weitkamp (1998), S. 670.
[49] Vgl. Burger (1995), S. 6.
[50] Vgl. Gräfer (2008), S. 9.
[51] Vgl. Born (2008), S. 9.
[52] Vgl. Gräfer (2008), S. 10.
[53] Vgl. Born (2008), S. 9.
[54] Vgl. Gräfer (2008), S. 10.
[55] Vgl. Gräfer (1997), S. 56.
[56] Vgl. Vollmuth (2009), S. 127.
[57] Vgl. Geschäftsbericht Metro Group 2008 (03.10.2009), http://www.metrogroup.de, S. 3.
[58] Vgl. Geschäftsbericht Metro Group 2008 (03.10.2009), http://www.metrogroup.de, S. 68.
[59] Vgl. ebenda
[60] Vgl. Geschäftsbericht Metro Group 2008 (03.10.2009), http://www.metrogroup.de, S. 132.
[61] Vgl. Coenenberg (2005), S. 956.
[62] Vgl. Gräfer (1997), S. 60.
[63] Vgl. Nicolini (2008), S. 53.
[64] Vgl. Nicolini (2008), S. 54.
[65] Vgl. Geschäftsbericht Metro Group 2008 (03.10.2008), http://www.metrogroup.de, S. 195.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842805958
- DOI
- 10.3239/9783842805958
- Dateigröße
- 669 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Hamburg – Wirtschaft und Politik, Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2010 (Oktober)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- bilanzanalyse konzernbilanzen metro beispiel ifrs
- Produktsicherheit
- Diplom.de