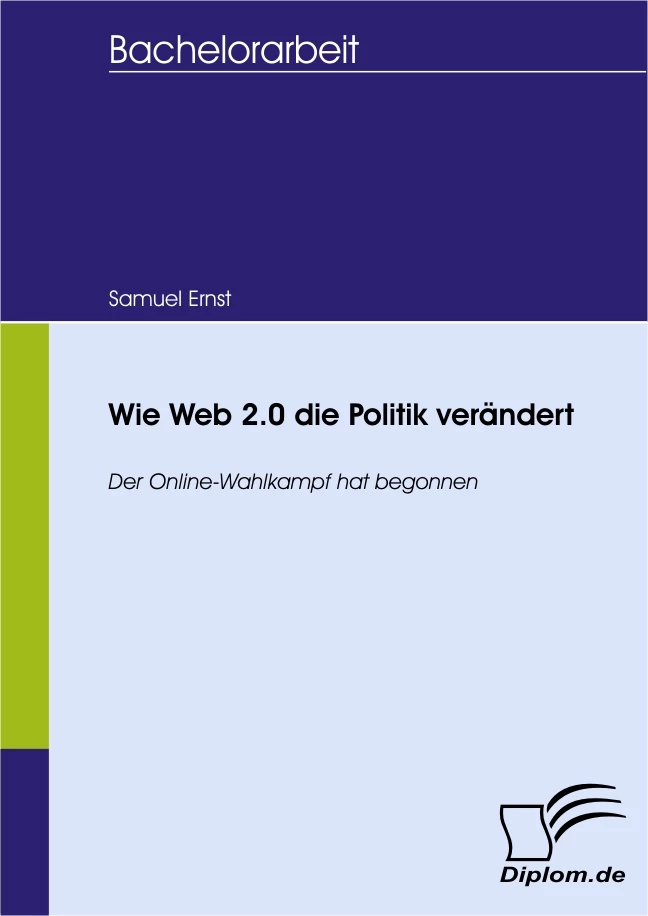Wie Web 2.0 die Politik verändert
Der Online-Wahlkampf hat begonnen
Zusammenfassung
Barack Hussein Obama war der erste Web 2.0-Präsident. Mit Hilfe von Web 2.0-Diensten hat sich Obama in einer professionellen Internet-Wahlkampagne die Gunst von Millionen von amerikanischen Wählern und Wählerinnen sichern können. Die zentralen Botschaften von Obama im Wahlkampf waren Veränderung (Change) und Hoffnung (Hope). Mit dem Slogan Yes We Can beeinflusste Obama innerhalb des neunmonatigen Wahlkampfs die öffentliche Meinung durch die unterschiedlichsten medialen Werkzeuge. Dabei setzte der erste afroamerikanische Präsident der USA neben den traditionellen Medien aus Print, Hörfunk und Fernsehen besonders auf ein neues Medium: das Internet.
Im US-Wahlkampf 2008 waren nicht die großen amerikanischen TV-Anstalten das Sprachrohr des Präsidenten, sondern die amerikanischen Bürger und Bürgerinnen selbst nahmen direkt politisch am Wahlkampf teil, organisierten sich über Foren, sammelten Spenden ein und waren somit aktiv. Das Marketingteam von Obama setzte auf die Strategie Obama Everywhere. Dies bedeutete, dass Obama auf jeglichen Sozialplattformen im Internet wie z.B. auf Facebook, Twitter, Myspace, Youtube und Linkedin vertreten war. Zudem unterstützen auch amerikanische Künstler, wie der Sänger der Black Eyed Peas will.i.am, den Wahlkampf auf YouTube. Das resultierende Yes-We-Can-Musikvideo, mit einer Länge von viereinhalb Minuten, wurde bis zum heutigen Tag knapp 21 Millionen mal abgerufen.
Rund ein Jahr vor den US-Präsidentschaftswahlen hatte Obama die Bedeutung der IT-Nutzung im Wahlkampf erkannt. Er nutzte das Internet, um eine neue Plattform von Basisdemokratie zu ermöglichen. So können die Bürger live die Regierung und deren Sitzungen mitverfolgen, Kommentare abgeben, und somit Einfluss auf die Politik nehmen.
Inspiriert durch den Wahlkampf 2008 in den USA wird im Verlauf dieser Ausarbeitung insbesondere aufgezeigt, wie Web 2.0 auf die Politik in Deutschland Einfluss nimmt. Zunächst werden einige Begrifflichkeiten definiert, um im Anschluss verschiedene Web 2.0-Instrumente an konkreten Beispielen im Online-Wahlkampf zu erklären; dabei werden Chancen und Risiken des Web 2.0s an kurzen Beispielen aufgezeigt. Im Hauptteil dieser Ausarbeitung findet sich eine medienpolitische Analyse zu den Themen Föderalismus, Jugend-, Verbraucher- und Datenschutz. Im vierten Kaptitel folgt ein Interview mit dem Internetspezialisten Matthias J. Lange. Abschließend ist das Fazit […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
I. Danksagung
II. Abkürzungsverzeichnis
III. Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Internet, das neue Leitmedium
2.1. Vom Web 1.0 zum Web 2.0
2.2. Definition Web 2.0
2.3. E-Government
3. Das Web 2.0
3.1. Facebook
3.1.1. Risiken bei Facebook
3.1.2. Vermarktung und Wahlkampf der Politiker
3.1.3. Die Online-Partizipation der Bürger
3.1.4. Obama auf Facebook
3.1.5. Bundespräsidentenwahl 2010: Gauck vs. Wulff
3.2. Blogs
3.2.1. Internationale Blogs
3.2.2. Yoani Sánchez – live aus Kuba
3.2.3. Nationale Blogs
3.2.4. netzpolitik.org
3.2.5. BILDBlog
3.2.6. Horst Köhler – gestürzt durch Blogger?
3.3. Twitter
3.3.1. Wahlprognose zur Bundestagswahl 2009
3.4. Medienpolitik
3.4.1. Artikel 5 des Grundgesetzes
3.4.2. Föderalismus
3.4.3. Jugendschutz
3.4.4. Datenschutz und Verbraucherschutz
4. Interview mit Internetspezialist Matthias J. Lange
5. Fazit und Ausblick
6. Literaturverzeichnis
6.1. Monographien / Sammelbände / Studien
6.2. Gesetzestexte
6.3. Fachzeitschriften / Zeitungen / Berichte
6.4. Elektronische Texte / Internetverweise
7. Erklärung
I. Danksagung
An dieser Stelle ist es mir eine ganz besondere Freude, mich bei jenen Menschen zu bedanken, ohne welche die vorliegende Ausarbeitung nicht hätte verwirklicht werden können.
Besonderer Dank gilt daher an erster Stelle der Betreuerin dieser Ausarbeitung, Frau Professorin Dr. Goderbauer-Marchner, die mich über das normale Maß hinaus begleitet und mich durch kritische Anregungen und Vorschläge immer wieder tatkräftig unterstützt hat.
An zweiter Stelle gilt ein herzlicher Dank Herrn Professor Dr. Hillebrecht, der die Ausarbeitung als Zweitprüfer betreute.
Im Besonderen bedanke ich mich bei Personen aus meinem privaten und geschäftlichen Umfeld. Vor allem meinen Eltern, Dr. Martin und Oslinde Ernst, die mich stets tatkräftig bei der Ausarbeitung unterstützt haben, sei ein besonderer Dank für ihre Mithilfe ausgesprochen.
Des Weiteren danke ich Herrn Matthias J. Lange für das informative Interview über Politik und Web 2.0.
Ein abschließender und besonderer Dank gilt der Hanns-Seidel-Stiftung e.V., die mich während meiner Zeit als Student an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt mit einem Begabtenstipendium ideell sowie finanziell aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert hat.
Ein außerordentlicher Dank gilt an dieser Stelle dem Leiter des Förderungswerks der Stipendiaten und Stipendiatinnen, Herrn Professor Niedermeier sowie der ehemaligen Referentin des Journalistischen Förderprogramms (JFS) Frau Rechl.
II. Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
III. Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Barack Obama im Wahlkampf 2008
Abbildung 2: Entwicklung der Onlinenutzung in Deutschland
Abbildung 3: Regelmäßige Nutzung von sozialen Netzwerken
Abbildung 4: Facebook-Profil von zu Guttenberg
Abbildung 5: Twitter-Profil von Kristina Schröder
Abbildung 6: Matthias J. Lange
1. Einleitung
Barack Hussein Obama war der erste Web 2.0-Präsident.[1]
Mit Hilfe von Web 2.0-Diensten hat sich Obama in einer professionellen Internet-Wahlkampagne die Gunst von Millionen von amerikanischen Wählern und Wählerinnen sichern können. Die zentralen Botschaften von Obama im Wahlkampf waren Veränderung (Change) und Hoffnung (Hope). Mit dem Slogan „Yes We Can“ beeinflusste Obama innerhalb des neunmonatigen Wahlkampfs die öffentliche Meinung durch die unterschiedlichsten medialen Werkzeuge. Dabei setzte der erste afroamerikanische Präsident der USA neben den traditionellen Medien aus Print, Hörfunk und Fernsehen besonders auf ein neues Medium: das Internet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im US-Wahlkampf 2008 waren nicht die großen amerikanischen TV-Anstalten das Sprachrohr des Präsidenten, sondern die amerikanischen Bürger und Bürgerinnen selbst nahmen direkt politisch am Wahlkampf teil, organisierten sich über Foren, sammelten Spenden ein und waren somit aktiv. Das Marketingteam von Obama setzte auf die Strategie „Obama Everywhere“. Dies bedeutete, dass Obama auf jeglichen Sozialplattformen im Internet wie z.B. auf „Facebook“, „Twitter“, „Myspace“, „Youtube“ und „Linkedin“ vertreten war.[2]
Zudem unterstützen auch amerikanische Künstler, wie der Sänger der Black Eyed Peas „will.i.am “, den Wahlkampf auf YouTube. Das resultierende Yes-We-Can-Musikvideo, mit einer Länge von viereinhalb Minuten, wurde bis zum heutigen Tag knapp 21 Millionen mal abgerufen.[3]
Rund ein Jahr vor den US-Präsidentschaftswahlen hatte Obama die Bedeutung der IT-Nutzung im Wahlkampf erkannt. Er nutzte das Internet, um eine neue Plattform von Basisdemokratie zu ermöglichen. So können die Bürger live die Regierung und deren Sitzungen mitverfolgen, Kommentare abgeben, und somit Einfluss auf die Politik nehmen.[4]
Inspiriert durch den Wahlkampf 2008 in den USA wird im Verlauf dieser Ausarbeitung insbesondere aufgezeigt, wie Web 2.0 auf die Politik in Deutschland Einfluss nimmt.
Zunächst werden einige Begrifflichkeiten definiert, um im Anschluss verschiedene Web 2.0-Instrumente an konkreten Beispielen im Online-Wahlkampf zu erklären; dabei werden Chancen und Risiken des Web 2.0s an kurzen Beispielen aufgezeigt. Im Hauptteil dieser Ausarbeitung findet sich eine medienpolitische Analyse zu den Themen Föderalismus, Jugend-, Verbraucher- und Datenschutz. Im vierten Kaptitel folgt ein Interview mit dem Internetspezialisten Matthias J. Lange. Abschließend ist das Fazit angefügt.
2. Internet, das neue Leitmedium
Johannes Gensfleisch, alias Gutenberg, revolutionierte im 15. Jahrhundert die Welt mit der Erfindung der beweglichen Lettern. Die Druckmedien wurden wirtschaftlich erschwinglich und waren dadurch nicht mehr nur dem Klerus vorbehalten. Im 17. sowie 18. Jahrhundert entstanden Plakate, Flugschriften, Briefe, Zeitungen und Kalender, die von der sich bildenden bürgerlichen Gesellschaft vermehrt verwendet wurden. Die erste Wochenzeitung, die „Relation“, ist auf das Jahr 1605 datiert und wurde in Straßburg verlegt.[5] Im Industrie und Massenzeitalter des 19. Jahrhunderts war die Erfindungen der elektromagnetischen Wellen durch Funkentladung 1888 von Heinrich Hertz die Grundlage für die spätere audio-visuelle Entwicklung von Radio, Film und Fernsehen. Die Brüder Lumiére zeigten 1895 die ersten bewegten Bilder in Paris - der Kinofilm war somit geboren. 1897 erfand Guglielmo Marconi die drahtlose Telegraphie. Dank Reginald Fessenden folgte 1906 die erste Rund-funksendung in den USA. In Deutschland hingegen fasste das Radio erst 1923 mit der „Deutsche Stunde AG“ Fuß. Das Fernsehen begann als Massenmedium die ersten Aufführungen 1923 in Leipzig und hatte den Höhepunkt in der Live-Berichterstattung über die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin.[6]
Dank der Globalisierung und Digitalisierung befindet sich die Medienlandschaft erneut im Umbruch. Das Internet ist das neue innovative Medium des 21. Jahrhunderts. Dabei wird das Internet folgendermaßen definiert: „Das Internet ist eine technologische Plattform auf Basis des Computers für verschiedene eigenständige digitale Netzmedien. Meist wird Internet als Synonym für das World Wide Web benutzt.“[7]
Dabei entstand das Internet 1983 ursprünglich als Forschungsnetz. Erst seit 1991 ist das Bedienen von multimedialen Anwendungen durch die Standardisierung des World Wide Web (WWW) möglich. Der Begründer des Standards war der Brite Tim Berner-Lee.[8] In den vergangen Jahren konnte das Internet einen rasanten Wachstum der Nutzerzahlen verzeichnen. Waren beispielsweise 1997 nur 4,1 Millionen (6,5%) der Bundesbürger gelegentlich online, sind es seit 2010 circa 49 Millionen (69,4%). Dies bedeutet einen Zuwachs von über 62,9% innerhalb von 13 Jahren.[9]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vornehmlich bei den sogenannten „Digital Natives“ hat sich das Internet als Leitmedium etabliert. Digital Natives sind Personen, die mit dem Internet aufgewachsen und somit mit den digitalen Technologien vertraut sind.[10] Laut der ARD/ZDF-Onlinestudie von 1997 bis 2009 sind über 95% der 14 bis 29-jährigen online[11]. Dabei setzen über 90% der 14 bis 29-jährigen das Internet primär für die Suche bei Suchmaschinen und Versenden und Empfangen von E-Mails ein. Die Web 2.0 Dienste wie Gesprächsforen, Newsgroups, Chats, Online-Communities und Instant Messaging werden im Schnitt von knapp zwei Drittel der Digital Natives mindestens einmal wöchentlich genutzt.[12] 2009 hat das Statistische Bundesamt Deutschland ermittelt, dass 82% der 16 bis 24-jährigen jeden oder fast jeden Tag auf die private Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien zurückgreifen.[13] Laut einer 2010 durchgeführten Marktforschung des Unternehmens „tfactory“ nutzen im Schnitt 84 Prozent der 15 bis 24-jährigen Web 2.0 Produkte.[14] Aus diesen Studien lässt sich schließen, dass heute schon die Digital Natives das Internet als Leitmedium verwenden.
2.1. Vom Web 1.0 zum Web 2.0
In den Anfängen des World Wide Web – dem sogenannten Web 1.0 – konnte der Anwender nur simple Informationen auf einer Homepage abrufen oder E-Mails versenden. Jedoch auch simple Funktionen, wie z.B. die einer E-Mail, wurden schon im US-Wahlkampf 1992 eingesetzt.[15]
Das Web 2.0 hingegen bietet die Möglichkeit der Partizipation, des Austausches oder der Beteiligung auf Online-Plattformen. Dabei stammt der Begriff Web 2.0 aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Eric Knorr, Chefredakteur der InfoWorld, gebrauchte im Dezember 2003 erstmalig den Begriff Web 2.0: „This is nothing less than the start of […] Web 2.0, where the Web becomes a universal, standards-based integration platform. Web 1.0 (HTTP, TCP/IP and HTML) is the core of enterprise infrastructure.“[16] Zudem prognostizierte Knorr, dass ab 2004 die Web 2.0-Dienste erfolgreich beim Endkunden angenommen werden. Neben dem „Gründungsvater“ Knorr sollte an dieser Stelle auch der Ire Tim O’Reilly genannt werden, der mit seiner Publikationen „What is Web 2.0?“ im Jahre 2004 zudem das Schlagwort Web 2.0 etabliert hat.[17]
2.2. Definition Web 2.0
Vereinfacht formuliert könnte das Web 2.0 somit als „Mitmachnetz“ bezeichnet werden.[18] Um die Definition des „Mitmachnetzes“ zu konkretisieren hat der Physiker, Mathematiker und Universitätslektor Hans G. Zeger folgende treffende Definition gefunden: „Web 2.0 ist die Produktion von Inhalten durch Nutzer für Nutzer auf Online-Plattformen mit technischen Mitteln. Die Web 2.0-Techniken erlauben die Individualisierung der Informationsnutzung bei gleichzeitig stärkerer Vernetzung.“[19] Hierzu sollte noch die Anmerkung von Katrin Busemann und Christoph Gscheidle ergänzt werden: „Beim Web 2.0 geht es um Partizipation, Vernetzung und Austausch – darum, sich auf speziellen Plattformen aktiv einzubringen und eigene Inhalte beizusteuern. Diese Beisteuerung wird als «user generated» bezeichnet.“[20]
2.3. E-Government
Das Internet und das Web 2.0 sind mitverantwortlich, dass der Politik ein Wandel bevorsteht. Die Demokratie könnte nach dem Motto „Die Herrschaft des Volkes“ eine Renaissance erleben. Dank des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) kann heutzutage der Bürger selbst die Verwaltungs- und Entscheidungskultur der Politik mitbestimmen. Im E-Government entsteht ein technisch-basierter Dialog zwischen Politik, Verwaltung und Bürger. Diese Partnerschaft kann z.B. Politikverdrossenheit abbauen oder eine Bürgernähe ermöglichen.[21] Das Thema politische Kommunikation zwischen Bürger und Politik über die Neuen Medien lässt viele Politiker in Deutschland von einer neuen „besseren“ Demokratie träumen.
Dabei eifert ein Teil der Mitglieder des Bundestages den amerikanischen Vorbildern nach und setzt dabei auf die neuen Online-Dienste. Auf der anderen Seite gibt es auch strikte Gegner dieser Entwicklung.[22]
Nachdem einige Begrifflichkeiten in Kapitel zwei erklärt worden sind, werden nun im dritten Kapitel, dem Hauptteil dieser Ausarbeitung, Web 2.0-Instrumente wie soziale Netzwerke, Blogs und Twitter analysiert. Darüber hinaus werden die medienpolitischen Felder wie Daten-, Verbraucher-, und Jugendschutz im digitalen Zeitalter thematisiert.
3. Das Web 2.0
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im WWW gibt es verschiedene Web 2.0-Dienste, die z.B. im heutigen Online-Wahlkampf von Politikern eingesetzt werden, um mit den Bürger/innen in Diskurs zutreten. In der Kommunikationsrichtung wird zwischen „many-to-many“ (z.B. soziale Netzwerke), „one-to-many“ (z.B. RSS-Feed, YouTube, Twitter) und „one-to-one“ (z.B. Blogs, Podcast) unterschieden.[23]
Zunächst werden die privaten sozialen Netzwerke beleuchtet, die in den vergangenen Jahren einen enormen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen konnten. Marktführer der sozialen Netzwerke in Deutschland sind die „VZ-Netzwerke“ der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck mit gut 16 Millionen aktiven Mitgliedern. Diese setzen sich aus 6 Millionen „studiVZ-“, 5,5 Millionen „schülerVZ-“ und 4 Millionen „meinVZ-Mitgliedern“ zusammen.[24]
3.1. Facebook
Facebook ist eines der wichtigsten sozialen Netzwerke in Deutschland. Laut Fittkau & Maaß Consulting[25] hat es die regelmäßigsten Networker:
Dabei liegt Facebook mit mehr als neun Millionen Mitgliedern in Deutschland an zweiter Stelle.[26] Das Netzwerk wurde 2004 von den Studenten Mark Zucker-berg, Dustin Moskovitz, Chris Hughes und Eduardo Saverin an der Harvard-Universität gegründet.[27] Seit 2010 hat Facebook über 500 Millionen Mitglieder. Dabei ist es in über 70 Sprachen abrufbar und somit das größte private Netz-werk weltweit.[28] Die steigenden Mitgliederzahlen lassen darauf schließen, dass Facebook auch in naher Zukunft das größte soziale Netzwerk in Deutschland sein wird. Die amerikanische Psychologin Kit Yarrow erklärte in der „ZEIT“, warum Facebook so erfolgreich bei den jungen Mitgliedern ist: „Diese Generation schätz schnelle und häufige Kontakte mit Menschen wie mit Marken, auch weil ihre Aufmerksamkeitsspanne so gering ist. Gleichzeitig ist ihr Bedürfnis nach Stimulation sehr groß.“[29] Facebook bedient genau diese Bedürfnisse der Mitglieder. Das Netzwerk ist so angelegt, dass jeder die Fotos, Videos und Mitteilungen der Freunde mitverfolgen kann. Durch den kontinuierlichen Kontakt zwischen den Mitgliedern erzeugt die Plattform Aufmerksamkeit. Jeder Kontakt im Cyperspace führt zu einem kleinen Glückserlebnis. Psychologin Yarrow nennt dies Phänomen „connection is attention“.[30] Für viele Internetnutzer ist deshalb Facebook unabdingbar geworden. Auf der Plattform werden Freunde getroffen, private sowie geschäftliche Kontakte gepflegt und Informationen ausgetauscht.
3.1.1. Risiken bei Facebook
Während Daten im 20. Jahrhundert noch analog gelagert worden sind, werden im 21. Jahrhundert hingegen Daten digital gespeichert. Dabei laden die Online-User z.B. bei Facebook sehr viele Daten hoch. Doch sind die Internetuser sich auch bewusst, welchem Unternehmen sie ihre persönlichen Daten überlassen? Auf Facebook sind meist Vor- und Zuname, Geschlecht, Geburtsdatum, Religionszugehörigkeit, sexuelle Orientierung, Freunde, Exfreunde, Musikgeschmack, Lieblingsmarken, Reiseziele und jede Menge Trivialitäten der User eingetragen. Schätzungsweise 25 Milliarden (!) Inhalte tauschen die Facebook-Nutzer pro Monat miteinander aus.[31] Die Daten liegen dabei auf keinem deutschen, sondern auf einem amerikanischen Server in Palo Alto, Kalifornien. Jeder, der bei Facebook angemeldet ist, muss Paragraph 9, Absatz 2 der Datenschutzrichtlinien akzeptieren: „Zustimmung zur Datenerfassung und -verarbeitung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Durch die Verwendung von Facebook stimmst du der Übertragung und Verarbeitung deiner persönlichen Daten in die bzw. in den USA zu.“[32]
Mit den Informationen aus Bildern, Texten und Videos können fremde Personen oder der zukünftige potenzielle Arbeitgeber schnell mit ein paar Klicks ein spezifisches Profil zu einer bestimmten Person erstellen. Denn jeder Facebook-User gibt durch die Online-Vernetzung ein einmaliges individuelles Profil preis. Das Profil ist nur dann ausreichend geschützt, wenn die korrekten Sicherheitseinstellungen der Privatsphäre aktiviert sind. Dazu kommt noch folgendes Problem: „Die Kinder und Jugendlichen von heute unterscheiden nicht zwischen der realen Welt und der Cyber-Welt"[33], so Rechtswissen-schaftler Urs Gassner und genau deshalb veröffentlichen sie oft sensible Daten im Netz. Journalist Henrich Wefing vermutet sogar in der Wochenzeitung „DIE ZEIT“, dass „wohl kein Geheimdienst dieser Welt – der chinesische vielleicht ausgenommen – über ein derart präzises, vielfältiges, ständig aktualisiertes Bild dessen, was in der Bevölkerung vorgeht, verfügt [ ..].“ Zudem stellt er fest, dass „eine staatliche Behörde auch nur annähernd so viele statistische Informationen besitzt[ ..].“[34] Jan Schmidt, Soziologe am Hans-Bredow-Institut in Hamburg rät deshalb: „Der Knackpunkt ist Medienkompetenz. Jugendliche müssen die Datenschutz-Einstellungen einer Plattform auch nutzen können und wissen, dass ihre Daten auch nach Jahren noch vorhanden sein können.“[35]
Insbesondere Verbrechen boomen im Web 2.0. Nicht nur Kinder und Jugendliche werden davon beeinflusst (siehe Kapitel 3.4.3) sondern auch Erwachsene. Wer Informationen im Netz freiwillig preisgibt, muss davon ausgehen, dass kriminelle Web 2.0-Nutzer diese Daten auch nutzen.
Ein Beispiel aus den USA verdeutlicht dies: Kurt Pendleton und Keri McMullen veröffentlichen am 20. März 2010 auf Facebook, dass die beiden auf ein Konzert gehen. Ein angeblicher Facebook-Freund liest die Mitteilung mit und raubt die Wohnung des Paares in deren Abwesenheit aus.[36] Nicht nur geheime Recherchen zu fremden Personen können auf Facebook getätigt werden, das Netzwerk versteht sich auch offiziell als Werbeplattform. Jede Firma kann auf dem Netzwerk zielgruppenspezifische Werbung schalten. David Bell, Marketingmanager bei „Sony Music“ zieht es so: „Bei Facebook kann ich direkt und ausschließlich die Fans von «Bullet for my Valentine» ansteuern. Deshalb ist es wahrscheinlicher, dass sie etwas kaufen.“[37] Weiter wird im Artikel bestätigt, dass „im ersten Quartal in den USA, abgesehen von Google, keine Onlinefirma so viel Werbung gezeigt hat wie Facebook.“[38]
Dass Facebook als eine technische Plattform zudem Fehler und Lücken hat, zeigen diese beiden Beispiele: Am 23.03.2010 waren über 400 Millionen E-Mail-Adressen von Facebook-Mitgliedern frei einsehbar. Ein technischer Fehler hatte die Sicherheitsvorkehrungen ausgeschaltet.[39] Am 28.07.2010 veröffentlicht die „taz“, dass über 170 Millionen Facebook-Accounts von einem Hacker ausgelesen wurden.[40] An dieser Stelle muss nachgefragt werden. Warum veröffentlichen insbesondere die Digital Natives ohne Bedenken ihre Daten im Web 2.0? Ruben Karschnick, 18 Jahre jung und Gewinner des Schülerzeitungs-wettbewerbs des „Spiegels“ sieht es so: „Wir lieben das Gefühl, in Gesellschaft zu sein, obwohl wir in Wahrheit doch so einsam vor unserem Bildschirmen hocken. Wir empfinden Online und Offline nicht als zwei Welten, sondern leben in beiden gleichzeitig. Wir geben Facebook unsere Daten, Facebook gibt uns das Gefühl von Zugehörigkeit. Um viele Gefahren der digitalen Welt wissen wir. Dass Facebook unsere Daten erkauft und Google alles speichert, was wir je anfragen, ist uns bewusst. Wir leben im Rausch der Informationen. Wir sind von ihnen abhängig und fühlen uns schlecht, wenn wir nicht auf sie zugreifen können. Wir brauchen das ständige Grundrauschen.“[41]
[...]
[1] Vgl. Hans G. Zeger, Paralleluniversum Web 2.0, 1.A., Wien 2009, S.90
[2] Vgl. Hans G. Zeger, Paralleluniversum Web 2.0, 1.A., Wien 2009, S.90
[3] S. Video „Yes We Can - Barack Obama Music Video“, in: Youtube, URL: http://www.youtube.com/watch?v=jjXyqcx-mYY [Abgerufen: 30. Juli 2010]
[4] S. „US-Präsidentschaftskandidaten haben ganz unterschiedliche Pläne für die IT-Nutzung und Förderung“, in: Computer Zeitung, Heft 48, 2007
[5] Vgl. G.Göhler/A.Knaut/C.Schmalz-Jacobsen/C.Walther (Hrsg.), Markt/Medien/Medien, T.Schmid – Warum sich Zeitungen neu erfinden müssen, 1.A., Frankfurt am Main 2008, S.61
[6] S. Jahreszahlen bei Werner Faulstich, Grundwissen Medien, 2.A., München 1995, S. 26,35,161,237,238 sowie den Abriss der Mediengeschichte in Werner Faulstich, Mediengeschichte von 1700 bis ins 3. Jahrtausend, 1.A., Göttingen 2006, S. 12-13
[7] Werner Faulstich, Mediengeschichte von 1700 bis ins 3. Jahrtausend, 1.A., Göttingen 2006, S. 172
[8] S. Festschrift „Internet zwischen Hype, Ernüchterung und Aufbruch“, in: 10 Jahre ARD/ZDF-Onlinestudie, S.2, online einsehbar unter URL: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/fileadmin/Fachtagung/ARD_ZDF_Onlinebrosch_re_040507.pdf [Abgerufen: 3. August 2010]
[9] S. „Entwicklung der Onlinenutzung in Deutschland zwischen 1997 bis 2010“, in: ARD-ZDF-Onlinestudie 2010, URL: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=onlinenutzung0 [ Abgerufen: 5. September 2010]
[10] S. Begriff „Digital-Native“, in: Gründerszene, URL: http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/digital-native [Abgerufen: 2. August 2010]
[11] S. Tabelle „Internetbenutzer in %“, in: ARD-ZDF-Onlinestudie 2009, URL: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=onlinenutzung-prozen [Abgerufen: 2. August 2010]
[12] S. Tabelle „Genutzte Anwendungen“, in: ARD-ZDF-Onlinestudie 2009, URL: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=onlinenutzung-anwend [Abgerufen: 2. August 2010]
[13] S. Tabelle „Private Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien 2009“, in: Destatis, URL: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Informationsgesellschaft/PrivateHaushalte/Tabellen/Content75/NutzungInternetAlter,templateId=renderPrint.psml [Abgerufen: 2. August 2010]
[14] S. „Mediennutzung von Teenager: Facebook statt FAZ“, in: Chip, 07.04.2010, URL: http://www.chip.de/news/Mediennutzung-von-Teenagern-Facebook-statt-FAZ_42318968.html [Abgerufen: 2. August 2010]
[15] Vgl. Peter Filzmaier, Fritz Plasser, Wahlkampf um das Weiße Haus – Presidential Elections in den USA, Opladen: Leske und Budrich Verlag, 2001, S. 157-159 sowie Jens C. König, Politische Kultur in den USA und Deutschland: Nationale Identität am Anfang des 21. Jahrhunderts, 1.A. Berlin 2010, S.432
[16] Eric Knorr „The Year of Web Service“, in CIO, 12/2003, S.90
[17] Vgl. Katrin Busemann und Christoph Gscheidle „Web 2.0: Communitys bei jungen Nutzern beliebt“, in Media Perspektiven, 7/2009, S.356
[18] Vgl. Katrin Busemann und Christoph Gscheidle „Web 2.0: Communitys bei jungen Nutzern beliebt“, in Media Perspektiven, 7/2009, S.356
[19] Vgl. Hans G. Zeger, Paralleluniversum Web 2.0, 1.A., Wien 2009, S.17 und S.140
[20] Katrin Busemann und Christoph Gscheidle „Web 2.0: Communitys bei jungen Nutzern beliebt“, in Media Perspektiven, 7/2009, S.357
[21] Vgl. Marco Bräuer, Thomas Biewendt „Elektronische Bürgerbeteiligung in deutschen Großstädten 2005
Zweites Website-Ranking der Initiative eParticipation", S.3, online einsehbar unter URL: http://www.initiative-eparticipation.de/Studie_eParticipation2005.pdf [Abgerufen: 2. August 2010]
[22] Vgl. G.Göhler/A.Knaut/C.Schmalz-Jacobsen/C.Walther (Hrsg.), Medien/Demokratie, A. Knaut - Politikvermittlung online: Abgeordnete des Deutschen Bundestages im Web 2.0, 1.A., Frankfurt am Main 2010, S.9-10
[23] Vgl. G.Göhler/A.Knaut/C.Schmalz-Jacobsen/C.Walther (Hrsg.), Medien/Demokratie, A. Knaut - Politikvermittlung online: Abgeordnete des Deutschen Bundestages im Web 2.0, 1.A., Frankfurt am Main 2010, S.15
[24] S. „Jeder Zehnte Deutsche ist Facebook-Mitglied“, in: Spiegel Online, 03.05.2010, URL: http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,692592,00.html [Abgerufen: 4. August 2010]
[25] S. Grafik in „Facebook dominiert in Deutschland“, in: Deutsche Startups, URL: http://www.deutsche-startups.de/2010/07/30/facebook-dominiert-in-deutschland/ [Abgerufen: 5. August 2010]
[26] S. „Jeder Zehnte Deutsche ist Facebook-Mitglied“, in: Spiegel-Online, 03.05.2010, URL: http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,692592,00.html [Abgerufen: 4. August 2010]
[27] Vgl. „Biografie der Gründer“, in: Facebook, URL: http://www.facebook.com/press/info.php?founderbios [Abgerufen: 5. August 2010]
[28] S. „Statistics“, in: Facebook, URL: http://www.facebook.com/press/info.php?statistics [Abgerufen: 4. August 2010]
[29] „Im Sog der Massen“, in DIE ZEIT, 23/10, 02.06.2010
[30] S. „Im Sog der Massen“, in DIE ZEIT, 23/10, 02.06.2010
[31] S. „Die neue Welt ist nackt“, in: DIE ZEIT 34/10, 19.08.2010
[32] „Facebook Datenschutzlinien“, in: Facebook, 22.04.2010, URL: http://www.facebook.com/policy.php [Abgerufen: 19. August 2010]
[33] „Bundestag debattiert über soziale Netzwerke“, in: Tagesschau, 05.03.2009, URL: http://www.tagesschau.de/inland/sozialenetzwerke104.html [Abgerufen: 19. August 2010]
[34] „Die neue Welt ist nackt“, in: DIE ZEIT, 34/10, 19.08.2010
[35] „Bundestag debattiert über soziale Netzwerke“, in: Tagesschau, 05.03.2009, URL: http://www.tagesschau.de/inland/sozialenetzwerke104.html [Abgerufen: 19. August 2010]
[36] S. „Verbrechen Web 2.0“, in: ZDF-Auslandsjournal, 21.07.2010, URL: http://auslandsjournal.zdf.de/ZDFde/inhalt/8/0,1872,8091016,00.html [Abgerufen: 1.September 2010]
[37] „Im Sog der Masse“, in: DIE ZEIT, 23/10, 2.06.2010
[38] „Im Sog der Masse“, in: DIE ZEIT, 23/10, 2.06.2010
[39] S. „Facebook legt für 30 Minuten die E-Mail-Adressen der Mitglieder offen“, in: Basic Thinking, 31.03.2010, URL: http://www.basicthinking.de/blog/2010/03/31/facebook-legt-fuer-30-minuten-die-mail-adressen-der-mitglieder-offen/ [Abgerufen: 19. August 2010]
[40] S. „170 Millionen Accounts asugelesen“, in: Taz, 28.07.2010, URL: http://www.taz.de/1/netz/netzkultur/artikel/1/170-millionen-accounts-ausgelesen/ [Abgerufen: 19. August 2010]
[41] „Echt jetzt?“, in: ZEIT Magazin, 34/10, Ruben Karschnick, S.23
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842805514
- DOI
- 10.3239/9783842805514
- Dateigröße
- 1.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt; Würzburg – Wirtschaftswissenschaften, Studiengang Medienmanagement
- Erscheinungsdatum
- 2010 (Oktober)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- medienpolitik online-wahlkampf facebook datenschutz
- Produktsicherheit
- Diplom.de