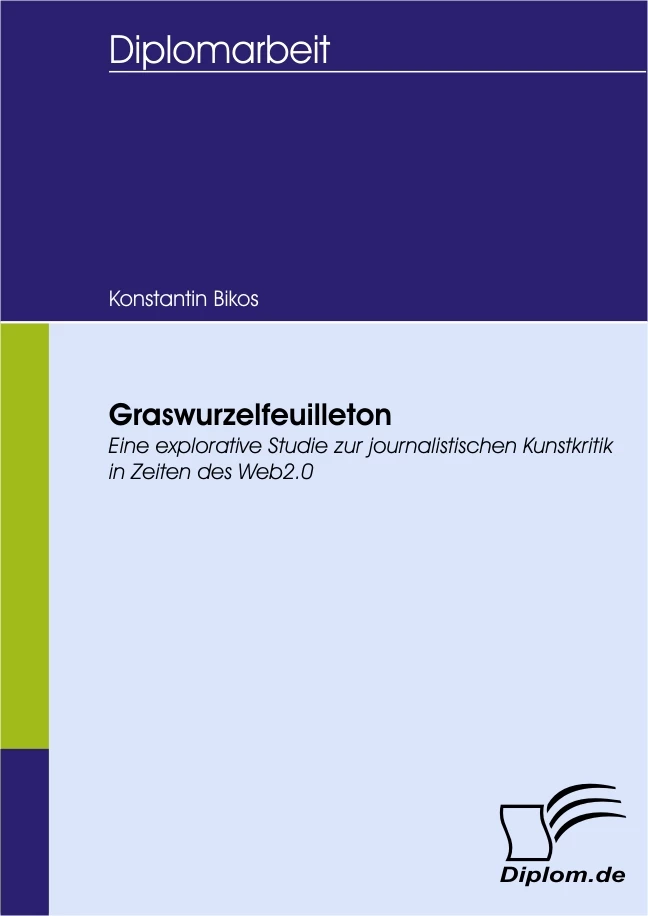Graswurzelfeuilleton
Eine explorative Studie zur journalistischen Kunstkritik in Zeiten des Web 2.0
Zusammenfassung
Das Feuilleton, so hört man immer wieder, befindet sich in der Krise. Darin scheinen sich selbst die Akteure dieses streitbaren Ressorts ausnahmsweise mal alle einig zu sein. Zwar kommt Bonfadelli aufgrund mehrerer quantifizierender Inhaltsanalysen zu einem scheinbar beruhigenden Ergebnis: Die Kulturberichterstattung im weitern (sic) und das Feuilleton im engern (sic) Sinn sind in den vergangenen 25 Jahren nicht abgebaut worden. Doch das Vokabular, dessen sich manch ein Teilnehmer der Debatte über Sinn und Unsinn des Feuilletons bedient, wirft unweigerlich die Frage auf: wie lange noch? Von Degeneration spricht der Feuilleton-Chef der Tageszeitung Die Zeit, Jens Jessen. Gerhard Stadelmaier, Theaterexperte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, beschwört den Untergang der Theaterkritik, den die wachsende Ökonomisierung der Medien mit sich bringe; Heß prophezeit kurzerhand das nahende Ende der Kultur, dem der Untergang des Abendlandes auf den Fuß folgt, kurz nachdem das Ende der Kritik, der Kultur-Kritik (...) gekommen war. Kulturverlust durch Kulturinflationierung, Verlust der Qualität durch Anbiederung an die Masse.. Es wirkt also fast wie eine logische Schlussfolgerung, wenn Franziska Augstein, Kulturredakteurin der Süddeutschen Zeitung, konstatiert, das Zeitungsfeuilleton sei eine Institution, die sich auf dem Wege zu ihrer Abschaffung befindet.
Die Liste der Symptome, die dem Kulturressort unterstellt werden, ist lang. Von inhaltlicher Nivellierung und Einheitssauce ist da etwa die Rede, von einem Ressort, das sein Heil angesichts der kulturell entgrenzenden Auswirkungen des postmodernen Zeitgeists und folglich sinkender Leserzahlen in traditionell ausgerichteten Feuilletons in der thematischen Grenzenlosigkeit sucht - und sich dabei inhaltlich in Luft aufzulösen droht. Wir haben Aufmacher über die Tour de France, so der Kulturkritiker Lothar Müller, aber wir haben keine Aufmacher über den gegenwärtigen Stand der Schauspielkunst in Deutschland. Heß zufolge leidet das Ressort angesichts seiner thematischen Zusammensetzung schlicht an Realitätsverlust. Gleichzeitig attestieren Beobachter den Kulturkritikern, deren demokratische Pflicht es nicht zuletzt ist, eine öffentliche kulturelle Debatte anzuregen und zu begleiten, einen Hang zur von Außenstehenden kaum nachvollziehbaren Selbstinszenierung. Schulz beklagt eine Abnahme der kritischen Qualität. Als Autorität in Sachen Kunst und Kultur habe das […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Das Feuilleton und die neue Konkurrenz aus dem Internet
1.2 Eingrenzung des Forschungsbereichs und Begriffsdefinitionen
1.3 Gang der Arbeit
2 Theoretischer Teil: Kulturjournalismus in der Zeitung und im Internet
2.1 Funktionen des Feuilletons und der journalistischen Kunstkritik
2.2 Voraussetzungen für die Erfüllung der Funktionen
2.2.1 Funktion 1: Kulturjournalismus als Berichterstattung
2.2.2 Funktion 2: Kulturjournalismus als Kontrolle der künstlerischen Qualität
2.2.3 Funktion 3: Kulturjournalismus als Bildungsinstrument
2.2.4 Funktion 4: Kulturjournalismus als "Motor des kulturellen Diskurses"
2.3 Kulturjournalismus in der Zeitung und im Internet - ein Vergleich auf funktionaler Ebene
2.3.1 Zu Funktion 1: Die Variable "Kapazität"
2.3.2 Zu Funktion 1: Die Variable "Motivation"
2.3.3 Zu Funktion 1: Die Variable "Einhaltung journalistischer Standards"
2.3.4 Zu Funktion 2: Die Variable "Geistiger und emotionaler Zugang"
2.3.5 Zu Funktion 2: Die Variable "Wissen"
2.3.6 Zu Funktion 2: Die Variable "Fähigkeit zur sprachlichen Umsetzung"
2.3.7 Zu Funktion 2: Die Variable "Motivation"
2.3.8 Zu Funktion 3: Die Variable "Motivation / Sendungsbewusstsein"
2.3.9 Zu Funktion 3: Die Variable "Fähigkeit zur journalistischen Vermittlung"
2.3.10 Zu Funktion 4: Die Variable "Motivation und geistiger Zugang"
2.3.11 Zu Funktion 4: Die Variable "Verfügbarkeit von Rückkanälen und ihre tatsächliche Nutzung"
2.4 Zusammenfassung der Erkenntnisse
3 Empirischer Teil: Befragung der Akteure
3.1 Hypothesenentwicklung
3.2 Operationalisierung
3.3 Die befragten Akteure und ihre kulturjournalistischen Angebote
3.4 Aus Sicht der Akteure - ausgewählte Ergebnisse der Leitfadengespräche
3.5 Ergänzung oder Konkurrenz? - Ein Ausblick
4 Schlussteil
4.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
4.1.1 Ergebnisse des Vergleichs auf funktionaler Ebene
4.1.2 Ergebnisse der Kommunikatorenbefragung
4.1.3 Partizipative kulturjournalistische Online-Angebote als Ergänzung
4.1.4 Partizipative kulturjournalistische Online-Angebote als Bedrohung
4.2 Vorschläge für einen neuen Kulturjournalismus
4.3 Ausblick
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Sieben zentrale Funktionen des Feuilletons und der Kunstkritik
Tabelle 2: Voraussetzungen für die Erfüllung der Feuilleton-Funktionen
Tabelle 3: Verteilung der Leser auf die Zeitungsteile
Tabelle 4: Die befragten Akteure und ihre kulturjournalistischen Angebote.
1 Einleitung
1.1 Das Feuilleton und die neue Konkurrenz aus dem Internet
Das Feuilleton, so hört man immer wieder, befindet sich in der Krise. Darin scheinen sich selbst die Akteure dieses streitbaren Ressorts ausnahmsweise mal alle einig zu sein. Zwar kommt Bonfadelli aufgrund mehrerer quantifizierender Inhaltsanalysen zu einem scheinbar beruhigenden Ergebnis: "Die Kulturberichterstattung im weitern [sic] und das Feuilleton im engern [sic] Sinn sind in den vergangenen 25 Jahren nicht abgebaut worden" (2008: 316).[1] Doch das Vokabular, dessen sich manch ein Teilnehmer der Debatte über Sinn und Unsinn des Feuilletons bedient, wirft unweigerlich die Frage auf: wie lange noch ? Von "Degeneration" spricht der Feuilleton-Chef der Tageszeitung Die Zeit, Jens Jessen (2002: 34). Gerhard Stadelmaier, Theaterexperte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, beschwört den Untergang der Theaterkritik, den die wachsende Ökonomisierung der Medien mit sich bringe (vgl. Reus 1999: 12); Heß prophezeit kurzerhand das nahende "Ende der Kultur, dem der Untergang des Abendlandes auf den Fuß folgt, kurz nachdem das Ende der Kritik, der Kultur-Kritik [...] gekommen war. Kulturverlust durch Kulturinflationierung, Verlust der Qualität durch Anbiederung an die Masse." (1992: 10). Es wirkt also fast wie eine logische Schlussfolgerung, wenn Franziska Augstein, Kulturredakteurin der Süddeutschen Zeitung, konstatiert, das Zeitungsfeuilleton sei "eine Institution, die sich auf dem Wege zu ihrer Abschaffung befindet" (Herkel 2004).
Die Liste der Symptome, die dem Kulturressort unterstellt werden, ist lang. Von "inhaltlicher Nivellierung und Einheitssauce" (ebd.) ist da etwa die Rede, von einem Ressort, das sein Heil angesichts der kulturell entgrenzenden Auswirkungen des postmodernen Zeitgeists und folglich sinkender Leserzahlen in traditionell ausgerichteten Feuilletons in der thematischen Grenzenlosigkeit sucht - und sich dabei inhaltlich in Luft aufzulösen droht. "Wir haben Aufmacher über die Tour de France", so der Kulturkritiker Lothar Müller, "aber wir haben keine Aufmacher über den gegenwärtigen Stand der Schauspielkunst in Deutschland" (zitiert nach Chervel / Seeliger 2003). Heß zufolge leidet das Ressort angesichts seiner thematischen Zusammensetzung schlicht an "Realitätsverlust" (1992: 11 f.). Gleichzeitig attestieren Beobachter den Kulturkritikern, deren demokratische Pflicht es nicht zuletzt ist, eine öffentliche kulturelle Debatte anzuregen und zu begleiten, "einen Hang zur von Außenstehenden kaum nachvollziehbaren Selbstinszenierung." (Chervel / Seeliger 2003). Schulz beklagt eine "Abnahme der kritischen Qualität" (2005: 47). Als Autorität in Sachen Kunst und Kultur habe das Feuilleton folglich ausgedient. Die Liste könnte scheinbar endlos weitergeführt werden. Diese Mängel haben jedoch nicht nur Folgen auf publizistischer und gesellschaftlicher Ebene: Fast scheint es so, als könnten sie mittelfristig das Ressort insgesamt ins Wanken bringen. Denn der inhaltlichen Misere steht eine wirtschaftliche gegenüber. Das Zeitungsfeuilleton gilt, in besonderen Maße wohl im Kontext der aktuellen Wirtschaftskrise, immer mehr als "Ressort, das kein Geld bringt, aber viel Geld kostet" (Chervel 2003).
Auf der anderen Seite geht gewissermaßen ein Konkurrent ins Rennen, der scheinbar viele Schwächen der Zeitung und ihrer Kulturberichterstattung ausgleichen kann: Das Internet ist ein schnelleres Medium, und es kann Texte und Bilder ebenso transportieren wie Audio- oder Videoaufnahmen, was besonders in der Kulturberichterstattung vorteilhaft ist: Der Rezipient ist nicht mehr ausschließlich darauf angewiesen, die "Übersetzung" künstlerischer Zeichen in verbale Ausdrücke zu verstehen und zu deuten - er kann sich selbst ein Bild vom Kunstwerk machen. In seiner aktuellen Ausprägung, dem sogenannten Web2.0, erlaubt es dem Empfänger journalistischer Botschaften außerdem, mit den Kommunikatoren journalistischer und pseudo-journalistischer Angebote und anderen Usern direkt in Kontakt zu treten oder sogar in die Berichterstattung einzugreifen: Hier kann der Rezipient zum Kommunikator avancieren. Neben der größeren Aktualität, Multimedialität und Interaktivität leistet das Medium aber vor allem eines: Es senkt die Schwelle zur Teilnahme am Prozess der Herstellung von Öffentlichkeit; es eröffnet Zugänge zur journalistischen Nachrichtenproduktion für die Allgemeinheit - für Individuen, die bisher in diesem Prozess nur als Rezipienten - also weitestgehend passive Nachrichten-Empfänger, Abnehmer publizistischer Produkte - agieren konnten.
Entsprechend spricht Neuberger von einem Wandel der massenmedialen Öffentlichkeit zur Internet-Öffentlichkeit, und vom Prozess der Disintermediation, also jener durch technische Neuerungen bedingten Entwicklung, durch die direkte Kanäle von den Nachrichtenquellen zum Nutzer entstehen - und vice versa. Ein Nachrichten-V ermittler also ein Redakteur als "Gatekeeper" der Information - sei in diesem Kontext zunächst nicht mehr vonnöten (vgl. 2008: 22). Natürlich greift diese Aussage in der Realität zu kurz: Auch in einer vollständig demokratisierten Nachrichtenproduktion ist diese Funktion notwendig, auch wenn sich die Modalitäten ändern können. Neuberger etwa spricht, in Anlehnung an Bruns, vom "Gatewatching" - also dem "nachträglichen Selektieren von bereits Publiziertem" (ebd.: 27). Trotzdem hat das Web2.0 den Prozess der Herstellung von Öffentlichkeit im Allgemeinen und die Produktion und Popularisierung journalistischer Inhalte im Besonderen revolutioniert: Mit nur geringem technischen Aufwand kann jetzt jeder daran teilnehmen, Öffentlichkeiten herstellen (wenn auch meist sehr kleine), sich als Journalist betätigen - auch als Kulturjournalist. Im Web2.0 treffen sich folglich Graswurzel-Journalismus und Feuilleton - auch, wenn der Begriff Graswurzelfeuilleton für manchen Puristen ein Oxymoron darstellen mag.
In welchem Ausmaß dieses Angebot speziell im kulturjournalistischen Wirkungsbereich tatsächlich angenommen wird, hängt vor allem von der Definition und funktionalen Abgrenzung dieses Wirkungsbereichs ab. Im Internet existiert eine Unmenge sehr kleiner Angebote, die sich im weitesten Sinne mit Kultur beschäftigen: Klassische Themen des Feuilletons wie Oper, Ballett und klassische Musik werden etwa in der sogenannten "Blogosphäre" - also der Gesamtheit aller Weblogs - genauso ausgiebig behandelt wie Architektur, Breakdance und Esoterik.[2] Zudem finden vor allem sogenannte "Fan-Seiten" regen Zulauf, auf denen sich die Bewunderer eines Künstlers über digitale Foren austauschen. Bei den meisten dieser Angebote sei allerdings der Bloggerin und Medienwissenschaftlerin Rebecca Blood zufolge unter anderem "die auf einer eigenständigen Recherche beruhende Berichterstattung, welche die Essenz des Journalismus sei, nicht gegeben" (zitiert nach Baumberger 2008: 11).
Es gibt allerdings auch im kulturjournalistischen Bereich mittlerweile durchaus "Plattformen, welche strukturell dem Journalismus näher kommen" (Kopp / Schönhagen 2008: 81). Zu nennen sind - neben den Internetseiten etablierter Medien (z.B. www.nmz.de) und reinen Online-Angebote mit professionell-redaktionellen Abläufen (z.B. www.nachtkritik.de) - dabei etwa auch partizipativ ausgerichtete Angebote wie www.netzfeuilleton.de, die sich nicht nur in ihrem Anspruch dem klassischen Feuilleton annähern, sondern scheinbar auch auf vielen Ebenen imstande sind, diesen Anspruch zu erfüllen. Im Spannungsfeld zwischen professioneller und partizipativer Nachrichtenproduktion macht Engesser zudem ein relativ neues Phänomen aus: Professionell-partizipative Formate wie www.opinio.de veröffentlichen Beiträge von sogenannten "Bürgerjournalisten" - allerdings erst, nachdem sie von einer professionellen Redaktion kontrolliert und redigiert wurden. Im kulturjournalistischen Bereich existieren entsprechende Angebote allerdings noch nicht.
Was bedeuten nun diese neuartigen Angebote für das - angeblich schwächelnde - klassische Feuilleton? Stehen die beiden Angebotstypen überhaupt in direkter Konkurrenz?Könnten einschlägige Online-Angebote mittelfristig gar eine existenzielle Bedrohung für das klassische Feuilleton darstellen, indem sie den etablierten Medien junge Lesergenerationen abspenstig machen? Oder haben sich die beiden Formate, einstweilen jedenfalls, auf eine Koexistenz geeinigt, in der sich die von ihnen hergestellten Öffentlichkeiten komplementieren? Diese Fragen sollen in der vorliegenden Studie beantwortet werden. Bevor jedoch die zentrale Forschungsfrage formuliert werden kann, muss der Forschungsbereich eingegrenzt und einige zentrale Begriffe definiert und erläutert werden. Diese Funktion soll das folgende Kapitel erfüllen.
1.2 Eingrenzung des Forschungsbereichs und Begriffsdefinitionen
Da das Forschungsfeld - besonders bezüglich der Angebote im Internet - so vielfältig und unübersichtlich ist, soll der Fokus im Folgenden auf bestimmte Angebotstypen beschränkt werden. Es ist jedoch zunächst festzuhalten: Verglichen werden sollen in erster Linie nicht Medien - also Printmedien und Internet -, sondern Prozesse der Nachrichtenproduktion im Kulturjournalismus. Interessant ist deswegen auf der Seite der Online-Angebote vor allem der Aspekt der Demokratisierung. Dieser ist zwar nicht zwangsläufig auf das Internet beschränkt; er wird jedoch durch dieses Medium in einem Ausmaß befördert, dass entsprechenden journalistischen Angeboten, zumindest in ihrer Gesamtheit, eine durchaus beachtliche publizistische und gesellschaftliche Relevanz zugesprochen werden kann. Entscheidend für die Auswahl der Online-Angebote, die für den Vergleich in Frage kommen, ist also eine niedrige Teilnahmeschwelle - sowohl für (potenzielle) Kommunikatoren als auch für Rezipienten. Konkret geht es also um partizipativ ausgerichtete kulturjournalistische Angebote. Zu nennen sind dabei vor allem sogenannte Kulturblogs wie www.netzfeuilleton.de, www.kulturlabskaus.de und www.indiskretion-ehrensache.com. Entsprechend wurden nur Angebote berücksichtigt, die keine professionelle Redaktion aufzuweisen haben und weitestgehend ohne wirtschaftliche Ansprüche - sozusagen als Hobby - betrieben werden.
Die zu untersuchenden Angebote müssen zudem einem inhaltlichen Anspruch genügen, der lose dem klassischen Feuilleton entlehnt ist: Sie müssen sich erstens, zumindest in großen Teilen, mit Kunst und Kunstkritik beschäftigen.
Ferner wird ein Fokus auf die Abbildung, Erklärung und Deutung einer "kulturellen Realität" vorausgesetzt.
Es geht also im weitesten Sinn um Angebote, die sich mit der Kunst- und Kulturkritik beschäftigen. Der Begriff soll der Einfachheit halber im Folgenden auf den Ausdruck "Kunstkritik" verkürzt werden. Eine Ausnahme bilden wörtliche Zitate.
Schließlich müssen die Angebote auch gewissen journalistischen Mindestanforderungen genügen. Das Ausmaß, in dem die Einhaltung journalistischer Standards den Kommunikatoren tatsächlich gelingt, soll zwar als Variable in der nachfolgenden Untersuchung dienen. Bereits bei der Vorauswahl der Angebote soll jedoch darauf geachtet werden, dass diese zumindest den Anspruch haben, die kulturelle Realität möglichst vollständig abzubilden und dabei gewonnene Erkenntnisse einem möglichst breiten Leserkeis zu vermitteln. Kurz: Ein Blick auf "die Allgemeinheit" ist hier das Hauptkriterium. Ausgeklammert werden also etwa besagte Kommunkationsforen auf Fan-Seiten oder tagebuchartige Blogs, die sich primär mit den alltäglichen Erlebnissen des Autors beschäftigen.
Auf der anderen Seite soll mit dem Begriff "klassisches Feuilleton" die Gesamtheit aller Feuilletons jener Zeitungen umschrieben werden, die ihre eigene Kulturredaktion unterhalten. Diese Einschränkung soll nicht nur gewissermaßen der Entwirrung eines komplexen Forschungsbereichs dienen. Es gibt auch andere Gründe für diese Auswahl: Erstens ist das Internet - trotz vielfältiger Möglichkeiten einer multimedialen Nutzung - in erster Linie ein textbasiertes Medium. Es tritt damit eher in ein Konkurrenzverhältnis zu den Printmedien als etwa zum Hörfunk oder zum Fernsehen. Wie in der Einleitung angedeutet, wird zudem vor allem hier über Sinn und Unsinn des Feuilletons gestritten. Auch angesichts des zunehmenden ökonomischen Drucks, der auf den privatwirtschaftlich organisierten Zeitungen lastet, wird diesem Ressort in schöner Regelmäßigkeit die Daseinsberechtigung abgesprochen. Schließlich wird vor allem mit dem Feuilleton der "großen Qualitätszeitungen" ein bestimmtes, historisch gewachsenes Image und Prestige verbunden. Was zunächst als Stärke daherkommt, könnte ein Zyniker auch als substanzielle Schwäche deuten: Wird das Ressort nur aufgrund einer starken Tradition von den Medienbetrieben noch "geduldet"? Erlangt es nur deswegen bei den Rezipienten (noch) eine höhere Reichweite und Glaubwürdigkeit?
Innerhalb des oben umrissenen Spannungsfeldes soll diese Studie also Antworten auf folgende zentrale Forschungsfrage suchen:
1.3 Gang der Arbeit
Als zugrunde liegendes theoretisches Gerüst für den Vergleich der Medientypen sollen die Cultural Studies dienen. Dieses Forschungsparadigma eignet sich am besten für die vorliegende Aufgabe, weil es den oben angedeuteten traditionell begründeten Images und Erscheinungsformen nur insofern eine Bedeutung zumisst, als sie im Prozess der "Selbstverständigung einer Gesellschaft" (vgl. Lünenborg 2005: 101) von Belang sind. Sowohl die Kunst als auch der Journalismus sind innerhalb dieses Vorgangs zunächst gleichberechtigte "Zeichensysteme", die sich gegenseitig bedingen und kommunikativ beeinflussen. Entscheidend dabei ist, dass die Kompetenz zur Erfüllung der zentralen sozio-kulturellen Aufgabe einer gesellschaftlichen Selbstverständigung den etablierten Medien und nicht-elitären "Zeichensystemen" wie Weblogs gleichermaßen zugeschrieben wird. Auch partizipativ ausgerichtete kulturjournalistische Angebote können - entsprechende Zirkulation und Partizipation vorausgesetzt - zu einer "Ausgestaltung und massenhafte[n] Verbreitung eines symbolischen Konzeptes von Gesellschaft" dienen (ebd.: 101).
Der Vergleich soll vor diesem Hintergrund und mit einem besonderen Fokus auf gesellschaftlich relevante Vorgänge zunächst auf einer funktionalen Ebene gezogen werden (Kapitel 2): Ein journalistisches Angebot kann nur dann in ein Konkurrenzverhältnis mit einem anderen treten und es möglicherweise langfristig obsolet machen, wenn es mindestens seine zentralen Funktionen zu erfüllen vermag. Als Maßstab soll dabei aber nicht das klassische Feuilleton dienen. Es soll vielmehr ergründet werden, welche Funktionen "das Feuilleton" normativ erfüllt - für den Kommunikator, das Medium, den Rezipienten -, und inwiefern eine Erfüllung dieser Funktionen zur "Selbstverständigung einer Gesellschaft" beitragen. Diese Aufgabe soll Kapitel 2.1 übernehmen. In Kapitel 2.2 werden dann die konkreten Voraussetzungen identifiziert, die für eine Erfüllung der Funktionen vonnöten sind. Aufgrund dieser Variablen werden die beiden Medientypen dann in Kapitel 2.3 miteinander verglichen. Die Grundlage für diesen Vergleich bilden die empirischen Befunde der Feuilletonforschung. Da jedoch der Forschungsstand in diesem Feld noch immer vergleichsweise dürftig ist, besonders bezüglich kulturjournalistischer Angebote im Internet, werden einige Wissenslücken bleiben.
Diese zu füllen soll nicht nur zukünftigen Studien überlassen werden: Im empirischen Teil dieser Untersuchung (Kapitel 3) soll der "Außenansicht" des Forschungsbereichs gewissermaßen eine "Innenansicht" gegenübergestellt werden. Hier sollen die Akteure selbst zu Wort kommen. In Kapitel 3.1 werden zunächst die zu untersuchenden Hypothesen aus den im theoretischen Teil dieser Studie präsentierten Erkenntnissen abgeleitet. In Kapitel 3.2 wird zunächst die Erhebungsmethode vorgestellt. Die befragten Akteure und ihre kulturjournalistischen Angebote werden in Kapitel 3.3 porträtiert. Kapitel 3.4 präsentiert die Ergebnisse der Erhebung. Einen Einblick in die Zukunftsperspektiven der Akteure hinsichtlich der zentralen Forschungsfrage bietet Kapitel 3.5.
Den Schlussteil dieser Studie bildet Kapitel 4. Hier werden einer Zusammenfassung und Bewertung aller Ergebnisse (Kapitel 4.1) auch einige daraus abgeleitete Vorschläge für Medienakteure (Kapitel 4.2) zur Seite gestellt. In Kapitel 4.3 werden schließlich in einem Ausblick einige Forschungsansätze für zukünftige Studien in diesem Themenfeld präsentiert.
2 Theoretischer Teil: Kulturjournalismus in der Zeitung und im Internet
2.1 Funktionen des Feuilletons und der journalistischen Kunstkritik
Trotz des bisweilen äußerst vehement geführten Streits, was das Feuilleton ist und was es zu leisten hat,[3] wird es als publizistische Institution wohl kaum ernsthaft in Frage gestellt. Eine Tages- oder Wochenzeitung ohne "Kulturteil", das darf man annehmen, kann und will sich niemand vorstellen. Innerhalb jeder Kontroverse über das Feuilleton herrscht Konsens darüber, dass jedes journalistische Produkt, dessen Anspruch es ist, seine Leserschaft möglichst umfassend zu informieren, neben den aktuellen politischen, wirtschaftlichen, sportlichen und lokalen Entwicklungen auch die kulturellen berücksichtigen muss. Kurz: Es gehört zum demokratischen Auftrag der Medien, die für das Verbreitungsgebiet relevante kulturelle Realität möglichst umfassend abzubilden und die dargestellte Information in gesellschaftlich relevante Kategorien einzuordnen. Die erste zentrale Funktion des Feuilletons unterscheidet das Ressort also nicht von anderen und heißt schlicht: Berichterstattung und Information.
Die zweite Funktion des Feuilletons bezieht sich auf jenen Aktivitätsbereich innerhalb des Kulturjournalismus', der aufgrund seiner historischen Bedeutung für das Ressort und seiner gegenwärtigen quantitativen Präsenz nicht umsonst als Kerngeschäft des Feuilletons bezeichnet wird: die Kunstkritik. Angesichts des Streits um die thematische Ausrichtung des Feuilletons scheint auf den ersten Blick eine Einengung der Perspektive an dieser Stelle zwar nicht angebracht: Für jenes Lager, das eine Erweiterung des Kunst- und Kulturbegriffs im Feuilleton propagiert, ist ja gerade die Vorherrschaft der Kunstkritik, und damit auch die formelle Verödung des Kulturteils durch die Fixierung auf die Rezension ein Dorn im Auge (vgl. etwa Glotz / Langenbucher 1993: 104). Zudem scheint eine einseitige Ausrichtung auf jenen Fachbereich, den das klassische Feuilleton seit seiner Gründung kultivieren und perfektionieren konnte, für einen Vergleich mit kulturjournalistischen Angeboten im Internet zunächst ungeeignet, da Letztere nicht nur benachteiligt zu sein scheinen, sondern möglicherweise auch andere Ansprüche haben und Ansätze vertreten. Doch die Kunstkritik soll hier ausdrücklich nicht gleichgesetzt werden mit der Rezension - und die Rezension nicht zwangsläufig mit einer verengten Berichterstattung, die "einsinnig-publizistisch von der Ästhetik her denkt" (Glotz 1968: 84). Sie muss sich stattdessen, so soll im Folgenden argumentiert werden, der gesellschaftlichen Verwurzelung und Relevanz ihres Objektes, der Kunst, annehmen. Sie schließt zwar die Bewertung eines Kunstwerks aufgrund künstlerisch-ästhetischer Kriterien ausdrücklich ein, muss aber auch den dadurch entstehenden künstlerischen Diskurs mit gesellschaftspolitischen Diskursen verknüpfen. So ausgelegt, ist eine Untersuchung anhand der Kunstkritik durchaus für einen Vergleich der beiden Mediengattungen und zur Beantwortung der Forschungsfrage geeignet: Dem Ansatz der Cultural Studies folgend, fungiert sie in dieser Form nicht nur als kritisierende und Sinn stiftende Instanz innerhalb des künstlerischen Subsystems, sondern als Zeichensystem, welches den kulturellen Diskurs zur "Selbstverständigung der Gesellschaft" anregt und moderiert.
Zunächst soll jedoch eine naheliegende und oft gestellte Frage erörtert werden: Warum muss Kunst eigentlich kritisiert werden? Was bezweckt etwa die Rezension einer Theateraufführung, die schon gelaufen ist? Und sollte man nicht grundsätzlich Kunst einfach Kunst sein lassen? Diese Fragen erscheinen zunächst durchaus berechtigt, wird die öffentlich geübte Kritik vonseiten der Rezipienten - und dazu gehören nicht zuletzt die Künstler selbst - doch gerne als sinnlos, kontraproduktiv oder gar destruktiv bezeichnet. Die pointierteste Bemerkung stammt zweifelsohne von Rainald Goetz, der im Spiegel von der "Arschlochwelt" des Feuilletons sprach (Goetz 1992). Der "völligen Wirkungslosigkeit der Kunstkritik" ist sich Klaus Honnef gewiss (Honnef / Lodermeyer 2009: 23). Greiner identifiziert indes aus Sicht der Kunstkritiker den Rezipiententypus des "kulturell marodierenden Flaneurs", der die Kunstkritik als Fremdkörper im Kunsterleben und als Hindernis auf dem Weg zum Kunsterlebnis missverstehe: "Dieser Typus besteht aus seinem Konsumverhältnis zur Kunst, und er verargt der Kritik jene Schwierigkeit, die das Merkmal von Kunst ist" (Greiner 1992: 260). Das destruktive Potenzial, welches der Kunstkritik mitunter zugeschrieben wird, belegen nicht zuletzt die presserechtlichen Konsequenzen, die manch eine Rezension bereits hatte (vgl. Richter 2005: 26). Bösartigkeit wird den Kritikern bisweilen auch unterstellt - George Bernard Shaw äußerte etwa einst den Verdacht, Kunstkritiker seien "blutrünstige Leute, die es nicht bis zum Henker gebracht haben" (Quelle unbekannt). Zweifelsohne entspringt die abweisende Haltung mancher Beobachter der Tatsache, dass es sich bei der journalistischen Kunstkritik um die Meinungsäußerung eines Subjekts handelt, die darauf ausgelegt ist, Gegenpositionen zu erzeugen. Entsprechen die Ansichten des Rezensenten nicht denen des Kritisierten, wird Ersterem allzu schnell die Kompetenz abgesprochen. Doch sollte man die Kunstkritik deswegen insgesamt in Frage stellen?
Wer nach dem Sinn der Kunstkritik fragt, muss sich auch Gedanken über Sinn und Wesen der Kunst machen.[4] Denn bei genauerer Betrachtung ist die Kunstkritik lediglich in prozessualer Hinsicht eine Folgeerscheinung der Kunst; in existenzieller Hinsicht sind die beiden untrennbar miteinander verwoben. Bereits der künstlerisch-schöpferische Prozess ist ein Vorgang "kritischer" Auseinandersetzung des Künstlers mit seiner Umwelt - auch, wenn dies nicht jedem Künstler bewusst ist. Das kritische Element kann sich in einer gesellschaftspolitischen Aufladung des Kunstwerks niederschlagen - muss es aber nicht. Als kritisch kann auch der Schöpfungsprozess selbst beschrieben werden: Der Künstler destilliert das Werk aus einer ihn umgebenden Realität durch kritische Abwägung, Ableitung und Abstraktion.
Das Wesen der Kunst als Kritik bedeutet wiederum, dass Kunst (normativ) Kritik nach sich zieht, sobald die Kunst mit dem gesellschaftlichen Teil jener Realität rückgekoppelt wird, aus der sie erwachsen ist. Greiner formuliert diesen Prozess im Hinblick auf den literarischen Entstehungsprozess wie folgt: "Das literarische Kunstwerk entsteht aus der Erfahrung eines Mangels, eines Zwiespalts zwischen dem Autor und der Welt, es ist Ausdruck eines Nicht-Einverständnisses, es ist Kritik. Und dadurch setzt es unweigerlich einen kritischen Disput in Gang" (Greiner 1992: 259)[5]. Das Kunstwerk ist also intrinsisch verwoben sowohl mit der Realität, aus der es durch einen kritischen Prozess erwächst, als auch mit dem kritischen Diskurs, den es normativ nach sich zieht. Kunstkritik - journalistisch oder nicht - ist also zunächst nichts anderes als die Verbalisierung dieses kritischen Disputs, die Auseinandersetzung mit einem Prozess, der im künstlerischen Schöpfen bereits enthalten ist.
Abzuleiten ist aus dieser Erkenntnis auch eine weitere Aussage über die Funktionen und die Qualitätskritierien der Kunstkritik: Sie sollte sich, in angemessenem Ausmaß, der Ausprägung des kritischen Schöpfungsprozesses bewusst sein und an den "kritischen Disput", den das Kunstwerk nach sich zieht, anknüpfen. Dazu ist die Bereitstellung von geeigneten theoretischen Kategorien und ihre kompetente Anwendung notwendig. Erst wenn der Kunstkritik diese Auseinandersetzung gelingt, kann sie, unter anderem, auch jene Funktion wahrnehmen, die ihr sonst allzu leichtfertig zugeschrieben wird: künstlerische Qualität - wie auch immer diese definiert sein mag! - zu kontrollieren und zu sichern.
Der Journalismus - "in der Mediengesellschaft das populärste und umfassendste Zeichensystem zur diskursiven Verhandlung von Relevanz und Bedeutung" (Lünenborg 2005: 101) - kann ferner entscheidend zur Vermittlung und Popularisierung des Zeichensystems Kunst beitragen, indem er die vergleichsweise abstrakten Symbole der Kunst in das allgemein verständlichere Zeichensystem der Sprache übersetzt und sie in das alltägliche Erleben der Rezipienten einordnet. Eine dritte zentrale Funktion der Kunstkritik besteht hier primär in der Bereitstellung von Orientierungshilfen für den Leser; sekundär geht es um die Bildung des Lesers, also um die Vermittlung von Kategorien, mithilfe derer sich der Rezipient dem besprochenen Kunstwerk im Besonderen und der Kunst im Allgemeinen persönlich zuwenden kann. Dieser Anspruch des Kulturjournalismus' wird besonders von Akteuren des klassischen Feuilletons oft ganz generell als erzieherischer Auftrag ausgelegt: Wie in Kapitel 2.3.8 zu lesen sein wird, ist hier das Berufsverständnis des "Pädagogen und Erziehers" besonders weit verbreitet. Die herausragende Bedeutung der vermittelnden Funktion der Kunstkritik für die Gesellschaft einerseits und das kulturelle Subsystem Kunst andererseits fasst Reus wie folgt zusammen: "Vermittlung vor allem - so lautet der demokratische Auftrag der Kulturkritik" (1999: 13).[6]
Es muss dem Kritiker auch gelingen, die Schnittstellen zwischen kultureller Realität und Kunst, die durch das Kunstwerk entstehen, zu identifizieren, zu beschreiben, einzuordnen und vor dem Hintergrund anderer relevanter kultureller Kategorien und Prozesse zu interpretieren und zu kritisieren. Die journalistische Erfassung und Kritik jener Aspekte dieser Schnittstellen, die eine gesellschaftliche Relevanz aufweisen - und das sind die meisten! - kann in der Folge der Kulturberichterstattung durch ihre diskursive Verlängerung zur "Selbstverständigung einer Gesellschaft" beitragen. Das Ausmaß, in dem diese Prozesse dem Künstler selbst bewusst sind, spielt dabei zunächst nur eine geringe Rolle. Eine Rezension über ein Werk des zeitgenössischen Komponisten Helmut Lachenmann wird sicherlich inhaltlich nicht am selben Punkt ansetzen wie eine CD-Besprechung über das aktuelle Album der Rockgruppe Tokio Hotel. Der "kritische Disput", den Letztere initiiert, darf der Kunstkritiker jedoch trotzdem nicht ignorieren - er ist ebenso präsent, er findet lediglich weniger auf einer künstlerischen als auf einer, im weitesten Sinne, kulturellen Ebene statt. Konkret wäre hier zum Beispiel eine Abhandlung über die kompositorische Struktur der Musikstücke weniger fruchtbar als eine Evaluation ihrer herausragenden gesellschaftlichen Resonanz.
Eine vierte Funktion, die sich daraus ableiten lässt, ist die "Ver-öffentlichung", also die technisch unterstützte Verbreitung und Popularisierung des "kritischen Disputs", welchen die Kunst nach sich zieht. Der Journalismus stellt die Kunst - in der kollektiv-gesellschaftlichen Empfindung meist als abgehoben vom Alltäglichen rezipiert und interpretiert - im Idealfall sozusagen mitten in die Gesellschaft. Er agiert als "Motor des kulturellen Diskurses" (Lünenborg 2005: 101), bereitet dabei der Kunst im Idealfall neuen gesellschaftlichen Nährboden und den Künstlern neue Impulse. Analog schreibt Schulz über die Musikkritik des 20. Jahrhunderts: "Stets noch wurde über die Printmedien die Debatte, die die Komponisten vor allem auf dem Wege ihrer schöpferischen Produkte führten, kritisch verlängert" (2005: 49). Die enorme Bedeutung dieser "Verstärkerfunktion" des Journalismus für die Kunst ist in folgender Aussage Ulrich Greiners abzulesen: "Ohne sie (die Kritik, der Verf.) wäre das literarische Leben tot" (1992: 259). In Schulz' Beobachtung ist allerdings bereits die Befürchtung abzulesen, dass das Feuilleton angesichts des von der Postmoderne verursachten Verlustes von künstlerischen Wertehierarchien und klaren diskursiven Linien diese Funktion heute nicht mehr erfüllt - weil es sie nicht erfüllen kann. Als eine weitere Ursache für seine Sorge führt Schulz eine schwindende Sachkompetenz der zeitgenössischen Kunstkritiker an: "Fakt aber ist, dass der Austausch des schöpferischen Musikers mit einer regulierenden Kritik (die seinem Denken Anstöße und Anregungen gibt) mehr und mehr schwindet" (2005: 50).
Unmittelbar verbunden mit den Funktionen 3 und 4 ist die des Förderers und Katalysators der Kunst. Der Kulturjournalismus nimmt innerhalb des Journalismus' schon insofern eine Sonderstellung ein (vgl. auch Kapitel 2.2.2), dass er, oberflächlich betrachtet, freiweg gemeinsame Sache macht mit dem journalistischen Objekt. Konkret kann es etwa darum gehen, vom politischen System die Finanzierung von Kunstprojekten - direkt oder indirekt - einzufordern. Moralisch verwerflich ist diese Allianz zunächst freilich nicht: Kunst ist nicht nur ein integraler Bestandteil menschlicher Existenz, sondern als solcher an sich ein hohes kulturelles Allgemeingut. Die Kunstkritik in ihrer Funktion als Förderer der Kunst erfüllt hier also ein menschliches Grundbedürfnis. Die teilweise Aufgabe der Objektivität und Unparteilichkeit - sonst so zentrale ethische und professionelle Normen journalistischen Wirkens - ist hier also durchaus berechtigt. Zu betonen ist hier auch, dass die Wertungstendenz des Kunstkritikers für diese Funktion im Regelfall unerheblich ist - wichtig ist, dass überhaupt bewertet wird. Eine Rezension kann positiv oder negativ ausfallen - doch auch ein scharfer Verriss trägt zur Verbreitung der Kunst-Diskurse und damit verbundener Forderungen bei, sofern die Kritik aufrichtig, logisch begründet und nicht von Abfälligkeit oder Zynismus geprägt ist. "Wertung ist wichtig. Und die Tageszeitung braucht immer noch beides: den scharfen Verriss und die überschwängliche Hymne" (Meyer-Arlt 2008: 430). Meyer-Arlt hat bei dieser Aussage zwar in erster Linie die Attraktivität des journalistischen Produktes für den Leser im Sinn. Doch eine rigorose Wertung ist nicht nur für die Unterhaltung des Lesers, sondern auch für die Kunst wichtig. In diesem Sinne titelte etwa die Zeit: "Die Feigheit der Kritiker ruiniert die Kunst" (Rauterberg 2007). Im Vorspann hieß es weiter: "Die meisten Kritiker scheuen das Urteil. Sie folgen dem Markt und schaden damit den Künstlern und ihren Werken" (ebd.).
In Rauterbergs Kritik deutet sich eine weitere wichtige Funktion der Kunstkritik an. Auch die Kunstwelt ist von einer steigenden Ökonomisierung betroffen, und ein journalistischer Beitrag an prominenter Stelle kann den Marktwert des "Kunstproduktes" durchaus erhöhen. "Natürlich wird der Wert, auch der Marktwert eines Festivals, die Bedeutung eines Opernhauses oder die Größe eines Künstlerpersönlichkeit vor allem aufgrund des Presseechos bewertet" (Richter 2005: 34). Umgekehrt kann der Kulturjournalismus als Kunst-Promoter einem bisher unbekannten Künstler eine öffentliche Plattform bieten. Einmal abgesehen von der mehr oder weniger noblen Absicht des Kommunikators: Diese Funktion des Kulturjournalismus wirft Fragen auf über die Abhängigkeit des Journalismus von der PR - eine Verdächtigung, der sich natürlich vor allem die Feuilletons der großen, populären Medien ausgesetzt sehen.
Schließlich hat das Feuilleton auch aus Sicht der (klassischen) Medien natürlich durchaus seine Funktion - trotz geringer Leserzahlen (vgl. Kapitel 2.3.1). Wer etwas auf sich hält, so könnte man sagen, hat ein starkes Feuilleton. Für Thomas Steinfeld ist "das Feuilleton jenes Element [...], das die Zeitung am stärksten profiliert" (Kluge / Steinfeld 2004). Es gilt als geistiges Aushängeschild des Blattes und, kumulativ betrachtet, der Gesellschaft. Es bringt Farbe ins journalistische Produkt und beschert ihm einen gewissen intellektuellen Glanz, ein schillerndes Prestige, das sich bei der Lektüre auch auf den Rezipienten zu übertragen scheint. Hier erwartet der geneigte Leser Beiträge, die sich inhaltlich über bloße Tatsachen erheben, die den tieferen Sinn hinter ihnen ergründen. Kurz: Hier schreiben die "großen Denker" über die "großen Themen" unserer Kultur. Die Anziehungskraft, die das Kulturressort auch bei insgesamt kleiner Leserschaft entfalten kann, illustriert etwa das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das trotz konservativer Blattlinie aufgrund einer als qualitativ hochwertig bewerteten Kulturberichterstattung auch bei Lesern entgegengesetzter politischer Überzeugungen großen Anklang findet.[7]
Zusammenfassend können - ohne Anspruch auf Vollständigkeit[8] - sieben zentrale Funktionen des Feuilletons und der Kunstkritik identifiziert werden (siehe Tabelle 1):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1, Quelle: Eigene Darstellung
In Funktion 1 hebt sich das Feuilleton im Prinzip nicht von anderen Ressorts ab. Es geht hier um die fundamental journalistische Aufgabe, den Rezipienten als Individuum, aber auch die Gesellschaft insgesamt, möglichst zeitnah und vollständig über aktuelle Entwicklungen und Ereignisse zu informieren und die Informationen einzuordnen. Konkret kann es dabei etwa um eine Konzerttournee eines internationalen Musikstars gehen oder um den Geburts- oder Todestag eines Künstlers. Die angestammte Darstellungsform, die der Erfüllung dieser Funktion dient, ist - auch im Feuilleton - die Nachricht oder der Bericht. Eine Rezension muss jedoch naturgemäß auch immer einen Informationswert enthalten. Funktion 2 wird allzu oft mit dem Wirkungsbereich des Feuilletons insgesamt gleichgesetzt. Das liegt nicht zuletzt an der historisch bedingten quantitativen Übermacht der Kunstkritik und ihrer angestammten Darstellungsform, der Rezension, im klassischen Feuilleton. Typische Beispiele sind die Buchbesprechung eines aktuell erschienenen Romans oder die fachmännisch-kritische Auseinandersetzung mit der musikalischen Interpretation eines klassischen Werks durch ein Orchester. Diese Funktion hat naturgemäß in der lokalen Kulturberichterstattung eine relativ geringe Bedeutung.
Funktion 3 spielt auf das im klassischen Feuilleton überdurchschnittlich verbreitete professionelle Selbstverständnis des Kulturjournalisten als Pädagoge und Erzieher an. Auch im Rahmen der "Selbstverständigung einer Gesellschaft" kommt es jedoch natürlich auch darauf an, was beim Leser hängen bleibt - zum Beispiel über die rezeptionsgeschichtliche Bedeutung von Jackson Pollocks Gemälden, den strukturellen Aufbau einer Sinfonie oder die historisch-kulturellen Wurzeln des Jazz. Bei Funktion 4 geht es für den Kunstkritiker darum, die Schnittstellen der Kunst mit der gesellschaftlichen Realität aufzuzeigen und vor dem Hintergrund anderer kultureller Diskurse zu interpretieren. Hier kann es etwa darum gehen, Gründe für die gesellschaftliche Resonanz einer Rockgruppe zu untersuchen. Der Rezipient soll durch die Berichterstattung dazu motiviert werden, am initiierten kulturellen Diskurs teilzunehmen. Während diese Aufgabe etwa bei der Berichterstattung über populäre Ausdrucksformen (z.B. Popmusik oder Blockbuster-Filme) nachrangig ist, weil der öffentliche Diskurs oftmals bereits auf nicht-journalistischer Ebene vorhanden ist, stellt sie zum Beispiel für die zeitgenössische Musik, die stets um breite Aufmerksamkeit und damit um ein treues Stammpublikum kämpfen muss, eine geradezu überlebensnotwendige Funktion dar.
In Funktion 5 nähert sich der Kulturjournalismus, oberflächlich gesehen, an die PR an: Hier geht es darum, dass die Kunst als gesellschaftliches Allgemeingut gefördert wird. Insofern ist sie natürlich unmittelbar verbunden mit Funktion 4. Hier geht es jedoch um direkte Förderung, gewissermaßen ohne Umweg über die gesellschaftliche Dimension - sei es durch die Bereitstellung einer Plattform für Künstler oder durch einen Appell an den Verwaltungsapparat, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Funktion 6 schließlich ist eher eine Nebenwirkung der journalistischen Auseinandersetzung mit der Kunst. Die steigende Ökonomisierung der Kunstwelt bedeutet dabei, dass Kunstvermarkter die Medien für ihre Zwecke benutzen - sozusagen als Trittbrettfahrer der vom Journalismus erzeugten Öffentlichkeit. Funktion 7 schließlich ist nicht zuletzt die Folge einer allgemeinen aktuellen Entwicklung im Journalismus: Mit dem ökonomischen Druck, der in steigendem Ausmaß auf den privat-wirtschaftlich organisierten Presseunternehmen lastet, wächst auch die Bedeutung einer unterhaltsamen Präsentation, um so den Kaufanreiz für den potenziellen Leser zu erhöhen. Bei partizipativ ausgerichteten Angeboten im Internet geht es oft schlicht um Aufmerksamkeit vonseiten der User.
2.2 Voraussetzungen für die Erfüllung der Funktionen
Inwiefern erfüllen nun die kulturjournalistischen Angebote der beiden Mediengattungen - etablierte Print-Publikationen mit professionell-redaktioneller Nachrichtenproduktion auf der einen und relativ neue, partizipativ ausgerichtete Angebote im Internet auf der anderen Seite - diese Funktionen? Bevor diese Frage in Kapitel 2.3 beantwortet werden kann, sollen im Folgenden zunächst jene Voraussetzungen identifiziert werden, die eine Erfüllung der Funktionen erst möglich machen. Im Sinne der Cultural Studies sollen dabei, sofern praktikabel und erkenntnisfördernd, alle drei am medialen Prozess der "Selbstverständigung einer Gesellschaft" beteiligten Ebenen gleichwertig behandelt werden: Kommunikator, Medium und Rezipient (vgl. Lünenborg 2005: 101). Im Rahmen dieser Studie bedeutet dies, dass die Erfüllung einer Funktion bestimmte Gegebenheiten auf zwei oder sogar allen drei Ebenen simultan voraussetzen kann.
Da Funktionen 1 - 4 die im Rahmen der "Selbstverständigung einer Gesellschaft" besonders zentralen Aufgaben des Kulturjournalismus und der Kunstkritik darstellen und somit für den angestrebten Vergleich besonders gut geeignet sind, sollen Funktionen 5 - 7 fortan ausgeblendet werden. Diese stehen zwar für durchaus wichtige Faktoren im Kulturjournalismus - Funktionen 6 und 7 etwa stehen in Verbindung mit aktuellen Entwicklungen im Journalismus und in der Kunst, und sie werden mittelfristig wohl noch an Bedeutung gewinnen (vgl. Kapitel 3.5). Alle drei Funktionen können allerdings im Rahmen dieser Studie als funktionale Randerscheinungen der Kunstkritik bezeichnet werden, die entweder eher Auswirkungen auf die Kunstwelt haben oder traditionell mit Image und Strategien der etablierten Printmedien zu tun haben. Sie sind somit nur bedingt dazu geeignet, Antworten auf die Forschungsfrage zu finden. Indem sie ausgeklammert werden, kann den vier wichtigsten Funktionen - Information, künstlerische Auseinandersetzung, Bildung und gesellschaftliche Auseinandersetzung - letztendlich mehr Aufmerksamkeit zuteil werden.
2.2.1 Funktion 1: Kulturjournalismus als Berichterstattung
Natürlich kann eine vollständige Abbildung jedweder Realität nie gelingen. In die Berichterstattung kann nur aufgenommen werden, was das Medium transportieren kann. Dieser Faktor ist vor allem bei Zeitungen relevant, die wegen Platzmangels nur einen sehr beschränkten Ausschnitt der Realität darstellen können. Die Variable Kapazität beschreibt hier also zunächst den banalen Sachverhalt des zur Verfügung stehenden Platzes. Doch auch auf die Ebene der Nachrichtenrezipierung muss geachtet werden: Hier spielt etwa die Aufmerksamkeit des Publikums eine zentrale Rolle - ein Faktor, der de facto vor allem die Kapazität der Berichterstattung im Internet begrenzt. Auch die Tatsache, dass sich das Medium Papier einer ausgeprägten multimedialen Nutzung entzieht - nicht aber das Medium Internet - ist hier von Belang. In diesem Zusammenhang spielt natürlich auch die tatsächliche Mediennutzung der Rezipienten eine Rolle - und damit jene Faktoren, die das Medium für diese attraktiver machen: die Schnelligkeit des Internets etwa oder das Ansehen eines Printmediums. Vor allem im Internet kommt es aufseiten der Kommunikatoren auch auf die personelle Kapazität an - also die Anzahl der Berichterstatter und oft auch die Arbeitszeit, die von ihnen in ein Angebot gesteckt werden kann. All diese Phänomene und damit zusammenhängende Faktoren seien hier unter dem Begriff Kapazität zusammengefasst.
Um dem Rezipienten ein ausgewogenes Bild der kulturellen Realität zu bieten, in dem kumulativ betrachtet langfristig zumindest ein überwiegender Teil der vorhandenen kulturellen Sparten und Ausdrucksformen zur Geltung kommen, bedarf es zudem der Motivation, dieses Ziel zu erreichen. Was zunächst als Selbstverständlichkeit erscheinen mag, gewinnt an Relevanz, wenn man sich etwa die Selektionsentscheidungen der Kommunikatoren des klassischen Feuilletons vergegenwärtigt (vgl. Kapitel 2.3.2): Hier kommen fast nur Kunstwerke zur Geltung, die gemeinhin der sogenannten "Hochkultur" zugeschrieben werden - also Aufführungen auf den großen Theater- und Opernbühnen oder Ausstellungen namhafter Maler. Es ist dieser eingeschränkte Kunst- und Kulturbegriff, den Reus im Sinn hat, wenn er von den Redakteuren ein Ethos der Offenheit und Vielfalt einfordert (vgl. Reus 1999: 68).
Schließlich spielt für eine möglichst umfassende Information der Leserschaft im Rahmen der "Selbstverständigung einer Gesellschaft" auch die Einhaltung journalistischer Qualitätsstandards eine Rolle. Vor allem angesichts vieler pseudo-journalistischer, von Laien betriebener Angebote im Internet gewinnt dieser Faktor an Bedeutung.[9]
2.2.2 Funktion 2: Kulturjournalismus als Kontrolle der künstlerischen Qualität
Um ein Kunstwerk angemessen zu kritisieren, muss der Kritiker es nicht nur erleben, er muss es auch verstehen - es bedarf also des geistigen und emotionalen Zugangs des Kritikers zum Kunstwerk. So lautet jedenfalls der gesellschaftlich ausgehandelte und weitgehend akzeptierte Kanon: Wer in der Öffentlichkeit etwas zur Kunst sagen will, muss sie zunächst verstehen. Wie in Kapitel 2.3.4 zu zeigen sein wird, ist diese Variable für die Qualität der Kunstkritik jedoch weitgehend vernachlässigbar. Da die damit verbundenen Ansichten über die mangelnde Kritikfähigkeit von "Laien" jedoch noch immer tief im kollektiven Bewusstsein westlicher Gesellschaften verhaftet ist und oftmals der Partizipation breiterer Bevölkerungsschichten an kulturjournalistischen Aktivitäten im Internet und ganz allgemein am "kritischen Disput" der Kunst im Wege steht, soll sie in diese Untersuchung mit aufgenommen und, zumindest teilweise, entkräftet werden. Interessant ist im Rahmen dieser Studie vor allem die Frage, inwiefern die Ansicht, dass die Kunstkritik ein Privileg des "Kunstexperten" sei, von den journalistischen Kommunikatoren der beiden Mediengattungen vertreten wird (vgl Kapitel 3.4).
Viel entscheidender für einen Vergleich der Qualität und Relevanz einer Kunstkritik - weil sozusagen nicht angeboren - ist die Variable Wissen, also der Grad der einschlägigen Bildung und Erfahrung des Rezensenten. Wissen, etwa in den Bereichen Kunsttheorie, Kunstgeschichte, Kunsttechnik, sowie Wissen über das Kunstwerk im Besonderen, den Schöpfungsprozess, die Eigenheiten der Kunstsparte, den Künstler und seinen Werdegang, vergrößert die Menge und Adäquanz der zur Verfügung stehenden Kategorien und rationalisiert ihre Auswahl; es bietet dem Rezensenten theoretische Instrumente zur Analyse und Interpretation des Kunstwerks und hilft ihm dabei, das Kunstereignis "rezeptionsgeschichtlich einzuordnen" (Richter 2005: 33).
Je nach Kunstsparte bedarf es für eine kompetente Kritik auch einer Überführung visueller, akustischer oder atmosphärischer Signale, sowie emotionaler oder dramatischer Impressionen in verbale Ausdrücke. Dem Rezensenten muss es dabei gelingen, abstrakte Information in einer Form sprachlich darzustellen, die dem Kunstwerk gerecht wird, die aber auch den Leser anspricht und diesen emotional und intellektuell beteiligt. Entscheidend für eine gelungene Kritik ist also auch, ganz allgemein, eine Fähigkeit zur sprachlichen Umsetzung. Schließlich muss auch hier die Motivation gegeben sein. Deren Abwesenheit selbst bei Kommunikatoren des klassischen Feuilletons, oft als "Rezensionsfachressort" bezeichnet (Haller 2002: 12), bemängeln etwa Kolb (vgl. Kolb 2005: 248) und Stadelmaier (vgl. Stadelmaier 1991).
2.2.3 Funktion 3: Kulturjournalismus als Bildungsinstrument
Um diese Funktion zu erfüllen - also das vor dem Hintergrund des Kunstwerks aufbereitete Wissen des Experten an die Leserschaft weiterzugeben - muss der Kommunikator erstens ein gewisses Sendungsbewusstsein aufweisen. Es geht also um das berufliche Selbstverständnis des "Pädagogen" und "Erziehers" (vgl. Altmann 1983: 164, sowie Reus / Schneider / Schönbach 1995: 315 ). Zudem muss eine Fähigkeit zur journalistischen Vermittlung vorhanden sein - also die handwerkliche Kompetenz, komplexe und im Kulturjournalismus oft abstrakte, Sachverhalte für den Leser verständlich darzustellen. Dabei muss der Spagat gelingen, Rezipientengruppen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen und Bildungshintergründen anzusprechen. Im Falle einer Filmkritik könnte man diese, Eckhardt / Horn folgend, etwa in die Sparten "Desinteressierte", "Zufallsinteressierte", "Unterhaltungsorientierte", "Bildungsorientierte" und "Cineasten" unterteilen (vgl. Eckhardt / Horn 1991: 325).
2.2.4 Funktion 4: Kulturjournalismus als "Motor des kulturellen Diskurses"
Auch hier ist ein wichtiger Faktor der geistige Zugang des Kritikers. Dieser muss sich nicht nur der kunstinternen Diskurse bewusst sein; er muss sich auch auskennen in jenen Feldern der Wissenschaft, die sich mit den Bereichen menschlicher Existenz beschäftigen, welche an den unmittelbaren Wirkungsbereich der Kunst angrenzen. Hilfreich sind dabei Kenntnisse vor allem in der Soziologie, aber auch in den Bereichen Psychologie, Ethnologie, Philosophie und Anthropologie. Um diese Funktion zu erfüllen, bedarf es also weniger des kunstwissenschaftlichen Fachmanns als des geisteswissenschaftlichen Allrounders. Natürlich muss auch hier die Motivation der Kommunikatoren zu einer solchen Auseinandersetzung gegeben sein. Wie in Kapitel 2.3.10 zu zeigen sein wird, mangelt es vielen Kommunikatoren an dem Bewusstsein, dass eine solche Auseinandersetzung in den Zuständigkeitsbereich eines Feuilletons fällt.
Eine entscheidende Rolle spielt für die Erfüllung dieser Funktion natürlich auch die Kapazität der Medien - besonders ihr Image und ihre Reichweite. Da diese Aspekte jedoch schon im Rahmen von Funktion 1 (Kulturjournalismus als Berichterstattung) behandelt werden, soll hier auf jene Facette der Kapazität eingegangen werden, die für die Erfüllung von Funktion 4 wohl am wichtigsten ist: die Verfügbarkeit von Rückkanälen - also die Möglichkeiten, die dem Rezipienten zur Verfügung stehen, direkt mit dem Kommunikator und anderen Lesern in Verbindung zu treten. Diese Variable erlangt hier insofern eine herausragende Bedeutung, als solche Rückkanäle die Möglichkeit eröffnen, den "kritischen Disput" der Kunst bereits innerhalb des Mediums auszutragen und die Schwelle für eine Teilnahme daran somit erheblich herabzusetzen. Die Beteiligung "der Allgemeinheit" an einer diskursiven Verhandlung über die Kunst und ihre gesellschaftliche Relevanz auf öffentlicher Bühne kann den Prozess der "Selbstverständigung einer Gesellschaft" dabei nicht nur beschleunigen - sie kann ihn auch qualitativ stärken und verdichten. Selbstverständlich ist überdies die Frage von Belang, in welchem Ausmaß die vorhandenen Rückkanäle von den Rezipienten tatsächlich zu diesem Zweck genutzt werden und ob dadurch tatsächlich die gewünschte Debatte entsteht.
Tabelle 2 soll dazu dienen, die oben gewonnenen Erkenntnisse noch einmal zusammenzufassen.
Voraussetzungen für die Erfüllung der Feuilleton-Funktionen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2, Quelle: Eigene Darstellung
[...]
[1] Hervorhebung des Verfassers
[2] Siehe etwa das Blog-Verzeichnis www.bloggerei.de
[3] Vgl. auch Stalder 2003: 267 f. oder La Roche 1997: 87.
[4] Diese Studie hat natürlich nicht den Anspruch, Sinn und Zweck der Kunst zu analysieren. Es soll hier die kulturanthropologische Beobachtung genügen, dass weltweit kein Kulturkreis existiert, der nicht über - im weitesten Sinne - künstlerische Darstellungsformen verfügt. Kunst ist also, wenn man so will, ein unerlässlicher Teil der Conditio Humana.
[5] Hervorhebung im Original
[6] Hervorhebung des Verfassers
[7] In Ermangelung entsprechender empirischer Befunde gründet diese Aussage lediglich auf Beobachtungen des Verfassers. Es sei jedoch auf entsprechende Beobachtungen etwa bei Lischka (2002: 73) verwiesen.
[8] An dieser Stelle sei z.B. auf Glotz / Langebucher sowie Hamm verwiesen, die der Kunstkritik u.a. die Funktion zuwiesen, über die materiellen Hintergründe der Kunstproduktion zu berichten (vgl. Glotz / Langenbucher 1993: 105 und Hamm 1970: 9). Zudem sind die Funktionen des Feuilletons und die Funktionen der Kunstkritik hier trotz vielfältiger Überlappungen in der Realität der Einfachheit halber nicht getrennt dargestellt, da dies zur Beantwortung der Forschungsfragen nicht erforderlich ist.
[9] Analog zur in Fußnote 8 erwähnten zusätzlichen Funktion des Feuilletons, über die Hintergründe der Kunstproduktion zu berichten, könnte hier eine weitere Voraussetzung angeführt werden: Um diese Funktion zu erfüllen, muss es dem Berichterstatter möglich sein, Zugang zu jenen Orten und Einblick in jene Prozesse zu erlangen, die einem Großteil der Kunstrezipienten normalerweise verborgen bleiben. Dabei kann es sich um die Bereitschaft eines Künstlers zum Interview handeln oder die Erlaubnis, der Generalprobe eines Sinfonieorchesters beizuwohnen. Der Begriff hat dabei nicht unbedingt etwas zu tun mit physischen Barrieren, sondern vor allem mit dem Ruf des Journalisten und seines Mediums.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842803688
- DOI
- 10.3239/9783842803688
- Dateigröße
- 910 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Hohenheim – Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Kommunikationswissenschaft und Journalistik
- Erscheinungsdatum
- 2010 (September)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- kulturjournalismus online-journalismus feuilleton kulturblogs kunstkritik
- Produktsicherheit
- Diplom.de