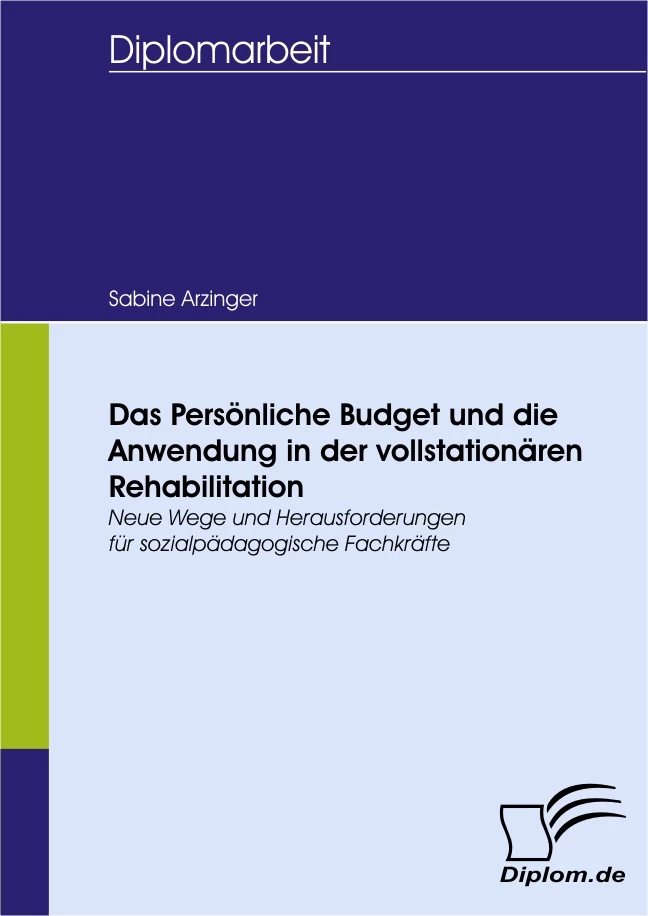Das Persönliche Budget und die Anwendung in der vollstationären Rehabilitation:
Neue Wege und Herausforderungen für sozialpädagogische Fachkräfte
Zusammenfassung
Der deutsche Sozialstaat muss sich einem immer größer werdenden Kostendruck stellen. Durch die ansteigende Arbeitslosenquote und den steigenden Hilfebedarf im Versorgungssystem des Gesundheitswesens werden die Sozialhaushalte gefordert sein, auf die Situation mit kostendämpfenden und strukturverändernden Umbaumaßnahmen zu reagieren. Speziell die Kosten der Eingliederungshilfe werden als ein stark gewachsenes Finanzierungsproblem definiert, da sie durch eine zunehmende Nachfrage und steigende Fallzahlen kaum noch finanzierbar sind.
Speziell der Abbau stationärer Eingliederungshilfen und die Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär trägt die Hoffnung vieler Seiten, die Kosten der Eingliederungshilfe zu senken. Ein in diesem Zusammenhang beschriebenes Reformgesetz wurde in § 17 SGB IX mit dem Persönlichen Budget gesetzlich verankert. Seit dem 01.01.2008 hat somit jeder Mensch einen Rechtsanspruch seinen bedarfsbezogenen Geldbetrag direkt zu erhalten, um die erforderlichen Unterstützungsleistungen selbst auszuwählen und zu finanzieren.
Durch die Einführung des Persönlichen Budgets soll unter fachlichen und finanziellen Aspekten geprüft werden, inwieweit Menschen, die bislang stationär betreut wurden, auch künftig im ambulant unterstützten Wohnen die benötigte Hilfe erfahren können. Durch den Ausbau ambulanter und offener Angebote sollen Alternativen zur Heimunterbringung entwickelt werden, um dem behinderten Menschen ein selbstbestimmtes und selbstverantwortliches Leben im eigenen Wohnraum zu ermöglichen. Man erhofft sich außerdem, dass sich das Hilfesystem für behinderte Menschen dadurch weiterentwickelt und flexibilisiert, aber auch vor allem die Kosten der vollstationären Eingliederungshilfe somit immens gesenkt werden.
Zurzeit liegt das Verhältnis von ambulanten Hilfen zu stationären Hilfen bei aktuell landesweit 40 : 60 %, welches sich zugunsten der ambulanter Hilfen durch die Einführung des Persönlichen Budgets verändern soll.
Weg von dem Objekt der Fürsorge soll nun der behinderte Mensch kurzum mehr Selbstständigkeit durch das im Persönlichen Budget verankerte Wunsch- und Wahlrecht erhalten.
Folglich bekommt man den Eindruck, dass alle Weichen gestellt sind, um durch das Persönliche Budget die vollstationäre Rehabilitation als ein Auslaufmodell erscheinen zu lassen. Unter diesem Aspekt kommt die Frage auf, was aber mit den Menschen passiert, die aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung und dem damit […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Interviewerstellung
2.2 Behinderung
2.3 Persönliches Budget
2.3.1 Einführung des Persönlichen Budgets
2.3.2 Ziele des persönlichen Budgets
2.3.3 Rechtliche Grundlagen
2.3.4 Veränderung der Rechtsverhältnisse
2.3.5 Zielgruppen des Persönlichen Budgets
2.3.6 Berufsfelder des Persönlichen Budgets
2.4 Rehabilitation und Teilhabe
2.5 Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen
2.6 Wohnbezogene Hilfen im bundesdeutschen Vergleich
3. Qualitätsgewährleistung
3.1 Zielvereinbarung
4. Beratung
4.1 Angehörige
4.2 Peer Counseling
4.3 Leistungsträger
4.4 Gesetzlicher Betreuer
4.5 Externe Service- und Beratungsstellen
5. Die klassischen Finanzierungsarten/-formen freier Träger
5.1 Direkte Finanzierung – Zuschüsse
5.1.1 Subventionen
5.1.2 Zuwendungen
5.1.2.1 Institutionelle Förderung
5.1.2.2 Projektförderung
5.2 Finanzierungsarten
5.2.1 Vollfinanzierung
5.2.2 Teilfinanzierung
5.3 Leistungsverträge
5.4 Indirekte Finanzierung
5.4.1 Pflege- und Kostensätze
5.4.2 Leistungsvereinbarungen
5.5 Eigenmittel
5.6 Zusammenfassung
6. Vergleich europäischer und deutscher Modelle
6.1 Großbritannien
6.2 Die Niederlande
6.3 Modellprojekt „Perle“
6.3.1 Beschreibung des vollstationären Wohnhauses und der Bewohnerschaft
6.3.2 Leistungsdifferenzierung innerhalb der stationären Einrichtung
6.3.3 Finanzierung und Bemessung der Budgets
6.3.4 Bildung und Beratung
6.3.5 Erfahrungen mit dem Persönlichen Budget
6.4 Zusammenfassung
7. Konzept einer vollstationären Rehabilitation
7.1 Mission, Vision, Leitbild
7.2 Strategische Analyse
7.2.1 Umfeldanalyse
7.2.2 Unternehmensanalyse
7.2 Strategiefindung
7.2 Unternehmensumsetzung
8. Auswirkung auf die soziale Arbeit
9. Zusammenfassung
Quellenverzeichnis
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Tabellen:
Tab. 1: Budgetnehmer in Hamburg zum Stand November 2008
Tab. 2: Übersicht der neuen Leistungsvorschriften zum Persönlichen Budget in den Sozialgesetzbüchern
Tab. 3: Anzahl Leistungsempfänger/innen ambulanter und stationärer wohnbezogener Hilfen pro 1.000 Einwohner/innen in Deutschland und NRW 2006
Tab. 4: Sachleistungen und Geldleistungen
Tab. 5: Budgethöhen nach Leistungstyp/Hilfebedarfsgruppen
Abbildungen:
Abb. 1: Dreiecksverhältnis alt und neu in der Behindertenhilfe
Abb. 2: Formen der Finanzierung sozialer Arbeit
Abb. 3: Analyse der Stakeholder
1. EINLEITUNG
Der deutsche Sozialstaat muss sich einem immer größer werdenden Kostendruck stellen. Durch die ansteigende Arbeitslosenquote und den steigenden Hilfebedarf im Versorgungssystem des Gesundheitswesens werden die Sozialhaushalte gefordert sein, auf die Situation mit kostendämpfenden und strukturverändernden Umbaumaßnahmen zu reagieren. Speziell die Kosten der Eingliederungshilfe werden als ein stark gewachsenes Finanzierungsproblem definiert, da sie durch eine zunehmende Nachfrage und steigende Fallzahlen kaum noch finanzierbar sind.
Speziell der Abbau stationärer Eingliederungshilfen und die Umsetzung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ trägt die Hoffnung vieler Seiten, die Kosten der Eingliederungshilfe zu senken. Ein in diesem Zusammenhang beschriebenes „Reformgesetz“ (vgl. Holuscha 2003, S. 35) wurde in § 17 SGB IX mit dem Persönlichen Budget gesetzlich verankert. Seit dem 01.01.2008 hat somit jeder Mensch einen Rechtsanspruch seinen bedarfsbezogenen Geldbetrag direkt zu erhalten, um die erforderlichen Unterstützungsleistungen selbst auszuwählen und zu finanzieren.
Durch die Einführung des Persönlichen Budgets soll unter fachlichen und finanziellen Aspekten geprüft werden, inwieweit Menschen, die bislang stationär betreut wurden, auch künftig im ambulant unterstützten Wohnen die benötigte Hilfe erfahren können. Durch den Ausbau ambulanter und offener Angebote sollen Alternativen zur Heimunterbringung entwickelt werden, um dem behinderten Menschen ein selbstbestimmtes und selbstverantwortliches Leben im eigenen Wohnraum zu ermöglichen. Man erhofft sich außerdem, dass sich das Hilfesystem für behinderte Menschen dadurch weiterentwickelt und flexibilisiert, aber auch vor allem die Kosten der vollstationären Eingliederungshilfe somit immens gesenkt werden.
Zurzeit liegt das Verhältnis von ambulanten Hilfen zu stationären Hilfen bei aktuell landesweit 40 : 60 % (vgl. Schäfer 2009, S. 172), welches sich zugunsten der ambulanter Hilfen durch die Einführung des Persönlichen Budgets verändern soll.
Weg von dem Objekt der Fürsorge soll nun der behinderte Mensch kurzum mehr Selbstständigkeit durch das im Persönlichen Budget verankerte Wunsch- und Wahlrecht erhalten.
Folglich bekommt man den Eindruck, dass alle Weichen gestellt sind, um durch das Persönliche Budget die vollstationäre Rehabilitation als ein Auslaufmodell erscheinen zu lassen. Unter diesem Aspekt kommt die Frage auf, was aber mit den Menschen passiert, die aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung und dem damit verbundenen Handlungsbedarf in vollstationären Strukturen wohnen bleiben werden? Es wird immer Menschen geben, die sowohl eine intensive Tages- als auch Nachtbetreuung benötigen werden. Kann man nicht auch denjenigen Menschen, die sich in stationären Kontexten befinden, durch das Persönliche Budget mehr Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten schaffen?
Bislang wurden die Chancen und Risiken des Persönlichen Budgets vornehmlich aus dem Blickwinkel der ambulanten Leistungserbringung diskutiert. Bei der Betrachtung des Persönlichen Budgets muss allerdings betont werden, dass die gewünschte Geldleistung in Form des Persönlichen Budgets auch innerhalb stationärer Handlungsrahmen angeboten werden kann und nicht automatisch ausgeschlossen werden darf.
Die Fragestellung wie sich das Persönliche Budget innerhalb stationärer Rehabilitationseinrichtungen initiieren lässt, habe ich mir zum Anlass genommen, mich mit der Thematik zu befassen. Ich bin der Auffassung, dass die Einführung des Persönlichen Budgets auch in vollstationären Institutionen sowohl für den Bewohner als auch für den Leistungserbringer einen Nutzen haben kann, wenn sich Unternehmen öffnen und ihre Organisationsabläufe verändern, um innovative Neuerungen durchzuführen.
Da ich meine Praxissemester in einer vollstationären Institution für Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung absolviert habe, werde ich die Ausarbeitungen und Diskurse zu der geschilderten Thematik in den Kontext des Arbeitsfeldes der Drogenrehabilitation stellen. Somit möchte ich unter Einbeziehung des Arbeitsgebietes einen Praxisbezug herstellen und geäußerte Sachverhalte und Beschreibungen anschaulich und nachvollziehbar gestalten.
Im ersten Teil beschäftige ich mich mit der theoretischen Grundlegung als Ausgangspunkt für die weitere Arbeit. Es werden Definitionen der in der Diplomarbeit verwendeten Begriffe, sozialstatistische Erhebungen, rechtliche Rahmenbedingungen, Zielgruppen und Berufsfelder des Persönlichen Budgets sowie die Vorgehensweise bezüglich der von mir geführten Interviews geklärt.
In Kapitel 3 wird auf den Zusammenhang zwischen Persönlichem Budget und Gewährleistung der Qualität eingegangen. Abschließend werde ich mich mit der Zielvereinbarung auseinandersetzen, die bei der Erbringung des Persönlichen Budgets als eine notwendige Vorbedingung verstanden wird.
Eine detaillierte Übersicht der Beratungsmöglichkeiten wird in Kapitel 4 geboten. Hier beschäftige ich mich mit den jeweiligen Möglichkeiten, die die unterschiedlichen Beratungsinstanzen mit sich bringen.
In Kapitel 5 folgt ein theoretischer Gesamtüberblick über die klassischen Finanzierungsmöglichkeiten sozialer Institutionen, um so ein Verständnis für neuere Finanzierungsformen wie das Persönliche Budget zu gewinnen.
Im folgenden Kapitel werde ich beispielhaft diejenigen Nachbarländer anführen, in denen bereits Erfahrungen mit Geldleistungen vorliegen. Außerdem wird das Projekt PerLe vorgestellt, dass als eine Besonderheit gilt, da sich das Persönliche Budget innerhalb vollstationärer Rehabilitationsstrukturen etabliert hat.
Den inhaltlichen Schwerpunkt der Arbeit stellt Kapitel 7 mit der Vorstellung einer Konzeptentwicklung dar. Modellhaft werde ich die organisatorischen und strategischen Ansätze für die Einführung des Persönlichen Budgets innerhalb eines vollstationären Handlungsrahmens veranschaulichen.
Abschließend wird auf die Anforderungen an die sozialpädagogische Praxis eingegangen, die sich aus der vorherigen Auseinandersetzung mit dem Thema Persönliches Budget ergeben.
Im Interesse einer besseren Lesbarkeit des Textes wird im Folgenden bei Personen- und Gruppenbezeichnungen die grammatikalisch maskuline Form verwendet. Selbstverständlich sind immer beide Geschlechter gemeint.
2. Theoretische Grundlagen
Der folgende Abschnitt widmet sich den grundsätzlichen Gesichtspunkten des Persönlichen Budgets. Sie tragen zum allgemeinen Verständnis der Arbeit bei. Neben den hier verwendeten Begrifflichkeiten werde ich auf den derzeitigen Forschungsstand, die sozialstatistischen Erhebungen und die rechtlichen Grundlagen eingehen.
2.1. Interviewerstellung
Im Rahmen dieser Arbeit interviewte ich zum einen die Leitung eines vollstationären Wohnhauses der Brücke gGmbH Rendsburg-Eckernförde und zum andern einen Diplom-Psychologen als persönlichen Betreuer zu dem Thema Einführung des Persönlichen Budgets. Ziel dabei war es - zusätzlich zu den theoretischen Erarbeitungen - Meinungen und Beurteilungen aus der fachlichen Perspektive zu gewinnen und die Arbeit durch praktische Beispiele zu bereichern.
Um eine Nähe zum Alltagsgeschäft entsprechend einfangen zu können, erschien mir ein Vorgehen anhand qualitativer Befragungen am geeignetsten. Die Befragten wurden aufgefordert, die subjektiven Einschätzungen und Erfahrungen anhand konkreter Schilderungen von Erlebnissen und anhand von Beispielen darzustellen, weshalb ich die Methode des Leitfaden-Interviews wählte (vgl. Friebertshäuser 2003, S. 375f).
Das Interview wurde direkt vor Ort im Wohnhaus und bei dem Betreuer zu Hause geführt. Die Dauer des Interviews lag zwischen 45 und 90 Minuten. Mit Zustimmung der Interviewpartner wurde das Gespräch mit einem Tonband aufgenommen. Die aufgezeichneten Aussagen wurden von mir teiltranskribiert, das heißt, dass ich bei der wörtlichen Verschriftung der Interviews bereits eine Auswahl vornahm und transkribierte nur die für diese Arbeit inhaltlich relevanten Teile. Auf linguistische und paralinguistische Elemente wie Lachen, Räuspern und Gesprächspausen habe ich verzichtet, da in dieser Arbeit die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund stehen soll. Lediglich ausgelassene Wörter und Satzteile habe ich als (…) gekennzeichnet und von mir eingefügte Ergänzungen, die zum Verständnis der Interviewsequenzen dienen, sind als […] dargestellt (vgl. Mayring 1999, S. 74). Jedem Interviewzitat habe ich als Vermerk Leitung bzw. Betreuer beigefügt, damit ersichtlich wird, wer die angeführte Aussage getroffen hat.
Der von mir erstellte Interview- bzw. Gesprächsleitfaden orientiert sich an den theoretischen Vorüberlegungen zur Thematik des Persönlichen Budgets in vollstationären Institutionen. Die Fragen wurden möglichst offen formuliert, um Antwortvorgaben zu vermeiden. Der erstellte Interviewleitfaden dient als „roter Faden“ zur Gesprächsführung (vgl. Mayring 1999, S. 51).
Entgegen üblicher Auswertungsverfahren soll der Inhalt der geführten Interviews weder interpretiert noch analysiert, verglichen, gedeutet oder zur Theoriebildung genutzt werden (vgl. Schmidt-Grunert 2004, S. 50). Zweck der verarbeiteten Sequenzen ist es, das theoretisch erarbeitete Material durch Beispiele zu beleben, zu belegen oder in einigen Fällen zu widerlegen.
2.2. Behinderung
Man spricht von Menschen mit einer Behinderung, die infolge einer Schädigung ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Funktionen soweit beeinträchtigt sind, dass die Verrichtungen im alltäglichen Leben oder ihre Teilnahme am Leben der Gesellschaft erschwert werden. (vgl. Antor/Bleidick 2001, S. 59).
Rabenstein konkretisiert den Behindertenbegriff, indem er sich auf das SGB IX bezieht. Nach § 2 Abs. 1 SGB IX gelten Menschen als behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist (vgl. Rabenstein 2004, S. 12). Durch diese zeitliche Komponente soll verhindert werden, dass vorübergehende Beeinträchtigungen nicht unter den Begriff der Behinderung fallen (vgl. Frankenstein/Knobloch/Viernickel S. 6).
Von der Vollversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde im Mai 2001 die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) beschlossen. Immer wieder wurde die rein medizinische, kausale Einteilung nach Behinderungsarten kritisch betrachtet. Um einen von Behinderung betroffenen Menschen in seiner Ganzheitlichkeit zu sehen, reicht es nicht nur aus die Eindimensionalität der Schädigung zu beachten, sondern die biopsychosozialen Wirkzusammenhänge mit einzubeziehen (vgl. Wacker/Wansing/Hölscher 2004, S. 127).
Nach § 53 Abs. 3 SGB XII ist es die besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern oder die Menschen in die Gesellschaft einzugliedern (ebd., S. 12).
In weiten Teilen der Sozialpolitik hat sich ein finaler Behinderungsbegriff durchgesetzt, der als gesetzes- und verwaltungstechnischer Begriff zu verteilungspolitischen Zwecken dient. Damit unterliegt der sozialtechnologische Behinderungsbegriff einem handlungsleitenden Interesse: Es werden solche Personen als behindert definiert, die der sozialen Hilfe bedürfen, etwa nach dem Sozialgesetzbuch XII (vgl. Antor/Bleidick 2001, S. 59).
Deutlich wird, dass bezüglich des Behindertenbegriffs verschiedene Kategorien, Bilder, Verständnisse und Sichtweisen bestehen. Die Relativität des Behindertseins und die Dynamik sozialer Definitionsprozesse drücken sich in der Ambivalenz des Behindertenbegriffs aus: Der Status der Behinderung verleiht zum einen Schutz und Hilfe, zum anderen bedroht er mit Stigmatisierung und Aussonderung (vgl. Antor/Bleidick 2001 S. 60).
2.3. Persönliches Budget
„…eine alte Forderung der Behindertenbewegung, dass das Geld in die Hände der behinderten Menschen gehört.“ (Lippe/Lessing 2007, S. 21)
2.3.1 Einführung des Persönlichen Budgets
Mit dem Persönlichen Budget erhalten Menschen mit einer Behinderung oder von Behinderung betroffene Menschen die Möglichkeit, monetäre Leistungen von den in Frage kommenden Leistungsträgern als Budget zu erhalten und die erforderlichen Hilfen nach eigenen Wünschen bei den sozialen Dienstleistungserbringern selbst einzukaufen und abzurechnen (vgl. Windisch 2006, S. 9). Betroffene haben somit die Möglichkeit frei zu wählen und zu entscheiden, welche Unterstützungleistung je nach Bedarf benötigt wird und welche nicht (vgl. Kräling 2004, S. 110). Diese „Direktzahlungen“ (Loeken 2006, S. 31) sind individuell bemessene Geldbeträge, die die betroffenen Personen von einem oder mehreren Leistungsträgern erhalten (vgl. Peters/Ruppert/Jungnickel 2007, S. 18). Die Wahlfreiheit soll die Selbstbestimmung der behinderten Menschen fördern.
Das Persönliche Budget wurde zum 01.07.2001 im SGB IX als Geldleistung verankert und als eine so genannte „Kann-Leistung“ in verschiedenen Regionen bundesweit erprobt. Ab dem 01.01.2008 haben Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Personen einen Rechtsanspruch auf das Persönliche Budget (vgl. Trendel 2008, S. 11).
In der Vergangenheit galt in der Behindertenhilfe das Sachleistungsprinzip. Die Einrichtungen erbrachten Leistungen für die sie vom Kostenträger entsprechende Gelder erhielten. Die Leistungserbringer sahen sich in der Pflicht nach fachlichen Kenntnissen und Überzeugungen Leistungspakete zu entwickeln und mit Inhalten zu füllen (vgl. Wacker 2009, S. 4). Nicht selten wurden die Leistungserbringer ohne Mitsprachemöglichkeiten der Nutzer von den Kostenträgern ausgewählt. Die Kosten der in Anspruch genommenen Leistungen waren für die betroffenen Personen nicht grundsätzlich transparent (vgl. Peters/Ruppert/Jungnickel 2007, S. 10). Somit bestand ein Dreiecksverhältnis der Leistungserbringung[1], Leistungsempfänger und Kostenträger[2], bei dem der Nutzer nur begrenzt Einfluss auf die Art und Qualität der Leistungserbringung hatte.
Dies hat zur Folge, dass zwischen dem Leistungsträger und Leistungserbringer keine Verhandlungen mehr über die Erbringung der jeweiligen Leistungen geführt werden. Zwischen dem Leistungserbringer und Budgetnehmer wird ein zivilrechtlicher Vertrag geschlossen, der einem Arbeitgeber-Arbeitnehmervertrag ähnlich ist (vgl. Lippe /Lessig 2007, S. 21).
Grundsätzlich sind alle von Behinderung betroffenen Menschen unabhängig von Alter und Schwere der Behinderung leistungsberechtigt. Fesca geht davon aus, dass fast alle Unterstützungsbedarfe über das Persönliche Budget gedeckt werden können. (vgl. Fesca 2006, S. 22).
Lachwitz konkretisiert dies, indem er sich auf die Sozialgesetzgebung bezieht (§ 17 Abs. 2 Satz 3 SGB IX), die besagt, dass nur budgetfähige Leistungen durch ein Persönliches Budget erbracht werden. Als budgetfähig werden Leistungen bezeichnet, die sich auf die alltäglichen, regelmäßig wiederkehrenden und regiefähigen[3] Bedarfe beziehen.
In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass das Persönliche Budget keine neue Leistung ist, sondern dass es die Ausführung bereits bestehender Leistung betrifft. Es wird dem Budgetnehmer die Möglichkeit eröffnet zu entscheiden, ob die benötigten Leistungen als Geld- oder als Sachleistung gewährt werden. Somit wird ein zusätzlicher Zahlungsweg zwischen dem Budgetnehmer und dem Leistungserbringer eröffnet (vgl. Lachwitz, S. 12).
Folgend untergliedert man vier Arten des Persönlichen Budgets, die nach Zielsetzung und Tragweite unterschieden werden:
1. Trägerübergreifendes Persönliches Budget (SGB IX), das seit 2004 eingeführt ist und erprobt wird;
2. Personenbezogenes Pflegebudget (SGB XI), das seit 2004 Gegenstand der Erprobung ist;
3. Persönliches Budget als Leistung zur Teilhabe nach SGB XII, das in Rheinland-Pfalz seit 1998 leistungsberechtigten Personen mit Behinderung als pauschalierte, in drei Stufen gestaffelte Geldleistung zur Verfügung gestellt wird;
4. Integriertes Budget, das eine Kombination aus dem trägerübergreifenden Persönlichen Budget und dem Pflegebudget ist.
(vgl. Göltz 2008, S. 49)
Das Persönliche Budget als Leistung zur Teilhabe nach SGB XII der Eingliederungshilfe wurde als „einfaches“ Persönliches Budget (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2006, S. 1) innerhalb eines Modellprojektes in Rheinland-Pfalz erprobt. In der Modellphase wurde es in 3 Stufen zwischen DM 400,- und DM 1.500,- analog zur Pflegeversicherung eingeteilt. Mit dem SGB XII wurde das Persönliche Budget zum 01. Juli 2004 als flächendeckende Regelleistung eingeführt und als trägerübergreifendes Persönliches Budget weiter ausgestaltet (vgl. Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie Rheinland-Pfalz 2001, S. 3).
In der Debatte des Persönlichen Budgets wird zwischen dem trägerübergreifenden Budget und dem Pflegebudget differenziert.
Gemäß § 17 Abs. 3 SGB IX wird der Begriff der „Komplexleistung“ aufgegriffen. Es gibt Personen, die verschiedene Unterstützungsansprüche geltend machen möchten. Hier werden bei den unterschiedlichen Leistungen mehrere Leistungsgesetze im gegliederten System angesprochen. Das bedeutet, dass unterschiedliche Leistungsträger in Betracht kommen können, beispielsweise Sozialhilfeträger[4], Krankenkassen[5] und die Pflegekassen[6] (vgl. Lachwitz S. 34). Verschiedene Träger sind beim trägerübergreifendem Budget aufgefordert den Leistungskomplex gemeinsam zu definieren und festzulegen (vgl. Rabenstein 2004, S. 34f). Der trägerübergreifende Budgetbetrag soll schließlich „wie aus einer Hand“ erhalten werden (vgl. Trendel 2008, S. 33). Der Leistungsträger, bei dem der Antrag zuerst gestellt wird, ist verpflichtet die Gesamtleistung zu koordinieren und das Gesamtbudget dem Leistungsberechtigten auszuzahlen. Dies soll der bürokratischen Vereinfachung bei den unterschiedlichen Zuständigkeiten dienen, so dass der Budgetnehmer nur mit einem beauftragten Ansprechpartner zu tun hat (vgl. Rabenstein 2004, S. 14).
Im Projektzeitraum des Persönlichen Budgets wurde ersichtlich, dass tatsächlich nur fünf Prozent des Persönlichen Budgets als Trägerübergreifendes Persönliches Budget gewährt wurde. Begründet wird diese geringe Nutzung durch die noch nicht aufeinander abgestimmten Beantragungs- und Bewilligungsverfahren von Seiten der Leistungsträger und das Fehlen einer mit ausreichenden personellen und fachlichen Ressourcen ausgestatteten Beratungsinstanz, die die trägerübergreifende Zusammenarbeit erleichtert (vgl. Bayer 2008, S. 9). Auch die Praxis zeigt, dass viele Leistungsträger sich mit dem Systemwechsel schwer tun und sich von dem Persönlichen Budget keinen Nutzen versprechen (siehe hierzu auch Tab. 1) (vgl. Schäfers 2009, S. 176).
„Ich bin aufgrund meiner Anzeige nochmal angerufen worden, aber vom Jugendamt Dithmarschen, die sagten, Herr B., wir haben hier auch immer Klienten und wir würden gerne für die etwas mit dem Persönlichen Budget machen, aber alles was wir sozusagen versuchen zu beantragen, wird abgelehnt. Selbst behördliche Stellen, die sich für die Menschen, die so einen Anspruch auf Persönliches Budget haben, kümmern, erleben immer wieder, dass derselbe Funktionsapparat Behörde in der Hilflosigkeit nicht reagiert oder immer wieder ablehnend reagiert.“ (Betreuer)
Tabelle 1 : Budgetnehmer in Hamburg zum Stand November 2008
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[7]
Quelle: Westecker 2009, S. 10
Das Personenbezogene Pflegebudget wird als eine neue Kombination von Pflege und niedrigschwelligen Leistungen definiert, die zu einem Gesamtangebot verknüpft werden. Das personenbezogene Pflegebudget soll als Geldleistung an Pflegebedürftige oder deren Angehörige für den Einkauf von Pflegedienstleistungen ausgezahlt werden (vgl. Brandenburg 2004, S. 259). Gem. §§ 8 Abs. 3 und 36 SGB XI sollen von den Geldern „Care-Leistungen“ eingekauft werden. Hierbei handelt es sich nicht um die klassischen Pflegeleistungen. Somit werden alle Verrichtungen gekennzeichnet, die unter den unscharfen Begriff der Betreuung fallen (vgl. Klie/Pfundstein 2006, S. 42). Ziel der Einführung des personenbezogenen Pflegebudgets ist es, eine kostengünstigere, effektivere und individuell angepasste Pflege und Betreuung für den pflegebedürftigen Menschen durch mehr Entscheidungsfreiheit und Selbstorganisation der Kleinstanbieter zu schaffen. Greuèl/Mennemann (2006, S. 70) sprechen von einer Flexibilisierung der Leistungen. Die Autoren betonen eine bei der Verrichtung von Pflegeleistungen bis dato sehr starke Fokussierung auf somatische Handlungen wie die der Grundpflege. Durch die Einführung des Pflegebudgets soll die psychosoziale Betreuung in den Vordergrund rücken (vgl. Greuel/Mennemann 2006, S. 70). Die Ähnlichkeit der Ziele mit denen der Behindertenhilfe ist sehr deutlich (vgl. Kramer 2007, S. 20f).
Hervorzuheben ist hier, dass der Pflegebedürftigkeitsbegriff unangetastet bleibt, das bedeutet, dass die Pflegestufen weiterhin gemäß Sozialgesetzbuch §§ 14, 15 ermittelt werden. (vgl. Klie/Pfundstein 2006, S. 42).
Das Integrierte Budget ist zwischen dem Persönlichen Budget, auch trägerübergreifend, nach § 17 SGB IX und dem vorab beschriebenen Pflegebudget auf der Grundlage des § 8 Abs. 3 SGB XI anzusiedeln. Es eröffnet die Möglichkeit die Leistungen der häuslichen Pflege in das trägerübergreifende Budget gemäß § 17 SGB IX aufzunehmen. Demnach können Menschen mit einer Behinderung auch die Leistungen der Pflegeversicherung in Form eines Budgets erhalten. Schnittstellenprobleme zwischen den Kostenträgern sollen auf diese Art verringert werden. Einzelpersonen und Dienste, die keinen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen abgeschlossen haben, können mit dem Integrierten Budget die benötigten Verrichtungen ausführen (vgl. Speicher 2006, S. 10).
2.3.2 Ziel des Persönlichen Budgets
Ziel der Einführung des Persönlichen Budgets ist es, dass Personen mit Unterstützungsbedarf die erforderlichen Hilfen nach eigenen Wünschen frei wählen und entscheiden können. Eingekauft und abgerechnet wird direkt mit den sozialen Dienstleistungserbringern und nicht mehr über den Kostenträger (vgl. Windisch 2006, S. 9). Die Leitidee des Persönlichen Budgets ist eng verknüpft mit der gesellschaftlichen Teilhabe, der Inklusion und den individuellen und an den persönlichen Bedarfen ausgerichteten Hilfeleistungen. Dadurch erhält ein Mensch mit Behinderung bezüglich der Hilfen mehr Wahlmöglichkeiten. So besteht die Möglichkeit eigene, persönliche Bedürfnisse jenseits der bekannten und eher institutionszentrierten Unterstützungsformen zu entwickeln:
„Wir wollen ihn aus dem vollstationären Rahmen holen. Er wirkt antriebs- und interessenlos. Was fange ich mit mir an, was fange ich mit meinem Tag an? Er hat es nicht gelernt, die ganzen letzten Jahre waren institutionell von morgens bis abends fremdbestimmt und das, was an Freizeit gestellt wurde, konnte nicht unterstützt werden. (…) Er hat keine konkrete Vorstellungskraft, was es gibt. Unser Konzept ist es, ihn mit dem Persönlichen Budget zu betreuen und ihn bezüglich eigener Interessen und Bedürfnisse zu ,wecken’.“ (Betreuer)
Die Unterstützungsleistungen können zeitlich und sozial flexibler organisiert werden. Zudem zielt die Einführung des Persönlichen Budgets darauf ab, den behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen zum Kunden, Käufer und Arbeitgeber werden zu lassen. Dieser soll durch das Persönliche Budget selbst darüber verfügen, wann, wo, wie und von wem er die Unterstützungsleistung bezieht (vgl. Bayer 2008, S. 7). Niehoff (2003, S. 57) bezeichnet dies als ein Mehr an „Regiekompetenz“. Außerdem soll die Möglichkeit, zwischen ambulanten und stationären Angeboten frei zu wählen, verbessert werden. Dadurch soll der noch schwach entwickelte Bereich der ambulanten Eingliederungshilfen flächen- und bedarfsdeckend erweitert werden.
Auch unter finanziellen Gesichtspunkten ist Deutschland aufgrund von Sparpolitik und stetig wachsender Staatsverschuldung stark betroffen, so dass Forderungen nach dem Persönlichen Budget als Konsequenz erscheinen:
Der Reformdruck in Deutschland ist dadurch noch höher geworden als bei unseren Nachbarn. (…) Diese Reformen haben u. a. zum Ziel WENIGER Geld auszugeben. (…) Um Ihnen dieses plastisch vor Augen zu führen, muss ich Sie jetzt mit den größten Ausgabeblöcken unseres Bundeshaushaltes konfrontieren: An Zuschüssen für Rentenkassen, für Pensionszahlungen und Zinsen geben wir aktuell 130 Mrd. Euro jährlich in Deutschland aus – über 46 Prozent des Gesamtetats (…). Die Bundesagentur für Arbeit hat in den letzten 20 Jahren kontinuierlich über Steuern finanzierte Zuschüsse des Bundes erhalten, weil das Aufkommen aus der Arbeitslosenversicherung nicht reichte, um die beschlossenen Leistungen für Arbeitslose zu erbringen. (…) Beispiel Gesundheitspolitik: Die explodierenden Kosten im Gesundheitswesen sind ein Dauerthema und werden es absehbar bleiben – denn neben zu teuren Medikamenten, unwirtschaftlicher Arbeit von 250 Krankenkassen, nicht transparenten Abrechnungen und Mehrfachuntersuchungen sowie Krankenhäusern mit modernster Apparatemedizin ist der Hauptgrund für diese Kostensteigerung, dass wir alle immer älter werden – die höchsten Gesundheitskosten werden nämlich in den letzten drei Lebensjahren „fällig“ (Hagedorn 2008, S. 55ff).
Folglich wird ein Prozess der Ökonomisierung gewünscht. Das Persönliche Budget soll einen Markt mit Leistungsanbietern schaffen, die miteinander im Wettbewerb stehen. Hier werden Einspareffekte durch die Verringerung der administrativen Kosten erhofft, die gerade im Bereich der Verwaltung der Hilfen anzutreffen sind. Hier spricht Sack von einer Veränderung eines stark regulierenden Sozialsystems der Hilfestrukturen hin zu einem sich selbst regulierenden Markt (vgl. Sack 2007, S. 25).
2.3.3 Rechtliche Grundlagen
Seit dem 01. Januar 2008 wird der Ermessensanspruch auf ein Persönliches Budget durch einen allgemeinen Rechtsanspruch abgelöst. Dies bedeutet, dass ab 2008 ein persönliches Budget für Betroffene einklagbar ist.
Die Gesetzesgrundlage der Leistungen für Menschen mit Behinderung bilden die Sozialgesetzbücher (SGB IX), also die Rehabilitation und Teilhabe für behinderte Menschen, sowie das Zwölfte Buch (SGB XII), die Sozialhilfe.
Zudem gelten die übergeordneten Sozialgesetzbücher SGB I, IV und X entsprechend (vgl. Göltz 2008, S. 32). Die Vorschriften sowohl zum Persönlichen Budget als auch zum trägerübergreifenden Persönlichen Budget nach SGB IX, dem Gesetz zur Rehabilitation und Teilhabe, werden in den meisten Sozialleistungen als anwendbar erklärt.
Tab. 2 : Übersicht der neuen Leistungsvorschriften zum Persönlichen Budget in den Sozialgesetzbüchern
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Hagelskamp 2004, S. 130
Die Regelung des Persönlichen Budgets wurde ab dem 01. Juli 2004 im § 17 SGB IX verankert. Außerdem wurde zum gleichen Zeitpunkt die Budgetverordnung erlassen.
Ziel des § 17 SGB IX ist es, „dem/der Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen“ (§ 17 Abs. 2 Satz 1 SGB IX).
Ebenfalls werden im § 17 SGB IX die budgetfähigen Leistungen beschrieben. In § 17 Abs. 2 Satz 3 SGB IX wird geregelt, dass das Persönliche Budget trägerübergreifend als Komplexleistung erbracht werden kann (vgl. Welti/Rummel 2007, S. 17). In § 10 Abs. 1 SGB IX ist die Verfahrenshöchstdauer bei dem trägerübergreifenden Budget berücksichtigt. So sind neun Wochen zuzüglich des trägerübergreifenden Bedarfsfeststellungsverfahrens die gesetzliche Höchstfrist (vgl. Welti/Rummel 2007, S. 32).
Die Budgetverordnung (BudgetV) konkretisiert den Inhalt und die Ausführung des Persönlichen Budgets und regelt das Verfahren sowie die Zuständigkeit bei Beteiligung mehrerer Leistungsträger. Darüber hinaus bezieht sie die Pflegeversicherung in den Kreis der Träger ein, die die Leistungen des Persönlichen Budgets ausführen können (vgl. Theunissen/Schirbort 2006, S. 111).
Der Gesetzesgeber begrenzt den Anwendungsbereich des Persönlichen Budgets auf Leistungen zur Teilhabe, die in folgende Kapitel gegliedert werden:
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§§ 26ff. SGB IX),
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§§ 33ff. SGB IX),
- Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen (§§ 44ff,
SGB IX),
- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
(Lachwitz 2004, S. 5)
Die Höhe des Persönlichen Budgets soll so zu bemessen sein, dass der individuell festgestellte Bedarf einschließlich der erforderlichen Beratung gedeckt wird. Jedoch sieht der § 17 Abs. 3 Satz 4 SGB IX vor, dass die Höhe des Persönlichen Budgets die Kosten aller bisher individuell festgestellten Leistungen nicht überschreiten soll. Gerade in der stationären Rehabilitation könnten hier Probleme auftauchen, da zum Beispiel der Wechsel aus der stationären in die ambulante Betreuung mit einem Mehr an Beratungsleistung und somit einem höheren Unterstützungsbedarf einhergeht. Hier muss allerdings betont werden, dass es sich um eine Soll-Vorschrift handelt, von der in sachlich begründeten Fällen abgewichen werden kann.
2.3.4 Veränderung der Rechtsverhältnisse
Im traditionellen Sachleistungsmodell spricht man von einem sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis:
Ein Leistungserbringer erstellt ein Leistungsangebot nach eigenen fachlichen Kenntnissen und Überzeugungen. Überlebensstrategien der Organisation und Akzeptanz unterschiedlicher Interessenfelder sind demnach maßgeblich in vielen Entscheidungsprozessen und bei der Entwicklung des Leistungsspektrums (vgl. Wacker 2009, S. 49). Herkömmlich erbrachte Leistungen des Kostenträgers werden direkt mit den Leistungserbringern verrechnet. Zwischen Leistungserbringer und Leistungsträger bestehen im Sachleistungsmodell öffentlich-rechtliche Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen (siehe hierzu Punkt 5.3, 5.4.2).
Deutlich wird hier, dass in diesem Dreieck vorrangig Leistungsträger und Leistungsanbieter in Abstimmung stehen, während der behinderten oder von Behinderung bedrohten Person eine überwiegend passive Aufgabe zukommt. Er hat einen Rechtsanspruch auf Kostenübernahme, muss aber das, was ihm angeboten wird, nutzen.
Göltz (2008, S. 40) spricht von einer nichtschlüssigen Tauschbeziehung , da der Austausch von Geld und Leistung nicht über die Beziehung Leistungsberechtigte/r -Anbieter erfolgt. Dies verdeutlicht folgende Abbildung:
Abb. 1: Dreiecksverhältnis alt und neu in der Behindertenhilfe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Trendel 2008, S. 14f
Das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis soll durch das Persönliche Budget abgelöst werden.
Durch die Veränderung der Zahlungswege werden die Vertragsbeziehungen von Leistungserbringer und –nutzer gestärkt. Menschen mit Behinderung übernehmen eine neue Rolle als gleichberechtigte „Vereinbarungspartner und Kunden“ (Fesca 2006, S. 23). Sie kaufen ihre Leistungen direkt beim Leistungserbringer ein und es werden unmittelbare Verträge zwischen Ihnen formuliert (vgl. Windisch 2006, S. 9). Außerdem verhandelt der Leistungsberechtigte nun direkt mit dem Kostenträger über die Höhe des Geldbetrages, mit dem er bestimmte Ziele verfolgen möchte. So erhält der Nutzer mehr Einfluss auf die Art, den Umfang und die Organisation der Leistungserbringung. Er erklärt sich allerdings auch bereit, sich mit finanziellen und rechtlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen (vgl. Jahncke-Latteck/Rösner/Weber 2007,
S. 88).
Die gewandelte Strategie, Mittel direkt dem Nutzer zuzuweisen, soll zu einem effektiveren und effizienteren Mitteleinsatz führen und die Rollen im Leistungsdreieck neu verteilen (vgl. Wacker 2009, S. 5).
Für soziale Institutionen bedeutet diese gewandelte Nachfrage, dass sie in Zukunft angehalten seien werden, flexibler mit einem bedarfsgerechten Leistungsangebot zu reagieren. Zudem dürfte langfristig betrachtet auch der Konkurrenzdruck – gerade in großstädtischen Ballungsgebieten – zunehmen (vgl. Rabenstein 2004, S. 13). Lachwitz betont, dass sich die Rechtsstellung der Leistungserbringer verändert, da die Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen gem. §§ 75ff SGB XII an Bedeutung verlieren (vgl. Lachwitz 2004, S. 9). Durch diese Änderung der Rechtsverhältnisse kommt es zu einer geringeren Planungssicherheit des Leistungserbringers, weil die zeitliche Bewilligung – meistens des Sozialamtes – nicht mehr die unmittelbare Vertragsgrundlage ist, sondern allein der privatrechtliche Vertrag zwischen dem Leistungserbringer und dem Budgetnehmer und der Budgetnehmerin (vgl. Lippe/Lessig 2007, S. 22).
In der Vergangenheit wurden die Leistungen für Menschen mit Behinderung einerseits über die Kostenzusagen und andererseits über Platzkapazitäten und deren Verteilung auf ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote durch die Kostenträger gesteuert. Die Funktion des Sozialstaats als Versorgungsinstitution wurde in den letzten Jahren immer kritischer betrachtet, da diese mit einem hohen bürokratischen und organisatorischen Aufwand verbunden ist. Durch die Einführung des Persönlichen Budgets sollen die Sicherungselemente von Seiten des Kostenträgers zugunsten von mehr Eigenleistung der Nutzer zurückgefahren werden (vgl. Loeken 2006, S. 22).
Die Leistungsträger der Rehabilitation treten in die Rolle der Garanten, die für die Unterstützung ausreichender Ressourcen zuständig sind. Verändert hat sich hier, dass die Rehabilitationsträger, die nun als Beauftragte agieren, nicht „festlegen“ sollen, was die einzelne Person als individuellen Hilfebedarf zu erhalten hat, sondern „feststellen“ sollen, worin der individuelle Bedarf besteht.
Hier betont Plagemann (2006, S. 177), dass es sich bei dem individuellen Bedarf um einen objektiven Tatbestand handelt, der durch Einschaltung von Sachverständigen[8] ermittelt werden kann (vgl. Plagemann 2006, S. 17). Zudem lässt sich aus dem § 11 Abs. 2 SGB XII ableiten, dass zu den neuen Aufgaben der Kostenträger die neutrale Unterstützung und Budgetberatung zählen, die beispielsweise über die Beratungsstellen der Sozialhilfeträger erfolgen sollen (vgl. Lachwitz 2004, S. 48f).
2.3.5 Zielgruppen des Persönlichen Budgets
Menschen, die aufgrund körperlicher Einschränkungen, intellektueller Beeinträchtigung oder chronisch psychischer Erkrankungen die täglichen Anforderungen nicht bewältigen können, haben die Möglichkeit mit Hilfe des Persönlichen Budgets als Geldleistung ihre Hilfeleistungen einzukaufen. Ursprünglich ging es in der Diskussion zur Einführung des Persönlichen Budgets hauptsächlich um die Leistungen der Pflege ggf. verbunden mit dem betreuten Wohnen (vgl. Plagemann 2006, S. 175; Kramer 2007, S. 21).
Die Gesetzesgrundlage wurde allerdings so ausgestaltet, dass die Gewährung des Persönlichen Budgets an keine bestimmten Zugangskriterien geknüpft wurden[9], so dass alle behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen das Recht haben, ihren Hilfebedarf als Geldleistung gewährt zu bekommen (vgl. Hansen 2007, S. 31).
Nicht selten wird der Irrglaube gehegt, dass das Persönliche Budget nicht für alle Menschen mit Behinderungen in Betracht käme, da diese aufgrund verschiedener Behinderungsarten und Schweregraden und dem damit verbundenen hohen Betreuungsbedarfs nicht in der Lage sei (vgl. Holuscha 2003, S. 36). Der Umgang mit dem Persönlichen Budget wird eher bei Menschen mit einer Körperbehinderung für möglich gehalten als bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen (vgl. Peters/Ruppert/Jungnickel 2007, S. 33). Umstritten ist hier, ob die Person selbstständig die eigene Verantwortung für das Persönliche Budget übernehmen kann und ob die Befähigung eines gesetzlichen Vertreters ausreicht, um die betroffene Person zu unterstützen.
Nach Bienwald (2005, S. 255) ist diese Fragestellung nicht ausdrücklich geregelt und geklärt. Für Holuscha (2003, S. 36) steht fest, dass die Nutzer des Persönlichen Budgets über Kompetenzen verfügen müssen, um auf die Ausgestaltung der Leistung Einfluss zu nehmen und um so in ihrer Funktion als Auftraggeber zu agieren. Ein Leistungsberechtigter sollte das Angebot an entsprechenden Dienst- und Sachleistungen kennen und abschätzen können, wie viel Geld erforderlich ist, um die benötigten Leistungen einzukaufen (vgl. Lachwitz 2004, S. 23).
Schelter verdeutlicht dies mit folgendem Zitat:
Selbstbestimmung umfasst hier das Recht der Auswahl der Assistenten (Personalkompetenz), die Planung des Einsatzes und der Zeiten der Hilfe (Organisationskompetenz), die Entscheidung über Form, Art, Umfang und Ablauf der Hilfen (Anleitungskompetenz), die Bestimmung über den Ort der Leistungserbringung (Raumkompetenz), die Kontrolle über die Bezahlung und Verwendung der Mittel (Finanzkompetenz) und das Recht zur Wahl der Hilfen von verschiedenen Personen und Anbietern (Differenzierungskompetenz). (Schelter 2003, S. 392).
Er betont allerdings in diesem Zusammenhang, dass dies kein tragfähiger Einwand sei, das Persönliche Budget nicht zu gewähren, da dies zum Beispiel durch die Unterstützung des gesetzlichen Betreuers oder durch die Budgetassistenz erreicht werden könne (vgl. Schelter 2003, S. 393).
Innerhalb des Modellprojektzeitraums in Deutschland hat sich erwiesen, dass zu den Hauptnutzern vor allem Menschen mit psychischen Erkrankungen[10] gefolgt von Menschen mit geistiger Behinderung und Menschen mit Körperbehinderungen zählen (vgl. Trendel 2008, S. 21). Das Durchschnittsalter der Budgetnehmer liegt bei 36,5 Jahren, während in der Literatur verdeutlicht wird, dass die Alterspanne von 3 Jahren bis hin zu 78 Jahren reicht (vgl. Deutscher Bundestag 2006, S. 36). Für das Persönliche Budget haben sich überwiegend Personen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 entschieden; sie waren also amtlich als schwerbehindert anerkannt (vgl. Wacker 2009, S. 9).
Auch die Praxis beweist, dass alle behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen in der Lage sind, ihren Hilfebedarf als Geldleistung gewährt zu bekommen, auch wenn oft davon ausgegangen wird, dass das Persönliche Budget nur für Menschen mit leichten beziehungsweise mittelschweren Behinderungen gedacht sei.
„Persönliches Budget bedeutet auch: Umdenken, Umfühlen und Verstehen. Oft wird gedacht, dass das Persönliche Budget nicht für Menschen gedacht ist, die nicht ganz klar ihre eigenen Bedarfe entwickeln können und wissen, was sie benötigen. Das sind aber oftmals die Wenigsten.“ (Leitung)
Treffend erklärt Plagemann, dass die Gewährung der Leistungen als Persönliches Budget auch „…für schwerst- und mehrfach behinderte Menschen interessant sein (könnte)“ (Plagemann 2006, S. 174), da schwerst- und mehrfach behinderte Menschen in der Regel vielfältige Sozialleistungen erhalten, die als Trägerübergreifendes Budget schneller und zielgerichteter eingekauft werden können.
2.3.6 Berufsfelder des Persönlichen Budgets
Alle Leistungen zur Teilhabe nach dem SGB IX sind budgetfähig. Diese Teilhabeleistungen sind vielfältig und können beispielsweise in Form von Früherkennung und Frühförderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder, Sprach- und Beschäftigungstherapie, psychosozialer Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Arbeitsassistenz, aufsuchender sozialpädagogischer Betreuung, Begleitung zu Freizeitaktivitäten etc. erbracht werden (vgl. Trendel 2008, S. 38ff). Je nach Bedürfnissen und Bedarf des Einzelnen richtet sich die Betreuungsintensität von wenigen Wochenstunden in bestimmten Bereichen bis hin zur Rund-um-die-Uhr-Betreuung und kann in Form von ambulanter, teilstationärer oder stationärer Betreuung erbracht werden.
Die praktische Umsetzung des Persönlichen Budgets konzentriert sich bisher überwiegend auf den ambulanten Leistungsbereich der Eingliederungshilfe, wird aber in Zukunft als Leistungsanspruch in stationären Bereichen immer mehr thematisiert werden müssen (vgl. Wansing/Schäfers 2006, S. 18). Demzufolge werden sowohl ambulante als auch stationäre Institutionen sozialer Arbeit angehalten sein, individuelle Angebote zu formulieren, um sich auf der Anbieterlandschaft zu positionieren (vgl. Jahncke-Latteck/Rösner/Weber 2007, S. 89).
Vor diesem Hintergrund kann man davon ausgehen, dass sich in Zukunft immer mehr Unternehmen und Vereine gründen werden, die sich auf die Erbringung von Hilfebedarfen spezialisieren. Für Sozialpädagogen mit entsprechender Qualifikation eröffnen sich dadurch neue Berufsmöglichkeiten, indem sie beispielsweise als Einzelunternehmer die gewünschten Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Organisatorische und personelle Rahmenbedingungen müssen innerhalb eines Arbeitsvertrages schriftlich formuliert werden, um so ein Minimum an Klarheit im Bezug auf die Rechte und Pflichte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu schaffen (vgl. Trendel 2008, S. 57). Wie sich dies in der Praxis gestalten soll, wirft eine Menge Unsicherheit auf, da beispielsweise Haftungsfragen noch nicht gesetzlich klar geregelt wurden. Dies verdeutlicht folgende Aussage:
„Wie Sozialarbeiter innerhalb der Budgetassistenz agieren ist noch nicht geregelt. Es wird ein ganz neues Arbeitsfeld, man will loslegen die Budgetassistenten auszubilden, aber man muss wissen, was sie können müssen, wenn sie das begleiten. Wenn man mich fragt, Herr B., wollen Sie den Arbeitsvertrag machen, da hab ich echte Schwierigkeiten. Die Problematik ist, dass wenn er sie einstellt und er geht in die Klinik. Kann er sie entlassen, wer finanziert sie weiter, wie kann man das jetzt alles mit den arbeitsrechtlichen, gesetzlichen Bestimmungen in Einklang bringen. Das Arbeitsgericht interessiert es nicht, ob die Person behindert ist oder nicht, der Arbeitsvertrag ist das, was zählt. Das wird ein ganz heikler Punkt, ja“ (Betreuer)
Die neue professionelle Rolle wird in der Fachwelt konträr diskutiert. Hansen spricht davon, dass auf die Sozialarbeiter neue Herausforderungen zukommen werden, da zum einen die Risiken immer größer werden und zum anderen sie sich immer wieder den rasanten Veränderungen der einzelnen Sozialgesetzbücher und Veränderungen sonstiger Rahmenbedingungen stellen müssen (vgl. Hansen 2006, S. 22ff).
Sowohl für Mitarbeiter sozialer Institutionen als auch für selbstständige, sozialpädagogische Einzelunternehmer werden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen unumgänglich sein, damit sie die benötigte Beratungskompetenz glaubhaft anbieten können (vgl. Marcus 2008, S. 51; Liedke 2006, S. 14).
2.4. Selbstbestimmung und Teilhabe
Unter Selbstbestimmung versteht man die Einflussnahme auf wichtige Entscheidungen, die das Führen des eigenen Lebens betreffen. Es wird betont, dass die Selbstbestimmung nicht gelehrt werden kann, sondern von der betroffenen Person erfahren und erschlossen werden muss. Selbstbestimmung kann nicht zeitlich begrenzt gesehen werden. Es handelt sich um einen lebenslangen Prozess (vgl. Theunissen 2006, S. 31). Zudem ist die Selbstbestimmung immer als Interaktion im sozialen Gefüge und als nicht statisch zu betrachten (vgl. Theunissen 2003, S. 30).
Selbstbestimmung wird gelegentlich automatisch mit Wohlbefinden gleichgesetzt, kann allerdings zuweilen genau das Gegenteil bewirken, wenn eigenverantwortliche Entscheidungen zu einer persönlichen Überforderung führen. Folglich kommt es darauf an, nicht nur alleine die Selbstbestimmung zu fokussieren, sondern gleichfalls die Person im sozialen Netzwerk sowie die gewünschten Unterstützungsleistungen zu betrachten (vgl. Theunissen, S. 32). Dies ergänzt Hahn, indem er das menschliche Wohlbefinden mit der Bedürfnisbefriedigung gleichsetzt. Bedürfnisse können sowohl in größtmöglicher Unabhängigkeit oder selbstbestimmt in Abhängigkeit von anderen realisiert werden.
Die Rehabilitation hat sich zur Aufgabe gemacht, die Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu verringern und ihnen entgegenzuwirken (vgl. Frankenstein/Knobloch/Viernickel 2006, S. 8).
In der Rehabilitation wurde jahrzehntelang ein Augenmerk auf die Fürsorge und die Versorgung gelegt. Selbstbestimmung bedeutet gegenwärtig, dass Menschen die Wahl haben, eigene und individuelle Lebenskonzepte zu entwickeln.
„Im Persönlichen Budget sind Elemente der Mitbestimmung enthalten, aber da merke ich auch selber, dass Kollegen Sorgen haben, dass die Menschen überfordert sind, dass sie es ihnen nicht zutrauen. Das ist aber nicht das, was wir erfahren haben in der Mitwirkungsarbeit. Wir haben viel Engagement erfahren, viel Selbstbewusstsein und eher so, dass bei Menschen, die am meisten involviert sind in den Prozessen, die wenigsten Probleme auftreten und es am besten läuft.“ (Leitung)
Bei der Begrifflichkeit der Teilhabe unterscheidet man zwischen der Integration als ein Bestreben der Eingliederung des Menschens in die bestehende Gesellschaft und der Inklusion, die sich als Aufgabe setzt, bestehende Strukturen und Auffassungen dahin zu verändern, dass die Unterschiedlichkeit der Menschen zur Normalität wird.
Das Persönliche Budget versteht sich als eines der wichtigen Instrumente zur Förderung der Selbstbestimmung eines behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschens, da ihm dadurch neue Entscheidungsspielräume geschaffen werden, um nach individuellen Vorstellungen die notwendigen Unterstützungsleistungen eigenverantwortlich zu organisieren (vgl. Loeken 2006, S. 59).
Nach wie vor ist jedoch das wichtigste Instrument zur Förderung der Selbstbestimmung die Fähigkeit der „Profis“ und/oder Mitmenschen, die Willensäußerungen und Entscheidungen der Betroffenen wahrzunehmen und anzuerkennen, wie auch die Bereitschaft diese umzusetzen.
[...]
[1] Das sind Institutionen, Organisationen und Einrichtungen.
[2] Beispielsweise Träger der Sozialhilfe.
[3] Alltäglich bezieht sich auf die Anforderungen in Arbeit, Familie, Privatleben, Gesellschaft sowie des eigenen Lebensumfelds. Der Hilfebedarf kann darin bestehen diese Anforderungen individuell zu bewältigen und die eigenen Ressourcen zu erweitern. R egelmäßig wiederkehrend bedeutet, dass die Leistungen in feststellbaren Zeitabständen (z.B. täglich, wöchentlich etc.) anfallen und einen erkennbaren Rhythmus aufweisen. Regiefähig bedeutet, dass der Budgetnehmer alleine oder mit Unterstützung entscheiden kann, wer die Leistungen mit welchen Zielen und in welcher Zeit wo und wie ausführt. Dabei reicht es aus, dass auch nur einzelne Dimensionen regiefähig sind (vgl. Lachwitz, S. 35f).
[4] In Form von Betreutem Wohnen.
[5] In Form von Rehabilitationssport.
[6] In Form von Pflegesachleistungen.
[7] Freie Hansestadt Hamburg
[8] Mediziner, Psychologen, Sozialpädagogen oder auch Fachausschuss
[9] Wie beispielsweise Anforderungen an die Verwaltungskompetenz der Leistungsberechtigten.
[10] sogenannte seelische Behinderungen
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842803213
- DOI
- 10.3239/9783842803213
- Dateigröße
- 1.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Kiel – Soziale Arbeit und Gesundheit, Studiengang: Sozialwesen
- Erscheinungsdatum
- 2010 (September)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- persönliches budget betreuung ambulantisierung rehabilitation fachkräfte
- Produktsicherheit
- Diplom.de