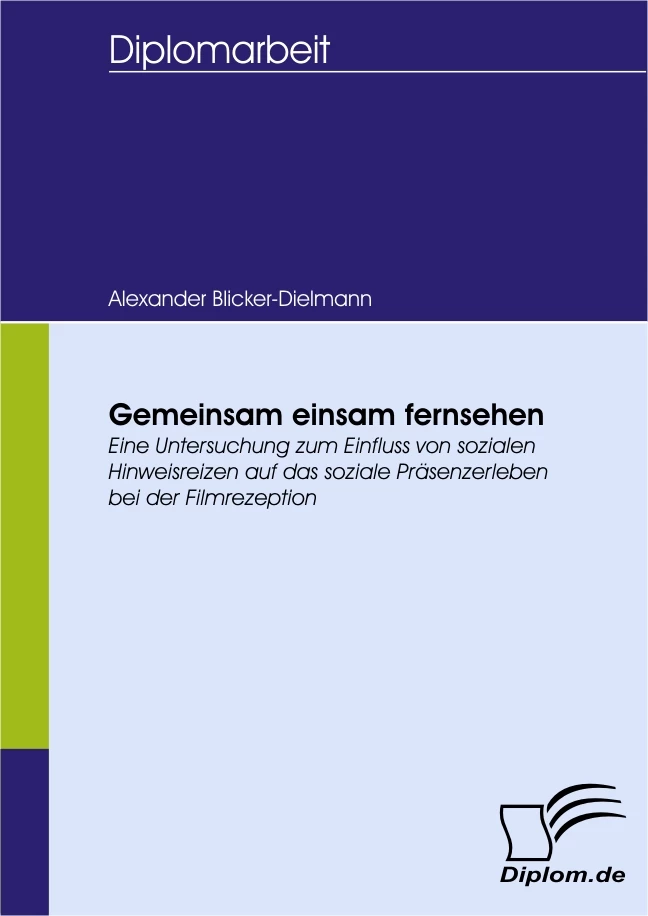Gemeinsam einsam fernsehen
Eine Untersuchung zum Einfluss von sozialen Hinweisreizen auf das soziale Präsenzerleben bei der Filmrezeption
Zusammenfassung
Die Auswertungen der ARD/ZDF-Onlinestudien von 2008 und 2009 bestätigen das Fernsehen als Leitmedium. Die intermedialen Nutzungsanteile verzeichnen sogar einen leichten Zuwachs von 40,5 Prozent im Jahr 2008 auf 41,5 Prozent in 2009. Neben dem Fernsehen erhöhte sich auch der Nutzungsanteil des Internets von 10,6 Prozent auf 13,1 Prozent. Gleichzeitig ergab sich eine erhöhte Nachfrage nach Videos im Netz. So nutzten 2009 62 Prozent der Online-User ab 14 Jahren bewegte Bilder im Internet. In 2008 waren es 55 Prozent. Nach dem Medienradar 2009 gaben 79 Prozent dieser Nutzer an, TV-Inhalte anzusehen. Interessant sind diese Ergebnisse vor dem Hintergrund, dass das Fernsehen viel stärker als andere Medien der Entspannung, der Ablenkung vom Alltag, dem Spaß und der Bewältigung von Einsamkeitsgefühlen dient. Gleichzeitig wird der soziale Nutzen der Fernsehrezeption in direkter Form als gemeinschaftliches Erleben und indirekt als Angebot von Themen für Anschlusskommunikationen betont. Es gibt allerdings auch Stimmen, die in dieser Entwicklung eine Gefahr sehen. Vincent Nichols, Erzbischof der römisch-katholischen Kirche von England, warnte im August 2009 im Online-Portal der Times:
Facebook and Myspace drive teens to suicide. . Skills such as reading a person´s mood and body language were in decline, and that exclusive use of electronic information had a ´dehumanising´effect on community life. . Among young people often a key factor in their committing suicide is the trauma of transient relationships. They throw themselves into a friendship or network of friendships, then it collapses and they´re desolate.
Auch wenn man die medienvermittelte Kommunikation nicht kausal für die Selbstmorde Jugendlicher verantwortlich machen kann, findet sich die Kritik doch auch in der Medienpsychologie wieder. So stellen Theorien und Modelle, die den defizitären Ansätzen zuzuordnen sind, gerade den negativen Aspekt des Verlusts an sozialen Hinweisreizen in den Vordergrund ihrer Betrachtung. Immer mehr Menschen unterhalten inzwischen Beziehungen über größere räumliche Distanz. Die Weiterentwicklung und zunehmende Verbreitung von Kommunikationstechnologien schafft hierfür die Voraussetzungen. Durch die Vereinzelung wird der soziale Nutzen der Fernseh-Rezeption von den Forschern des Social TV als gefährdet angesehen, insbesondere da das Fernsehen über keinen direkten Kommunikationskanal verfügt. Um den sozialen Nutzen des Fernsehens trotz dieser […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretischer Hintergrund
2.1 Begrifflichkeit und wissenschaftliche Verortung
2.2 Die Theorie der sozialen Präsenz
2.2.1 Begriffsbestimmung
2.2.2 Dimensionen und Ebenen von sozialer Präsenz
2.3 Das Modell rezeptionssituativer Publikumsvortellungen
2.3.1 Modellannahmen
2.3.2 Mediale Hinweise und subjektive Medientheorien
2.3.3 Publikumsvorstellungen
2.3.4 Effekte
2.4 Echte Kopräsenz als Referenzsituation
3. Forschungsfragen und Hypothesen
4. Methodik
4.1 Untersuchungsverlauf
4.1.1 Rekrutierung der Versuchsteilnehmer
4.1.2 Empfang und Einweisung der Probanden
4.1.3 Freiwilligkeit der Teilnahme und Vertraulichkeit der Daten
4.1.4 Erhebungsphase
4.1.5 Variationen des Experimentes (unabhängige Variable)
4.1.5.1 Kopräsenz-Bedingung
4.1.5.2 Feedback-Bedingung
4.1.5.3 Kontroll-Bedingung
4.2 Erhebungsmethoden
4.2.1 Messung von sozialer Präsenz (abhängige Variable)
4.2.2 Weitere Fragebogenerhebungen
4.2.3 Sliderrating, psychophysiologische Datenerhebung, Mimikerfassung
4.2.4 Technische Umsetzung
4.3 Auswahl des Filmmaterials
4.4 Verwendete Verfahren der Datenanalyse
5. Ergebnisse
5.1 Allgemeine Ergebnisse
5.2 Deskriptive Statistiken zu den Variablen
5.3 Häufigkeiten von Antwortverweigerungen („keine Angabe“)
5.4 Ergebnisse der Varianzanalyse (ANOVA)
5.5 Signifikante Ergebnisse
5.6 Zusammenfassung der Ergebnisse
6. Diskussion
6.1 Inhaltliche Diskussion
6.2 Methodenkritik
7. Ausblick
8. Zusammenfassung
9. Literaturverzeichnis
10. Abbildungsverzeichnis
11. Tabellenverzeichnis
12. Abkürzungsverzeichnis
13. Anhang
A Diagramme zur Telepräsenz
B Diagramme zur Sozialen Präsenz
C Materialien zur Rekrutierung
D Vorlage zur Slider-Beschriftung
E Auswertungen zum Pretest
F Film- und Szenenbeschreibungen
G Auswertungen zur Hauptuntersuchung
H Screenshots
I Einleitungstext: Kopräsenz und Kontrollgruppe
J Einleitungstext: Feedback: Smiley und Feedback: Kurve
K Fragebogen
1. Einleitung
Die Auswertungen der ARD/ZDF-Onlinestudien von 2008 und 2009 bestätigen das Fernsehen als Leitmedium. Die intermedialen Nutzungsanteile verzeichnen sogar einen leichten Zuwachs von 40,5 Prozent im Jahr 2008 auf 41,5 Prozent in 2009. Neben dem Fernsehen erhöhte sich auch der Nutzungsanteil des Internets von 10,6 Prozent auf 13,1 Prozent (vgl. Oehmichen & Schröter, 2009). Gleichzeitig ergab sich eine erhöhte Nachfrage nach Videos im Netz. So nutzten 2009 62 Prozent der Online-User ab 14 Jahren bewegte Bilder im Internet. In 2008 waren es 55 Prozent (vgl. Van Emmeren & Frees, 2009). Nach dem Medienradar 2009 gaben 79 Prozent dieser Nutzer an, TV-Inhalte anzusehen (vgl. Gerhards & Klinger, 2009). Interessant sind diese Ergebnisse vor dem Hintergrund, dass das Fernsehen „viel stärker als andere Medien der Entspannung, der Ablenkung vom Alltag, dem Spaß und der Bewältigung von Einsamkeitsgefühlen dient“ (vgl. Oehmichen & Schröter 2009). Gleichzeitig wird der soziale Nutzen der Fernsehrezeption in direkter Form als gemeinschaftliches Erleben und indirekt als Angebot von Themen für Anschlusskommunikationen betont (vgl. Harboe, Massey, Metcalf, Wheatley & Romano, 2007; vgl. Ducheneaut, Moore, Oehlberg, Thornton & Nickell, 2008).
Es gibt allerdings auch Stimmen, die in dieser Entwicklung eine Gefahr sehen. Vincent Nichols, Erzbischof der römisch-katholischen Kirche von England, warnte im August 2009 im Online-Portal der Times:
Facebook and Myspace drive teens to suicide. …. Skills such as reading a person´s mood and body language were in decline, and that exclusive use of electronic information had a ´dehumanising´effect on community life. …. Among young people often a key factor in their committing suicide is the trauma of transient relationships. They throw themselves into a friendship or network of friendships, then it collapses and they´re desolate (Gledhil, R. 2009).
Auch wenn man die medienvermittelte Kommunikation nicht kausal für die Selbstmorde Jugendlicher verantwortlich machen kann, findet sich die Kritik doch auch in der Medienpsychologie wieder. So stellen Theorien und Modelle, die den defizitären Ansätzen zuzuordnen sind, gerade den negativen Aspekt des Verlusts an sozialen Hinweisreizen in den Vordergrund ihrer Betrachtung (vgl. Döring, 2003; Rüggenberg 2007). Immer mehr Menschen unterhalten inzwischen Beziehungen über größere räumliche Distanz. Die Weiterentwicklung und zunehmende Verbreitung von Kommunikationstechnologien schafft hierfür die Voraussetzungen. Durch die Vereinzelung wird der soziale Nutzen der Fernseh-Rezeption von den Forschern des Social TV als gefährdet angesehen, insbesondere da das Fernsehen über keinen direkten Kommunikationskanal verfügt. Um den sozialen Nutzen des Fernsehens trotz dieser Entwicklung zu gewährleisten, wird vorgeschlagen, das Fernsehen mit der computervermittelten Kommunikation (cvK) zu verbinden und somit eine Verbindung zwischen den Rezipienten zu ermöglichen (vgl. Harboe et al., 2007; Ducheneaut et al., 2008). Daraus ergibt sich die Frage, ob die computervermittelte Information ausreicht, um ein vergleichbar soziales Erleben im Sinne der gemeinschaftlichen Fernsehrezeption zu schaffen.
Das Konzept des Social TV geht von einem Gemeinschaftserleben über das Verbundenheitsgefühl zwischen den Rezipienten aus. Die vorliegende Studie geht der Frage nach, ob ein computervermittelter Hinweisreiz zum affektiven Erleben des Mitpublikums eine Verbundenheit im Sinne der Theorie der sozialen Präsenz bewirkt. Sollte dies gelingen, wäre dies ein erster Schritt, die räumlich zunehmend isoliert stattfindende Film- und Fernsehrezeption sozialer zu gestalten.
Diese Untersuchung leistet also einen Beitrag zur Rezeptionsforschung. Der Fokus liegt dabei ebenfalls auf der Filmrezeption als Gemeinschaftserlebnis. Darüber hinaus leistet sie einen Beitrag zur Publikumsforschung, indem sie der Frage nachgeht, ob soziale Hinweisreize ausreichen, um die Vorstellung eines Mitpublikums im Sinne des Modells rezeptionssituativer Publikumsvorstellungen und damit ein Gefühl von sozialer Präsenz auszulösen.
Im theoretischen Teil dieser Untersuchung wird in einem ersten Schritt der zugrundeliegende Kommunikationsbegriff bestimmt und eine Anbindung an verschiedene Forschungsdisziplinen vorgenommen (2.1). In einem zweiten Schritt wird die Rezeptionssituation näher betrachtet. Neben unterstützenden Theorieverweisen wird dabei hauptsächlich auf die aus der computervermittelten Kommunikation stammende Theorie der sozialen Präsenz (2.2) sowie das Modell rezeptionssituativer Publikumsvorstellungen (2.3) zurückgegriffen. In einem ersten Ergebnis werden Hypothesen aufgestellt, die Aussagen über die Salienz (Taylor & Fiske, 1978) von Zuschauervorstellungen bzw. das Empfinden sozialer Präsenz bei der Filmrezeption im Zusammenhang mit sozialen Hinweisreizen treffen (3). Im anschließenden empirischen Teil wird der Untersuchungsverlauf beschrieben (4.1). In diesem Kontext werden die Variationen des Experiments, also die unabhängige Variable ausgearbeitet (4.1.5). Es folgt eine Erläuterung der Erhebungsmethoden (4.2) mit einem Schwerpunkt auf der Messung von sozialer Präsenz als abhängige Variable (4.2.1). Anschließend wird auf die Bestimmung des Stimulusmaterials (4.3) sowie auf die verwendeten statistischen Verfahren (4.4) näher eingegangen. In einem letzten Schritt werden die empirischen Ergebnisse dargestellt (5), diskutiert (6) und ein sich daraus ableitender Ausblick auf weitere Forschungsfragen gegeben (7).
2. Theoretischer Hintergrund
2.1 Begrifflichkeit und wissenschaftliche Verortung
In ihrer Definition von medialer Kommunikation als sozialer Kommunikation formuliert Lindner-Braun (2007) drei hinreichende Kriterien:
(1) Der Informationsaustausch zwischen Sender und Empfänger findet über Symbole statt.
(2) Der Transport der Signale erfolgt über ein technisches Medium
(3) Die Informationsabgabe des Senders ist intendiert und wird vom Empfänger auch als intendiert wahrgenommen.
Alle drei Kriterien entsprechen der Untersuchungssituation der vorliegenden Studie. Die Informationsabgabe des Senders ist intendiert und vom Empfänger als intendiert wahrgenommen. Auf die Fragestellung übertragen bedeutet das: Wenn die Kommunikation eines Mitpublikums über ein Symbol wahrgenommen wird, kann auch hier von einer sozialen Kommunikation gesprochen werden. Wenn sich die Affektvermittlung als präsenzauslösend bestätigt und damit eine soziale Kommunikation stattfindet, öffnet dies die hier vorliegende Fragestellung den Theorien und Konzepten der Mediensoziologie.
Die Vorstellung, dass ein Mitpublikum Einfluss auf das Verhalten hat, findet sich auch in der Theorie der Schweigespirale (vgl. Haferkamp, 2008). In den Versuchen, diese
Theorie bzw. Teilaspekte der Theorie empirisch zu prüfen, zeigte sich, dass die Ausgestaltung der Einflussnahme eines vagen Mitpublikums in Form einer vorgestellten Mehrheit nicht konkretisiert werden konnte (vgl. Noelle-Neumann, 1973; Noelle-Neumann, 1992; Fuchs, Gerhards & Neidhardt, 1992). Hier bietet einerseits das Modell rezeptionssituativer Publikumsvorstellungen einen Anknüpfungspunkt, aber auch die Theorie der sozialen Präsenz könnte ein Ansatz sein, um diese offen geblieben Fragen zu schließen und die Theorie einer fruchtbareren empirischen Überprüfung zuzuführen. In diesem Fall wäre eine Anbindung an makrosoziologische Fragestellungen gegeben.
Bente, Krämer und Petersen (2002) verbinden das Vorliegen eines sozialen Präsenzempfindens mit der Anwendung verschiedener sozial-psychologischer Modelle.
Da der Frage nachgegangen wird, wie man von einem anonymen Massenpublikum, das sich einer massenkommunikativen Aussage zuwendet, zum Erleben eines Gemeinschaftsgefühls bei dem einzelnen Rezipienten gelangt, erscheint der Blickwinkel auf das massenmediale Mitpublikum notwendig.
Entsprechend der Systematisierung der Medienwissenschaften nach der Lasswellschen Formel „Who says what in which channel to whom with what effect“ behandelt die hier vorliegende Studie die Rezeptionssituation und hat damit Relevanz für die Rezeptionsforschung sowie die Publikumsforschung und entsprechend der Definition von sozialer Kommunikation auch einen Anknüpfungspunkt an die Mediensoziologie. Der Schwerpunkt liegt jedoch bei der Medienpsychologie, da über die Theorie der sozialen Präsenz und dem hier angewandten Instrumentarium die kognitiven Aspekte des Rezeptionserlebens in den Vordergrund gestellt werden.
2.2 Die Theorie der sozialen Präsenz
2.2.1 Begriffsbestimmung
Der Präsenz-Begriff umfasst ursprünglich das Bewusstsein bzw. das Erleben der eigenen Existenz eines Individuums in der Welt, die von diesem Subjekt auch als existierend angenommen wird. Um dieses Bewusstsein aufrecht zu erhalten, ist das Individuum von Geburt an damit beschäftigt, sich der eigenen bzw. der Existenz seiner Umwelt zu vergewissern, denn ein grundlegendes Bedürfnis der Menschen ist, sich selbst in einer relevanten Umgebung ständig zu bestätigen, die eigene Identität zu definieren. Der Ursprung jeglicher sozialer Kommunikation besteht in der Selbstvergewisserung (vgl. Heeter, 1992; Rüggenberg 2007). Der soziale Kontakt zu anderen Individuen stellt somit ein essenzielles Bedürfnis des Menschen dar. Die Grundlage für die Erfüllung dieses Bedürfnisses bildet „die wahrgenommene, erlebte und gefühlte Anwesenheit anderer Menschen“ (Rüggenberg, 2008, S. 318). In diesem Zusammenhang kann man von sozialer Präsenz als einem subjektiven Erleben der eigenen Existenz innerhalb einer sozialen Umgebung sprechen (vgl. Blascovich, 2002; Rüggenberg, 2007).
Medienpsychologischer Untersuchungsgegenstand wurde die soziale Präsenz, nachdem mehr und mehr medienvermittelte Kommunikationssituationen an Bedeutung gewannen. Im Vergleich zu Face-to-Face-Situationen, in denen eine totale Präsenz vorhanden ist, stehen in der medienvermittelten Kommunikationssituation nur begrenzt Informationen über den jeweils anderen zur Verfügung. Es bildeten sich zwei theoretische Strömungen heraus. Während die eine das Defizitäre der computervermittelten Kommunikation betont und die Face-to-Face-Situation als das Optimum darstellt, liegt der Fokus der Anderen auf der Kompensation des Defizits. Auf beide Strömungen soll hier kurz eingegangen werden, da sie sich beide mit einem sozialen Präsenzerleben beschäftigen und dabei jeweils eine Perspektive ergreifen, die für die vorliegende Untersuchung berücksichtigt werden muss.
Bei den Vertretern des Defizit-Ansatzes besteht das Optimum der Face-to-Face-Situation im potenziellen Einsatz der fünf menschlichen Sinne, d. h. der auditiven, visuellen, olfaktorischen, haptischen und gustatorischen Wahrnehmung der sozialen Welt. Medienvermittelte Kommunikation bedeutet immer einen Ausschluss von Sinnesmodalitäten in der interpersonellen Kommunikation. In diesem Ansatz wird aufgrund dieser Kanalreduktion von einer ärmeren bis hin zu entmenschlichter Kommunikation gesprochen (vgl. Döring, 2003; Rüggenberg, 2007). Die Vertreter der so genannten Filtermodelle heben besonders den Verlust von sozialen Hinweisreizen hervor, d. h., es fehlen wichtige nonverbale und paralinguistische Informationen im Vergleich zur Face-to-Face-Situation (vgl.Döring, 2008; Walther & Parks, 2002). Das Fehlen sozialer Hinweisreize behindert auf der einen Seite den Kommunikationsfluss, da mehr kommunikativer Aufwand nötig ist, um eine Interaktion zu gewährleisten. Auf der anderen Seite führt der reduzierte Kenntnisstand auch zu einem höheren Grad an Anonymität und damit zu einer niedrigeren Hemmschwelle in der Kommunikation. Dies kann positive Auswirkungen haben in Bezug auf eine größere Offenheit, da aufgrund der verringerten Information auf Kommunikator- wie Rezipientenseite weniger Zwänge vorliegen können. Es kann aber auch aufgrund geringerer Verantwortungsübernahme zu einem devianten Kommunikationsverhalten (Flaming-Verhalten) führen. Die häufig angebrachte Kritik an diesem Ansatz ist vor allem auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Befundlage oft sehr konträr zu sein scheint, die Sachlage vermutlich also komplexer ist, als bisher angenommen wird, und insgesamt die mediierte Situation aus einer Perspektive betrachtet wird, die zu technik-deterministsich ausgerichtet ist (vgl. Rüggenberg, 2007).
Im Gegensatz zum defizitären Ansatz, der den Informationsverlust betont, heben die Vertreter des kompensatorischen Ansatzes die Chancen der Konstruktion von Innovationen (z.B. Emoticons, Aktionswörter) bzw. der Entwicklung neuer sozialer Fertigkeiten hervor, um den Informationsverlust auszugleichen, wie dies zum Beispiel im Social Information Processing Modell (SIP) untersucht wird (vgl. Rüggenberg, 2007; Walter & Parks, 2002; Walther, 1992). Betont wird der Zeitaspekt, d. h., je länger Nutzer mit der restriktiven Situation umgehen müssen, umso größer ist die Chance für Ersatzinnovationen mit dem Ziel, dass sich die Unterschiede zwischen der computervermittelten Kommunikation (cvK) und der Face-to-Face-Situation angleichen (vgl. Rüggenberg, 2007; Walter & Parks, 2002; Walther 1992). Darüber hinaus könne davon ausgegangen werden, dass „CMC-Interaktionen sich sogar als freundlicher, sozialer und vor allem intimer gestalten können als in FtF-Situationen“ (Rüggenberg, 2007, S. 91) und damit zu einem größeren Gefühl von Entspannung und Selbstzufriedenheit führen (vgl. Rüggenberg, 2007). Weitere Variablen für dieses positive Rezeptionserleben sind beziehungs- und kontextbedingte Faktoren. So spielen bspw. die Erwartung zukünftiger Interaktion eine Rolle, vorherige Interaktionserfahrungen, Einstellungen gegenüber der verwendeten Technologie sowie empathische Fähigkeiten (vgl. Döring, 2003; Rüggenberg, 2007). Die Sichtweise des kompensatorischen Ansatzes betont analog zum symbolischen Interaktionismus bzw. analog zum dynamisch-transaktionalen Ansatz von Früh die Rezipientenperspektive im Sinne der Notwendigkeit, Bedeutung zu konstruieren (vgl. Früh, 2001; Krotz, 2001). Insbesondere wird dies im Simulations-/Imaginationsansatz deutlich, da hier nicht nur eine Face-to-Face-Situation kompensiert wird, sondern eine neue Realität konstruiert wird (vgl. Rüggenberg, 2007). Der defizitäre Ansatz setzt den Schwerpunkt auf die technische Seite der computervermittelten Kommunikation und unterscheidet in mehr oder weniger reichhaltige Kommunikationstechnologien. Dagegen betont der kompensatorische Ansatz den Einfluss der Nutzereigenschaften auf das kommunikative Geschehen. Somit liefern beide Ansätze einen Beitrag dazu, die mediierte Interaktion zu verstehen. Rüggenberg (2008) weist darauf hin, dass die Gemeinsamkeit beider Ansätze darin liege, dass ein soziales Präsenzerleben als positiv angesehen werde und dass computervermittelte Kommunikation (cvK) dieses Präsenzerleben fördern solle (vgl. auch Biocca et al., 2003). Problematisch sei jedoch, dass unterschiedliche Ansätze den Begriff der sozialen Präsenz unterschiedlich definierten und konzeptualisierten (vgl. Rüggenberg, 2008).
Der Begriff der sozialen Präsenz wurde erstmalig bei Short, Williams & Christie (1976) definiert, und zwar als Qualitätseigenschaft eines Kommunikationsmediums. Soziale Präsenz ist demnach „the degree of salience of the other person in the interaction and the consequent salience of the interpersonal relationships“ (Short, Williams & Christie, 1976, S. 65). Die Ergebnisse ihrer Studien zeigten, dass der Grad an sozialer Präsenz zwischen den Medien variiert. Die Variationen bestimmten die Art und Weise, wie Individuen interagieren. Dabei sei sich jeder Nutzer eines Kommunikationsmediums dessen Grads an sozialer Präsenz bewusst und vermeide dementsprechend, je nach Kommunikationsabsicht, bestimmte Interaktionstypen. Der Nutzer richte seine Interaktion nach dem Grad der zur Verfügung stehenden Präsenzqualität des Mediums aus. Die Fähigkeit, nonverbale Informationen und paralinguistische Hinweisreize zu vermitteln, bestimmten also den Grad der sozialen Präsenz eines Kommunmikationsmediums, wobei das Individuum die Bedeutung der einzelnen Faktoren für die Kommunikation individuell gewichte. Daher sei die soziale Präsenz kein objektives Qualitätsmerkmal des Mediums, obwohl sie von den objektiven Eigenschaften des Mediums abhänge, sondern eine subjektive Qualitätseigenschaft. Um den Einfluss von Telekommunikationsmedien auf das Verhalten ihrer Nutzer zu verstehen, sei es wichtig zu wissen, wie die Nutzer das Medium wahrnehmen, was sie dabei fühlten und wie ihre persönliche Einstellung zu dem Medium sei (vgl. Short, Williams & Christie, 1976). Short, Williams und Christie schlagen ein semantisches Differential zur Bestimmung von sozialer Präsenzeigenschaft eines Mediums vor: „...Social Presence factor is typically marked by scales such as unsociable – sociable, insensitive – sensitive, cold – warm and impersonal – personal“ (Short, Williams & Christie, 1973, S. 66). Sie leiten anhand dieser bipolaren Items eine Soziale-Präsenz-Skala ab, auf der sich unterschiedliche Medien einordnen lassen. Im Ergebnis erreicht die Face-to-Face-Situation den höchsten Wert, gefolgt vom Video. Andere Medien, die aufgrund ihrer reduzierten Kommunikationskanäle weniger Sinne ansprechen, erreichen einen geringeren Grad an sozialer Präsenz. Die Reichhaltigkeit an Aktivierungsmöglichkeiten von Sinnesmodalitäten durch die Kommunikation mit dem jeweiligen Medium bestimme also das subjektive Präsenzerleben. Dieser Gedanke wurde und wird weiter ausgearbeitet in den defizitären Ansätzen, insbesondere in der Media Richness Theorie (vgl. Daft, & Lengel, 1984; Fischer, 2008; Kock, 2005; Mühlenfeld, 2004). In dieser Theorie wird die Medienwahl in Abhängigkeit von der Komplexität der Kommunikationsaufgabe und der Reichhaltigkeit der zur Verfügung stehenden Medien modelliert. Betont wird, dass ein Zuviel an Informationen, die durch das Medium vermittelt werden, je nach Aufgabe, eine effektive Kommunikation ebenso erschweren würde wie durch ein Zuwenig an Information. Auch in der Definition von (Tele)Präsenz durch Steuer (1992) stehen technische Merkmale im Vordergrund. Er ordnet die Telepräsenz zwei Grunddimensionen zu: der Lebendigkeit (vividness) sowie der Interaktivität (interactivity), die das mediale System ermöglicht (Anlage A.1; vgl. Bente, Krämer & Petersen, 2002; Steuer, 1992). Dabei meint die Lebendigkeit „the representational richness of a mediated environment as defined by his formal features, that is the way in which an environment presents information to the senses“ (Steuer, 1992, S.81). Die Lebendigkeit des Mediums wird wiederum bestimmt von den Möglichkeiten an Sinneserfahrungen, konkreter durch die Anzahl gleichzeitig erlebbarer Sinnesmodalitäten. Als zweiter Faktor bestimmt die Tiefe des jeweiligen sensorischen Erlebens die Lebendigkeit (vgl. Bente, Krämer & Petersen, 2002; Steuer, 1992). Die Interaktivität definiert Steuer als „the extent to which users can participate in modifying the form and content of a mediated environment in real time“ (Steuer, 1992, S.84). Diese Dimension wird von drei Faktoren bestimmt: der Geschwindigkeit „which refers to the rate at which input can be assimilated into the mediated environment“ (Steuer, 1992, S.85), der Anzahl der Handlungsmöglichkeiten in der medialen Umgebung sowie der Abbildungsmöglichkeiten von Veränderungen in einer möglichst natürlichen und vorhersagbaren Art und Weise (vgl. Bente, Krämer & Petersen, 2002; Steuer, 1992). Innerhalb der genannten Dimensionen lassen sich alle Medien klassifizieren, wobei das Ideal eine jeweils höchste Ausprägung beider Dimensionen umfasst. Eine Klassifikation verschiedener Medien nach den Dimensionen Lebendigkeit und Interaktivität findet sich im Anhang (Anhang A.2). Ein Höchstmaß an Lebendigkeit und Interaktivität führt dazu, dass eine perfekte, gleichzeitig utopische Illusion von Realität erzeugt wird. Ein Beispiel für dieses Ideal könnte die virtuelle Umgebung sein, wie sie in der amerikanischen Serie Star-Treck gezeigt wird, das so genannte Holodeck (Anhang A.2; vgl. Bente, Krämer & Petersein, 2002; Steuer, 1992).
In anderen Definitionen wird die Zuschreibung von sozialer Präsenz als feste Eigenschaft eines Mediums aufgehoben. Carrie Heeter (1992) bezieht zum Beispiel im Zusammenhang mit der Untersuchung virtueller Welten den Begriff der sozialen Präsenz auf das Ausmaß, in welchem andere Wesen (lebende oder artifizielle) in der jeweiligen Welt existieren und auf das Individuum zu reagieren scheinen. Denn das subjektive Gefühl des Individuums, mit jemandem in Kontakt zu sein, der an seine Existenz zu glauben scheint, erlaubt ihm eine Selbstvergewisserung seiner Existenz. Damit kann das Gefühl des „being together“ zwar vom Medium beeinflusst sein, ist jedoch keine feste Eigenschaft des Mediums selbst (vgl. Rüggenberg, 2007).
Eine nutzerbezogene Definition von sozialer Präsenz findet sich auch bei Blascovich (2002) in seiner Untersuchung eines Schwellenmodells für sozialen Einfluss im Rahmen von virtuellen Umgebungen: „... we define social presence as a psychological state in which the individual perceives himself or herself as existing within an interpersonal environment“ (Blascovich, 2002, S. 130).
Biocca und Harms (2002) definieren soziale Präsenz explizit als Eigenschaft von Menschen und nicht von Technologien (vgl. Biocca & Harms, 2002). Rüggenberg versteht unter sozialer Präsenz „das sozio-emotionale Erleben, sich der Anwesenheit eines anderen Menschen auch in mediierten Kommunikationssettings bewusst zu sein“ (Rüggenberg, 2008, S. 318). Beide Definitionen entfernen sich also noch mehr vom Technikbezug des Begriffs der sozialen Präsenz und verorten das Präsenzerleben „als aktiven psychologischen Wahrnehmungs- und Erlebnisprozess seitens des Nutzers“ (Rüggenberg, 2007, S. 101) ganz im Individuum, wobei das Medium lediglich als Einflussgröße betrachtet wird. Diese Sichtweise thematisiert unter anderem auch individuelle Persönlichkeitseigenschaften der Nutzer, Inhalt und Ziel der Interaktion sowie die individuelle Erfahrung im Umgang mit modernen Kommunikations-technologien. Die Auffassung von sozialer Präsenz als einem komplexen psychologischen Prozessgeschehen innerhalb des Nutzers, das von den unterschiedlichsten Faktoren beeinflusst werden kann, führt jedoch zu definitorischen Divergenzen. Rüggenberg unterscheidet vier Subkonzeptionen, die sich aus der jeweiligen Schwerpunktsetzung der in diese Thematik involvierten Forscher ergeben: soziale Präsenz als Co-Präsenz, als kognitive und sozio-emotionale Beteiligung, als Verhaltensabhängigkeit und als reziproken Prozess. Zwar würden die sich daraus zwangsläufig ergebenden Konstruktdivergenzen zunehmend kritisiert, jedoch ließen sich erste Bestrebungen zu integrativeren Ansätzen erkennen. Als ein Beispiel dafür nennt Rüggenberg die theoretischen Überlegungen von Biocca, Harms und Gregg (2001), deren Ziel das Auffinden komplexerer Wirkungszusammenhänge zwischen den einzelnen Subaspekten isei, die zwar theoretisch bereits angedacht, jedoch empirisch noch nicht belegt worden seien (vgl. Rüggenberg, S. 319).
Für die vorliegende Untersuchung ist der Begriff der sozialen Präsenz, wie ihn Biocca und Harms (2002a) definieren relevant, nämlich als „the moment-to-moment awareness of Copresence of a mediated body and the sense of accessibility of the other being´s psychological, emotional, and intentional states“ (Biocca & Harms, 2002a, S. 10). Die soziale Präsenz bezieht sich auf medial vermittelte Information, ist dabei jedoch keine Eigenschaft der Technologie, sondern von Menschen. Der Zustand der sozialen Präsenz verändert sich im Verlauf einer medialen Interaktion. Biocca und Harms unterscheiden dabei drei Ebenen: Die unterste Stufe umfasst lediglich das Bewusstsein über die Mitanwesenheit eines Anderen, eine wechselseitige vage Vermutung über seine inneren Zustände und eine grundlegende reziproke Zuordnung von Identität, Empfindungs-vermögen und Aufmerksamkeit. Eine mittlere Stufe ist gekennzeichnet durch ein wachsendes Gefühl für die Zugänglichkeit des jeweils Anderen, welches als ein zunehmendes psychologisches Involvement (vgl. Schwab, 2008) wahrgenommen wird. Der Nutzer hat das Gefühl, einen größeren Zugang zu den intentionalen, kognitiven und affektiven Zuständen des Anderen zu haben. Die höchste Stufe, die Stufe der sozialen Interaktion, ist geprägt von wechselseitiger Zugänglichkeit im Sinne einer wechselseitigen Aufmerksamkeit, eines wechselseitigen umfassenden Verständnisses, im Sinne von geteilten emotionalen Zuständen und interdependentem Verhalten. (Biocca & Harms, 2002a; Bente, Krämer & Petersen, 2002, Rüggenberg, 2007)
2.2.2 Dimensionen und Ebenen von sozialer Präsenz
In Erweiterung der oben genannten Definition ordnen Biocca und Harms den drei Stufen des „sense of being together“ (Biocca & Harms, 2002a, S. 12) verschiedene Dimensionen zu:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Ebenen und Dimensionen von Sozialer Präsenz (nach Biocca & Harms, 2002, S.12)
Ein „sensorischer Eindruck der Anwesenheit des Gegenübers an demselben Ort“ (Bente, Krämer & Petersen, 2002, S. 19) kennzeichnet die unterste Ebene. Diese schließt die Vorstellung eines wechselseitigen Bewusstseins von Kopräsenz ein (vgl. Biocca & Harms, 2002a). Bereits Goffman (1963) unterscheidet zwei Momente der Kopräsenz, zum einen das Bewusstsein eines Individuums, andere wahrzunehmen, und zum anderen umgekehrt bewusst wahrgenommen zu werden. Während Goffmans Aussagen sich auf den physischen Raum sowie physische Personen beziehen, fokussiert die Theorie der sozialen Präsenz auf medienvermittelte Repräsentationen des jeweils Anderen.
Das Vorhandensein von Kopräsenz ist nach Biocca und Harms eine notwendige, jedoch noch keine hinreichende Bedingung für soziale Präsenz. Die bloße Wahrnehmung eines lebendigen Anderen reiche nicht aus. Aus einer evolutionspsychologischen Perspektive ergebe sich für das Überleben die Notwendigkeit, andere Individuen nicht nur wahrzunehmen, sondern auch deren Verhalten vorherzubestimmen. Daher habe sich die Fähigkeit, die Absichten eines Anderen zu modellieren, als evolutionärer Vorteil erwiesen. Dies beschreibt die nächste Stufe sozialer Präsenz, die subjektive Ebene, auf welcher der jeweils Andere als eigenständige Intelligenz wahrgenommen und sein mögliches Verhalten simuliert wird (vgl. Biocca & Harms, 2002; Bente et al., 2002). Dabei unterscheiden Biocca und Harms vier Dimensionen, die auf einander bezogenes Verhalten, wahrgenommenes Verständnis, die wahrgenommene auf einander bezogene Emotionalität und die wechselseitige aktive Bereitschaft zur Aufmerksamkeit umfassen. In Erweiterung zur Kopräsenz geht dies über ein gegenseitiges Bewusstsein der Anwesenheit des jeweils Anderen hinaus. Um ein Bild von den intentionalen Zuständen des Anderen herzustellen, braucht es eine gesteigerte Aufmerksamkeit auf umfassendere Hinweisreize (a ttentional engagement). Die aktive Aufmerksamkeit entspricht dabei einem Gespür des Nutzers für die eigene mentale Anstrengung, um ein Bild des medienvermittelten Anderen zu erzeugen.
Die Fähigkeit, die emotionale Qualität der Wahrnehmung eines Anderen zu verstehen, ist nach Biocca und Harms (2002) eine notwendige Voraussetzung, um eine Verbindung mit einer anderen Person einzugehen und aufrechtzuerhalten. Die wahrgenommene emotionale Interdependenz werde immer ausgelöst, wenn Emotionen zwischen Individuen ausgelöst würden. Unter Empathie verstehen Biocca und Harms „the imaginative intellectual and emotional participation in another person’s experience“(Biocca & Harms, 2002a, S.22). Es gibt individuelle Unterschiede in der Fähigkeit zur Empathie. Je ausgeprägter die Empathiefähigkeit ist, umso stärker sind empathische Reaktionen auf medienvermittelte emotionale Hinweisreize des jeweils Anderen.
Das wahrgenommene Verständnis kann definiert werden als der Grad, mit dem der Beobachter meint, Einsicht in die Intentionen, Motivationen und Gedanken des Anderen zu haben. Die Autoren betonen, dass es sich um ein wahrgenommenes Verständnis (perceived understanding) handelt, denn obwohl der Nutzer seine Vorstellungen als objektiv wahr ansehe und sie im Rahmen der Kommunikation überprüfe, handele es sich nur um die „ illusion of access to the others meaning“ (Biocca & Harms, 2002, S. 23). Die Intensität der Zugangsillusion hänge von der wahrgenommenen Interaktionsstärke ab. Nach Biocca und Harms beinhaltet die wahrgenommene Interaktion auch nicht-bewusste Nachahmungshandlungen und Reaktionen, wie bspw. die emotionale Ansteckung (emotional contagion) (vgl. Hatfield, Cacioppo & Rapson, 1993).
Die höchste Stufe sozialer Präsenz, die intersubjektive Ebene, betont noch stärker die Wechselseitigkeit von Interaktion (behavioral interdependence). Dies impliziert, dass der jeweilige Kommunikationspartner weiß, dass er Teil eines mentalen, subjektiven Modells des anderen ist. Beide wissen darüber hinaus auch, dass diese Information, nämlich das Wissen, Bestandteil eines mentalen Modells des anderen zu sein, vom anderen erkannt wird. Die mentalen Modelle beruhen jeweils auf Informationen über den anderen. Das Ausmaß von Bewusstheit, Aufmerksamkeit und Verständnis, das die Kommunikationspartner für die Wahrnehmung des jeweils anderen aufbringen, kann jedoch individuell oder situationsbedingt unterschiedlich sein und zu einem Ungleichgewicht in der Interaktion und damit zu einem Ungleichgewicht im sozialen Präsenzgefühl führen (vgl. Biocca & Harms, 2002a; Goffman, 1963). Diese Ausführungen, die sich auf Face-to-Face-Situationen beziehen, waren notwendig, um die Interaktionen in computervermittelten Kontexten verstehen und entsprechende Messinstrumente entwickeln zu können.
In ihrer Anwendung auf computermediierte Kontexte unterscheiden Biocca und Harms zwischen Within-Interactant -Symmetrie und Cross-Interactant- Symmetrie. Eine grafische Veranschaulichung findet sich im Anhang (Anhang B.1 und B.2). Die Within-Interactant -Symmetrie (Anhang B.1) ist der Grad von Symmetrie bzw. Zusammenhang zwischen dem Gefühl von sozialer Präsenz des Nutzers (A) im Verhältnis zu seiner Wahrnehmung des sozialen Präsenzgefühls seines Partners (B). Da beides, sowohl die eigene Vorstellung von sozialer Präsenz (A(A)) als auch die wahrgenommene soziale Präsenzempfindung des Anderen (A(B)), Wahrnehmung und Vorstellung einer Person (A) sind, kann dies als subjektive Einschätzung über einen Fragebogen gemessen werden. Diese Symmetrie ist für die eigene Einschätzung einer erfolgreich geführten Interaktion wichtig. Wenn ein Interagierender davon ausgeht, dass die Wahrnehmung des Anderen von ihm selbst mit seiner eigenen Vorstellung von sich selbst übereinstimmt, kann er von einer gelungenen Interaktion im Sinne eines gegenseitigen übereinstimmenden Verstehens ausgehen (vgl. Biocca & Harms 2002a). Je höher die Symmetrieeinschätzung ist, umso größer ist das Gefühl des Verstanden-worden-Seins und um so eher besteht der Eindruck einer erfolgreich geführten Interaktion. Eine erfolgreich geführte Interaktion ist ein Hinweis darauf, dass der medial vermittelte Austausch den Anforderungen an die Interaktion genügt. An dieser Stelle impliziert dies ein starkes soziales Präsenzempfinden.
Die Cross-Interactant -Symmetrie (Anhang B.2) ist der Grad von Übereinstimmung zwischen der Vorstellung der eigenen sozialen Präsenzwahrnehmung (A(A)) und der Vorstellung dieser sozialen Präsenzwahrnehmung durch den Anderen (B(A)). Bei der Messung der Cross-Interactant -Symmetrie genügt es nicht, nur eine Person zu befragen, da es um die subjektive Einschätzung beider Interagierender zum selben Gegenstand geht. Beide Einschätzungen müssen getrennt erhoben und mit einander verglichen werden. Das Gefühl von sozialer Präsenz zwischen zwei Individuen, die medienvermittelt interagieren, bedarf also nicht nur einer ähnlichen Aufmerksamkeit für einander, sondern darüber hinaus eines ähnlichen emotionalen wie intentionalen Zustands. Durch das Entschlüsseln des Interaktionsinhaltes, wie er im Kontext des Erlebenszustandes des jeweils Anderen erscheint, wird ein gewisses Maß an Nähe und Verständnis erreicht (vgl. Biocca & Harms, 2002a) und damit ein Gefühl von Gemeinschaft bzw. sozialer Präsenz.
2.3 Das Modell rezeptionssituativer Publikumsvortellungen
2.3.1 Modellannahmen
Haben die bisherigen Ausführungen die Situation computermediierter Interaktionen beschrieben und die Möglichkeiten genannte, wie hierbei ein Gefühl der sozialen Präsenz, also der Gemeinschaft entstehen kann, tritt nun die Situation, in der Filmrezeption stattfindet, in den Fokus. Dohle und Hartmann beschreiben in ihrem Modell die Umstände, unter denen sich Rezipienten Vorstellungen von ihrem Mitpublikum machen und welche Auswirkungen diese auf ihr Rezeptionserleben haben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Model rezeptionssituativer Publikumsvorstellungen (nach Hartmann & Dohle, 2005)
Das Massenpublikum (besser wäre aufgrund der unterschiedlichen Medienangebote und Medieninteressen von Massenpublika zu sprechen) setzt sich aus einer großen Zahl, räumlich getrennter und weit verstreuter Personen zusammen, die das Interesse an einer bestimmten medialen Aussage teilen (vgl. Maletzke, 1963, Lindner-Braun, 2007). Aufgrund dieser Kriterien kann auch von einer anonymen Rezeptionssituation gesprochen werden. Der Rezipient nimmt sein Mitpublikum nicht wahr, weiß jedoch, aufgrund seiner allgemeinen Medienkompetenz, dass er Filme nicht alleine rezipiert. Darüber hinaus kennen Rezipienten Situationen, in denen sie die Filmrezeption gemeinschaftlich erleben, bspw. im Rahmen eines Kinobesuchs oder eines DVD-Abends (vgl. Dohle & Hartmann, 2007; Dohle& Hartmann, 2008).
Das Modell basiert auf zwei Annahmen: Rezipienten haben während des Rezeptionsprozesses zumindest zeitweise eine subjektive Vorstellung von ihrem Mitpublikum, die das Rezeptionserleben beeinflusst. Diese Vorstellung bewirkt ein Verbundenheitsgefühl, weshalb die Autoren von einer sozialen Gemeinschaft sprechen. Ziel des Modells ist es, die Existenz und Struktur dieser Publikumsvorstellungen näher zu beschreiben und ihre möglichen Auswirkungen auf das Rezeptionserleben zu formulieren (vgl. Hartmann & Dohle, 2005, Dohle & Hartmann, 2007). Inhaltlich bezieht sich das Modell auf massenkommunikative Rezeptionssituationen.
2.3.2 Mediale Hinweise und subjektive Medientheorien
Im Unterschied zur Face-to-Face-Situation, in der es aufgrund der gemeinsamen Präsenz der Kommunikationsteilnehmer wechselseitige Abstimmungsprozesse gibt, welche eine konkrete Vorstellung der Empfänger von einander ermöglichen, verfügt der Rezipient in einer massenkommunikativen Rezeptionssituation über vergleichsweise wenige Hinweise, die ihn das Mitpublikum assoziieren lassen. Aufgrund der fehlenden Hinweise stellen die Zuschauer Hypothesen über ihre Mitzuschauer auf, die sie aus ihren subjektiven Medientheorien und medialen Hinweisen ableiten. Über die Hypothesen wird eine kognitive Repräsentation des jeweiligen Mitpublikums ausgelöst. Im Folgenden wird erklärt, wie nach Dohle und Hartmann diese Hypothesen zustande kommen.
Mediale Hinweise können Informationen in einer konkreten Sendung sein, Hinweise aus anderen Medien, Vorinformationen über einen bestimmten Sender oder ganz allgemein das Wissen, dass es sich um ein Massenmedium handelt und damit Mitzuschauer zwangsläufig vorhanden sind. In der Summe hat der Rezipient die sichere Annahme, dass es ein Mitpublikum gibt. Dies ist eine kognitiv repräsentierte Größe. Über die Zusammensetzung, die grobe Anzahl der Mitzuschauer und die Simultanität stellt er Vermutungen an (vgl. Dohle & Hartmann, 2005; Dohle & Hartmann, 2007). Damit verbunden sind subjektive Medientheorien. Aus den genannten medialen Vorinformationen der erworbenen Medienkompetenz und der jeweiligen Rezeptionssituation können Mediennutzer naive Theorien formulieren, die Vorstellungen von Mitpublika beinhalten (vgl. Dohle & Hartmann, 2005; Dohle & Hartmann, 2007; Hartmann & Dohle, 2005). Neben allgemeinem Wissen enthalten diese subjektiven Theorien auch spezifische Annahmen, die individuell differieren. Dies erklärt, warum kognitive Repräsentationen von Publika unterschiedlich sein können, denn über Verallgemeinerungen von beobachteten Einzelfällen und Hinweisen des massenmedialen Diskurses bauen Rezipienten ihre naiven Theorien auf. Daraus ergibt sich ein je Individuum unterschiedlich großes Vorwissen. Das subjektive Vorwissen beinhaltet formale sowie inhaltliche Eigenschaften des bislang rezipierten Medienangebots. Je nach Reichhaltigkeit der jeweiligen subjektiven Medientheorien können Rezipienten auf eine Vielzahl von Hypothesen über ihre Mitzuschauer zurückgreifen (vgl. Hartmann & Dohle, 2005).
Der Vorstellung subjektiver Theorien liegt das Forschungsprogramm subjektiver Theorien von Groeben, Wahl, Schlee und Scheele (1988) zu Grunde. Dies basiert in Anlehnung an Kelly auf der Vorstellung, den Menschen als Wissenschaftler zu betrachten, der zur Bewältigung seines Alltags Hypothesen und Theorien bildet. Dieser Alltag ist von Zeit-, Handlungs- und Orientierungsdruck geprägt. Die objektive Wissenschaft hingegen genießt diesbezüglich Druckfreiheit. Dies ermöglicht daher eine systematische, methodische Überprüfung von Hypothesen und gewährleistet Intersubjektivität als Voraussetzung für einen wissenschaftlich geordneten Fortschritt (vgl. Groeben et al., 1988). Dahingegen unterliegt der subjektive Alltagswissenschaftler nicht der intersubjektiven Konsensanforderung. Seine subjektiven Theorien sind funktionale Erklärungs-, Prognose- und Handlungsmodelle. Würde er diese Theorien einem objektiven wissenschaftlichen methodologischen Kriterienkatalog unterwerfen, wäre das für ihn entscheidende Merkmal der Alltagstauglichkeit nicht erfüllt. Dennoch findet nach Groeben et al. (1988) eine Hypothesen- und Theoriebildung statt, die mit der objektiven Wissenschaft vergleichbar ist. Statisch gesehen bildet eine subjektive Theorie eine Argumentationsstruktur ab. Dynamisch gesehen ermöglichen subjektive Theorien als Kognitionsaggregate Schlussfolgerungen bzw. Schlussfolgerungs-verfahren. Dadurch ergibt sich das Bild des „reflexiven Subjekts Wissenschaftler“ (Groeben et al., 1988, S. 19). Subjektive Theorien wie auch Kognitionen generell können sich auf das eigene Ich sowie auf ich-unabhängige Ereignisse beziehen. Das heißt, inhaltlich bestehen subjektive Theorien aus Phänomenen der Selbst- und Weltsicht eines reflexiven Subjekts (vgl. Groeben et al., 1988).
Hans-Jörg Stiehler wendet den Grundgedanken subjektiver Theorien auf den Medienbereich an. Dabei wird Medienhandeln als soziale Handlung im Gegenstandsbereich Medienwelt mit den ihr eigenen medientypischen Symbolen angesehen. Entsprechend dem Bild vom reflexiven Subjekt können subjektive Theorien auch zum Gegenstandsbereich Medien gebildet werden. Der Alltagsmensch setzt sich in Bezug zu seiner medialen Umgebung. Grundlage der individuellen subjektiven Medientheorien sind Sozialisation, fortlaufende Medienerfahrungen und populäre Sichtweisen gängiger Medienwissenschaft (vgl. Stiehler, 1999). Nach Stiehler fließen Alltagsverständnisse und Alltagsvorstellungen von Strukturen, Funktionen und Wirkungen der Medienkommunikation in subjektive Medientheorien ein. Er folgert, ganz im Sinne Groebens, dass subjektive Medientheorien ebenso umfassend sein können wie Theorien der Kommunikations- und Medienwissenschaft, jedoch sind in der Praxis die individuellen Reflexionsmöglichkeiten sowie die Handlungsfelder, in denen Menschen aktiv sind und in denen sie agieren, begrenzt. Folgende sechs Eigenschaften kennzeichnen nach Stiehler (1999) subjektive Medientheorien:
(1) Subjektive Medientheorien beinhalten Vorstellungen und Wissensbestände über Medien, die sich mit dem eigenen Medienhandeln und den Reflexionen darüber entwickeln. Daher ist eine individuell unterschiedliche Tiefe und Breite von subjektiven Medientheorien zu vermuten.
(2) Diese Medientheorien unterliegen dem Kriterium der Alltagstauglichkeit, da sie zur Bewältigung von Zeit- und Orientierungsdruck Ereignisse definieren, erklären und prognostizieren und Handlungen begründen.
(3) Subjektive Medientheorien sind systemisch organisiert, d.h. einzelne Auffassungen folgen einer subjektiven Plausibilität und nicht einer methodologischen Widerspruchsfreiheit, wie dies bei objektiven Theorien der Fall wäre. Mögliche Inkonsistenzen der subjektiven Theorien ließen sich nach Mechanismen, wie sie in Festingers Theorie der kognitiven Dissonanz beschrieben sind, auflösen.
(4) Subjektive Theorien haben meist impliziten Charakter, werden nicht notwendigerweise ausformuliert, bleiben eher vage. Reflexion und Explikation sind eher zu vermuten, wenn Alltagsroutinen gestört werden.
(5) In Bezug zu objektiven Tatsachen stellen subjektive Medientheorien einen Filter dar, so dass die Wahrnehmung der Wirklichkeit die eigene Theorie eher stützt als widerlegt. Das Ziel, eigene Theorien empirisch zu prüfen, wie das die Wissenschaft fordert, widerspräche der Alltagsfunktion subjektiver Theorien, die rasche Orientierung und Handlungssicherheit erfordert.
(6) Subjektive Theorien nehmen auch Inhalte populärer Theorien bzw. populärwissenschaftlicher Veröffentlichungen auf.
Subjektive Theorien sind wie objektive Theorien aufgebaut und erfüllen analoge Funktionen. Der wissenschaftliche Theoriebegriff beschreibt Theorien als Systeme von Aussagen, zwischen denen logische Beziehungen bestehen sollen. Darüber hinaus enthalten Gesetze und Theoreme einer Theorie Beschreibungen, Definitionen und intersubjektiv verbindliche Begriffe. Entsprechend dem wissenschaftlichen Theoriebegriff gibt es analoge Grundbestandteile in subjektiven Theorien. Hypothesen und Gesetzmäßigkeiten sind wesentlicher Bestandteil wissenschaftlicher Theorie und stellen insbesondere Kausalzusammenhänge dar (vgl. Opp, 2005). Analog sind Kausalaussagen im Sinne von Wenn-dann- bzw. Je-desto-Formulierungen Kernbestandteile subjektiver Theorien. Die Unterscheidung zwischen Hypothese und Gesetz spielt für den Träger einer subjektiven Theorie keine Rolle, da das Kriterium „empirisch bewährt“ hier irrelevant ist.
Quellen dieser Medientheorien sind der eigene Umgang mit Medieninhalten, die Beobachtung anderer im Umgang mit Medien, Reflexionen über die eigene Mediennutzung bzw. die anderer sowie die Metakommunikation in den Medien über Medien (vgl. Stiehler, 1999). Nach Charlton & Klemm (1998) besteht die Notwendigkeit subjektiver Medientheorien darin, dass die Massenkommunikation Leerstellen aufweist, die der Rezipient selbst schließen muss. Dabei wird die Fernsehaneignung, d. h. die Verarbeitung des Fernsehtextes als ein permanenter Kommunikationsprozess angesehen. Diese Kommunikation ist einmal Teil einer Selbstreflexion in Form eines inneren Dialogs. Dabei positioniert sich der Rezipient gegenüber dem Fernsehtext und ermittelt die an ihn gestellten Anforderungen. Weiterhin stellt er einen Bezug zwischen Mediendarstellung und eigener Lebenswelt her. Hierzu gehört auch eine Bewertung der Gratifikationen, die die Mediennutzung in dieser Situation bietet. Im Rahmen der „inneren Rede“ (Charlton & Klemm, 1998, S.713) stellt sich dem Rezipienten auch die Frage nach Verarbeitung durch kommunikative Handlungen mit anderen, d.h. welche Fernsehinhalte und Reflexionsergebnisse sollen mit den Anwesenden bzw. im Rahmen einer Anschlusskommunikation besprochen werden. Im Zusammenhang mit unserer Fragestellung ist wichtig, dass die Aneignung medialer Kommunikate auch in Kombination mit Gratifikationen während der Rezeption bzw. in Erwartung von Gratifikationen in Anschlusssituationen Teil eines sozialen Prozesses ist. Sozial im Sinne einer konkreten Kommunikation mit anderen, sozial aber auch in der Selbstreflexion im Rahmen eines inneren Dialogs, in dem Mitzuschauer eine Rolle spielen bzw. in dem die Vorstellung von Mitzuschauern Gratifikationserwartungen auslöst, bspw. durch zukünftige Anschlusskommunikationen.
2.3.3 Publikumsvorstellungen
Nach Dohle und Hartmann (2005) setzt sich die Vorstellung über das Mitpublikum aus einer Reihe von Einzelüberlegungen zusammen. Sie schlagen vier Dimensionen vor, denen diese Einzelüberlegungen analytisch zuzuordnen sind. Der Rezipient hat eine grobe Vorstellung über die Anzahl seiner Mitzuschauer, über Simultanität, die unterstellte soziale Zusammensetzung, und er antizipiert das Rezeptionserleben seines Mitpublikums. Nicht alle Dimensionen müssen gleichzeitig auftreten, entscheidend ist die jeweilige Rezeptionssituation (vgl. Hartmann & Dohle, 2005; Dohle & Hartmann, 2005; Dohle & Hartmann, 2007).
Aus medialen Hinweisen in der konkreten Rezeptionssituation verbunden mit den subjektiven Theorien resultieren Vorstellungen zu Größe, Simultanität, sozialer Zusammensetzung und Erleben des Mitpublikums. Dabei sind die unterstellten Größenannahmen eher grob und unkonkret, Simultanitätsunterstellungen unterscheiden die Ausprägungen simultan versus nicht simultan. Die unterstellte soziale Zusammensetzung des Mitpublikums kann konkreter sein, zum Beispiel in Bezug auf Alter, Geschlechterverteilung, Bildungsgrad, Interessen und Wertvorstellungen. Wie konkret die Repräsentation ist und welche Merkmale unterstellt werden, hängt vom subjektiven Vorwissen sowie den situationsspezifischen medialen Informationen ab (Dohle & Hartmann, 2005; Hartmann & Dohle, 2005; Dohle & Hartmann, 2007).
Die Bedeutung des aktuellen, situationsbezogenen Rezeptionserlebens lässt sich auch aus dem dynamisch-transaktionalen Ansatz bei Früh ableiten (vgl. Dohle & Hartmann, 2008; Früh, 2001). Die Entwicklung der Medienwissenschaft führte zu einem Paradigmenwechsel von der Vorstellung starker Medien hin zur Vorstellung schwacher Medien. Schienen die Rezipienten zunächst den Medien hilflos ausgeliefert, rückten sie im Lauf der Zeit zu selbstbestimmten Mediennutzern auf. Den Höhepunkt dieser Entwicklung sieht Früh (2001) im Uses and Gratification-Ansatz (vgl. Aelker, 2008b; Rosengren & Windahl, 1972; Rubin, 2002) als elaboriertestem Erklärungsansatz für Mediennutzung. Doch diese Verschiebung des Fokus und der Wechsel vom passiven Mediennutzer hin zum aktiven Rezipienten änderte nichts an der Vorstellung des zu Grunde liegenden Wirkungsflusses. Auch bei dieser Sichtweise führt ein Stimulus, nämlich die mediale Aussage als objektive Information, zu einer Wirkung (Response) im Rezipienten. Der Unterschied liegt lediglich darin, dass der Rezipient die entstandene Wirkung einschätzen kann und sie entsprechend seiner Bedürfnisse aktiv als Motiv für die Mediennutzung heranzieht. Ein dieser Vorstellung entgegengesetztes Wirkungsverständnis findet sich in der konstruktivistischen Vorstellung des Informationsaustauschs, wie sie im symbolischen Interaktionismus angelegt ist. Bleibt in der ersten Vorstellung die Information nahezu unverändert, ist aus konstruktivistischer Perspektive Objektivität nicht möglich. Eine Medienaussage ist in dieser Vorstellung überwiegend vom Publikum selbst erschaffen, eine objektive Medienwirkung ist damit ausgeschlossen (Früh, 2001). Nach der Auffassung der Vertreter des Uses and gratification-Ansatzes wählt der Rezipient aufgrund seiner antizipierten Wirkungserwartung einen objektiven Medieninhalt aus. Der symbolische Interaktionismus setzt eine interpretierende konstruktive Aktivität des Rezipienten voraus (vgl. Krotz, 2001). Früh versucht mit seinem dynamisch-transaktionalen Ansatz, eine Synthese zwischen der Vorstellung, Informationen, also auch Medieninhalte, seien objektiv wirksam, und der Vorstellung, die Wirkung einer Medienaussage sei rein subjektiv konstruiert, indem er einen neuen Wirkungsbegriff vorschlägt, den er aus einer Kombination von einer molar-ökologischen, einer dynamischen und einer transaktionalen Perspektive ableitet. Im Folgenden sollen die genannten Perspektiven kurz erläutert und zusammengeführt werden, um dann auf die vorliegende Fragestellung mit Berücksichtigung des Modells rezeptionssituativer Publikumsvorstellungen angewandt werden.
Ausgangpunkt ist die Tatsache, dass es bei der menschlichen Wahrnehmung elementare Unschärfen gibt, die in der Abstraktion von der Ganzheit und Komplexität der Umwelt und ihrer Strukturierung bestehen. Der Inhalt der unmittelbaren Wahrnehmung wird zudem symbiotisch mit bereits vorhandener Information verknüpft. Kognitive Größen wie Wissen oder Meinungen erlangen erst durch ihre konkrete Aktualisierung Bedeutung, wobei die Aktualisierung von Vorstellungen im Kontext der jeweiligen Randbedingungen erfolgt. Ohne die jeweilige Aktualisierung bleiben Gedächtnisinhalte lediglich Möglichkeit von Wissen, das für seine Existenz der konkreten Vergegenwärtigung bedarf (vgl. Früh, 2001). Mediale Kommunikation stellt in diesem Kontext eine spezifische Form der Aktualisierung von Wissen, Meinung und Vorstellung dar. Früh sieht das Medium hierbei als Transportmittel einer Information (vgl. McLuhan, 1963) sowie als speziellen Verschlüsselungscode. Dieser spezifische Schlüssel führt zu einer spezifischen Form von Aktualisierung, die zusätzlich von situations- und personenspezifischen Merkmalen beeinflusst wird.
Früh betont den transaktionalen Charakter der Rezeptionssituation im Gegensatz zu einer Ursache-Wirkung-Kombination. Für den Kommunikationsprozess bedeutet dies, dass ein vom Kommunikator kodiertes Signal vom Rezipienten enkodiert werden muss. Diese Entschlüsselung gelingt durch Verwendung spezifischer Kompetenzen. In der Medienrezeption, genauer in der Filmrezeption, handelt es sich dabei konkret um Medienkompetenz. Früh betont, dass die Rezeption nicht passiv erfolgt, sondern als „produktiver und kreativer Elaborationsprozess“ (Früh, 2001, S. 22) aufgefasst werden muss. Er unterscheidet zwischen horizontalen und vertikalen Transaktionen. Unter horizontaler Transaktion versteht Früh eine Interdependenz zwischen medialer Aussage auf derselben Hierarchieebene. Das heißt, dass jede Aussage zum einen eine eigenständige funktionale Bedeutung hat, die jedoch ohne die Bedeutung der korrespondierenden Aussage nicht denkbar ist, und zum anderen ihre Bedeutung einer simultanen, teils hypothetischen Bedeutungskonstruktion aller Aussagenteile verdankt. Unter vertikaler Transaktion versteht Früh den Aufbau, die Überprüfung und ggf. Veränderung von Vorstellungen, die aufgrund von Informationen gemacht werden. Es entsteht ein Wechselspiel zwischen detaillierter Information, die zu Hypothesen führt und eine umfassende Vorstellung herbeiführt. So kann eine Detail-information, die nicht in die Globalvorstellung passt, diese verändern und zu einer Uminterpretation der bisherigen Detailinformationen führen. Es besteht eine Interdependenz zwischen globaler Vorstellung und detailliertem Hinweis. Eine Information – in unserem Falle zum Beispiel ein medialer Hinweisreiz – löst die Vorstellung eines Mitpublikums aus. Alle weiteren Informationen in diesem Sinnzusammenhang werden auf Konsistenz mit der entstandenen Vorstellung überprüft. Die Informationen können die Vorstellung bestätigen oder widerlegen. Widersprechende Informationen können dazu führen, dass auch vorherige Hinweise neu interpretiert und der revidierten Vorstellung angepasst werden. Auch das soziale Präsenzempfinden basiert auf der Vorstellung eines Anderen, die auf computervermittelte Detailinformationen beruht. Bei der Rezeption eines Medieninhaltes findet eine permanente Rekonstruktion im Sinne einer Anpassung bzw. Veränderung von Bedeutung statt. Vorhandene Informationen werden ergänzt und uminterpretiert oder verlieren an Beutung, werden vergessen. Dies beschreibt die dynamische Komponente aus mikroskopischer Perspektive (vgl. Früh, 2001). Es ist in Bezug auf die Publikumsvorstellung während einer Filmrezeption ein ähnlich dynamisch rekursiver Konstruktionsprozess anzunehmen.
Entscheidend für alle vier Dimensionen ist, dass die objektive Publikumsituation keine Rolle spielt, es kommt nur auf subjektive Wahrnehmung, individuelle Hypothesen-bildung und damit verbundene subjektive kognitive Repräsentation an.
In der hier vorliegenden Untersuchung liegt der Schwerpunkt auf dem vorgestellten Rezeptions-erleben des Mitpublikums. Auch diese Dimension basiert auf subjektiven Medientheorien, wobei unterstellt wird, dass jeder Rezipient subjektive Annahmen über das Rezeptionserleben der Anderen hat.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783836649353
- DOI
- 10.3239/9783836649353
- Dateigröße
- 2.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität zu Köln – Humanwissenschaftliche Fakultät, Medienwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2010 (Juli)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- soziale präsenz kommunikation social publikumsvorstellung medienwirkungsforschung
- Produktsicherheit
- Diplom.de