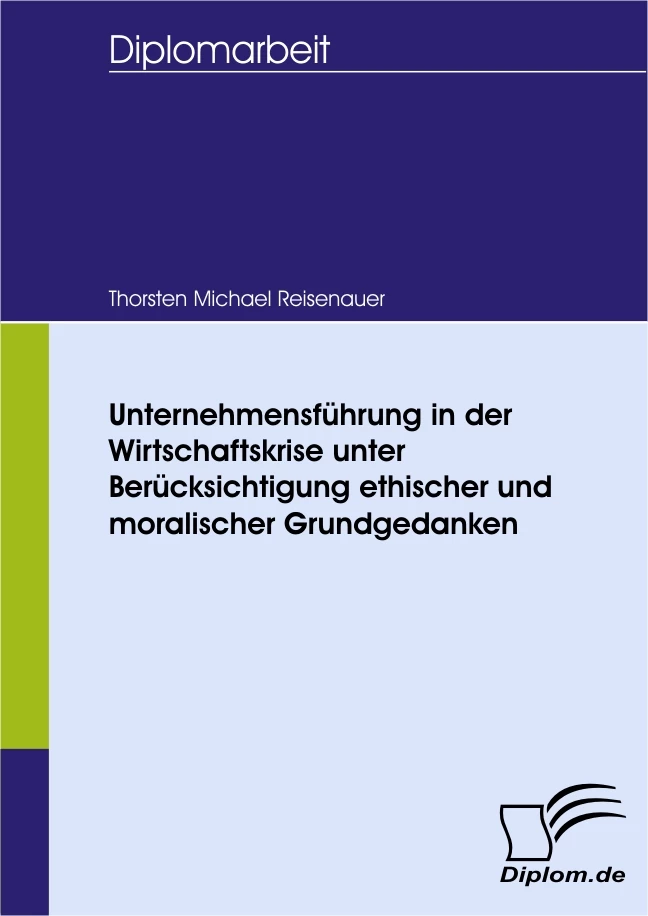Unternehmensführung in der Wirtschaftskrise unter Berücksichtigung ethischer und moralischer Grundgedanken
©2010
Diplomarbeit
172 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Der Kapitalismus hat in den letzten Jahrzehnten eine durchgehende Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs und des Wohlstands hervorgebracht. Technischer Fortschritt, gestiegene Lebensqualität, individuelle Freiheit, die Chancen zum sozialen Aufstieg, sind nur einige der Aspekte die mit dem Kapitalismus assoziiert wurden.
Die weltweite Vernetzung der Nationalökonomien und der Finanzindustrie hat dabei das theoretische Wirtschaftspotenzial für den Kapitalismus ebenfalls erheblich erweitert. Vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise geraten allerdings auch die Schwachpunkte der kapitalistischen Theorie immer mehr in den Fokus der Ökonomen. Besonders das Phänomen der Blasenbildung ist für die Ökonomen von höchstem Interesse, da sich dieses in Verbindung mit der überkapitalisierten Finanzindustrie zu einem systemischen Risiko für die gesamte Weltwirtschaft herausgestellt hat.
Nachdem die, nach der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre, getroffenen Maßnahmen zur Regulierung der Finanzindustrie schrittweise wieder abgebaut wurden, erschien es, mit dem Hintergrund der Finanzkrise und des systemischen Fast-Kollapses des Bankensektors, recht aussichtsreich eine globale Re-regulierung der Finanzindustrie durchsetzen zu können.
Das Versagen des Gleichgewichts an den Märkten hat zu einer umfangreichen Ursachenforschung bezüglich der Ursachen der Wirtschafts- und Finanzkrise geführt.
Die Ursachenforschung unterscheidet dabei die Ursachen die im System bzw. im gesetzlichen Rahmen desjenigen und den Ursachen die in den Akteuren liegen die innerhalb dieses Systems agieren. Durch den massiven politischen Einfluss und das wirtschaftliche Gewicht der Finanzlobby scheint die angestrebte systemische Neuordnung des globalen Finanzsektors, dem Herz des Kapitalismus, jedoch noch nicht durchsetzbar zu sein. Die kapitalistische Grundidee, Wagnis, Risikobereitschaft und damit Gier zu belohnen und wirtschaftliches Scheitern mit Verlust zu ahnden bleibt bestehen, wobei die systemischen Gefahren übergroßer Gesellschaften und Konzerne anscheinend weiterhin ausgeklammert werden, da nationale Interessen betroffen sind. Auf volkswirtschaftlicher Ebene wird also der Gedanke maximales Risiko mit maximalem Gewinn zu ködern beibehalten, um das Wachstum und den Fortschritt zu stimulieren bzw. nicht abzuwürgen.
Es wird Gegenstand dieser Arbeit sein die Rolle der menschliche Moral und Ethik bei der Entstehung der aktuellen […]
Der Kapitalismus hat in den letzten Jahrzehnten eine durchgehende Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs und des Wohlstands hervorgebracht. Technischer Fortschritt, gestiegene Lebensqualität, individuelle Freiheit, die Chancen zum sozialen Aufstieg, sind nur einige der Aspekte die mit dem Kapitalismus assoziiert wurden.
Die weltweite Vernetzung der Nationalökonomien und der Finanzindustrie hat dabei das theoretische Wirtschaftspotenzial für den Kapitalismus ebenfalls erheblich erweitert. Vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise geraten allerdings auch die Schwachpunkte der kapitalistischen Theorie immer mehr in den Fokus der Ökonomen. Besonders das Phänomen der Blasenbildung ist für die Ökonomen von höchstem Interesse, da sich dieses in Verbindung mit der überkapitalisierten Finanzindustrie zu einem systemischen Risiko für die gesamte Weltwirtschaft herausgestellt hat.
Nachdem die, nach der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre, getroffenen Maßnahmen zur Regulierung der Finanzindustrie schrittweise wieder abgebaut wurden, erschien es, mit dem Hintergrund der Finanzkrise und des systemischen Fast-Kollapses des Bankensektors, recht aussichtsreich eine globale Re-regulierung der Finanzindustrie durchsetzen zu können.
Das Versagen des Gleichgewichts an den Märkten hat zu einer umfangreichen Ursachenforschung bezüglich der Ursachen der Wirtschafts- und Finanzkrise geführt.
Die Ursachenforschung unterscheidet dabei die Ursachen die im System bzw. im gesetzlichen Rahmen desjenigen und den Ursachen die in den Akteuren liegen die innerhalb dieses Systems agieren. Durch den massiven politischen Einfluss und das wirtschaftliche Gewicht der Finanzlobby scheint die angestrebte systemische Neuordnung des globalen Finanzsektors, dem Herz des Kapitalismus, jedoch noch nicht durchsetzbar zu sein. Die kapitalistische Grundidee, Wagnis, Risikobereitschaft und damit Gier zu belohnen und wirtschaftliches Scheitern mit Verlust zu ahnden bleibt bestehen, wobei die systemischen Gefahren übergroßer Gesellschaften und Konzerne anscheinend weiterhin ausgeklammert werden, da nationale Interessen betroffen sind. Auf volkswirtschaftlicher Ebene wird also der Gedanke maximales Risiko mit maximalem Gewinn zu ködern beibehalten, um das Wachstum und den Fortschritt zu stimulieren bzw. nicht abzuwürgen.
Es wird Gegenstand dieser Arbeit sein die Rolle der menschliche Moral und Ethik bei der Entstehung der aktuellen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Thorsten Michael Reisenauer
Unternehmensführung in der Wirtschaftskrise unter Berücksichtigung ethischer und
moralischer Grundgedanken
ISBN: 978-3-8366-4906-3
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Fachhochschule für angewandtes Management, Erding, Deutschland, Diplomarbeit,
2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
1
Inhaltsverzeichnis
1.
Einleitung
1.1.
Problemstellung der vorliegenden Arbeit ... 3
1.2.
Gang der Untersuchung ... 5
2.
Die Rolle von Ethik und Moral in der Unternehmensführung
der modernen Wirtschaft
2.1.
Begriff und Definition der Unternehmensführung ... 6
2.1.1.
Evolution der Unternehmensführung ... 8
2.1.2.
Philosophisch- Moralische Handlungsbasis der Unternehmensführung ... 13
2.1.3.
Ansätze verantwortlicher Unternehmensführung ... 16
2.1.3.1.Corporate Social Responsibility ... 17
2.1.3.2.Nachhaltige Unternehmensführung ... 18
2.1.3.3.Unternehmensethik ... 19
2.1.3.4.Corporate Accountability ... 19
2.1.3.5.
ISO 26000 ,,Guidance on social Responsibility" (Stand Mai 2010) ... 20
2.2.
Begriff und Definition der Moral ... 21
2.2.1.
Die Evolution des moralischen Handelns ... 22
2.2.2.
Grundgedanken menschlicher Moral ... 26
2.2.2.1.Eigentum ... 26
2.2.2.2.Freiheit und Verantwortung ... 31
2.2.2.3.Gerechtigkeit ... 42
2.3.
Begriff und Definition der Ethik ... 51
2.3.1.
Wirtschaftsethik ... 54
2.3.2.
Unternehmensethik ... 58
2.3.3.
Führungsethik ... 61
2.3.4.
Individualethik ... 61
2.3.5.
Berufsethik ... 64
2.4.
Abgrenzung von Moral und Ethik ... 65
2.5.
Gegenüberstellung des Prinzips Führung und des Programms
der menschlichen Moral ... 66
3.
Moralische und ethische Ursachen der Wirtschaftskrise ... 68
3.1.
Verfehlungen auf Makroethischer-Ebene
3.1.1.
Reduzierung des Menschen zum ,,Homo oeconomicus" als Theoriebasis des
marktwirtschaftlichen Modells ... 69
3.1.2.
Abkehr von der ,,optimalen Allokation der Ressourcen" zur ,,optimalen
Allokation des Kapitals" ... 72
3.1.3.
Der Konkurrenzmechanismus des freien Marktes führt zu stetiger Absenkung
der Grenzmoral ... 77
2
3.2.
Verfehlungen auf Mesoethischer-Ebene
3.2.1.
Einseitige Ausrichtung der Unternehmensaktivitäten nach dem Shareholder-
Value Konzept ... 82
3.2.2.
Integrierung der Wachstumsdoktrin in das Unternehmensleitbild ... 88
3.2.3.
Rein Ergebnisorientierte Anreizsysteme ... 94
3.2.4.
Massenphänomene als Ursachen ethischen Fehlverhaltens ... 101
3.3.
Verfehlungen auf Mikroethischer-Ebene
3.3.1.
Moralische Verfehlungen im Bereich der Unternehmens-Führungsethik ... 105
3.3.1.1.Moral-Hazard ... 106
3.3.1.2.Erfolgreiche Strategien werden beibehalten... 108
3.3.2.
Moralische Verfehlungen im Bereich der Individualethik ... 111
3.3.2.1.Kurzfristiger Egoismus der Marktakteure ... 112
3.3.2.2.Gier ... 116
3.3.2.3.Verantwortungslosigkeit ... 118
3.3.2.4.Emotion steuert Kognition ... 122
3.3.2.5.
Hybris ... 127
4.
Nachhaltig erfolgreiche Unternehmensführung durch Integration und Sicherung der
Individualmoral als oberste ökonomische Entscheidungsinstanz der
Unternehmensführung ... 130
4.1.
Implementierung einer zertifizierten kognitivistischen Ethik- Managementnorm ... 133
4.1.1.
Grundsätze der Ethik-Managementnorm ... 134
4.1.1.1.Menschengerecht ... 134
4.1.1.2.Umweltgerecht ... 135
4.1.1.3.Transparenz ... 136
4.1.1.4.Nachhaltigkeits-Due Diligence Prüfung ... 137
4.1.2.
Ziele der Ethik-Managementnorm
4.1.2.1.Aktivierung der Individualmoral ... 138
4.1.2.2.Gewinnmaximierungsdoktrin relativieren ... 139
4.1.3.
Integrierung der Ethik-Managementnorm in die Unternehmensführung ... 140
4.1.3.1.Aktivierung der Individualmoral in Führungsprozessen
4.1.3.1.1.
Ethik-Coaching für Führungskräfte ... 141
4.1.3.1.2.
Trainingsseminare bezüglich Führungsethik ... 142
4.1.3.2.Einführung von Seminaren über berufsspezifische
Verantwortungspotenziale ... 143
4.2.
Seminare zur ethischen Organisation des Unternehmen ... 145
4.2.1.
Seminare zur Implementierung ethischer Rahmenbedingungen in das
Unternehmensführungskonzept zur Stabilisierung der Individualmoral
4.2.1.1.Integration betriebsinterner ethischer Rahmenbedingungen ... 146
4.2.1.2.Integration ethischer Rahmenbedingungen im Außenverhältnis ... 149
4.2.2.
Seminar zur Einführung eines unabhängigen Ethikbeauftragten ... 150
5.
Zusammenfassung und Ausblick ... 151
Literaturverzeichnis: ... 158
Elektronische Quellen: ... 168
3
1.
Einleitung
1.1.
Problemstellung
Der Kapitalismus hat in den letzten Jahrzehnten eine durchgehende Phase des
wirtschaftlichen Aufschwungs und des Wohlstands hervorgebracht. Technischer
Fortschritt, gestiegene Lebensqualität, individuelle Freiheit, die Chancen zum sozialen
Aufstieg, sind nur einige der Aspekte die mit dem Kapitalismus assoziiert wurden.
Die weltweite Vernetzung der Nationalökonomien und der Finanzindustrie hat dabei das
theoretische Wirtschaftspotenzial für den Kapitalismus ebenfalls erheblich erweitert.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise geraten allerdings auch
die Schwachpunkte der kapitalistischen Theorie immer mehr in den Fokus der Ökonomen.
Besonders das Phänomen der Blasenbildung ist für die Ökonomen von höchstem Interesse,
da sich dieses in Verbindung mit der überkapitalisierten Finanzindustrie zu einem
systemischen Risiko für die gesamte Weltwirtschaft herausgestellt hat.
Nachdem die, nach der Weltwirtschaftskrise der 30'er Jahre, getroffenen Maßnahmen zur
Regulierung der Finanzindustrie schrittweise wieder abgebaut wurden, erschien es, mit
dem Hintergrund der Finanzkrise und des systemischen Fast-Kollapses des
Bankensektors, recht aussichtsreich eine globale Re-regulierung der Finanzindustrie
durchsetzen zu können.
Das Versagen des Gleichgewichts an den Märkten hat zu einer umfangreichen
Ursachenforschung bezüglich der Ursachen der Wirtschafts- und Finanzkrise geführt.
Die Ursachenforschung unterscheidet dabei die Ursachen die im System bzw. im
gesetzlichen Rahmen desjenigen und den Ursachen die in den Akteuren liegen die
innerhalb dieses Systems agieren.
Durch den massiven politischen Einfluss und das wirtschaftliche Gewicht der Finanzlobby
scheint die angestrebte systemische Neuordnung des globalen Finanzsektors, dem Herz des
Kapitalismus, jedoch noch nicht durchsetzbar zu sein.
Die kapitalistische Grundidee, Wagnis, Risikobereitschaft und damit Gier zu belohnen und
wirtschaftliches Scheitern mit Verlust zu ahnden bleibt bestehen, wobei die systemischen
Gefahren übergroßer Gesellschaften und Konzerne anscheinend weiterhin ausgeklammert
werden, da nationale Interessen betroffen sind.
Auf volkswirtschaftlicher Ebene wird also der Gedanke maximales Risiko mit maximalem
Gewinn zu ködern beibehalten, um das Wachstum und den Fortschritt zu stimulieren bzw.
nicht abzuwürgen.
4
Es wird Gegenstand dieser Arbeit sein die Rolle der menschliche Moral und Ethik bei der
Entstehung der aktuellen Weltwirtschaftskrise zu untersuchen, bzw. welchen Stellenwert
dieser Aspekt bei denjenigen Entscheidungen der Wirtschaftsakteure hatte, welche zu den
Grundursachen dieser Krise zu zählen sind.
Weiterhin soll der Zusammenhang von Unternehmensführung und Moral bzw. deren
gegenseitige Beeinflussung bei Führungsentscheidungen auf Unternehmensebene
untersucht werden.
Da es bereits eine große Bandbreite an Ansätzen für nachhaltig-ethische
Unternehmensführung gibt, diese sich aber in der Wirtschaft nicht durchsetzen konnten,
wird die Frage aufgeworfen werden, ob das evolutionäre Programm der Moral den
Ansprüchen einer modernen globalisierten Wirtschaftswelt überhaupt noch gerecht werden
kann.
Darüber
hinaus
wird
der
Frage,
wieso
die
individuellen
ethischen
Selbstkontrollmechanismen bei einer so breiten Schicht von Managern nicht eingegriffen
haben, nachgegangen.
Besonders die Frage ob es eher Sinn macht ethische Führungskonzepte zu integrieren, oder
ob es sinnvoller ist die Führungskräfte ethisch und moralisch zu sensibilisieren bzw. erst zu
aktivieren, damit sie aus eigenem Antrieb ethisch handeln und nicht nach vorgegebenem
Ethik-Konzept, wird im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen.
Anhand der aktuellen Wirtschaftskrise, als Untersuchungsumfeld für das Zusammenspiel
von Unternehmensführung und ethischem Handeln, soll also erörtert werden wieso
moralische Schranken oft nicht greifen und wieso sich nachhaltige Unternehmensführung
nicht, in relevanter Breite, am Markt hat etablieren können.
Weiteres Ziel der vorliegenden Arbeit ist es anhand von Analysen des Prinzips
Unternehmensführung, des Programms der menschlichen Moral und deren sozial-
evolutionärem Zusammenhang, Ansätze zu nachhaltiger Unternehmensführung zu
entwickeln.
Diese Ansätze zur ethischen Unternehmensführung, sollen sowohl normativ, als auch
strategisch und operativ in ein wirtschaftliches Umfeld integrierbar sein und gleichzeitig
dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprechen.
5
1.2.
Gang der Untersuchung
Im ersten Kapitel wird mit der Problemstellung kurz ein Überblick über den Hintergrund
und die Problematik der aktuellen Wirtschaftskrise geschaffen. Gleichzeitig werden die
Untersuchungsfelder dieser Arbeit umrissen und die Problematik vorgestellt.
Im zweiten Kapitel werden die Themenbereiche Unternehmensführung, Moral und Ethik
definiert, und deren evolutionäre Entwicklung, deren Zusammenhang sowie deren
Abgrenzungen untersucht.
Weiterhin werden bereits bestehende Ansätze zur verantwortlichen Unternehmensführung
vorgestellt.
Dieser Teil stellt somit die theoretische Basis der weiteren Arbeit dar.
Im dritten Kapitel werden die moralischen und ethischen Ursachen der aktuellen
Wirtschaftskrise analysiert, wobei jeder Aspekt zuerst theoretisch erörtert, und danach in
seinen konkreten Ausprägungen dargestellt wird.
Die Ursachen werden sowohl auf der Ebene der Makroethik, der Mesoethik als auch auf
Ebene der Mikroethik untersucht.
Das vierte Kapitel entwirft, ausgehend von den Erkenntnissen der Kapitel 2 und Kapitel 3,
einen Ansatz im Bereich der Unternehmensführung, welcher über eine Aktivierung der
Individualmoral für Führungsentscheidungen, nachhaltiges, sozial und ökologisch
verantwortliches Wirtschaften ermöglicht.
Dieses Kapitel bildet somit den Kern der vorliegenden Arbeit, da es einen konkreten
Ansatz für die Integrierung einer ethisch-nachhaltigen Unternehmensausrichtung auf
Unternehmensführungsebene enthält.
Die Arbeit wird durch Kapitel 5 mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick
abgeschlossen.
6
2.
Die Rolle von Ethik und Moral in der Unternehmensführung der modernen
Wirtschaft
2.1.
Begriff und Definition der Unternehmensführung
Die moderne Unternehmensführungslehre hat Ihren Ursprung in den Anfängen des
Kapitalismus und ist eng mit der industriellen Revolution verbunden, welche, im
angehenden 19. Jahrhundert von der britischen Textilindustrie ausgehend, die Wirtschaften
Europas und Nordamerikas revolutionierte.
1
Neben der Entwicklung der Dampfmaschine durch James Watts 1765, waren auch die
ökonomischen Ansätze von Adam Smith aus seinem 1776 entstandenen Hauptwerk
,,Wealthy of Nations" eine der Prämissen, welche die Basis zur Entstehung des
Kapitalismus bildeten. Die damit einhergehenden, komplexeren Anforderungen an das
Management, ließen eine effiziente und gut organisierte Unternehmensführung immer
wichtiger werden.
Obwohl Smith sich hauptsächlich volkswirtschaftlich-politischen Aspekten widmet,
bildeten seine Ansätze zur Arbeitsteilung, sowie zur Funktion des Geldes als Tauschmittel
und als Kapital
2
, die Basis zum Strukturwandel der Wirtschaft, hin zur industriellen
Produktion und der Entstehung von Großbetrieben.
Die Führung von Unternehmen, also die Planung, Steuerung und Kontrolle sowie die
strategische Ausrichtung des Unternehmens hat sich zu einem immer wichtigeren Aspekt
in der konkurrenzintensivierten Wirtschaftswelt entwickelt.
Eine Hauptaufgabe der Unternehmensführung besteht in der Koordination der Menschen
die in dieser Organisation agieren. Die Handlungen dieser Menschen müssen auf ein
gemeinsames Ziel und auf den möglichst effizienten Nutzen aus dem Einsatz der
Unternehmensressourcen ausgerichtet werden.
Unternehmensführung kann sowohl als Institution verstanden werden, d.h. als das
einflussnehmende Element der Hierarchie in der Organisation, bzw. als eine Person oder
eine Gruppe von Personen, welche aufgrund Ihrer Position in der Hierarchie und ihrer
Aufgabe andere Personen, die Ihnen unterstehen, im Sinne des Unternehmenserfolges
1
Harald Hungenberg, Thorsten Wolf: Grundlagen der Unternehmensführung:, Springer Verlag 2004, Seite
35.
2
Karl Graf Bellestrem: Adam Smith: Beck Verlag 2001, Seite 136.
7
beeinflussen , als auch als die direkte Handlung dieser Personen. Man spricht dann auch
von der Unternehmensführung als Funktion oder Tätigkeit.
3
Mitglieder der Unternehmensführung werden Führungskräfte oder Manager genannt und
deren Handlungen synonym als Management.
Die einzelnen Führungsentscheidungen der Unternehmensführung lassen sich in drei
logisch voneinander abgegrenzte Kategorien unterscheiden.
4
Je nach Zeithorizont, Freiheitsgrad und nach unternehmensrelevanter Bedeutung der
Entscheidung wird in der fachspezifischen Literatur zwischen normativer-, strategischer-
und operativer- Unternehmensführung unterschieden.
Man unterscheidet die normative Ebene, welche sich mit den generellen Zielen des
Unternehmens, den Prinzipien, Normen und Spielregeln beschäftigt, die strategischen
Ebene welche für den Aufbau, die Pflege, die Nutzung von Erfolgspotenzialen und
zielgerichtete Ressourcenbereitstellung verantwortlich ist, und die operative Ebene,
welche, sich an den Fähigkeiten und Ressourcen des Unternehmens ausrichtend, die
normativen und strategischen Vorgaben operativ umsetzt.
5
Dieses Modell wird auch das ,,St. Galler Managementmodell" genannt und basiert auf dem
Systemansatz von Prof. Hans Ullrich.
6
Das Modell greift die von Prof. Ullrich hervorgehobenen drei Managementebenen,
normativ-strategisch-operativ-, auf, und verbindet sie mit dem, was vielfach als die
spezifische «St.Galler» Management-Sichtweise angesehen wurde und wird: der
Harmonisierung des Dreiklangs von Strategie, Struktur und Kultur.
7
Diese Arbeit wird sich auf die normative und die strategische Ebene konzentrieren, und die
operative Ebene und die darin integrierte Mitarbeiterführung nur peripher tangieren.
Die Unternehmensführung entwickelt die Vision für das Unternehmen, integriert ein
unternehmensspezifisches Wertesystem, legt die Ziele für das Unternehmen fest und plant
unter Berücksichtigung der Unternehmensressourcen das Leistungsangebot.
3
Harald Hungenberg, Thorsten Wolf: Grundlagen der Unternehmensführung:, Springer Verlag 2004, Seite
24.
4
Knut Bleicher: Das Konzept integriertes Management Visionen-Missionen-Programme: Campus Verlag
Hamburg, 2004, Seite 77.
5
Knut Bleicher: Das Konzept integriertes Management Visionen-Missionen-Programme: Campus Verlag
Hamburg, 2004, Seite 78.
6
Knut Bleicher. Das Konzept integriertes Management Visionen-Missionen-Programme: Campus Verlag
Hamburg, 2004, Seite 77.
7
http://www.ifb.unisg.ch/org/Ifb/ifbweb.nsf/wwwPubInhalteGer/St.Galler+Management-
Modell?opendocument
,
8
Weiterhin ist die Unternehmensführung für die operative Planung und Umsetzung der
Unternehmensziele sowie für die Kontrolle zuständig.
8
2.1.1.
Evolution der Unternehmensführung
,,Am Anfang, noch vor dem ersten Tier, vor der ersten Emotion, war eine Nervenzelle, die
sich direkt aus einem Bakterium entwickelt hatte. Der innerste Kern der Neuronen unseres
Gehirns, die Millionen von Mitochondrien, ähnelt diesen Urbakterien fast aufs Haar. Wir
haben dieses Milliarden Jahre alte System in jeder unserer Zellen."
Robert Ornstein, Gehirnforscher
9
Um sich der Problematik des Arbeitsthemas dieser Arbeit zu nähern, nämlich der Rolle
von Ethik und Moral in der modernen Unternehmensführung, wird die Entstehung und die
Entwicklung des Führungsgedankens untersucht.
Der Gedankengang Führung in die Evolutionstheorie mit einzubeziehen, ist sicherlich
problematisch und wird von vielen Autoren kategorisch abgelehnt. Es könnte aber auch
eine neue Perspektive auf das Verhältnis von Führung und Moral aufzeigen, auf der sich
dann Erklärungsansätze für die Problematik zwischen erfolgreicher Führung und Moral
entwickeln lassen.
Von den Philosophen Thomas Hobbes und John Locke wurde der Standpunkt vertreten
dass der Mensch in seiner Entwicklung zum sozialen, vernünftigen Wesen ein Stadium
durchschritten hat, welches sie ,,Naturzustand" nannten und in welchem der Mensch als
egoistisches, gewissenloses, unsoziales Wesen agierte.
10
Laut Locke ist dies ,, Ein Zustand der Gleichheit, in dem alle Macht und Rechtssprechung
wechselseitig sind, da niemand mehr besitzt als ein anderer: Nichts ist einleuchtender, als
dass Geschöpfe von gleicher Gattung und von gleichem Rang, die ohne Unterschied zum
Genuss derselben Vorteile der Natur und zum Gebrauch derselben Fähigkeiten geboren
sind, ohne Unterordnung und Unterwerfung einander gleichgestellt leben sollen."
11
Hobbes folgerte in seiner staatstheoretischen Schrift ,,Leviathan" daraus, dass aufgrund der
Tatsache dass im Naturzustand jeder Mensch alleine seine Existenzberechtigung,
8
Klaus Macharzina/Joachim Wolf: Unternehmensführung Das internationale Managementwissen
Konzepte-Methoden-Praxis, Gabler Verlag, Wiesbaden 2008, Seite 37.
9
Michael Alznauer :Evolutionäre Führung: Der Kern erfolgreicher Führungspraxis; Gabler Verlag,
Wiesbaden 2006, Seite 19.
10
Wolfgang Kullmann :Aristoteles und die moderne Wirtschaft; Stuttgart 1998, Seite 432.
11
John Locke: Zwei Abhandlungen über die Regierung, Europäische Verlagsanstalt Frankfurt am Main
1967, Seite 201.
9
gegenüber den anderen Menschen durchsetzen muss, dies unweigerlich zu einem Krieg
jeder gegen jeden führt.
Da der natürliche Zustand, im Naturzustand, der Krieg ist, und jeder einzelne auch nur sein
eigener Richter, ist es für den laut Kant ,,vernünftigen Menschen" unmöglich sein
Eigentum und damit auch sein Leben in befriedigendem Maße schützen zu können.
Diese praktische Vernunft des Menschen, von Hobbes ,,recta ratio" genannt, fordert nun
von ihm aus diesem Naturzustand herauszutreten, um eben sein Naturrecht auf
Selbsterhaltung wahrnehmen zu können, damit der Zustand des Friedens den des ewigen
Krieges ablöst, und sein Recht auf Selbsterhalt durch ein soziales Gebilde durchgesetzt
werden kann.
12
Um diesem Zustand des ewigen Krieges entkommen zu können, muss der Mensch sich
also einer Obrigkeit unterordnen um so Rechtssicherheit zu erlangen, und somit seine
absolute und radikale Freiheit aufgeben.
Dieser evolutionäre Wendepunkt stellt somit den Ursprung aller sozialen und kulturellen
Entwicklungen dar, die den Menschen zu dem erfolgreichsten Gemeinschaftswesen haben
werden lassen.
Das Phänomen Führung und der soziale Gedanke haben, wenn man dieser Theorie folgt,
gleichen Ursprung und sind somit gleich alt.
Die Vorläufer der komplexen Organisationen unserer Zeit, waren in der menschlichen
Frühzeit die Sippen und den Anführer dieser Sippe würde man heute Manager nennen.
Die Führungsrolle der Sippenführer beschränkte sich zu Beginn des modernen Menschen
fast ausschließlich auf den physischen Selbsterhalt d.h. das Beschaffen von
Nahrungsmitteln, Kleidung, Brennmaterial, den Schutz vor Witterung und die
Verteidigung.
Mit der kulturellen, sozialen und technologischen Weiterentwicklung der Menschheit,
wurden die Aufgaben immer komplexer und die Bandbreite immer breiter.
Wo vorher eher körperliche Stärke zur Führung legitimierte, wurde immer mehr und mehr
auch der Intellekt und soziale Kompetenzen zu entscheidenden Faktoren.
Das Phänomen Führung hat sich gemeinsam mit dem Menschen immer weiter entwickelt
und legte bereits vor über 5.000 Jahren bei dem Bau der Pyramiden in Ägypten, Zeugnis
über gut geführtes Management ab.
13
12
Paul Geyer: Die Entdeckung des modernen Subjekts; Königshausen & Neumann Verlag, Würzburg 2007
Seite 84 ff.
13
Harald Hungenberg, Thorsten Wolf: Grundlagen der Unternehmensführung:, Springer Verlag 2004, Seite
35.
10
Darüber hinaus gab es auch bereits in der Antike theoretische Ansätze von Sokrates und
Aristoteles zu Fragen der Unternehmensführung.
14
Die moderne Unternehmensführungslehre allerdings, ist erst im Zuge der industriellen
Revolution entstanden und hat einen Großteil ihrer theoretische Basis in den Werken von
Adam Smith, besonders in seinem Hauptwerk ,,Der Wohlstand der Nationen" (1776).
15
Durch
die
Entstehung
immer
größerer
Unternehmen
wurde
auch
die
Unternehmensführungslehre vor immer größere und komplexere Herausforderungen
gestellt und musste angepasst werden.
Die anfänglichen Ansätze der Unternehmensführung haben sich auf die operative Ebene
konzentriert und dabei besonders die Arbeitsteilung und die leistungsgerechte Entlohnung
als Akkordarbeit im Fokus gehabt. Der Vordenker dieses Ansatzes ist F.W. Tayler (1856-
1915).
16
Auf dieses mechanistische Menschenbild aufbauend, erweitern Henri Fayol (1841-1925)
der sich neben der Optimierung der individuellen Einzelleistung auch für eine
Verbesserung der Organisation als Gesamtes einsetzt
17
und Max Weber (1846-1920), der
neben der Integrierung sozialer Aspekte besonders durch seine Theorie der Legitimität der
Herrschaft, dem sogenannten Bürokratieansatz, Einfluss auf die damalige
Unternehmensführungslehre nahm, die theoretische Basis der Unternehmensführung.
18
Durch die Hawthorne Experimente (1920) , und die durch die klassischen Theorien nicht
erklärbaren Resultate, gewann die Human-Relation Bewegung großen Einfluss auf die
damaligen Führungstheorien. Im Zuge dieser Bewegung kommt es zu einer Verschiebung
des arbeitswissenschaftlichen Fokus von den rein ökonomischen Funktionen des
Unternehmens, hin zu den menschlichen Beziehungen welche am Arbeitsplatz existieren.
19
Die Gruppe wird nun als soziales System wahrgenommen, in welchem Gefühle und
Emotionen die Leistung beeinflussen.
20
Die Logistikprobleme des zweiten Weltkrieges führten dann zu der Entwicklung von
mathematischen Führungsmodellen, welche bei der Formulierung und Lösung von
Entscheidungsproblemen auf exaktes mathematisches Zahlenmaterial zurückgreifen
konnten, und damit den Anspruch einer Naturwissenschaft erhoben.
14
Harald Hungenberg, Thorsten Wolf: Grundlagen der Unternehmensführung:, Springer Verlag 2004, Seite
35.
15
Karl Graf Bellestrem: Adam Smith: Beck Verlag 2001, Seite 135.
16
Edmund Heinen: Betriebswirtschaftliche Führungslehre; Gabler Verlag, Wiesbaden 1984, Seite 146.
17
Erich Kirchler: Arbeits- und Organisationspsychologie; Facultas Verlag, Wien 2008, Seite 48.
18
Erich Kirchler: Arbeits- und Organisationspsychologie; Facultas Verlag, Wien 2008, Seite 51.
19
Erich Kirchler: Arbeits- und Organisationspsychologie; Facultas Verlag, Wien 2008, Seite 66.
20
Günther Endruweit: Organisationssoziologie; Lucius & Lucius Verlag, Stuttgart 2004, Seite 65.
11
Besonders im Bereich der strategischen Unternehmensführung wurde allerdings erkannt
dass nicht alle Planungsprobleme in mathematischen Modellen abbildbar sind.
21
Unter dem Einfluss der Systemtheorie, die Unternehmen als autopoietische Systeme
begreift
22
, welche sich ihrerseits in Subsysteme aufgliedern lassen, und selbst ein
Subsystem der Gesellschaft sind, wurde die Unternehmensführungstheorie um neue
Instrumentarien erweitert, welche sich nachhaltig in der Management-Praxis und Theorie
etabliert haben. Laut dieser Theorie besteht innerhalb der Unternehmen sowie in deren
Kontext eine Vielzahl von Wirkungsbeziehungen, welche dann von jeder in das System
eingreifenden Führungsentscheidung eine Folgewirkung, sowohl ökonomischer wie auch
nicht ökonomischer Natur, erwarten lässt.
23
In der Unternehmenspraxis hat sich der systemtheoretische Ansatz ebenfalls bewährt, und
zwar besonders in der Erklärung des Verhaltens im Unternehmen durch den Management-
Regelkreis und im Bereich der Führungstatbestände in Form einer Handlungsfolge
bestehend aus Ist-Analyse, Formulierung eines Soll-Konzepts und dessen Implementierung
.
24
Parallel zum systemtheoretischen Denken haben kontingenztheoretische Ansätze die
Unternehmensführungslehre seit den 70'er Jahren ebenfalls maßgeblich mitgeprägt.
Nach
den
kontingenztheoretischen
Ansätzen
ist
es
im
Rahmen
der
Unternehmensführungslehre nicht möglich, allgemein gültige Aussagen zum
Zusammenhang zwischen zwei Variablen zu treffen. Dieser Zusammenhang wird vielmehr
durch die vorherrschenden situativen Rahmenbedingungen geprägt.
Dementsprechend werden diese Ansätze in der Fachliteratur auch situative Ansätze
genannt.
25
Die Unternehmensführung muss, um eine höchstmögliche Effizienz der Organisation zu
erreichen, eine höchstmögliche Kongruenz zwischen Situation und Organisationsstruktur
schaffen.
26
21
Harald Hungenberg, Thorsten Wolf: Grundlagen der Unternehmensführung:, Springer Verlag 2004, Seite
44.
22
Karl G. Kasenbacher: Gruppen und Systeme, Leske+Budrich Verlag, Opladen 2003, Seite 26.
23
Klaus Macharzina/Joachim Wolf: Unternehmensführung Das internationale Managementwissen
Konzepte-Methoden-Praxis, Gabler Verlag, Wiesbaden 2008, Seite 70.
24
Klaus Macharzina/Joachim Wolf: Unternehmensführung Das internationale Managementwissen
Konzepte-Methoden-Praxis, Gabler Verlag, Wiesbaden 2008, Seite 70.
25
Harald Hungenberg, Thorsten Wolf: Grundlagen der Unternehmensführung:, Springer Verlag 2004, Seite
46.
26
Karin Exner: Controlling in der New Economy; Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden 2003, Seite 22.
12
Obwohl sich die situativen Annahmen lediglich auf Plausibilitätsannahmen stützen und
sich damit oft dem Vorwurf der Theorielosigkeit ausgesetzt sahen, wurde der situative
Ansatz weiter verfolgt und vervollständigt.
27
Durch die Aufnahme immer weiterer Variablen wie Umwelt, Technologie, Kultur,
Fähigkeiten usw. in die Theorie prägt der situative Ansatz die heutige
Unternehmensführungslehre maßgeblich mit, da damit das komplexe und sich permanent
anpassende Unternehmensumfeld als am ehesten beschreibbar scheint.
Der erhebliche Wissenszuwachs über diese Faktoren, die für den langfristigen Erfolg einer
Unternehmung von vitaler Bedeutung sind, hat den Unternehmensführungshorizont von
der langfristigen Planung hin zur strategischen Unternehmensführung erweitert.
Die Integrierung der strategischen Planung in die Unternehmensführungstheorie hat zu
einer immer stärkeren Trennung zwischen operativer Unternehmensführung und
strategischer Unternehmensführung geführt.
28
Besonders die Globalisierung und die sich intensivierende Vernetzung der Weltwirtschaft
machen das Erkennen von Marktchancen, das Schaffen und Erhalten eigener
Erfolgspotenziale zu einem, für die Unternehmen, überlebensnotwendigen Aspekt der
Unternehmensführung.
Den, in der operativen Unternehmensführung, maßgebenden Größen Erfolg und Liquidität,
wird eine systematische und organisierte Vorsteuerung vorgelagert, welche durch eine
strategische Steuerung der Erfolgspotenziale, der operativen Führung später maßgebende
Effizienz- und Bewegungsspielräume schafft.
29
All diesen Aspekten der Unternehmensführungstheorie ist eine fast ausschließliche
Konzentration auf das Unternehmen, seine Mitarbeiter und diejenigen Systeme die direkte
Interaktionspartner sind vorzuwerfen.
Indirekte Auswirkungen des eigenen unternehmerischen Handelns wie Umweltschädigung,
Ressourcenverknappung, indirekte Beeinträchtigung der Existenz Dritter oder potenzielle
systemische Gefährdung finden größtenteils nur insoweit Beachtung als dass sie die
Bilanz betreffen.
Nachdem die rein betriebswirtschaftlich-liberale Ausrichtung der Unternehmen sowohl zu
irreparablen Schädigungen der Umwelt, wie auch zu systemischen Fehlentwicklungen und
zu systemischem Marktversagen, wie in der aktuellen Weltwirtschaftskrise sichtbar,
27
Michael Urselmann: Erfolgsfaktoren im Fundraising von Non-Profit Organisationen; ; Deutscher
Universitätsverlag, Wiesbaden 1998, Seite 38.
28
Alois Gälweiler: Strategische Unternehmensführung; Campus Verlag, Frankfurt/Main 2005, Seite 23.
29
Alois Gälweiler: Strategische Unternehmensführung; Campus Verlag, Frankfurt/Main 2005, Seite 24.
13
geführt hat, finden soziale und ethische Aspekte in der Ausrichtung der
Unternehmensstrategie immer mehr Beachtung.
Der Druck der Öffentlichkeit hat, wertorientierte Unternehmensführung bzw. die
Integrierung ethischer, ökologischer und sozialer Standards in die Unternehmenskultur,
sowie ganzheitliche Ansätze verantwortlicher Unternehmensführung zu mathematisch-
betriebswirtschaftlich relevanten Erfolgsgrößen gemacht.
Ethische und moralische Aspekte sind inzwischen zwar ein fester Bestandteil in der
Unternehmensführungstheorie,
konnten
sich
jedoch
in
der
Praxis
gegen
betriebswirtschaftliche Aspekte nicht behaupten und werden daher in der Praxis
mehrheitlich nur dann integriert, wenn es gesetzlich vorgeschrieben wurde.
Als größte Herausforderung der Unternehmensführung, kann der langfristige Erhalt des
Ökosystems, und die Minimierung systemischer Risiken angesehen werden.
2.1.2.
Philosophisch Moralische Handlungsbasis der Unternehmensführung
Die Frage was das menschliche Gegenüber tun wird, wieso er es tun wird, oder wieso er
das was er gemacht hat genau so gemacht hat, ist eine der ältesten Überlegungen der
Menschheit.
Luhmann sah in den Menschen unberechenbare Lebewesen bzw. Systeme, die jederzeit
den Handlungsspielraum haben, nach eigenem, freiem Entschluss zu handeln, und nannte
diesen offenen Spielraum ,,Kontingenz"
30
Unter ,,Doppelte Kontingenz" versteht man die Problematik wenn mindestens zwei über
Kontingenz verfügende Menschen aufeinandertreffen, sich als unbeschriebene Blätter
gegenüberstehen und erkennen dass das jeweilige Gegenüber auch kontingent und
sinngesteuert ist. Das Erkennen der ,,Doppelten Kontingenz" bildet die evolutionäre
Grundlage für, sich stets momenthaft aktualisierende soziale Systeme, da die Beobachtung
und der Aufbau einer eigenen Erwartungshaltung gegenüber seinem Gegenüber zu einer
eigenen Handlungseinleitung unerlässlich ist, und damit, durch das aufeinander bezogene
erwartungsgesteuerte Verhalten, einen emergenten Sachverhalt des Sozialen darstellt.
31
Um das soziale Leben zu vereinfachen bzw. im Grund erst zu ermöglichen, haben die
Menschen eine Einschränkung ihres theoretisch offenen Handlungsspielraum
hingenommen, um dann ihrerseits eine konkretere Erwartungshaltung gegenüber ihrer
30
Karl G. Kasenbacher: Gruppen und Systeme, Leske+Budrich Verlag, Opladen 2003, Seite 35.
31
Detlev Krause: Luhmann-Lexikon; Verlag Lucius & Lucius, Stuttgart 2005, Seite 18.
14
Umwelt aufbauen zu können, da davon ausgegangen wird, dass die soziale Umwelt diese
Handlungseinschränkungen ebenfalls integriert hat.
Diese Einschränkungen können entweder selbst auferlegt sein, also moralischer Natur,
oder auch institutioneller Natur sein. Institutionelle Handlungseinschränkungen sind
offensichtlich von Menschen geschaffen und enthalten Normen deren Nichtbefolgung
Sanktionen nach sich ziehen.
32
Bei sozial- kulturellen Handlungseinschränkungen wie z.B. durch normative
Werterahmen, religiöse Grundwerte usw. werden Verstöße mit sozialen Sanktionen wie
Ablehnung, Ächtung oder Gruppenausschluss geahndet.
Bei rechtlich institutionalisierten Handlungseinschränkungen, hinter denen der Staat als
einziger Träger legaler physischer Gewalt steht, sind die Sanktionen juristischer Natur und
können von der Einschränkung von Bürgerrechten, bis hin zu dem Entzug der Freiheit, in
einigen, zum Glück nur noch wenigen, Staaten sogar des Lebens, gehen.
Innerhalb dieser Einschränkungen hat sich der Mensch in der demokratisch-freiheitlichen
Welt aber noch ein großes Maß an persönlicher Freiheit erhalten, und kann, da er die
sozialen und institutionellen Einschränkungen bereits integriert hat, und diese damit
meistens gar nicht mehr hinterfragt, aus seiner Perspektive über sein Leben frei
entscheiden.
Für diese Arbeit wird besonders die Freiheit des Menschen im Wirtschaftsleben fokussiert.
Im Wirtschaftsbereich sind z.B. für viele institutionelle Tatsachen moralischer Natur keine
rechtlichen Sanktionen vorgesehen, wie z.B. für die durch Lobbyisten durchgesetzte
Besserstellung gewisser Wirtschaftseinheiten, für Lohn-Dumping, aktuell für das Manager
Vergütungssystem, für Ressourcenverschwendung usw.
Im Rahmen dieser persönlichen Freiheit kann ein Mensch frei entscheiden was er aus sich
und seinem Leben machen möchte.
Die Frage ob bei einer Entscheidung noch andere Faktoren als der persönliche, subjektiv
als frei empfundene Wille, eine Rolle spielt, ist einer der ältesten
Untersuchungsgegenstände der Philosophie und schließlich der Psychologie.
Nach dem Humeschen Handlungsmodell, welches auf den englischen Empiristen David
Hume zurückgeführt wird, geht jede menschliche Handlung, sofern sie intelligent und
situationsangepasst ist, einerseits auf Überzeugungen (beliefs) und andererseits auf
Wünsche (desires) zurück. Die Wünsche legen dabei die zu erreichenden Ziele und deren
32
Rafael Ferber: Philosophische Grundbegriffe; Verlag Beck, München 2003, Seite 176.
15
Prioritäten fest und die Überzeugungen spiegeln die Annahmen des Subjekts über kausale
Verkettung oder Subsumptionszusammenhänge zwischen Ereignissen.
33
Wünsche bilden die voluntative oder motivationale Quelle des Handelns, und die
Überzeugungen die kognitive Vorbedingung. Wünsche und Überzeugungen werden
rational aufeinander bezogen und abgeglichen, bis schließlich mit einem Kompromiss, der
Ausgangspunkt der praktischen Überlegung entsteht, worauf dann in der Regel die
Handlung erfolgt.
34
Die Frage welcher Mensch welche Wünsche und welche Überzeugungen und damit auch
welches konsistente, nach außen gerichtete, Verhalten er hat, ist ebenfalls ein
Untersuchungsgegenstand der die Menschheit seit langem beschäftigt.
Persönlichkeitstheoretikern unterteilen Menschen in klar umgrenzte, nicht überlappende
Kategorien, die man als Persönlichkeitstypen bezeichnet.
35
Auf der Körpersafttheorie des Hippokrates aufbauend, entwickelte der griechische Arzt
Galenos im 5. Jahrhundert eine Theorie, nach der die Persönlichkeit eines Menschen davon
abhänge welcher Körpersaft vorherrsche. Dieser kombinierte die Körpersäfte nach
Hippokrates nach folgendem Schema mit Persönlichkeitstypen:
36
Blut: Sanguinistisches Temperament; fröhlich und aktiv
Schleim: Phlegmatisches Temperament; apathisch und träge
Schwarze Galle: Melancholisches Temperament; traurig und grüblerisch
Gelbe Galle: Cholerisches Temperament; aufbrausend und reizbar
William Sheldon (1942) hat eine Typologie erstellt, die den Körperbau in Verbindung zu
der Persönlichkeit setzte und Frank Sulloway ging sogar davon aus dass man Menschen
nach der Geburtsreihenfolge typologisieren kann.
37
Erst das ,,Fünf Faktoren Modell" von Paul Costa und Robert McRae, konnte jedoch auch
modernen wissenschaftliche Prüfungen glaubhaft standhalten und prägt seitdem diese
Forschungsrichtung als Status Quo.
Laut persönlichkeitspsychologischer Forschung stellen die Big Five hinsichtlich
Messqualität das, zur Zeit gültige kulturübergreifende Referenzsystem dar und werden als
universelle Transferplattform zwischen unterschiedlichsten diagnostischen Instrumenten
benutzt.
33
Martin Endreß/ Neil Roughley: Anthropologie und Moral; Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg
2000, Seite 246.
34
Martin Endreß/ Neil Roughley: Anthropologie und Moral; Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg
2000, Seite 246
35
Philipp G. Zimbardo, Richard J. Gerrig: Psychologie; 2008 by Pearson Studium, Seite 505.
36
Philipp G. Zimbardo, Richard J. Gerrig: Psychologie; 2008 by Pearson Studium, Seite 505.
37
Philipp G. Zimbardo, Richard J. Gerrig: Psychologie; 2008 by Pearson Studium, Seite 506.
16
Mithilfe der Big Five und ihrer Subtests können daher auch die Begriffssysteme jedes
beliebigen Persönlichkeitsinventares übersetzt, ,,transformiert" und im Big-Five Standard
dargestellt und beschrieben werden.
38
Die Führungsmotivation der Menschen liegt also eher in ihrer Persönlichkeit und nicht in
ihrer Moral, was dann dazu führt dass sich Unternehmensführung ausschließlich durch die
Gesellschaft moralisch legitimieren kann.
Die Gesellschaft fordert von ihren Mitgliedern dass sie freiwillig persönliche
Entscheidungsfreiheiten an zentrale Führungspersonen oder Organisationen abgeben, da
sie davon ausgeht, dass die Gesellschaft einen Vorteil durch die Zentralisierung von
Entscheidungsgewalt zu erwarten hat. Wenn sich Menschen in ihrem ökonomischen
Streben der Leitung einer Unternehmensführung unterordnen, so kann diese Leitung nur
durch einen materiellen Vorteil für die Gesellschaft moralisch legitimiert werden.
Es folgt somit dass Unternehmensleitung ohne einen materiellen Vorteil für die
Gesellschaft keine moralische Handlungsbasis hat.
Das Augenmerk dieser Arbeit richtet sich besonders auf die Frage wieso Menschen sich
dazu berufen fühlen Unternehmen zu gründen, andere Menschen zu führen, Verantwortung
für diese und deren Handeln zu übernehmen, woraus sie ihre Motivation ziehen und wie
sie schlussendlich ihre Führungsentscheidungen vor sich selbst und ihrer Umwelt
legitimieren.
2.1.3.
Ansätze verantwortlicher Unternehmensführung
Bereits im Februar 1973 formulierten führende Wirtschaftsvertreter in Davos einen
Entwurf für den ,,Kodex des ethischen Wohlverhaltens" für die Unternehmensführung, der
unter dem Namen ,,Davoser Manifest" in der Öffentlichkeit bekannt wurde.
39
Der Kodex hielt fest, dass die Unternehmen neben den Kunden, Mitarbeitern und
Geldgebern auch der Gesellschaft zu dienen hätten.
40
Weiterhin wurde auch die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt für die nachfolgenden
Generationen und die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen explizit
festgehalten.
38
Walter Simon: Persönlichkeitsmodelle und Persönlichkeitstests; Gabal Verlag, Offenbach 2006, Seite 115.
39
Andrea Maurer, Uwe Schimank: Die Gesellschaft der Unternehmen-Die Unternehmen der Gesellschaft;
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, Seite 146.
40
Michael Hülsmann, Georg Müller-Christ, Hans-Dietrich Haasis: Betriebswirtschaftslehre und
Nachhaltigkeit; Deutscher Universitätsverlag; Wiesbaden 2004, Seite 77.
17
In Europa wurde der Fokus auf die soziale Verantwortung der Unternehmen besonders
durch das ,,Grünbuch: Europäische Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung der
Unternehmen" gelegt, welches 2001 von der Europäischen Kommission herausgegeben
wurde.
41
Das Konzept nachhaltiger Unternehmensführung hatte zwar immer schon eine theoretische
und insbesondere marketingtechnische Attraktivität, konnte sich aber in der
Unternehmenspraxis aufgrund höherer Kosten nicht stabil etablieren.
Mit dem Hintergrund der aktuellen Weltwirtschaftskrise und den damit verbundenen
Erkenntnissen, erscheint eine verantwortliche nachhaltige Unternehmensführung, als
Antipode zu dem gescheiterten Modell des Share-Holder Value Prinzips, als
unverzichtbare Orientierung für die strategische Positionierung des Unternehmens.
In der Praxis haben sich mehrere Ansätze herauskristallisiert welche das Stadium der rein
wissenschaftlichen Auseinandersetzung verlassen haben, und in der Praxis integriert
werden konnten.
42
2.1.3.1.Corporate Social Responsability (CSR)
,,CSR ist ein Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger
Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die
Wechselbeziehung mit ihren Stakeholder zu integrieren. Sozial verantwortlich
handeln heißt nicht nur, die gesetzlichen Bestimmungen einhalten, sondern über die
bloße Gesetzeskonformität hinaus ,,mehr" investieren in Humankapital, in die
Umwelt und in die Beziehungen zu anderen Stakeholdern."
43
-
EU Kommission 2001-
CSR kann sowohl als betriebswirtschaftliches Konzept zur betrieblich orientierten
Verantwortung, als auch als Norm, in Form von Verhaltenskodizes oder
Unternehmensleitlinien aufgefasst werden.
Die konzeptionellen Grundlagen der CSR wurden Mitte des 20'en Jahrhunderts in den
USA gelegt und entstanden aus einer ethisch-moralischen Verantwortungsübernahme der
Unternehmen für ihr Handeln heraus.
44
41
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2001/com2001_0366de01.pdf
,
42
Katharina Schmitt: Corporate Social Responsibility in der strategischen Unternehmensführung; Berlin
2005, Seite 11.
43
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2001/com2001_0366de01.pdf
,
18
Der Schwerpunkt der damaligen Ansätze lag auf einer normativen Verankerung der
ethischen Verpflichtung des Unternehmens und der strategischen Einbindung
gesellschaftlicher Bedürfnisse. Trotz dem Trend zur Operationalisierung konnten sich die
Grundmodelle der CSR in der Praxis nicht durchsetzen.
45
2.1.3.2.Nachhaltige Unternehmensführung
Nachhaltige Unternehmensführung hat ihren Ursprung nicht in einem rein
betriebswirtschaftlichen Konzept, sondern wurde durch das Leitbild der UN-Konferenz
von 1992 in Rio de Janeiro maßgeblich geprägt und beruht eher auf volkswirtschaftlichen
und politischen Überlegungen.
Das Leitbild der UN Konferenz beruht auf dem sogenannten Brundtland Bericht von 1987,
der nach seinem Vorsitzenden dem ehemaligen Norwegischen Ministerpräsidenten Gro
Harlem Brundtland benannt wurde. Nach der Definition dieser Kommission ist eine
Entwicklung dann nachhaltig, wenn sie die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu
riskieren, dass die zukünftigen Generationen ihre Bedürfnisse nicht mehr befriedigen
können.
46
Dabei werden die Dimensionen, oder die 3-Säulen der Nachhaltigkeit, ökonomisch,
ökologisch und sozial in dem Leitbild unterschieden und ein Einklang dieser angestrebt.
Auf betriebswirtschaftlicher Ebene wurde die sogenannte ,, Triple Bottom Line"
entwickelt, die ebenfalls auf den 3-Säulen der Nachhaltigkeit basierend, darauf
ausgerichtet ist, die Unternehmensaktivitäten bezüglich der
sozialen, ökologischen und
ökonomischen Nachhaltigkeitsherausforderungen auszurichten.
47
Die Triple Bottom Line strebt eine 3-Dimensionale Wertschöpfung an. Neben den sozialen
und ökologischen Aspekten, welche bereits in der CSR fokussiert werden, ist der
Kapitalerhalt ein zentraler Gesichtspunkt, welcher allerdings bei Widersprüchlichkeit der
Ziele, den anderen beiden Dimensionen untergeordnet wird.
48
44
Katharina Schmitt: Corporate Social Responsibility in der strategischen Unternehmensführung; Berlin
2005, Seite 27.
45
Katharina Schmitt: Corporate Social Responsibility in der strategischen Unternehmensführung; Berlin
2005, Seite 27.
46
Christian Leitz: Corporate Social Responsability; Diplomarbeit 2008, Seite 8.
47
Katharina Schmitt: Corporate Social Responsibility in der strategischen Unternehmensführung; Berlin
2005, Seite 17.
48
Christian Leitz: Corporate Social Responsability; Diplomarbeit 2008, Seite 9.
19
2.1.3.3.Unternehmensethik
Die Überprüfung der unternehmerischen Entscheidungen auf ethische Vereinbarkeit und
Legitimität ist der Hauptuntersuchungsgegenstand der Unternehmensethik.
Sie reflektiert die funktionalen Imperative der Unternehmung als gewinnorientiertes
Selbstbehauptungssystem.
49
Anhand eines Wertesystems und ethischen Kriterien werden unternehmerische
Handlungen überprüft und bewertet. Das Konzept der Unternehmensethik ist somit ein
stark werte- und normenorientiertes Führungskonzept,
50
und somit hauptsächlich im
normativen Management verankert. Es werden alle im Unternehmenskontext getroffenen
Entscheidungen betrachtet und die Auswirkungen kollektiv der Unternehmensleitung
zugeordnet, da diese, durch die Erstellung eigener Regeln, für das ethische Handeln im
Unternehmen und dessen Verhalten nach Außen verantwortlich ist.
51
Die Unternehmensethik bietet einen auf moralischen Grundsätzen basierenden
Werterahmen,
der
ausschließlich
als
ideelle
Orientierungshilfe
bei
der
Entscheidungsfindung dienen soll.
2.1.3.4.Corporate Accountability (CA)
Corporate Accountability ist ein relativ neues Unternehmensführungskonzept und
besonders vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise und dem oft unverantwortlichen
und unverantworteten Handeln von Marktteilnehmern ein zukunftsweisender Ansatz.
Crane/Matten definieren CA folgendermaßen ,,Corporate Accountability refers to whether
a
corporation is answerable in some way for the consequences of its actions"
52
Die Hauptaufgabe der CA besteht darin, die Unternehmensleistung hinsichtlich ihrer
ökonomischen, ökologischen und sozialen Wirkung für die Öffentlichkeit aufzubereiten,
transparent darzulegen und die, zur Verifizierung der Unternehmensdaten, relevanten
Informationen leicht zugänglich zu machen.
53
49
Thomas Rusche: Philosophische versus ökonomische Imperative einer Unternehmensethik; Lit Verlag
Münster, Seite 11.
50
Katharina Schmitt: Corporate Social Responsibility in der strategischen Unternehmensführung; Berlin
2005, Seite 17.
51
Hartmut Kreikebaum, Michael Behnam, Dirk Ulrich Gilbert: Management ethischer Konflikte in
international tätigen Unternehmen; Gablerverlag, Wiesbaden 2001, Seite 8.
52
Andrew Crane/Dirk Matten: Business Ethiks; Oxford University Press, Oxford 2007, Seite 64.
53
Katharina Schmitt: Corporate Social Responsibility in der strategischen Unternehmensführung; Berlin
2005, Seite 18.
20
Die Implementierung der zu der Gewinnung, Aufbereitung und Darstellung der
Unternehmensdaten, notwendigen Managementsysteme stellt dabei die anspruchvollste
Aufgabe dar.
CA geht über die reine Bekenntnis zu sozialer Verantwortung hinaus und übernimmt, in
einem gewissen Haftungsumfang, Verantwortung für negative unternehmerische
Ergebnisse.
Besonders die Verbindlichkeit des Konzeptes, die verstärkte Transparenz und die
Grundannahme dass Unternehmen der Gesellschaft Rechenschaft abzulegen haben,
kommen den Forderungen der Öffentlichkeit, welche die Unternehmen für ihre negativen
Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit in Haftung nehmen will, sehr nahe.
2.1.3.5. ISO 26000 ,,Guidance on social Responsibility" (
Stand Mai 2010)
Die ISO 26000 ist eine, von der International Standards Organisation, geplante
umfassende, international ausgerichtete Norm, die gesellschaftlich verantwortliches
Handeln für alle Arten für Organisationen definiert, und dafür die entsprechenden
Empfehlungen zur Verfügung stellt.
54
ISO 26000 soll helfen, die durch die Globalisierung entstandenen Herausforderungen,
sozial und ökologisch verantwortungsvoll, zu meistern.
Um auch eine internationale Akzeptanz zu erreichen, nehmen über 90 Länder an der
Entwicklung der Norm teil.
Ziel der internationalen Norm ist es:
55
Organisationen bei der Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung im
Rahmen unterschiedlicher Kulturen, Gesellschaften, ökologischen Umgebungen
und Rechtsräumen zu unterstützen
Organisationen praktische Unterstützung bei der Identifizierung und Einbindung
der Stakeholder und bei der Stärkung der Glaubwürdigkeit der Berichterstattung zu
geben
Den Bekanntheitsgrad gesellschaftlicher Verantwortung zu erhöhen
54
http://www.netzwerksozialeverantwortung.at/TCgi/nesove/TCgi.cgi?target=home&P_kat=21&P_katSub=48
,
55
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-
8929321/8929339/8929348/3935837/8471348/8471349/Pr%C3%A4sentation_ISO_26000_200908.pdf?node
id=8493260&vernum=-2
,
21
Das Vertrauen und die Zufriedenheit der Konsumenten und Anspruchsgruppen
gegenüber Organisationen erhöhen
Die ISO 26000 entwickelt ihre Leitlinien aus sieben Grundprinzipien, die auch das
Fundament der gesellschaftlichen Wahrnehmung bezüglich sozialer Verantwortung
darstellen, und an denen die Organisationen ihr Handeln und ihre Ausrichtung ausrichten
sollten. Die sieben Grundprinzipien sozial verantwortungsvollen Handelns sind:
56
Rechenschaftspflicht
Transparenz
Ethisches Verhalten
Stakeholder-Orientierung
Gesetzestreue
Internationale Verhaltensstandards
Menschenrechte
Das Konzept der ISO 26000 Norm ist eng an das Konzept der Corporate Social
Responsability angelehnt, mit dem Unterschied dass sich diese Norm an alle Arten von
Organisationen wendet und nicht nur an Unternehmen der Privatwirtschaft.
Die ISO 26000 wird eine nicht zertifizierte Norm sein, und somit nur Anleitungen und
Empfehlungen bezüglich der sozialen und ökologischen Verantwortung von
Organisationen geben.
2.2.
Begriff und Definition der Moral
Das Wort Moral folgt dem lateinischen Stammwort mos oder mores ( Sitte, Brauch,
Gewohnheit, Charakter).
57
Die Bedeutung des Begriffs Moral ist seit dem von Cicero geprägten Terminus philosophia
moralis einem stetigen Wandel unterlegen. Heute versteht man unter dem Begriff Moral
ein System von anerkannten sittlichen Normen und Werte und deren Implementierung im
56
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-
8929321/8929339/8929348/3935837/8471348/8471349/Pr%C3%A4sentation_ISO_26000_200908.pdf?node
id=8493260&vernum=-2
,
57
Alexander Brink: Philosophische Analyse und Bewertung des Share-Holder Value Konzept;
Magisterarbeit an der Ruhruniversität Bonn; Seite 41.
22
täglichen Leben,
58
sowie den Anspruch der Mitmenschen an das eigene Bewusstsein und
Gewissen.
Cicero und Platon reihen die Moral neben die Logik und die Physik als dritten Teil der
Philosophie ein.
59
Im Alltag begegnet uns die Moral als ,,Regulator" intersubjektiver Verhältnisse und ist
durch Bereitstellung von sittlichen Handlungsnormen, moralischer Werturteile, und
moralischer Institutionen (Eigentum) gleichzeitig Orientierungshilfe praktischen
Handelns.
60
2.2.1.
Die Evolution des moralischen Handelns
,,But neither of us accuse man`s nature in it. The Desires, and other Passions of man, are
in themselves no Sin. No more are the Actions that proceed from those Passions, till they
know a Law that forbids them: which till Laws be made they cannot know; nor can any
Law be made, till they have agreed upon the Person that shall make it."
Thomas Hobbes
Thomas Hobbes, ein englischer Philosoph und Mathematiker (1588- 1679) ging davon aus,
dass der Mensch bevor er zum sozialen, moralischen Wesen wurde im sogenannten
Naturzustand lebte.
Dieser Zustand gesteht jedem Menschen das Recht auf Alles zu, das heißt das jeder
Mensch selbst frei entscheiden kann was er zu seiner Selbsterhaltung glaubt tun zu müssen,
ohne für sein Tun irgendwelche Sanktionen zu fürchten zu haben, da es weder Gesetze
noch Normen gibt.
61
Jede Handlung die der Mensch im Naturzustand zur Erhaltung seiner selbst ausführt, ist
rechtens, da nur er selbst entscheidet was Recht und was Unrecht ist. Da er die Handlung
zur Selbsterhaltung bzw. zu seinem Vorteil ausführt, ist sie aus seiner Sicht, und die ist im
Naturzustand absolut, immer rechtens.
62
58
Johann Platzer: Friedrich Nietzsche-Erkenntnis und Moral als Selbstaufhebung; Diplomarbeit Berlin, Seite
63.
59
Alexander Brink: Philosophische Analyse und Bewertung des Share-Holder Value Konzept;
Magisterarbeit an der Ruhruniversität Bonn; Seite 41.
60
Holger Burckhart: Philosophie, Moral, Bildung; Verlag Königshausen &Neumann, Würzburg 1999, Seite
105.
61
Thomas Hobbes/ Günther Gawlick: Vom Menschen; Verlag Felix Meiner, Hamburg 1994, Seite 82.
62
Thomas Hobbes/ Günther Gawlick: Vom Menschen; Verlag Felix Meiner, Hamburg 1994, Seite 82.
23
Hobbes sagte aber auch, das dieses Recht auf Alles, was man zu seiner Selbsterhaltung als
notwendig erachtete, für die Menschen keineswegs von Vorteil war, denn die Wirkung
dieses Rechts war die Gleiche, als ob überhaupt kein Recht bestände.
,,Wenn jeder von einer Sache sagen konnte: diese ist mein, so konnte er doch seines
Nachbarn wegen diese Sache nicht genießen, da dieser mit gleichem Recht und gleicher
Macht behauptete, dass sie sein sei."
63
Thomas Hobbes
Die Folgerung Hobbes war, dass damit der natürliche Zustand der Menschen, bevor sie zur
Gesellschaft zusammentraten, der Krieg war, und zwar ein permanenter Kriegszustand
aller gegen alle.
64
Trotzdem erschien es Hobbes evident, dass es dem natürlichen Interesse der Menschen zur
Selbsterhaltung widerspricht, wenn er sich einer permanenten gegenseitigen
Lebensbedrohung ausgesetzt sieht. Die Vernunft, von Hobbes rein militaristisch, als
Instrument zur Lebenserhaltung und Lebenssteigerung aufgefasst, fordert von den
Menschen den Frieden zu suchen und damit auf ihr natürliches Recht auf Alles zu
verzichten.
65
Trotzdem sieht er den Menschen im Naturzustand nicht als absolut böse und unmoralisch,
sondern
betont
nur
dass
der
Lebenserhaltungstrieb
all
die
anderen
Persönlichkeitsausprägungen überdeckt und damit die Aktivierung dieser verhindert.
Da jedoch alle Zusicherungen, Verträge oder Gelübde im Naturzustand ohne jegliche
Bindung sind und damit auch jegliche persönliche Sicherheit nicht garantiert werden kann,
ist es für die Menschen unerlässlich sich in Gesellschaft zu begeben und einen
,,Gesellschaftsvertrag" zu schließen, der durch seine Regeln, Konventionen und,
staatstheoretisch gesehen, Gesetze, die Minimalbasis menschlichen Zusammenlebens
bildet.
Während Hobbes, Locke und Pufendorf mit dem Ausgang vom fiktiven status naturalis
und dem damit einhergehenden Gesellschaftsvertrag, noch die Einrichtung des Staates
philosophisch rechtfertigen wollten
66
, geht Rousseau in seiner Abhandlung ,,Vom
Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts" bereits weiter, und fordert für die
Vertragsschließenden annähernde ökonomische Gleichheit, juristische Freiheit, und
63
Thomas Hobbes/ Günther Gawlick: Vom Menschen; Verlag Felix Meiner, Hamburg 1994, Seite 83.
64
Thomas Hobbes/ Günther Gawlick: Vom Menschen; Verlag Felix Meiner, Hamburg 1994, Seite 84.
65
Thomas Hobbes: Leviathan; Verlag FinanzBuch, München 2006, Seite 301.
66
Reinhard Brandt: Jean-Jaques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Seite
31.
24
insbesondere eine Legislative demokratischer Gestalt, in der das Recht zur Gesetzgebung
allen Bürgern gemeinsam ist.
67
Es blieb aber Kant vorbehalten den moralphilosophischen Aspekt in die Theorie des
Gesellschaftsverträge einzubauen. Er folgerte, dass wie der gegenwärtigen rechtlich-
bürgerlichen Gesellschaft ein rechtlicher Naturzustand vorausgegangen sei, so ist auch die
religiöse bzw. moralische Gesellschaft aus einem moralischer Naturzustand
hervorgegangen.
68
Kant erachtet dabei die menschlichen Gesetze die ein Gesellschaftsvertrag beinhaltet, als
nicht geeignet um den Übergang vom ethischen Naturzustand zum ethischen Gemeinwesen
einzuleiten und verweist auf die sogenannten öffentlichen Gesetze, die vom göttlichen
Gesetzgeber, dem moralischen Weltenherrscher, erlassen wurden, welche auch zugleich
innere Gesetze sind, weil der Gesetzgeber ein Herzenskündiger ist.
69
Somit hat Kant die Parallele der Entstehung der rechtlich-bürgerlichen und der ethisch-
bürgerlichen Gesellschaft gerechtfertigt und gleichzeitig dem Ursprung der moralisch-
praktischen Vernunft des Menschen, mit deren oberstem Prinzip der Sittlichkeit, göttlichen
Charakter zugewiesen.
Der Ursprung des sozialen Gedankens, der menschlichen Kultur und auch der Moral kann
somit in dem Übergangsstadium aus dem Naturzustand in die sozial-bürgerliche
Gesellschaft gesehen werden.
Die für uns wichtigen Aspekte der Führung und der Moral haben damit die gleichen
evolutionären Wurzeln und somit eine gewisses Parallelitätspotenzial für ihre Entwicklung.
Die Moralphilosophie der westlichen Welt ist entscheidend von den griechischen
Philosophen der Antike geprägt und größtenteils sogar begründet worden.
,,Vor der Griechen Zeit ist von Logik, Ethik, Naturphilosophie, nirgendwo die Rede".
70
Immanuel Kant
In der griechischen Philosophie ist das Kriterium des richtigen Handelns nicht von außen
durch göttliche Offenbarung gegeben, sondern muss im Menschen selbst gefunden
werden.
71
Diese Überzeugung hat zur Folge dass die griechische Moralphilosophie trotz
aller Verschiedenheiten, eine einheitliche Meinung darüber hat, dass das richtige und gute
67
Reinhard Brandt: Jean-Jaques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, Seite
35.
68
Norbert Fischer: Kant`s Metaphysik und Religionsphilosophie; Verlag Felix Meiner 2004, Seite 241.
69
Norbert Fischer: Kant`s Metaphysik und Religionsphilosophie; Verlag Felix Meiner 2004, Seite 242.
70
Carl August Eschenmayer: System der Moralphilosophie; Tübingen 1818, Seite 40.
71
Kurt von Fritz: Grundprobleme der Geschichte der antiken Wissenschaft; Verlag Walter de Gruyter& Co
1971, Seite 520.
25
Handeln, den der so handelt, glücklich machen muss und somit durchweg eudaemonistisch
ist.
72
Während Sokrates und Platon Moral als ein öffentliches Gut ansehen, diese somit auch
ökonomisch zu begründen sei, was dann wiederum zur Ausrichtung ökonomischer
Handlungen an der öffentlichen Moral verpflichtet, sieht Aristoteles seinerseits keine
Sicherheit in der Frage, ob auf die Einsicht, welche Handlung gut ist, auch automatisch die
entsprechende Handlung folgt.
73
Bezeichnend für die antike Moralphilosophie ist die praktische Ausrichtung, welche durch
das aktive Streben nach Glück geprägt wird. Glücklich konnte nur der sein der gut und
richtig handelt; ,,Kein Mensch handelt freiwillig schlecht". (Platon: Protagoras)
Das Streben der antiken griechischen Gesellschaft nach Wissen, nach Erkenntnis, nach
Freiheit, nach Askese, die Geringschätzung materieller Güter,
74
und der gesellschaftliche
Zusammenhalt sind Indizien dass diese Überzeugungen auch kulturell integriert waren.
Eine fast gegensätzliche Position vertritt die jüdische und die frühchristliche Religion.
,,Nicht um Einsicht und Wissen geht es primär sondern um Entscheidung, um Gehorsam
oder Ungehorsam gegenüber dem göttlichen Gebot",
75
also nicht mehr darum das
,,Richtige und Gute" zu tun sondern das gottgefällige.
Der religiöse Mensch bedarf also der Gnade Gottes und der sokratische Mensch der
Belehrung.
76
Das Vertrauen auf Gottes Gebote und das Vertrauen in die eigene Vernunft, sind für viele
Jahrhunderte die beiden Antipoden welche die Kulturgeschichte Europas geprägt haben.
Und wieder war es Kant vorbehalten durch sein Werk ,,Die Religion innerhalb der Grenzen
der bloßen Vernunft" eine Verbindung der beiden scheinbar gegensätzlichen Positionen zu
schaffen, indem er eine auf Vernunft basierende Religion entwirft,
77
und die Idee Gottes
als unbeweisbare aber notwendige Prämisse implementiert.
Kant erkennt in dem Menschen ein angeborenes moralisches Gefühl, eine Triebfeder Gutes
zu tun und nennt dieses ,,Keim des Guten",
78
sieht aber auch, ein letztlich unerklärliches
72
Kurt von Fritz: Grundprobleme der Geschichte der antiken Wissenschaft; Verlag Walter de Gruyter& Co
1971, Seite 520.
73
Martin Hollis, Wilhelm Vossenkuhl: Moralische Entscheidung und rationale Wahl; Oldenbourg Verlag
1992, Seite 17.
74
Kurt von Fritz: Grundprobleme der Geschichte der antiken Wissenschaft; Verlag Walter de Gruyter& Co
1971, Seite 522.
75
Kurt Roeske: Nachgefragt bei Sokrates-Ein Diskurs über Glück und Moral; Verlag Könighausen &
Neumann, Würzburg 2004, Seite 101.
76
Kurt Roeske: Nachgefragt bei Sokrates-Ein Diskurs über Glück und Moral; Verlag Könighausen &
Neumann, Würzburg 2004, Seite 102.
77
Immanuel Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft; Königsberg 1794, Seite 227.
78
Samuel Klar: Moral und Politik bei Kant; Verlag Könighausen & Neumann, Würzburg 2005, Seite 35.
26
Phänomen, einen Hang zum Bösen.
79
Dieser Hang ist laut Kant dafür verantwortlich dass
Menschen wider besseres Wissen unmoralisch handelt.
Moralphilosophie hat sich in seiner Entwicklung hauptsächlich politischen,
gesellschaftlichen und religiösen Themen gewidmet und die praktische Ökonomie dabei
fast ausgeklammert.
Der Moralphilosoph und spätere ,,Vater der Nationalökonomie" Adam Smith hat in seinem
Werk ,,Theory of moral sentiments" 1759 mit seiner Theorie der moralischen Gefühle oder
auch des Mitgefühls, einen ethischen Rahmen geschaffen, in den sich sowohl das soziale,
vorwiegend, altruistisch ausgerichtete Menschenbild, wie in ,,Theory of moral sentiments"
beschrieben, als auch das individualistische, konsequent egoistische Menschenbild aus
,,Wohlstand der Nationen" integrieren lassen.
80
Er sieht die Menschen nicht nur als von Natur aus egoistische Nutzenmaximierer, was sie
zweifellos auch sind, sondern als ebenso darauf aus, mit anderen Menschen
einvernehmlich zu kooperieren und deren Interessen, um ihrer selber willen zu
akzeptieren.
81
Mit seiner Theorie der moralischen Gefühle verknüpft Smith die moralpsychologische
Plausibilität Humes mit den normativ-universalistischen Ansprüchen Kants.
82
Die Ökonomie ist somit erstmals ausführlich in ein Moralphilosophisches Konzept
eingebaut worden. Dieses Konzept sollte sich jedoch erst im 20. Jahrhundert öffentlicher
Aufmerksamkeit erfreuen.
2.2.2.
Grundgedanken menschlicher Moral
Obwohl es noch keine philosophische inhaltliche Definition von dem Wesen der Moral
gibt, sind doch einige Aspekte historisch und philosophisch besonders beleuchtet worden,
und stellen auch die Säulen der westlichen Wertewelt dar.
2.2.2.1.Eigentum
Unter Eigentum versteht man das grundsätzlich unbeschränkte Recht an einer Sache, was
aber der wahren Bedeutung von Eigentum nicht mal annähernd gerecht werden kann.
79
Samuel Klar: Moral und Politik bei Kant; Verlag Könighausen & Neumann, Würzburg 2005, Seite 40.
80
Karl Graf Bellestrem: Adam Smith: Beck Verlag 2001, Seite 66.
81
Christel Fricke, Hans-Peter Schütt: Adam Smith als Moralphilosoph; Walter de Gruyter Verlag, Berlin
2005, Seite 2.
82
Christel Fricke, Hans-Peter Schütt: Adam Smith als Moralphilosoph; Walter de Gruyter Verlag, Berlin
2005, Seite 2
27
Über das Eigentum wird die Person in den Bereich der Sachgüter erweitert, was in der
Folgerung heißt, dass sich andere Personen dieser Objekte zu enthalten und sich somit in
ihrer eigenen Freiheit einzuschränken haben. Demnach ist das Eigentum identisch mit der
Freiheit, welche durch die äußeren Gegenstände repräsentiert wird, an denen man das
Eigentumsrecht hält.
83
Rousseau sah in der Bildung von Eigentum, und dem dazugehörigen Schutzbedürfnis, den
Hauptgrund der Menschen um aus dem natürlichen Zustand in eine bürgerlich-rechtliche
Gesellschaft einzutreten.
84
,,Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und dreist sagte: 'Das ist mein' und so
einfältige Leute fand, die das glaubten, wurde zum wahren Gründer der bürgerlichen
Gesellschaft. Wieviele Verbrechen, Kriege, Morde, Leiden und Schrecken würde einer dem
Menschengeschlecht erspart haben, hätte er die Pfähle herausgerissen oder den Graben
zugeschüttet und seinesgleichen zugerufen: 'Hört ja nicht auf diesen Betrüger. Ihr seid alle
verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören und die Erde keinem."
85
Jean-Jacques Rousseau
Obwohl Rousseau in der Idee des Privateigentums einen Hauptgrund für die moralische
und politische Ungleichheit unter den Menschen sieht, ist es seiner Auffassung nach
trotzdem eine Grundbedingung für die Entwicklung und den Fortschritt der Menschheit.
86
Die Menschen haben nach Rousseau das Recht sich durch ,,legitima prima occupatio"
Boden anzueignen, falls niemand anderes zuvor dies bereits getan hätte. Man darf dabei
nur so viel okkupieren, wie man zum Lebensunterhalt benötigt und muss den Boden selbst
bestellen.
87
Weil die Menschen, aus Furcht dass ihre eigenen Eigentumsansprüche von einem anderen
durch Repressalien bedroht werden könnten, sich nicht mehr die Eigentumsansprüche der
Anderen durch Repressalien aneignen wollten, konnten sich erste Eigentumsrecht ähnliche
Zustände etablieren.
88
Auf die Problematik, dass durch Privateigentum, in Folge, soziale und materielle
Ungleichgewichte entstehen, hat Rousseau zwar deutlich hingewiesen und sogar die
83
Susann Held: Eigentum und Herrschaft bei John Locke und Immanuel Kant; Lit Verlag, Berlin 2006, Seite
17.
84
Christian Spieß: Sozialethik des Eigentums; Lit Verlag, Münster 2004, Seite 53.
85
Walter Reese Schäfer: Klassiker der politischen Ideengeschichte; Wissenschaftsverlag, Oldenburg 2007,
Seite 122.
86
Christian Spieß: Sozialethik des Eigentums; Lit Verlag, Münster 2004, Seite 53.
87
Christian Spieß: Sozialethik des Eigentums; Lit Verlag, Münster 2004, Seite 58.
88
Christian Spieß: Sozialethik des Eigentums; Lit Verlag, Münster 2004, Seite 53.
28
Fortführung des Kriegszustandes unter Vertragsrecht kommen sehen,
89
konnte aber
trotzdem keine realisierbaren Alternativlösungen anbieten.
Locke, der das Thema bereits vor Rousseau aufgegriffen hat, argumentierte zwar ebenfalls
für ein Recht auf Eigentum, kam aber über eine völlig andere Argumentationslinie zu
diesem Ergebnis.
Das absolute Recht an Eigentum kann nach Locke nur das Recht des Menschen an seiner
eigenen Person sein, da die Erde allen Lebewesen gehört. Dieser naturrechtliche Besitz des
Menschen an seinem Körper, seiner Freiheit, und insbesondere seiner Arbeit ist die
argumentative Basis der Locke`schen Eigentumstheorie.
90
Wenn der Mensch nun irgendeinen herrenlosen Gegenstand bearbeitet und damit in seinem
natürlichen Zustand verändert, fügt er diesem Gegenstand seine Arbeitskraft, und damit
etwas seines persönlichen Eigentums, zu und macht ihn somit zu seinem Eigentum.
91
Durch die Verknüpfung des Eigentumsrechts mit der Arbeitskraft des einzelnen
Individuums und dessen gottgegebenes natürliches Recht auf seine Arbeit und das Produkt
seiner Arbeit, wird das Recht auf Privatbesitz in den Rang eines Menschenrechts auf
Freiheit gehoben.
Der naturrechtlich geschützte Bereich des Individuums wird auf die von ihm bearbeiteten
Sachgüter ausgeweitet und stellt diese somit auch unter naturrechtlichen Schutz.
92
Damit ist bei Locke, im Unterschied zu der Okkupationstheorie Rousseaus, Eigentum ein
fester Bestandteil der Individualrechte und damit natürlich begründet.
93
Seine Arbeitswerttheorie erweitert Locke noch durch seine Geldtheorie, die besagt dass
erst die Wertzuweisung für unverderbliche Güter wie z.B. Silber und Gold durch den
Menschen, Güter hat knapp werden lassen und ihnen erst damit ein Potenzial zur
Schaffung gesellschaftlicher Ungleichheit gegeben hat.
94
Da aber Gold und Silber oder Geld jedwelcher Art auch immer, für das Leben der
Menschen einen weit geringeren Wert haben als Nahrungsmittel, Kleidung, Nutztiere usw.,
und nur durch die Übereinkunft der Menschen diesen spezifischen Wert erhalten haben, ist
es für Locke nur logisch, dass diese somit auch mit einer ungleichen Besitzverteilung
einverstanden sind.
95
89
Christian Spieß: Sozialethik des Eigentums; Lit Verlag, Münster 2004, Seite 59.
90
Christian Spieß: Sozialethik des Eigentums; Lit Verlag, Münster 2004, Seite 37.
91
Christian Spieß: Sozialethik des Eigentums; Lit Verlag, Münster 2004, Seite 37.
92
Christian Spieß: Sozialethik des Eigentums; Lit Verlag, Münster 2004, Seite 37.
93
Susann Held: Eigentum und Herrschaft bei John Locke und Immanuel Kant; Lit Verlag, Berlin 2006, Seite
21.
94
Andreas Eckl/ Bernd Ludwig; Was ist Eigentum; Verlag C.H.Beck, München 2005, Seite 99.
95
Andreas Eckl/ Bernd Ludwig; Was ist Eigentum; Verlag C.H.Beck, München 2005, Seite 96.
29
Hume sieht die Verteilung des Eigentums als letztlich zufällig, wie z.B. durch Erbschaft,
Glück usw., an und zeigt sich keineswegs verwundert dass sie oft mit den Bedürfnissen
und den Wünschen der Menschen im Widerspruch steht. Er erkennt ebenfalls dass dies ein
Übelstand ist, sieht aber nur die Gewalt, und diese lehnt er ab, als unmittelbares Mittel zur
Lösung dieses Übelstandes.
96
Als einzige Möglichkeit die Verteilung des Eigentums
gerechter zu gestalten sieht Hume den einvernehmlichen Handel und Gütertausch, in der
modernen Welt würden auch Dienstleistungen dazugehören, bei dem die Menschen die
Möglichkeit haben durch freiwilliges Abtreten von eigenen Eigentumsrechten, im Tausch,
Eigentum an anderen Gütern oder Boden zu erwerben.
97
Die Eigentumstheorien Kants, der Eigentum durch die physische Existenz dieses, als mit
der praktischen Vernunft vereinbar und damit als legitimiert ansah,
98
und Fichtes, der
Eigentum als ein auf Naturrecht basierendes Handlungsziel ansah,
99
blieben in sich
widersprüchlich und haben daher auch keinen weitreichenden Einfluss auf die
Eigentumsphilosophie entwickeln können.
Die Eigentumstheorien Hegels und seines Schülers Marx hingegen werden die Gesellschaft
nachhaltig prägen und somit ausführlich erläutert werden.
Für Hegel war der soziale Aspekt der gerechten Verteilung des Eigentums nur zweitrangig,
da erstens führ ihn die Verteilung bereits abgeschlossen und damit rechtlich zu schützen
sei,
100
und zweitens das Eigentum Teil seiner panlogistischen Freiheitsphilosophie war.
101
Weiterhin war für Hegel der Grund dafür, dass überhaupt Eigentum möglich ist, das
Personsein eines subjektiven Geistes, der sich objektivieren muss, und seine Freiheit zuerst
im Eigentum realisiert. Diese Person muss dabei in die Rechtsgesellschaft integriert
sein.
102
Dass das Eigentum bei Hegel nicht nur auf materielle Güter begrenzt ist, sondern auch
geistiges Eigentum mit einschließt, war ebenfalls Teil seiner Freiheitsphilosophie, da er
davon ausging dass Kunst und Wissenschaft dem freien Geiste eigen sind und der Geist
ihnen ein Äußerliches gegeben hat.
103
Besonders die Rolle des Staates als Hüter des Rechts auf Eigentum und Freiheit, der bei
Hegel totalitären, gottgleichen Charakter hat und für ihn letztlich die Wirklichkeit der
96
Andreas Eckl/ Bernd Ludwig; Was ist Eigentum; Verlag C.H.Beck, München 2005, Seite 122.
97
Andreas Eckl/ Bernd Ludwig; Was ist Eigentum; Verlag C.H.Beck, München 2005, Seite 122.
98
Andreas Eckl/ Bernd Ludwig; Was ist Eigentum; Verlag C.H.Beck, München 2005, Seite 137.
99
Andreas Eckl/ Bernd Ludwig; Was ist Eigentum; Verlag C.H.Beck, München 2005, Seite 154.
100
Ludwig Siep: Grundlinien der Philosophie des Rechts; Akademie Verlag, Berlin 2005, Seite 56.
101
Schwäbisch Hall Stiftung: Kultur des Eigentums; Springer Verlag, Heidelberg 2006, Seite 105.
102
Andreas Eckl/ Bernd Ludwig; Was ist Eigentum; Verlag C.H.Beck, München 2005, Seite 166.
103
Schwäbisch Hall Stiftung: Kultur des Eigentums; Springer Verlag, Heidelberg 2006, Seite 106.
30
sittlichen Idee ist, wurde einer der größten Angriffspunkte seiner Theorie, obwohl er durch
seine Ansätze ebenfalls als einer der Vorreiter heutiger liberaler, bürgerlicher
Gesetzbücher angesehen werden kann.
Zusammenfassend kann gesagt werden dass Hegel die Freiheit des Eigentums, die Natur
der Freiheit des Geistes und das Recht in Verbindung gebracht hat, und dieses in seiner
Staatsphilosophie integriert hat.
Sein Schüler Karl Marx hingegen sah im Privateigentum, besonders bei den
Produktionsmitteln, die Entfremdung von der menschlichen Natur und nur durch die
Abschaffung des Privateigentums die vollständige Emanzipation menschlicher Sinne und
Eigenschaften als erreichbar.
104
Für ihn war Privateigentum kein Teil der Freiheit sondern entsprach der Knechtschaft des
Individuums in dem System, da der Mensch nur noch produziert um zu haben und sich
durch dieses Streben nach Eigentum, von sich selbst und der Natur entfremdet.
105
Ebenso wie das Privateigentum lehnt Marx den Staat an sich ab und fordert den neuen
Menschen, der eine Welt ohne Staat, Privateigentum, Geldkapital, Lohnarbeit, und
Arbeitsteilung ausfüllen soll. Der ideale gesellschaftliche Mensch, befreit von allen
Antithesen, in die er als gegenständliches Wesen verstrickt ist, ist für Marx ,,das aufgelöste
Rätsel der Geschichte".
106
Einen Weg wie dieser soziale Mensch, der ohne materialistischen Streben nach
persönlichem Vorteil auskommt, entstehen soll, konnte Marx auch nicht aufzeigen, da ja
die alte Welt und der alte Mensch zuerst vernichtet werden müssen, um den neuen
Menschen und die neue Welt entstehen lassen zu können. Da aber der Mensch sich aus
sich selbst reproduziert und wenn er erst vernichtet ist, sich nicht mehr selbst entstehen
lassen kann, und die Vernichtung dogmatische Voraussetzung ist, kann dieses von Marx
geschaffene Menschenbild folglich nie entstehen.
Die geschichtliche Entwicklung hat Marx wiederlegt und seine Gesellschaft ohne
Privateigentum hat sich für die Gegenwart als Utopie herausgestellt. Eigentumsrecht und
das Verständnis für Eigentum hingegen haben sich fest in der abendländischen Kultur
verankert und werden durchgehend durch das Gesetz geschützt und legitimiert.
In Deutschland wird das Eigentumsrecht als Grundrecht angesehen und vom Grundgesetz
durch Art. 14 GG geschützt.
107
104
Wolfgang Janke: Historische Dialektik; de Gruyter Verlag, Berlin 1977, Seite 499.
105
Wolfgang Janke: Historische Dialektik; de Gruyter Verlag, Berlin 1977, Seite 492.
106
Franz Schupp: Geschichte der Philosophie; Felix Meiner Verlag, Hamburg 2003, Seite 454.
107
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_14.html
,
31
2.2.2.2.Freiheit und Verantwortung
Die Frage nach der eigenen Freiheit ist eine Thematik die den Menschen seit seinem
Auftreten als soziales Wesen beschäftigt.
Da er mit dem Verlassen des Naturzustandes den Zustand der totalen Freiheit aufgegeben
hat, und somit Einschränkungen in seiner persönlichen Freiheit in Kauf genommen hat, ist
Freiheit bzw. der Grad der Einschränkung der Freiheit ein fundamentaler Aspekt in der
eigenen Selbstwahrnehmung des Menschen.
Daher ist es auch nicht weiter erstaunlich dass die Freiheit bzw. die Einschränkung in
dieser, in allen Bereichen des menschlichen Lebens und des menschlichen Seins eine
bedeutende Rolle spielt.
Die Frage der persönlichen Freiheit bzw. die Möglichkeit zur Selbstbestimmung
unabhängig von dem Willen anderer, ist dabei der zentrale Aspekt.
108
Neben der Handlungs- und der Gedankenfreiheit gerät, insbesonders durch die jüngsten
Einsichten der Genetik und der Neurowissenschaften, der Aspekt der Willensfreiheit
immer mehr in den Fokus der Forschung. Dabei soll geklärt werden ob der menschliche
Wille bereits durch bestimmte Faktoren festgelegt bzw. maßgeblich beeinflusst wird, oder
ob der Mensch selbst seinen Willen frei und unabhängig bestimmt.
109
In der Geschichte des Freiheitsbegriffes spielt das antike Griechenland, das als Ursprung
des Demokratiegedankens und damit der politischen Freiheit gilt, eine zentrale Rolle, da
sich die griechischen Philosophen mit dieser Thematik sehr intensiv auseinandergesetzt,
und auch ein erstes Bild der menschlichen Freiheit, innerhalb der Gesellschaft, entworfen
haben.
In der griechischen Polis wird Freiheit besonders als Gleichheit der freien Bürger vor dem
Staat empfunden, was dann wiederum, da die Bürger ja frei sind, die Abwesenheit von
Sklaverei beinhaltet.
110
Freiheit wird dabei als ein, durch die Polis und Nomos bestimmter, Ordnungsrahmen
empfunden, und muss sich der öffentlichen Ordnung unterordnen.
111
Platon warnt vor einer Verwechslung der Freiheit mit Anarchie und fordert eine maßvolle
Freiheit.
112
108
Jan-Christoph Heilinger: Naturgeschichte der Freiheit; Walter de Gruyter Verlag, Berlin 2007, Seite 1.
109
Jan-Christoph Heilinger: Naturgeschichte der Freiheit; Walter de Gruyter Verlag, Berlin 2007, Seite 1.
110
Arnd Uhle: Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Identität; Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2004,
Seite 150.
111
Arnd Uhle: Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Identität; Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2004,
Seite 150.
32
Für Aristoteles bestimmt die Idee der Freiheit den Inhalt der demokratischen Gleichheit,
wobei für ihn Freiheit, in seinem Entwurf der radikalen Demokratie, bedeutet dass jeder
freie Bürger leben könne wie er wolle.
113
Dass Frauen, Sklaven, Bettler und alle
ortsansässigen Ausländer, nicht als freie Bürger gelten, und somit nicht in den Genuss
dieser Freiheit kommen können, lässt die Aussagen Humes dass die Griechen die Freiheit
zwar preisen aber nicht praktizieren, als nachvollziehbar erscheinen.
114
Aristoteles sah in der Demokratie eine verfehlte Herrschaftsform, da sie den Armen
gleiche politische Freiheiten zugestand. Da diese zahlenmäßig immer in der Mehrzahl
waren, war die Demokratie also ein politisches Instrument, welches nur den Vorteil der
Armen und nicht den gemeinsamen Nutzen anstrebt.
115
Trotzdem sind die Staatstheorien des antiken Griechenlands als die Vorläufer der
modernen Demokratien anzusehen, da in der Suche nach dem idealen Staat das Wohl der
Bürger im Mittelpunkt steht, und diese hier, unabhängig von Rang und Reichtum, gleiches
Stimmrecht haben.
116
Für die Römer war weniger die persönliche und politische Freiheit von Bedeutung, als
vielmehr die Gleichheit vor dem Richterstuhl bzw. Rechtssicherheit und die Sicherung der
sozialen Existenz
117
.
Der römische Verwaltungsapparat fungiert dabei als Instrument der versachlichten
kaiserlichen Fürsorge. Die institutionalisierte und versachlichte Verwaltung sichert den
römischen Bürgern die Freiheit in Form von Sicherheit, und zwar einer Sicherheit die sich
auf Gesetze und Organe berufen kann, welche nicht auf Grund herrschaftlicher Gnade
sondern durch Freiheitsrechte begründet sind.
118
Die Stoa war die Philosophenschule welche das Ideal der Freiheit in der Antike am meisten
prägte, da sie diesen Aspekt in die Mitte ihres Denkens stellten, ohne den Freiheitshorizont
durch die Grenzen der jeweiligen Staaten oder durch die Polis einzuengen.
112
Erich Loewenthal: Platon Sämtliche Werke in 3 Bänden; Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2004, Seite
205.
113
Otfried Höffe: Aristoteles- Politik; Akademie Verlag, Berlin 2001, Seite 178.
114
Otfried Höffe: Aristoteles- Politik; Akademie Verlag, Berlin 2001, Seite 178.
115
Manfred G. Schmitt: Demokratietheorien; VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, Seite
30.
116
Manfred G. Schmitt: Demokratietheorien; VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, Seite
29.
117
Arnd Uhle: Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Identität; Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2004,
Seite 152.
118
Jochen Bleicken / Frank Goldmann: Gesammelte Schriften II Römische Geschichte, Franz Steiner
Verlag, Stuttgart 1998, Seite 927.
33
In der stoischen Kosmopolis erweist sich die Freiheit als Transformation der älteren
Eleutheria der Polis, in der bereits politische, religiöse und rechtliche Aspekte gemeinsam
integriert wurden.
119
Sowohl die jüdische, wie auch später die christliche Religion übernahmen Teile der
stoischen Eleutheria.
Das jüdische Verständnis von Freiheit ist jedoch, geprägt von der ägyptischen
Knechtschaft und dem Kampf gegen die römischen Besatzer, deutlich weltlicher und
stärker an der Realität ausgerichtet, wogegen das frühchristliche Verständnis von Freiheit
sich eher auf die innere Freiheit konzentriert und somit den frühen Christen eine
fundamentale Distanz zur äußeren Welt, namentlich zu Staat und Politik, verschaffte.
120
Im Mittelalter wendet sich das Christentum immer mehr dem Aspekt der individuellen
Freiheit zu, da sich die christliche Kirche zu einer universalen Organisation entwickelt hat,
was den einzelnen Christen dann dazu zwingt zu einzelnen Fragen der weltlichen
Organisation Stellung zu beziehen.
121
Begünstigt wurde diese Entwicklung auch durch die Idee der Gottesebenbildlichkeit des
Menschen, welche für den individuellen Freiheitsanspruch des Menschen eine einzigartige
Legitimationsbasis darstellt.
Die christliche Vorstellung von Schuld, Sühne und der Umkehr basiert auf der Vorstellung
dass der Mensch ein freies Individuum geistiger Natur ist, der sich, eschatologisch
gesehen, für den Gebrauch seiner Freiheit nur vor Gott zu verantworten hat.
122
Der, sich auf sittliche Autonomie berufende, personale Freiheitsgedanke wird durch
Augustinus (354-439) und Thomas von Aquin (1224-1274) im christlichen Naturrecht
ausformuliert,
123
und wird somit auch zur Grundlage christlicher Theologie. Diese
Integrierung des individuellen Freiheitsgedankens in die christliche Religionslehre, führt
neben einer gesellschaftlichen Akzeptanz, auch zu einem verstärkten Streben nach einer
konkreten Ausformulierung der Menschen- und Bürgerrechte,
124
und zu einer stärkeren
Position des Einzelnen seinem Souverän gegenüber.
119
Samuel Vollenweider: Freiheit als neue Schöpfung ; Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Göttingen 1989,
Seite 23.
120
Arnd Uhle: Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Identität; Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2004,
Seite 155.
121
Arnd Uhle: Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Identität; Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2004,
Seite 156.
122
Arnd Uhle: Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Identität; Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2004,
Seite 156.
123
Hans Welzel: Naturrecht und materielle Gerechtigkeit; Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Göttingen,
1962, Seite 63.
124
Gerhard Oestreich: Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss; Duncker und
Humblot Verlag, 1978, Seite 14.
34
Außerdem sieht Thomas von Aquin das Leben, die Freiheit und das Eigentum des
Einzelnen durch das Evangelium geschützt, was dann den weltlichen Herrscher dazu
verpflichtet, sein Volk in väterlicher Weise zu führen, ohne den Einzelnen in seinen oben
genannten Rechten einzuschränken oder ihn zu unterdrücken.
125
Trotzdem ist das Selbstverständnis der mittelalterlichen Menschen eher durch die
Zugehörigkeit zum gesellschaftlichen Ganzen, als durch den Anspruch auf geistige
Individualität geprägt.
Während der Renaissance und im Zuge der Reformation tritt immer mehr die Autonomie
des Individuums in den Mittelpunkt des Denkens, und Freiheitsaspekte werden subjektiv
als immer wichtiger empfunden.
Neben Martin Luther und Jean Bodin, welche für die Ablösung des im Mittelalter
praktizierten christlichen Dienst- und Gehorsamsgedanken und für religiöse Freiheiten
stehen, sind Schriftsteller wie Dante Aligheri, , Phillipp Melanchton und William
Shakespeare, Philosophen wie Pico de la Mirandola, Erasmus von Rotterdam, Hugo
Grotius, Naturwissenschaftler wie Galileo Galilei, Giordano Bruno, Johannes Keppler oder
Nikolaus Kopernicus für die Änderungen bezüglich des menschlichen Welt- und
Selbstbilds verantwortlich und leiteten mit ihren Erkenntnissen und Thesen eine Reihe von
Änderungen im religiösen, rechtlichen und sozialen Selbstverständnis der damaligen
Menschen ein.
126
Es blieb jedoch den philosophischen Strömungen des späten 16. Jahrhunderts vorbehalten,
welche schließlich die Epoche der Aufklärung einläuteten, sich dem Freiheitsaspekt, den
Wechselwirkungen und spezifischen Zusammenhängen, kritisch und aus allen Richtungen
zu nähern, ohne maßgeblich von starren und überholten Vorurteilen sowie von
theologischen Dogmen und Ideologien eingeengt zu sein.
Thomas Hobbes ist zwar nur unter Vorbehalt dieser Epoche zuzurechnen, hat aber durch
seine staatstheoretischen Schriften ,,Leviathan" und ,,Elementa Philosophiae" und seine
Theorien über Freiheit und deren Auswirkungen auf das Gemeinwohl, einige
philosophische Auseinandersetzungen angeregt und wahrscheinlich erst auch viele
Schriftsteller und Philosophen zu Gegenschriften und Opposition provoziert.
Obwohl er in weiten Teilen seiner Theorien der christlichen Heilsgeschichte folgt und den
Sündenfall, in moderner Art und Weise integriert, ist er, von der zu der Zeit aufblühenden,
Physik so eingenommen, dass er ein bis damals ungekanntes mechanistisches
125
Arnd Uhle: Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Identität; Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2004,
Seite 157.
126
http://www.susannealbers.de/03philosophie02epochen.html
,
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783836649063
- DOI
- 10.3239/9783836649063
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule für angewandtes Management GmbH – Wirtschaftspsychologie
- Erscheinungsdatum
- 2010 (Juli)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- unternehmensführung wirtschaftskrise wirtschaftsethik moral social responsability
- Produktsicherheit
- Diplom.de