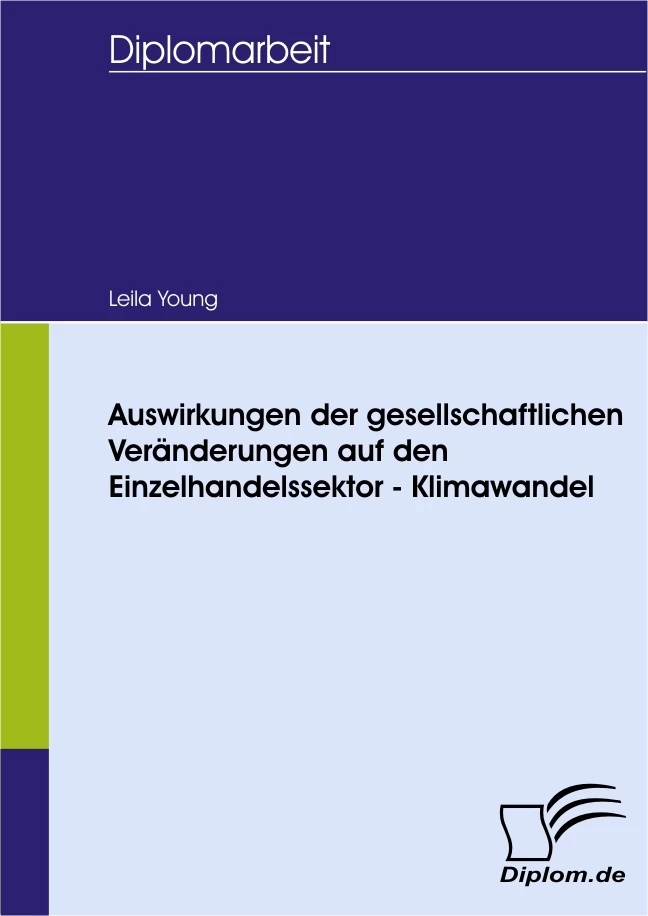Auswirkungen der gesellschaftlichen Veränderungen auf den Einzelhandelssektor - Klimawandel
©2009
Diplomarbeit
88 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Bio-Produkte boomen. Bereits im Jahr 2006 haben 90% der deutschen Haushalte mindestens einmal ein solches Produkt gekauft, und das obwohl sie teuerer als konventionelle Waren sind. Vor allem haben die Discounter von dieser Entwicklung profitiert. Nachhaltige Produkte, zu denen unter anderem auch Bio-Produkte zählen, sind keine Nischenprodukte mehr, sondern werden auf breiter Basis im Einzelhandel angeboten. Die Produktkennzeichnung mit einem Gütesiegel ist eine elementare Komponente um Verbraucher über die Nachhaltigkeit eines Produktes zu informieren. Leider hat es in den vergangenen Jahren eine starke Verbreitung der unterschiedlichsten Kennzeichnungen gegeben, welches zur Folge hat, dass eine Informationsüberflutung und Verwirrung bei den Verbrauchern eintritt. Daher ist es notwendig, dass Politik, Wirtschaft und andere Institutionen auf zumindest europaweiter, wenn nicht sogar internationaler Basis eine einheitliche und produkt-übergreifende Kennzeichnung voranbringen. Auf Unternehmensseite, zu dem auch der deutsche Einzelhandel zählt, hat es eine starke und vielseitige Verbreitung des Nachhaltigkeitsgedanken, auch im Sinne des Klimaschutzes, in den Unternehmenswerten gegeben. Der Klimawandel animiert Verbraucher zunehmend dazu Investitionen in bspw. energieeffiziente Technik zu tätigen. Es hat auch schon eine Veränderung, hin zu umweltschonendem und energiesparendem Verhalten, in der Bevölkerung gegeben.
Der deutsche Durchschnittsverbraucher verursacht 11 Tonnen CO2-Äquivalente (CO2e) im Jahr. Daher spielt bei der Reduktion der klimaschädigenden Kohlendioxidemissionen der Konsum und die Energienutzung der privaten Haushalte eine entscheidende Rolle. Eine Kennzeichnung mit Siegeln ist eine wichtige Voraussetzung für einen strategischen Konsum und eine innovationstreibende Nachfrage. International sind die unterschiedlichsten Klimasiegel eingeführt worden, auch in Deutschland existieren bereits zwei, die ganz verschiedene Konzepte verfolgen und andere Informationen bereitstellen. Es gibt mannigfache Merkmale die zur Differenzierung der Konsumenten herangezogen werden können. Die vorliegende Untersuchung wird anhand der emotionalen Betroffenheit durch den Klimawandel, dem Wissensstand über den Klimawandel und anhand der umweltschonenden Kaufgewohnheiten der Konsumenten eine Aufteilung vornehmen, um eventuelle Unterschiede in der möglichen Gestaltung eines Klimasiegels hinsichtlich des Informationsumfangs zu […]
Bio-Produkte boomen. Bereits im Jahr 2006 haben 90% der deutschen Haushalte mindestens einmal ein solches Produkt gekauft, und das obwohl sie teuerer als konventionelle Waren sind. Vor allem haben die Discounter von dieser Entwicklung profitiert. Nachhaltige Produkte, zu denen unter anderem auch Bio-Produkte zählen, sind keine Nischenprodukte mehr, sondern werden auf breiter Basis im Einzelhandel angeboten. Die Produktkennzeichnung mit einem Gütesiegel ist eine elementare Komponente um Verbraucher über die Nachhaltigkeit eines Produktes zu informieren. Leider hat es in den vergangenen Jahren eine starke Verbreitung der unterschiedlichsten Kennzeichnungen gegeben, welches zur Folge hat, dass eine Informationsüberflutung und Verwirrung bei den Verbrauchern eintritt. Daher ist es notwendig, dass Politik, Wirtschaft und andere Institutionen auf zumindest europaweiter, wenn nicht sogar internationaler Basis eine einheitliche und produkt-übergreifende Kennzeichnung voranbringen. Auf Unternehmensseite, zu dem auch der deutsche Einzelhandel zählt, hat es eine starke und vielseitige Verbreitung des Nachhaltigkeitsgedanken, auch im Sinne des Klimaschutzes, in den Unternehmenswerten gegeben. Der Klimawandel animiert Verbraucher zunehmend dazu Investitionen in bspw. energieeffiziente Technik zu tätigen. Es hat auch schon eine Veränderung, hin zu umweltschonendem und energiesparendem Verhalten, in der Bevölkerung gegeben.
Der deutsche Durchschnittsverbraucher verursacht 11 Tonnen CO2-Äquivalente (CO2e) im Jahr. Daher spielt bei der Reduktion der klimaschädigenden Kohlendioxidemissionen der Konsum und die Energienutzung der privaten Haushalte eine entscheidende Rolle. Eine Kennzeichnung mit Siegeln ist eine wichtige Voraussetzung für einen strategischen Konsum und eine innovationstreibende Nachfrage. International sind die unterschiedlichsten Klimasiegel eingeführt worden, auch in Deutschland existieren bereits zwei, die ganz verschiedene Konzepte verfolgen und andere Informationen bereitstellen. Es gibt mannigfache Merkmale die zur Differenzierung der Konsumenten herangezogen werden können. Die vorliegende Untersuchung wird anhand der emotionalen Betroffenheit durch den Klimawandel, dem Wissensstand über den Klimawandel und anhand der umweltschonenden Kaufgewohnheiten der Konsumenten eine Aufteilung vornehmen, um eventuelle Unterschiede in der möglichen Gestaltung eines Klimasiegels hinsichtlich des Informationsumfangs zu […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Leila Young
Auswirkungen der gesellschaftlichen Veränderungen auf den Einzelhandelssektor -
Klimawandel
ISBN: 978-3-8366-4701-4
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Universität zu Köln, Köln, Deutschland, Diplomarbeit, 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
1
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung ...2
2. Der globale anthropogene Klimawandel und seine ökologischen, sozialen und
ökonomischen Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft...3
3. Die Kundenanalyse...9
3.1 Die Laienwahrnehmung des Klimawandels...10
3.2 Gesellschaftliche Entwicklungen und Charakteristika umwelt- und
klimabewusster Kunden ...12
3.3 Die Rolle der Wahrnehmung im Kaufentscheidungsprozess...19
4. Etablierte Gütesiegel und ihre Erfolgsfaktoren ...23
5. Ergebnisse der Kundenumfrage und statistischen Analysen...32
6. Die unternehmensbezogene Analyse...54
6.1 Motivgründe von und Hindernisse für Unternehmen eine klimabewusste
Position zu beziehen...54
6.2 Die Branchenanalyse...62
7. Fazit ...65
8. Anhang ...66
8.1 Vollständiger Fragebogen mit Häufigkeitsverteilungen ...66
8.2 Verwendete Formeln ...76
9. Literaturverzeichnis...78
2
,,Durch die weltweite Finanzkrise kühlt sich die Wirtschaft überall ab. In gewisser
Weise ist es doch das was wir brauchen, die Gelegenheit langsamer zu werden und
die Produktion umzustellen auf mehr Freundlichkeit, umweltfreundlicher, und
damit glücklicher für die ganze Menschheit."
Fürst Karma Ura, Leiter des Zentrums für Bhutan Studien
1
1. Einleitung
Bio-Produkte boomen. Bereits im Jahr 2006 haben 90% der deutschen Haushalte
mindestens einmal ein solches Produkt gekauft, und das obwohl sie teuerer als
konventionelle Waren sind. Vor allem haben die Discounter von dieser Entwicklung
profitiert (GfK-Nürnberg e.V. 2007a, S. 1-2). Nachhaltige
2
Produkte, zu denen unter
anderem auch Bio-Produkte zählen, sind keine Nischenprodukte mehr, sondern werden
auf breiter Basis im Einzelhandel angeboten. Die Produktkennzeichnung mit einem
Gütesiegel ist eine elementare Komponente um Verbraucher über die Nachhaltigkeit
eines Produktes zu informieren. Leider hat es in den vergangenen Jahren eine starke
Verbreitung der unterschiedlichsten Kennzeichnungen gegeben, welches zur Folge hat,
dass eine Informationsüberflutung und Verwirrung bei den Verbrauchern eintritt. Daher
ist es notwendig, dass Politik, Wirtschaft und andere Institutionen auf zumindest
europaweiter, wenn nicht sogar internationaler Basis eine einheitliche und produkt-
übergreifende Kennzeichnung voranbringen. Auf Unternehmensseite, zu dem auch der
deutsche Einzelhandel zählt, hat es eine starke und vielseitige Verbreitung des Nach-
haltigkeitsgedanken, auch im Sinne des Klimaschutzes, in den Unternehmenswerten
gegeben (HDE 2008, S. 1-8). Der Klimawandel animiert Verbraucher zunehmend dazu
Investitionen in bspw. energieeffiziente Technik zu tätigen. Es hat auch schon eine Ver-
änderung, hin zu umweltschonendem und energiesparendem Verhalten, in der Be-
völkerung gegeben (GfK-Nürnberg e.V. 2007b, S. 1-3). Der deutsche Durch-
schnittsverbraucher verursacht 11 Tonnen CO
2
-Äquivalente
3
(CO
2e
)
im Jahr. Daher
spielt bei der Reduktion der klimaschädigenden Kohlendioxidemissionen der Konsum
und die Energienutzung der privaten Haushalte eine entscheidende Rolle (PCF 2009, S.
4). Eine Kennzeichnung mit Siegeln ist eine wichtige Voraussetzung für einen
strategischen Konsum und eine innovationstreibende Nachfrage (BMU 2008, S. 26).
1
Zitat aus einem Interview, zu finden unter:
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=13740 (Zugriff am 29.10.2009).
2
Die drei Säulen der Nachhaltigkeit sind Ökologie, Ökonomie und Soziales (HDE 2008, S.8).
3
Ein CO
2
-Äquivalent ist die Summe aller Treibhausgase (die im Kyoto-Protokoll erfasst sind)
um-gerechnet in die Klimawirksamkeit von CO
2
.
3
International sind die unterschiedlichsten Klimasiegel eingeführt worden, auch in
Deutschland existieren bereits zwei, die ganz verschiedene Konzepte verfolgen und
andere Informationen bereitstellen. Es gibt mannigfache Merkmale die zur
Differenzierung der Konsumenten herangezogen werden können. Die vorliegende
Untersuchung wird anhand der emotionalen Betroffenheit durch den Klimawandel, dem
Wissensstand über den Klimawandel und anhand der umweltschonenden Kauf-
gewohnheiten der Konsumenten eine Aufteilung vornehmen, um eventuelle Unter-
schiede in der möglichen Gestaltung eines Klimasiegels hinsichtlich des Informations-
umfangs zu identifizieren. Somit sollen Handlungsempfehlungen bei der Klimasiegel-
gestaltung abgeleitet werden können, die den Konsumentenbedürfnissen entgegen-
kommen. In einer abschließenden Branchenanalyse wird evaluiert werden, bei welchen
Produktkategorien eine Kennzeichnung mit einem Klimasiegel sich am erfolg-
versprechendsten erweisen dürfte.
2. Der globale anthropogene Klimawandel und seine ökologischen, sozialen und
ökonomischen Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft
Verschiedene Treibhausgase in der Atmosphäre absorbieren die Sonneneinstrahlung,
die von der Erde zurückreflektiert wird. Dieser natürliche Treibhauseffekt ermöglicht
überhaupt erst das menschliche Leben auf diesem sonst sehr kalten Planeten (Van der
Wurff 2009, S. 460). Seit Anfang des neunzehnten Jahrhunderts ist die Kohlendioxid-
konzentration, sowie die der anderen Treibhausgase, in der Atmosphäre allerdings
wesentlich stärker angestiegen, als es in den letzten 650.000 Jahren jemals zu beo-
bachten war. Dieser Anstieg kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf die Nutzung
fossiler Brennstoffe, die Abholzung von Wäldern und die Landnutzung zurückgeführt
werden (Bolin 2007, S. 200). Die durch den Menschen verursachten Emissionen haben
den natürlichen Treibhauseffekt verstärkt (Van der Wurff 2009, S. 460). Die Erhöhung
der globalen Mitteldurchschnittstemperatur wurde allerdings hauptsächlich indirekt
durch den Kohlendioxidanstieg verursacht. So führt eine Erhöhung des Kohlendioxids
(CO
2
) zu einem Anstieg von Wasserdampf in der Atmosphäre, welcher das
gravierendere Treibhausgas darstellt. Mehr Wasserdampf in der Atmosphäre führt zu
häufigeren und höchstwahrscheinlich zu extremeren Wetterereignissen wie Stürmen,
Hurrikanen usw. Da Aerosole (feine Staubpartikel in der Luft) die Sonneneinstrahlen
ins All zurückreflektieren und somit die Atmosphäre abkühlen, wird es durch die
4
Verminderung von Luftverschmutzung und Smog zu einem noch stärkeren Temperatur-
anstieg kommen. Der Transfer von CO
2
in die Ozeane und andere Speicher wie Wälder
und Böden geht nur sehr langsam von Statten. So gelangen schon jetzt immer noch
45% der vom Menschen verursachten Emissionen in die Atmosphäre. Teile Zentral-
und Südeuropas sind in den letzen Dekaden von ungewöhnlich heißen und trockenen
Wetter betroffen gewesen und in Australien und Afrika sind vermehrt Dürren auf-
getreten. Leider gibt es bereits heute in Regionen wie Afrika Probleme mit der Wasser-
versorgung. Der Meeresspiegel ist angestiegen und wird auf Grund der Schmelzwasser
(von arktischem Eis, Grönlandeis und weltweiten Gletschern) und der Ausdehnung des
Meerwassers wegen seiner Erwärmung noch weiter ansteigen. Küstenregionen sind
darüber hinaus bereits verstärkt Stürmen ausgesetzt (Bolin 2007, S. 202-207). Bedingt
durch das Abschmelzen des Eises in der Antarktis und in Grönland wird es zu einer
weiteren Erderwärmung kommen, da die Eisflächen nicht mehr die Sonnen-
einstrahlung ins All zurückreflektieren (Weber 2008, S. 37).
Die Folgen des Klimawandels variieren je nach geographischer Lage und nach den An-
passungsmöglichkeiten der Nationen. Inselstaaten und Entwicklungsländer sind
besonders benachteiligt, und so wird es verstärkte Migration und mehr Konflikte und
Kriege auf Grund der Ressourcenverknappung (z.B. Wassermangel, Ernteausfälle)
geben (Weber 2008, S. 37-38). Es könnte zu einer Verbreitung von Krankheiten wie
Malaria kommen, da durch die Erwärmung sich die erregerübertragenden Insekten
weitere Regionen erschließen können. Regionale Wettergegebenheiten könnten sich auf
Grund der Erderwärmung abrupt ändern, das El Niño-Phänomen sei hier beispielhaft
erwähnt. In Europa werden Hitzewellen, wie in im Jahr 2003 aufgetreten, bis Mitte des
Jahrhunderts den Alltag prägen (Stern 2006, S. vi-ix).
Neben CO
2
, das 65% der Treibhauswirkung ausmacht, gibt es noch weitere Gase, die
vom Menschen verursacht werden. Hauptsächliche Verursacher von Methan (CH
4
) sind
die Massentierhaltung, insbesondere von Rindern, und die landwirtschaftliche Nutzung,
vor allem der Reisanbau. Zwar wird Methan relativ schnell abgebaut, jedoch besteht die
Gefahr, dass Permafrostböden auftauen und Sedimente im Arktischen Ozean auf Grund
der globalen Erwärmung Methan in die Atmosphäre freisetzen. Die in der Land-
wirtschaft, aber auch in der Forstwirtschaft, genutzten Düngemittel verursachen eine
Erhöhung der Distickstoffmonoxide (Lachgas, N
2
O), die nur sehr langsam abgebaut
5
werden können. Durch die Minderung der Luftverschmutzung und dem Verbot von
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), dem Hauptverursacher des Ozonlochs, konnte
einerseits die Abnahme von Ozon in der Troposphäre und andererseits die Zunahme
von Ozon in der Stratosphäre erreicht werden. Auch wenn sich somit die Gefahr des
Ozonlochs verringert, bleibt jedoch der Umstand bestehen, dass auch FCKW sehr lange
braucht bis es abgebaut wird (Bolin 2007, S. 222-223). Es existieren noch weitere
Treibhausgase wie z.B. perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) und Schwefelhexa-
fluorid (SF
6
) (Weber 2008, S. 44). Die Versauerung durch die vermehrte CO
2
-
Konzentration sowie die Erwärmung der Ozeane hat gravierende Auswirkungen auf die
empfindlichen marinen Ökosysteme (und den darin lebenden Organismen wie
Korallen; Weber 2008, S. 35) und vermindert deren Speicherfunktion (Bolin 2007, S.
234). Der Verlust der Biodiversität ist wohl das bedeutendste der vielen Beispiele für
die Irreversibilität der Folgen des Klimawandels (Weber 2008, S. 107).
Der Klimawandel stellt nicht nur eine Bedrohung für die Umwelt dar, sondern aus
dieser resultierend auch eine ökonomische Gefahr für die Volkswirtschaften. Die
Kosten der Klimaschäden können jedoch gemindert werden, sofern eine sofortig wirk-
same Klimaschutzpolitik auf nationaler und internationaler Ebene umgesetzt wird. So
rechnet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) damit dass Maßnahmen,
die 2005 ergriffen worden wären zwar 5,7 Mrd. $ im Jahre 2050 und 40 Mrd. $ im Jahre
2100 kosten, dafür aber Kosten durch Klimaschäden im Jahre 2050 von 33 Mrd. $ und
160 Mrd. $ im Jahre 2100 vermieden würden (Kemfert 2005, S. 209, 215). Auch Stern
(2006, S. i-ii) verdeutlicht in seinem Bericht, dass die Vorteile eines frühzeitigen und
energischen Handels deutlich über den Kosten liegen. Er bezeichnet den Klimawandel
als das ,,größte und weittragendste" (Stern 2006, S. i) Marktversagen der menschlichen
Geschichte und verweist auf die negativen und sehr wahrscheinlich irreversiblen Aus-
wirkungen auf das wirtschaftliche und soziale Leben. Der Klimawandel hat gravierende
Einflüsse auf die Grundversorgung der Menschheit auf der ganzen Welt, in dem er die
Landnutzung, die Wasserversorgung, die Gesundheit und Lebensmittelproduktion be-
einflusst. Insbesondere arme Länder und Menschen werden zuerst und am Stärksten be-
troffen sein. Sie sind geographisch benachteiligt, stärker von der Landwirtschaft ab-
hängig, haben eine schlechtere Gesundheitsversorgung und nicht genügend Kapital zur
Verfügung um Anpassungsmaßnahmen zu finanzieren. Es wird folglich zu einer Ver-
schärfung der Armut kommen und zu verstärkter Migration, diese Veränderungen
6
werden zu mehr Konflikten führen, besonders in Afrika und Asien (Stern 2006, S. vi-
viii). Sollte es bis zum Ende des 21. Jahrhunderts zu einer Erderwärmung von 5-6°C
kommen, welche nach Stern eine ,,realistische Möglichkeit" (Stern, 2006, S. ix) dar-
stellt, so werden die Kosten des Klimawandels 5-10% des globalen Bruttoinlands-
produktes betragen. Bei Entwicklungsländern wird es deutlich mehr ausmachen (Stern
2006, S. x). Eine Minderung bzw. Stabilisierung der Emissionen steht dabei nicht im
Gegensatz zum wirtschaftlichen Wachstum (Stern 2006, S. xii) und ist auch nicht
gleichbedeutend mit Komfortverzicht (BMU 2005, S. 25).
Leider ist momentan statt einer Minderung der globalen Emissionen ein Anstieg, wegen
der schnellen Industrialisierung in Entwicklungsländern wie China und Indien, zu ver-
zeichnen (Bolin 2007, S. 203). Da die globale Population weiter steigen wird und der
Energiebedarf sich sogar verdoppeln könnte, ist es notwendig Energie effizienter zu
nutzen, erneuerbare Energien einzuführen und Anreize zur Verminderung und Re-
gulation von CO
2
-Emissionen zu setzen, z.B. über den Emissionshandel (Bolin 2007, S.
235).
Der Lebensstil muss sich ändern, denn solange immer mehr Automobile und Flugzeuge
genutzt werden, wird die CO
2
-Konzentration weiter ansteigen. Auch ein Umsteigen auf
Elektroautos wird momentan nicht zu einer deutlichen Reduktion von CO
2
-Emissionen
führen, da der benötigte Strom nur geringfügig aus erneuerbaren Energien gewonnen
wird. Auch die Nutzung von Biodiesel aus Ethanol stellt keine effiziente Alternative
dar, da für die Gewinnung von Zellulose aus bspw. Mais mehr Anbauflächen benötigt
werden wird, und die erreichte CO
2
-Reduktion durch die verminderte Nutzung von
Benzin und Diesel in keinem Verhältnis dazu steht. Vielmehr tragen Maßnahmen zur
besseren Wärmedämmung einen Anteil zur Reduktion des Energiebedarfs und der
damit verbundenen Energiekosten bei, die in Zukunft weiter ansteigen werden (Bolin
2007, S. 236-237). In Deutschland hat die Bundesregierung durch Fördermaßnahmen
Impulse zur besseren Wärmedämmung im Wohn- und Gebäudebereich gegeben, da
rund drei Viertel des Energiebedarfs der privaten Haushalte für die Wärmeerzeugung
benötigt werden. Durch Sanierung und ökologischem Neubau können erhebliche
Energieeinsparpotentiale ausgeschöpft werden. Um dem steigendem Energiebedarf der
privaten Haushalte durch moderne Informations- und Kommunikationstechnologien
entgegen wirken zu können, bedarf es nicht nur einer technischen Umgestaltung (z.B.
7
die Möglichkeit den Stand-by-Betrieb zu deaktivieren) sondern auch der Verhaltens-
änderung bei den Verbrauchern. Hierzu initiiert die Bundesregierung Kampagnen zur
Aufklärung der Bevölkerung. Neben der Förderung von erneuerbaren Energien in der
Energiewirtschaft, werden auch Anreize zum Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) von Seiten der Bundesregierung gesetzt. Verschiedene ökonomische Anreiz-
instrumente der Bundesregierung wie die Ökosteuer, eine emissionsorientierte Kfz-
Steuer und eine Maut, die differenzierte Emissionen einbezieht, stellen dabei nicht nur
einen Eingriff in die Gesellschaft, sondern auch in die Wirtschaft dar (BMU 2005, S.
23). Weitere Interventionen der Regierung zur Verringerung der Emissionen durch den
Verkehr sind die Kennzeichnungspflicht des Energieverbrauchs und die Ausweisung
der CO
2
-Emissionen bei Pkws (BMU 2005, S. 21-26).
Deutschland hat sich im internationalen Vergleich als das ehrgeizigste Land im Klima-
schutz hervorgetan. Hierzu gaben hauptsächlich die historisch bedingten politischen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die Möglichkeit, die den gemeinschaftlich
gewachsenen Standpunkt Deutschlands bildeten, dass der Klimawandel eine ernst zu
nehmende Bedrohung darstellt, die einer gemeinsamen Handlung zur drastischen
Reduktion von Treibhausgasen bedarf (Hatch 2007, S. 41-42, 59). Das Vorsorgeprinzip
steht schon lange im Vordergrund der Umweltpolitik. Zudem haben sich in der
Öffentlichkeit starke umweltfreundliche Werte etabliert, die wiederum die Politik be-
einflussten (Bang, Vevatne und Twena 2007, S. 293). Die deutsche Kultur ist geprägt
von einer generellen Risikoaversion und holistischen
4
Werten, die dazu führen, dass der
Klimawandel als besonders ernste Bedrohung, aber auch als Herausforderung, an-
gesehen wird. Zudem besteht der Glaube darin, dass Ökonomie und Ökologie keine
Gegensätze darstellen, und dass über technologische und strukturelle Veränderungen
das dringend notwendige Wirken durchgreifend und umfassend erreicht werden kann
(Van der Wurff 2009, S. 465-466). Als eine der ökonomisch starken Nationen in Europa
ist es Deutschland gelungen im Klimaschutz eine Führungsposition einzunehmen, und
gilt somit im internationalen Wettbewerb als attraktiver Standort. Die Abhängigkeit von
importierten fossilen Energieträgern hat darüber hinaus auch einen Beitrag zur
Förderung der erneuerbaren Energien geleistet. Dadurch verfügt Deutschland über ein
4
Holismus, der (gr.): Lehre, nach der alle Daseinsformen der Welt danach streben, ein Ganzes zu
sein. Hier bedeutet es, in Kombination mit der Risikoaversion, dass die Natur als empfindliches und
instabiles Ganzes lieber in Frieden gelassen werden sollte (Van der Wurff 2009, S. 465).
8
Viertel der globalen Windenergiekapazitäten (Bang, Vevatne und Twena 2007, S. 288-
293).
Da die Folgen des Klimawandels erst lange Zeit nach dem Ausstoß der Treibhausgase
in Erscheinung treten, werden die von den Menschen heute verursachten Emissionen
erst nach mehreren Jahrzehnten ihre Wirkung zeigen. Leider stellt sich der Klima-
wandel als ein sehr komplexer Ursache-Wirkungszusammenhang dar, dessen Prog-
nosen, basierend auf verschiedenen Annahmen und Szenarien, stark variieren. Dadurch
sind die Folgenannahmen in ihrer zeitlichen und räumlichen Auswirkung sehr
unterschiedlich und immer mit einem bestimmten Grad von Unsicherheit behaftet. Auf
individuellem Handlungsniveau besteht nun das Problem, dass auf Grund der globalen
Zusammenhänge entweder ein stimulierender Impuls (da sich das Individuum sich
seines weitreichenden Einflusses bewusst wird) oder aber ein Hemmnis (aus dem
Gefühl von Ohnmacht oder Überforderung) zur Maßnahmenergreifung entsteht (Weber
2008, S. 34-41).
Den Medien kommt bei der Informationsvermittlung der Klimawandelursachen und -
folgen eine wichtige Rolle zu, da sie das öffentliche Problembewusstsein formen und
Handlungsintentionen fördern können, in dem sie das Problem thematisieren und eine
Vermittlerposition zwischen der Bevölkerung und der Wissenschaft einnehmen. Die
Laienwahrnehmung des Klimawandels ist somit geprägt von den Medien, die aber auf
Grund der Selektion und Transformation der Informationen (Weber 2008, S. 82-90), die
Gefahr falscher Informationsverarbeitung auf Seiten der Rezipienten birgt. So werden
Extremereignisse fälschlicherweise dem Klimawandel zugesprochen (z.B. Tsunamis
und Erdbeben als Folge des Klimawandels) (Weber 2008, S. 94-104). Zum besseren
Verständnis und um Handlungsoptionen im Alltag bei der Bevölkerung offen zu legen,
sind zahlreiche Kampagnen der Bundesregierung geplant und bereits durchgeführt
worden (BMU 2005, S. 23-25). Das Umweltbundesamt verdeutlicht die Anpassungs-
notwendigkeit an den gegenwärtigen und zukünftigen Klimawandel in technischer und
planerischer Weise. Darüber hinaus betont es die öffentliche Diskussion der Risiken,
welche die Folgen des Klimawandels bergen, um einen akzeptablen Konsens über
tolerierbare und intolerierbare Veränderungen zu finden. Die Folgen des Klimawandels
müssen verstärkt in das Bewusstsein der Öffentlichkeit, der Politik, Wirtschaft und Ver-
waltung vordringen (UBA 2008, S. 8).
9
Neben der Umstellung auf kohlenstoffarme Technologien im Bereich des Verkehrs, der
Wärmeerzeugung und der Energieerzeugung, sowie der Ausnutzung von Effizienz-
steigerungen und der Minderung von anderen Emissionen außerhalb der Energie-
wirtschaft (z.B. die Abholzung, die 18% der globalen Emissionen verursacht; Stern
2006, S. xxix) empfiehlt Stern (2006, S. xiv) die Verringerung der Nachfrage nach
emissionslastigen Gütern und Dienstleistungen. Um dieses zu erreichen zählt Stern
(2006, S. xx-xxiii) auf drei wesentlichen Instrumente der Politik: die Preissetzung für
CO
2
(ob über Steuern, dem Emissionshandel oder durch Regulierung), die Förderung
von Innovationen für effiziente und emissionsarme Technologien und die Motivation zu
Verhaltensänderungen. Letzteres ist notwendig, um Informationslücken und
Transaktionskosten bei Verbrauchern und Unternehmen zu überwinden und um
Organisationen als auch der Bevölkerung Impulse zur Umstellung zu geben. Einen
wichtigen Beitrag zur Hilfestellung für ,,kluge Entscheidungen" (Stern 2006, xxiv)
sowie den Wettbewerb um emissionsarme und energieeffiziente Güter und Dienst-
leistungen zu stimulieren, kann dabei die Etikettierung dieser leisten.
Bevor aber die weitere Bedeutsamkeit der Etikettierung mit Gütesiegeln im Wahr-
nehmungsprozess des Kunden (s. Kapitel 3.3) und die Kriterien zur effektiven Nutzung
evaluiert werden (s. Kapitel 4), wird im folgenden Kapitel die Laienwahrnehmung des
Klimawandels beschrieben und die Trends im Umweltbewusstsein der Bevölkerung
evaluiert.
3. Die Kundenanalyse
Im folgenden Kapitel steht der Kunde im Mittelpunkt, der im Laufe der Zeit
,,wählerischer, kritischer und [...] unberechenbarer" geworden ist (Essig, Soulas de
Russel und Semanakova 2003, S. 14). Die Entwicklungen der Bevölkerung, bzgl. des
Umweltbewusstseins und der Veränderung des Lebensstils, haben einen entscheidenden
Einfluss auf die markt- und umweltorientierte Unternehmensführung (Bruhn und
Kirchgeorg 2007, S. 86), wie das Kapitel 6 deutlich machen wird. Um die
verschiedenen Mechanismen des Kaufprozesses bei Konsumenten verstehen zu können,
ist es notwendig Modelle des Käuferverhaltens zu betrachten. Bevor dies aber
geschieht, werden als erstes Erkenntnisse über die Bevölkerung bzgl. ihrer
Wahrnehmung des Klimawandels und ihrer Tendenzen im Umwelt- und Klima-
bewusstsein vorgestellt.
10
3.1 Die Laienwahrnehmung des Klimawandels
Die öffentliche Wahrnehmung des Klimawandels kann nach Zwick (2001, S. 27) als auf
vier Säulen ruhend beschrieben werden. Die erste Säule der Wahrnehmung ist die Be-
schreibung der Umweltveränderungen, die entweder über die Medien kommuniziert
werden oder über die eigene Erfahrung erfolgt. Hierzu werden in der Untersuchung von
Zwick (2001, S. 27) hauptsächlich die Erderwärmung, das Abschmelzen der Polkappen,
die häufigeren Extremwetterereignisse wie Stürme, Überschwemmungen und Dürren,
der Meeresspiegelanstieg sowie das Ozonloch genannt. Wobei Letzteres ein Anzeichen
dafür ist, dass der Klimawandel in einen semantisch breiteren Zusammenhang
anthropogen verursachter Veränderungen der Erdatmosphäre eingeordnet wird. Die
zweite Säule stellt die Bewertung des Klimawandels dar, dem die meisten Befragten ein
,,schreckliche[s], bedrohliche[s]" und, wenn auch schleichend, zunehmendes Risiko zu-
schreiben (Zwick 2001, S. 28). Dieses Risiko wird von den nachfolgenden
Generationen zu tragen sein werden und ist räumlich ungleich verteilt. Die dritte Säule
stellt die Verursachungslogik des Klimawandels dar, wobei in der bei Zwick (2001, S.
29) zu Grunde liegenden Untersuchung die Industrie und der Staat gleichermaßen als
Hauptverantwortliche benannt werden. Jedoch sind die Befragten sich auch ihrer Selbst-
verantwortung bewusst, da das vom westlichen Lebensstil, der sich unter anderem dem
Konsum verschreiben hat, geprägte Verhalten einen entscheidenden Beitrag zum
Klimawandel leistet. Die vierte und letzte Säule ist die Wahrnehmung der Lösungs-
möglichkeiten. Bei der Untersuchung von Zwick (2001, S. 30-31) sehen die meisten Be-
fragten die Verantwortlichkeit zur Lösung allerdings überwiegend bei der Politik und
der Industrie, denen von den Befragten wenig Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei der
Lösungsumsetzung entgegen gebracht wird. In einer weiteren Veröffentlichung von
Zwick (2005, S. 185-186) wird dem Klimawandel, im Vergleich zu anderen Risiken,
zwar das gravierendste persönliche und soziale Bedrohungspotential zugemessen,
jedoch wird es als akzeptables Risiko hingenommen, weil die Vorzüge bspw. der Auto-
nutzung dem gegenüber stehen. Dadurch, dass der Klimawandel zu den abstrakten und
meist nicht persönlich erfahrbaren Risiken (und damit wenig subjektive, alltägliche
Relevanz zukommt) zählt, wirkt dieser auch nur latent in der Wahrnehmung. Er ist
somit von externen Anreizen abhängig, die ihn ins Bewusstsein rufen, bspw. wenn er in
den Medien Aufmerksamkeit erlangt. Dadurch wiederum ist der Klimawandel starken
Schwankungen ausgesetzt und ihm kommt eine wechselhafte alltägliche Bedeutsamkeit
zu (Zwick 2005, S. 489-494).
11
Kasemir et al. (2000, S. 173-174) konnten in ihrer Untersuchung nachweisen, dass euro-
päische (darunter auch deutsche) Bürger mit einer Energienutzung wie bisher
(,,business-as-usual") eindeutig eher negative Assoziationen haben. Die bisherige
Energienutzung hat schwerwiegende negative Einflüsse auf die Umwelt und ruft Angst
hervor. Die ersten Assoziationen, die die Befragten mit dem Klimawandel haben, sind
Dürren und Überschwemmungen sowie die negativen Auswirkungen auf die Lebens-
umstände, wie Krankheiten, zunehmende Missverhältnisse, Armut und Gewalt. Zudem
wird nur mit der ,,business-as-usual"-Perspektive die Folge der Arbeitslosigkeit
assoziiert. Außerdem äußern einige Teilnehmer zynische Kommentare oder tendieren
zum schwarzen Humor, wenn sie sich mit der ,,business-as-usual"-Perspektive
beschäftigen (insbesondere sind dies deutsche und schweizerische Teilnehmer). Zwar
wurde der Energiereduktion (die nur in Ergänzung mit technologischen Innovationen
erreicht werden kann) überwiegend positive Assoziationen (z.B. eine gesündere
Umwelt, ein gesteigertes Wohlbefinden) zugeschrieben, jedoch schien für einige
(deutsche) Teilnehmer die Reduktion der Energienutzung auch mit einem, ambivalent
(d.h. sowohl negativ als auch positiv, wenn es sich lohnt) zu bewertenden, Verzicht ein-
herzugehen (Kasemir et al. 2000, S. 180-181).
Wie Grothmann und Patt (2005, S. 202) herausstellen, bedarf es zwei Determinanten,
die das Individuum dazu motivieren sich aktiv an den Klimawandel anzupassen. Die
erste Determinante ist die wahrgenommene Ernsthaftigkeit des Problems, die das
Individuum dazu veranlasst, den Willen zu entwickeln etwas gegen die drohende
Beeinträchtigung (die im Zusammenhang mit der wahrgenommenen
Eintrittswahrscheinlichkeit der Klimawandelfolgen steht) durch den Klimawandel zu
unternehmen. Die zweite Determinante ist die wahrgenommene Anpassungsfähigkeit,
diese sagt aus in wie fern sich das Individuum in der Lage (bedingt durch den Zugang
und die Verfügbarkeit der benötigten Ressourcen) sieht etwas tun zu können. So kann
es zu einer unzureichenden Anpassung kommen, wenn sich das Individuum zwar vom
Klimawandel bedroht fühlt, sich aber nicht dazu befähigt sieht etwas dagegen machen
zu können. Aber auch wenn sich die Bevölkerung auf die effiziente Anpassung durch
die öffentliche Hand verlässt, wird sie nicht als erstes bei sich selber anfangen etwas
bewirken zu wollen (Grothmann und Patt 2005, S. 204-205). In einer Studie zu
Überschwemmungen in der Kölner Region konnten Grothmann und Patt (2005, S. 209)
herausstellen, dass sozio-kognitive, statt sozio-ökonomische, Faktoren ausschlaggebend
12
sind für die Anpassung. Konkret bedeutet dies, dass das Wissen über die Fähigkeiten
zur Anpassung die treibende Kraft ist. Dieses muss von Seiten der Regierung und
anderen Institutionen über Aufklärungsmaßnahmen vermittelt werden. Ebenfalls
betonen die Autoren Tjernström und Tietenberg (2008, S. 320-323) den Wissensstand
als wichtigen Faktor der zur Bildung der Besorgnis beiträgt. Allerdings sind auch die
Wohngegend (urban oder ländlich), die Pressefreiheit und das Vertrauen in die
Regierung weitere einflussreiche Faktoren. Brechin (2003, S. 119, 125) stellt bezüglich
des Wissensstandes fest, dass bei den meisten Bürgern, länderübergreifend
(Deutschland miteinbezogen), trotz einer Verbesserung in den letzten zehn Jahren,
immer noch ein Defizit besteht in dem Verständnis über die Ursachen- und
Folgewirkungen des Klimawandels (z.B. die fälschliche Verbindung des Ozonlochs mit
dem Klimawandel). Ebenso die Autoren O'Connor et al. (2002, S. 13-14) stellen heraus,
dass das Verständnis über die Ursachen des Klimawandels ein starker
Vorhersageparameter für die Ergreifung eigener Aktionen zur Emissionsreduktion ist.
Darüber hinaus wirken nicht etwa nur der Wohlstand oder generelle ökonomischen
Faktoren hemmend auf die eigene Verhaltensänderung und die Akzeptanz politisch-
ökonomischer Instrumente zur Reduktion. Ein Hemmnis entsteht nur, wenn
Umweltschutzmaßnahmen eine persönliche oder wirtschaftliche Einschränkung
bedeuten, die Befragten bspw. den Verlust ihres Arbeitsplatzes befürchten.
Welche Veränderungen das Konsumverhalten, welches unter anderem gesteuert wird
vom Umwelt- bzw. Klimabewusstsein, das wiederum vom Wissensstand abhängig ist,
mit der Zeit durchlaufen hat, wird das nachfolgende Kapitel klären.
3.2 Gesellschaftliche Entwicklungen und Charakteristika umwelt- und
klimabewusster Kunden
Das Konsumentenverhalten wird stark von Gewohnheiten und Routinen gesteuert,
daher sind sich die Konsumenten oftmals nicht ihres Verhaltens und ihrer Ent-
scheidungen voll bewusst. Dieses Verhalten wird durch den hektischen Alltag mit
seiner Reizflut an simultan eintreffenden Informationen weiter verstärkt. Da die
Gewohnheiten darüber hinaus schwer zu verändern sind, ist es notwendig in Betracht zu
ziehen wie solche Verhaltensmuster durchbrochen werden können. Maréchal (2009, S.
74-83) identifiziert für die Veränderung solcher routinierter Verhaltensmuster haupt-
sächlich externe Faktoren, wie soziale, kulturelle, institutionelle und technologische
13
Parameter. Um kognitiv aufwendiges Verhalten zu zeigen, müssen extrinsische Anreize
gesetzt werden, die der langfristig wirkenden Vorteilhaftigkeit (bspw. vermittelt über
gesellschaftliche Werte) statt der kurzfristigen Bequemlichkeit Nachdruck verleihen.
Huppes und Simonis (2009, S. 12-13) stellen einen Wandel in der westlichen Gesell-
schaft fest. Organisierte, institutionalisierte große Referenzgruppen, wie Kirchen und
Gewerkschaften, verlieren zunehmend ihre Bedeutung. Internalisierte moralische
Normen und Werte sind seltener verhaltensweisend. Es existiert kein gemein-
schaftlicher Konsens über falsches und richtiges Verhalten mehr, dafür zählt nur noch
das Urteil einer zunehmend globalen Referenzgruppe. Diese globale Referenzgruppe ist
entstanden durch die vor allem medial (z.B. über international verbreitete Unter-
haltungsmedien, aber auch durch die Internetnutzung) stärkere Verknüpfung von bisher
kulturell differenzierten Nationen. Während also die kulturelle Kontrollinstanz zu-
nehmend globaler wird, ist auf subjektiver Ebene aber ein Trend in Richtung
Individualisierung zu beobachten. Dies bedeutet, dass vermehrt individuelle Ent-
scheidungen gefällt werden, die mit dem eigenen Standpunkt und der subjektiven Welt-
anschauung argumentativ untermauert werden. Nicht nur die weltweite Population wird
in den nächsten Jahren zunehmen, sondern auch das Durchschnittsalter in den Industrie-
nationen (demographischer Wandel). Die Wirtschaft wird in technologischer Hinsicht
zunehmend komplexer, Innovationen gewinnen immer mehr an Bedeutung, Hierarchien
werden verstärkt abgebaut und es hat ein Wechsel von der Produktorientierung hin zur
Serviceorientierung stattgefunden. Dieser Wandel birgt allerdings die Gefahr in sich,
dass immer mehr Energie und Rohstoffe benötigt werden. Natürliche Ressourcen
nehmen allerdings stetig ab, dadurch nimmt das Interesse von Seiten der Bevölkerung
und der Wirtschaft an Recyclingmethoden zu. Die Menschheit ist zunehmend mit
globalen Umweltproblemen konfrontiert, wie dem Klimawandel und dem Verlust der
Biodiversität, die durch die zunehmende Vernichtung und Vereinheitlichung (Mono-
kulturalisierung) von Ökosystemen hervorgerufen wird (Huppes und Simonis 2009, S.
246-249).
Franzen und Meyer (2004, S. 124-125) fanden in ihrem länderübergreifenden Vergleich
zum Umweltbewusstsein heraus, dass dieses in dem Zeitraum von 1993 bis 2000, nicht
nur in Deutschland, leicht abgenommen hat, sich aber in manchen Ländern auch
stabilisiert hat. Die Bevölkerung ist teilweise auch weniger bereit, in monetärer und
14
anderer Hinsicht, für die Verbesserung der Umwelt Aufwendungen zu akzeptieren.
Diese verringerte Zahlungsbereitschaft dürfte, nach Ansicht der Autoren Franzen und
Meyer (2004, S. 131), an der bereits existierenden vergleichsweise hohen Belastung der
Bevölkerung durch die Steuern für Umweltbelange in Deutschland liegen. Nach ihrer
Untersuchung sind das Einkommen (allerdings nur in einem bestimmten Intervall), das
Geschlecht (Frauen sind umweltbewusster), die Bildung (dieser Effekt sinkt allerdings
nach einer gewissen Bildungsbeteiligung ab, bevor er wieder ansteigt) und post-
materialistische
5
Werte (allerdings nur auf einem individuellem nicht etwa einem
kollektiven Niveau) die Parameter, die das Umweltbewusstsein begünstigen. Das Alter
und der Ehestand wirken eher negativ auf das Umweltbewusstsein (Franzen und Meyer
2004, S. 127-131). Bruhn und Kirchgeorg (2007, S. 94-95) fanden in ihrer Unter-
suchung ebenfalls heraus, dass die Gruppe der ökologisch bewussten Konsumenten
(ökologische Einstellung, ökologisches Wissen und Verhalten vorhanden) in dem
Zeitraum 1977-1994 zwar stetig anstieg, aber in der Zeit von 1994 bis 2004 sich fast
halbiert hat (von 55% auf 29%). Auch die Zahl der Konsumenten mit ökologischer
Einstellung und ökologischem Wissen (ohne ökologischem Verhalten) ist in dem letzt-
genannten Zeitraum gesunken (von 10,3% auf 1,3%). Deutlich zugenommen haben aber
die Gruppen der ökologisch weniger (von 28,7% auf 42,9%) bzw. nicht bewussten Kon-
sumenten (von 6,0% auf 26,8%). Dies lässt im ersten Augenblick vermuten, dass das
umweltfreundliche Verhalten in der deutschen Bevölkerung abgenommen hat. Bei
genauerer Betrachtung der Gruppen ergibt sich jedoch ein anderes Bild. In der Gruppe
der ökologisch weniger bewussten Gruppe (mit einer 1,5fachen Zunahme), ist die Zahl
der Konsumenten angestiegen, die zwar eine ökologische Einstellung und auch
ökologisches Verhalten aufweisen, jedoch nicht über ökologisches Wissen verfügen.
Auch der sehr hohe (4,5fache) Zuwachs der Gruppe der ökologisch nicht bewussten
Konsumenten verdankt seinem Wachstum den Konsumenten mit einem ökologischen
Verhalten, die aber weder über eine ökologische Einstellung noch über ökologisches
Wissen verfügen. Es gab also entgegen dem ersten Eindruck keine Abnahme des
ökologischen Verhaltens, sondern es hat eine Abnahme des ökologischen Wissens (und
der Einstellung) gegeben. Des Weitern ergibt sich bei Betrachtung der sozio-demo-
graphischen Angaben, dass die Gruppe der ökologisch nicht Bewussten (also weder
eine ökologische Einstellung, noch ökologisches Wissen oder Verhalten vorhanden ist),
5
Individuen, die in einer Gesellschaft mit ökonomischer Sicherheit aufwachsen, entwickeln eine
Präferenz für immaterielle Werte und damit bspw. ein höheres Umweltbewusstsein (Franzen und Meyer
2004, S. 121).
15
die von 0,8% auf 2,3% in den Jahren 1994 zu 2004 angestiegen ist, gekennzeichnet ist
von einer überwiegend jungen Population, die über ein geringes Ausbildungsniveau
verfügt und eher einer sozialen Unterschicht angehört (Bruhn und Kirchgeorg 2007, S.
96-97). Im Verhalten hat es also insgesamt einen Zuwachs gegeben. Bruhn und Kirch-
georg (2007, S. 97) bezeichnen dies als einem Trend zu einer verstärkten Ökologie-
orientierung bei der Verhaltensabsicht (2004 sind 41,2% stark ausgeprägt und 33,7%
sogar überragend stark ausgeprägt in ihrem umweltbewussten Verhalten). Durch die
fehlende kognitive (Wissen) und auch affektive (Einstellung) Komponente stellt sich
nun das Problem der eigentlichen umweltbewussten Handlung. So kann es eben durch
dieses Defizit dazu kommen, dass zwar ein umweltbewusstes Verhalten bekundet wird,
aber nicht in die Tat umgesetzt wird. Diese Vermutung wird noch weiter untermauert
durch die Tatsache, dass 73,8% der Befragten (in 2004) vermuten, dass die Umwelt-
bekundung der Anderen lediglich ein Lippenbekenntnis ist. Dieses wird, so vermuten
die Autoren, bspw. durch den Druck der sozialen Erwünschtheit von umweltbewusstem
Verhalten verursacht. Durch dieses Defizit entsteht nicht genug Motivation die Kosten
für das Kollektivgut auf individuellem Niveau zu übernehmen (Bruhn und Kirchgeorg
2007, S. 99-100). Es könnte somit ein so genannter ,,Trittbrettfahrer-Effekt"
6
vorliegen.
Allerdings stellen Bruhn und Kirchgeorg (2007, S. 100-101) auch fest, dass im Jahre
2004 sich die Verbraucher als die Hauptverantwortlichen bei der Lösung von Umwelt-
problemen sehen, gefolgt von den Herstellern und dem Staat. Dazu empfehlen die
Autoren, dass Hersteller ihren Beitrag zur Förderung des umweltbewussten Verhaltens
bei den Verbrauchern durch die Bereitstellung einer breiteren umweltfreundlichen
Produktpalette leisten können, und der Staat durch die Gesetzgebung eben dieses unter-
stützen sollte. Durch die seit 2006 verstärkte Sensibilisierung der Bevölkerung für die
Problematik des Klimawandels, könnte sich die affektive Komponente des Umwelt-
bewusstseins verändern. Diese Komponente könnte nicht nur zunehmen, sondern sie
könnte einen Wandel erfahren, von der bisher eher positiven Zuwendung zur Natur, die
geschützt werden soll, hin zu dem Gefühl einer unberechenbaren und bedrohlichen
Umwelt, vor der sich die Bevölkerung schützen muss (Bruhn und Kirchgeorg 2007, S.
104-106).
6
Der Trittbrettfahrer-Effekt bedeutet einen Motivationsverlust, der entsteht, wenn der einzelne
Beitrag zur Lösung eines kollektiven Problems nicht mehr eindeutig zurechenbar ist und das
gemeinschaftliche Ziel auch erreicht wird, wenn sich nicht jeder bis zum letzten engagiert (Fischer und
Wiswede 2002, S. 605).
16
Das Phänomen der Differenz zwischen einer geäußerten Verhaltensabsicht und dem tat-
sächlichen Verhalten (wie oben dargestellt durch das Phänomen des ,,Lippen-
bekenntnisses") bedarf einer genaueren Betrachtung. Das umweltrelevante Wissen eines
Individuums und die Wertigkeit der Umwelt für das einzelne Individuum wirken auf die
Verhaltensintention und nicht direkt auf das eigentliche Verhalten (Kaiser, Wölfing und
Fuhrer 1999, S. 12-13). Nur situationsspezifische Determinanten sind direkte Auslöser
für eine Handlung. Die unterschiedliche Wahrnehmung und Interpretation der Situation
hängt wiederum von der Einstellungsaktivierung ab. Daher kann eine umweltfreund-
liche Einstellung nicht als alleinige Variable entsprechendes Handeln erklären. Viel-
mehr bewirken Kontrollüberzeugungen (im Sinne des wahrgenommenen Schwierig-
keitsgrades der Ausführung einer Handlung) bei umweltbewussten Personen, dass
Intentionen entwickelt und auch ausgeführt werden. Während bei eher weniger umwelt-
bewussten Personen soziale Normen zu der Verhaltensabsicht führen, dies aber nicht
zwangsläufig in eine Handlung übergeht (Bamberg 2003, S. 23-30). Eine weitere
situationsspezifische Determinante des Verhaltens sind die Kosten (in einem weiteren
Sinne als der bloß monetären Art), die ein Individuum aufnehmen muss um eine Hand-
lung auszuführen. Diese Kosten beeinflussen den Effekt der Einstellung auf das Ver-
halten, d.h. Intentionen gehen erst in Handlungen über, wenn diese Handlung mit wenig
Kosten und Mühen verbunden ist. So zählen bspw. Aktivitäten wie das Trennen von
Müll zum Zwecke des Recyclings zu den eher weniger anstrengenden bzw. kost-
spieligen Tätigkeiten, wenn nicht noch weite Distanzen zum Recyclingcontainer
zurückgelegt werden müssen, sondern jeder Haushalt mit verschiedenen Mülltonnen
ausgestattet ist. Die Vorteile der Bequemlichkeit und Mobilität fallen viel schwerer ins
Kostenkalkül, daher stellt die Mobilitätsumstellung eher eine kostspielige Angelegen-
heit dar. Bei hohen Kosten werden Umweltaspekte herabgesetzt um Dissonanzeffekte
7
zu vermeiden und das Selbstwertgefühl zu wahren (Diekmann und Preisendörfer 2003,
S. 443-445).
Vor dem Hintergrund der Verbreitung des Nachhaltigkeitsgedanken in der Bevölkerung
sprechen Kuckartz und Rheingans-Heintze (2006, S. 17) von einem ,,sehr aufnahme-
bereiten Boden". Zwar können nur wenige den Begriff der Nachhaltigkeit richtig
7
Eine Dissonanz (=Unstimmigkeit) kann bei einstellungswidrigen Verhalten entstehen,
Einstellung und Verhalten sind somit schwer zu vereinbaren, daher führt dieser Effekt zu einem
unangenehmen Spannungszustand, der beseitigt oder zumindest reduziert werden möchte (Fischer und
Wiswede 2002, S. 242-243).
17
beschreiben, jedoch wird deutlich, dass die intergenerative Gerechtigkeit bei 88% der
Bevölkerung die größte Motivation zum Umweltschutz auslöst. Tendenziell hat der
Umweltschutz im Vergleich zu den 80er Jahren einen geringeren Stellenwert ein-
genommen. Dies liegt daran, dass viele Umweltprobleme, wie die Luftverschmutzung,
gelöst wurden und andere bspw. wirtschaftliche Probleme in den Vordergrund gerückt
sind. Hinzu kommt, dass viele weiterhin bestehende Umweltprobleme, wie die Ver-
breitung hormonell wirkender Chemikalien und der Klimawandel, nicht unmittelbar
persönlich erfahrbar sind. Trotzdem hat der Umweltschutz an Bedeutung gewonnen,
während er in den Jahren 2000 und 2002 noch auf dem vierten Platz der wichtigsten
Probleme in Deutschland lag ist er im Jahre 2004 auf den dritten Platz aufgestiegen. Im
Vergleich zu 2002 ist 2004 zwar die Zustimmung, dass der Umweltschutz ,,sehr
wichtig" ist um 6% gesunken, jedoch ist die Zustimmung zu ,,eher wichtig" in nahezu
gleichem Maße gestiegen (Kuckartz und Rheingans-Heintze 2006, S. 18-21). Das
Umweltbewusstsein, vor allem das Umweltkrisenbewusstsein, ist nach der Unter-
suchung von Kuckartz und Rheingans-Heintze (2006, S. 23-27) von 2002 auf 2004
leicht gestiegen, und die Umwelteinstellungen haben sich kaum verändert. Obwohl 29%
der Bevölkerung es als schwierig erachten persönlich etwas für die Umwelt tun zu
können, sehen sich immerhin 40% der Bevölkerung in der Verantwortung bei sich
selbst anzufangen. 53% der Bevölkerung schätzen das Risiko, das mit dem Klima-
wandel verbunden wird, als äußerst oder sehr gefährlich ein. Die Umweltbewussten
fühlen sich im Vergleich zu den weniger Umweltbewussten schlechter informiert über
die Gesundheits- und Umweltverträglichkeit von Produkten, wobei 62% der Be-
völkerung über einen Mangel klagen (Kuckartz und Rheingans-Heintze 2006, S. 28-30).
Es ist festzustellen, dass nur 8% der Bevölkerung sehr bereit sind Verzichte von ihrer
bisherigen Lebensweise hinzunehmen und nur 10% sehr bereit sind höhere Preise für
umweltfreundliche Produkte zu akzeptieren. Trotzdem genießen der ,,Blaue Engel"
(83%) und das ,,Bio-Siegel" (73%) einen hohen Bekanntheitsgrad unter der
Bevölkerung, und etwa die Hälfte gibt an diese auch bei ihrem Einkauf in ihrer Ent-
scheidung in Betracht zu ziehen. Diese Beachtung steigt mit dem Einkommen an und
hängt auch mit dem Geschlecht zusammen, da eher Frauen angeben öfter diese
gekennzeichneten Produkte zu kaufen. Allerdings ist die Häufigkeit des Kaufs von
ökologisch gekennzeichneten Lebensmitteln im Vergleich zu 2002 unverändert. In Be-
zug auf die Energienutzung ist der Trend zur Anschaffung energieeffizienter Haus-
haltsgeräte kontinuierlich angestiegen. Allerdings ist die Bereitschaft Ökostrom zu be-
18
ziehen gesunken, da viele sich als zu wenig informiert sehen und diesen als zu teuer
empfinden. Das Automobil ist das beliebteste Fortbewegungsmittel geblieben und die
Bus- und Bahnnutzung stellen für den Großteil der Bevölkerung keine Alternative für
das Auto oder das Flugzeug dar (Kuckartz und Rheingans-Heintze 2006, S. 33-41). Als
entscheidende Faktoren für das Umweltbewusstsein erweisen sich das Geschlecht
(Frauen sind stärker vertreten), ein höherer Bildungsgrad und das Alter, während das
Einkommen kaum einen Einfluss hat. Vor allem die 18- bis 24-Jährigen erweisen sich
als weniger umweltbewusst und repräsentieren überdurchschnittlich die Gruppe der
Umweltignoranten. Dies ist wohl auf den geminderten Druck durch akute Umwelt-
probleme (im Vergleich zu dem von vor zehn Jahren) und auf den Konsum von
Produkten die ,,in" sind zurückzuführen. Zudem ist diese Generation in einen Umfeld
aufgewachsen, in dem umweltbelastender Konsum zum Alltag und somit zur Gewohn-
heiten geworden ist (Kuckartz und Rheingans-Heintze 2006, S. 48-68). Zwar kann
zusammenfassend eine positive Entwicklung des Umweltbewusstseins beobachtet
werden, jedoch ist die Folge der verbreiteten Verankerung und Kommunikation des
Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanken in der Gesellschaft und Wirtschaft eine Normal-
isierung der Problematik, die die Bevölkerung eher weniger dazu veranlasst sich zu em-
pören oder zu engagieren. Die Lösung von Umweltproblemen wird zunehmend an den
Staat delegiert, obwohl eine Sensibilisierung (Katastrophenszenarien werden als immer
wahrscheinlicher eingestuft) für diese zu verzeichnen ist, mangelt es an individuellem
Einsatz (Kuckartz und Rheingans-Heintze 2006, S. 71-74). Dies kann daran liegen, dass
Kampagnen zur Sensibilisierung der Bevölkerung, die hauptsächlich die negativen
Folgen menschlichen Verhaltens thematisieren ohne dabei auch gleichzeitig die
Möglichkeiten umweltfreundlicher Handlungsoptionen aufzuzeigen, eine Abwehr-
haltung fördern können (Tanner und Foppa 1995, S. 130).
In einer Untersuchung von Lord, Bub und Ramspeck (2007, S. 31-34) wird deutlich,
dass 57% der Befragten sich mit dem Klimawandel beschäftigen und sogar 21,7% sich
sehr stark damit auseinandersetzen. Für 95% der Befragten hat der Klimawandel die
wichtigste zukünftige Bedeutung. Die befragten Kunden der Erhebung sind sich dessen
bewusst, dass sich ihre Lebensweise noch nicht genügend gewandelt hat, aber viele
kleinere und finanziell wenig aufwendige Maßnahmen (wie der Kauf von Energie-
sparlampen) wurden bereits umgesetzt und bis 2010 sind auch größere Investitionen
(wie der Kauf eines spritsparenden Autos oder einer Photovoltaik-Anlage) geplant. Vor
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836647014
- DOI
- 10.3239/9783836647014
- Dateigröße
- 1.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität zu Köln – Handel und Kundenmanagement, Studiengang Wirtschaftspädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2010 (Mai)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- klimasiegel klimabewusstsein clusteranalyse konsumentenumfrage gütesiegel
- Produktsicherheit
- Diplom.de