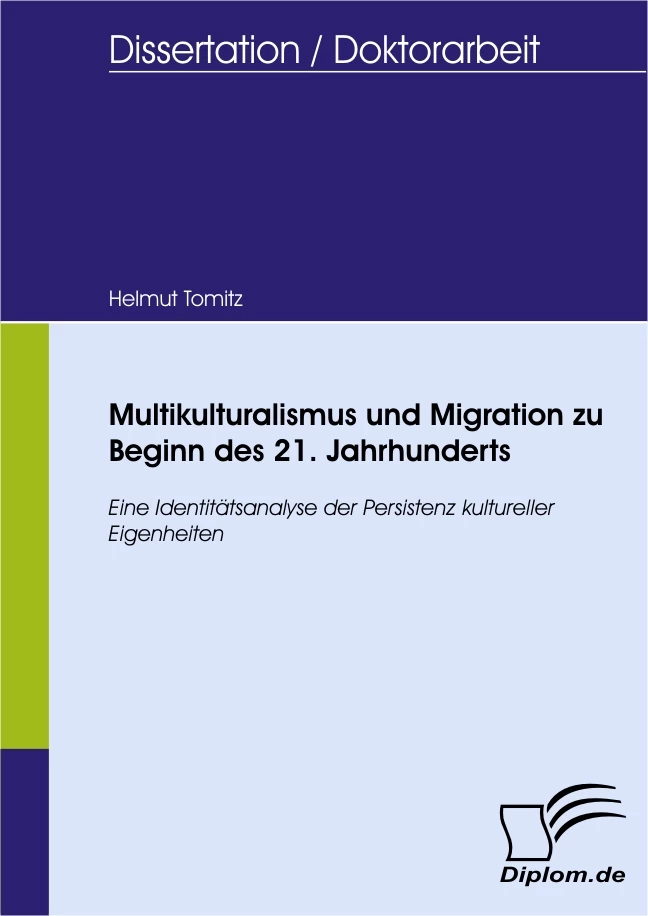Multikulturalismus und Migration zu Beginn des 21. Jahrhunderts
Eine Identitätsanalyse der Persistenz kultureller Eigenheiten
©2010
Doktorarbeit / Dissertation
288 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Bei etwa 8,3 Millionen Inlandsösterreichern leben heute Schätzungen zufolge weltweit 470.000 Auslandsösterreicher und bis zu eine Million Herzensösterreicher dauerhaft in einem anderen Land. Während man sich in über 400 österreichbezogenen Vereinigungen weltweit organisiert, werden die Auslandsösterreicher oft und gerne als das 10. Bundesland bezeichnet und wären laut dieser Definition das zahlenmäßig siebentgrößte Bundesland Österreichs.
Die vorliegende Publikation untersucht die gegenwärtige österreichische Emigranten-Situation sowie einzelne historisch bedingte Konstellationen in Lateinamerika, beziehungsweise Argentinien zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Ich versuche, mehr Verständnis für die aktuelle individuelle, beziehungsweise persönliche Situation dieser Auslandsösterreicher zu schaffen. Die Ausführungen in dieser Arbeit verstehen sich zum einen als ein Beitrag mit dem Ziel, mehr Akzeptanz für im Ausland lebende Österreicher zu gewinnen, versuchen zum anderen jedoch gleichzeitig, eine differenziertere Wahrnehmung gegenüber in Österreich lebenden Ausländern zu entwickeln. Aufschlussreich ausgewertete Erhebungsbögen von bereits seit längerer Zeit in dieser Region lebenden Österreichern verstehen sich nach ihrer Auswertung beziehungsweise Interpretation als wichtige Basis der vorliegenden Arbeit. Diese Rückschlüsse verbunden mit den Erkenntnissen aus einer Reihe von persönlichen Gesprächen und Interviews mit Auslandsösterreichern setze ich zum einen mit analoger Fachliteratur, zum anderen mit persönlichen Recherchen, beziehungsweise Erlebnissen in Beziehung. Anhand von alltags-, sozial- und geschlechterspezifischen Fragestellungen ist mein Ziel, die individuelle sowie kollektive Dimension der österreichischen Emigration nach Lateinamerika zu untersuchen.
Eine Analyse der bereits in zahlreichen Publikationen beschriebenen Emigrationen vor, beziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg nehme ich nur bedingt, beziehungsweise im Kontext vor. Mit anderen Worten: Wesentlicher Fokus der Untersuchungen ist die Emigration aus freiem Willen, beispielsweise Wirtschaftsemigranten (und deren Angehörige) sowie nach 1960 ausgewanderte Österreicher. Folgende Auswanderungsgruppen besitzen aus diesem Grund weniger Relevanz für meine Recherchen: politisch begründete Emigrationsgruppen, jüdische Bevölkerungsgruppen, Emigranten mit Bezug zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Nichtsdestoweniger bildet die […]
Bei etwa 8,3 Millionen Inlandsösterreichern leben heute Schätzungen zufolge weltweit 470.000 Auslandsösterreicher und bis zu eine Million Herzensösterreicher dauerhaft in einem anderen Land. Während man sich in über 400 österreichbezogenen Vereinigungen weltweit organisiert, werden die Auslandsösterreicher oft und gerne als das 10. Bundesland bezeichnet und wären laut dieser Definition das zahlenmäßig siebentgrößte Bundesland Österreichs.
Die vorliegende Publikation untersucht die gegenwärtige österreichische Emigranten-Situation sowie einzelne historisch bedingte Konstellationen in Lateinamerika, beziehungsweise Argentinien zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Ich versuche, mehr Verständnis für die aktuelle individuelle, beziehungsweise persönliche Situation dieser Auslandsösterreicher zu schaffen. Die Ausführungen in dieser Arbeit verstehen sich zum einen als ein Beitrag mit dem Ziel, mehr Akzeptanz für im Ausland lebende Österreicher zu gewinnen, versuchen zum anderen jedoch gleichzeitig, eine differenziertere Wahrnehmung gegenüber in Österreich lebenden Ausländern zu entwickeln. Aufschlussreich ausgewertete Erhebungsbögen von bereits seit längerer Zeit in dieser Region lebenden Österreichern verstehen sich nach ihrer Auswertung beziehungsweise Interpretation als wichtige Basis der vorliegenden Arbeit. Diese Rückschlüsse verbunden mit den Erkenntnissen aus einer Reihe von persönlichen Gesprächen und Interviews mit Auslandsösterreichern setze ich zum einen mit analoger Fachliteratur, zum anderen mit persönlichen Recherchen, beziehungsweise Erlebnissen in Beziehung. Anhand von alltags-, sozial- und geschlechterspezifischen Fragestellungen ist mein Ziel, die individuelle sowie kollektive Dimension der österreichischen Emigration nach Lateinamerika zu untersuchen.
Eine Analyse der bereits in zahlreichen Publikationen beschriebenen Emigrationen vor, beziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg nehme ich nur bedingt, beziehungsweise im Kontext vor. Mit anderen Worten: Wesentlicher Fokus der Untersuchungen ist die Emigration aus freiem Willen, beispielsweise Wirtschaftsemigranten (und deren Angehörige) sowie nach 1960 ausgewanderte Österreicher. Folgende Auswanderungsgruppen besitzen aus diesem Grund weniger Relevanz für meine Recherchen: politisch begründete Emigrationsgruppen, jüdische Bevölkerungsgruppen, Emigranten mit Bezug zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Nichtsdestoweniger bildet die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Helmut Tomitz
Multikulturalismus und Migration zu Beginn des 21. Jahrhunderts
Eine Identitätsanalyse der Persistenz kultureller Eigenheiten
ISBN: 978-3-8366-4673-4
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Karl-Franzens-Universität Graz, Graz, Österreich, Dissertation / Doktorarbeit, 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
Seite 3
Vorwort
Am Tag, da ich meinen Pass verlor, entdeckte ich, dass man mit seiner Heimat
mehr verliert als einen Fleck umgrenzter Erde.
(Stefan Zweig)
,,Als Österreicher im Ausland zu leben ist die optimale Möglichkeit,
daheim wegzufahren und ,zu Hause' anzukommen!"
(Helmut Tomitz)
Diese Arbeit ist gewidmet...
meiner geliebten Familie,
die mich stets bei der Entstehung dieser Arbeit unterstützt hat
sowie
allen, die stolz sind, ,,Österreicher" zu sein.
Links oben, links unten und rechts unten:
Abbildung 1: Schematische Darstellung Uni Graz
(vgl. Uni Graz, 2008, Internet)
Abbildung 2: Argentinische Flagge
(vgl. eigene Recherche)
Abbildung 3: Straßenschild ,,Calle de Austria" in Buenos Aires
(vgl. eigene Recherche)
Seite 4
Vorwort
Vorwort
Seit etwa 15 Jahren beschäftige ich mich mit der spannenden Thematik ,,Auslandsösterrei-
cher/innen". Das Interesse und die große Leidenschaft haben mich auch zu meiner Dissertati-
on mit dem Forschungsfokus Auslandsösterreicher/innen in Lateinamerika und dem Schwer-
punkt Argentinien geführt. Interessant und faszinierend ist für mich eine Forschungstätigkeit,
die sich zugleich auf zwei oder mehrere Staaten bezieht, wobei ein Perspektivenwechsel voll-
zogen werden kann, der viele neue Einsichten bietet.
Speziell die vorliegende Analyse der Persistenz kultureller Eigenheiten österreichischer Aus-
landsemigranten bietet ein weites, interessantes Forschungsspektrum. Lateinamerika und vor
allem mein Land im Fokus, Argentinien, bietet mit seiner multikulturellen Gesellschaft und
den emigrantenfreundlichen Zugängen einen im Bereich meiner Zielgruppe noch unergiebig
erforschten Bereich. In einer ständig enger zusammenwachsenden Welt und im Zeitalter der
Globalisierung soll diese interdisziplinär inspirierte Arbeit meinen motivierten Beitrag zur
Völkerverständigung liefern.
Erste Eindrücke von der lateinamerikanischen Kultur bekam ich während meiner Schulzeit im
Rahmen meines Geographieunterrichts. Später spezialisierte ich mich endgültig während
meines Studiums an der Karl-Franzens Universität Graz, parallel zu einer fundierten didakti-
schen Ausbildung mit Fokus auf Schul- und Erwachsenenbildung, schwerpunktmäßig auf
auslandsrelevante Themen und hier im Speziellen auf die Regionen Lateinamerika und Aust-
ralien. In diesem Zusammenhang entstand in den Jahren 2000 bis 2002 meine Diplomarbeit
zum Thema ,,Österreichische Emigranten in der multikulturellen Gesellschaft Australiens am
Beginn des 21. Jahrhunderts". Nach meinem einjährigen Erasmus-Studienaufenthalt an der
,,Universidad de Salamanca" in Spanien führte mich mein Forschungsweg nach Übersee, wo
ich im Jahr 2001 sieben Monate an der University of Wollongong in New South Wales (Aust-
ralien) gleichzeitig studiert und für die Diplomarbeit
recherchiert habe. Während dieser Zeit lernte ich eine Vielzahl nun in Australien lebender,
ausgewanderter Österreicher/innen kennen und schätzen. In unzähligen Gesprächen
Abbildung 4: Logo ,,University of Wol-
longong"
(vgl. UOW, 2002, Internet)
Seite 5
Vorwort
konnte ich dabei immer wieder feststellen, dass bei vielen von ihnen noch immer ein starker
Bezug zur Heimat vorhanden ist.
Die Faszination und die Leidenschaft für das Thema ließen mich auch nach Beendigung mei-
nes Studiums nicht mehr los: Ich entschloss mich, die vorliegende Dissertation zu verfassen.
Nach weiteren Reisen in mittlerweile über 50 verschiedene Länder weltweit führten mich die
Forschungsarbeiten zur vorliegenden Dissertation in Folge unter anderem für sieben Wochen
nach Südamerika, wo ich mich vorwiegend in Argentinien (Buenos Aires) und Uruguay
(Montevideo), aber auch Brasilien (Florianopolis) aufhielt. Die Botschaft in Buenos Aires, in
der man mir dankenswerterweise unkompliziert einen eigenen Arbeitsplatz zur Verfügung
stellte, aber vor allem auch geschätzte Mitglieder vom Club Social y Deportivo Austria und
Mitarbeiter vom Goethe-Institut Buenos Aires waren während dieser Zeit eine wertvolle Hil-
fe.
Weitere wichtige Informationen konnte ich am Iberoamerikanischen Institut in Berlin bezie-
hen, wo es beispielsweise das weltweit einzige vollständige Archiv des deutschsprachigen
,,Argentinischen Tageblatts" gibt.
Neben Zeitzeugengesprächen in Lateinamerika und Österreich führte mich der Weg weiters
nach Wien, wo ich vor allem in der Österreichischen Nationalbibliothek, in der Exilbibliothek
und im Lateinamerika Institut fündig wurde. In Graz waren für die Recherchen vor allem die
Universitätsbibliothek der Universität Graz, das Steiermärkische Landesarchiv, das Landes-
museum Joanneum, die Steiermärkische Landesbibliothek und die ,,Welthaus-Mediathek"
relevant. Die umfangreichen Recherchen im Internet waren intensiv beziehungsweise ergiebig
und für diese Arbeit unverzichtbar.
Bei der Erstellung der vorliegenden Dissertation fand ich von Anfang an viele mich unterstüt-
zende Personen, bei denen ich mich an dieser Stelle herzlich bedanke. Mehrere Einzelperso-
nen, Vereine und Institutionen trugen ihren Teil dazu bei, dass die Recherchen erfolgreich
verlaufen konnten.
Stellvertretend für alle, die mich während der verschiedenen Bearbeitungsphasen unterstütz-
ten, möchte ich mich herzlich bei einigen gesondert bedanken:
Alfredo Schwarz (Buenos Aires)
Arthur Pointner (Präsident des Club
Social y Deportivo Austria)
Bruno Kootz (Club Social y
Deportivo Austria)
Seite 6
Vorwort
Dr. Irmgard Helperstorfer (AÖ-
Weltbund)
Fritz Kalmar (Montevideo)
Georg Thalhammer (Club Social y
Deportivo Austria)
Gerald Ganglbauer (AÖ-Weltbund)
Mag. Harald Ulbrich (Konsul,
Österr. Botschaft Buenos Aires)
Mag. Andreas Melan (Österr. Bot-
schaft Buenos Aires)
Mag. Jessica Köhldorfer (Lektorin)
Mag. Georg Höber (langjähriger
Freund und AÖ in Mexiko)
Yuri Standenat (Österreichischer
Botschafter in Buenos Aires)
Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Friedrich M. Zimmermann vom Insti-
tut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz, der mir stets mit seinem kriti-
schen Rat zur Seite stand und mir dabei dennoch genügend Freiräume ließ. Meine Schwester
Heidi war während der gesamten Schaffensphase eine wertvolle Beraterin und neben dem
abschließenden Korrekturlesen immer wieder mit Ideen und Tipps zur Stelle. Meiner Mutter,
meinem Bruder Hermann, meiner Schwester Martina sowie meinen lieben Freunden Franz,
Franz-Thomas, Günter, Richard und Robert danke ich für ihren stärkenden Zuspruch und ihre
seelische sowie praktische Unterstützung während der Fertigstellung. Mein langjähriger
Freund Gunther war nicht nur durch seine wissenschaftliche Expertise eine besonders wert-
volle Hilfe, sondern gab mir mit Humor und erheiternden Gesprächen immer wieder Kraft.
An dieser Stelle ist es mir ein besonderes Anliegen, mich bei all meinen Freunden herzlich zu
bedanken, die mich auf meinem Lebensweg begleiten und mir immer mit Rat und Tat zur
Seite stehen. Meiner geliebten Ehefrau Gabi gilt ganz besonderer Dank: ohne Ihre Unterstüt-
zung wäre die Fertigstellung dieser Arbeit nicht in dieser Form möglich gewesen.
Bedanken will ich mich - last but not least- bei meinen Töchtern Felicia Jasmin und Lucia
Alice. Sie haben mich, neben viel Freude, die sie mir bereiten, bei der vorliegenden Arbeit
dazu animiert, Zeit und Energien noch effizienter zu fokussieren.
Anmerkung: Ich verzichte im Folgenden auf etwaige geschlechterspezifische Formulierungs-
unterschiede, betone jedoch, dass alle gewählten geschlechterspezifischen Formulierungen
geschlechterneutral zu verstehen sind und sich gleichermaßen auf männliche wie weibliche
Personen beziehen.
Seite 7
Zusammenfassung
Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wird die Situation österreichischer Auslandsemigranten zu Beginn des 21.
Jahrhunderts in Lateinamerika beleuchtet, wobei der Fokus auf die in Argentinien lebenden Auslands-
österreicher gerichtet ist. Primär wird die Gruppe jener österreichischen Emigranten erforscht, die
Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg und aus freiem Willen verlassen haben. Diese Personen müs-
sen, um für die vorliegenden Untersuchungen relevant zu sein, die Österreichische Staatsbürgerschaft
besitzen oder zuvor einmal besessen haben, und zumindest sechs Monate dauerhaft in Lateinamerika
gelebt haben. Auf Grund dieser Definition konnten auch jene Österreicher nach ihren Eindrücken be-
fragt werden, die nur kurz in der untersuchten Region wohnhaft sind beziehungsweise waren, bei-
spielsweise Kontrakt- oder Investitionsösterreicher sowie Schüler und Studenten.
Hauptforschungsaspekt dieser Dissertation ist die Persistenz kultureller Eigenheiten der Zielgruppe,
wobei speziell das Einwanderungsland Argentinien mit seiner multikulturellen Gesellschaft und den
emigrantenfreundlichen Zugängen einen in der Wissenschaft noch unergiebig erforschten Bereich
darstellt. Erkenntnisreich interpretierte Erhebungsbögen bilden nach ihrer vergleichenden Auswertung
eine wichtige Basis für die Recherchen. Die Schlussfolgerungen werden mit den Erkenntnissen aus
persönlichen Gesprächen und Interviews mit Personen der Zielgruppe in Beziehung gebracht. Analoge
Fachliteratur sowie persönliche Recherchen beziehungsweise Erlebnisse des Verfassers dieser Arbeit
bilden eine weitere vergleichbare, wichtige Basis. Sämtliche Erkenntnisse und Aspekte fließen in ein
umfangreiches Schlussresümee ein, in dem sich abschließend herauskristallisiert, dass sich der über-
wiegende Teil der heute in Argentinien lebenden Österreicher sehr wohl noch als ,,Österreicher" fühlt
und sich der österreichischen Werte bewusst ist.
Diese Aussage muss jedoch differenziert interpretiert werden, weshalb jedes einzelne Kapitel in dieser
Publikation erforderlich ist. Nach der Definition, wer als Österreicher bezeichnet werden kann, wird
der Frage nachgegangen, mit welchen Herausforderungen Auslandsösterreicher weltweit zu Beginn
des 21. Jahrhunderts konfrontiert sind. Nach einem Vergleich mit anderen Nationen und Migrations-
strömen wird die spezifische österreichische Emigration nach Lateinamerika mit dem Schwerpunkt
Argentinien unter die Lupe genommen. Bei der Definition des ,,heute in Argentinien lebenden Öster-
reichers" muss berücksichtigt werden, dass es verschiedene Einwanderungsgruppen gibt, die übli-
cherweise kaum in Kontakt miteinander stehen. Wägt man alle in dieser Arbeit aufgelisteten Aspekte
gegeneinander ab, so kann die oben angedeutete, folgende Erkenntnis formuliert werden: Die über-
wiegende Mehrheit der in Argentinien lebenden Österreicher ist heute auch angesichts etlicher Relati-
vierungen nach wie vor stolz, sich als Österreicher bezeichnen zu dürfen.
Seite 8
Summary
Summary
In this thesis, the situation of Austrian emigrants to Latin America at the beginning of the 21
century is discussed. The main focus is placed on Austrian expatriates living in Argentina.
Primarily, the group of Austrian emigrants is researched who left Austria of their own free
will after World War II. The research focuses on persons who possess or have possessed Aus-
trian citizenship and have lived for at least six months in Latin America. This definition also
includes Austrians who have lived only for a short term in the investigated region, for in-
stance contract or investment Austrians or students.
The main research aspect of this doctoral thesis is the persistence of cultural characteristics of
the target group. Particularly, the immigration country Argentina with its multicultural society
and immigrant-friendly approach has not yet been sufficiently investigated. Findings obtained
from the interpretation and comparative evaluation of questionnaires form the basis of the
research. The conclusions are put in relation to findings obtained from personal conversations
and interviews with persons from the target group. Relevant literature and personal research
and experiences of the author of this thesis are another comparable, important basis. All find-
ings and aspects are combined in a comprehensive summarizing chapter, in which the conclu-
sion is drawn that the majority of Austrians living today in Argentina do still feel like "Aus-
trians" and are aware of their Austrian values.
However, this conclusion has to be interpreted in respect of different aspects, thus making
every chapter of this thesis necessary. After starting with a definition of who may be called
Austrian, the question is dealt with what challenges Austrian expatriates face worldwide at the
beginning of the 21 century. This is followed by a comparison with other nations and migra-
tion flows. Next the specific Austrian emigration to Latin America is examined, focusing on
Argentina. When defining the "Austrian living today in Argentina", it has to be considered
that there are different immigration groups which usually hardly have any contact. Having
compared all aspects listed in this thesis, the following conclusion can be drawn: despite a
number of limitations, the vast majority of Austrians living in Argentina today are still proud
to call themselves Austrians.
Seite 9
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort ... 4
Zusammenfassung ... 7
Summary ... 8
Inhaltsverzeichnis ... 9
Abbildungsverzeichnis ... 11
Tabellenverzeichnis ... 13
1. Einleitung ... 14
2. Arbeitsmethodik, Problemstellungen und aktueller Forschungsstand ... 19
2.1. Qualitative versus quantitative Sozialforschung ... 23
2.2. Methodisches Problem: ,,Wer ist ,Österreicher'?" ... 30
3. Österreicher im Ausland ... 34
3.1. Wahlrecht und Staatsbürgerschaft ... 46
3.2. Service für Auslandsösterreicher und wichtige Institutionen ... 50
3.2.1. Das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, ,,Außenministerium"
... 50
3.2.1.1. Die Webseite www.auslandsösterreicher.at ... 51
3.2.1.2. Die ,,AÖ-Karte" ... 51
3.2.1.3. Finanzielle Unterstützungen für österreichische Staatsbürger im Ausland ... 52
3.2.2. Auslandsösterreicher Referat des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung ... 56
3.2.3. Der Auslandsösterreicher-Weltbund AÖWB ... 57
3.2.4. Die ,,Burgenländische Gemeinschaft" BG ... 63
4. Emigration auf der Welt und nach Lateinamerika, Schwerpunkt Argentinien ... 65
4.1. Emigrationen weltweit ... 65
4.2. Die Einwanderungsregion Lateinamerika im 19. und 20. Jahrhundert ... 72
4.3. Die Einwanderungsregion Lateinamerika zu Beginn des 21. Jahrhunderts ... 79
4.4. Das Einwanderungsland Argentinien ... 83
4.4.1. Der historische Weg Argentiniens zum Einwanderungsland: ,,gobernar es poblar" ... 84
4.4.2. Die wirtschaftliche Situation Argentiniens zu Beginn des 21. Jahrhunderts ... 88
4.4.3. Die ,,Zwiespaltmentalität" ... 91
5. Österreichische Migration nach Lateinamerika, Schwerpunkt Argentinien... 93
5.1. Die Auswanderung von Österreich nach Lateinamerika ... 93
5.2. Die Auswanderung von Österreich nach Argentinien ... 97
5.2.1. Die Auswanderung von Österreich nach Argentinien im 19. Jahrhundert ... 97
5.2.2. Die Auswanderung von Österreich nach Argentinien im 20. Jahrhundert ... 98
5.3. Motive der Auswanderung und Rückwanderung ... 104
5.3.1. Motive der Auswanderung ... 104
5.3.2. Die (un-)mögliche Rückwanderung ... 106
5.4. Die Ankunft im neuen Land und die erste Zeit danach ... 109
6. Das heutige Leben der Österreicher in Lateinamerika, Schwerpunkt Argentinien ... 116
6.1. Argentinien versus Österreich: die Kontakte und ein Vergleich ... 122
6.1.1. Der Sonderfall ,,Emigration" ... 122
6.1.2. Argentinien versus Mitteleuropa beziehungsweise Österreich: ein Kulturvergleich ... 126
6.1.2.1. Simpatía ... 126
6.1.2.2. Buena Presencia ... 128
6.1.2.3. Hierarchieorientierung ... 129
6.1.2.4. Ambivalente nationale Identität ... 129
6.1.2.5. Gegenwartsorientierung ... 130
6.1.2.6. Polychrones Zeitverständnis ... 131
Seite 10
Inhaltsverzeichnis
6.1.2.7. Flexibilität ... 132
6.1.2.8. Unverbindlicher Umgang mit Absprachen ... 132
6.2. Vor- und Nachteile im Auswanderungsland und in Österreich ... 133
6.2.1. Was wird von Auslandsösterreichern in der ,,neuen Heimat" am meisten geschätzt? ... 133
6.2.2. Was stört Auslandsösterreicher in der ,,neuen Heimat" am meisten? ... 136
6.2.3. Was vermissen Auslandsösterreicher an Österreich am meisten? ... 142
6.2.4. Was vermissen Auslandsösterreicher an Österreich am wenigsten? ... 143
6.3. Die zweite, dritte und vierte Generation ... 145
6.4. Die heutige Identität als ,,Österreicher" und die Integration in die neue Gesellschaft ... 148
6.4.1. Die österreichische Brauchtums- und Kulturpflege im Ausland ... 153
6.4.2. Das Österreichbild österreichischer Entscheidungsträger im In- und Ausland ... 157
6.4.3. Internet-Forum des AÖ-Weltbundes und Internet-Umfrage ... 160
6.5. Der (regelmäßige) Kontakt zu Österreich ... 167
6.6. Besuch in der ,,alten Heimat" ... 170
6.7. Österreichorientiertes Leben in der ,,neuen Heimat" ... 174
6.7.1. Deutschsprachige Publikationen in Lateinamerika am Beispiel der Zeitschrift ,,Das argentinische
Tageblatt" ... 177
6.7.2. Das österreichische Klubleben ... 179
6.7.2.1. Österreicherklubs in Argentinien am Beispiel des ,,Club Social y Deportivo Austria" ... 181
6.7.2.2. Ein konträres Beispiel: Österreicherklubs in Australien ... 189
6.7.2.3. Die Sprachfrage in argentinischen und australischen Österreicherklubs ... 194
6.8. Der politische Aspekt der Emigration ... 196
7. Botschaften ausgewanderter Österreicher an ihre in Österreich lebenden Landsleute ... 198
8. Resümee und Schlussfolgerungen ... 208
9. Bibliographie ... 219
9.1. Bücher ... 219
9.2. Periodische Publikationen ... 224
9.3. Quellen im Internet ... 226
10. Anhang ... 229
10.1. Adressen wichtiger Institutionen in Lateinamerika und Argentinien ... 229
10.1.1. Österreichische Vertretungsbehörden in Lateinamerika ... 229
10.1.2. Österreichische Vertretungsbehörden in Argentinien ... 238
10.1.3. Österreichische Vereinigungen in Argentinien ... 240
10.1.4. Deutschsprachige Schulen in Argentinien ... 241
10.2. Adressen wichtiger Institutionen mit Auslandsbezug in Österreich ... 243
10.2.1. Offizielle Institutionen mit Auslandsbezug ... 243
10.2.2. Argentinische Vertretungsbehörden in Österreich ... 250
10.2.3. Lateinamerikanische Vertretungsbehörden in Österreich ... 251
10.3. Relevante Internetadressen zum Thema ... 255
10.4. Allgemeine Informationen zu Argentinien ... 257
10.4.2. Wirtschaft ... 260
10.4.3. Außenpolitik ... 264
10.4.4. Innenpolitik ... 267
10.4.5. Kultur- und Bildungspolitik ... 270
10.4.6. Lexikonartikel vor der Krise 2001/2002 ... 272
10.5. Erhebungsbogen ... 276
10.5.1. Erhebungsbogen auf Deutsch ... 276
10.5.2. Erhebungsbogen auf Spanisch ... 282
Seite 11
Abbildungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Schematische Darstellung Uni Graz ... 3
Abbildung 2: Argentinische Flagge ... 3
Abbildung 3: Straßenschild ,,Calle de Austria" in Buenos Aires ... 3
Abbildung 4: Logo ,,University of Wollongong" ... 4
Abbildung 5: Helmut Tomitz vor der Österreichischen Botschaft in Buenos Aires ... 20
Abbildung 6: Praxisbeispiel: Erhebungsbogen, schematische Darstellung (Deckblatt) ... 28
Abbildung 7: Überseewanderung aus der Monarchie Österreich-Ungarn zwischen 1876 und 1910
(Weltkartendarstellung) ... 39
Abbildung 8: Überseewanderung aus der Monarchie Österreich-Ungarn zwischen 1876 und 1910
(Weltkartendarstellung) ... 40
Abbildung 9: Auswanderung aus Österreich 1919-1937 nach Zielregionen ... 41
Abbildung 10: Der Wiener Westbahnhof im Jahr 1946 ... 42
Abbildung 11: Auslandsösterreicher nach Kontinenten ... 44
Abbildung 12: Auslandsösterreicher nach Gaststaaten ... 45
Abbildung 13: Die ,,AÖ-Karte" ... 51
Abbildung 14: Logo des Auslandsösterreicher-Weltbundes ... 57
Abbildung 15: Logo der Burgenländischen Gemeinschaft ... 63
Abbildung 16: Bewegungen der Weltbevölkerung von 1821 bis 1910 ... 65
Abbildung 17: Auswandererdenkmal in Bremerhaven... 67
Abbildung 18: Karte Amerika ... 72
Abbildung 19: Bevölkerung und Einwanderung in Lateinamerika von 1825 bis 1910 ... 73
Abbildung 20: Südamerika im 19. und 20. Jahrhundert ... 76
Abbildung 21: Wirtschaftsentwicklung in Südamerika im 20. Jahrhundert ... 77
Abbildung 22: Die Hauptexportgüter Lateinamerikas seit 1930 ... 78
Abbildung 23: Anzahl der Einwanderer in Amerika ... 80
Abbildung 24: Anzahl der Einwanderer in Lateinamerika: Vergleich der Jahre 2000 und 2005 ... 81
Abbildung 25: Bevölkerungsdichte Amerika ... 82
Abbildung 26: Argentinische Landkarte ... 83
Abbildung 27: Burgenländische Bauarbeiter in Argentinien ... 86
Abbildung 28: Jüdische Auswanderer bei Ihrer Ankunft in Buenos Aires ... 86
Abbildung 29: Jüdisches Auswandererpärchen ... 86
Abbildung 30: Die fünf größten Einwanderungsgruppen in Argentinien ... 87
Abbildung 31: Das industrielle und landwirtschaftliche Zentrum Argentiniens: die Pampa ... 89
Abbildung 32: Rinderhirte in der argentinischen Pampa ... 90
Abbildung 33: Die argentinische Hauptstadt Buenos Aires: Panoramaaufnahme ... 91
Abbildung 34: Die früh verstorbene, stürmisch verehrte Präsidentengattin Eva ,,Evita" Perón ... 92
Seite 12
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 35: Jüdische Einwanderung in Lateinamerika 1933-1943 ... 94
Abbildung 36: Zielgebiete deutscher Auswanderer im Jahre 1900 ... 94
Abbildung 37: Zielgebiete deutscher Auswanderer im Jahre 1970 ... 95
Abbildung 38: NSDAP-Ausreisebewilligung nach Argentinien aus dem Jahr 1938 ... 99
Abbildung 39: Auswanderungswillige vor einer Botschaft in Wien im Jahr 1938 ... 100
Abbildung 40: Österreichische und deutschsprachige Agglomerationen in Argentinien zu Beginn der Siebziger
Jahre des 20. Jahrhunderts ... 103
Abbildung 41: Die Hauptauswanderungshäfen während der Österreichisch-Ungarischen Monarchie ... 109
Abbildung 42: Werbeplakat der Schiffahrtslinie ,,HSDG" für eine Fahrt von Hamburg nach Südamerika
während der Zwischenkriegszeit ... 110
Abbildung 43: Werbeplakat der Schiffahrtslinie ,,HSDG" für eine Fahrt von Hamburg nach Brasilien, Uruguay,
Argentinien ... 110
Abbildung 44: Figur eines Auswanderers nach dem Zweiten Weltkrieg mit typischem Reisegepäck ... 111
Abbildung 45: Registrierte Auslandsösterreicher in Amerika ... 116
Abbildung 46: Registrierte Auslandsösterreicher in Lateinamerika ... 117
Abbildung 47: Ein argentinischer Müllsammler ... 123
Abbildung 48: Anzahl der lateinamerikanischen Einwanderer in Spanien nach Nationalitäten im Vergleich der
Jahre 1995, 2000 und 2005 ... 124
Abbildung 49: Auswanderer von lateinamerikanischen Staaten ... 124
Abbildung 50: Staatspräsidentin Cristina Fernández de Kirchner ... 129
Abbildung 51: Argentinische Musiker in Buenos Aires ... 131
Abbildung 52: Austrians Abroad: Welchen Generationen entstammen wir? ... 161
Abbildung 53: Austrians Abroad: Wo sind wir geboren? ... 162
Abbildung 54: Austrians Abroad: Wo leben wir heute? ... 162
Abbildung 55: Austrians Abroad: Welche Reisepässe haben wir? ... 163
Abbildung 56: Austrians Abroad: Wie lange leben wir schon im Ausland? ... 163
Abbildung 57: Austrians Abroad: Was bedeutet für mich der Begriff ,,Heimat"? ... 164
Abbildung 58: Austrians Abroad: Wie viele Sprachen werden zu Hause gesprochen? ... 165
Abbildung 59: Austrians Abroad: Was war der Hauptgrund, aus Österreich auszuwandern? ... 165
Abbildung 60: Austrians Abroad: Wen haben oder hatten wir als Partner/in an unserer Seite? ... 166
Abbildung 61: Austrians Abroad: Wie oft reisen wir in die alte Heimat? ... 166
Abbildung 62: Austrians Abroad: Werden wir einmal wieder nach Österreich zurückgehen? ... 167
Abbildung 63: Hafen von Buenos Aires im Jahr 1945 ... 167
Abbildung 64: Argentinisches Tageblatt ... 177
Abbildung 65: Vereinswappen des ,,Club Social y Deportivo Austria" ... 182
Abbildung 66: Gründungsmitglieder des ,,Sport Club Austria" im Jahr 1930. ... 183
Abbildung 67: Heutiges Klubhaus des ,,Club Social y Deportivo Austria" ... 183
Abbildung 68: Schwimmbecken und Sprungturm im ,,Club Social y Deportivo Austria" ... 184
Abbildung 69: Tennisplatz im ,,Club Social y Deportivo Austria" ... 184
Abbildung 70: Kegelbahn im ,,Club Social y Deportivo Austria" ... 184
Abbildung 71: Mitglieder des ,,Club Social y Deportivo Austria" ... 185
Seite 13
1. Einleitung
Abbildung 72: Helmut Tomitz mit dem österreichischen Botschafter in Argentinien und dem Präsidenten des
,,Club Social y Deportivo Austria" ... 188
Abbildung 73: Osternestsuche im ,,Club Social y Deportivo Austria" ... 189
Abbildung 74: Besuch des Heiligen Nikolaus im ,,Club Social y Deportivo Austria" ... 189
Abbildung 75: Argentinische Flagge ... 257
Abbildung 76: Landkarte Argentinien... 257
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Wanderungssaldo 1961-2008 nach Staatsangehörigkeit ... 35
Tabelle 2: Die österreichische Bevölkerungsentwicklung im Bundesländervergleich ... 35
Tabelle 3: Österreichische Wohnbevölkerung nach Bundesländern und Gebürtigkeit 1934-2001 ... 36
Tabelle 4: Bevölkerung im Alter von 15 oder mehr Jahren nach Geburtsland und höchster abgeschlossener
Ausbildung 2001 ... 37
Tabelle 5: Auslandsösterreicher in 13 Ländern im Jahrzehntevergleich 1950 bis 1990 ... 42
Tabelle 6: Registrierte deutschsprachige Emigranten in Argentinien im Jahr 1938, Aufteilung nach Regionen . 98
Tabelle 7: Anzahl der Österreicher in Argentinien und Brasilien zwischen 1967 und 1992 ... 102
Tabelle 8: Österreichbild bei österreichischen Entscheidungsträgern im In- und Ausland und in ihrem sozialen
Umfeld (sehr gut = 100 %) ... 158
Tabelle 9: Vereinigungen mit Österreich - Bezug in Argentinien ... 181
Seite 14
1. Einleitung
1. Einleitung
Bei etwa 8,3 Millionen Inlandsösterreichern leben heute Schätzungen zufolge weltweit
470.000 Auslandsösterreicher und bis zu eine Million Herzensösterreicher
1
dauerhaft in ei-
nem anderen Land. Während man sich in über 400 österreichbezogenen Vereinigungen welt-
weit organisiert, werden die Auslandsösterreicher oft und gerne als das ,,10. Bundesland" be-
zeichnet und wären laut dieser Definition das zahlenmäßig siebentgrößte Bundesland Öster-
reichs.
Die vorliegende Publikation untersucht die gegenwärtige österreichische Emigranten-
Situation sowie einzelne historisch bedingte Konstellationen in Lateinamerika, beziehungs-
weise Argentinien zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Ich versuche, mehr Verständnis für die
aktuelle individuelle, beziehungsweise persönliche Situation dieser Auslandsösterreicher zu
schaffen. Die Ausführungen in dieser Arbeit verstehen sich zum einen als ein Beitrag mit dem
Ziel, mehr Akzeptanz für im Ausland lebende Österreicher zu gewinnen, versuchen zum an-
deren jedoch gleichzeitig, eine differenziertere Wahrnehmung gegenüber in Österreich leben-
den Ausländern zu entwickeln. Aufschlussreich ausgewertete Erhebungsbögen von bereits
seit längerer Zeit in dieser Region lebenden Österreichern verstehen sich nach ihrer Auswer-
tung beziehungsweise Interpretation als wichtige Basis der vorliegenden Arbeit. Diese Rück-
schlüsse verbunden mit den Erkenntnissen aus einer Reihe von persönlichen Gesprächen und
Interviews mit Auslandsösterreichern setze ich zum einen mit analoger Fachliteratur, zum
anderen mit persönlichen Recherchen, beziehungsweise Erlebnissen in Beziehung. Anhand
von alltags-, sozial- und geschlechterspezifischen Fragestellungen ist mein Ziel, die individu-
elle sowie kollektive Dimension der österreichischen Emigration nach Lateinamerika zu un-
tersuchen.
Eine Analyse der bereits in zahlreichen Publikationen beschriebenen Emigrationen vor, be-
ziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg nehme ich nur bedingt, beziehungsweise im
Kontext vor. Mit anderen Worten: Wesentlicher Fokus der Untersuchungen ist die ,,Emigrati-
on aus freiem Willen", beispielsweise Wirtschaftsemigranten (und deren Angehörige) sowie
1
Als ,,Herzensösterreicher" werden jene Personen bezeichnet, die nicht (mehr) die österreichische Staatsangehö-
rigkeit besitzen, sich aber auf Grund von Abstammung und Sprache Österreich verbunden fühlen, dazu zählen
auch Nachfahren von Auslandsösterreichern. Siehe dazu auch Kapitel 2.2. Methodisches Problem: ,,Wer ist
,Österreicher.
Seite 15
1. Einleitung
nach 1960 ausgewanderte Österreicher. Folgende Auswanderungsgruppen besitzen aus die-
sem Grund weniger Relevanz für meine Recherchen: politisch begründete Emigrationsgrup-
pen, jüdische Bevölkerungsgruppen, Emigranten mit Bezug zur Nationalsozialistischen Deut-
schen Arbeiterpartei (NSDAP). Nichtsdestoweniger bildet die Darstellung historischer Zu-
sammenhänge in etlichen Bereichen der Ausführungen eine wichtige stützende Funktion für
das Verständnis und die Interpretation des jeweiligen Sachverhalts. Der in bestimmten The-
menbereichen relevante Vergleich mit anderen Auswanderungsdestinationen, um mögliche
Divergenzen zu manifestieren, rundet die umfangreichen Recherchen ab.
Die Tatsache, dass ich meine Recherchen in einer Region mit anderer Kultur und Sprache
betrieb und zuvor keine Möglichkeit hatte, mich mit anderen wissenschaftlich arbeitenden
Personen über ihre Erfahrungen speziell in dieser Thematik und in dieser Region auszutau-
schen, war herausfordernd und spannend. Zugute kamen mir meine Erfahrungen bei der Er-
stellung meiner Diplomarbeit, die ein ähnliches Thema behandelte, sowie meine Spanisch-
Kenntnisse, die ich mir während meines einjährigen Aufenthaltes in Spanien angeeignet hatte.
Neben einer umfangreichen Erforschung der wissenschaftlichen Literatur aus dem Bereich
,,österreichische Emigration" bildeten meine persönlichen, während der letzten 15 Jahre ange-
sammelten fachspezifischen Kenntnisse eine wichtige Basis bei der Gestaltung der vorliegen-
den Publikation. In diesem Zusammenhang profitierte ich neben meinen individuellen Reisen
in weltweit über 50 Länder auch von meinem in Summe mehrjährigen dauerhaften Woh-
nen/Leben außerhalb Österreichs. Während dieser Zeit war ich selbst Auslandsösterreicher
und konnte mir einen wertvollen Erfahrungsschatz aneignen. In diesem Zusammenhang wa-
ren speziell
mein einjähriger Aufenthalt in Spanien,
der knapp dreimonatige Aufenthalt in Südostasien,
der siebenmonatige Aufenthalt in Australien,
der zweimonatige Aufenthalt in Mittelamerika sowie
der knapp zweimonatige Aufenthalt in Südamerika,
wo ich unzählige Gespräche mit ausgewanderten Österreichern führen konnte, erkenntnisreich
und für die Auswertungen dieser Arbeit höchst relevant. Bei Relevanz und Bedarf lasse ich
aus diesem Grund immer wieder persönliche Erlebnisse und Erkenntnisse in die vorliegende
Arbeit einfließen, die ich in Bezug zu anderen Aussagen beziehungsweise Theorien setze,
sowie analog der richtigen Thematik zuordne.
Seite 16
1. Einleitung
Bei der Suche nach vergleichbaren Auswanderungsdestinationen, mit denen die Situation in
Lateinamerika und speziell in Argentinien verglichen werden kann, war ein Kriterium die
Anzahl der in diesem Land lebenden Auslandsösterreicher. Eine Vergleichsvariante stellte
Kanada dar, das mit einer Anzahl von 8.000 registrierten Auslandsösterreichern in etwa im
Bereich von Argentinien liegt, wo 10.300 leben. Was gegen einen solchen Vergleich sprach,
ist die Tatsache, dass Kanada im starken Einfluss durch die U.S.A. steht, wo heute 30.400
Auslandsösterreicher registriert sind; dadurch entstünde ein Ungleichverhältnis. Außerdem
liegt Kanada ebenso wie Argentinien auf dem amerikanischen Kontinent, was möglicherweise
in verschiedenen Bereichen zu ähnlich wäre.
Eine andere mögliche Vergleichsvariante stellte Südafrika dar, wo jedoch bereits etwa doppelt
so viele registrierte Österreicher leben wie in Argentinien: 20.200.
Als das am besten geeignete Vergleichsland zu Argentinien stellte sich Australien heraus: Die
dort lebende österreichische Auswanderergemeinschaft kommt auf eine Anzahl von 15.000.
Wohl wissend, dass diese beiden Länder zwar in einigen Bereichen divergieren, gibt es doch
zusätzliche ganz wesentliche Gemeinsamkeiten: Beide Länder gelten, beziehungsweise galten
für viele Jahre als Einwanderungsländer. Die Politik beider Staaten verfolgte für lange Zeit
und in starkem Maß eine einwanderungsfreundliche Position. Diese politischen Bestrebungen
wurden mitunter sehr offensiv betrieben und es kam nicht selten zu direkten Werbeaktivitä-
ten, die eine Auswanderung in das jeweilige Land zum Ziel hatten. Österreicher mit verschie-
densten Auswanderungsmotiven wurden durch diese Kampagnen motiviert und in ihrer Idee
bestärkt, in diese Länder auszuwandern. Weiters sind beide, sowohl Argentinien als auch
Australien verhältnismäßig weit von Österreich entfernt. Auswanderungen in diese zwei Län-
der hatten mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit einen ,,Endgültigkeitscharakter" als
beispielsweise innereuropäische Emigrationen. Dadurch sind ein regelmäßiger Kontakt zu
Österreich geschweige ein häufiger Besuch nur erschwert und abhängig von den jeweiligen
persönlichen Möglichkeiten der österreichischen Emigranten möglich. Wie bereits eingangs
erwähnt, habe ich meine Diplomarbeit zu einem schwerpunktmäßig Australien behandelnden
Thema verfasst und dadurch detailliertes Fachwissen in diesem Bereich sammeln können:
,,Österreichische Emigranten in der multikulturellen Gesellschaft Australiens am Beginn des
21. Jahrhunderts". Diese im Zuge der Diplomarbeitserstellung unter anderem während eines
siebenmonatigen Australien-Aufenthaltes erworbenen speziellen Kenntnisse über die österrei-
chische Auswanderungssituation in Australien wären bei einem Vergleich mit den nun von
mir intensiv erforschten Gegebenheiten in Argentinien höchst wertvoll und relevant. Aus den
Seite 17
1. Einleitung
oben genannten Gründen habe ich mich nach Rücksprache mit meinem Dissertationsbetreuer
und gemeinsamen Überlegungen dazu entschieden, Ausführungen zur Situation in Lateiname-
rika beziehungsweise Argentinien in dieser Arbeit bei relevanten Themen in erster Linie mit
der Situation in Australien zu vergleichen.
Der Fokus der vorliegenden Dissertation liegt bei der Untersuchung der Identität der ständig
in Lateinamerika lebenden Österreicher. Ich gehe dabei der Frage nach, wie ständig im Aus-
land lebende Österreicher das Land Österreich sehen, beziehungsweise welchen Bezug sie zur
,,alten Heimat" haben. Am Beispiel Argentinien im Vergleich mit anderen lateinamerikani-
schen Staaten beziehungsweise Australien wird in diesem Zusammenhang der Frage nachge-
gangen, warum sich einige ,,bereits" eher als Argentinier, andere wiederum ,,noch" als Öster-
reicher fühlen.
Spezielle in der Arbeit untersuchte Aspekte sind:
Welche Unterstützungsvarianten gibt es für im Ausland lebende Österreicher von offi-
zieller und von privater Seite?
Welche Auswanderungsphasen gab es von Österreich nach Argentinien? Welche un-
terschiedlichen Auswanderungsgruppen gab es?
Was sind Motive der Auswanderung und welche Rückwanderungsstrategien gibt es?
Mit welchen Problemen haben Österreicher im Auswanderungsland zu kämpfen in
Bezug auf
o
die Ankunft
o
die erste Zeit danach
o
der Integration in die Gesellschaft? Integriert man sich, wie ist der Bezug zur
deutschsprachigen Gemeinde? Wie wird der Multikulturalismus in Argentinien
seitens der Österreicher gelebt?
Was sind die Unterschiede des Auswanderungslandes zu Österreich?
Was wird am Auswanderungsland, beziehungsweise an Österreich am meisten ge-
schätzt, was als störend empfunden?
Welchen Bezug zu Österreich haben die Nachfahren österreichischer Auswanderer?
Welchen Bezug haben die Kinder und Enkel österreichischer Emigranten zu Öster-
reich?
Seite 18
1. Einleitung
Welchen Bezug hat der im Ausland lebende Österreicher heute zu Österreich? Fühlen
sich Auslandsösterreicher noch immer als "Österreicher"? Ist der Bezug idealistisch,
konkret oder beides?
Wie wird "österreichische Kultur" in Argentinien gelebt? Werden Brauchtümer ge-
pflegt?
Wie wird der regelmäßige Kontakt zu Österreich gepflegt? Wie wird, beziehungsweise
wurde das Geschehen in Österreich nach der Auswanderung mitverfolgt?
Wie wird ein regelmäßiger Heimatbesuch nach Österreich durchgeführt? Wie erleben
Auslandsösterreicher diese Reisen?
Wie wird heute im Auswandererland österreichorientiert gelebt? Beeinflusst die öster-
reichische, beziehungsweise deutschsprachige Vergangenheit in irgendeiner Weise das
heutige Leben?
Wie stellt sich die aktuelle Situation von Auslandsösterreicher-Vereinigungen in Ar-
gentinien dar? Welche Rolle spielen (Auslandsösterreicher-)Institutionen für Aus-
landsösterreicher?
Wird heute noch die österreichische Politik verfolgt, beziehungsweise das Wahlrecht
genutzt?
Was bedeutet "Leben im Ausland" für ausgewanderte Österreicher? Welche Botschaf-
ten haben Auslandsösterreicher für Inlandsösterreicher?
Sollte keine andere Spezifizierung angegeben sein, so sind die in dieser Arbeit untersuchten,
beziehungsweise zitierten Personen allesamt in Lateinamerika wohnhaft, die meisten davon in
Argentinien, jedoch auch in Brasilien, Mexiko oder in anderen lateinamerikanischen Ländern.
Diese werden bei Relevanz mit in Australien lebenden Personen verglichen oder in Beziehung
gesetzt.
Seite 19
2. Arbeitsmethodik, Problemstellungen und aktueller Forschungsstand
2. Arbeitsmethodik, Problemstellungen und aktueller Forschungsstand
Migration hat seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine neue Qualität. Die Fluktuation
wandernder Personen und Personengruppen wurde angesichts der neuen Technologien und
der damit verbundenen Transportmöglichkeiten wesentlich erleichtert und erhöht, während
die Dimensionen Raum und Zeit manipulierbarer wurden. Die heutige Verkehrssituation de-
monstriert dies bis zu einem Grade, an dem nicht mehr unterscheidbar ist, ob bei der Migrati-
on eine Aus-, Ein-, Rück- oder Durchwanderung vorliegt. Diese klassischen Einteilungen
lassen sich oft erst aus einer Rückschau und einem Ablauf von Zeitfristen teilweise nachvoll-
ziehen. Auch in einer historischen Betrachtung ist nicht immer eindeutig definierbar, ob poli-
tische Impulse der Hauptgrund von Migrationsbewegungen waren. Schließlich dürften wirt-
schaftliche und davon abhängig soziale Faktoren überwogen haben, denn wirtschaftlich-
existenzielle Aspekte haben letztendlich immer den Vorrang, wenn es um das nackte Überle-
ben geht. Eine Unterscheidung in größere und kleinere Wanderungen bedeutet nicht zwangs-
läufig, dass es für eine unterschiedliche Betrachtung auch klare Unterscheidungsgrenzen gibt.
Ein generelles Phänomen sind nur individuelle Wanderungen einzelner Personen und von
Verwandtschaftsverbänden (vgl. Wagner, 1992, S. 39-40).
Um diese individuellen Wanderungen seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die
daraus resultierenden Schicksale geht es in der vorliegenden Dissertation, in der ich die ge-
genwärtige Situation österreichischer Immigranten in Lateinamerika, beziehungsweise Argen-
tinien untersuche. Ausgewertete und interpretierte Erhebungsbögen bilden ein Standbein der
vorliegenden Arbeit, die ich mit Erkenntnissen aus persönlichen Gesprächen und Interviews
mit österreichischen Emigranten in Beziehung setze. Mein Ziel ist es, an Hand von alltags-,
sozial- und geschlechterspezifischen Fragestellungen die individuelle sowie kollektive Di-
mension der österreichischen Emigration nach Lateinamerika, beziehungsweise Argentinien
zu untersuchen. Analoge Fachliteratur sowie persönliche Erkenntnisse und Recherchen bilden
ein weiteres essentielles Standbein dieser Arbeit.
Organisatorisch war ich bei der Erstellung der vorliegenden Arbeit immer wieder mit diversen
Herausforderungen konfrontiert, was die Rahmenbedingungen für die Recherchen erschwerte.
Im Zuge der Untersuchungen waren mehrere zum Teil weitere Reisen notwendig, die für eine
Seite 20
2. Arbeitsmethodik, Problemstellungen und aktueller Forschungsstand
seriöse Aufarbeitung des Themas unerlässlich waren und eine Reise auch nach Übersee mit
sich brachten:
-
Flug nach Lateinamerika, wo ich sieben Wochen lang in Argentinien, Uruguay und
Brasilien Recherchen durchführte. Während dieser Zeit hatte ich unter anderem inten-
siven Kontakt mit Mitarbeitern der Österreichischen Botschaft in Buenos Aires, wo
man mir dankenswerterweise einen eigenen Arbeits-
platz zur Verfügung stellte, mit Mitgliedern des Clubs
Social y Deportivo Austria sowie Mitarbeitern des Goe-
the-Instituts Buenos Aires. Gleichzeitig führte ich eine
Reihe von Interviews mit in diesen Ländern lebenden
Auslandsösterreichern und deren Kindern durch.
Abbildung 5: Helmut Tomitz
vor der Österreichischen Botschaft in Buenos Aires
(vgl. eigene Recherche)
-
Fahrt nach Berlin, wo sich im Iberoamerikanischen Institut etliche Publikationen be-
finden, die weltweit nur dort erhältlich sind, beispielsweise das einzige gesamte Ar-
chiv des ,,Argentinischen Tageblatts"
-
Fahrten nach Wien zur Nationalbibliothek und zur Österreichischen Exilbibliothek im
Literaturhaus Wien, wo sich relevante Informationen zu österreichischen Auswande-
rungsbewegungen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg befinden
-
Fahrten zum Auslandskärntnertreffen 2004 am Klopeiner See, wo ich neben interes-
santen, aufschlussreichen Gesprächen eine Reihe von relevanten Informationen im
Zuge beantworteter Fragen an Hand meiner Erhebungsbögen von Auslandskärntnern
erhalten habe.
In diesem Zusammenhang waren natürlich auch Recherchen in Graz wichtig. Hier waren vor
allem folgende Bibliotheken relevant:
-
Die Universitätsbibliothek Graz (inklusive Fachbibliotheken)
-
Das Steiermärkisches Landesarchiv
-
Das Landesmuseum Joanneum
-
Die Steiermärkische Landesbibliothek und
-
Die ,,Mediathek", Welthaus Graz.
Wesentliche Erkenntnisse der vorliegenden Publikation entstammen zum einen einer Reihe
persönlicher Gespräche von mir mit im Ausland lebenden Österreichern, und zum anderen
Seite 21
2. Arbeitsmethodik, Problemstellungen und aktueller Forschungsstand
von unterschiedlichen Rechercheergebnissen, die ich allesamt in die Arbeit einfließen habe
lassen. Besondere Bedeutung hat die Auswertung des von mir umfangreich konzipierten, 10-
seitigen Erhebungsbogens, der von insgesamt 92 Personen beantwortet worden ist. Empiri-
sche Sozialforschung bedeutet mehr als ein simples Konzipieren und Anwenden dieses Erhe-
bungsbogens: Sie ist vielmehr ,,Theorie geleitete und nachvollziehbare Anwendung von Er-
hebungsmethoden" (vgl. Atteslander, 2008, S.V). Atteslander führt weiter aus: ,,Die in der
Praxis angewendeten Methoden und Instrumente zielen zunächst auf wissenschaftliche Er-
kenntnis und auf objektive Diagnose gesellschaftlicher Strukturen und Prozesse. Dabei sind
drei Prinzipien zu beachten:
- Das Prinzip der Angemessenheit. Darunter ist zu verstehen, dass Methoden der Zielsetzung
der Forschung gemäß einzusetzen sind, wofür ausreichend Mittel und Zeit zur Verfügung
stehen müssen.
- Das Prinzip des Messens. Es gilt ein ausgeglichenes, objektbezogenes und zutreffendes Ver-
hältnis zu finden zwischen qualitativen und quantitativen Methoden. Lokale direkte Beobach-
tung auf der einen und standardisierte umfassende Befragung auf der anderen Seite sind nicht
gegeneinander, sondern in Ergänzung zu verwenden. Weder die eine noch die andere Form
der Tatsachenerfassung ist wissenschaftlicher als die andere.
Schließlich ist
- das Prinzip des Ermessens zu beachten. Was bedeuten erhobene Daten angesichts der zu
erforschenden und möglicherweise zu behebenden sozialen Krisen? Wie sind vorliegende
Befunde zu bewerten und welchen Beitrag leisten sie für gesellschaftsbezogene Entscheidun-
gen?"
Prinzipiell gelten für sämtliche empirischen Untersuchungen, egal ob diese zur Gewinnung
neuer Erkenntnisse führen sollen oder ob reine Routineuntersuchungen behandelt werden, für
die Durchführung der prinzipiell gleiche Forschungsablauf und die gleichen Regeln. Der
Forschungsablauf lässt sich dabei in fünf Phasen unterteilen:
· Problembenennung
· Gegenstandsbenennung
· Durchführung
· Analyse
· Verwendung von Ergebnissen (vgl. Atteslander, 2008, S.30f). Siehe dazu auch das nächste
Kapitel ,,2.1. Qualitative versus quantitative Sozialforschung".
Seite 22
2. Arbeitsmethodik, Problemstellungen und aktueller Forschungsstand
Basis, beziehungsweise prinzipielle Voraussetzung für eine empirische Untersuchung, die auf
Erfahrungswerten aufbaut, ist hauptsächlich die Konzeptionalisierung der geplanten Vor-
gangsweise. Dabei wird neben der eigenen Untersuchungstätigkeit auch der Stellenwert
des behandelten Problems, sein praktischer Nutzen präzisiert. Zur Optimierung des Erkennt-
nisgewinnes durch möglichst aussagekräftiges Datenmaterial ist neben der Wahl der
optimalen Untersuchungsmethode auch die Entwicklung eines Untersuchungsplanes notwen-
dig (Friedrichs, 1990, S. 160).
Im deutschsprachigen Raum wurden bereits kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs erste
Schritte gesetzt, die Thematik ,,Exil beziehungsweise Emigration während des Nationalsozia-
lismus" zu untersuchen, wobei Themen der politischen Emigration prioritär behandelt wur-
den. Die Exilforschung bekam in weiterer Folge speziell ab den siebziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts einen größeren Aufschwung. Nach Jahren der ,,Prominentisierung" begann sich das
Forschungsinteresse auch allmählich auf ,,das Exil der kleinen Leute" zu erweitern (vgl. Benz,
1994, S.42f.). Aktive Studenteninitiativen forcierten diese Tendenzen, die sich auf der Suche
nach Alternativen zu staatskonformen Denkschemata befanden. Wichtige Impulse kamen auf
akademischer Ebene weiters aus den Literaturwissenschaften, wo sich das Forschungsinteres-
se in erster Linie auf Exilliteratur und -werke von bekannten Schriftstellern, Künstlern und
Wissenschaftlern beschränkte. Andere relevante Themenbereiche blieben lange Zeit margina-
lisiert, wie etwa das jüdische Exil, die Remigration, alltags- und sozialgeschichtliche Aspekte
des Exils oder geschlechtsspezifische Untersuchungen der Vertreibung. Erst um die Jahrtau-
sendwende setzten Initiativen ein, die sich verstärkt mit den zuvor vernachlässigten Bereichen
beschäftigten (vgl. Mettauer, 2004, S.2).
Auch weibliche Exilerfahrungen wurden nach jahrelangem Fokus auf männliche Schicksale
allmählich dank der Verwendung der Kategorie Geschlecht entdeckt und erforscht. Dies
brachte laut Quack den Vorteil, dass ,,wir der historischen Realität der Exilierten in sehr viel
größerem Maße gerecht werden können als bisher, wenn wir Geschlecht als historische Kate-
gorie verstehen, mit deren Hilfe wir die gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Hand-
lungsspielräume erkennen können, die sich an die physiologischen Unterschiede zwischen
Männern und Frauen geknüpft haben." (vgl. Quack, 1996, S.32)
Lateinamerika hatte für die Exilforschung lange Zeit eine nur untergeordnete Bedeutung, be-
ziehungsweise Wichtigkeit. Bis zu den achtziger Jahren des 21. Jahrhunderts gab es keine
Seite 23
2. Arbeitsmethodik, Problemstellungen und aktueller Forschungsstand
wesentlichen Überblicksdarstellungen von in Lateinamerika lebenden deutschsprachigen Im-
migranten; sie wurden erstmalig von Wolfgang Kießling und Patrik von zur Mühlen erstellt.
Chile und Mexiko waren das Untersuchungsziel der ersten Länderstudien deutschsprachiger
Auswanderer in lateinamerikanischen Ländern. Sie wurden mittlerweile durch andere Länder
ergänzt. Publikationen zu einzelnen Themen, wie etwa künstlerische Aspekte deutschsprachi-
ger Emigranten im lateinamerikanischen Raum, waren ebenfalls bereits vor einer gesamt-
lateinamerikanischen Zusammenstellung verfügbar. All diese Arbeiten gingen jedoch nicht
speziell, beziehungsweise im Überblick auf das österreichische Exil in Lateinamerika ein. In
der österreichischen Wissenschaft galt die Beschäftigung mit Lateinamerika ebenfalls lange
Zeit als ,,akademischer Luxus". Nach dem Zweiten Weltkrieg existierte eine
,,deutschtümelnde" Volkskunde, die sich mit den deutschen Siedlungen der Region beschäf-
tigte. Ab den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts war ein verstärktes Interesse für Dritte
Welt-Politik vorhanden, was erste zarte Ansätze einer österreichischen Lateinamerikanistik
bedeutete. Spätestens seit dem Jahr 1988 kann eine aktive publizistische Auseinandersetzung
mit dem österreichischen Exil in Lateinamerika festgestellt werden: Die Dokumentation ,,Ver-
triebene Vernunft" von Fritz Stadler lieferte neben Länderstudien zu Brasilien und Mexiko
auch eine Überblicksdarstellung über das politische Exil in Lateinamerika. Gleichzeitig ent-
stehen seit diesem Zeitpunkt verstärkt zeitgeschichtliche und literaturwissenschaftliche For-
schungsarbeiten (vgl. Seeber, 1995, S.8).
2.1. Qualitative versus quantitative Sozialforschung
Die qualitative Sozialforschung wird in den Sozialwissenschaften prinzipiell als Gegensatz
zur quantitativen Sozialforschung gesehen. Bei der Unterscheidung oder Auswahl der Metho-
de sollte das eigene Interesse am gewünschten Ergebnis im Vordergrund stehen, das eine Er-
kenntnis zum Ziel hat. Während quantitative Methoden Hypothesen voraussetzen, die getestet
werden können, wird die qualitative Sozialforschung dann verwendet, wenn es gilt, Hypothe-
sen zu entwickeln, oder wenn das Forschungsgebiet, beziehungsweise der Forschungsgegen-
stand neu sind.
Die quantitative Forschung und hier im speziellen die quantitative Befragung ist weit verbrei-
tet und besitzt in der Sozialforschung eine lange Tradition. Für eine große Anzahl von Frage-
stellungen stehen standardisierte und geeichte Messinstrumente zur Verfügung, zumeist in
Seite 24
2. Arbeitsmethodik, Problemstellungen und aktueller Forschungsstand
Form von Erhebungsbögen oder Ausrüstungen. Die wissenschaftliche Literatur zur Entwick-
lung von Datenerhebungsinstrumenten und zur Analyse der erhobenen Daten ist umfassend.
In der wissenschaftlichen Grundlagen- und Anwendungsforschung, aber auch in der Markt-,
Media- und Meinungsforschung sind heute quantitative Methoden sehr beliebt. Während der
letzten Jahre hat jedoch auch eine zunehmende Wiederaufwertung der qualitativen Methoden
innerhalb der Sozialforschung stattgefunden. Speziell die Grenzen der quantitativen Metho-
den haben als Alternative zur Entwicklung einer großen Anzahl von qualitativen Befragungs-
und Beobachtungsmethoden geführt. In der Marktforschung gibt es mittlerweile eine Reihe
von Instituten, die hauptsächlich qualitativ vorgehen und ihren eigenen Methodengrundstock
konzipiert haben (vgl. Winter, 2000, S.3).
Die quantitativen und qualitativen Methoden verhalten sich in der empirischen Sozialfor-
schung gegensätzlich. Während die quantitativen Methoden den Schwerpunkt auf die inter-
subjektive Nachprüfbarkeit des gesamten Forschungsablaufes legen und denselben weitest-
gehend standardisieren, sind in der qualitativen Forschung die Grenzen fließend (Lamnek,
1995, S.60f). Diekmann gibt in diesem Zusammenhang an, dass qualitative Methoden bei-
spielsweise Probleme bei der Wahl der Stichprobe, der Validität der Daten und der Auswer-
tung haben (vgl. Diekmann, 1997, S. 451). Lamnek wiederum sieht die Methode eher positiv,
wobei er angibt, dass Theorien und Rückschlüsse auf gesellschaftliche Phänomene erst nach
der Erhebung der Daten generiert werden und das Bestreben nach Falsifikation derselben
nicht mehr im Vordergrund steht. Vielmehr soll der Versuch unternommen werden, die sozi-
ale Wirklichkeit zu erkennen und mit den Augen der befragten Personen zu erfassen (Lam-
nek, 1995, S.56).
Tatsache ist, dass weder eine quantitative noch eine qualitative Methode universell anwendbar
ist. Winter (vgl. Winter, 2000, S.4-5) fasst die wesentlichsten Vor- und Nachteile der beiden
zusammen:
Vorteile
Quantitative Methoden:
exakt quantifizierbare Ergebnisse
Ermittlung von statistischen Zusammenhängen möglich
Möglichkeit, eine große Stichprobe zu untersuchen und quantitative vs. qualitative
Methoden zu erhalten
im Vergleich zu qualitativen Verfahren geringere Kosten, geringerer Zeitaufwand
Seite 25
2. Arbeitsmethodik, Problemstellungen und aktueller Forschungsstand
hohe externe Validität durch große Stichprobe
größere Objektivität und Vergleichbarkeit der Ergebnisse
Qualitative Methoden:
Flexible Anwendung der Methode, diese passt sich an den Untersuchungsgegenstand
an und nicht umgekehrt.
Die Offenheit des Vorgehens ermöglicht es, neue, bisher unbekannte Sachverhalte zu
entdecken.
Da die Teilnehmer keinerlei Vorgaben haben, erhält man eher wahre und vollständige
Informationen über die subjektive Sicht der Gesprächspartner.
Der Fokus wird vom Teilnehmer selbst bestimmt, dadurch liegt er vor allem auf den
für den Teilnehmer relevanten Sachverhalten.
Durch die persönliche Interaktion gibt es die Möglichkeit, Hintergründe zu erfragen
und Unklarheiten zu beseitigen.
hohe inhaltliche Validität durch nicht prädeterminierte Vorgehensweise
tieferer Informationsgehalt durch offene Befragung
größere Subjektivität der Ergebnisse
Nachteile
Quantitative Methoden:
Keine Flexibilität während der Untersuchung durch die Standardisierung der Untersu-
chungssituation, die Fragen sind schon vorher festgelegt, kein individuelles Eingehen
auf die Testpersonen möglich
Man ermittelt nicht die Ursachen für einen Befund oder eine Einstellung wie bei-
spielsweise Unzufriedenheit (zur Verringerung dieses Problems empfiehlt sich der
Einsatz offener Fragen zur Ursachenermittlung).
Man erhält keine Verbesserungsvorschläge (dieser Nachteil kann durch die Integration
offener Fragen verringert werden).
Qualitative Methoden:
Qualitative Methoden sind relativ zeit- und kostenintensiv.
Die Anforderungen an die Qualifikation des Interviewers / Beobachters sind recht
hoch, wovon die Qualität der Daten ist zu einem gewissen Teil auch abhängig ist.
Seite 26
2. Arbeitsmethodik, Problemstellungen und aktueller Forschungsstand
Die Auswertung ist vor allem im Vergleich zu den quantitativen Methoden relativ
aufwendig.
Aus qualitativen Daten kann man keine zahlenmäßigen Mengenangaben ableiten (vgl.
Winter, 2000, S.4-5).
Wesentlich für die Aussagekraft der Untersuchung ist die Auswahl der optimalen Methode für
die Datenbeschaffung. Friedrichs definiert die zwei Seiten der Medaille folgendermaßen:
,,Das Urteil über die Angemessenheit einer Methode für ein Forschungsproblem kann daher
nur auf der Vertrautheit mit den Möglichkeiten und Nachteilen aller einzelner Methoden be-
ruhen (vgl. Friedrichs, 1990, S.189)." Für die vorliegende Publikation und die dafür notwen-
digen Recherchen erwies sich die Wahl einer qualitativen Forschungsmethode am zweckmä-
ßigsten. Zur Erörterung des zu Beginn dieser Arbeit erläuterten Forschungsschwerpunkts mit
den adäquaten Forschungsfragen wurde die Befragung von Auslandsösterreichern mittels ei-
nes von mir konzipierten Erhebungsbogens als das am idealsten geeignete Instrument beur-
teilt.
Der qualitative Ansatz zeichnet sich im Vergleich zu quantitativen Methoden durch wesent-
lich größere Offenheit und Flexibilität aus. Die Befragung, beispielsweise mit qualitativen
Interviews oder Gruppendiskussionen, ist frei und explorativ, während bei der qualitativen
Beobachtung die Subjektivität des Beobachteten und des Beobachters interessant ist. Der qua-
litativen Befragung liegt ein grobes thematisches Konzept/ ein Leitfaden zu Grunde, während
auf standardisierte Vorgaben soweit wie möglich verzichtet wird. Die Antwortmöglichkeiten
der Gesprächspartner sind dadurch unbeschränkt und die Reihenfolge und Gestaltung der
Fragen sind flexibel. Durch diese (Vorgehens-)Weise wird ein tieferer Informationsgehalt der
Ergebnisse, sowie eine hohe Inhaltsvalidität erzielt, ohne jedoch zahlenmäßige und repräsen-
tative Aussagen machen zu können, beziehungsweise das zu wollen. Die Bildung der Stich-
proben erfolgt nach theoretischen Gesichtspunkten: Sie wird aus einer kleinen Gruppe von für
den Untersuchungsgegenstand typischen Vertretern ausgewählt (vgl. Winter, 2000, S.1-2).
Bei der Auswahl der von mir zu befragenden Auslandsösterreicher war es nicht immer leicht
oder gar selbstverständlich, Personen zu finden, die dazu bereit waren, an Hand des struktu-
riert konzipierten Erhebungsbogens die Fragen zu beantworten. Es kam mitunter vor, dass
sich Auslandsösterreicher weigerten, entweder den gesamten Fragenkatalog oder zumindest
Teile daraus zu beantworten. Dadurch ergab sich bereits eine natürliche Selektion nach jenen
Seite 27
2. Arbeitsmethodik, Problemstellungen und aktueller Forschungsstand
Personen, die bereit waren, Auskunft zu geben und solchen, die dazu nicht zu bewegen waren
obwohl vermutlich auch, oder gerade diese Auslandsösterreicher Interessantes zu erzählen
gehabt hätten.
Im Zuge einer explikativen Datenanalyse wird mit Hilfe von Anreicherung und Interpretation
der Daten eine Erklärung des Verhaltens angestrebt. Qualitative Methoden sind explorativ
und hypothesengenerierend konzipiert, die Theoriebildung erfolgt schrittweise und wird wäh-
rend der Untersuchung noch weiterentwickelt. Ziel der qualitativen Forschung ist es, die
Wirklichkeit anhand der subjektiven Sicht der relevanten Gesprächspersonen abzubilden und
so mögliche Ursachen für deren Verhalten nachzuvollziehen und das Verhalten zu verstehen.
Bei qualitativen Methoden liegt das Hauptaugenmerk auf dem Beschreiben, Interpretieren
und Verstehen von Zusammenhängen, der Aufstellung von Klassifikationen oder Typologien,
und der Generierung von Hypothesen. Die qualitative Befragung, beziehungsweise Beobach-
tung zeichnet sich durch eine unverzerrte, nicht prädeterminierte und umfangreiche Informa-
tionen liefernde Herangehensweise aus und ist auf diese Weise überall dort geeignet, wo eine
differenzierte und ausführliche Beschreibung individueller Meinungen und Eindrücke benö-
tigt wird. Speziell zur Sammlung von detaillierten Verbesserungsvorschlägen, zur Erkundung
von Ursachen (für Sachverhalte wie beispielsweise Unzufriedenheit) und zur Kreierung von
Typologisierungen sind qualitative Methoden ausgezeichnet geeignet. Aus den im Zuge der
Auswertung gewonnenen Erkenntnissen lassen sich die relevanten Beurteilungskriterien für
den fraglichen Sachverhalt und intervenierende Folgemaßnahmen ableiten. Bezogen auf den
Entwicklungsprozess der zu verfassenden Arbeit kann man qualitative Methoden in nahezu
allen Phasen sinnvoll einsetzen. Sehr gut eignen sie sich beispielsweise bei der Definition und
Analyse von Bedarfsveränderungen der Nachfrager, im Rahmen von Konzepttests oder gene-
rell bei der Ideengenerierung (vgl. Winter, 2000, S.1-2).
Die Durchführung einer qualitativen Methode sieht folgenden Handlungsablauf vor:
Definition der Fragestellung
Entscheidung über Art und Strukturierungsgrad der Methode
Entwicklung des Interviewleitfadens/ Beobachtungsleitfadens/ Diskussionsleitfadens
und Ähnliches
Schulung der Interviewer/ Beobachter/ Diskussionsleiter etc.
Rekrutierung der Teilnehmer
Durchführung und Protokollierung der BefragungM/ Beobachtung
Seite 28
2. Arbeitsmethodik, Problemstellungen und aktueller Forschungsstand
Auswertung der Verbaldaten/ Beobachtungsdaten und Kategorisierung
Interpretation
Ergebniszusammenstellung
Ergebnispräsentation
Uneinigkeit herrscht bei Wissenschaftern in der Frage nach der idealen Stichprobengröße:
Man findet in der wissenschaftlichen Literatur unterschiedliche Meinungen. Die Auffassung
von der geeigneten Größe einer Stichprobe bewegt sich zwischen 20 und 200 Personen, wobei
in Abhängigkeit von der untersuchten Fragestellung ab einer gewissen Anzahl teilnehmender
Personen eine theoretische Sättigung eintritt. Dies hat zur Konsequenz, dass bei einem even-
tuellen Beifügen weiterer Personen kein wesentlicher, zusätzlicher Erkenntnisgewinn erreicht
wird. Die erforderliche Stichprobengröße ist für gewöhnlich deutlich geringer als bei quantita-
tiven Verfahren. Für die Zusammensetzung der Stichproben gelten die Grundsätze des
,,theoretical sampling". Die Stichprobe sollte
laut diesem Prinzip den theoretischen Überle-
gungen und der Fragestellung angepasst werden,
heterogen zusammengesetzt sein und möglichst
typische Vertreter inkludieren (vgl. Winter,
2000, S.3-4).
Abbildung 6: Praxisbeispiel: Erhebungsbogen, sche-
matische Darstellung (Deckblatt)
(vgl.: eigene Recherche)
Anmerkung: Der Erhebungsbogen befindet sich in
voller Länge im Anhang
Der von mir konzipierte Erhebungsbogen be-
schäftigt sich, wie eingangs erwähnt, mit der
Identität der ständig in Lateinamerika lebenden
Österreicher, wobei ich einen Fokus auf die in Argentinien lebenden Personen lege. Bei den
Interviews wird untersucht, wie ständig im Ausland lebende Österreicher das Land Österreich
sehen, beziehungsweise welchen Bezug sie zur ,,alten Heimat" haben. Insbesondere wiege ich
ab und vergleiche, warum sich einige ,,bereits" eher als Argentinier, andere wiederum ,,noch"
als Österreicher fühlen.
Seite 29
2. Arbeitsmethodik, Problemstellungen und aktueller Forschungsstand
Ziel meiner Untersuchungen ist es, die Wirklichkeit an Hand der subjektiven Sicht des jeweils
befragten Auslandsösterreichers abzubilden, um so mögliche Ursachen für das jeweilige Ver-
halten nachzuvollziehen, beziehungsweise das Verhalten zu verstehen. Die unterschiedlichen
Persönlichkeiten und die daraus resultierenden divergierenden Aspekte setze ich bei der Aus-
wertung miteinander in Verbindung und stelle bei Bedarf einen relevanten Kontext her; auf
diese Art kreiere ich analoge Schlussfolgerungen. Persönliche Recherchen, Erlebnisse, Er-
kenntnisse und Fachwissen, sowie relevante wissenschaftliche Fachliteratur werden in weite-
rer Folge erkenntnisreich mit den Auswertungen in Beziehung gesetzt.
Feldforschung als wissenschaftliche Methode setzt generell Freiwilligkeit und Zielsetzung
voraus, so auch die Befragung der Auslandsösterreicher mit Hilfe der Erhebungsbögen. Der
Begriff ,,Feldforschung" beschreibt den Prozess des Verlassens des eigenen Schreibtisches
und dem Gang zum Forschungsort. Nicht ausreichend wären eine alleinige Analyse ,,vom
Schreibtisch aus" und eine Auswertung von rein jenen Informationen, die von anderen Perso-
nen vorgelegt, beziehungsweise erzählt werden (vgl. Malinowski, 1929, S.1). Unter dem Be-
griff ,,Feldforschung" wird die systematische Erforschung von Kulturen oder bestimmten
Gruppen definiert, indem man sich in den jeweiligen Lebensraum begibt und das Alltagsleben
der Menschen zeitweise teilt. Ich konnte in diesem Zusammenhang während meines Südame-
rika-Aufenthalts einige intensive Wochen lang qualitative Zeit mit in Argentinien lebenden
Österreichern verbringen und führte unter anderem während dieser Phase eine Reihe von In-
terviews, speziell an Hand des von mir konzipierten Erhebungsbogens durch.
Die klassische Feldforschung, beziehungsweise die "qualitative Sozialforschung" befindet
sich laut Girtler in der Tradition der deutschen Geisteswissenschaften, jedoch gleichzeitig
auch in der der Chicagoer Schule der Soziologie (vgl. Girtler, 2010, Internet): ,,Auf den Über-
legungen von Simmel, Weber u. a. Autoren, die zwischen Natur- und Geisteswissenschaften
unterscheiden, baut auch R. E. Park aus der Chicagoer Schule der Soziologie bei seinen For-
schungen auf. Park rief seine Studenten auf, sich die Stadt Chicago zu erwandern. Die Stärke
der klassischen Chicagoer Schule war, dass deren Vertreter den direkten Kontakt zu den Men-
schen suchten. Charakteristisch für die Feldforschung in dieser Tradition ist die Überlegung,
dass eine Gesellschaft nichts Einheitliches ist, sondern Nischen mit eigenen Kulturen besitzt.
Die einzige Kontrolle bei der Feldforschung liegt im Forscher selbst. Die Prinzipien der Of-
fenheit und der Kommunikation leiten den Forschungsprozess an. Die Feldforschung ist somit
von vornherein nicht determiniert. Ihr Vorgehen ist ein ,kommunikatives'." Für Fischer (vgl.
Seite 30
2. Arbeitsmethodik, Problemstellungen und aktueller Forschungsstand
Fischer, 2002, S.11) sind die Fragen nach Zielsetzung und Brauchbarkeit wesentliche Ele-
mente: ,,'Feldforschungen' sind aber nur solche Vorhaben, die bewusst, gezielt und geplant
mit allen vorhandenen und möglichen Vorkenntnissen und Vorarbeiten durchgeführt werden
und mit dem einen Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse zu erbringen: Forschung. Und nur
nach ihren Ergebnissen ist dann die Brauchbarkeit des Vorhabens (der Methode) zu beurtei-
len."
Die Methode der empirischen Befragung bedeutet Kommunikation zwischen zwei oder meh-
reren Parteien, beziehungsweise Personen. Als Folge verbaler Stimuli (Fragen) werden verba-
le Reaktionen (Antworten) hervorgerufen: Dies geschieht in bestimmten Situationen und wird
geprägt durch gegenseitige Erwartungen. Die Antworten beziehen sich auf erlebte und erin-
nerte soziale Ereignisse, stellen Meinungen und Bewertungen dar. Mit dem Mittel der Befra-
gung wird nicht soziales Verhalten insgesamt, sondern lediglich verbales Verhalten erfasst.
,,[...]Nichts scheint einfacher, als Informationen zu sammeln. Eine Kirchengemeinde möchte
wissen, warum immer weniger Menschen zum Gottesdienst kommen. Eine Partei möchte
wissen, mit wie vielen Stimmen sie bei der nächsten Wahl rechnen kann. Ein Unternehmer
möchte wissen, wie seine Produkte beim Käufer ankommen. Was liegt näher, als den Men-
schen diese Fragen zu stellen? [...] Die klassische Befragung, bei der der Interviewer der
Auskunftsperson von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, wird aus vielen Gründen im-
mer seltener. In großstädtischen amerikanischen Agglomerationen wurde das ,von Tür zu
Tür' - Interview zu gefährlich und musste durch die immer weiter um sich greifende Telefon-
befragung ersetzt werden. Telefonumfragen sind mittlerweile auch in Europa üblich." (vgl.
Atteslander, 2008, S. 101) Die sicher bekannteste und heute auch gebräuchlichste Form der
Befragung ist das Interview, das mündlich und an Hand eines stark strukturierten Erhebungs-
bogens als Einzelinterview geführt wird (vgl. Atteslander, 2008, S. 133).
2.2. Methodisches Problem: ,,Wer ist ,Österreicher'?"
Bevor die weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen durchgeführt und fortgesetzt werden
können, ist eine exakte Definition der Spezifizierung ,,Österreicher" notwendig. Vor Ende des
Ersten Weltkrieges hatten sich beispielsweise auch Ungarn, Südtiroler oder Südsteirer dem
Land Österreich zugehörig gefühlt und sich deshalb bei statistischen Erhebungen im Ausland
ebenfalls als ,,Österreicher" bezeichnet. Diese Tatsache erschwert die Interpretation und Re-
Seite 31
2. Arbeitsmethodik, Problemstellungen und aktueller Forschungsstand
cherche ausländischer statistischer Daten über Österreicher enorm, da in den meisten Fällen
keine Unterscheidung vorgenommen wurde, beziehungsweise vorgenommen werden konnte.
Gemeint sind heute mit der Bezeichnung ,,Österreicher" alle im 21. Jahrhundert inner- oder
außerhalb Österreichs lebenden Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Es gibt da-
bei verschiedene Einteilungen:
Auslandsösterreicher
Als ,,Auslandsösterreicher" werden all jene Personen bezeichnet, die zwar in Österreich gebo-
ren, jedoch im Moment nicht wohnhaft sind: Sie leben im Ausland und haben dort ihren Le-
bensmittelpunkt.
Altösterreicher
Hiermit gemeint sind deutschsprachige Einwohner der ehemaligen österreichischen Kronlän-
der, die im Laufe der Geschichte eigene Staaten wurden.
Herzensösterreicher
So werden jene Personen bezeichnet, die nicht (mehr) die österreichische Staatsangehörigkeit
besitzen, sich aber auf Grund von Abstammung und Sprache Österreich verbunden fühlen.
Oft sind dies Nachfahren von Auslandsösterreichern in der zweiten, dritten oder vierten Gene-
ration. Herzensösterreicher verfügen mitunter über keine oder nur unzulängliche Deutsch-
kenntnisse.
Passösterreicher
So werden jene Personen bezeichnet, die Inhaber der österreichischen Staatsangehörigkeit
sind und damit auch den österreichischen Reisepass besitzen.
Kontraktösterreicher
So werden jene Passösterreicher bezeichnet, die im Auftrag einer österreichischen oder aus-
ländischen Firma nur für eine bestimmte Zeit im Ausland verweilen.
Investitionsösterreicher
So werden jene Passösterreicher bezeichnet, die zum Zweck der Geldanlage Ländereien und
ähnliches im Ausland erwerben.
Seite 32
2. Arbeitsmethodik, Problemstellungen und aktueller Forschungsstand
Im Vergleich zu Schweizern oder Deutschen besitzen Österreicher andere historische Wur-
zeln. In Österreich fanden bereits seit den frühen Anfängen Besiedlungen von Slawen, Kelten
und Römern statt, später war man mit der Hauptstadt Wien über viele Jahrhunderte hinweg
(bis ins 20. Jahrhundert) das politische und kulturelle Zentrum des riesigen Habsburgerreichs.
Diese mannigfachen Einflüsse führten in weiterer Folge zu einer reichen kulturellen Traditi-
on, welche über viele Generationen hinweg Elemente verschiedener prägender Kulturen ab-
sorbierte, allen voran die ungarische und die slawische (Norst, 1988, S.276).
Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges im Jahr 1914 hatte die Bezeichnung ,,Österreicher"
eine völlig andere Bedeutung als heute. Bis zu diesem Zeitpunkt bestand noch die Österrei-
chischUngarische Monarchie, die mit ihrer Multikulturalität und Vielsprachigkeit eine bunte
Mischung unterschiedlicher Völker bot. Als Bürger in der Monarchie lebend fühlten sich vie-
le als ,,Österreicher": Deutsche, Ungarn, Nord-Slawen (Tschechen, Mährer, Slowaken, Po-
len), Süd-Slawen (Kroaten, Serben, Slowenen, Dalmatiner, Bosnier, Herzegowinaer), Rumä-
nen und Italiener. Mit dem Jahr 1918 bezeichneten sich nur noch Bürger der (neuen) Republik
Österreich als ,,Österreicher".
Heute bedeutet für die meisten in Österreich lebenden Personen die Frage der Nationalität
kein Problem mehr: Sie wurden in Österreich geboren und fühlen sich auch als Bürger und
Mitglieder dieses Landes. Jene hingegen, die vor 1918 in ehemaligen Regionen der Österrei-
chisch-Ungarischen Monarchie zur Welt gekommen sind, finden sich nun in anderen Natio-
nen wieder. So befinden sich beispielsweise auch heute noch viele Tausende Deutschspre-
chende in Tschernowitz (heutige Ukraine), in der Bukowina (heutiges Rumänien) oder auch
nahe der österreichischen Grenze, wie etwa in Pressburg (heutige Slowakei). Viele dieser
Leute nannten bei ihrer Emigration ins Ausland als Muttersprache Deutsch und als Herkunfts-
land ,,Österreich", obwohl ihr Reisepass in manchen Fällen etwas anderes angab. Diese Per-
sonen werden in den meisten Statistiken bis 1918 als Österreicher geführt (vgl. Tomitz, 2002,
S.44). Siehe dazu auch das Kapitel ,,6.4. Die heutige Identität als ,,Österreicher" und die In-
tegration in die neue Gesellschaft".
Ich habe mich für meine Recherchen nach reichlicher Überlegung auf eine Fokussierung jener
Österreicher entschieden, die zum Zeitpunkt der Erhebung die österreichische Staatsbürger-
schaft besaßen oder zuvor einmal besessen haben und zumindest sechs Monate dauerhaft in
Lateinamerika gelebt haben. Den kurzen Zeitraum von sechs Monaten für den Minimal-
Seite 33
3. Österreicher im Ausland
Auslandsaufenthalt habe ich deshalb gewählt, damit ich laut dieser Definition auch die Ein-
drücke jener Österreicher untersuchen konnte, die nur kurze Zeit in der Region ansässig wa-
ren, beispielsweise Kontrakt- oder Investitionsösterreicher sowie Schüler und Studenten.
Seite 34
3. Österreicher im Ausland
3. Österreicher im Ausland
Das Land Österreich wird seit Jahrhunderten durch Wanderungsbewegungen geprägt. Öster-
reichische Politiker bezeichnen die Republik Österreich heute, zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts, gerne als ,,neues Immigrationsland", das sich offen den Herausforderungen, die Immig-
rantenströme mit sich bringen, stellt. Immer wieder wird jedoch auch von einer ,,Bedrohung
der nationalen Identität und Stabilität" durch Zuwanderung gesprochen. Dabei wird die Tatsa-
che vergessen oder bewusst verschwiegen, dass Österreich ein Land ist, das seit Jahrhunder-
ten bis in die Gegenwart durch Wanderungsbewegungen, sowohl Immigrationen als auch
Emigrationen, geprägt wird.
In Österreich konnte im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, etwa zu Deutschland,
nach dem Zweiten Weltkrieg kein Wechsel der Dynamik der Migration, beispielsweise von
Auswanderung zu Einwanderung, festgestellt werden. Transitmigrationen nichtösterreichi-
scher Staatsbürger sind ebenso wenig die einzigen österreichischen Migrationsbewegungen
seit dem Jahr 1945. Tatsache ist, dass Emigrationen von Österreichern in andere Länder auch
nach dem Zweiten Weltkrieg keine Einzelphänomene waren oder sind, sondern in ihrem
Ausmaß immer wieder die Zahl der Zuwanderungen von Ausländern nach Österreich erreich-
te. Infolgedessen können sämtliche österreichische Migrationsbewegungen weder getrennt
von anderen europäischen Migrationsbewegungen betrachtet werden, noch als Besonderhei-
ten gewisser Zeiträume der österreichischen Geschichte interpretiert werden. Für die Konsti-
tuierung der österreichischen Gesellschaft waren kontinuierlich ablaufende Migrationen es-
sentiell und prägend. Österreichische Politiker sollten den daraus resultierenden Notwendig-
keiten, beziehungsweise diesem Phänomen mit einer analogen migrationsorientierten Ein-
wanderungs- und Staatsbürgerschaftspolitik Rechnung tragen (vgl. Neyer, 1997, S.60-61).
Siehe dazu auch das Kapitel ,,3.1. Wahlrecht und Staatsbürgerschaft".
In den letzten Jahren konnte ein kontinuierlicher Anstieg der Zuwanderung beobachtet wer-
den, was bei einer gleich bleibenden Auswanderungstendenz ein positives Wanderungssaldo,
und somit einen Anstieg der österreichischen Einwohnerzahl bewirkte:
Seite 35
3. Österreicher im Ausland
Tabelle 1: Wanderungssaldo 1961-2008 nach Staatsangehörigkeit
(vgl. Marik-Lebeck, 2009, S.15)
Für das Jahr 2008 ergab sich von 110.074 Zuwanderungen aus dem Ausland und 75.638
Auswanderungen in das Ausland ein Wanderungsgewinn von 34.436 Personen, was 0,41 %
der österreichischen Bevölkerung entspricht. Im Vergleich zum Jahr 2007 lag der Wande-
rungsgewinn mit 34.731 Personen und 0,42 % nur geringfügig darüber. Bei der Betrachtung
der letzten Jahrzehnte kann
ein kontinuierlicher Anstieg
der österreichischen Wohnbe-
völkerung in Folge des Wan-
derungsgewinns verzeichnet
werden (vgl. Marik-Lebeck,
2009, S.15).
Tabelle 2: Die österreichische
Bevölkerungsentwicklung im
Bundesländervergleich
(Vergleich 2009 zu 2010)
(vgl. Krusch, 2010, S.20-21)
Seite 36
3. Österreicher im Ausland
Wie in ,,Tabelle 2: Die österreichische Bevölkerungsentwicklung im Bundesländervergleich"
dargestellt, konnte im Bundesländervergleich der Jahre 2009 und 2010 in Wien mit 0,7 % der
größte Bevölkerungsanstieg verzeichnet werden, was sowohl mit der positiven Wanderungs-
bilanz als auch mit der positiven Geburtenbilanz in Wien, die seit dem Jahr 2004 verzeichnet
wird, zusammenhängt. Kärnten hat als einziges Bundesland eine rückläufige Tendenz aufzu-
weisen. Die Anstiege in den einzelnen Bundesländern sind nicht auf eine positive Geburtenbi-
lanz zurückzuführen, sondern auf Grund von Zuwanderung. Im Jahr 2009 gab es weniger Ge-
burten als im Jahr davor, gleichzeitig hat sich die Zahl der Migranten in Österreich allein im
Jahr 2009 um 25.000 Personen erhöht. Die Steiermark verzeichnet seit 1997 eine stetig nega-
tive Geburtenbilanz. Im Jahr 2009 wurde die Statistik durch etwa 2500 Zuwanderer mit einem
steirischen Bevölkerungsanstieg von 0,1 % ins Positive gerückt, davor waren es jährlich etwa
4000 Zuwanderer. Der Rückgang der Zuwanderung ist auf die Wirtschaftskrise zurückzufüh-
ren, nach dem Motto: "bei wenig Arbeitsplätzen gibt es auch wenig internationale Zuwande-
rung." Deutsche stellen in der Steiermark derzeit die größte Gruppe der Zuwanderer, der
Großteil von ihnen stammt ursprünglich aus dem ehemaligen Ostdeutschland. Kroaten und
Bosnier liegen auf den Plätzen zwei und drei der steirischen Ausländerpopulationen (vgl.
Krusch, 2010, S.20-21).
Tabelle 3:
Österreichi-
sche Wohnbe-
völkerung
nach Bundes-
ländern und
Gebürtigkeit
1934-2001
(vgl. Weigl,
2010, S.15)
Seite 37
3. Österreicher im Ausland
Zählt man in ,,Tabelle 3: Österreichische Wohnbevölkerung nach Bundesländern und Gebür-
tigkeit 1934-2001" alle Einwanderer mit unbekanntem Geburtsort dazu, die aliquot auf die
übrigen Geburtskategorien aufgeteilt werden, so ergibt sich ein noch höherer Ausländeranteil
an der österreichischen Gesamtbevölkerung. Im Jahr 2001 waren nach dem Ergebnis der
Volkszählung 12,5 % der Bevölkerung nicht in Österreich geboren. Dieser Wert unterscheidet
sich kaum vom Jahr 1951 oder gar vom Jahr 1934. Es kam jedoch in den ersten Jahren des 21.
Jahrhunderts zu einem weiteren Anstieg auf nahezu 15 % mit Jahresende 2006. Innerhalb der
Europäischen Union (EU-25) wurde Österreich um die Jahrtausendwende nur von Luxem-
burg, Estland, Zypern und geringfügig von Deutschland übertroffen (vgl. Weigl, 2010, S.14-
15).
Wíe in der folgenden ,,Tabelle 4: Bevölkerung im Alter von 15 oder mehr Jahren nach Ge-
burtsland und höchster abgeschlossener Ausbildung 2001" dargestellt, spiegelt sich in den
Bildungsabschlüssen der verschiedenen Migrantengruppen die unterschiedliche Bildungsin-
tegration in der Geschichte der Zweiten Republik (vgl. Weigl, 2010, S.72-73):
Tabelle 4:
Bevölkerung
im Alter von
15 oder mehr
Jahren nach
Geburtsland
und höchster
abgeschlosse-
ner Ausbil-
dung 2001
(vgl. Weigl,
2010, S.73)
Demnach besaßen im Jahr 2001 etwa 7 % der in Österreich geborenen Bevölkerung einen
universitären Bildungsabschluss, jedoch 17 % der aus den ,,alten EU-Ländern" zugewander-
ten und sogar 23 % aus dem übrigen Westeuropa, Nordamerika und Australien. Zuwanderer
aus den ,,neuen EU-Ländern" (einschließlich Bulgarien und Rumänien) kamen auf einen
Seite 38
3. Österreicher im Ausland
durchschnittlichen Akademikerschnitt von etwa 12 %, was noch immer deutlich über dem
Schnitt der österreichischen Gesamtbevölkerung lag. Ein anderes Bild ergibt sich bei Zuwan-
derern aus den ehemaligen Gastarbeiterländern (Ex-)Jugoslawien und der Türkei. Der
Akademikeranteil ist bei dieser Bevölkerungsgruppe sehr gering und der Anteil von Personen
mit Pflichtschul- oder keinem Schulabschluss liegt weit über dem Durchschnitt. Im Jahr 2001
betrug dieser Wert unter Ex-Jugoslawen 61 %, unter Türken gar 81 %, während der Anteil bei
der österreichischen Gesamtbevölkerung, einschließlich zweiter und dritter
Einwanderergeneration, etwa 33,5 % betrug (vgl. Weigl, 2010, S.72-73).
In Kapitel ,,2.2. Methodisches Problem: ,,Wer ist ,Österreicher'?"" habe ich das methodische
Problem erläutert, wer als ,,Österreicher" bezeichnet werden kann. Die folgenden Ausführun-
gen definieren, wie im besagten Kapitel resümierend vorangekündigt, als ,,Österreicher" all
jene Personen, die nach dem Ersten Weltkrieg inner- oder außerhalb Österreichs lebten oder
leben und die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen.
Österreichische Auswanderung in einer kursorischen historischen Betrachtung
Während bis Mitte des 19. Jahrhunderts wie eingangs kurz erwähnt Auswanderungsbewegun-
gen aus den deutschsprachigen Ländern der Donaumonarchie hauptsächlich religiöse und
politische Ursachen hatten und noch keine Massenbewegungen waren, änderte sich die Situa-
tion mit der Industriellen Revolution. Die Verbesserung der Transportmittel und die Gewäh-
rung der Auswanderungsfreiheit durch das Staatsgrundgesetz im Jahr 1867 animierten etliche
Bevölkerungsschichten, im Ausland ihr Glück zu suchen. Zwischen den Jahren 1867 und
1910 wanderten nicht weniger als 5 Millionen Menschen, dies entspricht etwa 10 % der da-
maligen Bevölkerung, aus der Österreichisch-Ungarischen Monarchie aus. Etwa 30 % dieser
Personen verblieben in Europa, während 70 % nach Übersee gingen, wie in der folgenden
,,Abbildung 7: Überseewanderung aus der Monarchie Österreich-Ungarn zwischen 1876 und
1910 (Weltkartendarstellung)" dargestellt wird (vgl. Neyer, 1996, S. 14-15):
Seite 39
3. Österreicher im Ausland
2953587
358507
157969
64360
6544
4097
1771
109
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
U.S.A.
Argentinien
Kanada
Brasilien
Südamerika (andere)
Australien
Afrika
Asien
Überseewanderung aus der Monarchie Österreich-Ungarn
zwischen 1876 und 1910
Abbildung 7: Überseewanderung aus der Monarchie Österreich-Ungarn zwischen 1876 und 1910 (Welt-
kartendarstellung)
(vgl.: Englisch, 1913, S.84)
Anmerkung: Diese Statistik basiert auf einer Zusammenstellung der Passagierlisten, die in den Auswan-
derungshäfen gesammelt wurden, und stellt die Personenanzahl dar.
Beliebtestes Ziel der Überseewanderung zwischen 1876 und 1910 waren die U.S.A., in die
knappe 3 Millionen der insgesamt 3,5 Millionen, das sind 83,3 % der österreichischen Über-
seeemigranten, während dieses Zeitraums auswanderten. Bereits an zweiter Stelle folgt Ar-
gentinien: knapp 360.000 Einwohner der Monarchie wählten dieses Land als ihre Auswande-
rungsdestination, das entspricht 10,1 % der österreichischen Überseeemigranten, und liegt
während dieses Zeitraums weit vor Brasilien, wohin ,,nur" 64.360, das sind 1,8 %, emigrierten
(vgl. Neyer, 1996, S. 14-15).
Seite 40
3. Österreicher im Ausland
Abbildung 8: Überseewanderung aus der Monarchie Österreich-Ungarn zwischen 1876 und 1910 (Welt-
kartendarstellung)
(vgl. Chmelar, 1992, S.78)
Gründe und Motive der verhältnismäßig beliebten Auswanderung nach Argentinien während
dieser Phase stelle ich im Kapitel ,,4.4.1. Der historische Weg Argentiniens zum Einwande-
rungsland: ,,gobernar es poblar"" dar. In den folgenden Jahren änderte sich die Situation
grundlegend. Der Erste Weltkrieg brachte die Trennung der Österreich-Ungarischen Monar-
chie. Österreich war aus einer europäischen Großmacht ein Kleinstaat mit nur rund einem
Achtel der Bevölkerung geworden. Die triste Wirtschaftslage der Nachkriegszeit und die hohe
Arbeitslosigkeit bewirkten neue Auswanderungsströme. Ein Hindernis für eine Massenaus-
wanderung stellten jedoch die oft restriktiven Einwanderungsbestimmungen anderer Länder
und die Kosten einer Auswanderung dar. Das Österreichische Wanderungsamt, das im Jahr
1919 als Informations- und Auskunftsstelle gegründet worden war, registrierte in den Jahren
1919 bis 1937 80.164 Personen, die Österreich in Richtung Übersee verließen. Die meisten
von ihnen emigrierten in den ersten Jahren nach Kriegsende: Zwischen 1919 und 1923 verließ
nahezu die Hälfte dieser Emigranten die neue geschaffene Republik Österreich. Hauptdestina-
tion waren weiterhin die U.S.A. mit 34.014 österreichischen Emigranten, wie in der folgenden
,,Abbildung 9: Auswanderung aus Österreich 1919-1937 nach Zielregionen" ersichtlich ist
(vgl. Neyer, 1996, S. 16-17):
Seite 41
3. Österreicher im Ausland
34014
15431
11260
5423
3169
1931
1138
1054
994
842
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
U.S.A.
Brasilien
Argentinien
Kanada
Sowjetunion
Palästina
Türkei
Paraguay
Franz. Kolonien
Brit. Kolonien
Auswanderung aus Österreich 1919-1937
nach Zielregionen
Abbildung 9: Auswanderung aus Österreich 1919-1937 nach Zielregionen
(vgl. List, 1942/43, S.153)
Die zwei größten Einwanderungsländer in Lateinamerika, Brasilien und Argentinien, ver-
zeichneten während der Jahre 1919 bis 1937 eine ähnlich hohe Einwanderungszahl: Nach
Brasilien emigrierten 15.431 Personen, dies entspricht 20,5 %, und in Argentinien ließen sich
11.260 nieder, dies entspricht 15 % (vgl. Neyer, 1996, S. 16-17). Bei einer Betrachtung des
historischen Verlaufs österreichischer Auswanderung zeigt sich, dass nur in der Zeit der
Habsburgermonarchie mehr Menschen langfristig aus Österreich ausgewandert sind als in der
Zweiten Republik. Auch wenn man die Rückwanderungsbewegungen berücksichtigt, sind
nach dem Zweiten Weltkrieg allein in die sechs zentralen Zielländer österreichischer Migrati-
on etwa 400.000 Österreicher ausgewandert.
Die Auswanderungsbewegungen haben sich hin in Richtung der unmittelbaren Nachbar-
staaten, allen voran Deutschland und die Schweiz, verstärkt, während die Überseemigration in
die nordamerikanischen Staaten stark zurückgegangen ist. Gleichzeitig kamen nach 1945 neue
Auswanderungsdestinationen wie zum Beispiel Australien oder Südafrika dazu.
Seite 42
3. Österreicher im Ausland
Abbildung 10: Der Wiener Westbahnhof im Jahr
1946
spielte bei österreichischen Auswanderungsbewe-
gungen nach dem Zweiten Weltkrieg eine zentrale
Rolle
(vgl. Seeber, 1995, S.10)
Die Wanderungsbewegungen in Richtung
Lateinamerika gingen zwar zurück, doch
sind die Gesamtzahlen in den zwei folgend
dargestellten Ländern Brasilien und Argenti-
nien leicht gestiegen. In Brasilien lebten im
Jahr 1960 17.000 Österreicher, im Jahr 1990
21.000. In Argentinien ist eine analoge Zunahme feststellbar: Im Jahr 1960 lebten 6.000 Ös-
terreicher im Land, im Jahr 1990 10.000 (vgl. Neyer, 1996, S.20). In der folgenden ,,Tabelle
5: Auslandsösterreicher in 13 Ländern im Jahrzehntevergleich 1950 bis 1990" sind diese
Entwicklungen dargestellt:
Auslandsösterreicher in 13 Ländern
im Jahrzehntevergleich 1950 bis 1990
Staat
1950
1960
1970
1980
1990
BRD
46.683
57.337
143.114
172.573
183.161
Schweiz
22.153
37.762
43.143
31.736
28.802
Liechtenstein
876
1.184
1.858
2.029
2.122
Schweden
1.000
4.000
4.984
3.346
2.819
Großbritannien
-
8.000
6.000
7.000
5.870
Frankreich
3.790
3.740
3.315
2.904
3.280
Italien
3.316
3.566
4.810
5.500
8.800
U.S.A.
-
26.000
20.000
18.900
15.700
Kanada
-
13.000
7.500
10.000
10.000
Australien
-
14.000
11.000
10.000
11.000
Rep. Südafrika
-
1.000
5.000
10.000
20.000
Brasilien
-
17.000
21.000
21.000
21.000
Argentinien
-
6.000
5.000
8.000
10.000
Insgesamt gerundet
-
193.000
277.000
303.000
323.000
Tabelle 5: Auslandsösterreicher in 13 Ländern im Jahrzehntevergleich 1950 bis 1990
(vgl. Bauer-Fraiji, Fraiji, 1996, S.311)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783836646734
- Dateigröße
- 5.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Karl-Franzens-Universität Graz – Umwelt-, Regional- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Geographie und Raumforschung
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- migration österreich identität lateinamerika argentinien
- Produktsicherheit
- Diplom.de