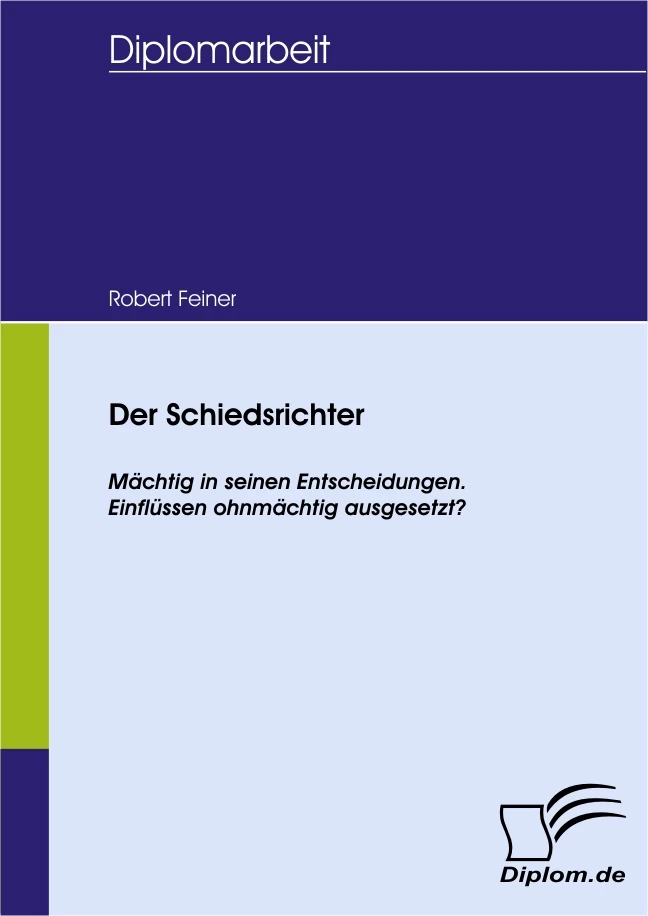Der Schiedsrichter
Mächtig in seinen Entscheidungen. Einflüssen ohnmächtig ausgesetzt?
©2009
Diplomarbeit
116 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. So hieß es schon im Jahre 1974, als der Deutsche Fußball-Bund anlässlich der Weltmeisterschaft im eigenen Lande eine Schallplatte aufnehmen ließ. Bis heute hat die Sportart nichts von ihrer Faszination verloren. Wenn man sich die Zuschauerentwicklungen sowie die Ausgaben für Übertragungsrechte ansieht, ist die Begeisterung sogar erheblich angestiegen.
Allein in Deutschland wird Fußball von über sechs Millionen Aktiven in 26.000 Fußballvereinen ausgeübt. Die 306 Spiele der Fußball-Bundesliga-Saison 2008/09 wurden von rund 12,8 Millionen Zuschauern besucht, im Durchschnitt sind das knapp 42.000 Zuschauer pro Partie. Damit verzeichnete der deutsche Profifußball zum achten Mal in Folge eine Zuschauersteigerung. Diese Kennzahlen verdeutlichen seine Relevanz für einen Großteil der Bevölkerung.
Fußball ist jedoch längst nicht mehr nur des Deutschen liebstes Hobby. Ganze Wirtschaftszweige haben sich rund um diesen Mannschaftssport entwickelt. Alleine die Fußball-Bundesliga erhält jährlich 412 Millionen Euro für die TV-Rechte im Inland. Durch Abstiege sind Angestellte im Umfeld der betroffenen Vereine in ihrer Existenz gefährdet.
Die Tragweite, die dabei Schiedsrichter-Entscheidungen spielen können, wurde in der Vergangenheit des Öfteren deutlich: Als Beispiel soll an dieser Stelle das so genannte Phantomtor von Thomas Helmer vom 23. April 1994 angeführt werden, welches über Umwege zum Abstieg des 1. FC Nürnberg in die Zweite Bundesliga führte. Aus einer undurchsichtigen Situation heraus beförderte der damalige Spieler des FC Bayern München den Ball Richtung Nürnberger Tor. Er verfehlte dies und der Ball rollte links am linken Pfosten vorbei über die Torauslinie. Der Schiedsrichter-Assistent hingegen hatte, zur Verwunderung aller, ein Tor gesehen und signalisierte dies dem Schiedsrichter, der den Treffer anerkannte. Bayern gewann dadurch mit 2:1. Ein Unentschieden hätte den Franken am Ende der Saison zum Nichtabstieg gereicht. Da jedoch auch das Wiederholungsspiel verloren ging, war der Abstieg besiegelt.
Auch Franz Beckenbauer, der ehemalige Profi-Fußballspieler und aktuelle Präsident des FC Bayern München belegt mit seiner Aussage Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift die enorme Macht der Unparteiischen. Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter schaffen mit ihren Entscheidungen Tatsachen. Diese sind laut Regel V der offiziellen Fußballregeln […]
Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. So hieß es schon im Jahre 1974, als der Deutsche Fußball-Bund anlässlich der Weltmeisterschaft im eigenen Lande eine Schallplatte aufnehmen ließ. Bis heute hat die Sportart nichts von ihrer Faszination verloren. Wenn man sich die Zuschauerentwicklungen sowie die Ausgaben für Übertragungsrechte ansieht, ist die Begeisterung sogar erheblich angestiegen.
Allein in Deutschland wird Fußball von über sechs Millionen Aktiven in 26.000 Fußballvereinen ausgeübt. Die 306 Spiele der Fußball-Bundesliga-Saison 2008/09 wurden von rund 12,8 Millionen Zuschauern besucht, im Durchschnitt sind das knapp 42.000 Zuschauer pro Partie. Damit verzeichnete der deutsche Profifußball zum achten Mal in Folge eine Zuschauersteigerung. Diese Kennzahlen verdeutlichen seine Relevanz für einen Großteil der Bevölkerung.
Fußball ist jedoch längst nicht mehr nur des Deutschen liebstes Hobby. Ganze Wirtschaftszweige haben sich rund um diesen Mannschaftssport entwickelt. Alleine die Fußball-Bundesliga erhält jährlich 412 Millionen Euro für die TV-Rechte im Inland. Durch Abstiege sind Angestellte im Umfeld der betroffenen Vereine in ihrer Existenz gefährdet.
Die Tragweite, die dabei Schiedsrichter-Entscheidungen spielen können, wurde in der Vergangenheit des Öfteren deutlich: Als Beispiel soll an dieser Stelle das so genannte Phantomtor von Thomas Helmer vom 23. April 1994 angeführt werden, welches über Umwege zum Abstieg des 1. FC Nürnberg in die Zweite Bundesliga führte. Aus einer undurchsichtigen Situation heraus beförderte der damalige Spieler des FC Bayern München den Ball Richtung Nürnberger Tor. Er verfehlte dies und der Ball rollte links am linken Pfosten vorbei über die Torauslinie. Der Schiedsrichter-Assistent hingegen hatte, zur Verwunderung aller, ein Tor gesehen und signalisierte dies dem Schiedsrichter, der den Treffer anerkannte. Bayern gewann dadurch mit 2:1. Ein Unentschieden hätte den Franken am Ende der Saison zum Nichtabstieg gereicht. Da jedoch auch das Wiederholungsspiel verloren ging, war der Abstieg besiegelt.
Auch Franz Beckenbauer, der ehemalige Profi-Fußballspieler und aktuelle Präsident des FC Bayern München belegt mit seiner Aussage Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift die enorme Macht der Unparteiischen. Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter schaffen mit ihren Entscheidungen Tatsachen. Diese sind laut Regel V der offiziellen Fußballregeln […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Robert Feiner
Der Schiedsrichter
Mächtig in seinen Entscheidungen. Einflüssen ohnmächtig ausgesetzt?
ISBN: 978-3-8366-4521-8
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Technische Universität München, München, Deutschland, Diplomarbeit, 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
Inhaltsverzeichnis
3
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ... 3
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis ... 5
1
Einführung sowie Relevanz des Themas ... 6
2
Erwartungshaltung an den Fußball-Schiedsrichter ... 9
2.1
Soziale Rollen im Sport ... 10
2.1.1 Die Rolle des Schiedsrichters ... 11
2.1.2 Beispiel einer Rollenüberschreitung ... 13
2.1.3 Rollenkonflikte ... 15
2.2
Leistungsanforderungen ... 15
2.2.1 Physische Leistungsfähigkeit ... 16
2.2.2 Psychische Leistungsfähigkeit ... 19
3
Schiedsrichterentscheidungen ... 23
3.1
Die Entscheidungsfindung und damit verbundene Probleme ... 24
3.1.1 Wahrnehmung ... 26
3.1.2 Kategorisierung... 29
3.1.3 Gedächtnisorganisation ... 30
3.1.4 Urteilen und Entscheiden ... 31
3.2
Beeinflussung ... 32
4
Methodische Vorgehensweise ... 34
4.1
Datenerhebung ... 35
4.2
Datenauswertung ... 37
5
Einflussfaktoren auf den Fußball-Referee Darstellung der Ergebnisse... 41
5.1
Mannschaftsverbund und einzelne Spieler ... 43
5.2
Trainer sowie Team-Offizielle ... 49
5.3
Zuschauer ... 52
5.4
Näheres soziales Umfeld ... 57
5.5
Schiedsrichter-Beobachter... 60
5.6
Medien... 62
5.7
Gastgeschenke ... 65
5.8
Platzverhältnisse ... 67
5.9
Wetter ... 70
Inhaltsverzeichnis
4
5.10 Unterbringung ... 73
5.11 Spielklasse ... 75
5.12 Einstellungen, Erwartungen und Vorurteile ... 79
5.13 Heikle Entscheidungen... 83
5.14 Stimmungslage ... 86
5.15 Anreise ... 88
5.16 Zusammenfassung ... 89
6
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Ergebnisse ... 93
6.1
Spielklassenspezifischer Vergleich ... 96
6.2
Geschlechtsspezifischer Vergleich ... 98
6.3
Persönlichkeitsspezifischer Vergleich ... 99
7
Fazit ... 101
Anhang ... 104
Literaturverzeichnis ... 107
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
5
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildung 1: Rollensatz des Schiedsrichters, eigene Darstellung angelehnt an
Heinemann ... 11
Abbildung 2: Auszüge aus einem Artikel auf Welt Online vom 25. November 2008,
unbekannter Verfasser ... 14
Abbildung 3: Pulsfrequenzprofil eines Schiedsrichters in der 1. Halbzeit eines
Bundesligaspiels, Beseke 1987, S. 18 ... 18
Abbildung 4: Die kognitiven Stufen der Informationsverarbeitung, eigene
Erstellung übernommen von Fiedler und Bless ... 25
Abbildung 5: Vereinfachte Darstellung der Entstehung einer Schiedsrichter-
Entscheidung, eigene Grafik ... 26
Abbildung 6: Das Sandersche Parallelogramm, eigene Erstellung übernommen von
Altvater ... 27
Abbildung 7: Die Abhängigkeit von Trikotfarbe und Foulentscheidungen, eigene
Erstellung übernommen von Plessner und Raab (2000, S. 111) ... 30
Abbildung 8: Kategorienbildung im Rahmen der Interviewauswertung mit Hilfe des
Analyseprogramms MAXQDA ... 38
Abbildung 9: Quantitative Darstellung der angesprochenen und ausgewerteten
Einflussfaktoren ... 41
Tabelle 1: Die absoluten und relativen Häufigkeiten der von Schiedsrichtern
genannten Persönlichkeitsmerkmale, übernommen von Frütel ... 21
Tabelle 2: Übersicht und Einteilung der befragten Schiedsrichter ... 36
Tabelle 3: Beispielhafter Ausschnitt aus einem Reduktionsvorgang zum Thema
Platzverhältnisse ... 39
Tabelle 4: Einteilung der ausgewerteten Einflussfaktoren in die Stufen der
Gedächtniswahrnehmung... 42
1 Einführung sowie Relevanz des Themas
6
1
Einführung sowie Relevanz des Themas
,,Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt". So hieß es schon im
Jahre 1974, als der Deutsche Fußball-Bund anlässlich der Weltmeisterschaft im eigenen
Lande eine Schallplatte aufnehmen ließ. Bis heute hat die Sportart nichts von ihrer Fas-
zination verloren. Wenn man sich die Zuschauerentwicklungen sowie die Ausgaben für
Übertragungsrechte ansieht, ist die Begeisterung sogar erheblich angestiegen.
Allein in Deutschland wird Fußball von über sechs Millionen Aktiven in
26.000 Fußballvereinen ausgeübt (vgl. DFB 2009a). Die 306 Spiele der Fußball-
Bundesliga-Saison 2008/09 wurden von rund 12,8 Millionen Zuschauern besucht
(vgl. DFB 2009b), im Durchschnitt sind das knapp 42.000 Zuschauer pro Partie. Damit
verzeichnete der deutsche Profifußball zum achten Mal in Folge eine Zuschauersteige-
rung. Diese Kennzahlen verdeutlichen seine Relevanz für einen Großteil der Bevölke-
rung.
Fußball ist jedoch längst nicht mehr nur des Deutschen liebstes Hobby. Ganze Wirt-
schaftszweige haben sich rund um diesen Mannschaftssport entwickelt. Alleine die
Fußball-Bundesliga erhält jährlich 412 Millionen Euro für die TV-Rechte im Inland
(vgl. Bundesliga 2009). Durch Abstiege sind Angestellte im Umfeld der betroffenen
Vereine in ihrer Existenz gefährdet.
Die Tragweite, die dabei Schiedsrichter-Entscheidungen spielen können, wurde in der
Vergangenheit des Öfteren deutlich: Als Beispiel soll an dieser Stelle das so genannte
Phantomtor von Thomas Helmer vom 23. April 1994 angeführt werden, welches über
Umwege zum Abstieg des 1. FC Nürnberg in die Zweite Bundesliga führte. Aus einer
undurchsichtigen Situation heraus beförderte der damalige Spieler des FC Bayern Mün-
chen den Ball Richtung Nürnberger Tor. Er verfehlte dies und der Ball rollte links am
linken Pfosten vorbei über die Torauslinie. Der Schiedsrichter-Assistent hingegen hatte,
zur Verwunderung aller, ein Tor gesehen und signalisierte dies dem Schiedsrichter, der
den Treffer anerkannte. Bayern gewann dadurch mit 2:1. Ein Unentschieden hätte den
Franken am Ende der Saison zum Nichtabstieg gereicht. Da jedoch auch das Wiederho-
lungsspiel verloren ging, war der Abstieg besiegelt.
1 Einführung sowie Relevanz des Themas
7
Auch Franz Beckenbauer, der ehemalige Profi-Fußballspieler und aktuelle Präsident des
FC Bayern München belegt mit seiner Aussage ,,Abseits ist, wenn der Schiedsrichter
pfeift" die enorme Macht der Unparteiischen. Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter
1
schaffen mit ihren Entscheidungen Tatsachen. Diese sind laut Regel V der offiziellen
Fußballregeln endgültig (vgl. Fußball-Regeln 2009/2010, S. 29). Alleine durch diese
ihm zugestandene Autorität erlangt der Schiedsrichter eine große Macht im Fußball.
Wie aber kommen fehlerhafte Urteile der Fußball-Referees zu Stande? Forschungen, die
Einflussfaktoren auf Schiedsrichterentscheidungen nachweisen, existieren bereits. So
konnten Oudejans, Verheijen, Bakker, Gerrits, Steinbrücker und Beek im Jahre 2000
beispielsweise zeigen, dass die Fehler bei Abseitsentscheidungen durch Linienrichter
häufig auf die gewählte Position hinter dem letzten Verteidiger zurückzuführen sind
(vgl. Kapitel 3.1.1). Die damit verbundene relative Blickperspektive auf die Angreifer
und Verteidiger führte in vielen Spielsituationen zwangsläufig zur fehlerhaften Wahr-
nehmung von Abseitsstellungen. Ein Experiment von Frank und Gilovich (1998) ergab,
dass das Verhalten von Mannschaften in schwarzen Trikots eher als regelwidrig gewer-
tet wurde, als jenes von Teams in weißer Sportbekleidung (vgl. Kapitel 3.1.2). Diese
Erkenntnis wurde in Bezug auf die Sportart Football gewonnen. Weitere Untersuchun-
gen belegen zudem die Existenz von Konzessionsentscheidungen bei gegebenen Straf-
stößen sowie die Wirkung von Fans bei Heimspielen. Beispielsweise pfiffen Schieds-
richter weniger Fouls der Gastmannschaft bei Spielen unter Ausschluss der Öffentlich-
keit (vgl. Kapitel 5.3). Eine ausführliche Übersicht von Arbeiten zu Urteils- und Ent-
scheidungsprozessen von Fußball-Schiedsrichtern findet sich bei Mascarenhas, O'Hare
und Plessner (2006).
Vorliegende Diplomarbeit soll, neben den bereits untersuchten, weitere Einflussfaktoren
aufzeigen, denen sich Schiedsrichter ausgesetzt sehen. Des Weiteren ist es erklärtes
Ziel, zu ergründen, inwiefern sich diese auf die Entscheidungen der Schiedsrichter aus-
wirken.
1
Im Interesse einer besseren Lesbarkeit des Textes wird im Folgenden jeweils nur die männliche Form
verwendet, womit jedoch auch stets die weibliche Form gemeint ist.
1 Einführung sowie Relevanz des Themas
8
Neben den Erwartungshaltungen an den Unparteiischen (vgl. Kapitel 2) werden die Stu-
fen der Entscheidungsfindung in den Fokus gerückt. Verzerrende Probleme, die dabei
auftreten können, finden ebenfalls Berücksichtigung (vgl. Kapitel 3).
Empirischer Inhalt der vorliegenden Arbeit ist es, Gespräche mit Schiedsrichtern von
der Bundesliga bis zu den untersten Klassen auf den Inhalt möglicher Einflussfaktoren
hin zu untersuchen und mittels der Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse auszuwer-
ten (vgl. Kapitel 4). Im Anschluss werden die Ergebnisse präsentiert (vgl. Kapitel 5)
und auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin untersucht (vgl. Kapitel 6).
Diese empirische Diplomarbeit soll einen Beitrag dazu leisten, für die Rolle des
Schiedsrichters erhöhtes Verständnis zu fördern und kann als Anregung verstanden
werden, sich in der Ausbildung der Unparteiischen stärker mit Einflussfaktoren zu be-
schäftigen und die Auszubildenden für dieses Thema zu sensibilisieren.
2 Erwartungshaltung an den Fußball-Schiedsrichter
9
2
Erwartungshaltung an den Fußball-Schiedsrichter
Die zentrale Aufgabe des Schiedsrichters besteht darin, über die Einhaltung der Spielre-
geln zu wachen. ,,Er handelt dabei nicht in seinem eigenen Namen; er drückt nicht dem
Spiel seine Marke auf wie ein Spielmacher, sondern ist ein Sachwalter der Regeln; diese
soll er im Zentrum des Spiels wirken lassen" (Gebauer 2006, S. 135).
Darauf beschränkt sich jedoch sein Aufgabenbereich nicht: Der Schiedsrichter lenkt
auch das Spiel er versucht, den Spielfluss aufrecht zu erhalten. Brand und Neß be-
zeichnen ihn deshalb passend als Game-Manager (vgl. Brand/Neß 2004, S. 127). In
dieser Tätigkeit sieht er sich mit einer Vielzahl von Anforderungen konfrontiert. Mit
Erwartungen von den konträrsten Seiten.
Ziel dieses Kapitels ist es, mit den Besonderheiten der Schiedsrichterrolle vertraut zu
machen. Wie alle Individuen agieren auch Schiedsrichter in ihrer Tätigkeit nicht voll-
kommen autonom und unabhängig von Lebenszusammenhängen beziehungsweise
-situationen. Ihre Handlungen sind in einen gesellschaftlichen und situativen Kontext
eingebettet. Sozialer Einfluss entspringt beispielsweise dem Wunsch des Individuums
nach Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Soziale Rollen wiederum bilden die Grund-
voraussetzung für eine mögliche soziale Beeinflussung.
Der Ursprung von Anforderungen wird zunächst aus einer soziologischen Perspektive
beleuchtet, beschränkt auf den Bereich des Sports (vgl. Kapitel 2.1). Ausgehend von
den allgemeinen sozialen Rollen fokussiert sich der Blick anschließend auf die spezielle
Rolle des Schiedsrichters (vgl. Kapitel 2.1.1), der im Sportspiel eine besondere Rolle
einnimmt. Anschließend soll ein Beispiel aus der vergangenen Bundesliga-Saison
exemplarisch die Rollenüberschreitung eines Unparteiischen darstellen (vgl. Kapi-
tel 2.1.2) und aufzeigen, dass Überschreitungen häufig nicht folgenlos bleiben. Dieses
Beispiel erinnert zudem, dass es sich auch bei Schiedsrichtern nicht um unfehlbare Re-
gelhüter handelt. Die Persönlichkeit des Einzelnen, die auch im empirischen Teil eine
zentrale Rolle spielen wird, fließt demnach bei Spielentscheidungen mit ein. Den Ab-
schluss bildet die Darstellung möglicher Rollenkonflikte (vgl. Kapitel 2.1.3), vor denen
auch Schiedsrichter nicht geschützt sind.
2 Erwartungshaltung an den Fußball-Schiedsrichter
10
Der Schiedsrichter sieht sich konfrontiert mit einer Vielzahl an Erwartungen. Um diesen
bestmöglich gerecht werden zu können, muss er bestimmte Leistungsanforderungen
erfüllen (vgl. Kapitel 2.2). Zudem können dem Regelhüter seine physischen (vgl. Kapi-
tel 2.2.1), vor allem aber seine psychischen Fähigkeiten (vgl. Kapitel 2.2.2) helfen, un-
parteiische und vor allem selbständige Entscheidungen zu treffen. Der Schiedsrichter
agiert somit resistenter gegenüber diversen Einflüssen.
2.1 Soziale Rollen im Sport
Der Sport stellt eine Vielzahl spezifischer Positionen zur Verfügung. Ob nun der Sport-
ler selbst, Trainer, Zuschauer oder Schiedsrichter jeder hat eine soziale Stellung inne.
Mit Übernahme einer dieser Rollen werden unweigerlich Erwartungen an den Rollen-
träger gestellt. So beruht beispielsweise der regelmäßige Trainingsbesuch eines Fuß-
ballspielers nicht nur auf der eigenen Vernunft oder dem Ehrgeiz. Auch andere Parteien
wie beispielsweise der Trainer oder seine Mitspieler richten Forderungen an den
Sporttreibenden. Die Summe aller Erwartungen darüber, wie sich der Inhaber einer Po-
sition verhalten sollte, bestimmt die soziale Rolle.
Zimbardo und Gerrig beschreiben die soziale Rolle als ,,(...) ein sozial definiertes Ver-
haltensmuster, das von einer Person erwartet wird, wenn sie in einer bestimmten Umge-
bung oder Gruppe funktioniert" (Zimbardo/Gerrig 2008, S. 670).
Sowohl Rechte als auch Pflichten werden an das Individuum herangetragen. Die Erwar-
tungen richten sich dabei zum einen an sein Verhalten (Rollenverhalten), zum anderen
aber auch häufig an bestimmte Eigenschaften und Merkmale (Rollenattribute). Dies
erleichtert die Interaktion mit dem Rolleninhaber, da sein Handeln dadurch eine gewisse
Berechenbarkeit und Verlässlichkeit erhält (vgl. Röthing 1995, S. 64 f.). Erwartungssi-
cherheit entsteht.
Die soziale Rolle besagt dennoch nichts über das tatsächliche Verhalten der Person, wie
Kapitel 2.1.2 zeigt. Sollte der Betreffende entgegen den Erwartungen handeln, muss er
jedoch mit Sanktionen rechnen mit Maßnahmen der Gesellschaft, um die Einhaltung
der Verhaltensvorschriften durchzusetzen. So kann der Fußballspieler dem Training
selbstverständlich unentschuldigt fern bleiben, muss dann aber gegebenenfalls negative
2 Erwartungshaltung an den Fußball-Schiedsrichter
11
Reaktionen befürchten. Ein Beispiel für eine Sanktion des Trainers wäre die Verban-
nung auf die Auswechselbank am nächsten Spieltag.
Sanktionen können jedoch zudem positiver Art sein. So kann konformes Verhalten auch
honoriert werden, beispielsweise in Form von Anerkennung oder auch als konkrete Be-
lohnung.
Die Erwartungen an den Sportler beziehen sich stets auf die jeweilige Position, die er
gerade einnimmt. Der Fußballspieler unterliegt anderen Normen und Regeln als der
Zuschauer, der Präsident eines Vereins hat andere Aufgaben zu erfüllen als der Trainer
und an den Platzwart richten sich andere Erwartungen als an den Schiedsrichter (vgl.
Heinemann 2006, S. 225).
2.1.1 Die Rolle des Schiedsrichters
Wie bereits erläutert, ist mit der sozialen Rolle das Verhalten festgelegt, welchem der
Inhaber einer Position gerecht werden sollte. Darüber hinaus steht mit der Rollenüber-
nahme das Netzwerk sozialer Beziehungen fest, in das ein Positionsinhaber eingebettet
ist. In dieses Geflecht ebenfalls mit eingebunden sind alle Positionen, die legitimerweise
Verhaltenserwartungen an den Inhaber einer Rolle stellen können. Ein solches Netz-
werk wird in Abbildung 1 exemplarisch dargestellt (vgl. Heinemann 2006, S. 226).
Abbildung 1: Rollensatz des Schiedsrichters, eigene Darstellung angelehnt an Heinemann
2 Erwartungshaltung an den Fußball-Schiedsrichter
12
Der Referee übernimmt in den Sportspielen die wichtige Funktion eines Unparteiischen
und ist für die Einhaltung der Spielregeln verantwortlich. Doch ,,von allen Akteuren, die
sich auf dem Fußballfeld befinden, erfährt der Schiedsrichter die geringste Aufmerk-
samkeit" (Gebauer 2006, S. 135). Gleichzeitig werden an ihn aber die kontroversesten,
sich widersprechenden Erwartungen gestellt, wie er seine Rolle ausführen sollte. So
liegen eine Verkörperung der Regeln und die entsprechende Konsequenz im Interesse
der Fußballverbände. Die Spieler dagegen erwarten einen verständnisvollen Schieds-
richter, der vielleicht einmal Gnade vor Recht ergehen lässt.
Jedoch sieht sich der Unparteiische nicht nur selbst mit Erwartungshaltungen belastet.
Auch er stellt Anforderungen an andere Rolleninhaber, wie beispielsweise an die Spie-
ler. Ein Teil dieser Forderungen ist den Wettkampfregeln zu entnehmen (vgl. Fußball-
Regeln 2009/2010).
Um komplexe Rollen, wie beispielsweise die des Schiedsrichters, greifbarer zu machen,
charakterisiert Heinemann soziale Rollen nach vier verschiedenen Gesichtspunkten
(vgl. Heinemann 2006, S. 227 f.):
Herkunft sozialer Normen und Rollen
Bei der Schiedsrichterrolle handelt es sich um eine stark organisationsbezogene
Rolle. Ihre Herkunft hat sie in der hierarchischen Struktur einer Organisation, na-
mentlich dem Deutschen Fußball-Bund.
Funktionen der Rolle
Der Schiedsrichter lässt sich, ebenso wie beispielsweise der Dopingkontrolleur, in
die Sparte der Kontrollrollen einordnen. Die Aufgabe des Schiedsrichters besteht
darin, die Einhaltung der Regeln zu überwachen. Für Heinemann ist der Referee
somit weniger am Produktionsprozess der Sportleistung beteiligt als beispielswei-
se der Spieler oder Trainer.
Grad der positionellen Verfestigung
Die Position des Schiedsrichters mit seinen Aufgaben, Rechten und Pflichten ist
im Regelwerk sehr genau definiert. Die komplette Regel V in den Fußball-Regeln
(vgl. Fußball-Regeln 2009/2010, S. 28 ff.) beschäftigt sich ausschließlich mit ihm
und seinen Aufgaben. Seine Position ist somit weitgehend festgelegt. Als Gegen-
2 Erwartungshaltung an den Fußball-Schiedsrichter
13
beispiel sei der Zuschauer genannt. Ihm fehlt diese positionelle Fixierung größten-
teils.
Grad der Verfügbarkeit
Rollen können unterschiedlich stark nach individuellen Ideen und Vorstellungen
gestaltet sein. Die Persönlichkeit des Einzelnen kommt teilweise mehr, teilweise
weniger zum Tragen. Während beim Trainer der Charakter relativ deutlich zum
Ausdruck kommt, bewegt sich der Schiedsrichter in einem engen Netz sozialer
Verpflichtungen. Er besitzt kaum Gestaltungsfreiheit in seinem Handeln.
Die Schiedsrichter-Rolle hat im Fußballspiel einen besonderen Stellenwert:
,,Die Teilnehmer am Wettkampf haben die abschließende Kontrolle und Entscheidung über die
Beachtung und Auslegung der Regeln und das Aussprechen von Sanktionen bei einer Regelverlet-
zung aus ihren Händen gegeben und sich dem Unparteiischen unterworfen" (Heinemann 2006,
S. 294).
Dem Regelwerk zufolge erhält der Schiedsrichter also eine zentrale Bedeutung für die
Erfüllung der Regeln und somit für das Funktionieren des Spiels. Er überwacht die ein-
gesetzten Mittel der Akteure. Mit Hilfe von Sanktionsmaßnahmen stellt er eine Balance
her, wenn diese durch Fouls oder Ähnliches aus dem Gleichgewicht geraten ist. Diese
reichen von der mündlichen Verwarnung ohne weitere Folgen über den Freistoß für das
gegnerische Team bis hin zum sofortigen Ausschluss eines Spielers vom Spielbetrieb.
Seine Entscheidungen zu spielrelevanten Tatsachen sind wie bereits erwähnt endgültig.
Eine solche Vormacht ist in dieser absoluten Form im sozialen Leben sehr ungewöhn-
lich. Der ehemalige deutsche Bundesliga-Referee Pauly beschreibt seine Stellung im
Jahre 1990 folgendermaßen: ,,Der Schiedsrichter ist auf dem Platz Polizist, Staatsan-
walt, Richter und Vollzugsbeamter in einer Person. Er hat damit eine Machtfülle, die
kaum noch einmal vorkommt" (Pauly 1990, S. 10).
2.1.2 Beispiel einer Rollenüberschreitung
Diese Rollenfestlegung gesteht dem Unparteiischen also eine enorme Macht im Fuß-
ballspiel zu. Er darf nicht in den Verdacht geraten, diese Befehlsgewalt in irgendeiner
Art zu missbrauchen. Umso wichtiger ist es für den Schiedsrichter, den entsprechenden
Normen zu genügen. Die sozialen Erwartungen können aber selbst in den obersten Li-
2 Erwartungshaltung an den Fußball-Schiedsrichter
14
gen nicht immer erfüllt werden. Darauf soll ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit
hinweisen. Abbildung 2 zeigt Auszüge einer sid-Meldung von Welt Online (vgl. Dop-
pel-Gelb 2008):
Doppel-Gelb
DFB-Schiris schießen gegen den ,,Eifel-Django"
Schiedsrichter Thomas Metzen hat sich mit
seiner Aufsehen erregenden Aktion im
Zweitligaspiel Mainz gegen St. Pauli (2:2),
als er zwei Gelbe Karten gleichzeitig aus der
Tasche holte, eine Menge Ärger eingehan-
delt. ,,Selbstdarsteller" nennt ihn Ex-Fifa-
Referee Hellmut Krug. Der DFB verbittet
sich eine Wiederholung.
Sein Auftritt erinnerte an Revolverhelden aus
alten Western-Filmen, doch mit seiner High-
Noon-Aktion hat es sich Referee Thomas Met-
zen bei den Schiedsrichter-Verantwortlichen
beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der
Deutschen Fußball Liga (DFL) kräftig ver-
scherzt. Für Metzen bedeutet das kuriose
,,Doppel-Gelb" vom Wochenende vorerst
selbst ,,Rot".
,,Der Schiedsrichter ist nicht für den Showteil
verantwortlich. Metzen hat sich selbst und alle
[sic!] anderen Schiris geschadet", wetterte der
Schiedsrichter-Experte der DFL, Hellmut
Krug, in der ,,Bild"-Zeitung. Es wird nun be-
reits spekuliert, dass Metzen zunächst eine
schöpferische Pause erhält.
Der Unparteiische selbst zeigte sich reumütig.
,,(...) Die Intention des Schiedsrichters ist es,
sich in Zurückhaltung zu üben, von daher war
es sicher unangemessen und wird bestimmt
nicht mehr vorkommen." Metzen beteuerte,
zwei Karten gehörten zu seiner Grundausstat-
tung, beide gleichzeitig zu ziehen sei spontan
gewesen.
(...) Die DFB-Verantwortlichen finden die
Aktion von Metzen, als er (...) den Spielern
Miroslav Karhan und Florian Bruns gleichzei-
tig jeweils einen gelben Karton unter die Nase
hielt, gar nicht witzig. ,,Der Schiedsrichter hat
erst den einen und dann den anderen Spieler zu
verwarnen", erklärte Schiedsrichter-Lehrwart
Eugen Strigel.
Beim DFB fürchtet man um den seriösen Ruf
der Unparteiischen. ,,(...) Jeder fragt sich dann,
wie der DFB einen solchen Selbstdarsteller zu
einem
Bundesligaspiel
schicken
kann",
schimpfte Krug nach der Aktion von Metzen,
und Top-Schiedsrichter Herbert Fandel machte
der Auftritt ,,sprachlos".
Zwar ist es nach den Regeln nicht verboten,
zwei Gelbe Karten in die Luft zu halten, doch
der DFB hat bereits reagiert und deutlich klar
gemacht, dass eine solche Aktion nicht noch
einmal vorkommen solle. Metzens Verhalten
entspricht augenscheinlich nicht den internen
Anweisungen. Die ,,Doppel-Verwarnung" von
Sonntag bleibt somit wohl einzigartig.
Abbildung 2: Auszüge aus einem Artikel auf Welt Online vom 25. November 2008, unbekannter Verfasser
Offensichtlich hatte der Zweitliga-Schiedsrichter den Grad der Verfügbarkeit (vgl. S.13)
bei der Partie 1. FSV Mainz 05 gegen den FC St. Pauli überschritten. Die Intention als
Referee lautet, sich in Zurückhaltung zu üben. Obwohl das gleichzeitige Aussprechen
2 Erwartungshaltung an den Fußball-Schiedsrichter
15
zweier Gelber Karten laut Regeln nicht verboten ist, hat sich der Schiedsrichter dadurch
für den DFB zu sehr in den Mittelpunkt gestellt. Metzen hatte seine Gestaltungsfreiheit
überschritten, woraufhin er als Sanktion vom DFB bei der Spieleinteilung bis Anfang
März 2009 nicht berücksichtigt wurde.
2.1.3 Rollenkonflikte
Ein weiteres Problem neben der Rollenüberschreitung stellt für den Unparteiischen der
Rollenkonflikt dar. Schließlich ist der Schiedsrichter nicht nur Schiedsrichter und Trä-
ger dieser Sportrolle. Gleichzeitig ist er beispielsweise Familienvater, Angestellter,
Ehegatte und vieles mehr.
,,Der Prozess, die unterschiedlichen Rollen aufeinander abzustimmen und sie einander
anzupassen, birgt ein vielfältiges Konfliktpotential" (Baumann 1998, S. 339). Baumann
unterscheidet je nach Herkunft verschiedene Spannungsfelder, mit denen die Regelhüter
umzugehen haben.
So bezeichnet der Interrollenkonflikt die Konfrontation mit Erwartungen aus mehreren
verschiedenen Rollen. Ein Beispiel hierfür wäre der Schiedsrichter und Familienvater,
der am Geburtstag seines Sohnes ein Spiel leiten soll. Beim Intrarollenkonflikt kollidie-
ren dagegen Erwartungen aus verschiedenen Positionssegmenten miteinander. Der In-
haber muss sich innerhalb seiner Rolle für ein bestimmtes Verhalten entscheiden. Mit
diesem Konflikt kommt der Schiedsrichter durchaus häufiger in Kontakt, da er sich im
Spannungsfeld entgegengesetzter Interessen befindet
2
.
2.2 Leistungsanforderungen
Die Umsetzung der durch den Weltverband für Fußball (FIFA) erlassenen, vom Europä-
ischen Fußballverband (UEFA) und vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) übernomme-
nen Fußball-Regeln gehört zu den Kernaufgaben eines Schiedsrichters.
2
Zudem spricht Baumann noch vom interpersonellen Rollenkonflikt. Dieser tritt bei der Besetzung von
Rollen auf. Im Schiedsrichterbereich ist er jedoch kaum von Relevanz, da die Einteilung über feste
Beurteilungssysteme geregelt ist. Darum wird in dieser Arbeit nicht näher darauf eingegangen.
2 Erwartungshaltung an den Fußball-Schiedsrichter
16
Zudem formulieren Ebersberger, Malka und Pohler weitere Erwartungen, die der Refe-
ree zu erfüllen hat (vgl. Ebersberger/Malka/Pohler 1980, S. 98). Der Schiedsrichter soll:
das Spiel neutral und objektiv leiten
gerecht sein
keine Unterschiede in der Bewertung gleicher Spielvorgänge oder Vorkommnisse
machen
alle Spieler gleichgestellt behandeln
klare Entscheidungen treffen
mitlaufen, möglichst immer im Zentrum des Spielgeschehens sein
Verständnis für die Spieler aufbringen und nicht zu empfindlich auf Kritik reagie-
ren
konsequent im Handeln sein
sich nicht beeinflussen lassen
Um diesen vielfältigen Anforderungen weitestgehend gerecht werden zu können, muss
der Referee sowohl physisch als auch psychisch auf die Spielleitung vorbereitet sein.
Der Unparteiische trifft nach aktuellem Wissensstand pro Spiel durchschnittlich
220 Entscheidungen (vgl. Krug 2008, S. 33). Dabei gibt es neben den sichtbaren
Schiedssprüchen, die durch einen Pfiff oder ein klares Handzeichen signalisiert werden,
eine enorme Fülle an Entscheidungen, die unsichtbar ablaufen. Der Unparteiische greift
hierbei nicht aktiv in das Spielgeschehen ein. Dieser Quantität kann er nur gerecht wer-
den, wenn er auf die an ihn gestellten Anforderungen hinreichend vorbereitet ist. Dem-
nach bilden für Merk, den dreimaligen Weltschiedsrichter des Jahres, die sportliche
Leistungsfähigkeit und die psychische Belastung ,,(...) eine Art Symbiose. Das eine
verlangt nach dem anderen. Die eine kann ohne die andere Seite nicht existieren" (Merk
2005, S. 49).
2.2.1 Physische Leistungsfähigkeit
Körperliches Leistungsvermögen stellt die Grundlage einer guten Spielleitung dar. Nur
ein Schiedsrichter mit ausgeprägter Kondition wird dem Spiel über 90 Minuten oder
2 Erwartungshaltung an den Fußball-Schiedsrichter
17
länger folgen können. Ein gutes Stellungsspiel beispielsweise erleichtert die richtige
Entscheidungsfindung enorm. Zudem steigert die eigene Fitness die Akzeptanz der Ent-
scheidungen bei Spielern, Trainern und auch den Zuschauern. ,,Der Schiedsrichter im
Fußball muß selbst Sportler sein" (Ebersberger et al. 1980, S. 9).
Für den Referee stellt der Fußball ebenso wie für Spieler eine azyklische Sportart mit
Intervallcharakter und einer leistungsbegrenzenden Ausdauerkomponente dar. Da die
Anforderungen an die Ausdauer von Schiedsrichtern durch einen häufigen Rhythmus-
wechsel zwischen niedrigen und höheren Intensitäten gekennzeichnet sind, kommt auch
der anaeroben Energiebereitstellung eine hohe Bedeutung zu. Auf diese speziellen An-
forderungen müssen sich Schiedsrichter einstellen und vorbereiten (vgl. Teipel/Kem-
per/Heinemann 1999, S. 42 f.). Regelmäßige Leistungstests von Seiten des Verbandes
überprüfen den Fitnesszustand der eingesetzten Schiedsrichter. Dabei stellt der DFB an
weibliche wie an männliche Referees die gleichen Anforderungen.
Mehrere Untersuchungen wurden in den letzten Jahren durchgeführt, um Aussagen über
die physische Beanspruchung von Fußball-Schiedsrichtern tätigen zu können. Ausge-
wählte Ergebnisse werden im Folgenden vorgestellt:
Ein Indiz für körperliche Belastungen stellt die Pulsfrequenz dar. Pulsfrequenzverläufe
bei Schiedsrichtern wurden unter anderem von Besecke (1987), Catterall, Reilly, Atkin-
son und Coldswell (1993) sowie von Johnston und Mc Naughton im Jahre 1994 analy-
siert. An dieser Stelle soll ein besonderes Augenmerk auf die Untersuchung von
Besecke gelegt werden, da er sich als einziger Wissenschaftler mit deutschen Referees
beschäftigt hat. Untersucht wurde der Puls von 20 Bundesliga-Schiedsrichtern vor, wäh-
rend und nach Ligaspielen. Pro Partie wurden dabei durchschnittlich 142 Situationen
protokolliert und benannt. Die Anforderung mit der höchsten durchschnittlichen Puls-
frequenz stellte dabei das Ordnen der Mauer dar. Über 174 Pulsschläge/Minute zeigten
die Schiedsrichter im Schnitt bei dieser Tätigkeit. Entscheidungen, wie ein Elfmeterpfiff
(ebenfalls 174 Pulsschläge/min) und Spielerauswechslungen (knapp 173 Pulsschlä-
ge/min), folgten.
2 Erwartungshaltung an den Fußball-Schiedsrichter
18
Abbildung 3: Pulsfrequenzprofil eines Schiedsrichters in der 1. Halbzeit eines Bundesligaspiels, Beseke 1987, S. 18
Catterall et al. analysierten die Pulsfrequenz über eine gesamte Partie gesehen und er-
hielten einen durchschnittlichen Puls von 165. Die höchsten gemessenen maximalen
Pulsfrequenzwerte zeigten sich bei Schiedsrichtern von Spitzenspielen und erreichten
Werte bis zu 200 Pulsschlägen/min. Johnston und Mc Naughton verzeichneten in ihrer
Studie maximale Pulsfrequenzen von 172 bis zu 195 (vgl. Teipel et al. 1999, S. 44 ff.).
Zum Vergleich: Ein sehr gut trainierter Läufer erreicht bei einem 100-Meter-Sprint
Werte um die 190 Pulsschläge/min. Dieser Vergleich macht deutlich, welche körperli-
che Leistung Schiedsrichtern auf dem Spielfeld abverlangt wird.
Allerdings sind diese hohen Pulsfrequenzen nicht ausschließlich auf die körperliche
Anstrengung des Schiedsrichters zurückzuführen. Auch die Ausschüttung von Stress-
hormonen wie Adrenalin und Noradrenalin aufgrund der psychischen Belastung spielt
bei diesen Werten eine nicht zu verachtende Rolle.
Die zurückgelegten Laufwege der Schiedsrichter innerhalb eines Spiels stehen in den
letzten 20 Jahren vermehrt im Fokus der Wissenschaft. Das erlaubt die Vergleichbarkeit
über einen größeren Zeitraum.
2 Erwartungshaltung an den Fußball-Schiedsrichter
19
9.990 Meter legte ein Spitzen-Schiedsrichter vor 20 Jahren durchschnittlich pro Partie
zurück. Dies ergab eine Studie von Asami, Togari und Ohashi aus dem Jahre 1988.
Mittlerweile bewältigt ein Bundesliga-Schiedsrichter im selben Zeitraum mehr als
10.800 Meter (vgl. Kemper/Teipel 2006, S. 128). Krug spricht 2008 gar von Werten
zwischen 11.000 und 13.000 Metern (vgl. Krug 2008, S. 34). Diese Werte liegen in den
meisten Fällen über denen der Spieler.
In der siebthöchsten Spielklasse absolviert der Referee durchschnittlich immerhin noch
mehr als 7.800 Meter pro Partie (vgl. Kemper/Teipel 2006, S. 129). Neben schwächeren
konditionellen Fähigkeiten der Akteure trägt auch die weniger dynamische Spielweise
zu dieser Verringerung bei.
Der Schiedsrichter hat regelkonforme Entscheidungen zu treffen und ist zudem ,,(...) in
seiner Leistung ein Spitzensportler, der mehr läuft als ein Spieler (...), wenn auch nicht
mit der Intensität des Profi-Fußballers. Seine Form ist abhängig vom körperlichen Trai-
ning und der mentalen Fitneß" (Michel 1999, S. 504).
2.2.2 Psychische Leistungsfähigkeit
,,Der Schiedsrichter ist ein Einzelkämpfer inmitten von 22 Spielern, Zehntausenden von Zuschau-
ern im Stadion und Millionen am Bildschirm. Es gibt nur wenige vergleichbare Aufgaben, die mit
einer derartigen Belastung verbunden sind" (Blatter 1992, S. 20).
Dieses Zitat des FIFA-Präsidenten lässt die enorme psychische Belastung erahnen, die
auf Schiedsrichter der höchsten Klassen wirkt. Der Referee hat die alleinige Macht auf
dem Spielfeld, ohne mitmachen zu dürfen. Für Heisterkamp ist er somit ,,(...) psycholo-
gisch tatsächlich der einsamste Mensch auf dem Platz" (Heisterkamp 1978, S. 163).
Nicht zuletzt diese Sonderstellung sorgt dafür, dass laut Ebersberger nach der abge-
schlossenen Schiedsrichterausbildung über 60 Prozent der Referees ihre Tätigkeit an
den Nagel hängen (vgl. Ebersberger 2001, S. 213). Die Belastung beschränkt sich of-
fensichtlich nicht ausschließlich auf die Unparteiischen der elitären Ligen.
Schiedsrichter finden sich Woche für Woche enormen Anforderungen gegenüberge-
stellt. Die Einmaligkeit des Sehens dem Schiedsrichter stehen keine Wiederholungen
oder Zeitlupen zur Verfügung verbunden mit der enormen Macht und einem einge-
schränkten Wahrnehmungsvermögen (vgl. Kapitel 3.1.1) führen dazu, dass der Schieds-
richter vielen dieser Ansprüche kaum gerecht werden kann. Ein fehlerfrei geleitetes
2 Erwartungshaltung an den Fußball-Schiedsrichter
20
Spiel findet zudem kaum Beachtung oder gar Lob, während der Regelhüter bei umstrit-
tenen Entscheidungen oder gar bei Fehlentscheidungen mit negativen Reaktionen von
vielen Seiten rechnen muss. Falsche Entscheidungen werden vom Referee als hochgra-
dig belastend empfunden. Nicht zuletzt, da sich eine negative Bewertung seiner Leis-
tung auf zukünftige Spieleinteilungen auswirken kann (vgl. Kapitel 5.5).
,,Die psychische Leistung bestimmt, je nach Sportart (vgl. z.B. den Langstreckenlauf
gegenüber den Mannschaftssportarten), 40 bis 80 % der Gesamtleistung des Sportlers"
(Altvater 1996, S. 4). Diese Aussage trifft auch auf den Schiedsrichter als Sportsmann
zu. Seine Leistung hängt in hohem Maße von der individuellen psychischen Stabilität
ab, was DFB-Schiedsrichtersprecher Amerell bestätigt. Für ihn ist die Persönlichkeit
des Kampfrichters ,,(...) das wichtigste Element für eine erfolgreiche Spielleitung (...)"
(Amerell 1999, S. 25).
Persönlichkeitsmerkmale standen im Fokus einer Befragung von Frütel aus dem Jahre
1995. 31 Bundesliga-Referees sollten die ihrer Einschätzung nach wichtigsten Schieds-
richterattribute angeben. Die Ergebnisse finden sich in der nachfolgenden Tabelle (vgl.
Frütel 1995, S. 76):
2 Erwartungshaltung an den Fußball-Schiedsrichter
21
Tabelle 1: Die absoluten und relativen Häufigkeiten der von Schiedsrichtern genannten Persönlichkeitsmerkmale,
übernommen von Frütel
Nicht angekreuzt
N
Nicht angekreuzt
%
Angekreuzt
N
Angekreuzt
%
Mut
1
3,2
30
96,8
Fähigkeit zur Selbstkritik
5
16,1
26
83,9
Konsequenz
6
19,4
25
80,6
Nervenstärke
7
22,6
24
77,4
Besonnenheit
11
35,5
20
64,5
Charakterstärke
11
35,5
20
64,5
Ehrlichkeit
14
45,2
17
54,8
Selbstsicherheit
15
48,4
16
51,6
Disziplin
17
54,8
14
45,2
Integrität
24
77,4
7
22,6
Hohe Frustrationstoleranz
28
90,3
3
9,7
Sonstige Merkmale
26
83,9
5
16,1
Neben der Fähigkeit zur Selbstkritik wurden die Charakterzüge Mut und Konsequenz
von Referees als hochgradig relevant eingeschätzt. Die reine Regelkenntnis reicht dem-
nach nicht, um erfolgreich Spiele zu leiten. Für Weinberg und Richardson unterscheiden
die psychologischen Fähigkeiten die guten Schiedsrichter vom Rest (vgl. Wein-
berg/Richardson 1995, S. 157). Jedoch nehmen sich ihrer Einschätzung nach zu wenige
Unparteiische die Zeit, diese Fähigkeiten weiter zu entwickeln.
An den Schiedsrichter werden psychische Anforderungen gestellt wie an kaum einen
anderen Rolleninhaber. Allerdings bringt es dieser Umstand auch mit sich, dass die
Schiedsrichtertätigkeit zu einer Weiterentwicklung der Persönlichkeit des Unpartei-
ischen führt: Der ,,(...) Schiedsrichter, der sich von den negativen Seiten nicht
2 Erwartungshaltung an den Fußball-Schiedsrichter
22
abschrek-ken läßt, wird im Laufe der Zeit auf dem Platz zur Persönlichkeit reifen. (...)
Ein unschätzbarer Vorteil, den man erst später erkennt" (Michel 1999, S. 504).
3 Schiedsrichterentscheidungen
23
3
Schiedsrichterentscheidungen
Kampfrichterentscheidungen können ganz einfach sein: Der Vergleich der sportlichen
Leistungen von Athleten ist in vielen Sportarten nahezu problemlos messbar. Als Sieger
des Wettkampfs darf sich beispielsweise derjenige bezeichnen, der am schnellsten ge-
laufen ist, am höchsten gesprungen ist oder das schwerste Gewicht gestemmt hat. Ganz
nach dem heutigen olympischen Motto ,,citius altius fortius"
3
.
Hier gibt es im Normalfall nur eine einzige richtige Entscheidung eine Entscheidung,
die naturwissenschaftlich exakt überprüfbar ist. Der Fußball verfährt ähnlich, wenn am
Ende die Anzahl der erzielten Tore über Sieg oder Niederlage entscheidet (vgl. Krähe
2008, S. 9).
Der Schiedsrichter ermittelt jedoch nicht nur den Sieger. Während des Spielverlaufs hat
der Unparteiische eine Vielzahl an Entscheidungen zu treffen, bei denen es auf seine
Bewertung der Situation ankommt: Foul oder Schwalbe? Strafstoß oder Freistoß? Gelbe
Karte oder Rote Karte?
Die Hauptaufgabe des Fußball-Schiedsrichters besteht somit darin, einzelne Spielsitua-
tionen zu beobachten und zu bewerten. Die Grundlage dafür bietet das Regelwerk. Was
sich zunächst relativ einfach anhört, führt nicht selten zu Unmut bei Spielern, Trainern
und auch Fans. Zum einen trägt sicherlich die sogenannte Vereinsbrille der angespro-
chenen Gruppen zu dieser Tatsache bei. Zum anderen agieren aber auch Schiedsrichter
nicht immer fehlerfrei.
Hier stellt sich die Frage, woran Letzteres liegen könnte. Unkelbach, Plessner und Haar
sind sich sicher: Bei ihren Entscheidungen unterliegen Schiedsrichter wie auch die an-
deren Sportteilnehmer ,,(...) Einflüssen, was sich an vielen Beispielen (...) einfach de-
monstrieren lässt" (Unkelbach et al. 2009, S. 682). Eine detaillierte Auseinandersetzung
mit Einflüssen erfolgt im Empirieteil dieser Arbeit.
Um jedoch deren Wirkung besser verstehen und kategorisieren zu können, werden im
Folgenden die Stufen der Entscheidungsfindung aufgezeigt. Da Schiedsrichterurteile
3
Zu Deutsch: Schneller - höher - stärker.
3 Schiedsrichterentscheidungen
24
immer auch soziale Urteile sind, baut dieses Kapitel auf den theoretischen Grundlagen
der sozialen Kognition auf.
,,Bei der sozialen Kognition geht es um die Untersuchung sozialen Wissens und der
kognitiven Prozesse, die beteiligt sind, wenn Individuen ihre subjektive Realität kon-
struieren" (Fiedler/Bless 2002, S. 127).
3.1 Die Entscheidungsfindung und damit verbundene
Probleme
Im Wesentlichen werden bei der Informationsverarbeitung zwischen einem
Stimulusereignis und der darauf folgenden Verhaltensweise vier kognitive Stufen
durchlaufen. Zur Veranschaulichung werden diese jeweils mit einem typischen Beispiel
aus der Entscheidungsfindung eines Fußball-Schiedsrichters belegt (orientiert an Pless-
ner/Raab 1999, S. 136 ff.):
Wahrnehmung
Der Unparteiische sieht, dass ein Spieler seinen Gegenspieler am Fuß trifft.
Kategorisierung
Diese Situation bewertet er als unfaires Spiel.
Gedächtnisorganisation
Er erinnert sich, dass derselbe Spieler in der Partie schon des Öfteren negativ aufge-
fallen ist.
Urteilen und Entscheiden
Nach dem Zusammenfassen dieser Informationen kommt der Schiedsrichter zu dem
Entschluss, einen Freistoß auszusprechen sowie die Gelbe Karte zu vergeben.
Spätere Stufen bauen in allen Prozessstadien auf früheren auf. Dabei hängen die einzel-
nen Stufen zur Entscheidungsfindung in hohem Maße wechselseitig voneinander ab und
sind teilweise durch Rückkopplungen gekennzeichnet (vgl. Plessner/Raab 1999,
S. 134). Eine Grafik soll die Zusammenhänge visuell verdeutlichen (vgl. Fiedler/Bless
2002, S. 133):
3 Schiedsrichterentscheidungen
25
Abbildung 4: Die kognitiven Stufen der Informationsverarbeitung, eigene Erstellung übernommen von Fiedler und
Bless
Die Kognitionsforschung geht folglich davon aus, dass Urteile nur teilweise durch die
Reize in einer gegebenen Situation festgelegt sind. Unsere Entscheidungen hängen auch
im hohen Maße vom Vorwissen (vgl. Kapitel 5.12) ab, das wir in diese Situation ein-
bringen. Zudem können ,,persönliche Betroffenheit, Gefühlszustände oder Umweltfak-
toren (...) einen beträchtlichen Einfluss auf logisches Denken, Stereotypisieren, Urteils-
bildung und Entscheidung haben" (Fiedler/Bless 2002, S. 161). Eine eigene vereinfach-
te Darstellung soll die Zusammenhänge verdeutlichen:
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836645218
- Dateigröße
- 1.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität München – Fakultät für Sportwissenschaften, Sport, Medien und Kommunikation
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- schiedsrichter fußball einfluss erwartung entscheidung
- Produktsicherheit
- Diplom.de