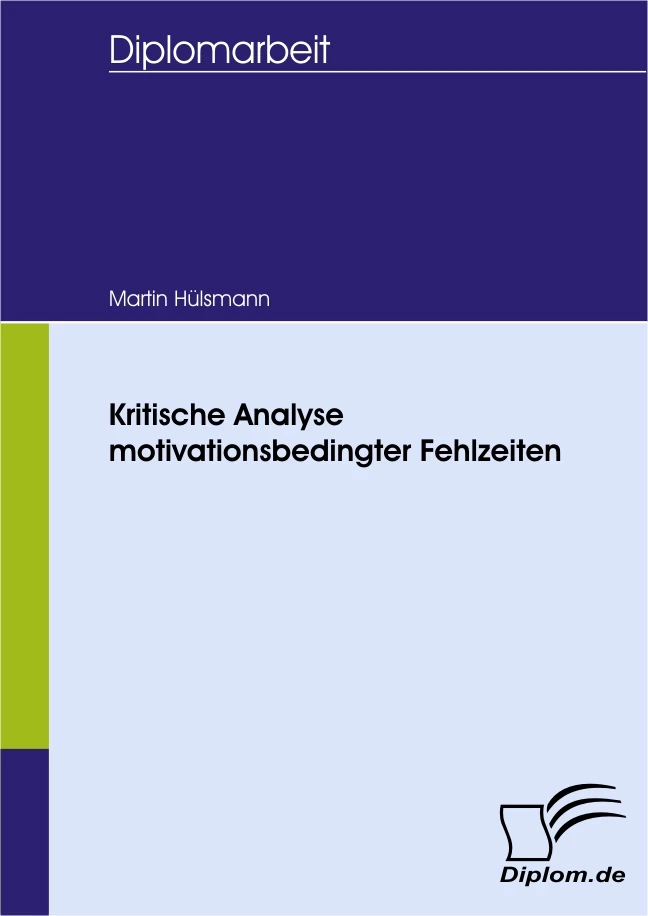Kritische Analyse motivationsbedingter Fehlzeiten
©2009
Diplomarbeit
103 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Bereits Anfang 1980 erschien ein anarchistisches Buch mit dem Titel Wege zu Wissen und Wohlstand oder lieber krankfeiern als gesund schuften!, welchem schnell die Beinamen Krankfeierbroschüre und Untergrundfibel anhafteten. Darin wurden detailliert Methoden beschrieben, wie ein arbeitsunwilliger Arbeitnehmer einem Arzt unwiderlegbar Arbeitsunfähigkeit vortäuschen könnte, um in den Besitz einer Krankschreibung zu kommen. Das Buch wurde in Deutschland, nach Feststellung der Verfassungswidrigkeit der beschriebenen Methoden und der damit verbundenen Aufforderung zum Betrug, Ende 1980 verboten. Es hielt sich jedoch noch lange in zensierter Form in den Buchläden und war noch viele Jahre später ein Verkaufsschlager.
Furore machte das Buch aber auch aus folgendem Grund. Durch die Herausgabe wurde in Deutschland der Terminus Krankfeiern etabliert. Dieser dominierte auch etliche Jahre später noch die Diskussion des betrieblichen Krankenstandes. Eine noch größere Dimension erreichte der Diskurs durch eine Titelgeschichte des Magazins Der Spiegel aus dem Jahre 1991. Darin wurde ergänzend der neue Begriff Volkssport Krankfeiern geprägt, in welchem deutlich die vermutete Tragweite des Problems steckt.
Die Aktualität dieses Themas reißt nicht ab. Genauso wenig lässt die Polemik und Provokanz nach, mit der verschiedene Experten das Thema diskutieren. So macht der in vielen Unternehmen bekannte Fehlzeitenberater Michael Schmilinsky vor allem die deutsche Ärzteschaft, welche sich durch leichtfertiges Krankschreiben ihren Kundenstamm sichern will, für die Problematik des Krankfeierns verantwortlich. Ferner identifiziert er das weitmaschige Sozialnetz, das geradezu zum Blaumachen einlädt, und Führungskräfte in Unternehmen, die sich nicht gegen Betriebsräte durchsetzen können, als Problemfelder. Natürlich muss das Thema viel differenzierter diskutiert werden. Es muss den Sichtweisen unterschiedlicher Interessengruppen, sowohl Arbeitnehmern als auch Unternehmen, Rechnung getragen werden.
Gerade in Zeiten der Globalisierung, in denen Deutschland darum kämpft, sich als Wirtschaftstandort zu behaupten, spielt dieses Thema eine entscheidende Rolle. Hohe Lohn- und Lohnnebenkosten belasten schon lange die Konkurrenzfähigkeit deutscher Produkte auf den internationalen Märkten. Zunehmend ins Bewusstsein der Menschen rückt aber auch das Problem, dass Deutschland Statistiken zufolge die höchsten Fehlzeitenquoten im europäischen […]
Bereits Anfang 1980 erschien ein anarchistisches Buch mit dem Titel Wege zu Wissen und Wohlstand oder lieber krankfeiern als gesund schuften!, welchem schnell die Beinamen Krankfeierbroschüre und Untergrundfibel anhafteten. Darin wurden detailliert Methoden beschrieben, wie ein arbeitsunwilliger Arbeitnehmer einem Arzt unwiderlegbar Arbeitsunfähigkeit vortäuschen könnte, um in den Besitz einer Krankschreibung zu kommen. Das Buch wurde in Deutschland, nach Feststellung der Verfassungswidrigkeit der beschriebenen Methoden und der damit verbundenen Aufforderung zum Betrug, Ende 1980 verboten. Es hielt sich jedoch noch lange in zensierter Form in den Buchläden und war noch viele Jahre später ein Verkaufsschlager.
Furore machte das Buch aber auch aus folgendem Grund. Durch die Herausgabe wurde in Deutschland der Terminus Krankfeiern etabliert. Dieser dominierte auch etliche Jahre später noch die Diskussion des betrieblichen Krankenstandes. Eine noch größere Dimension erreichte der Diskurs durch eine Titelgeschichte des Magazins Der Spiegel aus dem Jahre 1991. Darin wurde ergänzend der neue Begriff Volkssport Krankfeiern geprägt, in welchem deutlich die vermutete Tragweite des Problems steckt.
Die Aktualität dieses Themas reißt nicht ab. Genauso wenig lässt die Polemik und Provokanz nach, mit der verschiedene Experten das Thema diskutieren. So macht der in vielen Unternehmen bekannte Fehlzeitenberater Michael Schmilinsky vor allem die deutsche Ärzteschaft, welche sich durch leichtfertiges Krankschreiben ihren Kundenstamm sichern will, für die Problematik des Krankfeierns verantwortlich. Ferner identifiziert er das weitmaschige Sozialnetz, das geradezu zum Blaumachen einlädt, und Führungskräfte in Unternehmen, die sich nicht gegen Betriebsräte durchsetzen können, als Problemfelder. Natürlich muss das Thema viel differenzierter diskutiert werden. Es muss den Sichtweisen unterschiedlicher Interessengruppen, sowohl Arbeitnehmern als auch Unternehmen, Rechnung getragen werden.
Gerade in Zeiten der Globalisierung, in denen Deutschland darum kämpft, sich als Wirtschaftstandort zu behaupten, spielt dieses Thema eine entscheidende Rolle. Hohe Lohn- und Lohnnebenkosten belasten schon lange die Konkurrenzfähigkeit deutscher Produkte auf den internationalen Märkten. Zunehmend ins Bewusstsein der Menschen rückt aber auch das Problem, dass Deutschland Statistiken zufolge die höchsten Fehlzeitenquoten im europäischen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Martin Hülsmann
Kritische Analyse motivationsbedingter Fehlzeiten
ISBN: 978-3-8366-4443-3
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Magdeburg, Deutschland, Diplomarbeit,
2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
- II -
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis...IV
1.
Einleitung...1
1.1.
Problemstellung und Aktualität des Themas... 1
1.2.
Ziel der Arbeit... 2
1.3.
Aufbau der Arbeit ... 3
2.
Terminologische und systematische Grundlagen ...5
2.1.
Organisation... 5
2.2. Motivation ... 6
2.2.1.
Motiv und Motivation... 6
2.2.2.
Intrinsische vs. extrinsische Motivation ... 8
2.2.3.
Das Handlungsphasenmodell der Motivation... 9
2.3.
Fehlzeit... 11
2.3.1.
Abgrenzung zwischen verschiedenen Fehlzeiten ... 11
2.3.2.
Absentismus ... 14
3.
Theoretische Ansätze zur Arbeitsmotivation...17
3.1.
Inhaltstheorien der Arbeitsmotivation ... 17
3.1.1.
Die Zwei- Faktoren- Theorie von Herzberg ... 17
3.1.2.
Das Modell der Arbeitscharakteristika von Hackman & Oldham. 19
3.2.
Prozesstheorien der Arbeitsmotivation ... 20
3.2.1.
Die Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Theorie von Vroom ... 20
3.2.2.
Die Equity-Theorie von Adams... 22
- III -
4.
Die Genese motivationsbedingter Fehlzeiten ...24
4.1.
Das Anwesenheitsverhalten ... 24
4.2.
Erklärungsmodelle für Absentismus ... 38
4.2.1.
Aversion gegen das Arbeitsverhältnis ... 38
4.2.2.
Neuverhandlung des psychologischen Vertrages ... 43
4.2.3.
Gruppenpression... 46
4.2.4.
Ökonomisch rationales Verhalten ... 48
5.
Betriebswirtschaftliche Bedeutung von Fehlzeiten ...51
5.1.
Fehlzeiten als Kostenfaktor ... 51
5.2.
Fehlzeiten als Störfaktor... 53
5.3.
Fehlzeiten als Signal ... 54
6.
Maßnahmen zum Abbau motivationsbedingter Fehlzeiten57
6.1.
Grundlagen...57
6.2.
Präventive Maßnahmen... 58
6.3.
Kurative Maßnahmen ... 64
6.4.
Motivationstheoretische Analyse... 70
6.5.
Kosten und Erlöse... 81
7.
Abschließende Beurteilung ...86
Literaturverzeichnis... V
Bücherquellen ... V
Internetquellen... XII
- IV -
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Das Handlungsphasenmodell der Motivation von Heckhausen ... 9
Abbildung 2: Klassifizierung von Fehlzeiten ... 12
Abbildung 3: Krankenstand in der GKV in Deutschland 2000-2007 ... 14
Abbildung 4: Zwei Faktoren-Theorie der Arbeitszufriedenheit ... 18
Abbildung 5: Das Modell der Arbeitscharakteristika von Hackman Oldham 19
Abbildung 6: Die VIE-Theorie nach Vroom ... 22
Abbildung 7: Das Modell des Anwesenheitsverhaltens von Steers Rhodes... 24
Abbildung 8: Anwesenheit via VIE-Theorie von Vroom ... 34
Abbildung 9: Abwesenheit via VIE-Theorie von Vroom ... 36
Abbildung 10: Absentismus durch Unzufriedenheit... 38
Abbildung 11: Formen der Arbeitszufriedenheit nach Bruggemann et al. ... 39
Abbildung 12: Absentismus bei den Zufriedenheitsformen ... 41
Abbildung 13: Austauschprozess zwischen Organisation und Mitarbeiter ... 44
Abbildung 14: Absentismus durch unzulänglichen Anwesenheitsdruck ... 47
Abbildung 15: Absentismus im neoklassischen Arbeitsangebotsmodell ... 48
Abbildung 16: Stufenplanvorschlag für Rückkehr- und Fehlzeitengespräche... 66
Abbildung 17: Das Kontrollparadoxon... 79
Abbildung 18: Die Umkehrung des Kontrollparadoxons ... 80
Abbildung 19: Transaktionskosten von Gruppenarbeit ... 83
- 1 -
1.
Einleitung
1.1.
Problemstellung und Aktualität des Themas
Bereits Anfang 1980 erschien ein anarchistisches Buch mit dem Titel ,,Wege zu
Wissen und Wohlstand oder lieber krankfeiern als gesund schuften!", welchem
schnell die Beinamen ,,Krankfeierbroschüre" und ,,Untergrundfibel" anhafteten.
Darin wurden detailliert Methoden beschrieben, wie ein arbeitsunwilliger
Arbeitnehmer einem Arzt unwiderlegbar Arbeitsunfähigkeit vortäuschen könnte,
um in den Besitz einer Krankschreibung zu kommen. Das Buch wurde in
Deutschland, nach Feststellung der Verfassungswidrigkeit der beschriebenen
Methoden und der damit verbundenen Aufforderung zum Betrug, Ende 1980
verboten. Es hielt sich jedoch noch lange in zensierter Form in den Buchläden und
war noch viele Jahre später ein Verkaufsschlager.
1
Furore machte das Buch aber auch aus folgendem Grund. Durch die Herausgabe
wurde in Deutschland der Terminus ,,Krankfeiern" etabliert. Dieser dominierte
auch etliche Jahre später noch die Diskussion des betrieblichen Krankenstandes.
Eine noch größere Dimension erreichte der Diskurs durch eine Titelgeschichte des
Magazins ,,Der Spiegel" aus dem Jahre 1991. Darin wurde ergänzend der neue
Begriff ,,Volkssport Krankfeiern" geprägt, in welchem deutlich die vermutete
Tragweite des Problems steckt.
2
Die Aktualität dieses Themas reißt nicht ab. Genauso wenig lässt die Polemik und
Provokanz nach, mit der verschiedene Experten das Thema diskutieren. So macht
der in vielen Unternehmen bekannte Fehlzeitenberater Michael Schmilinsky vor
allem die deutsche Ärzteschaft, welche sich durch leichtfertiges Krankschreiben
ihren Kundenstamm sichern will, für die Problematik des ,,Krankfeierns"
verantwortlich. Ferner identifiziert er das weitmaschige Sozialnetz, das geradezu
zum ,,Blaumachen" einlädt, und Führungskräfte in Unternehmen, die sich nicht
gegen Betriebsräte durchsetzen können, als Problemfelder.
3
Natürlich muss das
Thema viel differenzierter diskutiert werden. Es muss den Sichtweisen
unterschiedlicher Interessengruppen, sowohl Arbeitnehmern als auch Unter-
nehmen, Rechnung getragen werden.
Gerade in Zeiten der Globalisierung, in denen Deutschland darum kämpft, sich als
Wirtschaftstandort zu behaupten, spielt dieses Thema eine entscheidende Rolle.
1
Vgl. Mende (1994), S. 21.
2
Vgl. Marr (1996), S. 12.
3
Vgl. Bueren (2001), S. 57.
- 2 -
Hohe Lohn- und Lohnnebenkosten belasten schon lange die Konkurrenzfähigkeit
deutscher Produkte auf den internationalen Märkten. Zunehmend ins Bewusstsein
der Menschen rückt aber auch das Problem, dass Deutschland Statistiken zufolge
die höchsten Fehlzeitenquoten im europäischen Vergleich aufweist.
4
Dabei stellen insbesondere Fehlzeiten betriebswirtschaftlich gesehen eine
erhebliche Beeinträchtigung der Rentabilität eines Unternehmens dar. Einerseits
wirken sie sich katastrophal auf den betrieblichen Ablauf aus. Andererseits haben
Fehlzeiten aber auch vielschichtige Kosten zur Folge, z.B. durch die Einarbeitung
zusätzlich beschäftigter Arbeitskräfte oder durch ungenügende Auslastungen des
Produktionsapparates.
5
In Deutschland macht der betriebliche Krankenstand etwa die Hälfte aller
Fehlzeiten aus. Allein dieser verursachte im Jahr 2007 geschätzte 65 Mrd. Euro
Kosten für die deutsche Volkswirtschaft.
6
Leider ist es nahezu unmöglich, Zahlen
über den Anteil der motivationsbedingt Abwesenden am Krankenstand zu
ermitteln. Trotzdem ist sich jeder darüber bewusst, dass dieser nicht unbedeutend
ist. Man muss sich nur vergegenwärtigen, dass diese Abwesenheiten für
Unternehmen, im Kontrast zu echten krankheitsbedingten Fehlzeiten, in der Regel
vermeidbar bzw. steuerbar sind. Grundlage dafür ist, dass sie nicht ausschließlich
von außerbetrieblichen Faktoren erzeugt werden. Die Tatsache, dass eine negativ
erlebte Arbeitssituation ursächlich für das Fehlen sein könnte, ist Legitimation
genug für eine profunde Untersuchung der Problematik. Die Daueraktualität des
Themas ist unverkennbar.
1.2.
Ziel der Arbeit
,,Fehlzeiten sollten nicht ausschließlich negativ gesehen werden. Fehlzeiten sind
Symptom und Signal dafür, dass von betrieblicher Seite irgendwas nicht stimmt
und verändert werden sollte. Fehlzeiten sind eine Chance, um durch eine intensive
Ursachenforschung auf für Unternehmen wahrscheinlich völlig neuen Wegen zu
neuen Einsichten zu gelangen. Fehlzeiten führen nicht selten zu einem neuen
Denken."
7
Von diesem Standpunkt ausgehend, ist es das Ziel dieser Arbeit, zum
einen die Entstehung motivationsbedingter Fehlzeiten zu ergründen, zum anderen
4
Vgl. Brandenburg / Nieder (2003), S.13.
5
Vgl. Bitzer (1999b), S.1.
6
Vgl. AOK Gesundheitsbericht 2008, S. 4.
7
Bitzer (1999b), Vorwort.
- 3 -
aber auch Ansätze für die betriebliche Praxis aufzuzeigen, die eine Reduzierung
dieser Abwesenheiten ermöglichen.
Dabei gilt es, zwischen verschieden Einflussfaktoren zu differenzieren, welche auf
die Arbeitseinstellung, -zufriedenheit und -motivation der Mitarbeiter wirken. So
können zum Beispiel persönliche bzw. familiäre Gründe für die Abwesenheit
eines Mitarbeiters vorliegen. In diesem Fall benötigt der Mitarbeiter zusätzliche
Freizeit. Der private Lebensbereich rückt in den Vordergrund. Anlässlich dafür
können selbst bestimmte Umstände, beispielsweise eine Wohnungsrenovierung,
oder Situationen, denen man sich nicht entziehen kann, sein. Beispiele dafür
wären Erkrankungen von Angehörigen oder Ehekrisen.
8
Im Rahmen dieser Arbeit sind die privaten Faktoren unrelevant, da sie von
betrieblicher Seite schlecht zu beeinflussen sind. Hier soll es um Gründe gehen,
die sich auf die Arbeitssituation eines fehlenden Mitarbeiters beziehen. Extreme
Unter oder Überforderung, als stressig empfundene Tätigkeiten oder persönliche
Konflikte am Arbeitsplatz zählen zu solchen betrieblichen Ursachen motivations-
bedingter Fehlzeiten. Oftmals liegt dem Fehlen eines Mitarbeiters keine grund-
sätzlich mangelhafte Einstellung zur Arbeit zugrunde, sondern unzumutbare oder
gar gesundheitsschädliche Arbeitsumstände oder Perspektivlosigkeit drängen ihm
die Abwesenheitsentscheidung geradezu auf. Die hier diskutierten Wege zur Fehl-
zeitenreduzierung erfolgen demzufolge hauptsächlich über eine Verbesserung der
Arbeitssituation. Diese zielt jedoch nicht auf die Prävention von wirklichen
Krankheiten ab, wie etwa bei Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung,
sondern auf die Determinanten der Arbeitszufriedenheit und -motivation der
Mitarbeiter.
Auf der Basis logischer Schlussfolgerungen soll die Kausalbeziehung stringent
erörtert werden, dass bei abnehmender Arbeitszufriedenheit die Fehlzeiten
zunehmen. Es soll ebenso herausgestellt werden, dass Fehlzeiten das Produkt
eines rationalen Entscheidungsprozesses sind.
1.3.
Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit ist in drei Hauptbestandteile gegliedert. Der erste Teil,
bestehend aus den Kapiteln zwei bis vier, ist der Entstehung motivationsbedingter
Abwesenheit vom Arbeitsplatz gewidmet. Zunächst werden im zweiten Kapitel
die für diese Arbeit fundamentalen Begriffe Organisation, Motiv und Motivation,
8
Vgl. Bueren (2001), S. 95.
- 4 -
Fehlzeit und Absentismus erklärt bzw. voneinander abgegrenzt. Es werden sodann
im dritten Kapitel beutende theoretische Ansätze zur Arbeitsmotivation erläutert,
welche im vierten Kapitel basal für die Genese von Arbeitszufriedenheit und
Anwesenheitsmotivation sind. Auf Seiten der Inhaltstheorien der Arbeits-
motivation ist der Überblick auf das Zwei-Faktoren-Modell von Herzberg und auf
das Modell der Arbeitscharakteristika von Hackman und Oldham beschränkt. Die
Prozesstheorien der Arbeitsmotivation werden in dieser Arbeit durch die Valenz-
Instrumentalitäts-Erwartungstheorie von Vroom und die Equity-Theorie von
Adams vertreten. Im Anschluss wird im vierten Kapitel die Genese motivations-
bedingter Fehlzeiten erörtert. Dafür wird zuallererst das renommierte Modell des
Anwesenheitsverhaltens von Rhodes und Steers erklärt, da es relativ überschaubar
den Zusammenhang zwischen Anwesenheitsmotivation, deren Voraussetzungen
und Anwesenheit am Arbeitsplatz illustriert. Daraufhin werden im vierten Kapitel
vier alternative Erklärungsmodelle für Absentismus untersucht.
Das fünfte Kapitel stellt den zweiten Teil der Arbeit dar. In diesem wird die
betriebswirtschaftliche Bedeutung von Fehlzeiten thematisiert. Dabei werden drei
Sichtweisen beleuchtet. Zunächst werden Fehlzeiten als Kostenfaktor ausgemacht.
Dabei wird sowohl auf direkte als auch auf indirekte Kosten eingegangen. Danach
werden Fehlzeiten als Störfaktor beschrieben. Hierfür werden die Belastungen für
den fehlenden Mitarbeiter selbst, für Vorgesetzte, für Kollegen und für die
gesamte Organisation herangezogen. Zuletzt wird noch auf die besonders wichtige
dritte Sichtweise, Fehlzeiten als Signal, eingegangen. Nicht selten können
Abwesenheiten als Frühwarnsystem für grundlegend unbefriedigende Zustände in
der Arbeitssituation der Mitarbeiter interpretiert werden.
Der dritte Teil der Arbeit beginnt mit dem sechsten Kapitel. Hier werden
betriebliche Instrumente zur Reduzierung motivationsbedingter Fehlzeiten
aufgezeigt. Zuerst werden Grundlagen für ein derartiges Instrumentarium erörtert.
Danach geht es um präventive Maßnahmen, welche die Anwesenheitsmotivation
der Mitarbeiter erhöhen sollen. Daraufhin werden kurative Maßnahmen erläutert,
welche sich zur Reduzierung dieser Abwesenheiten anbieten. Nachdem diverse
Maßnahmen auf ihre motivationstheoretische Eignung überprüft wurden, werden
sodann Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit einiger Maßnahmen angestellt. Den
Abschluss der Arbeit bildet das siebte Kapitel. In der hier vorgenommenen
Beurteilung wird ein Fazit gezogen und auf verschiedene Aspekte hingewiesen,
welche nicht ausführlicher thematisiert worden sind.
- 5 -
2.
Terminologische und systematische Grundlagen
2.1.
Organisation
Da im weiteren Verlauf dieser Arbeit der Begriff der Organisation von außer-
ordentlicher Bedeutung ist, soll er hier zu Beginn kurz erläutert werden. Der
Gebrauch des Wortes Organisation kann in zwei unterschiedlichen Absichten
erfolgen. Zum einen gibt es die instrumentelle Sichtweise dieses Begriffs. In
dieser spricht man bei der Durchführung bestimmter Maßnahmen von tätigkeits-
bezogener Organisation. Die Schaffung von Strukturen und Regelungen wird als
ergebnisbezogene Organisation verstanden. Zum anderen wird Organisation aber
auch als Synonym für Betrieb oder Unternehmen verwendet. Diese zweite Sicht-
weise wird als institutionell bezeichnet.
9
In dieser Arbeit wird der Terminus
Organisation, falls nicht explizit etwas anderes beschrieben wird, ausschließlich
in der institutionellen Bedeutung gebraucht, d.h. als Synonym für Unternehmen.
Dabei erweist er sich als besonders adäquat, weil er neben Unternehmen auch
noch etliche weitere Gebilde, beispielsweise Vereine, Behörden oder Parteien,
einschließt. Unbestritten gibt es eine Vielzahl tauglicher Erklärungen für den
Begriff der institutionellen Organisation, jedoch erscheint die Definition von
Rosenstiel (1992) von besonderer Prägnanz:
,,Eine Organisation ist
· ein gegenüber ihrer Umwelt offenes System,
· das zeitlich überdauernd existiert,
· spezifische Ziele verfolgt,
· sich aus Individuen bzw. Gruppen zusammensetzt, also ein soziales
Gebilde
ist, und
· eine bestimmte Struktur aufweist, die meist durch Arbeitsteilung und eine
Hierarchie von Verantwortung gekennzeichnet ist."
10
Eine solche Organisation ist ein fragiles Gebilde, das sich in einer sich ständig
ändernden Umwelt tagtäglich gegenüber anderen Organisationen behaupten muss,
mit internen Widersprüchen kämpft und stets vom Zerfall bedroht ist.
11
9
Vgl. Kleinbeck (1996), S. 103.
10
Ebenda, S. 107.
11
Vgl. Neuberger (1997), S. 118-119.
- 6 -
Zu den angesprochenen spezifischen Zielen gehört im Wesentlichen die Verbesse-
rung der Produktivität von Arbeitsvorgängen. Ferner ist die Weiterentwicklung
der Organisationsmitglieder ein Ziel, was sich sowohl auf deren wirtschaftlichen
Wohlstand als auch auf Verbesserung der persönlichen Leistungsvoraussetzungen
und Entfaltung der Persönlichkeit bezieht. Zwei Motivationsprobleme erschweren
jedoch den reibungslosen Ablauf in einer Organisation. Einerseits muss man die
Mitglieder motivieren Leistung zu erbringen. Andererseits muss man sie auch
schon zur bloßen Teilnahme an der Organisation, zur Anwesenheit, motivieren.
12
2.2. Motivation
2.2.1. Motiv und Motivation
Schon zu Beginn dieser Arbeit ist es erforderlich, die für das weitere Vorgehen
basalen Begriffe Motiv und Motivation zu erklären. Sie bilden gewissermaßen das
Fundament für die spätere Diskussion der motivationsbedingten Fehlzeiten.
Zuallererst soll der Begriff Motiv eingeführt werden. Termini, welche oftmals
synonym zu Motiv verwendet werden, sind Bedürfnis, Leitgedanke, Beweggrund
oder Antrieb.
13
Nach Heckhausen sind Motive zeitlich überdauernde und relativ
konstante Wertungsdispositionen in Individuen. Diese umfassen jeweils definierte
Inhaltsklassen von Handlungszielen, welche den angestrebten Folgen des eigenen
Handelns entsprechen. Konstante Wertungsdisposition bedeutet, dass sich ein
Individuum in verschiedenen, wiederkehren Situationen und zu unterschiedlichen
Zeitpunkten ähnlich verhält. Zusammenfassend erklären Motive demnach die
Konsistenz, bzw. die Regelhaftigkeit, individuellen Verhaltens. Diese Wertungs-
dispositionen sind nicht angeboren. Sie entwickeln sich erst durch Sozialisation
und durch den Druck sozialer Normen. Sie beziehen sich daher auch nur auf
solche Inhaltsklassen von Handlungszielen, die nicht für das reine Überleben
eines Individuums von Bedeutung sind. Überlebenswichtig wären in diesem Sinne
Hunger, Durst oder Schlaf. Diese Bedürfnisse müssen also von den Motiven
abgegrenzt werden. Bei der Mannigfaltigkeit menschlicher Handlungsziele ist es
nicht verwunderlich, dass es auch eine Vielzahl von Motiven gibt, welche schwer
definierbar sind. In der Regel wird daher eine Inhaltsklasse von Handlungszielen
mit unverwechselbaren Besonderheiten als Motiv bezeichnet. Es bleibt jedoch
12
Vgl. Steers / Black (1994), S. 189.
13
Vgl. Albs (2005), S. 15.
- 7 -
festzuhalten, dass ein Motiv in seiner Abstraktheit immer ein ,,hypothetisches
Konstrukt" ist. Es kann nicht unmittelbar beobachtet werden, erklärt sich jedoch
durch die Interpretation von Befunden, bei welchen unter zuvor definierten
Situationsbedingungen ein spezifisches Verhalten auf dispositionsanzeigende
Indikatoren folgt. Das bedeutet, dass die Erklärung eines bestimmten Verhaltens
über ein Motiv schlüssig sein kann. Prinzipiell sind aber auch andere Erklärungen
denkbar.
14
Motivation hingegen ist in der Psychologie ein Sammelbegriff für eine Vielzahl
von Prozessen, in denen ein Individuum sein Verhalten mit bestimmter Intensität,
Richtung und Ausdauer energetisiert, um die dadurch erwarteten Handlungsfolgen
zu erreichen.
15
Allgemein beschreibt Motivation daher die Abweichung zwischen
einem angestrebten Soll-Zustand und dem aktuellen Ist-Zustand, welche durch ein
Verhalten ausgeräumt werden soll.
16
Damit fällt ihr auch eine Schutzfunktion zu. Sie schützt das Verhalten eines
Individuums gegen äußere Einflüsse und hält es stabil. Abgesehen von kurz-
fristigen Verhaltensanpassungen in andere Richtungen, legen Individuen zumeist
gleiche Motivationsmuster an den Tag. Trotzdem ist Motivation keineswegs
statisch, sondern peu a peu veränderbar. Sie bezieht sich aber immer auf die Ziele
und Nutzenerwartungen des Individuums, dem sie innewohnt. Deshalb ist
Motivation individuell und nicht normierbar. Bei Maßnahmen zur nachhaltigen
Beeinflussung der Motivation muss daher den spezifischen Bedürfnissen jedes
Individuums Rechnung getragen werden.
17
Wichtig ist dabei, dass durch ein
Verhalten bestimmte Motive des Individuums befriedigt werden. Das Verhalten
kann sodann als ein Gradmesser für die Motivation verstanden werden. Bei
Motivbefriedigung spricht man von Zielerreichung, bei Nichtbefriedigung entsteht
ein Mangelempfinden.
18
Im Kontext der motivationsbedingten Fehlzeiten entspricht die Anwesenheit am
Arbeitsplatz dem beobachtbaren Verhalten und die dafür relevante Motivation ist
die Anwesenheitsmotivation. Im Kontrast dazu kann auch die Abwesenheit vom
Arbeitsplatz das Verhalten darstellen. Die hierzu korrespondierende Motivation
ist die Abwesenheitsmotivation.
14
Vgl. Heckhausen (1989), S. 9-10.
15
Vgl. ebenda, S. 10.
16
Vgl. Scheffer / Kuhl (2006), S. 9.
17
Vgl. Albs (2005), S. 12.
18
Vgl. ebenda, S. 13.
- 8 -
2.2.2. Intrinsische vs. extrinsische Motivation
In der Psychologie wird Motivation in zwei Formen des Auftretens unterteilt. Die
erste Form wird als intrinsische Motivation bezeichnet. Sie schreibt die
Beweggründe des Handelns dem eigenen Antrieb eines Individuums zu.
Intrinsisch motivierte Handlungen erfolgen somit von innen her, durch Anreize,
die von einer Aufgabe ausgehen.
19
Intrinsisch motivierte Handlungen sind also
eher hedonistischer Natur. Sie bieten positive Empfindungen, wie bspw. Spaß,
Interesse oder Zufriedenheit durch die Tätigkeit. Die Sicherung biologischer
Grundbedürfnisse des Individuums oder die Furcht vor Bestrafung, welche
eigentlich wichtige Determinanten motivierten Handelns sind, spielen bei
intrinsischer Motivation keine Rolle.
20
Die Handlung selbst stellt eine Belohnung
für das Individuum dar. Beispielhaft hierfür wäre die Ausübung eines Hobbies,
welches man nur zum Spaß betreibt.
21
Kontrastiert wird die intrinsische- durch die extrinsische Motivation, bei welcher
Handlungen eben nicht aus eigenem Antrieb heraus erfolgen. Sie müssen von
außen her angeregt werden. Es bedarf es also äußerer Anlässe, wie beispielsweise
Anerkennungen, Belohnungen, Strafen oder Zwänge.
22
Die Befriedigung ergibt
sich sodann aus den Folgen der Handlung. Die Handlung ist nur das Mittel für
einen anderen Zweck. Als Beispiel wäre eine Tätigkeit anzuführen, die nur für die
Einkommenserzielung ausgeübt wird. Die Einkommenserzielung wäre somit die
angestrebte Folge des Handelns.
23
Man kann Handlungen in endogene-, bei denen intrinsische Anreizwerte höheres
Gewicht haben, sowie exogene Handlungen, bei denen extrinsische Anreize
dominieren, unterscheiden. Eine interessante Randnotiz ist, dass in Studien eine
Korrumpierung intrinsischer Motivation durch Zugabe extrinsischer Bekräfti-
gungen festgestellt werden konnte. Demnach sank bei Testpersonen kontinuierlich
ihre ursprünglich ausschlaggebende intrinsische Motivation für eine Aufgabe,
wenn sie für die Aufgabenerfüllung auch extrinsische, insbesondere materielle,
Belohnungen erhielten. Sie erledigten dann die Aufgabe nur noch um der
Belohnung willen, wobei erwartete Belohnungen stärker korrumpierten als
unerwartete.
24
19
Vgl. Albs (2005), S. 15.
20
Vgl. Sansone / Harackiewicz (2000), S. 1-2.
21
Vgl. Mook (1996), S. 574-575.
22
Vgl. Albs (2005), S. 15.
23
Vgl. Nerdinger (1995), S. 51.
24
Vgl. Heckhausen (1989), S. 461.
- 9 -
2.2.3. Das Handlungsphasenmodell der Motivation
Abbildung 1: Das Handlungsphasenmodell der Motivation von Heckhausen
25
Wie durch Motivation im Individuum Handeln erzeugt wird, und wie das Handeln
abschließend bewertet wird, soll an dieser Stelle kurz erklärt werden. Die
Erklärung folgt dabei dem auf Abbildung 1 dargestellten Handlungsphasenmodell
der Motivation von Heckhausen, auch bekannt als das Rubikon-Modell.
Dem Modell nach lässt sich der Handlungsprozess in vier Phasen unterteilen. Die
erste Phase ist die Intentionsbildung, in welcher zwei Faktoren unmittelbar
wechselseitig auf die Motivation zur Handlung einwirken. Diese Faktoren sind
zum Ersten individuelle Merkmale einer Person, die Motive, und zum Zweiten
Merkmale der aktuell wirksamen Situation, in welcher die individuellen Motive
durch bestimmte Anreize aktiviert werden.
26
Es entsteht sodann eine motivationale Tendenz im Individuum, ein bestimmtes
Ziel erreichen zu wollen. Die Stärke der dieser Tendenz drückt gewissermaßen
den Nutzen der präferierten Handlungsalternative aus. Werden in einer Situation
mehrere Motive aktiviert, so können auch unterschiedliche motivationale
Tendenzen
parallel wirksam sein. In der Regel wählt das Individuum dann jene
Handlungsalternative, die mit der stärksten Tendenz verbunden ist. Bei dieser
harmonieren seine persönlichen Motive und die Anreize der Situation am besten.
Dadurch können im Umkehrschluss auch unerledigte- oder unterbrochene
Motivationstendenzen im Individuum vorliegen. Besteht aber für eine schwächere
Tendenz eine besonders günstige Gelegenheit oder ein bestimmter Zwang, so
kann sie auch einer dominanten Tendenz vorgezogen werden. Im Grunde
entscheidet das Individuum immer selbst, welche Motivationstendenz es
realisieren möchte.
27
25
Vgl. Nerdinger (1995), S. 75.
26
Vgl. ebenda, S. 12.
27
Vgl. Heckhausen (1989), S. 11-12.
1.Phase
Motivation
Wählen
(prädezisional)
2.Phase
Volition
Zielsetzung
(präaktional)
3.Phase
Volition
Handeln
(aktional)
4.Phase
Motivation
Bewerten
(postaktional)
- 10 -
Um sein Handlungsziel zu erreichen, wählt das Individuum eine Handlungs-
alternative. Die Bewertung der Alternativen, und die letztendliche Entscheidung
für eine derselben, lassen sich beispielsweise über die VIE-Theorie von Vroom
erklären.
28
Auf diese Theorie wird im dritten Kapitel genauer eingegangen. Mit
der Bildung der Intention, d.h. der Handlungsabsicht, und dem Bereitstellen von
Energie für die gewählte Handlungsalternative ist sodann die erste Phase der
Motivation abgeschlossen.
Der Name Rubikon bezieht sich auf die Annahme, dass mit der Entscheidung für
eine Handlungsalternative, dem Übergang zwischen Phase eins und Phase zwei,
der Rubikon überschritten wird. Die Metapher führt zurück auf Julius Caesar, der
einst den Fluss Rubikon überquerte und dann jeden Blick zurück vermied. Das
bedeutet, dass die getroffene Entscheidung nicht angezweifelt wird. Alle Energie
wird fortan in die Realisierung der Intention investiert.
29
Die Umsetzung der Intention, d.h. die Erklärung des Handelns, ist Gegenstand der
zweiten und der dritten Phase des Motivationsprozesses. Hier spielen Volitionen
eine Rolle. Das Handeln wird durch Willensprozesse und Gefühle gesteuert. Es
kann nicht durch rationale Erwartungs-mal-Wert-Theorien erklärt werden.
30
Diese
Willenshandlungen entstehen dadurch, dass sich ein Individuum ein bestimmtes
Ziel vorstellt, es diesem Ziel in einem bewussten Urteilsprozess gedanklich
zustimmt und dann der Handlung zur Herbeiführung des Ziels seine Energie
verleiht. Wichtig ist bei der Volitionstheorie, dass sich das Individuum selbst,
durch seine bewusste Zustimmung, als Ursache der zielgerichteten Handlung
erkennt.
31
Die präaktionale Volitionsphase verkörpert dabei die Wartezeit zwischen der
Intentionsbildung und der Handlungsausführung. Zudem werden in dieser Phase
die Handlungsziele konkretisiert. Es findet immer nur eine Intention zur gleichen
Zeit Zugang zum Handeln. Daher muss die Frage, welche Intention die Richtige
ist, entschieden werden. Zumeist determiniert eine besondere Gelegenheit, welche
Intention initiiert wird, d.h. welche Intention zuerst zum Zuge kommt.
32
Ist diese Gelegenheit zur Realisierung der Intention gekommen, beginnt sodann
die aktionale Volitionsphase. Hier werden durch Kontrolle und Regulierung die
Intensität und die Ausdauer des Handelns festgelegt. Handlungskontrolle bezieht
28
Vgl. Dingler (1997), S. 26.
29
Vgl. Nerdinger (1995), S. 77.
30
Vgl. ebenda, S. 105.
31
Vgl. ebenda, S. 12-15.
32
Vgl. Heckhausen (1989), S. 12.
- 11 -
sich auf die persistente Verfolgung der Intention bis zur Erfüllung, auch wenn
andere, konkurrierende Intentionen auf Erfüllung drängen. Regulierung bedeutet
dagegen, dass das Individuum seine Ziele auch in unterschiedlichen Situationen
und Kontexten verfolgt.
33
In der vierten Phase des Motivationsprozesses, der postaktionalen Phase, bewertet
das Individuum die erzielten Handlungsergebnisse. Diese Bewertung kann
Zufriedenheit oder Unzufriedenheit herbeiführen. Zufriedenheit entsteht durch die
Erfüllung oder die Antizipation der Erfüllung von Bedürfnissen. Sie ist demnach
das Resultat der Befriedigung aktivierter Motive. Daher kann man Zufriedenheit
als eine Funktion der Motivation ansehen.
34
Entscheidend für die Zufriedenheit ist auch, inwiefern das Individuum die Erfolge
internalisiert, also auf eigenes Können und Anstrengungen zurückführt, oder
externalisiert, d.h. Erfolge den Leistungen anderer Personen zuschreibt. Diese
Bewertung kann sich daraufhin auch auf das künftige Aktivitätsniveau des
Individuums auswirken. Erfolge bzw. Misserfolge verändern nämlich in der Regel
die Erwartungen und Bewertungen künftiger Handlungsergebnisse.
Es sind sodann sämtliche Handlungsphasen des Rubikon-Modells abgeschlossen.
An dieser Stelle setzt direkt der nächste Handlungsprozess an, welcher wiederum
mit der Intentionsbildung beginnt.
35
2.3.
Fehlzeit
2.3.1. Abgrenzung zwischen verschiedenen Fehlzeiten
Die einschlägige Literatur lässt weitgehend Konkordanz bei der Definition des
Terminus Fehlzeiten vermissen.
36
Aus diesem Grund soll der Begriff an dieser
Stelle so beschrieben werden, wie er im weiteren Verlauf der Arbeit gebraucht
wird. Nach Bitzer (1999) sind Fehlzeiten ,,[...] diejenigen Arbeitszeiten, die dem
Unternehmen fehlen, auf die das Unternehmen aber einen Anspruch hat."
37
Schläfli (1997) bezeichnet Fehlzeiten als jene Ausfallzeiten, in denen ein Arbeit-
nehmer seinen Verpflichtungen aus persönlichen Gründen nicht nachkommt. Sie
treten zumeist unvermittelt, also ohne Vorankündigung, auf. Ferner sind sie nicht
33
Vgl. Nerdinger (1995), S. 81-82.
34
Vgl. Dingler (1997), S. 29.
35
Vgl. Nerdinger (1995), S. 85-86.
36
Vgl. Brandenburg / Nieder (2003), S. 15.
37
Bitzer (1999b), S. 1.
- 12 -
durch gesetzliche, tarifliche, individuelle oder betriebliche Vereinbarungen
festgeschrieben.
38
Diese Arbeit schließt sich der Definition von Marr (1996) an, wonach Fehlzeit ein
ursachenneutraler Begriff ist, der lediglich den in Tagen gemessenen Anteil der
Abwesenheit eines Arbeitnehmers an seiner Sollarbeitszeit widerspiegelt.
39
Abbildung 2: Klassifizierung von Fehlzeiten
40
Abbildung 2 illustriert die zu dieser Definition passende Zusammensetzung des
Gebildes Fehlzeiten. Wie ersichtlich, fallen unter diese Definition auch gesetzlich
geregelte Abwesenheiten. Diese umfassen vor allem tarifliche- und gesetzliche
Freistellungen von Mitarbeitern, beispielsweise bei Schwangerschaftsfristen,
Hochzeitstagen, Wehrübungen oder für den Beisitz in Gerichtsverhandlungen. Die
Befreiung für Kuren und Rehabilitationsmaßnahmen nach Krankheiten erklärt
sich selbst. Eine entschuldigte Fehlzeit liegt beispielsweise vor, wenn ein
Mitarbeiter mit Einverständnis des Arbeitgebers, innerhalb der Arbeitszeit einen
Arzt aufsucht. Von unentschuldigten Fehlzeiten spricht man immer dann, wenn
keine Begründung des Fehlens vorliegt. Daher sollen an dieser Stelle auch keine
Beispiele angeführt werden. Unentschuldigte Fehlzeiten machen in der Praxis
auch lediglich einen vernachlässigbar geringen Anteil der Gesamtfehlzeiten aus.
Die bedeutendste Größe unter diesen Gesamtfehlzeiten ist mit knapp 50 % der
Krankenstand.
41
38
Vgl. Schlaefli (1997), S. 18.
39
Vgl. Marr (1996), S. 16.
40
Vgl. Brandenburg / Nieder (2003), S. 17.
41
Vgl. Marr (1996), S. 18-19.
Fehlzeiten
Kuren,
Rehabili-
tation
Kranken-
stand
Entschul-
digte
Fehlzeiten
Unent-
schuldigte
Fehlzeiten
medizinische
Notwendigkeit
motivations-
bedingte
Abwesenheit
Gesetzliche
Regelungen
- 13 -
Zum Krankenstand zählen alle Fehlzeiten, bei denen Arbeitnehmer ihre Abwesen-
heit mit Arbeitsunfähigkeit (AU) begründen und gegebenenfalls durch ärztliches
Attest legitimieren.
42
Ein Arbeitnehmer ist nämlich an den ersten drei Krankheits-
tagen gesetzlich nicht zur Vorlage einer AU-Bescheinigung verpflichtet.
43
Auch
Krankheit, welche allein auf Aussage des Arbeitnehmers beruht, wird in den
Krankenstand eingerechnet. Insgesamt ist der Begriff Krankenstand ursachen-
bezogen. Er lässt sich in medizinisch notwendige Abwesenheit (echte Arbeits-
unfähigkeit) und motivationsbedingte Abwesenheit unterteilen. Der medizinisch
notwendige Krankenstand setzt sich aus Verletzungen sowie organischen- und
psychischen Krankheiten zusammen.
Der Gesundheitszustand ist jedoch nicht objektiv bestimmbar. Das Kontinuum
zwischen Gesundheit und Krankheit ist eine extrem subjektive Grauzone. Manche
Experten behaupten plakativ, dass fast der gesamte Krankenstand als motivations-
bedingt angesehen werden könnte. Eine subjektiv empfundene Arbeitsunfähigkeit
könnte nahezu immer als Entscheidung des Mitarbeiters, bzw. als Ausdruck
mangelnder Motivation, interpretiert werden.
44
Diese Einschätzung erscheint
allerdings äußerst polemisch. Man bedenke dazu lediglich Arbeitsunfähigkeiten,
welche auf objektiv schwerwiegende Verletzungen zurückzuführen sind.
In dieser Arbeit soll auch das subjektive Unwohlsein, d.h. ein ,,sich krank fühlen"
ohne objektiv vorliegende Krankheitssymptome, zum medizinisch notwendigen
Krankenstand zählen. Dadurch wird die Abgrenzung zum motivationsbedingten
Fehlen erleichtert. Dieses lässt sich dann ausschließlich durch eine bewusste
Entscheidung zum Fehlen, ohne gesundheitliche Einflüsse, charakterisieren.
Allein der mit Attest legitimierte betriebliche Krankenstand macht in Deutschland
durchschnittlich etwa 3,5 % der Sollarbeitszeit aus. Dabei ist er, gemäß einer
Studie des Bundesministeriums für Gesundheit, zwischen den Jahren 2000 und
2007 von 4,18 % auf 3,16 % gesunken (Siehe Abbildung 3).
Dabei muss beachtet werden, dass jene Fehltage in dieser Krankenstandsstatistik
der Krankenkassen unberücksichtigt sind, für welche die Arbeitnehmer keine AU-
Bescheinigung vorgelegt haben. Problematisch ist auch, dass nur ganze Fehltage
als Fehlzeiten erfasst werden. Fehlen am Arbeitsplatz kann sich aber auch darin
äußern, dass Mitarbeiter notorisch zu spät zur Arbeit erscheinen, zu früh den
Arbeitsplatz verlassen oder die Länge ihrer Pausen überstrapazieren. Auch in
42
Vgl. Bitzer (1999b), S. 1.
43
Vgl. Bährle (1998), S. 113.
44
Vgl. Bueren (2001), S. 70-71.
- 14 -
diesen Fällen geht natürlich Arbeitszeit verloren. Diese Minderleistung wird aber
oftmals nicht statistisch erfasst, obwohl Organisationen durch sie ein größerer
Schaden entstehen kann, als durch die ganztägige Abwesenheit vereinzelter
Mitarbeiter.
45
Krankenstand in der gesetzlichen Krankenversicherung
0
1
2
3
4
5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
%
Krankenstand
Abbildung 3: Krankenstand in der GKV in Deutschland 2000-2007
46
2.3.2. Absentismus
Motivationsbedingte Fehlzeiten sind nur eine Teilmenge des Krankenstandes.
Somit dürfen sie nicht mit den Termini Fehlzeiten bzw. Krankenstand gleich-
gesetzt werden. Nieder (2003) spekuliert, dass motivationale Abwesenheiten etwa
40% des gesamten Krankenstandes ausmachen.
47
In dieser Arbeit soll für motivationsbedingte Fehlzeiten synonym der Begriff
Absentismus gebraucht werden. Dieser beschreibt das Phänomen der Arbeits-
unwilligkeit, ,,[...] die reichen kann von einer von Krankheit kaum abgrenzbaren
psychologischen ,,Flucht aus dem Felde" bis zum willentlichen verdeckten Bruch
des Arbeitsvertrages [...]."
48
Besonders treffend bezeichnen dies Brinkmann und
Stapf durch ihre Formulierung ,,Bruch des psychologischen Arbeitsvertrages"
durch den Mitarbeiter. Als Begründung führen sie eine Reaktion des Mitarbeiters
auf die Nichterfüllung mannigfaltigster unausgesprochener- oder ausgesprochener
Erwartungen an die Organisation an.
49
45
Vgl. Marr (1996), S. 8.
46
Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (2008), S. 2.
47
Vgl. Brandenburg / Nieder (2003), S. 16.
48
Marr (1996), S. 8.
49
Vgl. Brinkmann / Stapf (2005), S. 9-10.
- 15 -
Marr (1996) hingegen definiert Absentismus als ,,(...) der gewollte Verzicht oder
die ungewollte Unmöglichkeit der Erbringung einer der Rollenerwartung ent-
sprechenden Leistung aufgrund physischer oder psychischer Abwesenheit."
50
Er
möchte sich damit von der herkömmlichen Definition distanzieren, in welcher
,,objektiv krankheitsbedingte" und ,,Krankheit vortäuschende" Fehlzeiten
voneinander abgegrenzt werden. Ferner möchte er ein Problemfeld beschreiben, in
das auch psychische Abwesenheit einbezogen wird. Dies bedeutet, dass der
Mitarbeiter zwar anwesend ist. Dennoch ist er nicht gewillt, die von ihm erwartete
Leistung zu erbringen.
51
Zweifelsohne ist das Problem der psychischen Abwesenheit von nicht unerheb-
licher Bedeutung. Gleichwohl beschränkt sich diese Arbeit auf die Analyse der
körperlichen Abwesenheit. Eine Diskussion beider Abwesenheitsformen würde
die Komplexität signifikant erhöhen. Im Rahmen dieser Arbeit wäre sodann nur
eine oberflächliche Darstellung der Problematik möglich.
Auch die bewussten Verspätungen, das zu frühe Verlassen des Arbeitsplatzes,
Pausenverlängerungen, etc. gehören zum Problembereich motivationsbedingten
Fehlens. Diese werden jedoch definitorisch ausgeklammert. Absentismus soll sich
in dieser Arbeit ausschließlich auf ganze Fehltage beziehen, die mit Krankheit
begründet werden.
Durch die Subjektivität des Wohlbefindens der Mitarbeiter, kann man lediglich
Vermutungen über den Missbrauch einer Arbeitsunfähigkeit anstellen. Als
verdächtig werden vor allem solche Fehlzeiten erachtet, die in der Form von sich
häufig wiederholenden Kurzerkrankungen von maximal 3 Tagen, also ohne die
Notwendigkeit eines ärztlichen Attests, auftreten.
52
,,Für statistische Vergleiche
wäre daher nicht nur die Gesamtheit der Fehlzeitentage heranzuziehen, sondern
auch die Anzahl der Fehlzeitenfälle und ihre jeweilige Dauer."
53
Im Bemühen um eine einheitliche Diskussionsgrundlage hat die Bundes-
vereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände nach der Auswertung einer
repräsentativen Studie neben häufig auftretenden Kurzerkrankungen diverse
weitere Orientierungshinweise ausgestaltet, welche auf einen Missbrauch von
Arbeitsunfähigkeit hindeuten.
54
50
Marr (1996), S. 16.
51
Vgl. ebenda, S. 17.
52
Vgl. Bitzer (1999b), S. 55.
53
Vgl. Marr (1996), S. 16.
54
Vgl. Bueren (2001), S. 12.
- 16 -
Einige ausgewählte Anhaltspunkte dieser Studie sind:
-
Mitarbeiter wechseln für Krankschreibungen häufig ihren Arzt
-
Erkrankung tritt auf, wenn für den Zeitraum Urlaub verwehrt wurde
-
Erkrankungen treten gehäuft an Montagen oder Freitagen auf
-
Krankheit tritt bei vorher angedeuteten familiären Problemen auf
-
Mitarbeiter bekommen Krankschreibungen von Ärzten, denen der Ruf
eines ,,Doc Holiday", d.h. ein Arzt der leichtfertig krankschreibt, anhaftet
-
Konkrete Hinweise von Kollegen des Fehlenden
-
Periodisches Auftreten von Erkrankungen, bspw. einmal pro Monat
-
Krankheit an Brückentagen
-
Erkrankung vor Kündigung oder Trennung
-
Erkrankung nach ausgesprochener Kündigung
Darüber hinaus wird heutzutage in der Wirtschaft Benchmarking zwischen
Organisationen gleicher Branchen betrieben. Das bedeutet, dass man sich mit den
Organisationen vergleicht, welche den geringsten Krankenstand der Branche
aufweisen. Man nimmt an, dass dieser minimale Krankenstand medizinisch
notwendig ist. Abweichungen nach oben sind sodann hauptsächlich
motivationsbedingtem Fehlen zuzuschreiben. Dieses Benchmarking impliziert
jedoch, dass sämtliche zum Vergleich herangezogenen Organisationen gleiche
gesundheitliche- und soziale Ausgangsbedingungen haben. In der Praxis sind die
Belegschaften in Organisationen aber derart heterogen und unvergleichbar, dass
Benchmarking als äußerst fragwürdig erscheint.
55
Man kann also zusammenfassend konstatieren, dass man auf Organisationsseite
lediglich Vermutungen über die Ursache der krankheitsbedingten Fehlzeit eines
Mitarbeiters, bzw. über die Glaubwürdigkeit seiner Arbeitsunfähigkeit, anstellen
kann. Deshalb ist der Anteil der motivationsbedingten Fehlzeiten am Kranken-
stand nur eine spekulative Größe.
55
Vgl. Bueren (2001), S. 28-29.
- 17 -
3.
Theoretische Ansätze zur Arbeitsmotivation
3.1.
Inhaltstheorien der Arbeitsmotivation
Inhaltstheorien der Motivation bedienen die Fragestellung: Was erzeugt im
Individuum ein Verhalten? Inhaltstheorien der Arbeitsmotivation beziehen sich
demzufolge auf die Faktoren, welche Arbeitsmotivation hervorrufen.
56
3.1.1. Die Zwei- Faktoren- Theorie von Herzberg
Im Jahre 1959 führte der Amerikaner Frederick Herzberg eine Untersuchung
durch, mit welcher er die Wirkungsweise betrieblicher Leistungsanreize auf die
Mitarbeiter erforschte. Seiner Meinung nach lassen sich alle Leistungsanreize in
zwei Gruppen unterteilen. Bei der ersten Gruppe spricht er von Motivatoren,
welche zu Leistung und Leistungssteigerung motivieren. Sie tragen aktiv zur
Zufriedenheit eines Mitarbeiters bei. Beispielhaft dafür sind Verantwortung,
Beförderung, Anerkennung und die Tätigkeit selbst.
Somit ist Zufriedenheit
weitgehend durch intrinsische Motivation herstellbar. Die zweite Faktorengruppe
bezeichnet Herzberg als Hygienefaktoren. Diese können zwar nicht direkt
Zufriedenheit erzeugen, helfen aber Unzufriedenheit zu vermeiden. Sie motivieren
einen Mitarbeiter bestenfalls, die von ihm erwartete Normalleistung zu erbringen.
Entsprechen die Hygienefaktoren nicht den subjektiven Erwartungen des Mit-
arbeiters, sinkt seine Leistungsbereitschaft sogar unter das Normalniveau. Den
Hygienefaktoren zuzurechnen sind beispielsweise Kontakt zu Kollegen, der
Führungsstil des Vorgesetzten, Arbeitsplatzsicherheit und die Bezahlung.
57
Hygienefaktoren stellen gewissermaßen ein notwendiges Gerüst dar. Es sind
äußere Bedingungen, die eine Organisation erzeugen muss, damit es den
Mitarbeitern möglich wird, sich selbst zu motivieren. Falls es der Organisation
nicht gelingt, ein von den Mitarbeitern erwartetes Mindestmaß bezüglich der
Hygienenefaktoren bereitzustellen, reagieren diese mit ansteigender Arbeitsun-
zufriedenheit. Selbst wenn alle Erwartungen der Mitarbeiter bezüglich der
Hygienefaktoren erfüllt sind, beginnen sie erst Arbeitszufriedenheit aufzubauen
und Engagement zu zeigen, wenn sie die positiven Motivatoren vorfinden.
58
Die
56
Vgl. Nerdinger (1995), S. 28.
57
Vgl. Herzberg / Mausner / Snydermann (1967), S. 113-114.
58
Vgl. Jost (2000), S. 31-32.
- 18 -
Messlatte für Zufriedenheit und Unzufriedenheit ist aber in jedem Fall die
Erwartungshaltung der Mitarbeiter.
59
Abbildung 4 veranschaulicht die Zweidimensionalität von Arbeitszufriedenheit
bzw. Arbeitsunzufriedenheit nach Herzberg. Die Motivatoren werden als Kontent-
faktoren
(engl. content = Inhalt) bezeichnet, weil sie sich schwerpunktmäßig auf
den Arbeitsinhalt beziehen. Die Hygienefaktoren sind Kontextfaktoren (engl.
context = Zusammenhang), da sie eher das Arbeitsumfeld betreffen.
60
bessere Kontextfaktoren:
keine Unzufriedenheit
bessere Kontent-
schlechtere Kontent-
faktoren:
Faktoren:
Zufriedenheit
keine Zufriedenheit
schlechtere Kontextfaktoren:
Unzufriedenheit
Abbildung 4: Zwei Faktoren-Theorie der Arbeitszufriedenheit
61
Herzbergs Theorie ist häufig kritisiert worden, vor allem weil die Zuordnung
bestimmter Faktoren zu den Motivatoren oder Hygienefaktoren nicht in allen
Untersuchungen eindeutig war. So könnte man das Gehalt, nach Herzberg ein
Hygienefaktor, auch als Anerkennung, ein Motivator, interpretieren.
62
Dennoch stellt die Theorie einen Meilenstein dar, weil sie den Fokus auf die
Gestaltung der Arbeitsinhalte lenkt. Eine alleinige Betrachtung des Arbeits-
umfeldes wäre demnach defizitär.
63
59
Vgl. Albs (2005), S. 47.
60
Vgl. Fischer (1991), S. 9.
61
Vgl. Nerdinger (1995), S. 44.
62
Vgl. ebenda, S. 45.
63
Vgl. Dingler (1997), S. 27-28.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836644433
- DOI
- 10.3239/9783836644433
- Dateigröße
- 872 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg – Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Studiengang Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2010 (März)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- fehlzeiten absentismus arbeitsmotivation arbeitszufriedenheit krankenstand
- Produktsicherheit
- Diplom.de