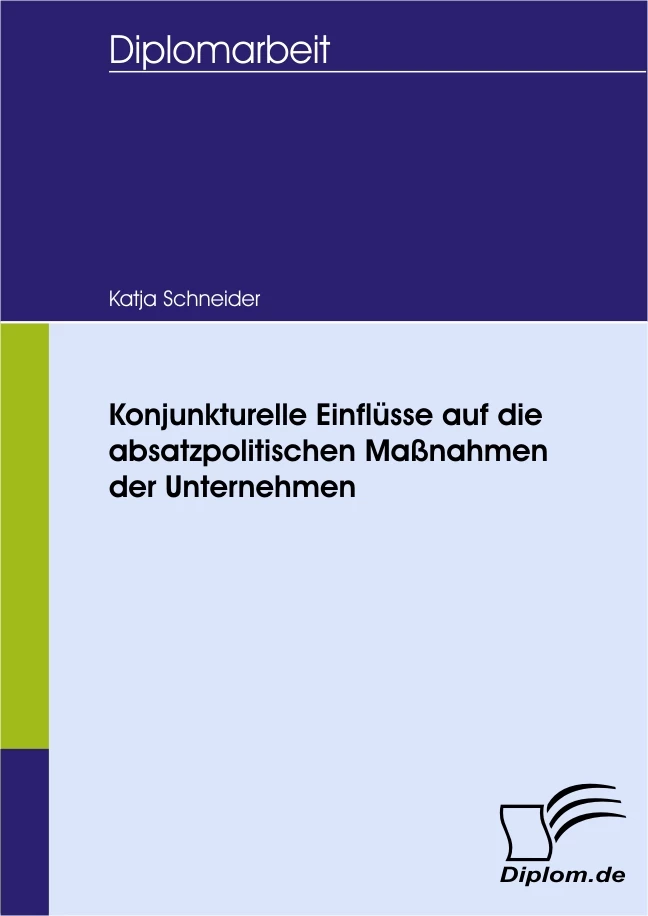Konjunkturelle Einflüsse auf die absatzpolitischen Maßnahmen der Unternehmen
©2010
Diplomarbeit
74 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die internationale Finanzkrise, die mit dem Platzen der Spekulationsblase an den Hypotheken- und Kreditmärkten seit Sommer 2007 zunächst im Banken- und Finanzsektor zu Liquiditäts- und Solvenzproblemen geführt hat, scheint sich zur schwersten weltweiten Wirtschaftskrise seit der großen Depression der 20er Jahren des letzten Jahrhunderts zu entwickeln. Die US-Immobilienkrise erfasste Ende des Jahres 2008 weltweit auch die reale Wirtschaft, was u.a. in starkem Maße Auswirkungen auf die Exportindustrie hatte. Da Deutschland zu den bedeutendsten Exportländern zählt, sind hier die Folgen der Rezession im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern besonders ausgeprägt und erfasste die gesamte Wirtschaft. Dadurch kam es zum größten wirtschaftlichen Einbruch seit der Wiedervereinigung.
Diese Ausgangssituation erfordert von jedem Unternehmen ein hohes Maß an fundiertem betriebs- und marktwirtschaftlichen Wissen, um Strategien zu entwickeln, die gewährleisten, dass das Unternehmen auch in Zeiten während und nach der Rezession seine Position auf dem Markt behaupten kann und somit die negativen Auswirkungen auf das Unternehmen abmildert bzw. eliminiert. Weiterhin bilden die durch die Rezession ausgelösten Veränderungen der Konsumentenbedürfnisse einen Ausgangspunkt für die Anpassung des Unternehmensverhaltens. Insbesondere das strategische und operative Marketing müssen angemessen und rezessionsadäquat ausgestaltet werden, um einer verstärkten Kaufzurückhaltung der Verbraucher entgegenzuwirken und das Kaufverhalten zu beleben. Innerhalb rezessiver Phasen werden die Unternehmen jedoch u.a. mit dem Problem konfrontiert, dass die Umsätze und somit die Gewinnerwartungen sinken, woraufhin sich die Investitionsneigung der Unternehmen vermindert und Einsparungen erforderlich sind, die häufig zuerst im Marketing durchgeführt werden. Somit wurde in vergangenen Krisenzeiten relativ zügig das Marketingbudget gekürzt, da diese Ausgaben nicht zweckgebunden und somit frei verfügbar sind. Dabei bieten sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Chancen an, die während der Hochkonjunktur so nicht vorhanden sind, durch die ein Unternehmen mit geeigneten Marketingentscheidungen eine verbesserte Marktposition erreichen kann.
Damit stellt sich für die Unternehmen die Frage, in welcher Weise sie diesem, durch die Krise ausgelösten Ausmaß, begegnen können. Hier setzt diese Arbeit an.
Gang der Untersuchung:
Den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit […]
Die internationale Finanzkrise, die mit dem Platzen der Spekulationsblase an den Hypotheken- und Kreditmärkten seit Sommer 2007 zunächst im Banken- und Finanzsektor zu Liquiditäts- und Solvenzproblemen geführt hat, scheint sich zur schwersten weltweiten Wirtschaftskrise seit der großen Depression der 20er Jahren des letzten Jahrhunderts zu entwickeln. Die US-Immobilienkrise erfasste Ende des Jahres 2008 weltweit auch die reale Wirtschaft, was u.a. in starkem Maße Auswirkungen auf die Exportindustrie hatte. Da Deutschland zu den bedeutendsten Exportländern zählt, sind hier die Folgen der Rezession im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern besonders ausgeprägt und erfasste die gesamte Wirtschaft. Dadurch kam es zum größten wirtschaftlichen Einbruch seit der Wiedervereinigung.
Diese Ausgangssituation erfordert von jedem Unternehmen ein hohes Maß an fundiertem betriebs- und marktwirtschaftlichen Wissen, um Strategien zu entwickeln, die gewährleisten, dass das Unternehmen auch in Zeiten während und nach der Rezession seine Position auf dem Markt behaupten kann und somit die negativen Auswirkungen auf das Unternehmen abmildert bzw. eliminiert. Weiterhin bilden die durch die Rezession ausgelösten Veränderungen der Konsumentenbedürfnisse einen Ausgangspunkt für die Anpassung des Unternehmensverhaltens. Insbesondere das strategische und operative Marketing müssen angemessen und rezessionsadäquat ausgestaltet werden, um einer verstärkten Kaufzurückhaltung der Verbraucher entgegenzuwirken und das Kaufverhalten zu beleben. Innerhalb rezessiver Phasen werden die Unternehmen jedoch u.a. mit dem Problem konfrontiert, dass die Umsätze und somit die Gewinnerwartungen sinken, woraufhin sich die Investitionsneigung der Unternehmen vermindert und Einsparungen erforderlich sind, die häufig zuerst im Marketing durchgeführt werden. Somit wurde in vergangenen Krisenzeiten relativ zügig das Marketingbudget gekürzt, da diese Ausgaben nicht zweckgebunden und somit frei verfügbar sind. Dabei bieten sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Chancen an, die während der Hochkonjunktur so nicht vorhanden sind, durch die ein Unternehmen mit geeigneten Marketingentscheidungen eine verbesserte Marktposition erreichen kann.
Damit stellt sich für die Unternehmen die Frage, in welcher Weise sie diesem, durch die Krise ausgelösten Ausmaß, begegnen können. Hier setzt diese Arbeit an.
Gang der Untersuchung:
Den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Katja Schneider
Konjunkturelle Einflüsse auf die absatzpolitischen Maßnahmen der Unternehmen
ISBN: 978-3-8366-4389-4
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Fachhochschule Nordhausen, Nordhausen, Deutschland, Diplomarbeit, 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
_______________________________________________________________
I
Inhaltsverzeichnis
Seite
Inhaltsverzeichnis...I
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis ...III
Abkürzungsverzeichnis... IV
1 Einführungskapitel ...1
1.1 Ausgangssituation und Problemstellung ...1
1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit...2
2 Konjunktur...4
2.1 Der Konjunkturbegriff und der Konjunkturzyklus ...4
2.1.1 Expansion (Aufschwung) ...5
2.1.2 Boom (Hochkonjunktur) ...6
2.1.3 Rezession (Abschwung) ...7
2.1.4 Depression (Krise) ...8
2.2 Konjunkturindikatoren...10
2.2.1 Frühindikatoren ...10
2.2.2 Präsenzindikatoren ...13
2.2.3 Spätindikatoren ...14
2.3 Erklärungsansätze für Konjunkturschwankungen...15
2.3.1 Exogene Ursachen ...17
2.3.2 Endogene Ursachen ...20
3 Absatzpolitische Maßnahmen ...23
3.1 Marketing-Konzeption ...23
3.2 Marketingmix ...24
3.2.1 Produktpolitik ...25
3.2.2 Preispolitik ...26
3.2.3 Distributionspolitik ...28
3.2.4 Kommunikationspolitik ...31
_______________________________________________________________
II
4 Marktteilnehmerverhalten und absatzpolitische Maßnahmen in der
Rezession ...35
4.1 Strategische Verhaltensweisen der Unternehmen in der Rezession..35
4.2 Ist-Analyse Marktteilnehmerverhalten in der Rezession...37
4.2.1 Konsumentenverhalten in der Rezession ...38
4.2.2 Unternehmensverhalten in der Rezession ...43
4.3 Soll-Konzept Absatzpolitische Maßnahmen in rezessiven Märkten 48
4.3.1 Anpassung der Produktpolitik ...48
4.3.2 Anpassung der Preispolitik ...50
4.3.3 Anpassung der Distributionspolitik ...54
4.3.4 Anpassung der Kommunikationspolitik ...55
5 Schlusskapitel...59
Literaturverzeichnis...61
______________________________________________________________
III
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Seite
Abb. 1:
Die Konjunkturphasen...5
Abb. 2:
Entwicklung des ifo-Geschäftsklimas (1997-2009) ...12
Abb. 3:
Entwicklung des Bruttoinlandproduktes, preisbereinigt,
2. Quartal 2009 ...14
Abb. 4:
Modell der kurzfristigen Wirtschaftsschwankungen...17
Abb. 5:
Verschiebung der Gesamtangebotskurve ...18
Abb. 6:
Verschiebung der Gesamtnachfragekurve...19
Abb. 7:
Bestandteile der Marketingkonzeption ...24
Abb. 8:
Systematisierung strategischer Verhaltensalternativen in
rezessiven Märkten ...35
Abb. 9:
Rezession 2002/2003 ...40
Abb. 10
Betroffenheit der Konsumgüterbereiche durch die Krise...42
Abb. 11
Werbeausgaben in Krisenzeiten ...44
______________________________________________________________
IV
Abkürzungsverzeichnis
BBDO
Batten, Barton, Durstine & Osborn
BDI
Baltic Dry Index
BIP
Bruttoinlandsprodukt
bzw.
beziehungsweise
CRM
Customer
Relationship
Management
(dt.
Kundenbeziehungsmanagement)
d.h.
das heißt
dt.
deutsch
DIHK
Deutscher Industrie und Handelskammertag
f.
folgende
ff.
fort folgende
GfK
Gesellschaft für Konsumforschung
i.d.R.
in der Regel
i.e.S.
im engeren Sinne
ifo
Akronym aus Information und Forschung
IHK
Industrie- und Handelskammer
OPEC
Organization of Petroleum Exporting Countries (dt. Organisation
Erdöl exportierender Länder)
o.ä.
oder ähnliches
o.V.
ohne Verfasser
PR
Public Relations (dt. Öffentlichkeitsarbeit)
S.
Seite
_______________________________________________________________
V
SB
Selbstbedienung
sog.
sogenannt
u.a.
unter anderem
USA
United States of America
usw.
und so weiter
Vgl.
Vergleich
vgl.
vergleiche
z.B.
zum Beispiel
%
Prozent
&
und
Einführungskapitel
1
1 Einführungskapitel
1.1 Ausgangssituation und Problemstellung
Die internationale Finanzkrise, die mit dem Platzen der Spekulationsblase an
den Hypotheken- und Kreditmärkten seit Sommer 2007 zunächst im Banken-
und Finanzsektor zu Liquiditäts- und Solvenzproblemen geführt hat, scheint
sich zur schwersten weltweiten Wirtschaftskrise seit der großen Depression der
20er Jahren des letzten Jahrhunderts zu entwickeln.
1
Die US-Immobilienkrise
erfasste Ende des Jahres 2008 weltweit auch die reale Wirtschaft, was u.a. in
starkem Maße Auswirkungen auf die Exportindustrie hatte. Da Deutschland zu
den bedeutendsten Exportländern zählt, sind hier die Folgen der Rezession im
Gegensatz zu anderen europäischen Ländern besonders ausgeprägt und
erfasste die gesamte Wirtschaft.
2
Dadurch kam es zum größten wirtschaftlichen
Einbruch seit der Wiedervereinigung.
3
Diese Ausgangssituation erfordert von jedem Unternehmen ein hohes Maß an
fundiertem betriebs- und marktwirtschaftlichen Wissen, um Strategien zu
entwickeln, die gewährleisten, dass das Unternehmen auch in Zeiten während
und nach der Rezession seine Position auf dem Markt behaupten kann und
somit die negativen Auswirkungen auf das Unternehmen abmildert bzw.
eliminiert.
4
Weiterhin
bilden
die
durch
die
Rezession
ausgelösten
Veränderungen der Konsumentenbedürfnisse einen Ausgangspunkt für die
Anpassung des Unternehmensverhaltens. Insbesondere das strategische und
operative Marketing müssen angemessen und rezessionsadäquat ausgestaltet
werden,
um
einer
verstärkten
Kaufzurückhaltung
der
Verbraucher
entgegenzuwirken und das Kaufverhalten zu beleben.
5
Innerhalb rezessiver
Phasen werden die Unternehmen jedoch u.a. mit dem Problem konfrontiert,
dass die Umsätze und somit die Gewinnerwartungen sinken, woraufhin sich die
Investitionsneigung der Unternehmen vermindert und Einsparungen erforderlich
sind, die häufig zuerst im Marketing durchgeführt werden.
6
Somit wurde in
vergangenen Krisenzeiten relativ zügig das Marketingbudget gekürzt, da diese
1
Vgl. o.V. Stern (2008)
2
Vgl. o.V. Focus (2009)
3
Vgl. o.V. Welt Online (2009)
4
Vgl. Böhner/Dellago/Gerszke/Tochtermann (2009), S. 10.
5
Vgl. Berndt (1994), S. 117f.
6
Vgl. Becker (2001), S. 764f.
Einführungskapitel
2
Ausgaben nicht zweckgebunden und somit frei verfügbar sind.
7
Dabei bieten
sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Chancen an, die während der
Hochkonjunktur so nicht vorhanden sind, durch die ein Unternehmen mit
geeigneten Marketingentscheidungen eine verbesserte Marktposition erreichen
kann.
8
Damit stellt sich für die Unternehmen die Frage, in welcher Weise sie diesem,
durch die Krise ausgelösten Ausmaß, begegnen können. Hier setzt diese Arbeit
an.
1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit
Den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit stellen die konjunkturellen
Einflüsse auf die absatzpolitischen Maßnahmen der Unternehmen dar.
Aufgrund der Komplexität hinsichtlich aller Konjunkturphasen sowie angesichts
der besonderen Gegebenheiten und Herausforderungen mit denen die
Unternehmen konfrontiert werden, wird in dieser Arbeit speziell die Phase der
Rezession berücksichtigt. Die Basis bildet hierbei die gegenwärtige
Wirtschaftskrise bzw. Rezession. Das Ziel besteht darin, die Zusammenhänge
zwischen der Marketingstrategie und dem ökonomischen Abschwung zu
analysieren und daraus Handlungsalternativen bzw. -empfehlungen für
Unternehmen abzuleiten.
Die Arbeit ist folgendermaßen gegliedert. Im ersten Kapitel werden die
Ausgangssituation und Problemstellung sowie das Ziel und der Aufbau dieser
Arbeit dargestellt. Im zweiten Kapitel werden zunächst die theoretischen
Grundlagen der Konjunktur näher betrachtet. Dabei wird zu Beginn auf die
Definition
des
Konjunkturbegriffs
sowie
auf
die
vier
Phasen
des
Konjunkturzyklus' Expansion, Boom, Rezession, Depression eingegangen.
Weiterhin werden einzelne Konjunkturindikatoren innerhalb der Früh-, Präsenz-
und Spätindikatoren betrachtet, mit denen die konjunkturellen Schwankungen
prognostiziert und bestimmt werden können. Den Abschluss dieses Kapitels
bilden die möglichen Erklärungsansätze für Konjunkturschwankungen, welche
in die endogenen und exogenen Ursachen untergliedert sind. Im dritten Kapitel
7
Vgl. Meyer/Perrey/Spillecke (2009), S. 53.
8
Vgl. Böhner/Dellago/Gerszke/Tochtermann (2009), S. 10.
Einführungskapitel
3
erfolgt eine Darstellung der absatzpolitischen Maßnahmen. Zunächst erfolgt
eine Betrachtung der Marketing-Konzeption, um den Zusammenhang zwischen
Marketingzielen, Marketingstrategien und dem Marketingmix aufzuzeigen. Im
letzten
Teil
dieses
Kapitels
erfolgt
ein
Überblick
über
die
vier
Instrumentalbereiche:
die
Produkt-,
Preis-,
Distributions-
und
Kommunikationspolitik, woraufhin dieser Themenkomplex abgeschlossen wird.
Mit dem vierten Kapitel beginnt der praktische Teil dieser Arbeit. Zu Beginn wird
die Ist-Situation betrachtet. Hierbei werden zuerst die möglichen strategischen
Verhaltensweisen (prozyklisch, azyklisch, partiell-antizyklisch, antizyklisch) von
Unternehmen
in
einer
Rezession
aufgeführt
bevor
im
nächsten
Gliederungspunkt
anhand
von
Studienergebnissen
das
Markteilnehmerverhalten während der Rezessionsphase aufgezeigt wird. Dabei
erfolgt
eine
gesonderte
Betrachtung
des
Konsumenten-
und
Unternehmensverhalten. Im folgenden Gliederungspunkt wird die Soll-Situation
betrachtet, bei der Handlungsempfehlungen gegeben werden, wie die
Unternehmen vorgehen könnten bzw. sollten, um die Krise erfolgreich zu
bewältigen. Die wesentlichen Erkenntnisse dieser Arbeit werden im fünften
Kapitel zusammengefasst.
Konjunktur
4
2 Konjunktur
Wie die Wirtschaftsgeschichte und die aktuelle Situation Deutschlands es
widerspiegeln, ist ein Land nicht in der Lage die Wirtschaft dauerhaft auf einem
gesunden und stabilen Niveau zu halten. Unterschiedliche Gründe können
dafür verantwortlich sein, dass die Jahre des Aufschwungs durch Zeiträume
wirtschaftlicher Schwäche abgelöst werden.
9
Die hierfür grundlegenden
Erklärungsansätze werden im Folgenden dargestellt.
2.1 Der Konjunkturbegriff und der Konjunkturzyklus
Der Begriff ,,Konjunktur" (lat. conjungere ,,zusammenbinden")
10
bezeichnet kurz-
bis mittelfristige zyklische Bewegungsvorgänge, d.h. den Gesamtprozess des
wiederkehrenden Auf- und Abschwungs, der ökonomischen Aktivitäten einer
Wirtschaft.
11
,,Konjunkturzyklen sind Schwankungen in der Gesamtproduktion, dem
Gesamteinkommen und der Beschäftigung eines Landes mit einer Dauer von
üblicherweise zwei bis zehn Jahren."
12
Diese wirtschaftlichen Änderungen sind
durch ein gewisses regelmäßiges (zyklisches) Verhalten der Auf- und
Abschwungphasen gekennzeichnet.
13
Nicht zu verwechseln ist die Konjunktur
mit dem langfristigen Wachstumstrend, der in erster Linie vom technischen
Fortschritt abhängt. Die Konjunktur ist lediglich die Schwankung um den
langfristigen Wachstumstrend.
14
Keine zwei Konjunkturzyklen sind identisch und es existiert keine präzise
Formel, um die Dauer und Intensität eines Konjunkturzyklus vorherzusagen.
Jedoch lässt sich ein ,,klassisches" Grundmuster des kurzfristig schwankenden
Konjunkturverlaufs aufzeigen. Es ergibt sich ein wellenförmiger bzw. S-förmiger
Verlauf, den man entsprechend in vier Phasen unterteilt. Der Tiefpunkt heißt
Depression (Krise), dem sich der Aufschwung (Expansion) anschließt, welcher
in einem Boom (Hochkonjunktur) seinen Abschluss findet bevor es zu einer
9
Vgl. Samuelson/ Nordhaus (2005), S.661.
10
Vgl. Krommes (1972), S. 30.
11
Vgl. Peto (2008), S. 191.
12
Samuelson/ Nordhaus (2005), S. 1041.
13
Vgl. Baßeler/Heinrich/Utecht (2006), S.861.
14
Vgl. Siebert (2003), S. 332.
Konjunktur
5
Rezession (Abschwung) kommt (vgl. Abb. 1).
15
Im Folgenden werden die
Schwankungen der Konjunktur genauer betrachtet.
2.1.1 Expansion (Aufschwung)
Die Expansion als Zuwachs des Wirtschaftswachstums kennzeichnet den Start
und die erste Phase des Konjunkturzyklus. Diese Phase ist durch eine erst
langsame und dann zunehmende Nachfrage nach Produkten und
Dienstleistungen charakterisiert. Um diese Nachfrage zu befriedigen, steigern
die Unternehmen ihre Produktion. Durch die verbesserte Auslastung der
Produktionskapazitäten sinken die Stückkosten. Infolge der anwachsenden
Nachfrage
tätigen
die
Unternehmen
vermehrt
Investitionen
in
Produktionsfaktoren wie Personal, Maschinen und Rohstoffe, um ihre
Produktionskapazitäten auszuweiten.
16
Um diese Investitionen durchführen zu
können, nehmen die Unternehmen vermehrt Kredite auf. Es erfolgt ein relativ
geringer
Preisanstieg
und
die
Unternehmer
erzielen
aufgrund
der
angekurbelten Nachfrage durch die anwachsende Konsumentenstimmung
zunehmend steigende Gewinne. Folglich fordern die Gewerkschaften mehr
Lohn, um die Realeinkommen der Arbeitnehmer zu sichern, so dass die Löhne
15
Vgl. Baßeler/Heinrich/Utecht (2006), S.861.
16
Vgl. Koch/Czogalla (1999), S. 367.
Abbildung 1
Die Konjunkturphasen
Quelle: Mamberer, F. / Seider, H. (2009)
Konjunktur
6
aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage ansteigen. Da die Inflationsrate
zunimmt, liegt die Aufgabe der Europäischen Zentralbank darin die Leitzinsen
17
anzuheben, um die Kredite sukzessive zu verteuern. Diese positive Nachricht
hat zur Folge, dass die Aktienkurse steigen.
18
In dieser Phase ist die
Grundstimmung in der Wirtschaft sehr optimistisch.
2.1.2 Boom (Hochkonjunktur)
Die Aufwärtsbewegung erreicht in der Boomphase ihren Höhepunkt. Diese
charakterisiert
sich
durch
voll
ausgelastete
oder
überlastete
Produktionskapazitäten der Unternehmungen, da mehr Güter erforderlich sind
als produziert werden, d.h. es herrscht eine starke gesamtwirtschaftliche
Nachfrage, die zu Kapazitätsengpässen führen kann.
19
Unter einer normalen
Auslastung der Kapazitäten ist die Menge an Gütern und Dienstleistungen zu
verstehen, die eine Wirtschaft während einer normalen wirtschaftlichen Lage
bereitstellen kann. Folglich ist es in dieser Phase nicht möglich noch mehr zu
produzieren als im derzeitigen Moment. Durch die Marktmechanismen steigen
die Preise und die Teuerung macht sich zunehmend bemerkbar. Es werden nur
noch jene Kunden beliefert, die bereit sind einen höheren Preis zu bezahlen.
Weiterhin herrscht Vollbeschäftigung oder Überbeschäftigung und auch die
Maschinenlaufzeiten werden erhöht, wodurch die Phase der Hochkonjunktur
sowohl durch steigende Löhne als auch durch erhöhte Produktions- und
Stückkosten gekennzeichnet ist.
20
Die Gewinne der Unternehmen steigen in die
Höhe und führen zu weiteren Investitionen, was wiederum eine erhöhte
Kreditnachfrage mit sich bringt. Um einer Überhitzung der Konjunktur entgegen
zu wirken, wird das Zinsniveau angehoben, um die umlaufende Geldmenge zu
verringern. Dies hat zur Folge, dass die Finanzierung von Investitionen
erschwert wird.
21
Die Stimmung verschlechtert sich in dieser Phase allmählich,
was u.a. dazu führt, dass die Aktienkurse sinken, wenn die Investoren die
nächste Phase des Konjunkturzyklus, die Rezession, in Ihre Erwartungen mit
aufnehmen.
22
17
Der Zinssatz zum dem die Zentralbank den Geschäftsbanken Geld leiht. Dadurch wird Einfluss auf die
im Umlauf befindliche Geldmenge und die Zinsentwicklung genommen.
18
Vgl. Blum (1994), S. 347.
19
Vgl. Siebert (2003), S. 334.
20
Vgl. Kampmann/Walter (2001), S. 13.
21
Vgl. Siebert (2003), S. 334.
22
Vgl. Samuelson/Nordhaus (2005), S. 662.
Konjunktur
7
2.1.3 Rezession (Abschwung)
Die Konjunktur hat ihren Gipfel überschritten und es beginnt die dritte Phase
des Zyklus, der Abschwung. Die Konsumenten sind verunsichert und somit geht
die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen merklich zurück und das
BIP sinkt. Durch den Nachfragerückgang sinkt auch das Preisniveau. Zudem
gehen die Erträge der Unternehmen aufgrund der gestiegenen Kosten, der
verminderten Investitionen sowie dem einsetzenden Sparverhalten zurück. Die
Lager füllen sich, da nur noch wenige bis keine Abnehmer zur Verfügung
stehen. Die verringerte Nachfrage führt dazu, dass die Produktion zurück geht
und weniger Arbeitnehmer benötigt werden. Aufgrund dessen sind viele
Unternehmen
gezwungen
Kurzarbeit
anzumelden
und
später
auch
Entlassungen, überwiegend bei Leiharbeitern, durchzuführen, was eine
vermehrte Arbeitslosigkeit mit sich bringt.
23
Da die Zentralbanken durch die
Regulierung der Zinsen oder der Geldmenge Einfluss auf die Nachfrage
nehmen können, wird i.d.R. versucht in rezessiven Phasen die Ausgaben durch
eine Erhöhung der Geldmenge anzuregen.
24
Im Bezug auf die aktuelle Wirtschaftskrise betrieb die US-Notenbank Federal
Reserve zum Zeitpunkt eines konjunkturellen Abschwungs im Jahr 2001 eine
Niedrigzinspolitik, um einer möglichen Rezession entgegenzuwirken. Dadurch
sollten die Unternehmen zum Investieren angeregt werden, um die Wirtschaft
zu beleben. Die Terroranschläge des 11. September 2001 sorgten für eine
zusätzliche Anspannung der Situation in der internationalen Finanzsektor und
einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage.
25
Der frühere US-
Zentralbankchef
Alan
Greenspan
führte
folglich
eine
intensivere
Niedrigzinspolitik, um für eine Stabilisierung der Finanzmärkte zu sorgen und
die Wirtschaft mit billigem Geld anzukurbeln. Trotz eintretender verbesserter
Lage wurde der Leitzins mehrfach gesenkt und diese Politik beibehalten. Seit
40 Jahren fiel der Leitzins erstmals von Mitte 2001 bis 2003 kurzfristig auf einen
Tiefstand von 1,0%. Dadurch waren die Kredite günstiger als je zuvor und es
folgten zunehmend Investitionen.
26
Letztendlich wurde damit jedoch die Basis
23
Vgl. Samuelson/Nordhaus (2005), S. 662.
24
Vgl. Kyrer/Penker (2000), S. 111.
25
Vgl. Riecke (2001), S. 4.
26
Vgl. Hajek (2007), S. 154.
Konjunktur
8
für die aktuelle Wirtschaftskrise gelegt, da die Banken zum Zeitpunkt einer
schwachen Konjunktur auch Kleinstverdienern den Traum von einem eigenen
Heim erfüllen konnten.
27
Größtenteils handelte es sich bei der Finanzierung der
Immobilien durch den Anleger um sogenannte ,,Subprimes". Dies sind Kredite,
die an nichtsolvente Hauskäufer und -bauer vergeben werden. Aufgrund der
barrierefreien Zugänglichkeit an diese Kredite erlangte die Vergabe der
,,Subprimes" zügig eine steigende Anzahl.
28
In einer Rezession beschließen Regierungen Hilfspakete, um einer
Abwärtsspirale
entgegenzuwirken.
Diese
können
z.B.
Subventionen,
Steuersenkungen o. ä. sein. Auch in der aktuellen Krise, die vorerst
überwiegend im Finanzbereich herrschte und zusehends auf die Realwirtschaft
übergriff, schnürte die Regierung ein immenses Hilfspaket.
29
Somit beschloss
die deutsche Regierung nach dem Konjunkturpaket I ,,Beschäftigungssicherung
durch Wachstumsstärkung" Anfang des Jahres 2009 das Konjunkturpaket II in
Höhe von rund 50 Milliarden Euro. Es beinhaltet Investitionen, Wirtschaftshilfen
und eine Abwrackprämie, um die Nachfrage nach Autos anzukurbeln und
Steuersenkungen, um die Bürger und die Wirtschaft weiterhin zu entlasten.
30
2.1.4 Depression (Krise)
Den Tiefpunkt erreicht der Konjunkturzyklus in der Depression. Bei den
Konsumenten und Unternehmen herrscht eine desolate Stimmung. Die Phase
der wirtschaftlichen Depression ist durch eine niedrige Nachfrage aus dem In-
und Ausland in Bezug auf die geringe Auslastung der Kapazitäten
gekennzeichnet. Es müssen Überkapazitäten abgebaut werden und es kommt
vermehrt zu Entlassungen, was zu einer Arbeitslosigkeit auf hohem Niveau
führt. Weiterhin sinken die Einkommen der Haushalte und damit geht auch die
Nachfrage nach Konsumgütern stark zurück. Die Preise stagnieren oder sinken,
wodurch sich die Gewinne der Unternehmen verringern und kein Anreiz für
neue Investitionen besteht. Demzufolge ist die Investitionsnachfrage
rückläufig.
31
Dies kann zur Insolvenz führen.
32
Durch kontinuierliche
27
Vgl. Bischoff (2008), S. 19.
28
Vgl. Bischoff (2008), S. 7.
29
Vgl. Böschen u.a. (2009), S. 88.
30
Vgl. o.V. Handelsblatt (2009b)
31
Vgl. Siebert (2003), S. 335.
32
Vgl. Kampmann/Walter (2001), S. 13.
Konjunktur
9
Zinssenkungen kann die Nationalbank versuchen die Investitionen wieder
attraktiv zu machen, um einer möglichen Deflation entgegen zu wirken.
33
Die Eigenschaften der einzelnen Phasen werden in der Realität von weiteren
Einflüssen geprägt. Ebenso ist eine klare Abgrenzung der einzelnen Zyklen
nicht möglich, da die Übergänge fließend erfolgen.
Bei der gegenwärtigen Wirtschaftskrise handelt es sich jedoch um keine
typische zyklische Krise, die eine Wirtschaft alle paar Jahre durchläuft und
somit auch um keine ,,normale" Rezession.
34
In den USA boomte in den
vergangenen Jahren der Immobilienmarkt. Während die Häuserpreise immer
weiter stiegen vergaben die Banken Millionen Kredite an die Käufer von
Häusern. Ein beachtlicher Teil der Immobilienkredite wurde an Familien mit
schlechter Zahlungsfähigkeit vergeben, sog. Subprime-Kredite, die ohne
ausreichendes Einkommen den Kauf von Häusern mit Krediten finanzierten. Die
meisten Finanzinstitute behielten die vergebenen Darlehen allerdings nicht in
ihren eigenen Büchern. Die Kredite wurden zu neuen ,,Finanzprodukten"
gebündelt, verbrieft und an Investmentfonds und Banken weltweit verkauft.
Diese neuen ,,Finanzprodukte" setzten sich aus Krediten mit guter und
schlechter Qualität zusammen und wurden auch von deutschen Banken über
ihre Töchter erworben. Als dann in den USA die Hauspreise sanken und die
Rückzahlung vieler notleidender Hypotheken über den Verkauf der Häuser
aussichtslos wurde, verfiel der Wert der Finanzprodukte. Die Vielzahl der
riskanten Geschäfte führte dazu, dass aus der US-Immobilienkrise eine Krise
des gesamten Finanzsystems wurde.
35
Da viele Banken Wertberichtigungen
und damit verbunden enorme Verluste hinnehmen mussten, zogen sie Geld von
den Kapitalmärkten ab und blockierten Finanz- und Kreditflüsse in einem
großen Umfang. Die Finanzkrise entwickelte sich so zu einer Liquiditätskrise
und erfasste damit die reale Wirtschaft.
36
Die Krise sollte als Systemkrise, eine
Krise des Finanzsystems begriffen werden, die überwiegend durch
menschliches Versagen ausgelöst wurde, da die Verantwortlichen im eigenen
Interesse handelten und dadurch das ganze System in Gefahr brachten.
33
Vgl. Siebert (2003), S. 335.
34
Vgl. Geier (2009)
35
Vgl. Brück/Detering/Jeimke-Karge/Stroisch (2009)
36
Vgl. Fischer/Ramthun/Schnitzler (2009)
Konjunktur
10
Letztendlich wurde somit der internationale wirtschaftliche Abschwung durch die
Finanzkrise hervorgerufen.
37
2.2 Konjunkturindikatoren
Um die Stärke der konjunkturellen Schwankungen prognostizieren, bestimmen
und bestätigen zu können, bedient man sich der entsprechenden Indikatoren.
38
Mit Hilfe von statistischen Zeitreihen dieser Beobachtungsgrößen sind die
Fluktuationen der Wirtschaftsaktivität erkennbar.
39
Die Indikatoren können unter
der üblichen Berücksichtigung des zeitlichen Aspekts in drei Gruppen eingeteilt
werden
40
:
·
Frühindikatoren,
·
Präsensindikatoren und
·
Spätindikatoren.
2.2.1 Frühindikatoren
Die
Frühindikatoren
zeigen
schon
frühzeitig
eine
mögliche
Konjunkturentwicklung auf, was für die Planung und den Einsatz
wirtschaftspolitischer Maßnahmen von großer Bedeutung ist. Deshalb besitzen
sie in der Wirtschaft einen hohen Stellenwert.
41
Wichtige
Zeitreihen bezüglich
der Frühindikatoren, die vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht werden,
sind u.a. die Reichweite der Auftragseingänge (Zahl der Monate, für die
Aufträge vorhanden sind) bei den Investitionsgüterindustrien sowie die
Baugenehmigungen
im
Hochbau.
Mit
beginnender
Stagnation
der
Auftragseingänge ist eine annähernd genaue Aussage über den Zeitpunkt, an
dem Produktion und Beschäftigung zurückgehen, möglich. Auch das
Baugewerbe liefert verlässliche Hinweise, denn Bautätigkeiten sind stark
abhängig von der konjunkturellen Entwicklung. Sinkt die Zahl der
Genehmigungen, ist dies in der Regel ein wichtiger Hinweis für eine
Abwärtsbewegung.
42
37
Vgl. Geier (2009)
38
Vgl. Peto (2008), S. 194.
39
Vgl. Neubäumer/Hewel (1998), S. 368.
40
Vgl. Peto (2008), S.194.
41
Vgl. Bartling/Luzius (1998), S. 250.
42
Vgl. Woll (2003), S. 634f.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783836643894
- DOI
- 10.3239/9783836643894
- Dateigröße
- 911 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Nordhausen – Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2010 (März)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- rezessionsmarketing wirtschaftskrise finanzkrise konjunktur absatzpolitische maßnahmen
- Produktsicherheit
- Diplom.de