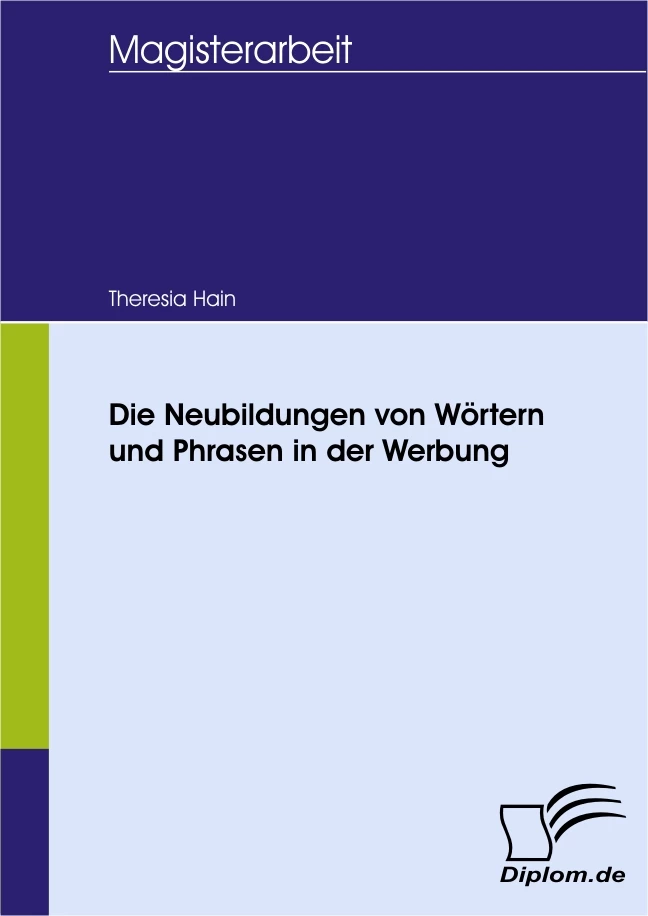Die Neubildungen von Wörtern und Phrasen in der Werbung
©2009
Magisterarbeit
156 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Werbung ist aus unserem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken. Ständig werden wir mit Werbeanzeigen in Zeitungen oder Zeitschriften, Werbespots im Kino oder im Fernsehen konfrontiert. Deshalb ist sie ein zentraler Untersuchungsgegenstand in vielen Wissenschaften.
In dieser Untersuchung sollen Neubildungen der Werbesprache im Bereich der Wortbildung und Phraseologie zusammengestellt und analysiert werden. Diese Magisterarbeit stellt dabei eine linguistisch orientierte Untersuchung der Produktivität von Wortbildungstypen dar. Die Grundlage bilden Werbeslogans, die im deutschsprachigen Raum, geschaltet und veröffentlicht wurden.
Ein essentielles Ziel ist dabei die werbesprachlichen Charakteristika der formalen Wortbildung und deren Funktion und Bedeutung für die Werbesprache herauszuarbeiten. Aus diesem Grund richtet sich die Auswahl der Slogans hauptsächlich nach morphologischen Kriterien. So steht bei der Wortbildung die Komposition (Milchjieper), die Derivation (kartoffelig) und die Kontamination (knäckoladig) im Zentrum der Analyse. Bei der Komposition ist vor allem von Interesse welche Zusammensetzungen von Wortarten besonders viele Neubildungen hervorbringen und welche eher weniger. Die Derivation dagegen betrachtet die Neubildungen vor allem aus dem Blickwinkel, was das Hinzufügen von Affixen bei diesen bewirkt und ob sich auch hier bestimmte Wortgruppen besonders dominant zeigen. Dagegen soll anhand der Kontamination gezeigt werden, ob die Verschmelzung von zwei Wörtern in der Werbesprache mit der Standardsprache gleichgesetzt werden kann und welche Kontaminationstypen hierbei besonders bevorzugt werden.
Die werbesprachlichen Neubildungen sollen in dieser Arbeit zudem nicht nur nach morphologischen Gesichtspunkten analysiert werden, sondern ein weiterer Schwerpunkt bildet die semantische Analyse der Neuprägungen. Hierbei werden zum einen die semantischen Relationstypen als auch deren Beziehungen zu anderen semantischen Typen aufgezeigt. Neu ist bei diesem Ansatz, dass ausschließlich nicht-lexikalisierte Bildungen untersucht werden und daher viele der Neubildungen Mehrdeutigkeiten aufweisen.
Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Neubildung von Phrasen in der Werbesprache. Dabei steht eine konkrete Auseinandersetzung mit den von Werbetextern als stilistisches Gestaltungsmittel benutzten modifizierten Phrasen im Zentrum. Im Mittelpunkt steht dabei, die Phrasen gebrauchsbezogen zu untersuchen. Dies […]
Die Werbung ist aus unserem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken. Ständig werden wir mit Werbeanzeigen in Zeitungen oder Zeitschriften, Werbespots im Kino oder im Fernsehen konfrontiert. Deshalb ist sie ein zentraler Untersuchungsgegenstand in vielen Wissenschaften.
In dieser Untersuchung sollen Neubildungen der Werbesprache im Bereich der Wortbildung und Phraseologie zusammengestellt und analysiert werden. Diese Magisterarbeit stellt dabei eine linguistisch orientierte Untersuchung der Produktivität von Wortbildungstypen dar. Die Grundlage bilden Werbeslogans, die im deutschsprachigen Raum, geschaltet und veröffentlicht wurden.
Ein essentielles Ziel ist dabei die werbesprachlichen Charakteristika der formalen Wortbildung und deren Funktion und Bedeutung für die Werbesprache herauszuarbeiten. Aus diesem Grund richtet sich die Auswahl der Slogans hauptsächlich nach morphologischen Kriterien. So steht bei der Wortbildung die Komposition (Milchjieper), die Derivation (kartoffelig) und die Kontamination (knäckoladig) im Zentrum der Analyse. Bei der Komposition ist vor allem von Interesse welche Zusammensetzungen von Wortarten besonders viele Neubildungen hervorbringen und welche eher weniger. Die Derivation dagegen betrachtet die Neubildungen vor allem aus dem Blickwinkel, was das Hinzufügen von Affixen bei diesen bewirkt und ob sich auch hier bestimmte Wortgruppen besonders dominant zeigen. Dagegen soll anhand der Kontamination gezeigt werden, ob die Verschmelzung von zwei Wörtern in der Werbesprache mit der Standardsprache gleichgesetzt werden kann und welche Kontaminationstypen hierbei besonders bevorzugt werden.
Die werbesprachlichen Neubildungen sollen in dieser Arbeit zudem nicht nur nach morphologischen Gesichtspunkten analysiert werden, sondern ein weiterer Schwerpunkt bildet die semantische Analyse der Neuprägungen. Hierbei werden zum einen die semantischen Relationstypen als auch deren Beziehungen zu anderen semantischen Typen aufgezeigt. Neu ist bei diesem Ansatz, dass ausschließlich nicht-lexikalisierte Bildungen untersucht werden und daher viele der Neubildungen Mehrdeutigkeiten aufweisen.
Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Neubildung von Phrasen in der Werbesprache. Dabei steht eine konkrete Auseinandersetzung mit den von Werbetextern als stilistisches Gestaltungsmittel benutzten modifizierten Phrasen im Zentrum. Im Mittelpunkt steht dabei, die Phrasen gebrauchsbezogen zu untersuchen. Dies […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Theresia Hain
Die Neubildungen von Wörtern und Phrasen in der Werbung
ISBN: 978-3-8366-4360-3
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Ludwig-Maximilian-Universität München, München, Deutschland, Magisterarbeit,
2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
2
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
2
Abkürzungsverzeichnis
4
Einleitung
5
Forschungsüberblick
7
Materialbasis
10
1. Erläuterungen zum Untersuchungsgegenstand
Werbesprache
12
1.1.
Historische
Entwicklung
12
1.2.
Definition
des
Begriffs
Werbesprache
13
1.3.
Notwendigkeit
von
Neubildungen
15
1.4. Zusammenwirken von Wortbildung und Phraseologie
17
2. Wortbildung: Überblick über die produktiven Wortbildungstypen
21
3.
Komposition
23
3.1.
Begriffsbestimmung
23
3.2.
Substantivkomposition
28
3.2.1.
Nomen-Nomen
29
3.2.2.
Adjektiv
als
Erstglied
34
3.2.3.
Verb
als
Erstglied
36
3.2.4.
Sonstige
Kombinationen
38
3.3.
Adjektivkomposition
38
3.3.1.
Substantiv
als
Erstglied
39
3.3.2.
Adjektiv-Adjektiv
40
3.3.3.
Verb
als
Erstglied
41
3.3.4. Kombination mit einem Partizip
42
3.4.
Verbkomposition
42
3.5.
Zusammensetzung
vs.
Komposition
43
3.6. Zur Semantik der Komposition
44
3.7.
Zusammenfassung
48
4.
Derivation:
Begriffsbestimmung
49
4.1.
Suffigierung
50
4.2.
Präfigierung
53
4.3.
Konversion
55
4.4.
Zusammenfassung
56
3
5.
Kontamination:
Begriffsbestimmung
57
5.1.
Substantivkontamination
58
5.2.
Adjektivkontamination
59
5.3.
Verbkontamination
60
5.4. Form der Verkettung, der Überlappung und der Umschließung
61
5.5.
Zusammenfassung
63
6.
Wortneubildung
mit
dem
Produktnamen
64
7. Phraseologie
68
7.1. Funktion der Phrasen in der Werbung
68
7.2.
Klassifiktion
der
Phrasen
71
7.3. Korpusbezogene Klassifikation von Phrasen und Modifikationsverfahren
74
7.4.
Satzgliedwertige
Phrasen
75
7.4.1.
Substantivphrasen
76
7.4.2.
Verbphrasen
78
7.4.3.
Adjektivphrasen
80
7.4.4.
Phrasen
anderer
Wortart
81
7.4.5.
Zusammenfassung
82
7.5.
Satzphrasen
83
7.5.1.
Einfachsatz
85
7.5.2.
Elliptische
Satzverbindung
85
7.5.3.
Satzreihe
87
7.5.4.
Satzgefüge
87
7.5.5.
Sprichwort
89
7.5.6. Zur Semantik der Phrase
92
7.5.7.
Zusammenfassung
95
8. Charakteristika der werbesprachlichen
Neuprägungen
96
8.1. Branchenspezifische Verteilung der Neubildungen
96
8.2. Rhetorische Figuren in der Werbesprache
98
Resümee
und
Ausblick
101
Literaturverzeichnis
105
Anhang:
Korpus
4
Abkürzungsverzeichnis
ae. altenglisch
afr. afrikaans
ahd. althochdeutsch
anord. altnordisch
as. altsächsisch
g. germanisch
gt. gotisch
mhd. mittelhochdeutsch
5
Einleitung
Die Werbung ist aus unserem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken.
Ständig werden
wir mit Werbeanzeigen in Zeitungen oder Zeitschriften, Werbespots im Kino oder im
Fernsehen konfrontiert. Deshalb ist sie ein zentraler Untersuchungsgegenstand in vie-
len Wissenschaften.
In dieser Untersuchung sollen Neubildungen der Werbesprache im Bereich der Wort-
bildung und Phraseologie zusammengestellt und analysiert werden. Diese Magisterar-
beit stellt dabei eine linguistisch orientierte Untersuchung der Produktivität von Wort-
bildungstypen dar. Die Grundlage bilden Werbeslogans, die im deutschsprachigen
Raum, geschaltet und veröffentlicht wurden.
Ein essentielles Ziel ist dabei die werbesprachlichen Charakteristika der formalen
Wortbildung und deren Funktion und Bedeutung für die Werbesprache herauszuarbei-
ten. Aus diesem Grund richtet sich die Auswahl der Slogans hauptsächlich nach mor-
phologischen Kriterien. So steht bei der Wortbildung die Komposition (Milchjieper),
die Derivation (kartoffelig) und die Kontamination (knäckoladig) im Zentrum der
Analyse. Bei der Komposition ist vor allem von Interesse welche Zusammensetzun-
gen von Wortarten besonders viele Neubildungen hervorbringen und welche eher we-
niger. Die Derivation dagegen betrachtet die Neubildungen vor allem aus dem Blick-
winkel, was das Hinzufügen von Affixen bei diesen bewirkt und ob sich auch hier
bestimmte Wortgruppen besonders dominant zeigen. Dagegen soll anhand der Kon-
tamination gezeigt werden, ob die Verschmelzung von zwei Wörtern in der Werbe-
sprache mit der Standardsprache gleichgesetzt werden kann und welche Kontaminati-
onstypen hierbei besonders bevorzugt werden.
Die werbesprachlichen Neubildungen sollen in dieser Arbeit zudem nicht nur nach
morphologischen Gesichtspunkten analysiert werden, sondern ein weiterer Schwer-
punkt bildet die semantische Analyse der Neuprägungen. Hierbei werden zum einen
die semantischen Relationstypen als auch deren Beziehungen zu anderen semanti-
schen Typen aufgezeigt. Neu ist bei diesem Ansatz, dass ausschließlich nicht-
lexikalisierte Bildungen untersucht werden und daher viele der Neubildungen Mehr-
deutigkeiten aufweisen.
Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Neubildung von Phrasen in der
Werbesprache. Dabei steht eine konkrete Auseinandersetzung mit den von Werbetex-
tern als stilistisches Gestaltungsmittel benutzten modifizierten Phrasen im Zentrum.
Im Mittelpunkt steht dabei, die Phrasen gebrauchsbezogen zu untersuchen. Dies be-
6
deutet im Hinblick auf ihre Vorkommenshäufigkeit und deren Funktion in der Werbe-
sprache. Bei der Phraseologisierung werden die Phrasen zunächst in die beiden Grup-
pen satzwertig (Das Tüpfelchen auf dem ich) oder satzgliedwertig (jede Mark in die
Werbung stecken) aufgeteilt. Danach wird bei der Gruppe der satzwertigen Phrasen
weiter sowohl nach ihrer Struktur (Einfachsätze wie Guten Appeltit, Satzreihen wie
Gut. Ehrlich. Schwäbisch., Satzverbindungen wie Der Käse, der aus der Reihe tanzt
und die elliptischen Sätze wie Benzin im Blut) als auch nach der Gruppe der Sprich-
wörtern (Der Appel fällt nicht weit vom Stamm.) differenziert. Die satzgliedwertigen
Phrasen werden hingegen nach Substantivphrasen (Lenker und Denker), nach Adjek-
tivphrasen (frisch und fründlich), nach Verbphraseme (trocken bleiben) und nach
Phrasen anderer Wortearten (drauf und davon) klassifiziert.
Der Schwerpunkt bei der Phrasenanalyse liegt dabei nicht nur auf der strukturellen
Verteilung, sondern auch in einer semantischen Klassifikation der Phrasen. Denn bei
Phrasen kann häufig zwischen einer übertragenen Bedeutung (Der Wolf im Fordpelz)
und einer wörtlichen Bedeutung (Und der Hunger ist gegessen) unterschieden werden.
Diese verschiedenen Bedeutungs- und Lesarten von Phrasen werden daher anhand der
Idiomatik erörtert.
Die Kenntnis der Bedeutung ist sowohl im Bereich der Wortbildung als auch Phraseo-
logie wichtig, um heraus zu finden, aus welcher Motivation eine Phrase gebildet wur-
de und weshalb nicht auf eine bereits bestehende Phrase zurückgegriffen wurde. So
können z.B. Fragen, wie warum kreierte das Unternehmen Coca Cola bei der Einfüh-
rung der PET-Flaschen das neue Wort unkaputtbar? Oder aus welchem Grund stellt
der Getränkehersteller Bluna in seinem Slogan die Frage Sind wir nicht alle ein bi-
schen Bluna? beantwortet werden. Um nachvollziehen zu können, warum Unterneh-
men Neubildungen für ihre Werbemaßnahmen kreieren lassen, muss zudem die Funk-
tion und Wirkungsweise der Bildung beim Konsumenten aufgezeigt. werden. Dies
kann am besten durch den Einbezug von psychologischen Kenntnissen über das Kon-
sumentenverhalten realisiert werden. Deshalb werden in dieser Arbeit am Rande auch
einige werbepsychologische Theorien bei der Analyse der Korpusbeispiele aufgezeigt,
wie z.B. ob die Sinnumdrehung eines bekannten Sprichworts ratsam ist.
Ein Bereich, der ebenfalls nur am Rande besprochen wird, ist die Gruppe der Pro-
duktnamen. Dies liegt vor allem daran, weil diese ein sehr großes Forschungsfeld dar-
stellt und als eigenständiges Thema in der Werbesprache behandelt wird. Trotzdem
konnten diese nicht ganz ausgeklammert werden, da im Bereich der Wortbildung bei
7
der Komposition (melittafiltern), der Suffigierung (faberhaft), der Konversion (scou-
ten) und vor allem im Bereich der Kontamination (Fixibilität) Neubildungen geschaf-
fen werden. Zudem enthalten auch zahlreiche Phrasen eine Komponente, welche Be-
zug auf den Produktnamen nimmt (Das ist die hohe Kunst der Duplomatie). Zudem
war der Anteil dieser Bildungen am Korpus so hoch, dass diese nicht ignoriert werden
konnten. Die Korpusaufnahme erfolgte dabei nach dem Kriterium, ob diese anhand
der Wortbildung verändert wurden oder eine bestimmte Funktion in der Phrase über-
nehmen.
Im letzten Kapitel dieser Arbeit soll zudem die branchenspezifische Verteilung der
Neubildungen aufgezeigt werden. Die zentrale Frage ist hier, ob die Verwendung und
Schöpfung von Neubildungen in manchen Branchen beliebter ist als in anderen und
welche Gründe sich dafür anführen lassen. Da im Bereich der Wortbildung und Phra-
seologie die metaphorische Bedeutung der neugebildeten Wörter und Phrasen vielfach
belegt ist. Wird in diesem letzten Kapitel zusätzlich noch ein kleiner Überblick über
die rhetorischen Stilmittel der Korpusbeispiele aufgezeigt. Denn Figuren wie z.B. die
Ellipse (Das Ende vom Durst), des Parallelismus (Daune gut, alles gut) oder der Kli-
max (Erfrischend. Spritzig. Limonig) sind charakteristisch für die Werbesprache.
Forschungsüberblick
Bereits um die Jahrhundertwende gibt es erste Anfänge in der wissenschaftlichen
Werbeforschung. Zu diesen ersten Pionieren gehört z.B. der Aufsatz von Richard
Meyer ,,Zur Terminologie der Reklame" (1902). Ein erster Aufschwung in der Werbe-
forschung erfolgte jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Ausbau der
Verkaufsaktivitäten und Verbreitung von Markenartikeln.
Eine besondere Stellung in dieser Zeit nimmt hier vor allem die Studie ,,Die Sprache
der Anzeigenwerbung" von Ruth Römer (1968) ein, die sich mit Werbeanzeigen von
1961 bis 1966 beschäftigte. Römer zeigt hier sprachliche Erscheinungen schwer-
punktmäßig auf, die dem Leser von Werbeanzeigen als typisch auffallen, unter Be-
rücksichtigung der verwendeten Lexik, der Syntax, der Verwendung von rhetorischen
Mitteln und der Wirkung dieser Sprache auf die Leser. Lange Zeit galt dieses Werk
als ein Standardwerk und wurde als maßgebende Beschreibung der deutschen Werbe-
sprache angesehen. Ein weiterer Wegbereiter bei der Analyse der deutschen Werbe-
sprache stellt in dieser Zeit Siegfried Grosse dar. Im Jahr 1966 veröffentliche dieser
den Aufsatz ,,Reklamedeutsch", der eine Beschreibung der Werbesprache auf den
8
Sprachebenen des Textes, Satzes und des Wortes darstellt. Zudem ist es eine der ers-
ten Arbeiten, die der Werbesprache einen Sonderstatus zuweist.
In den siebziger Jahren nimmt die Forschungsliteratur über die Werbesprache sprung-
haft zu. Dabei geht der Trend weg von den allgemein gehaltenen Arbeiten zur Spezia-
lisierung auf einzelne werbesprachliche Aspekte. Hier ist vor allem Bernhard So-
winskis Arbeit ,,Werbeanzeigen und Werbesendungen" (1979) anzuführen. Im Fokus
dieser Arbeit steht der Slogan, welcher nach seinen Hauptmerkmalen und Funktionen
untersucht wird. Eine vergleichbare Studie verfassten in dieser Zeit Jochen Möckel-
mann und Sönke Zander. Ihre Untersuchung zur ,,Form und Funktion der Werbeslo-
gan" (1978) liefert sowohl eine allgemeine Beschreibung der Funktionsweise der
Sprache der Werbung als auch typische stilistische Merkmale von Slogans.
Die Entwicklung der siebziger Jahre verstärkt sich weiter in den achtziger Jahren. Be-
vorzugte
Themen sind hier vor allem die Verwendung von Anglizismen in der Wer-
bung, sowie kommunikationstheoretische Aspekte. Zudem erscheinen erstmals Arbei-
ten zu rhetorischen Mitteln, zum Bereich Wortbildung und Wortarten. Außerdem tritt
immer mehr die Bildhaftigkeit der Werbesprache in den Vordergrund, der bislang
noch wenig Beachtung geschenkt wurde. Als herausragendes Werk kann hier die his-
torisch ausgerichtete Studie von Karl-Heinz Hohmeister (1981) genannt werden. Die-
ser untersuchte an ausgewählten Beispielen des ,,Gießeners Anzeigers" Veränderun-
gen in der Sprache der Anzeigenwerbung vom Jahre 1800 bis zur Gegenwart.
Schwerpunkt bildete dabei die Analyse der Anzeigen nach deren Wortschatz, Syntax
und Präsentationsform. Zu dieser Zeit ist ebenfalls der Autor Dieter Conen (1985)
anzugeben. Sein Werk ,,Die Wirkung von Werbesprache" stellt eine experimentelle
Untersuchung zur Interaktion von Bild und Text dar. Eine vergleichbare Studie ver-
fasste Arman Sahihi (1987), der sich in seiner Studie ,,Kauf mich!" mit der Werbewir-
kung von Sprache und Schrift beschäftigte.
Seit den neunziger Jahren nimmt die sprachwissenschaftliche Literatur explosionsartig
zu und neue Fragestellungen werden aufgenommen (wie Fachspracheneinfluss, Wort-
spiele, Intertextualität, Sprechhandlungsstrukturen). Hier kann vor allem die Arbeit
von Manuela Baumgart ,,Die Sprache der Anzeigenwerbung" (1992) genannt werden.
Sie aktualisiert darin die von Ruth Römer 1968 erschienene Monografie gleichen Ti-
tels. Im Fokus der Untersuchung steht dabei die Untersuchung von Werbeslogans
nach satzbezogenen rhetorischen Mitteln. In dieser Zeit entsteht auch eine Studienbib-
liografie von Albrecht Greule und Nina Janich (1997), die versuchen die Vielfalt der
9
Arbeiten über die Werbesprache systematisch zu veranschaulichen. Eine allgemeine
Beschreibung der Werbesprache findet sich in Nina Janichs Arbeitsbuch ,,Werbespra-
che" (1999). Diese Arbeit stellt eine breit gefächerte linguistische Auseinandersetzung
mit der Werbesprache dar und bietet einen guten Überblick über die Werbesprache.
Erstmals ausführlich wird in dieser Zeit auch Werbung aus Sicht der Phraseologiefor-
schung bearbeitet. Als viel zitiertes Werk kann hier die kontrastive Studie ,,Es muß
wirksam werben, wer nicht will verderben" von Andrea Hemmi (1994) aufgeführt
werden. Im Zentrum dieser Analyse steht die gebrauchsbezogene Erforschung von
nicht modifizierten und modifizierten Phraseologismen in der schweizerischen Anzei-
gen-, Radio- und Fernsehwerbung. Als weitere qualitative Studien zur Verwendung
von Phraseologismen sind die Arbeiten von Annette Sabban (1998) und Lange (1998)
zu nennen. Sabban (1998) zeigt in ihrer Studie ,,Okkasionelle Variationen sprachlicher
Schematismen" eine Analyse französischer und deutscher Presse- und Werbetexte auf.
Lange (1998) dagegen analysierte in seinem Aufsatz ,,Die Verwendung sprachlicher
Vorlagen in Texten der Anzeigenwerbung" unveränderte wie auch modifizierte Idio-
me und Sprichwörter anhand von ausgewählten Beispielen aus der deutschen Zeit-
schriftenwerbung des Jahres 1994 unter pragmatischen Gesichtspunkten. Eine der
neuesten Studie zur Erforschung der Phraseologismen in der Werbesprache stellt das
Werk ,,Muescht Knorr probiere, s'gaht über's Schtudiere!" von Nicole Bass (2006)
dar. Diese nimmt sowohl eine quantitative als auch qualitative Inhaltsanalyse von mo-
difizierten Phraseologismen im Zeitraum von 1928 bis 1998 vor. Das Hauptinteresse
dieser Arbeit liegt vor allem darin die Vorkommenshäufigkeit einzelner Phraseolo-
gismustypen und deren Modifikationsverfahren aufzuzeigen.
Grundlegend im Bereich der Wortbildung ist für diese Arbeit vor allem das Werk
,,Wortbildungsstrategien in der Werbung" von Ulrike Krieg (2004). In diesem werden
Wortneubildungen in Printanzeigen auf der Grundlage der Morphologie anaylsiert und
deren Funktion aufgezeigt. Die Dissertationsarbeit ,,Produktive Wortbildungstypen in
der Werbesprache" von Silke Kemmerling-Schöps (2001) stellt ebenfalls eine hilfrei-
che Bezugs- und Orientierungshilfe für dieses Thema dar. Denn diese Arbeit beschäf-
tigt sich ausschließlich mit der Erörterung der Charakteristika verschiedener formaler
Wortbildungstypen und ihrer Bedeutung und Funktion in der Werbesprache. Neben
Janichs neuere Auflage zur Werbesprache (2003), verschafft auch die Publikation
,,Die Sprache der Werbung" von Stefanie Schlüter (2007) einen guten Überblick über
die Charakteristika und Tendenzen in der Werbesprache.
10
Ein Forschungsdesiderat liegt im Bereich der Wortbildung vor allem darin, dass außer
der Dissertationsarbeit von Kemmerling-Schöps (2001) keine weiteren Werke existie-
ren, die sich ausschließlich mit Neubildungen im Bereich der Wortbildung beschäfti-
gen. Der Bereich der Phrasen dagegen ist sehr gut erforscht. Insbesondere für den
werbesprachlich charakteristischen Slogan existieren zahlreiche Werke.
Eine Forschungslücke stellt das Fehlen einer Untersuchung dar, die sich sowohl mit
neugebildeten Wörtern als auch Phrasen der Werbesprache beschäftigt. Diese For-
schungslücke gilt es im Rahmen dieser Magisterarbeit zu schließen.
Materialbasis
Das zur Analyse zusammengestellte Beispielmaterial entstammt hauptsächlich aus den
Internetdatenbanken www.slogans.de und www.markenlexikon.com. Die Datenbanken
wurden im Zeitraum von Anfang November 2008 bis Ende Februar 2009 vollständig
untersucht und dabei wurde ein Korpus von 1359 Werbeslogans zusammengestellt.
Die Hauptbezugsquelle slogans.de stellt eine offene und interaktive Datenbank dar,
die sowohl Werbeagenturen als auch Textern, Markenspezialisten und interessierten
Endverbrauchern als Recherche- und Inspirationsportal dient. Die Datenbank enthielt
zum erhobenen Zeitraum über 34.238 Slogans. Aufgrund dieser hohen Frequenz kön-
nen die untersuchten Neubildungen durchaus Repräsentativität beanspruchen. Die
Quellen, aus welchen die Datenbank ihre Slogans bezieht, stammen zum einen aus
einem eigenen stetig wachsenden Archiv von über 300.000 Anzeigen sowie aus Fach-
büchern und Filmmaterialien. Zudem wird regelmäßig in den globalen Online-Media-
Archiven von Verlagen, Verbänden, dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie im
Internet allgemein recherchiert.
(vgl. URL:http://www.slogans.de/index.php?Op=Info, 10.02.2009: 14: 38 Uhr)
Die zweite Bezugsquelle, das Online - Portal www.markenlexikon.com
,
stellt eine Da-
tenbank dar, welches sich nicht nur auf Slogans spezialisiert hat, sondern allgemein
Information über Marken, Marketingstrategien, Experten in Wissenschaft und Praxis
und Wissenswertes rund um das Thema Marken anbietet. Im sogenannten Marken-
glossar haben dort die besten und bekanntesten Slogans aller Zeiten Eingang gefun-
den und dienen dieser Arbeit als zusätzliche Materialquelle. (vgl.
URL
:
http://www.markenlexikon.com/markenportrait.html 10.02.2009: 14:50 Uhr) Jedoch
nehmen diese entnommenen Slogans nur etwa rund fünf Prozent des gesamten Korpus
ein.
11
Die Auswahl der Neubildungen des Korpus erfolgte im Bereich der Wortbildung
hauptsächlich nach morphologischen und syntaktischen Kriterien. Diese Bildungen
wurden nach den Wortbildungstypen der Komposition, Derivation und Kontamination
analysiert. Bei der Auswahl der Phrasen im Bereich der Phraseologie wurde der Fokus
auf modifizierte oder auch aus der Werbesprache stammende Phrasen gelegt. Sowohl
im Bereich der Wortbildung als auch der Phraseologie wurden graphische und ortho-
graphische Modifikationen ausgeklammert, da für diese Arbeit hauptsächlich die lin-
guistische Ebene im Bereich der Morphologie und Syntax von Interesse ist. Die Grup-
pe der Produktnamen werden zudem nur am Rande behandelt, da sie aufgrund ihrer
hohen Komplexität ein eigenes Forschungsfeld darstellen. Es wurden dabei nur Pro-
duktnamen in das Korpus aufgenommen, deren Morphologie oder Semantik verändert
wurde oder eine besondere Rolle spielt.
Bei der Auswahl der Bildungen war es vor allem wichtig, herauszufinden, ob diese
auch tatsächlich Neubildungen darstellen. Um diese sicherzustellen, wurde die Duden-
Online-Version genutzt. Dieses Portal stellt deswegen ein geeignetes Instrument dar,
da das eingegebene Wort in den verschiedenen Wörterbuchtypen (Rechtschreibung,
Grammatik, Fremdwort) gesucht wird und so sichergestellt wird, dass für diese Bil-
dung noch kein Eintrag gemacht wurde. Das Duden-Korpus umfasst zudem 1,4 Milli-
arden Wortformen und unterliegt ständiger Aktualisierung. Deswegen kann davon
ausgegangen werden, dass die Bildungen zu dem erhobenen Zeitpunkt noch nicht le-
xikalisiert wurden. (vgl. URL:
http://www.duden.de/ 10.02.2009: 16:30)
Insgesamt umfasst das Korpus 1340 Beispiele. Sortiert wurden die Slogans zum einen
nach ihrer Branchenzugehörigkeit. Dabei ergeben sich fünfzehn Branchen (Bau-
en/Immobilien
,
Bekleidung, Bildung, Chemie/Haushalt, Gastronomie, Han-
del/Wirtschaft, Kommunikation, Kosmetik, Lebensmittel, Medien, Pharma, Tabak,
Technik/Elektronik, Touristik und Transport). Zum anderen wurden die Slogans nach
der Kategorie Wort/Phrase und dem jeweiligen Wortbildungstyp geordnet. Aufgrund
der daraus entstehenden Komplexität der Tabelle wurden im Anhang dieser Arbeit nur
die Slogans mit dem entsprechenden Herstellerbezug aufgeführt. Die gesamte Tabelle
mit Quellenbelegen befindet sich auf beigelegten CD-ROM.
12
1. Erläuterungen zum Untersuchungsgegenstand Werbesprache
1.1. Historische Entwicklung
Die Wirtschaftswerbung und speziell die Absatzwerbung ist sehr stark an die Ent-
wicklung des Handels gebunden. Die Anfänge der Werbung reichen bis in die Antike
zurzeit Christi zurück. In weit entwickelten Städten wie Pompeij wurden Inschriften
gefunden, mit welchen für Gaststätten oder Politiker geworben wurden. Die Verbrei-
tung von Werbung wurde erheblich durch die Entdeckung des Buchdrucks im 15.
Jahrhundert und den ersten Anfängen des Pressewesens im 17. Jahrhundert verein-
facht. Die Entstehung der Intelligenzblätter im 18. Jahrhundert und die Erhebung einer
Steuer für diese Anzeigen, führten dazu, dass rund hundert Jahre später, Zeitungen
begannen ihre Kosten durch Werbeanzeigen zu finanzieren und dadurch den Preis für
ihre Auflagen zu senken. Die moderne Wirtschaftswerbung beginnt allerdings erst im
Zuge der Industriellen Revolution und der einsetzenden Massenproduktion. Obwohl
die Industrielle Revolution von England ausging, kann Amerika als die Wiege der
Warenwerbung genannt werden. Um 1860 begann dort die Verbreitung des Insera-
tenwesens. Frankreich schloss sich dieser Entwicklung an und steuerte dazu den eige-
nen Begriff Reklame bei. In Deutschland vollzog sich der Aufschwung der Waren-
werbung erst in den späten 20er Jahren, als eine verbesserte Druck- und Informations-
technik eine bessere Verbreitung und Wirkung ermöglichten. Auch durch die Ver-
wendung des neuen Mediums Rundfunk, konnte nun eine ,,Massierung des Unterbe-
wußtseins" (Bongard 1964: 158) erzielt werden. Dies leitete die Ablösung des übli-
chen Wortes Reklame, welches eine zu marktschreierische Konnotation hatte, zu dem
seriöseren Wort Werbung ein. Die weitere Entwicklung wurde in Deutschland durch
den 2. Weltkrieg erheblich gestoppt und setzte erst wieder mit den Anfängen des
Wirtschaftswunders, in den 50er Jahren, ein. Ab diesem Zeitpunkt wurde zunehmend
auch die psychologische Komponente der Werbung wichtig und der Bestseller über
die geheimen Verführer der Werbung von Vance Packard löste Wellen der Kritik an
der Werbung aus. Dies konnte jedoch den Aufschwung der Branche nicht eindämmen
und der alljährliche Umsatzzuwachs ist ein Hinweis darauf, wie wichtig Werbung für
die Volkswirtschaft ist. (vgl. Sowinski 1979: 10 ff., vgl. Zurstiege 2007: 23 ff.)
13
1.2. Definition des Begriffs Werbesprache
Allgemein kann die Werbesprache als Kommunikationsmittel zwischen einem Sender
und einem Empfänger bezeichnet werden. Damit wird ein Kontakt mithilfe von
sprachlichen Mitteln zwischen dem Produzenten und den potentiellen Kunden herge-
stellt.
Sprache, die neben der Information über das, wofür geworben wird, zum Ziel hat, den Ad-
ressaten mit psychologischen Mitteln (z.B. indem sie auf unterbewußte Triebe, Bedürfnis-
se, Wunschvorstellungen abzielt) zu einer bestimmten Entscheidung, einem bestimmten
(Kauf)verhalten zu bringen (meist ohne daß ihm dies bewußt wird) (Brockhaus Wahrig
1984: 716)
Eine Paraphrasierung des Terminus Werbesprache ergibt ,,Sprache der Werbung" und
zeigt, dass das Wort aus dem Wort Werbung gebildet wurde und eine besondere
Sprachform darstellt. Die Werbesprache ist jedoch nicht, wie die zahlreichen Berufs-
und Fachsprachen, eine Sondersprache, die nur bestimmten Fachleuten oder Kennern
über das Gebiet eigen ist. Einerseits wird diese zwar von relativ wenig Menschen, den
Werbetextern, geschaffen, andererseits aber soll diese jedoch von einer möglichst
breiten Masse verstanden werden. Aus diesem Grund beruht diese auf einer allgemein
verständlichen schriftsprachlichen Sprachschicht, die sich nur in bestimmten Fällen
der Umgangssprache oder einer Fachsprache anpasst. (vgl. Sowinski 1979: 88 ff.)
Jedoch muss auch gesagt werden, dass die Werbesprache ,,nicht die natürliche Spra-
che eines Menschen, sondern ein abgehobenes, isoliertes Gebilde" (Römer 1968: 203)
darstellt. So teilt die Werbesprache mit den anderen Fach- und Sondersprachen die
historische und eine Art soziale Gebundenheit. Zudem ist die Werbesprache nicht nur
,,eine Erscheinungsform eines Phänomens, das überzeitlich und nicht auf Warenan-
preisung beschränkt ist". Sondern ist ein kleiner Teil eines größeren Ganzen, das als
,,Propagandasprache" bezeichnet werden kann und die eine Sprachform darstellt, ,,um
das Denken und Handeln von Menschen zu lenken, deren Denken und Handeln noch
nicht in die Intention des Sprechers liegt, sondern dahin erst gebracht werden muss"
und durch welche Abwehrmechanismen erst noch beseitigt werden müssen. (vgl. Rö-
mer 1968: 206 ff.) Der Wortschatz der Werbesprache entstammt, abgesehen von den
Neubildungen und Fachausdrücken, hauptsächlich der Gemeinsprache, erscheint al-
lerdings nur in bestimmten Verwendungsformen. Demnach kann die Werbesprache
als ,,eine stark zweckbestimmte, von der Alltagssprache zumeist abgehobene schrift-
sprachlich geprägte Sprachauswahl mit beschreibendem, anpreisenden und überreden-
den Funktionen" (Sowinski 1979: 89) bezeichnet werden.
Der Ursprung des Wortes Werbung kann auf das Verb werben zurückgeführt werden.
14
Das Wort werben ist ein starkes Verb und geht aus den im 8. Jahrhundert entstande-
nen mhd. Verb werben, dem ahd. Verb werban, (h)wervan und dem as. Verb hwerban
hervor. Ältere Wurzeln finden sich im starken g. Verb *hwerb-a- ,sich wenden`, im gt.
Verb hairban und sowohl im anord. Verb hverfa als auch im ae. Verb hwerfon als
auch im afr. Verb. Hwerva. Jedoch gibt es keine sichere Vergleichsmöglichkeit für die
Entwicklung aus der einstigen Bedeutung von ,sich drehen` zu der heutigen Bedeutung
,sich um etwas bemühen`. (vgl. Kluge 2002: 983)
Die Verwendung des Wortes werben kann bis in die biblische Urgeschichte zurück-
verfolgt werden. Als der Teufel in der Gestalt der Schlange Eva und Adam zum Ap-
felgenuss verführt hatte. Aber auch im Tierreich wirbt das Männchen um die Gunst
des Weibchens. Wahrscheinlich wurde werben sogar in seiner ursprünglichen Form
auf dieses Balzverhalten der Tiere bezogen. Später wurde das Wort für die menschli-
che Braut- und Soldatenwerbung verwendet. (vgl. Kemmerling-Schöps 2001: 11)
Heute wird unter Werbung die ,,Gesamtheit werbender Maßnahmen" verstanden und
bezieht sich auf zahlreiche Bereiche des Lebens, z.B. Personalwerbung, politische
Werbung, Absatzwerbung etc.. In dieser Arbeit konzentriert sich die Untersuchung
ausschließlich auf die Absatzwerbung, welche sich mit ,,der öffentlichen Bekanntma-
chung von Firmennamen, Warennamen und Aussagen über Waren" (Römer 1980: 9)
beschäftigt. Die Werbesprache dient in diesem Prozess der Benennung von Produkt-
namen, Sortimentsnamen und deren Beschreibung, sowie der Namensgebung von
Herstellern und Vertreibern. Ziel der Werbesprache ist es, möglichst viele positive
Merkmale des Produktes hervorzuheben, damit es sich unter der Masse der konkurrie-
renden Produkten und Herstellern abhebt. Jedoch wird die Arbeit eines Werbetexters
durch eine Reihe von Vorschriften, Verordnungen und Gesetzten reglementiert, die
von Funktionären - wie dem Gesetzgeber, den Verbraucherschützern und Organen der
freiwilligen Selbstkontrolle- aufgestellt werden. (vgl. Neumann 2003: 21) Dies liegt
vor allem daran, dass die Werbung in der heutigen Zeit teilweise ein Art Leitbildwer-
bung darstellt. Sie zeigt Menschen in Verhaltenssituationen, die ,,zwar mehrheitlich
meist positiv bewertet werden, aber die Realität nur unrepräsentativ darstellen. Man
begegnet einer ,heilen Welt`, in der es weder Krankheit noch Armut gibt, in der die
Frauen in traditionellen Rollen verharren". (von Rosenstiel/Neumann 2002: 71) Sei-
tens der Frauenbewegung kommt auch öfters Kritik auf, dass Frauen in der Werbung
oft zu Sexualobjekten degradiert werden. Die Reglementierung der Werbung hilft
hier, dass gesellschaftliche, soziale und ethnische Normen eingehalten werden.
15
1.3. Notwendigkeit von Neubildungen
Originelle, auffällige und kreative Wörter in der Werbesprache sind daher notwendig,
da sie die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf das zu bewerbende Produkt lenken
sollen. Vor allem durch die heutige Übersättigung der Märkte und Konsumenten
wächst der Konkurrenzdruck unter den Firmen stetig und damit auch der Drang nach
immer neueren und noch reißerischen Strategien für die Vermarktung ihrer Produkte.
Die Sprache spielt hierbei eine zentrale Rolle. In der Vergangenheit priesen Markt-
schreier lautstark ihre Produkte zum Verkauf an, in der heutigen Zeit übernehmen
diese Aufgabe die Print- und Massenmedien:
But language is, more often than not, an important contributor to establishing the connota-
tive structure for product imagery. The use of verbal techniques to create effective adver-
tisements and commercials for instance ads with attention, getting headlines, with slo-
gans designed to help create a favourable image of a company and its products, etc. is a
fundamental part of product textuality.(Beasley/Danesi 2002: 112)
Laut Schätzungen erreichen in den hoch entwickelten Industrienationen wie den USA,
Japan oder Deutschland nur etwa 1 bis 2 % der in den Massenmedien angebotenen
Information die Empfänger. Der Rest bleibt weitgehend unbeachtet und dringt nicht in
das Bewusstsein der Konsumenten ein. (vgl. von Rosenstiel/Neumann 2002: 166) Da-
her muss umso mehr Wert auf eine attraktive Gestaltung der Werbebotschaften gelegt
werden. Zudem sind die Zeiten, als ein Bild mehr als 1000 Worte sagte, längst vorbei.
Die Lenkung der Aufmerksamkeit in der Werbung erfolgt vielmehr über ein komple-
xes Zusammenwirken von Bild- und Textelementen. Hierbei tritt das Bild zumeist als
Blickfang auf und dem dazugehörigen Text kommt eine stabilisierende und zum Teil
auch erklärende Funktion zu. (vgl. Hagmann/Hartmann 1998: 50) Es lässt sich also
erkennen, dass eine Werbung ohne gewisse sprachliche Hilfe nur in einem geringen
Maße, wenn nicht sogar gar nicht existent ist und deshalb stets versucht werden muss,
ihre visuellen und sprachlichen Mittel immer ihrem Zweck gemäß einzusetzen. So
gesehen ist es von hoher Wichtigkeit, Bild und Sprache aufeinander abzustimmen, um
wünschenswerte Ziele der Werbekampagne zu erreichen. Jedoch ist nicht nur die Ab-
stimmung der Bild- und Sprachelemente aufeinander wichtig, sondern auch die
Übermittlung einer zielgerichteten Botschaft für die Zielgruppen. Denn dadurch kön-
nen beim Konsumenten positive Assoziationen zum Produkt geweckt werden und die
Werbebotschaft bekommt die Chance über einen längeren Zeitraum im Gedächtnis
gespeichert zu werden. Diese Ziele können vor allem dadurch erreicht werden, indem
16
neue innovative Wörter oder Phrasen gebildet werden, da sie allein durch ihre Neuar-
tigkeit das Interesse auf sich ziehen. Letztlich ist es sogar möglich, dass sie im Ideal-
fall formend auf die Sprache des Alltags wirken und damit die Wirkung der Werbung
über einen langen Zeitraum hinweg verfestigen. Dies kann z.B. an den zahlreichen
Saturn- und Mediamarktkampagnen gesehen werden, die es geschafft haben durch
ihre reißerischen Slogans wie ,,Geiz ist geil" oder ,,Ich bin doch nicht blöd" ihre Bot-
schaft bei einem Großteil der Konsumenten in Deutschland im Gedächtnis zu veran-
kern. Der Claim ,,Geiz ist geil" kann sogar als ein Impuls für die Auslösung eines
neuen Lebensstils in Deutschland gesehen werden. Nämlich sowohl das Bewusstsein
für günstige Preise und Rabatte zu schärfen als auch die damit verbundenen Schamge-
fühle zu reduzieren und Sparsamkeit als Trend darzustellen. Ein weiterer wichtiger
Grund für die Notwendigkeit von Neubildungen in der Werbung ist, dass die Kunden
von heute mehr Informationen wünschen und durch die breite Angebotspalette zahl-
reiche Vergleichsmöglichkeiten zur Verfügung haben, bevor sie eine Kaufentschei-
dung treffen. Zudem fällt es dem Verbraucher zunehmend schwerer qualitative Unter-
schiede zwischen den einzelnen Produkten festzustellen und Gründe zu sehen, warum
er sich für das teure Markenprodukt entscheiden soll. Deshalb ist eine wirksame In-
formierung und Argumentation für die Vorteile des Produktes, vor allem auf Seiten
der Markenhersteller, von hoher Bedeutung. Auch Institutionen, wie z.B. die Stiftung
Warentest oder die zahlreichen Preissuchmaschinen im Internet stellen Informationen
bereit, die bewusst den Verbraucher in seiner Kaufintention beeinflussen können. Ge-
gen diese Macht der Verbraucher müssen die Unternehmer mit einer effektiven
Kommunikationspolitik gegenüber treten. Doch die Macht liegt nicht nur in den Hän-
den der Verbraucher. Auch die Unternehmen haben die Möglichkeit durch persuasive
Argumente die Vorteile des Produktes hervorzuheben und mögliche Nachteile zu ver-
schleiern oder davon abzulenken. Stefanie Schlüter nennt dies die ,,Ablenkungs- bzw.
Verschleierungsfunktion" (Schlüter 2007: 21) der Werbung. Damit ein Werbekonzept
erfolgreich wird und den Verbraucher erreicht, ist vor allem das Zusammenspiel zahl-
reicher Komponenten von entscheidender Bedeutung. Die Sprache stellt in diesem
Zusammenhang eine äußerst wichtige Komponente dar, um Aufmerksamkeit zu er-
zeugen und ein Werbekonzept erfolgreich werden zu lassen. Die deutsche Sprache
erweist sich hierbei als ideales Mittel, um sprachspielerisch zu agieren und Aufmerk-
samkeit durch schlagkräftige Slogans zu erzielen. Unsere Sprache, so Hartwig, erlau-
be uns jederzeit Neubildungen. Mehr als alle anderen Sprachen. Jedenfalls sei es uns
17
gegeben, durch Anfügen von Vor- und Nachsilben (Präfixe und Suffixe) unsere Wort-
stämme geschmeidiger zu machen und durch Wortzusammensetzungen, die noch viel
ergiebiger seien, einen Wortreichtum auszubreiten, der seinesgleichen suche. Es kön-
ne doch gar kein Zweifel sein, dass Presse, Rundfunk und Fernsehen, die heute bis in
die entlegensten Bergdörfer und auf die einsamen Inseln kommen, in den letzten Jahr-
zehnten den aktiven Wortschatz der Bevölkerung überall vermehrt haben. Die Wer-
bung habe daran - durch ihren großen Wiederholungscharakter - größten Anteil, wobei
es ganz unerheblich ist, dass dabei auch Ritter Ajax und Frau Saubermann gelernt
worden seien. Jedenfalls holen die Massenmedien nach, was die Zwergschulen im
Deutschunterricht versäumt haben, nämlich von der Sprachfülle etwas mehr auszu-
schütten als nur das Notwendigste.
(Hartwig 1974: 20 ff.) Zudem verleiht eine Wort-
neubildung dem beworbenen Produkt zuerst einmal eine Sonderposition im Markt, da
dieser Ausdruck nur mit dem jeweiligen Produkt in Verbindung gebracht wird. Ein
weiterer Vorteil von Neubildungen ist, dass der Grundwortschatz oft nicht die genaue
Bezeichnung für das neue Produkt bietet und dadurch eine neue Bezeichnung geschaf-
fen wird:
Der Hauptunterschied zwischen der Neubildung und möglichen Formulierungsalternativen
liege darin, dass dem bezeichneten Sachverhalt eine Legitimation gegeben wird, die keine
syntaktische Art der Kombination leisten kann. (Peschel 2002: 111)
Das Vokabular der Werbesprache zeichnet sich vor allem durch eine Vielzahl von
Neubildungen aus, die schnell und anpassungsfähig ,,auf das veränderliche Kaufange-
bot, die wechselnde Mode, das nicht konstante Kaufbedürfnis und den technischen
Erfindungsreichtum reagieren." Die wichtigsten Komponenten, die es in der Werbe-
sprache dabei zu beachten gilt ist ,,die allgemeine Verständlichkeit, die klare Präzisie-
rung des Gemeinten, der Überraschungseffekt, die schnelle Einprägsamkeit und die
genaue Beachtung der Situation". (Grosse 1973: 79)
1.3. Zusammenwirken von Wortbildung und Phraseologisierung
Das Ziel der Werbung ist, Produkte begehrenswert zu machen. Dies verlangt jedoch,
dass das Interesse der Konsumenten durch Besonderheiten des Wortschatzes im Wer-
betext geweckt wird. Zu den Möglichkeiten, den Wortschatz der Werbetexter zu vari-
ieren und zu erweitern, gehören neben Entlehnungen aus Fachsprachen, Fremdspra-
chen und aus anderen Sprachbereichen die verschiedenen Formen der Wortbildung,
wie Neuschöpfungen, Zusammensetzungen, Zusammenschreibungen und Ableitun-
gen. Die Sprache der Werbung ist deshalb interessant zu untersuchen, da diese noch
18
relativ viele Neuschöpfungen hervorbringt im Vergleich zur Standardsprache. Denn
für eine entwickelte Kultur- und Literatursprache wie das Deutsche ist die Anfangs-
phase der Wortschöpfung längst vorbei und Wörter werden in der Regel nicht durch
völlige Neuschöpfung, sondern durch zumindest teilweisen Rückgriff auf bereits vor-
handene sprachliche Einheiten, durch Weiterbilden des Überkommenen oder Entlehn-
ten gewonnen. (vgl. Erben 2006: 20)
Doch bevor die einzelnen Prozesse und Elemente der Wortbildungslehre und Phraseo-
logisierung aufgezeigt werden, durch die neuen Wörter und Phrasen entstehen, soll
zuerst einmal der Begriff Neubildung terminiert werden. Denn hier herrscht in der
Literatur große Uneinigkeit. Dies liegt zu allererst einmal an der Begriffsvielfalt in
diesem Bereich. Denn neben dem Begriff Neubildung tauchen auch oft die Begriffe
Neologismus, Ad-hoc Bildungen bzw. Okkasionalismus auf:
Neu gebildete Wörter sind nicht im gleichen Maß nichtusuell, deshalb unterscheidet man
zwischen Neologismen und echten Ad-hoc Bildungen. (Krieg 2005: 50)
Der Begriff des Okkasionalismus wird vor allem dann verwendet, wenn Bildungen nur
im Kontext verständlich sind und diese relevante Aufgaben im Text übernehmen. Zu-
dem üben sie sprachökonomische oder stilistische Funktionen und schließen vielmals
lexikalische Lücken. Deshalb stellen diese eine Vorstufe zum Neologismus dar. Da sie
sich zu etablierten Wortschatzeinheiten weiterentwickeln können oder aber auch vor-
her wieder verschwinden können. (vgl. Elsen 2004: 20) Nach Berkle befinden sich
Neologismen ,,sozusagen auf der Eintrittsschwelle in das Wortschatzgebäude einer
Sprache" und ad-hoc-Bildungen werden ,,einmal geprägt, gebraucht und verstanden
entweder wieder vergessen oder gelangen unter bestimmten Bedingungen als Neolo-
gismen für kürzere oder längere Zeit in den Wortschatz einer Gruppe oder Gesell-
schaft". (Berkle 1986: 186) Auf diese Abgrenzungsproblematik vor allem in Bezug
auf die Werbesprache macht auch Janich aufmerksam und differenziert diese beiden
Begriffe in folgender Weise, dass Neologismen zwar noch einen Neuheitswert besit-
zen und in der Regel noch nicht lexikalisiert sind. Dagegen die Augenblicksbildungen
erstmalig oder auch einmalig in einem Text erscheinen und noch nicht vorauszusehen
ist, ob diese sich in Richtung Neologismus und Lexikalisierung weiterentwickeln.
Weiter kritisiert Janich, dass sich diese Abgrenzungsproblematik besonders in der
Werbesprache bemerkbar macht, da hier die Beziehungen zwischen Werbe- und All-
tagssprache und der Übernahmebereitschaft von Wortschöpfungen in den Wortschatz
noch nicht eingehend untersucht wurden. (vgl. Janich 2003: 105 ff.) Zudem gestaltet
sich die begriffliche Bestimmung deshalb so schwierig, da noch weitere Faktoren bei
19
der Terminierung beachtet werden müssen. Zum einen spielt der Zeitfaktor eine Rolle.
Ab wann und bis wann kann ein neues Wort als Neologismen bezeichnet werden. Zu-
dem muss auch der Ausgangspunkt des jeweiligen Autors beachtet werden. So muss
z.B. ein Lexikograph die in der Sprache bereits relativ verbreiteten Wörter von Indivi-
dual und Gelegenheitsbildungen trennen und überlegen, ob Verschiebungen von
Konnotationen schon zu einer neuen Bedeutung geführt haben. (vgl. Elsen 2004: 17
ff.) Neben der begrifflichen Unterscheidung zwischen Neologismum und Okkassiona-
limus ist auch die konnotative Differenzierung von Bedeutung. Schippan terminiert
unter Neologismus ,,eine bewußte Neuzuordnung von Formativ und Bedeutung"
(Schippan 1992: 246) Dagegen ist für Kinne ,,ein neu zu beobachtender deutlicher
Konnotations- oder Wertungswandel kein ausreichendes Kriterium für den Status ei-
nes Neologismus." (Kinne 1996. 347)
Um dieser Diskussion nicht zu viel Raum zu geben, wird in der vorliegenden Arbeit
der Begriff Neubildung verwendet. Die Okkasionalismen werden ebenfalls unter die-
sen Typ gefasst, da die Neubildungen des Korpus häufig aus einem textuellen Zu-
sammenhang entstanden sind.
Der Begriff Neologismus bezieht sich allgemein auf neue Wörter, ohne auf diesen Unter-
schied einzugehen. Vielfach findet sich dafür auch Wortneubildung. (Elsen 2004: 21)
Zudem bedingt die Offenheit der Werbesprache für Wortneubildungen und ihren ho-
hen Anspruch an Originalität, dass sich die Verwendung der neuen Wörter und Phra-
sen oftmals nur im Zusammenhang mit der Werbung beschränkt und nur selten Ein-
gang in die Gemeinsprache finden.
Bei der Neubildung von Phrasen und Wörtern spielen nach Fleischer Wortbildung und
Phraseologie gleichermaßen eine Rolle. Denn der Gebrauch einer Sprache verlangt
,,artikulorisch-phonetische bzw. graphische Festigkeiten, die Beherrschung von Mo-
dellen der Zeichenbildung und kombination sowie die Kenntnis konkreter Zeichen-
einheiten und ihrer Verwendungsmöglichkeiten". (Fleischer 1997: 9) Wortbildung
und Phraseologisierung unterscheiden sich hauptsächlich in der Verflechtung und
Wechselwirkung von ,,semantischen und formativstrukturellen Prozessen". Bei der
Entstehung einer Wortbildungskonstruktion zum Wortschatz sind nach Fleischer vier
Stufen zu unterscheiden:
1. ,,frei bildbare", aber noch nicht ,,gebildete" Wörter
2. bereits ,,gebildete" Wörter, die zwar in einem Text vorkommen, aber noch
nicht ,,sozial approbiert" also okkasionell bleiben
20
3. ,,sozial approbierte" komplexe Wörter, die zwar gespeichert und intersubjektiv
verfügbar sind, aber noch keinen Prozess der Demotivation durchlaufen haben
und deshalb nur Lexemkombinationen darstellen
4. Lexeme als die ,,eigentlichen" Einheiten des Wortschatzes, die gespeichert und
semantisch nicht voll zerlegbar sind. (vgl. Fleischer 1997: 9 ff.)
Setzt man dies nun in Bezug auf die Phraseologisierung, lässt sich dies nicht ohne
weiteres übertragen. Bei der Phraseologisierung entstehen nach Fleischer die Phrasen
durch einen ,,primär semantischen, keinen formativstrukturellen Prozeß". Dieser Pro-
zess beruht hauptsächlich auf ,,partieller oder totaler Idiomatisierung auf dem Wege
der Metaphorisierung oder Metonymisierung". Nur eine Teilgruppe der Phrase folgt
dem ,,primär formativstrukturellen Prozeß". Dies wird dann als die ,,Unikalisierung
einer Komponente" oder auch als ,,Stereotypisierung nominativer Wortgruppen ohne
semantische Umdeutung" bezeichnet. Bei den Phrasen sind neben den ,,sozial appro-
bierten" Phraseologismen noch weitere Formen okkasioneller Konstruktionen zu un-
terscheiden:
1. Individuelle lexikalische Ausfüllungen des komparativen phraseologischen
Strukturmodells mit wie (z.B. Wir wissen wie ihre Kunden klicken)
2. Individuelle Modifikationen gespeicherter Phraseologismen (z.B. Das kommt
mir Spanisch vor ,das ist mir unbekannt`: Modifizierung in der Werbung zu
Das kommt mir brasilianisch vor)
3. sogenannte ,,Autorphraseologismen", die innerhalb eines künstlerischen Wer-
kes geschaffen werden, an dieses Werk gebunden sind, ohne Eingang in die
Allgemeinsprache zu finden (z.B. Hier bin ich Mensch Hier kauf ich ein)
Zudem lässt sich die innere syntaktische Struktur von Phrasen weiter in drei Grundty-
pen aufgliedern:
1. Wortgruppen ohne feste Prädikatsbeziehung (weitere morphologische Klassi-
fikation in substantivische, adjektivische, adverbiale und verbale Phraseolo-
gismen)
2. ,,festgeprägte prädikative Konstruktionen" (jmd. platzt der Kragen)
3. Festgeprägte Sätze oder kommunikative Formeln (Das wird dir noch leid tun)
(vgl. Fleischer 1997: 10 ff.)
In der Werbesprache werden diese zahlreichen Möglichkeiten zur Bildung neuer Wör-
ter und Phrasen genutzt. Dabei ist auch die semantische Bedeutung der Wörter und
Phrasen von zentraler Bedeutung. Denn das zentrale Charakteristikum der Werbespra-
21
che ist mit Wörtern und Phrasen sprachspielerisch zu agieren. Dabei nutzt die Werbe-
sprache vor allem die Möglichkeit der Doppeldeutigkeiten und Aufwertungen:
Die Gegenstände werden mit der Sprache aufgewertet. Sie werden in der Hierarchie der
Werte, die in der Sprache beschlossen ist, um eine oder mehrere Stufen heraufgerückt. Die
Gegenstände. die benannt oder charakterisiert werden müssen, sind wohl gut und haben ih-
ren Wert, aber sie werden mit Wortinhalten, also mit semantischen Mitteln, auf eine höhe-
re Stufe gestellt, als ihnen zukommt. (Römer 1968: 85)
Diese Präferenz lässt sich darauf begründen, dass die Produkte so viel verführerischer
und interessanter erscheinen. So wird eine einfache Krawatte in eine Luxuskrawatte
oder eine haushaltsübliche Seife wird plötzlich in eine Schönheitsseife der Filmstars
verwandelt. Zudem können konkrete Bezeichnungen zu Abstrakta mit einem höheren
Eindruckswert transformiert werden. So wird aus einer Zahncreme ein Schönheits-
zahnweiß oder ein einfaches Fertigbauhaus wird als ein Wärmegewinnhaus angeprie-
sen. Zudem werden Produkte mit Hochwörtern, sogenannten Augmentativa, aufgewer-
tet. Diese Wörter entstammen häufig gesellschaftlich angesehenen Namensbereichen.
So ist der Genuss des Sektes Fürst von Bismarck ein fürstliches Vergnügen und sollte
fürstlich genossen werden. Weiter werden gerne aufwertende Appelative, sogenannte
Euphemismen, verwendet. Häufig sind dies Beschönigungen durch Bezeichnungen,
die angesehener sind und oftmals eine größere Ausdehnung, Wirkung oder Leistung
versprechen, wie z.B. Internetguide oder Empfehlungsmaschine statt Suchmaschine
oder Nagelspezialist statt Nagelpflege.
2. Wortbildung: Überblick über die produktiven Wortbildungstypen
Die Wortbildungslehre untersucht und beschäftigt sich sowohl mit den wirkenden
Gesetzmäßigkeiten und entsprechenden Modellen bei der Bildung eines neuen Wortes
als auch mit der strukturellen Analyse eines ,,fertigen" Wortes. Im Fokus der Untersu-
chung stehen dabei die einzelnen sprachlichen Mittel, die bei der Bildung eines Wor-
tes verwendet werden, wie z.B. das Anfügen von Suffixen oder Präfixen. Die Wort-
bildung kann demnach als ein Verfahren bezeichnet werden, durch welches auf der
Grundlage von bereits vorhanden, bekannten Lexemen und Morphemen neue Wörter
produziert werden können. (vgl. Fleischer 1982: 19 ff.) Die Wortbildungstypen im
Deutschen sind jeweils durch eine typische Kombination von Wortbildungsmitteln
sowie durch eine bestimmte Strukturbedeutung gekennzeichnet. Die Bezeichnungen
der einzelnen Wortbildungstypen variieren in der Literatur. Einigkeit herrscht haupt-
sächlich über die beiden Grundtypen der Wortbildung der Komposition und der Deri-
22
vation. In dieser Arbeit wird noch zusätzlich der Terminus Kontamination aufgenom-
men, da dieser zu kreativen und werbesprachlich charakteristischen Beispiele beiträgt.
Zudem ist bei der Analyse der Neubildungen der Werbesprache ein Blick auf die Se-
mantik unerlässlich. Denn vor allem für das Hervorrufen von Aufmerksamkeit ist das
Spiel mit Wörtern und deren Bedeutungen von zentraler Bedeutung. So rufen viele
Bildungen Mehrdeutigkeiten und Anspielungen hervor. Zudem muss bei Wortbil-
dungskonstruktion, die einen großen Teil der Neubildungen einnehmen, zwischen
einer Gebrauchsbedeutung (= lexikalische Bedeutung) und einer Konstruktionsbedeu-
tung, d.h. sie referieren auf andere Wörter (= Motivationsbeziehungen) differenziert
werden. (vgl. Barz 1983: 66)
Geht man der pragmatischen Frage nach, welche Faktoren für die Auswahl einer be-
stimmten lexikalischen Einheit in der Werbesprache entscheidend sind oder warum in
einer bestimmten Situation eine spezielle Bezeichnung für eine bestimmte Bedeutung
ausgewählt wird, so bedarf es einer Betrachtungsweise nach semasiologischen und
onomasiologischen Aspekten. Im Mittelpunkt dieser Betrachtungsweise steht der Pro-
zess der Bildung der Wörter. Es geht dabei um die zentrale Frage, welche Wortbil-
dungsmodelle zum Ausdruck bestimmter Bezeichnungen verwendet werden. Hierbei
ist es notwendig die Regularitäten zu erfassen, die einer neuen Bildung zugrunde lie-
gen und den jeweiligen Wortbildungstyp zu ermitteln. Wortbildungstypen sind pro-
duktiv, wenn sie für die Bildung neuer Wörter genutzt werden. Diese stellen sozusa-
gen offene, erweiterungsfähige Wortbildungsreihen dar, wobei die Produktivität nicht
mit der Häufigkeit seines Vorkommens im Lexikon korreliert. Als unproduktiv wer-
den Wortbildungsmittel bezeichnet, wenn sie zwar als gespeicherte Wortbildungspro-
dukte durchaus noch in Reihen im Lexikon vorhanden sind, jedoch nicht mehr zur
Erweiterung dieser Reihen verwendet werden. (vgl. Krieg 2004: 53 ff, Hansen et all
1990: 32 ff.) In dieser Untersuchung zählen vor allem die Komposition, Derivation
und Kontamination zu den produktiven Wortbildungstypen. Hieraus ergibt sich fol-
gende Verteilung. Hier wird evident, dass die Komposition der mit Abstand produk-
tivste Typ in der Werbesprache ist. Die Derivation und Komposition sind dagegen
ungefähr gleich stark vertreten:
23
3. Komposition
3.1. Begriffsbestimmung
Die Komposition ist im Deutschen eines der Hauptverfahren zur Bildung neuer Wör-
ter. (vgl. Bauer 2001; Olsen 2000) Dabei werden zwei oder mehr Lexeme zu einem
komplexen Lexem zusammengefügt:
Bei der Komposition werden mindestens zwei Wörter [...] und/ oder Konfixe [...] zu ei-
nem Kompositum zusammengesetzt, [...]. Komposita können auch aus mehr als zwei
Wörtern und/ oder Konfixen bestehen, [...]. Zu unterscheiden sind vor allem, das Determi-
nativkompositum und das Kopulativkompositum. [...] (Donalies 2005: 51)
Die Dominanz der Komposita zeigt auch in die Auswertung des Gesamtkorpus. Hier
nehmen die kompositionellen Bildungen mehr als ein Drittel ein:
24
Diese Dominanz begründet sich darauf, dass die Sprache der Werbung eine stark
zweckbestimmte Sprache ist und vor allem ihre Wirkung durch die passende Auswahl
von Wörtern erzielt. Im Gegensatz zu anderen Wortbildungsmittel gelten Komposita
als solche Zusammensetzungen, deren Konstituenten in einem parataktischen Verhält-
nis stehen und wie addiert erscheinen
.
Durch die Zusammensetzung von z.B. zwei
Nomen oder Adjektiven können so nämlich sehr gut Eigenschaften und Beschreibun-
gen von Produkten ausgedrückt werden und stellen daher ein sehr beliebtes Mittel für
Werbetexter dar. Kompositabildungen sind auch deshalb eines der produktivsten
Wortbildungsmittel der Werbesprache, da sie oft durch eine plakative Aneinanderrei-
hung positiv konnotierter Einheiten entstehen, ohne dass es genaue Bedeutungsbezie-
hungen geben muss. Nach Sowinski ist die Kombination zweier oder mehrerer selbst-
ständiger Wörter oder Wortteile zu einem neuen Wort mit spezieller Bedeutung die
,,weitaus häufigste Form der Wortbildung in der Werbesprache". Dies liegt daran,
dass durch Komposita zahlreiche Variationsmöglichkeiten entstehen und diese sich
besonders gut für unterschiedliche Aussagezwecke eignen. Denn durch Komposita
können ,,Aussagen über Sachverhalte und Gegenstände" sowohl beliebig differenziert
als auch variiert werden. Zudem erlauben Komposita längere Aussagen in einem Wort
zusammenzufassen. Damit realisieren die Kompositabildungen das ,,Bestreben nach
sprachlicher Informationssammlung wie nach sprachlicher Ökonomie" auf eine ge-
schickte Art und Weise. (vgl. Sowinski 1979: 109)
Aufgrund der Quantität der Komposita ist interessant zu sehen, welche Branchen be-
sonders gerne Kompositabildungen für ihre Werbezwecke verwenden. Folgende Gra-
fik veranschaulicht diese Verteilung:
25
Spitzenreiter ist hier offensichtlich die Lebensmittelbranche, die mit 209 Komposita
einen entscheidenden Anteil an der Neubildung von Wörtern beiträgt. Mit einem ge-
wissen Abstand folgen darauf die Kosmetik- und Handel/Wirtschaftsbranche mit je-
weils 98 Belegen. Erwähnenswert sind zudem noch die Medien- und Che-
mie/Haushaltsbranche mit 53 bzw. 42 neugebildeten Komposita.
Begründet kann diese Dominanz der Lebensmittelbranche dadurch, dass diese Bran-
che verstärkt Werbung betreibt und im Vergleich zu anderen Branchen einen sehr
großen Bereich mit vielen Konkurrenzanbietern darstellt. Zudem hat sich die Bedeu-
tung der Lebensmittelindustrie in der Gesellschaft in den vergangen Jahren stark ver-
ändert. Auf den Markt werden jährlich zahlreiche neue Produkte gebracht und die
Verbraucher interessieren sich darüber hinaus immer mehr für Informationen, die mit
Ernährung und Gesundheit zusammenhängen. In einem westlichen Industrieland wie
Deutschland, welches über unbeschränkte Ressourcen über Nahrungsmittel verfügt, ist
der ,,Akt zur physischen Reproduktion allerdings nur unzulänglich charakterisiert".
(Krüger 1977: 111) Dies soll am Beispiel der Margarine veranschaulicht werden. Für
diese wird weniger geworben, dass sie satt macht, sondern vielmehr steht die Befrie-
digung gustatorischer Bedürfnisse, sowie die Erhaltung der Gesundheit bzw. der
Schutz vor Krankheit im Vordergrund. Dies stützen auch die Slogans des Korpus, da
diese weniger mit dem Sättigungsfaktor werben, sondern vielmehr mit besonderem
26
Geschmack (knusperfrisch, zungenzärtlich, feinwürzig, Stargeschmack) oder der
schlankmachenden Wirkung des Produkts (Schlankweg, Schlanke-Schlemmer-Quark,
Schlankheitskost).
Das Thema Gesundheit und Ernährung steht zwar momentan sehr im Fokus der Ge-
sellschaft, besonders im Hinblick auf eine gesundheitsbewusste Ernährung bei Kin-
dern, jedoch unterscheidet sich das reale Kaufverhalten in vielen Fällen stark davon.
Vielmehr werden die meisten Produkte im Lebensmittelbereich habituell gekauft.
Dies Verhalten liegt vor, wenn der Kauf bestimmter Produkte zur Gewohnheit, zur
,,unreflektierten Verhaltensnorm" wird. Dies zeigt sich z.B. in dem Zustand, dass
wenn die Milch im Kühlschrank zu Ende geht, ohne weitere Überlegungen eine neue
gekauft wird. (vgl. von Rosenstiel/ Neumann 2002: 45) Dies liegt auch daran, dass
viele Menschen wenig Zeit haben und den Werbeaussagen viel zu oft Glauben schen-
ken. So wird z.B. für ein zuckerhaltiges Erfrischungsgetränk für Kinder mit dem Slo-
gan Der gesunde Durstlöscher geworben. Zum anderen werden auch Entscheidungen
oft aus der Wiedererkennung heraus getroffen, z.B. hat man am Abend davor eine
Werbung für ein neues Produkt gesehen, dieses zwar im Laufe des Tages wieder ver-
gessen, aber beim Einkauf erinnert die Präsenz des Produktes an die Werbebotschaft
und in diesem Zusammenhang fällt dann oft die Kaufentscheidung. In der Psychologie
wird diese Art von Kaufentscheidung als ,,Wiedererkennungsimpulskauf" bezeichnet,
d.h. ,,man wird durch die Wahrnehmung des Artikels daran erinnert, dass man ihn
braucht." (von Rosenstiel/Neumann 2002: 258) Aufgrund dieser Tatsachen müssen
die Hersteller mit ihrer Werbung Gründe anbieten, weshalb der Verbraucher sich für
sein Produkt entscheiden soll. Da der Kontakt des Verbrauchers mit der Werbebot-
schaft im Normalfall aber nur auf wenige Sekunden beschränkt ist, muss die Botschaft
daher sehr kurz, aber dennoch aussagekräftig gehalten werden. Dies lässt sich mit
Kompositabildungen am besten realisieren. Denn die Erfindung von neuen Komposi-
tionen und Begriffen in der Lebensmittelbranche ermöglicht Produkteigenschaften
besonders stark zu betonen. So soll mit dem Kompositum schäfchenweich oder
Schmusewolle die besondere Weichheit des Produktes beschreiben oder mit fruchtig-
frisch wird auf den besonderen Fruchtgeschmack und Frische des Produktes aufmerk-
sam gemacht. Zudem können durch Komposita Assoziationen zu anderen Bereichen
ausgelöst werden. So weckt das Kompositum frühlingsfrisch die Erinnerung an die
ersten Frühlingstage nach dem Winter oder durch das Kompositum Sonntagskartoffel
wird dem einfachen Produkt Kartoffel ein Mehrwert in Richtung Festtagsessen gege-
27
ben.
Der Großteil der Zusammensetzungen folgt im Standarddeutschen dem Typus des
Determinativkompositums. Dabei bestimmt das Erstglied (=Bestimmungswort) das
Zweitglied (=Grundwort) näher. Das Grundwort legt zugleich Genus und Wortart der
gesamten Konstruktion fest und ist somit kategoriebestimmend (z.B. Gesundbrunnen;
Nomen). Der Hauptakzent liegt auf dem Determinans, der Nebenakzent auf dem De-
terminatum. Weiter sind paradigmatische und unparadigmatische Fugenelemente und
die iterierbare Reihenfolge, Determinans vor Determinatum, typisch (z.B. Goldkante
vs. *Kantegold) Graphisch wird die Einheit der Komposita meistens durch Zusam-
menschreibung ausgedrückt. Abweichungen wie durch Bindestrich-, Getrennt-, und
Binnengroßschreibung, werden in der Werbesprache hauptsächlich aus Gründen der
expressiven Wirkung eingesetzt (Super-Saugweg-Wischkraft-Rolle). Kopulative
Kompositionen kommen im Standarddeutschen dagegen weit weniger häufig vor.
Kennzeichen eines Kopulativkompositums ist, dass beide Teile semantisch gleich be-
rechtigt sind und zur gleichen Kategorie gehören (mildfrisch). Hauptakzent liegt hier
auf dem Zweitglied mit starkem Nebenakzent auf dem Erstglied. Zudem ist die Rei-
henfolge der beteiligten Konstituenten prinzipiell vertauschbar (frischsaftig vs. saftig-
frisch). (vgl. Altmann/ Kemmerling 2000: 32 ff., Lohde 2006: 36 ff.)
In der Abgrenzung zwischen Determinativ- und Kopulativkompositum ist sich die
Forschung allerdings uneins:
Über die Enge der Interpretation als Kopulativkompositum gibt es unterschiedliche Auffas-
sungen in der Wortbildungsforschung bis hin zur Negation dieser Bildung als eigenen
Kompositionstyp. (Römer/Matzke 2005: 79)
Dies zeigt sich bereits an der Vielzahl der existierenden Termini seitens der Kopula-
tivkomposita. So werden diese sowohl als appositive, appositionelle, koordinative,
konjunkte, konjunktive oder attributive Komposita als auch Additiva, Anreih-
Komposita, Reihenwörter, Zwillingsformen oder Verbindungszusammensetzungen
bezeichnet. Als Differenzierungsmerkmal wird oft die prinzipielle Unvertauschbarkeit
der Einheiten ohne wesentliche Bedeutungsveränderung in Determinativkomposita
angeführt (z.B. fingerlang Langfinger). Jedoch ist auch bei manchen Kopulativ-
komposita eine Vertauschung der Konstituenten nicht möglich, z.B. eine rot-gelb-
grüne Ampel. Zudem steht zur Diskussion, ob auch einige substantivische und verbale
Komposita neben den adjektivischen Komposita zu dieser Kategorie gezählt werden
sollen. Jedoch besitzen viele dieser Zusammensetzungen eine determinative Lesart
und legen ihr Genus durch das Grundwort fest. (z.B. der Radiowecker (m) das Radio
28
(n) + der Wecker (m)). Dies ist jedoch typisch für Determinativkomposita und nicht
für Kopulativkomposita. (vgl. Donalies 2007: 62 ff.)
Die Kombinationsmöglichkeiten bei der Komposition sind vielfältig und unterliegen
nur wenigen Beschränkungen. Grundsätzlich können die Kompositionstypen in drei
große Haupttypen unterteilt werden: Die Substantiv-, die Adjektiv- und die Verbkom-
position.
Folgende Grafik veranschaulicht diese Verteilung:
Hier wird sehr deutlich, dass die Gruppe der Substantivkompositionen den anderen
beiden Wortbildungstypen eindeutig überlegen ist und den Bereich der Neubildungen
dominiert. Dieses Ergebnis ist sich auch in anderen Studien über die Wortartenvertei-
lung in der Werbesprache zu finden:
Sowohl Substantive als auch Adjektive sind überproportional häufig Neologismen, deren
lexikalischer Innovationswert sich in der Regel aus der Kombination von zwei oder mehre-
ren Basismorphemen ergibt. (Krüger 1977: 63)
3.2. Die Substantivkomposition
Für eine Untersuchung der Substantivkomposita nach morphologischen und syntakti-
schen Aspekten ist es sinnvoll, die Konstituenten in die einzelnen Wortarten zu seg-
mentieren. Folgende Grafik veranschaulicht diese Verteilung:
29
Dabei wird ersichtlich, dass die Nomen-Nomen-Komposition allen anderen Kombina-
tionen weit überlegen ist. Mehr als zwei Drittel der Substantivkomposita bestehen aus
dieser Zusammensetzung. Produktiv kann in diesem Zusammenhang nur noch die
Verb-Nomen-Komposition und Adjektiv-Nomen-Komposition bezeichnet werden. Im
Folgetext sollen nun die einzelnen Kombinationstypen besprochen und analysiert
werden.
3.2.1. Nomen-Nomen
Die Dominanz der Nomen-Nomen-Kombination ist nicht nur ein Phänomen der Wer-
besprache, sondern spiegelt sich auch im Standarddeutschen wider. Dieser Typ, so
Erben, zählt im Deutschen sprachhistorisch zu ,,der ältesten und prototypischsten Va-
riante." Dieser Kompositionstyp ist daher sehr beliebt, da dieser eine bequeme Mög-
lichkeit ,,der knappen umrisshaft andeutenden Benennung" darstellt. Dieser Komposi-
tionstyp ist ,,eine ökonomische Ausdrucksform", die anstelle ,,sehr komplexer syntak-
tischer Verbindungen" gebraucht und zur Wiedergabe ,,sehr verschiedenartig logi-
scher Beziehungen" verwendet werden kann. Durch die Form der Zusammensetzung,
30
können Aussagen kurz und knapp zusammengefasst werden. Zudem ist Verlass auf
die ,,lexikalische Füllung des konventionell genutzten Strukturschemas sowie die Auf-
füllung durch den Ko(n)text". (Erben 2006: 67) Weiter bietet eine Komposition den
Vorteil, sich nicht präzise festlegen zu müssen. Die Präferenz an diesem Wortbil-
dungstyp liegt zudem auch an dem großen Anteil der Substantive am Gesamtwort-
schatz. Zudem gibt es nur wenige Restriktionen für die Bildungen solcher Varianten.
Eine Inkompatibilität ergebe sich lediglich aus der Kombination von Synonymen oder
von Personenbezeichnungen. (vgl. Erben 2006: 68) Auf der psychologischen Ebene
liegt der Grund für die Präferenz dieser Art der Zusammensetzungen darin, dass
,,durch inhaltsreiche Substantive die Schnelligkeit der Informationsaufnahme gestei-
gert werden kann." (Kroeber-Riel/ Meyer-Hentschel 1982: 161) So teilt das Komposi-
tum Der Schlanke-Schlemmer-Quark dem Käufer sofort zwei wichtige Eigenschaften
mit. Zum einen, dass dieser auf die schlanke Linie achtet und zum anderen dass dieser
(trotzdem) ein Quark für Genießer ist.
Da die Nomen-Nomen-Kompositionen mit Abstand den weitaus größten Teil des
Korpus einnehmen und daher gesagt werden kann, dass diese einen erheblichen Bei-
trag zu Neubildungen in der Werbesprache leisten, soll diese Gruppe ausführlicher
besprochen werden. Dies geschieht in einer weiteren Differenzierung nach den seman-
tischen Relationen der einzelnen Konstituenten.
Das Klassifikationsschema stammt
dabei aus dem Forschungsprojekt ,,Nominale Kompositionen" aus der ,,großen Inns-
brucker Bestandsaufnahme zur Wortbildung des heutigen Deutsch" von Loreliese
Ortner, Elgin Müller-Bollhagen, Hanspeter Ortner, Hans Wellmann, Maria Pümpel-
Mader und Hildegard Gärtner. Die Substantivkomposita werden in dieser Studie unter
anderem im Hinblick auf ihre syntagmatischen und paradigmatischen Beziehungen
untersucht. Jedoch wurde das Klassifikationsschema nicht eins zu eins übernommen,
sondern an die Korpusbeispiele angepasst und dementsprechend modifiziert. So wur-
den die Komposita nicht in den zahlreichen Untertypen zugeordnet, sondern auf sie-
ben Haupttypen aufgeteilt. Dies begründet sich darauf, dass zwischen den einzelnen
Typen zahlreiche Überschneidungen existieren und daher eine konkrete Zuweisung
sich sehr schwierig gestaltet. Zudem belegt der Korpus einzelne Untertypen nur sehr
spärlich oder gar nicht. Für einen bessern Überblick ist daher eine grobflächigere Zu-
ordnung sinnvoller. Dementsprechend wurden die Komposita in folgende Kategorien
unterteilt:
1. Gleichsetzungskomposita
31
2. Kennzeichnungskomposita
3. Zugehörigkeitskomposita
4. Bezugskomposita
5. Komposita der räumlichen und zeitlichen Einordnung
6. Bedingungs-, Begründungs- und Bewirkungskomposita
7. Komposita zur Kennzeichnung von Modalverhältnissen
Gleichsetzungskomposita bringen die beiden Konstituenten mit einem Vergleich in
Verbindung. Deshalb kann ein Teil dieser auch als komparational bezeichnet werden.
So stellt das Kompositum Luftschokolade einen Vergleich zur Schwerelosigkeit der
Luft dar und drückt damit aus, dass das Produkt so leicht wie die Luft ist. Durch das
Kompositum Seerosenfrische wird ein Vergleich zum Duft einer Seerose gezogen. In
der Funktion als semantisches Rollenpaar wird der zweiten Konstituente durch die
erste eine Eigenschaft zugeschrieben. Die erste Konstituente charakterisiert sich dabei
hinsichtlich ihrer Funktion. Beispielhafte Vertreter sind hierbei Fettbackgerät (,Gerät,
mit welchem Lebensmittel mithilfe von Fett gebacken werden können`) oder Millio-
nenspiel (,Spiel, bei dem Millionen gewonnen werden können`). Oft übernimmt die
erste Konstituente auch eine verdeutlichende Funktion ein und konkretisiert den, in
der zweiten Konstituenten genannten Sachverhalt. Dabei besitzt diese häufig keinen
semantischen Neuwert, so z.B. bei Serviceauskunft (eine Auskunft ist bereits ein Ser-
vice), Pausensnack (ein Snack ist eine kleine Mahlzeit, der in einer Pause gegessen
wird). Zu dieser Kategorie gehören auch Komposita, die ein Ausmaß bezeichnen. Ein
sogenanntes ,,mensuratives" Kompositum liegt bei Milchmahlzeit vor. Die zweite
Konstituente hat hierbei das Ausmaß der ersten. Eine Milchmahlzeit ist also eine
,Mahlzeit Milch`.
Substanzkomposita dagegen beschreiben einen Komplex aus einem Element der Ka-
tegorie Masse in der Konstituente A und einer vorhandenen Menge in der Konstituen-
te B. Dabei wird eine Einzelgröße in den Bezug mit einer Mengenbezeichnung ge-
setzt, wie z.B. Lederlenkrad (,Lenkrad aus Leder`), Stahlgürtelreifen (,Reifen aus
Stahl`) oder Heuunterbett (,Unterbett aus Heu`). Die Grenze zu den darauf folgenden
Kennzeichnungskomposita ist dagegen sehr verschwommen. Denn Kennzeichnungs-
komposita benennen eine Größe nach ihrem Teil oder Qualität oder eine Zeit oder
einen Ort nach etwas Bestehendem. Bei diesen steht somit auch der Aspekt des Kenn-
zeichnens im Vordergrund. Dies trifft damit auch für solche Beispiele zu, die das Pro-
dukt näher spezialisieren sollen. Deshalb ist eine Abgrenzung zu den Substanzkompo-
32
sita schwierig. Beispielhaft stehen hierfür Fruchtquark (,Quark aus Früchten`), Al-
penmilchschokolade (,Schokolade aus Alpenmilch`), Urlaubsmesse (,Messe für Ur-
laub`), Milchreme (,Creme aus Milch`), Nussöl (,Öl aus Nüssen`), Eisgebäck (,Ge-
bäck aus Eis`) oder Sonnenlbumenmargerine (,Margerine aus Sonneblumen[kernen]`).
Zugehörigkeitskomposita dagegen kennzeichnen eine Größe nach ihrer partitiven oder
soziativen Beziehung zu einer übergeordneten Größe. Eine partitive Beziehung ent-
spricht dabei eine Teil-Ganzes-Beziehung auf possessiver Basis z.B. Familienseife
(,Seife für die/der Familie`). Der Aspekt der Zugehörigkeit zwischen zwei Konstitu-
enten lässt sich am einfachsten in die Auflösung in eine Genitivkonstruktion aufzei-
gen. Dies trifft dann vor allem bei Komposita zu, die durch die Genitivkonstruktion
eine Eigenschaft benennen:
Fruchtgeschmack (,Geschmack der Frucht`)
Männerdurst (,Durst der Männer`)
Pilsgeschmack (,Geschmack des Pils`)
Die Mehrzahl der Nomen-Nomen-Komposita des Korpus stellt jedoch einen Bezug
zwischen den beiden Konstituenten her. Diese sogenannten Bezugskomposita können
am besten durch die Prädikation ,B bezieht sich auf A` ausgedrückt werden. Häufig
beziehen diese sich dabei auf ein bestimmtes Thema bzw. Inhalt eines Produktes.
Nach der semantischen Rolle von A können drei Hauptgruppen unterschieden werden:
Themaorientiert:
Das Rollenpaar beschreibt in der A-Konstituente ein Thema und in der B-Konstituente
eine Ausdrucksform:
Geländewagenmagazin, Shoppingmagazin, Statusmagazin, Seniorenmagazin, Fuß-
ballmagazin, Angelmagazin
Dieser Typ tritt im Korpus auch gern in der Verbindung mit dem Lexem Kultur auf:
Fußballkultur, Pilskultur, Körperkultur, Rheinkultur, Deutschlandkultur, Bürokultur,
Weinkultur, Netzkultur
Semantisch und stilistisch bedingt diese Verbindung. dass dem Produkt ein gewisser
Zeitgeist zugeschrieben wird und in eine höhere (geistige) Ebene hebt.
Zudem können die Konstituenten in das semantische Rollenverhältnis ,,repräsentiertes
Objekt Repräsentant" geformt werden: Kommunikationspflege oder Schlankheits-
kursus
Zielorientiert:
Das Rollenpaar repräsentiert hier einen Bezug auf eine zielorientierte Größe:
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836643603
- Dateigröße
- 2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München – Deutsche Philologie, Germanistische Linguistik
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Schlagworte
- werbesprache kompositum derivation adjektiv kontamination
- Produktsicherheit
- Diplom.de