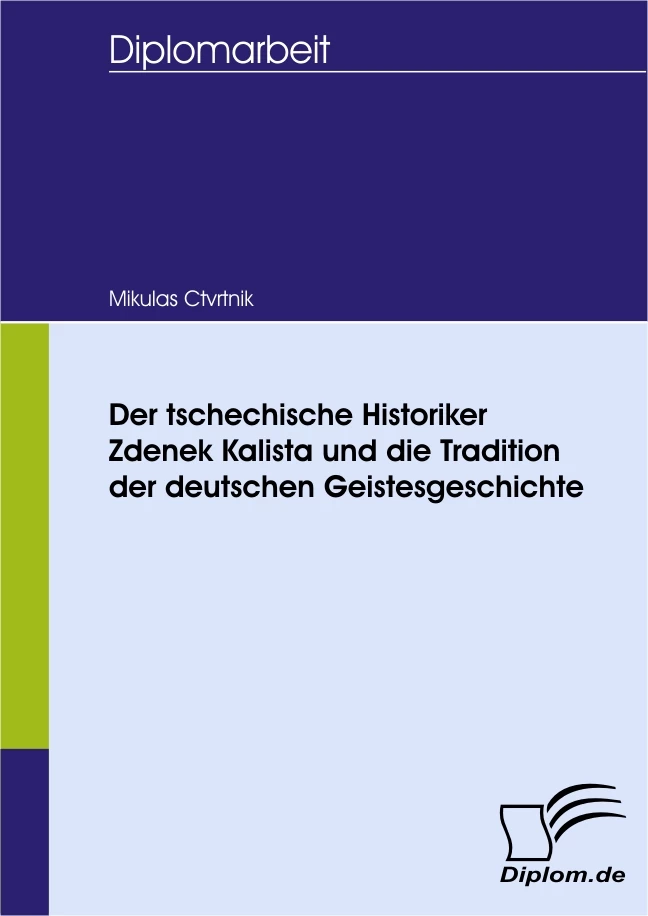Der tschechische Historiker Zdenek Kalista und die Tradition der deutschen Geistesgeschichte
©2008
Diplomarbeit
129 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Zdenek Kalista (1900-1982) gehört zu den bedeutendsten tschechischen Historikern des 20. Jahrhunderts. Er war der Schüler von Josef Pekar (1870-1937), der großen Gestalt der tschechischen Historiographie, der auch im deutschsprachigen Raum bekannt ist. In seinem Werk konzentrierte er sich einerseits auf die Barockzeit, an die er sich bemühte, in geistesgeschichtlicher Weise heranzugehen. Andererseits verfasste er zwei Studien, die er explizit dem Versuch widmete, die Richtung der Geistesgeschichte methodologisch zu untermauern. An diesen Texten arbeitete er bereits seit dem Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die erste Studie Kalistas von methodologisch-theoretischer Art Cesty historikovy konnte noch vor Antritt des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei erscheinen. Die zweite Studie, die einfach Duchové dejiny betitelt ist, wurde aus Kalistas Nachlass in der Gedenkstätte für Nationalliteratur (Památník národního písemnictví) mit Sitz in Prag herausgegeben, und zwar erst viele Jahre nach dem Sturz des kommunistischen Regimes in den böhmischen Ländern. Die erste Übersetzung Kalistas Studie Dejiny duchové in die deutsche Sprache wird als Anhang in dieser Arbeit veröffentlicht.
Das Schicksal von Zdenek Kalista nach dem kommunistischen Februarumsturz war kein erfreuliches. Kalista wurde im Jahr 1951 in einem konstruierten politischen Prozess zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Freilassung erlebte er 1960 und seine Rehabilitation erst sechs Jahre später. Am Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts in der Zeit des Prager Frühlings konnte er als außerordentlicher Professor an die Philosophische Fakultät der Karlsuniversität in Prag zurückkehren. Nach Beginn der Normalisierung in der Tschechoslowakei in den 70er Jahren war Kalista gezwungen, sich wieder in Abgeschiedenheit zurückzuziehen. Einige Jahre vor seinem Tod erblindete er. Er starb 1982. Den Sturz des Kommunismus in der Tschechoslowakei erlebte er nicht mehr.
Das Thema dieser Arbeit ist vor allem, die grundlegenden Züge der Geschichtsmethodologie bei Zdenek Kalista zu untersuchen, wie er sie vor allem für sein Konzept der Geistesgeschichte entworfen hat, die er als spezifischen Wissenschaftszweig im Rahmen der Geisteswissenschaften gründen wollte. Die Geistesgeschichte ist jedoch nichts, was Kalista auf der grünen Wiese gegründet hätte, sondern vor ihm wurde ab dem Ende des 19. Jahrhunderts und in den ersten Jahrzehnten in Deutschland eine […]
Zdenek Kalista (1900-1982) gehört zu den bedeutendsten tschechischen Historikern des 20. Jahrhunderts. Er war der Schüler von Josef Pekar (1870-1937), der großen Gestalt der tschechischen Historiographie, der auch im deutschsprachigen Raum bekannt ist. In seinem Werk konzentrierte er sich einerseits auf die Barockzeit, an die er sich bemühte, in geistesgeschichtlicher Weise heranzugehen. Andererseits verfasste er zwei Studien, die er explizit dem Versuch widmete, die Richtung der Geistesgeschichte methodologisch zu untermauern. An diesen Texten arbeitete er bereits seit dem Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die erste Studie Kalistas von methodologisch-theoretischer Art Cesty historikovy konnte noch vor Antritt des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei erscheinen. Die zweite Studie, die einfach Duchové dejiny betitelt ist, wurde aus Kalistas Nachlass in der Gedenkstätte für Nationalliteratur (Památník národního písemnictví) mit Sitz in Prag herausgegeben, und zwar erst viele Jahre nach dem Sturz des kommunistischen Regimes in den böhmischen Ländern. Die erste Übersetzung Kalistas Studie Dejiny duchové in die deutsche Sprache wird als Anhang in dieser Arbeit veröffentlicht.
Das Schicksal von Zdenek Kalista nach dem kommunistischen Februarumsturz war kein erfreuliches. Kalista wurde im Jahr 1951 in einem konstruierten politischen Prozess zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Freilassung erlebte er 1960 und seine Rehabilitation erst sechs Jahre später. Am Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts in der Zeit des Prager Frühlings konnte er als außerordentlicher Professor an die Philosophische Fakultät der Karlsuniversität in Prag zurückkehren. Nach Beginn der Normalisierung in der Tschechoslowakei in den 70er Jahren war Kalista gezwungen, sich wieder in Abgeschiedenheit zurückzuziehen. Einige Jahre vor seinem Tod erblindete er. Er starb 1982. Den Sturz des Kommunismus in der Tschechoslowakei erlebte er nicht mehr.
Das Thema dieser Arbeit ist vor allem, die grundlegenden Züge der Geschichtsmethodologie bei Zdenek Kalista zu untersuchen, wie er sie vor allem für sein Konzept der Geistesgeschichte entworfen hat, die er als spezifischen Wissenschaftszweig im Rahmen der Geisteswissenschaften gründen wollte. Die Geistesgeschichte ist jedoch nichts, was Kalista auf der grünen Wiese gegründet hätte, sondern vor ihm wurde ab dem Ende des 19. Jahrhunderts und in den ersten Jahrzehnten in Deutschland eine […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Mikulas Ctvrtnik
Der tschechische Historiker Zdenek Kalista und die Tradition der deutschen
Geistesgeschichte
ISBN: 978-3-8366-4333-7
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Karlsuniversität in Prag, Prag, Deutschland, Diplomarbeit, 2008
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
Dieses Buch entstand an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag im
Rahmen des Forschungsvorhabens MSM 0021620827 Die Böhmischen Länder inmitten
Europas in der Vergangenheit und heute, und zugleich ist das Buch Ergebnis des
Grantprojekts, das von der Grantagentur der Karlsuniversität in Prag (GAUK), Nummer
20209, unterstützt wird.
2
Inhalt
I. EINLEITUNG...5
II. DEUTSCHE GEISTESGESCHICHTE...7
1. Der Begriff der deutschen Geistesgeschichte...7
a) ,,Problemhistoriker" und ,,Geisteshistoriker"...11
3. Die Entwicklung der Geistesgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg ...14
4. Kalista zum Begriff der Geistesgeschichte...19
III. KALISTAS GEISTESGESCHICHTE ...23
1. Der Gegenstand der Geistesgeschichte ...23
a) Der Begriff und seine Geschichte...23
b) Begriffsgeschichte ...26
i) Zdenk Kalista...26
ii) Begriffsgeschichte in Deutschland: Koselleck...28
iii) Kalista und die deutsche Begriffsgeschichte...31
c) Mentalitätengeschichte und Kalistas Geistesgeschichte...32
i) Die gemeinsame Kritik der Mentalitätengeschichte und Kalistas Geistesgeschichte...34
d) Kulturgeschichte und Kalistas Geistesgeschichte ...36
i) Kalistas Begriff der Kulturgeschichte ...36
ii) Kulturgeschichte ...38
2. Geistesgeschichte als Wissenschaft ...41
a) Das Konzept der Geistesgeschichte ...41
b) Die Geistesgeschichte als neuer Wissenschaftszweig unter den übrigen Wissenschaften ...43
c) Die Beziehung von Zeit und Individuum bei Jaroslav Goll:...44
d) Kalistas Begriff ,,Zeit"...45
i) Die drei Stadien im Verfahren der Geistesgeschichte. Das Stadium der ,,Belebung des historischen
Fakts"...47
ii) Wandlungen der ,,Zeiten" in der Geschichte ...48
iii) Kalistas methodisches Vorgehen von der Zeit zum Einzelnen und umgekehrt ...53
e) Der Begriff der ,,Zeit" bei Kalista und Peka ...54
i) Der Begriff der ,,Zeit" auf der Ebene theoretischer Arbeiten ...54
ii) Der Begriff der ,,Zeit" auf der Ebene konkreter historischer Arbeiten ...56
f) Wie äußert sich Kalistas ,,Zeitgeist" in der Realität ...57
IV. DIE ROLLE DES SUBJEKTS IM HISTORISCHEN ERKENNEN ...62
1. Die Auffassung des Subjekts im Prozess des historischen Erkennens bei Zdenk Kalista...62
2. Vergleich der Rolle des Subjekts bei Max Dvoák und Zdenk Kalista...68
a) Die Beziehung von Subjektivität und Objektivität bei Max Dvoák...68
b) Die Beziehung von Subjektivität und Objektivität bei Zdenk Kalista ...70
V. SCHLUSS: KALISTAS GEISTESGESCHICHTE UND DIE DEUTSCHE
GEISTESGESCHICHTE...72
3
LITERATUR...75
I. Werke...75
II. Sekundärliteratur...77
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS...80
RESÜMEE IN ENGLISCHER SPRACHE ABSTRACT IN ENGLISCH...81
ANHANG: ZDENK KALISTA: GEISTESGESCHICHTE
...82
EINLEITUNG...83
I. ...84
II...90
III...96
IV. ...102
V...108
VI. ...116
SCHLUSS...122
4
I.
EINLEITUNG
Zdenk Kalista (1900-1982) gehört zu den bedeutendsten tschechischen Historikern des 20.
Jahrhunderts. Er war der Schüler von Josef Peka (1870-1937), der großen Gestalt der
tschechischen Historiographie, der auch im deutschsprachigen Raum bekannt ist. In seinem
Werk konzentrierte er sich einerseits auf die Barockzeit, an die er sich bemühte, in
,,geistesgeschichtlicher" Weise heranzugehen. Andererseits verfasste er zwei Studien, die er
explizit dem Versuch widmete, die Richtung der Geistesgeschichte (auf Tschechisch
,,duchové djiny") methodologisch zu untermauern. An diesen Texten arbeitete er bereits seit
dem Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die erste Studie Kalistas von methodologisch-
theoretischer Art Cesty historikovy
1
konnte noch vor Antritt des kommunistischen Regimes in
der Tschechoslowakei erscheinen. Die zweite Studie, die einfach Duchové djiny betitelt ist,
wurde aus Kalistas Nachlass in der Gedenkstätte für Nationalliteratur (Památník národního
písemnictví) mit Sitz in Prag herausgegeben, und zwar erst viele Jahre nach dem Sturz des
kommunistischen Regimes in den böhmischen Ländern.
2
Die erste Übersetzung Kalistas
Studie Djiny duchové in die deutsche Sprache wird als Anhang in dieser Arbeit
veröffentlicht.
Das Schicksal von Zdenk Kalista nach dem kommunistischen Februarumsturz war
kein erfreuliches. Kalista wurde im Jahr 1951 in einem konstruierten politischen Prozess zu
15 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Freilassung erlebte er 1960 und seine Rehabilitation erst
sechs Jahre später. Am Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts in der Zeit des Prager
Frühlings konnte er als außerordentlicher Professor an die Philosophische Fakultät der
Karlsuniversität in Prag zurückkehren. Nach Beginn der Normalisierung in der
Tschechoslowakei in den 70er Jahren war Kalista gezwungen, sich wieder in
Abgeschiedenheit zurückzuziehen. Einige Jahre vor seinem Tod erblindete er. Er starb 1982.
Den Sturz des Kommunismus in der Tschechoslowakei erlebte er nicht mehr.
Das Thema dieser Arbeit ist vor allem, die grundlegenden Züge der
Geschichtsmethodologie bei Zdenk Kalista zu untersuchen, wie er sie vor allem für sein
Konzept der Geistesgeschichte entworfen hat, die er als spezifischen Wissenschaftszweig im
Rahmen der Geisteswissenschaften gründen wollte. Die Geistesgeschichte ist jedoch nichts,
was Kalista auf der grünen Wiese gegründet hätte, sondern vor ihm wurde ab dem Ende des
19. Jahrhunderts und in den ersten Jahrzehnten in Deutschland eine gleichnamige Richtung
betrieben. Kalista selbst reflektierte seinen deutschen Vorgänger. Er wies allerdings darauf
hin, dass seine Geistesgeschichte etwas anderes sein soll, als es die deutsche
Geistesgeschichte sein wollte, als sie sich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts im
deutschen Raum konstituierte. Wir werden uns daher auch der deutschen Form der
Geistesgeschichte widmen, und zwar nicht nur in ihren Anfängen, sondern wir versuchen,
auch ihre Entwicklung in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu dem Stand zu
bewerten, auf dem sie sich heute befindet.
Für ein tieferes Verständnis von Kalistas Platz nicht nur im Rahmen der
tschechischen Historiographie, sondern auch im Kontext der europäischen, vor allem
deutschen Historiographie, erwähnen und charakterisieren wir kurz die historiographischen
1
Das Buch erschien in Prag 1947. Neuausgabe, laut der ich in diesem Artikel zitieren werde, KALISTA,
Zdenk: Cesty historikovy [Die Wege des Historikers], In: KALISTA, Zdenk: Cesty historikova myslení, Prag
2002, S. 21187. Weiterhin werde ich auf Kalistas Studie ,,Cesty historikovy" die im Rahmen der Cesty
historikova myslení veröffentlicht wurde, mit der Abkürzung CHM, CH verweisen.
2
KALISTA, Zdenk: Djiny duchové, In: KALISTA, Zdenk: Cesty historikova myslení, Prag 2002, S. 189
257. Weiterhin werde ich auf Kalistas Studie ,,Djiny duchové" mit der Abkürzung CHM, DD verweisen.
5
Richtungen Begriffsgeschichte, Mentalitätengeschichte, Kulturgeschichte, die Kalistas
Geistesgeschichte, aber auch der deutschen Geistesgeschichte nahestanden.
Die Frage nach dem Charakter von Kalistas Geschichtsmethodologie führt zu dem
Problem, wie der Platz und die Rolle des Subjekts, das die Geschichte erkennt, definiert
werden soll. In Kalistas Fall können wir auch vom Subjekt sprechen, das die Geschichte
,,wiederdurchleben" soll. Wenn wir die Dichotomie ,,verstehen erklären" in Betracht
ziehen, die als typisch in den methodologischen Diskussionen in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts nicht nur in Deutschland,
sondern auch in böhmischen Ländern auftauchte, können wir Kalista begründet in die
Richtung der ,,verstehenden Historiographie" einordnen.
Die vorgelegte Arbeit setzte sich das Ziel, zur Forschung der Geschichtsmethodologie
nicht nur der tschechischen, sondern auch der europäischen, vor allem der deutschen
Historiographie beizutragen. Zdenk Kalista wird häufig dafür kritisiert, dass er dem Subjekt,
das an die Geschichte herantritt und sie erkennt, zu viel Freiraum ließ. Kann man Kalista
wirklich vorwerfen, dass er den Platz, den das erkennende Subjekt im Prozess der Erkenntnis
der Geschichte hat, überbewertete? Ist es wirklich möglich, Kalista für einen rein
,,subjektivistischen Relativisten" zu halten? Das werden einige der Fragen sein, auf die wir in
der vorgelegten Arbeit zu antworten versuchen.
6
II. DEUTSCHE GEISTESGESCHICHTE
1. Der Begriff der deutschen Geistesgeschichte
Was ist eigentlich die deutsche Geistesgeschichte, eine der Richtungen der Historiographie in
den deutschsprachigen Ländern am Ende des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts?
Das erste Problem tritt bereits beim Ausdruck Geist (Tschechisch ,,duch") auf, das Träger
vieler Bedeutungen ist. Holger Klein geht von der Definition der Geistesgeschichte aus, wie
Eduard Spranger sie darbot, der unter anderem auch in ihren Rahmen eingeordnet werden
kann. Die Geistesgeschichte ist seiner Ansicht nach keine separierte Disziplin mit einem
eigenen Gegenstand, sondern es handelt sich eher um den Charakter der Methodologie oder
um einen gewissen Umfang an Zugehensweisen zur Historiographie.
3
Max Wehrli definiert
die Geistesgeschichte als ,,wissenschaftliche Methode oder Strömung", deren Hauptvertreter
vor allem zwischen die Jahre 1910-1925 eingeordnet werden können.
4
Eine genaue
Definition der Geistesgeschichte ist jedoch schwierig, was auch einen der Gründe für die
häufigen Einwände gegen sie darstellt.
Wenn Klein die Geistesgeschichte mit anderen Richtungen der Historiographie
vergleicht, schreibt er, dass sie weder mit der Ideengeschichte noch mit der Geschichte des
Denkens noch mit der Kulturgeschichte oder der Mentalitätengeschichte identisch ist. Alle
diese Richtungen haben gemäß Kleins Definition ihren Platz in der Geistesgeschichte, sind
allerdings begrenzter und im Hinblick auf sie präziser definiert.
5
In einem Vergleich der Ideengeschichte und der Geistesgeschichte heißt es, während:
,,die Ideengeschichte das Werden einzelner Ideen verfolgt, so stellt die Geistesgeschichte die
einzelnen Ideen nicht nur für sich, sondern im Zusammenhang mit dem gesamten
Geistesleben, als Faktoren neben andern und in Wechselwirkung mit anderen dar."
6
Die
,,geistesgeschichtliche" Abhandlung hebt so die Idee aus ihrer Isolation im Rahmen der
betreffenden Wissenschaft oder des Fachs und erforscht sie im Rahmen des allgemeinen
geistigen Lebens.
Klein nimmt die Geistesgeschichte vor allem als überwiegende Mode der deutschen
Bildungsschicht während der ersten dreißig bis vierzig Jahre des 20. Jahrhunderts wahr.
7
Es
entstand jedoch nie eine fest geschlossene Schule oder Bewegung. Auch deshalb ist es
3
,,In the most widely accepted understanding it is not a separate discipline with its own distinct subject, but a
methodology or a rather a certain range of approaches to history.", KLEIN, Holger: Geistesgeschichte, In:
Dictionnaire International des Termes Littéraires
, zit. gemäß: http://www.ditl.info/arttest/art1972.php, S. 1.
(Zitieren von Internetseiten in dieser Arbeit ist zum 20.6.2008).
4
,,Aus dem Appellativ ,Geistesgeschichte` ist also der Eigenname einer wissenschaftlichen Methode oder
Strömung geworden, deren Hauptvertreter in die Jahre 1910 bis 1925 und die umgebende zeitliche Zone
angesetzt werden können. Eine Definition ist allerdings schwierig, und diese Schwierigkeit, die mit dem
allgemeinen und schillernden Sinn der verwendeten Termini zusammenhängt, ist auch wohl der Haupteinwand
gegen die ganze ,Schule` geworden.", WEHRLI, Max: Was ist/war Geistesgeschichte?, In: Christoph KÖNIG
Eberhard LÄMMERT (Hrsg.), Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 19101925, Frankfurt am Main
1993, S. 23.
5
,,Also, it is not identical with history of ideas or history of thought, nor with cultural history or even that of
mentalities; they play a significant part in Geistesgeschichte but are more confined." K
LEIN
, Geistesgeschichte,
S. 12.
6
SEEBERG, Erich: Theologische Literatur zur neueren Geistesgeschichte, Deutsche Vierteljahrsschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 3, 1925, S. 464.
7
,,Geistesgeschichte was the prevailing mode of German-language scholarship during the first three or four
decades of the 20
th
century.", KLEIN: Geistesgeschichte, S. 2.
7
schwierig, diese Strömung präziser zu begrenzen und zu definieren. Die Geistesgeschichte
spiegelte sich im Grunde in allen Geisteswissenschaften wider, gleich ob das in der
Philosophie Ernst Cassirer, Theodor Litt, Georg Misch, Erich Rothacker, Eduard Spranger
und andere oder in der Religionsgeschichte Ernst Troeltsch, in der Sozialgeschichte Karl
Mannheim oder Max Weber, in der Kulturgeschichte Karl Lamprecht, Friedrich Meinecke,
Oswald Spengler und andere, in der Kunstgeschichte Max Dvoák usw. waren.
8
Wie zu
sehen ist, pflegen in die Geistesgeschichte Autoren eingeordnet zu werden, bei denen es auf
den ersten Blick gar nicht so scheint, als ob sie etwas gemeinsam hätten. In die gleiche
Strömung der Geistesgeschichte werden Philosophen eingereiht, die ansonsten abweichende
philosophische Konzeptionen vertreten, Historiker, die von den unterschiedlichsten
Standpunkten aus an die Geschichte herantreten usw.
Man kann keine systematische Auslegung der Lehre der Geistesgeschichte geben.
Diese stellt weder ein durchgearbeitetes philosophisches System dar noch gibt sie eine
systematische und genau definierte Aufzählung der Prämissen und Voraussetzungen, auf
denen sie ihre philosophischen, historischen oder jegliche anderen Forschungen aufbaut.
Dennoch können wir versuchen, gewisse gemeinsame Züge zu finden, welche die
traditionelle deutsche Geistesgeschichte auszeichnen, ggf. solche Interpretationen ablehnen,
welche die Geistesgeschichte falsch reduzieren, und auf diese Weise wenigstens das
definieren, was die Geistesgeschichte nicht ist.
1. Die Geistesgeschichte beschränkt sich in ihren Abhandlungen nicht nur auf den
menschlichen Geist als grundlegendes und einziges Prinzip der Auslegung. Man kann die
traditionelle deutsche Geistesgeschichte nicht so reduzieren, als ob der Geist für sie das
einzige Movens in der Geschichte wäre. Im Gegenteil, obgleich der Begriff ,,Geist" im
Grunde ungeklärt bleibt,
9
ist dennoch klar, dass es sich nicht um ein Äquivalent der
menschlichen Seele handelt. Begriffe wie Zeitgeist, Volksgeist, Kulturgeist oder einfach
Gesamtgeist
10
, die in den Werken von Historikern der Richtung Geistesgeschichte auftreten,
können gerade wegen ihrer Allgemeinheit und weil sie den Rahmen eines einzelnen
Individuums überschreiten, nicht mit der menschlichen Seele gleichgesetzt werden, auch
wenn diese ein Ausdruck jenes allgemeinen Geistes sein kann.
2. Es ist nicht wahr, dass die Geistesgeschichte wirtschaftliche, soziale, juristische
und weitere Phänomene als Faktoren, die in der Geschichte wirken, ausschließt. Sie
akzeptiert sie jedoch nicht, wie das die positivistischen Historiker taten, als notwendige
Gesetze, nach denen sich der Lauf der Geschichte richtet. Eher begreift sie diese entweder als
Faktoren unter anderen oder als eine Art Grundlage geistiger Phänomene, jedoch als eine
Grundlage, die aus der Interpretation der Geschichte nicht eliminiert werden kann. Im
Gegensatz zur materialistischen Position lehnt die Geistesgeschichte es jedoch ab,
ökonomische Faktoren als bestimmend für den Lauf der Geschichte zu akzeptieren.
11
3. Die Geistesgeschichte beschränkt sich in ihrer Gesamtheit nicht auf bewusste
Prozesse, sondern zieht auch unbewusste Prozesse in Betracht.
12
Dennoch lässt sich bei
vielen Repräsentanten der Geistesgeschichte das menschliche Bewusstsein als
Ausgangspunkt ihrer Abhandlungen über die Geschichte finden. Nach Ansicht dieser
Historiker soll die Geistesgeschichte gerade vom menschlichen Bewusstsein ausgehen.
Walter Strich sieht im Begriff des Geistes ,,das Wesenhafte des menschlichen Bewusstseins
[...]. Der Begriff Geist aber hebt aus den psychischen Phänomenen eine Sphäre heraus, die
8
KLEIN, Geistesgeschichte, S. 2.
9
VÁRDI, Steven Béla: Modern Hungarian Historiography, New York Guildford 1976, S. 6465.
10
Vgl. z.B. UNGER, Rudolf: Literaturgeschichte und Geistesgeschichte, In: Deutsche Vierteljahrsschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 4, 1926, S. 182.
11
Ebd., S. 180181. Vgl. auch VÁRDI, Modern Hungarian Historiography, S. 64.
12
Vgl. z.B. FEHR, Hans: Mehr Geistesgeschichte in der Rechtsgeschichte, In: Deutsche Vierteljahrsschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 5, 1927, S. 1.
8
nur dem menschlichen Bewusstsein eigen ist. Es ist die Sphäre des objektivierenden
Bewusstseins, das im Werk oder der Kultur seinen Ausdruck findet und Geschichte
begründet [...]. Geist also ist die bewusste Auseinandersetzung mit der Welt und ihre
Gestaltung in Werke."
13
4. Die Geistesgeschichte arbeitet nicht mit der positivistischen Vorstellung von der
Existenz notwendiger Gesetzlichkeiten in der Geschichte nach dem Vorbild der
Naturwissenschaften. Allerdings setzt sie eine gewisse Entwicklung in der Geschichte
voraus.
14
5. Sehr häufig wird die Geistesgeschichte als Fach aufgefasst, das der
Kulturgeschichte, Ideengeschichte, Philosophiegeschichte verwandt ist. Gleichzeitig wird
jedoch betont, dass es sich nicht um ein Fach handelt, das mit ihnen identisch ist, und dass
man sie nicht vermischen darf.
15
6. Obgleich die traditionelle deutsche Geistesgeschichte in die Tradition der
deutschen idealistischen Philosophie eingereiht wird,
16
kann man den Begriff des Geistes in
ihrem Rahmen und die spezielle Auffassung des Geistes und seine Entwicklung in der
Geschichte bei Hegel nicht gleichsetzen. Die Geistesgeschichte widerspricht in den meisten
Fällen dem metaphysischen Begreifen des Geistes, sei es im Sinne der ,,Selbstbewegung des
absoluten Geistes", der ,,Selbstentwicklung der Idee" usw. Der ,,Zeitgeist" gemäß der
Geistesgeschichte weist eher apersönliche Struktur auf. Er ist keine ,,Über-Person", sondern
es handelt sich eher um die Manifestation der Gesamtheit von Repräsentationen, um das
Einheitliche im Vielfältigen.
17
Für die Tatsache, dass die Geistesgeschichte Hegels spezifisches Konzept des Geistes
und seiner Entwicklung in der Geschichte nicht übernimmt, zeugt unter anderem auch, dass
in ihrem Rahmen keine einzige, deutliche und ausgearbeitete Vorstellung auftritt, was der
,,Geist" sein soll. Eher treffen wir bei der Geistesgeschichte darauf, dass der Geist, sei es der
Zeitgeist, der Gesamtgeist usw., als Begriff nicht klar definiert ist. So dass die konkrete
Spezifikation seiner Entwicklung, wie Hegel sie beschrieben hat, für die Geistesgeschichte
nicht vorausgesetzt werden kann. Die Geistesgeschichte konzentriert sich eher auf die
Feststellung des ,,Zeitgeistes" in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg können wir häufig
dem Terminus Zeitgeistforschung begegnen
18
- annähernd in dem Sinne der Gesinnung einer
Epoche.
19
Auch daher ist es möglich, manchmal auf die Termini Epochenforschung
20
,
grundlegende geistige Tendenz der betreffenden Zeit, Lebensgefühl einer Generation usw. zu
treffen. Max Wehrli zitiert für die Auffassung des Geistes im Rahmen der Geistesgeschichte
Kluckhohns Worte: ,,Der gemeinte ,,Geist" sei ja nicht etwa ein Teilgebiet der Geschichte,
13
STRICH, Walter (Hrsg.): Die Dioskuren (Jahrbuch für Geisteswissenschaften), Bd. I., München 1922, S. 2.
14
Vgl. VÁRDI: Modern Hungarian Historiography, S. 6465. Siehe auch STRICH: Wesen und Bedeutung der
Geistesgeschichte, S. 12.
15
Vgl. z.B. EHRLICH, Walter: Geistesgeschichte, Tübingen 1952, S. 5; SCHOEPS, Hans-Joachim: Was ist und
was will die Geistesgeschichte, In: Gesammelte Schriften, Bd. 6, Hildesheim Zürich New York 2000, S. 12
13.
16
VÁRDI: Modern Hungarian Historiography, S. 64; SCHORN-SCHÜTTE, Luise: Ideen-, Geistes-,
Kulturgeschichte, In: Hans-Jürgen GOERTZ (Hrsg.): Geschichte. Ein Grundkurs, Reinbek bei Hamburg 2007,
S. 542.
17
Geist ist, was ,,ohne tragendes Gesamtbewusstsein und ohne tragende Gesamtperson besteht, manifestiert er
sich immer nur in der Gemeinsamkeit der Repräsentation, als das Gemeinsame in der Mannigfaltigkeit [...].
Daher lässt sich der Zeitgeist auch nie fixieren und definieren, sondern nur in seinen Erscheinungsformen
charakterisieren." SCHOEPS: Was ist und was will die Geistesgeschichte, S. 27 und S. 33. Oder auch: ,, [...] die
Annahme der Existenz und mystischen Selbstbewegung eines Gesamtgeistes ist leere Metaphysik.", STRICH:
Wesen und Bedeutung der Geistesgeschichte, S. 2.
18
Vgl. z.B. SCHOEPS: Was ist und was will die Geistesgeschichte, S. 10 ff.
19
SCHOEPS, Hans-Joachim: Geistesgeschichte im Spiegel des Grossen Brockhaus
,
In: Zeitschrift für
Religions- und Geistesgeschichte 5, 1953, S. 174.
20
OTTO, Stephan: Materialien zur Theorie der Geistesgeschichte, München 1979, S. 8.
9
etwa neben Staat, Philosophie, Kunst, Dichtung usw., aber auch nicht die Gesamtheit dieser
Bereiche oder Kultursysteme, sagt Paul Kluckhohn, vielmehr sei Geistesgeschichte auf die
hier ,,wirksamen Kräfte, ihre geistige Grundhaltung, ihren gemeinsamen Antrieb oder auf
die Einheit des geistigen Lebens in ihnen" gerichtet."
21
Der Einfluss Hegels auf die
Geistesgeschichte kann dennoch nicht außer acht gelassen werden.
22
7. Laut einigen Interpretationen
23
ist es für die Geistesgeschichte grundlegend, dass
sie aus der Legung der Beziehung zwischen der ,,geistig-moralischen" und der ,,natürlichen"
Welt hervorgeht, wie sie bereits bei Droysen auftaucht, respektive zwischen Geist und
Materie, wie sie zum Beispiel bei Dilthey auftritt. Auf dieser Grundlage soll die
Geistesgeschichte dann das gegenseitige Wirken zwischen Individuen und kollektiven
Kräften, wie z.B. Institutionen, geistigen Strömungen, Traditionen usw., verfolgen. Der
Einzelne ist Teil einer historisch entstandenen, gelebten Welt und kann daher auch das
geistige Leben vergangener Zeiten verstehen.
8. Die wohl treffendste Charakteristik der Geistesgeschichte ist die Tatsache, dass sie
eine Einheit im Rahmen der unterschiedlichsten Phänomene der betreffenden Zeit, Nation,
Kultur usw. voraussetzen. Es ist gerade jener Begriff Gesamtgeist oder Zeitgeist usw., der
diese Einheit ausdrückt, eher als dass er sie selbst schaffen würde. Obgleich wir bei jedem
einzelnen Denker sein eigenständiges Verständnis dessen differenzieren könnten, was
eigentlich jener Geist darstellt, können wir für die Denker der Geistesgeschichte
zusammenfassen, dass bei ihnen in der Regel die Überzeugung von der Existenz eines
bestimmten ,,Zeitgeistes", eines ,,Kulturgeistes" oder eines ,,Gesamtgeistes" usw. auftaucht.
Gleichzeitig mit der Voraussetzung einer bestimmten Einheit im Rahmen der
unterschiedlichsten Phänomene der betreffenden Zeit setzen die Denker der Geistesgeschichte
die Verbundenheit dieser Phänomene, ihre gegenseitige Verknüpfung, bei der eines auf das
andere verweist, und dieses wieder auf ein drittes usw., voraus. Die Voraussetzung der Einheit
und Verbundenheit in der Gesamtheit der Erscheinungen der betreffenden Zeit ermöglicht es
den Denkern der Geistesgeschichte dann zum Beispiel den Zeit oder den Zeitgeist der Gotik,
Renaissance, des Barock usw. abzuhandeln. Die Denker der Geistesgeschichte sollen mittels
der Erforschung der Verbindung und der Einheit der unterschiedlichsten Phänomene der
betreffenden Zeit zu einer tieferen Erkenntnis des Geistes der betreffenden Zeit gelangen.
24
Dieser Zeitgeist wird von den Vertretern der Geistesgeschichte vorausgesetzt. Meiner Ansicht
nach stammt eine treffende Definition dessen, was eigentlich Geistesgeschichte ist, von Hans-
Joachim Schoeps: ,,Die Geistesgeschichte will den Geist einer Zeit, den sog. Zeitgeist
erfassen, wie er in den Manifestationen des geistigen Lebens: Philosophie, Kunst, Religion,
aber auch Staat, Recht, Wirtschaft usw. zum Ausdruck kommt."
25
Und Schoeps fährt fort:
,,[...] dass die Geistesgeschichte speziell interessiert ist an den Zusammenhängen aller
Gebiete untereinander, also z. B. an den inneren Beziehungen zwischen calvinistischer
Theologie und frühkapitalistischer Wirtschaftsethik, lutherischer Amtslehre und preussischem
Staat, expressionistischer Malerei und existenzphilosophischem Denken usw."
26
9. Die Geistesgeschichte arbeitet mit einer spezifischen Auffassung des erkennenden
Subjekts. Sie setzt eine ausgeprägte Aktivität des Subjekts im Prozess des
geistesgeschichtlichen Erkennens voraus. Es handelt sich nicht um ein Subjekt, das nur
passiv das reproduzieren würde, was geschehen ist, sondern immer um ein aktiv
21
WEHRLI: Was ist/war Geistesgeschichte?, S. 23.
22
Vgl. z.B. SCHOEPS: Was ist und was will die Geistesgeschichte, S. 11.
23
SCHOERN-SCHÜTTE, Luise: Neue Geistesgeschichte, In: Joachim EIBACH Günther LOTTES (Hrsg.),
Kompass der Geschichtswissenschaft, Göttingen 2006, S. 270271.
24
Vgl. z.B. STRICH: Wesen und Bedeutung der Geistesgeschichte, S. 511.
25
SCHOEPS, Hans-Joachim: Geistesgeschichte als Lehrfach, In: Zeitschrift für Religions- und
Geistesgeschichte 8, 1956, S. 308.
26
SCHOEPS: Geistesgeschichte als Lehrfach, S. 309.
10
,,konstruierendes" Subjekt. Prägnant hat das Stephan Otto ausgedrückt: ,,Strukturen,
Entsprechungen, Synthesen sind ja nie in der Geschichte selber einfach vorfindlich, sondern
werden immer nur von einem über Geschichte reflektierenden Subjekt gesetzt, das um mit
Lucien Goldmann zu sprechen im geschichtlichen Material gewisse ,innere Kohärenzen`
entdeckt. Vom Geistesgeschichtler in die Geschichte eingetragene Strukturen sind durchaus,
wie auch Dilthey es einmal ausdrückt, ,Schöpfungen des auffassenden Subjekts`. Am Beispiel
der Epochenforschung, einem besonders bedeutsamen Aufgabengebiet geistesgeschichtlicher
Arbeit, leuchtet dieser Sachverhalt ohne weiteres ein: Mit ,historischer Methode` lässt sich
über Beginn, Ende und Gestalt einer Epoche schlechthin keine Aussage machen [...]. Die
Morphologie, der innere Zusammenhang einer Epoche erschließt sich aber einzig und allein
dem Rekonstruktionsverfahren des Geistesgeschichtlers, der jene Verbindungslinien
,konstruiert`, welche die verdeckten inneren Kohärenzen zwischen Politik und religiösem
Dogma, Literatur und Philosophie, Recht und Wirtschaft einer Epoche erst zu einem
intelligiblen Strukturgefüge verknüpfen."
27
Das aktive Subjekt, das die Geschichte nicht
einfach nur reproduziert, sondern sie auf bestimmte Weise ,,konstruiert, tritt dann auch bei
Zdenk Kalista
28
auf, und auch in dieser Hinsicht steht er der Tradition der deutschen
Geistesgeschichte nah.
10. Die Historiker der Geistesgeschichte weisen häufig auf den Fakt hin, dass es im
Rahmen der Geistesgeschichte notwendig ist, auf besondere Weise an die Quellenbasis, die
der Geistesgeschichte zur Verfügung steht, heranzugehen.
29
Einerseits nimmt ihre
Quellenbasis einen breiten Raum ein für ihre Forschungen verwendet sie nicht nur
Chroniken, Urkunden, die verschiedensten anderen Dokumente, sondern konzentriert ihre
Aufmerksamkeit auf alles, was ein Produkt des menschlichen Geistes darstellt. Egal, ob das
Tagebücher, Homilien, künstlerische Gegenstände oder Rechtskodexe sind, bis hin zu den
bizarrsten möglichen Quellen. Sicher existieren auch andere historiographische Richtungen,
die mit ähnlichen Quellen arbeiten. Es muss daher hinzugefügt werden, dass die
Geistesgeschichte gerade zu dem ihr eigenen Zweck mit ihren Quellen arbeitet. Also gerade
mit der Frage: Wie äußert sich in diesen unterschiedlichsten Quellen der Zeitgeist, die
Stimmung der betreffenden Zeit, der Charakter der Epoche usw. Dadurch unterscheidet sich
ihre Arbeit mit den Quellen von den übrigen historiographischen Richtungen.
11. Ohne dass sich im Rahmen der Geistesgeschichte eine genau begrenzte und
definierte Methodologie konstituiert hätte, taucht bei ihren Vertretern häufig der Gedanke
auf, dass sie sowohl an die Geschichte allgemein als auch an die Geschichte der einzelnen
Wissenschaften auf eine spezifische Weise herangeht, die sich vom gewöhnlichen Zugang im
Rahmen der einzelnen wissenschaftlichen Geschichtszweige unterscheidet. Worin konkret
besteht dieser Unterschied?
a) ,,Problemhistoriker" und ,,Geisteshistoriker"
Sehr prägnant formulierte Erich Rothacker, einer der bedeutendsten Vertreter der
Geistesgeschichte, in seinem Artikel ,,Philosophiegeschichte und Geistesgeschichte"
30
das
unterschiedliche Herangehen der Geistesgeschichte an die Geschichte im Vergleich zu den
übrigen Zugehensweisen und gleichzeitig ihre Einzigartigkeit. Rothacker findet zwei Arten
27
OTTO: Materialien zur Theorie der Geistesgeschichte, S. 8.
28
Unten wird die Rolle des Subjekts in Kalistas Geistesgeschichte detaillierter analysiert.
29
Vgl. z.B. SCHOEPS: Was ist und was will die Geistesgeschichte.
30
ROTHACKER, Erich: Philosophiegeschichte und Geistesgeschichte, Deutsche Vierteljahrsschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 18, 1940, S. 125.
11
von Historikern vor. Auf der einen Seite stehen die Problemhistoriker,
31
auf der anderen
Seite sind das die Geisteshistoriker, also diejenigen, die Geistesgeschichte betreiben.
Nehmen wir zum Beispiel eine bestimmte Entdeckung in der betreffenden
Wissenschaft oder die Lösung eines gewissen Problems im Rahmen dieser Wissenschaft,
dann fordert der ,,Problemhistoriker" dazu auf, dass wir uns auf diese Entdeckung oder das
Problem selbst, auf seine sachliche Bedeutung konzentrieren sollen. Darum soll es in erster
Linie gehen. Alle übrigen Umstände sind nicht wichtig und hinsichtlich des betreffenden
Problems rein äußerlich. Der ,,Geisteshistoriker" würde eine solche Auffassung ablehnen.
Das, was der Problemhistoriker als rein äußerliche, unwichtige Bedingung begreift, fasst der
Geisteshistoriker als ebenso wichtig auf, wie es der eigentliche Inhalt der betreffenden
Entdeckung ist. Wenn wir das Beispiel verwenden, das Rothacker erwähnt, dann würde der
Problemhistoriker Kants neuen Ethikentwurf systematisch wie wir heute sagen würden
im Rahmen einer systematischen Philosophie erforschen, er würde ihn also in den Rahmen
anderer ethischer Systeme einordnen und sich auf die ,,eigentliche" philosophische Aussage
des betreffenden ethischen Systems konzentrieren. Der Geisteshistoriker würde im Gegenteil
darüber hinaus auch die geschichtliche Bedingtheit von Kants Ethik erforschen. Er würde
auch Tatsachen in Betracht ziehen, die nicht im eigentlichen Sinne des Wortes philosophisch
sind, sondern auch zum Beispiel den Einfluss des Protestantismus auf Kants Ethik oder die
Widerspiegelung der spezifisch christlichen Auffassung des Subjekts in ihr.
Der Problemhistoriker begreift also laut Rothackers Entwurf die geschichtlichen
Bedingungen der betreffenden Probleme, seien sie philosophischer, aber auch chemischer
oder physikalischer Art, als äußerlich, nebensächlich und unwichtig. Umgekehrt sind die
geschichtlichen Bedingungen für die konkrete Entdeckung, das Problem usw. für den
Historiker der Geistesgeschichte innerlicher und wesentlicher Art.
Rothacker behauptet als Vertreter des geistesgeschichtlichen Zugangs anschließend,
dass der ,,problemorientierte" Zugang nicht auf das gleiche Niveau gesetzt werden kann wie
der geistesgeschichtliche Zugang. Am Beispiel der Philosophiegeschichte zeigt Rothacker
dann: ,,...die geistesgeschichtliche Methode ist im Recht, und die problemhistorische im
Unrecht. Oder präziser: die Geistesgeschichte hat fürs Ganze Recht und die
Problemgeschichte nur für einen Teil des Ganzen. Und dies darum, weil die
geistesgeschichtliche Betrachtung die wertvollen Resultate einer vollendeten
problemgeschichtlichen Durchdenkung des klassischen Schrifttums restlos aufnehmen kann,
während die vollendete Problemgeschichte zwar zu sehr wertvollen philosophischen
Ergebnissen kommen kann, darum aber als Philosophiegeschichte trotzdem so
fragmentarisch bliebe [...]."
32
Der Geisteshistoriker verfolgt laut Rothacker an unserem Beispiel philosophische
Probleme in Verbindung mit den übrigen Wissenschaften und mit den übrigen kulturellen
31
ROTHACKER: Philosophiegeschichte und Geistesgeschichte, S. 7 f.
32
ROTHACKER: Philosophiegeschichte und Geistesgeschicht, S. 8. Im Grunde gleich stellt sich die Beziehung
der Geistesgeschichte und anderer spezieller Geisteswissenschaften Zdenk Kalista vor. Die Philosophie, aber
auch die Rechtsgeschichte u.a. verfolgen Begriffe, Vorstellungen, Probleme im Rahmen des betreffenden
philosophischen Systems, der Rechtsgeschichte usw., während die die Geistesgeschichte sich im Rahmen der
,,Struktur der Zeit", des ,,Zeitmilieus" mit ihnen befasst. Umgekehrt gilt laut Kalista für den
Philosophiehistoriker und sein Fach: ,,Wir könnten sagen, dass die Struktur der Zeit, in welche wir die Begriffe,
Vorstellungen und anderen Äußerungen des menschlichen Geistes zuerst setzten, als wir über den Gegenstand
der Geistesgeschichte sprachen, hier von der Struktur des philosophischen Systems ersetzt wird [...]. Nicht
gemäß dem, in welches zeitliche Umfeld sie gesetzt werden, sondern gemäß dem, in welchem philosophischen
System sie sich wiederfinden, nehmen diese Äußerungen des menschlichen Geistes für ihn ein verschiedenes
Aussehen an." (,,Mohli bychom íci, ze struktura doby, do které jsme postavili pojmy, pedstavy i jiné projevy
lidského ducha prve, mluvíce o pedmtu djin duchových, je tu nahrazena strukturou filozofického systému...
Ne podle toho, do jakého dobového prostedí jsou zasazeny, ale podle toho, v kterém filozofickém systému se
ocitají, nabývají pro nho tyto projevy lidského ducha rzného vzezení."), KALISTA: CHM, DD, S. 202.
12
Tätigkeiten.
33
Bedeutende Philosophen erforscht er nicht nur durch den Blickwinkel der
,,eigentlichen" philosophischen Probleme, mit denen sie sich beschäftigten, sondern er
verfolgt sie auch als Persönlichkeiten, in ihren nebensächlichen Interessenbereichen usw. Der
Geisteshistoriker verfolgt, wie sich in den von ihm erforschten historischen Persönlichkeiten
die ,,Sachleistung" mit dem ,,Zeitausdruck" verbindet. Die Aufgabe des Geisteshistorikers ist
es gerade, die Verbindung der beiden genannten Aspekte zu erforschen. Gerade weil diese
Aspekte nicht voneinander getrennt werden können. Die ,,Sachleistung" steht nie ganz
isoliert von den geschichtlichen Bedingungen der betreffenden Zeit und auch nicht von der
Persönlichkeit, welche die betreffende ,,Sachleistung" erbrachte. Immer ist gerade diese
Persönlichkeit bereits Teil der geschichtlichen Bedingungen, der Umstände der betreffenden
Zeit, aus denen sie nie heraustreten kann. Die Geistesgeschichte verfolgt also Denker auf
dem Hintergrund der betreffenden Zeit. Rothacker drückt das noch anders aus: Die
Geistesgeschichte überprüft, wie sich das ,,Leben" in Theorien, in ,,Sachleistungen", in der
Lösung vorliegender Probleme äußert.
Die letzte Folge ist dann, dass wir auch das Sachproblem selbst laut Rothacker
überhaupt nicht rein theoretisch, also rein problemhistorisch, ohne Rücksicht auf das Leben,
die Umstände der Zeit, ohne Rücksicht auf die Bedingungen, welche die Problemgeschichte
hinsichtlich des betreffenden Problems irrtümlich nur als rein äußerlich und unwichtig
auffasst, lösen können. Das eigentliche Sachproblem kann gerade nur dann richtig begriffen
werden, wenn wir das Leben, alle übrigen Umstände, die es umgeben und bedingen, in
Betracht ziehen. Das Sachproblem kann nicht vom Lebensproblem getrennt werden.
Wichtige Probleme können wir nur dann wirklich verstehen, wenn wir in ihnen gleichzeitig
die Logik der Sache, also die Logik des Lebens erblicken.
34
12. Als weiterer gemeinsamer Zug, der die Geistesgeschichte auszeichnet, erweist sich
auch die Tendenz, die Wissenschaft nicht vom Leben zu trennen. Diese scheinbar vage
Mitteilung wurde uns bereits teilweise an Rothackers Text klarer, verlangt jedoch noch eine
Ergänzung. Die Geistesgeschichte, die sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den
deutschsprachigen Ländern zu konstituieren begann, musste auch auf die Impulse reagieren,
die sie von der sogenannten Philosophie des Lebens erhielt, die seit der Zeit von Friedrich
Nietzsche in Deutschland an immer größerer Kraft gewann. Viele der Philosophen, die zur
Geistesgeschichte gezählt werden, werden gleichzeitig in die Strömung der Philosophie des
Lebens eingereiht, wie wir das zum Beispiel an Wilhelm Dilthey oder Georg Misch
beobachten können. Walter Strich schreibt zur allgemeinen Stimmung der 20er Jahre des 20.
Jahrhunderts: ,,Die Krisis der Wissenschaft lässt sich nicht leugnen. Die Problematik des
gegenwärtigen Moments zwingt das Interesse so stark auf die unmittelbare Gestaltung des
Lebens, dass darüber der Wert der Erkenntnis zweifelhaft werden musste [...]. Man verurteilt
das Streben nach reiner, uninteressierter Erkenntnis als müde Resignation und Flucht aus
dem Leben, und man verlangt auch die Wissenschaft in seinen Dienst gestellt zu sehen."
35
13. Die meisten Repräsentanten der Geistesgeschichte, sei es in ihren Anfängen oder
auch später, halten Wilhelm Dilthey für den geistigen Vater der Strömung der
33
Rothacker bringt in diesem Zusammenhang zum Beispiel die neuzeitliche cartesianische Auffassung des
Körpers, dem die Cartesianer Ausdehnung als einziges Attribut zusprachen. Das verbindet Rothacker dann mit
der damaligen Existenz der absolutistischen Monarchien in Europa. So wie im Rahmen der neuzeitlichen
absolutistischen Monarchien das Individuum nur etwas von ihnen Abgeleitetes wird, so wird auch der Körper im
Rahmen der neuzeitlichen cartesianischen philosophischen Vorstellungen nur eine Art Modifikation der
Ausdehnung. Vgl. ROTHACKER: Philosophiegeschichte und Geistesgeschichte, S. 2223.
34
,,Die Probleme, mit denen die Klassiker der Philosophie es zu tun haben, sind Sachprobleme und
Lebensprobleme zugleich. Und die Zusammenhänge, in denen die wirklichen Probleme der großen Denker
stehen, wären gar nicht zu verstehen, wenn man nicht in ihnen gleicherweise der Logik der Sache wie der Logik
des Lebens nachforschte, die gerade der Sache nah gar nicht zu trennen sind von den sog. ,sachlichen
Problemen.", ROTHACKER: Philosophiegeschichte und Geistesgeschichte, S. 2425.
35
STRICH: Wesen und Bedeutung der Geistesgeschichte, S. 1. Vgl. Ebd. auch S. 1819.
13
Geistesgeschichte, und zwar vor allem wegen seiner Absicht, das geschichtliche Leben aus
sich selbst heraus zu verstehen, unter anderen aus dem Grund und das ist für die
Geistesgeschichte zentral, dass es dadurch auf der Grundlage der vielfältigsten
Quellenmaterialien möglich ist, sich den geistigen Inhalt der betreffenden Zeit vorzustellen.
36
Diesen Standpunkt vertreten Anhänger der Geistesgeschichte allgemein.
3. Die Entwicklung der Geistesgeschichte nach dem Zweiten
Weltkrieg
Die Geistesgeschichte als eine der Strömungen in der Geschichte der Historiographie blieb
kein Kapitel, das irgendwann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geendet hätte. Die
Geistesgeschichte setzte sich auch nach dem 2. Weltkrieg fort. Einer der wichtigsten
Historiker der Geistesgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg war der Historiker und
Religionsphilosoph Hans-Joachim Schoeps. Nach dem Krieg kehrte Schoeps nach
Deutschland zurück und begann an der Universität in Erlangen (seit 1950 als ordentlicher
Professor) zu wirken, und direkt für seine Person wurde hier auf seine Initiative hin das
Seminar für Religions- und Geistesgeschichte gegründet. Dieses Seminar erlosch dann nach
dem Tod von Schoeps im Jahr 1980 als selbständiges Seminar, wobei es jedoch unter das
Institut für Politikwissenschaft überging.
37
Hier funktionierte es dann als ,,Abteilung für
Geistes- und Ideengeschichte". Es ist jedoch klar, dass es seine ursprüngliche Stellung
verloren hat.
Im Jahr 1948 begann Schoeps die Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte
herauszugeben, die bis heute erscheint, und 1958 gründete er die Gesellschaft für
Geistesgeschichte, die ihren Sitz in Potsdam hat und bis heute existiert. Sie veranstaltet
jährliche Konferenzen, deren Ergebnis die Reihe Studien zur Geistesgeschichte, ggf.
Beiträge zur Geistesgeschichte sind.
Schoeps´ Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte sollte nach seinen eigenen
Worten wissenschaftlich die von ihm durchgesetzte Richtung der Geistesgeschichte
untermauern und gleichzeitig Demonstrationen vorführen, wie sie praktisch betrieben werden
sollte.
38
Schoeps erwies sich als harter Kritiker, der sich in wissenschaftlichen Debatten nicht
scheute, scharfe Worte zu gebrauchen.
39
Er setzte die Tradition der Geistesgeschichte vom
Anfang des 20. Jahrhunderts fort. Die Geistesgeschichte soll sich dem ,,Zeitgeist" und seinen
36
,,Als eigentlicher Vater der Geistesgeschichte hat uns aber Wilhelm Dilthey zu gelten, der ohne die
Präokkupationen des Systems die Absicht hatte, das geschichtliche Leben aus sich selbst heraus zu verstehen,
um den geistigen Gehalt einer Zeit aus allen überhaupt erschließbaren Quellen heraus zur Darstellung zu
bringen.", SCHOEPS: Was ist und was will die Geistesgeschichte, S. 11.
37
TÖPNER, Kurt: Gesellschaft für Geistesgeschichte zum Thema "Reisen", In: Zeitschrift für Religions- und
Geistesgeschichte 37, 1985, S. 271.
38
SCHOEPS, Hans-Joachim: Was ist und was will die Geistesgeschichte?, In: Zeitschrift für Religions- und
Geistesgeschichte, Jahrgang 25, 1973, S. 243. Dieser Artikel ist jedoch nicht mit Schoeps Buch ,,Was ist und
was will die Geistesgeschichte" identisch. Im her zitierten Artikel geht es vor allem um die Reaktion der
deutschen Historiker gerade auf Schoeps selbständiges Buch mit dem gleichen Titel nur ohne Fragezeichen am
Ende.
39
Siehe z.B. Schoeps Kritik des Buchs von Friedrich Heer Europäische Geistesgeschichte, das der tschechische
Leser aus der Übersetzung unter dem Titel Evropské duchovní djiny (Prag 2000) kennen kann. Schoeps
kritisiert Heers Unterfangen scharf, dass es sich um eine Zusammenfassung einer Menge einzelner,
unzusammenhängender Fakten handle. Es fehle ihm die Geschlossenheit, Einheit. So kann Geistesgeschichte
laut Schoeps nicht betrieben werden. SCHOEPS, Hans-Joachim: Geistesgeschichte, In: Zeitschrift für Religions-
und Geistesgeschichte 7, 1955, S. 8991.
14
Wandlungen im Prozess der Geschichte widmen.
40
Auch für Schoeps äußert sich der Geist in
allen Manifestationen des geistigen Lebens. Der Zeitgeist beeinflusst alle Sphären des
Lebens, gleich ob es die Kunst, die Religion, die Wissenschaft, das Recht, die Philosophie
usw. ist.
Neben Schoeps und seinem Seminar an der Universität in Erlangen funktionierte seit
1965 an der Universität in München das Seminar für Philosophie und Geistesgeschichte des
Humanismus, dessen geistiger Vater der Professor Ernesto Grassi (1902 1991) war. Er
wirkte am Centro Italiano di Studi Umanistici e Filosofici, das in München im Jahr 1948
gegründet wurde und an welches dann das oben erwähnte Seminar anknüpfte, das seit 1973
von Stephan Otto, einem weiteren bedeutenden Vertreter der historiographischen Richtung
der Geistesgeschichte in Deutschland, geleitet wurde.
Das Institut wurde 1975 in Institut für Geistesgeschichte des Humanismus und 1985
in Institut für Geistesgeschichte und Philosophie der Renaissance umbenannt. Stephan Otto
leitete das Institut bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1997, als Eckhard Kessler die Leitung
des Instituts übernahm. Heute ist das Institut unter dem Namen Seminar für
Geistesgeschichte und Philosophie der Renaissance unter der Leitung von Thomas Ricklin
zu finden.
Stephan Otto trug zur Entwicklung der Geistesgeschichte durch Herausgabe der Reihe
,,Die Geistesgeschichte und ihre Methoden, Quellen und Forschungen" im Wilhelm Fink
Verlag München bei, wo er gleichzeitig im Jahr 1979 sein eigenes Werk ,,Materialien zur
Theorie der Geistesgeschichte" publizierte.
41
Ein weiteres wichtiges Unternehmen im Bereich der Geistesgeschichte in der
Nachkriegszeit, das von den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts bis heute besteht, ist die
Zeitschrift Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, mit
deren Herausgabe Paul Kluckhohn und Erich Rothacker im Jahr 1923 ursprünglich bei
Niemeyer in Halle begannen. Später erschien die Zeitschrift bei Metzler in Stuttgart. Die
heutige Redaktion leiten Christian Kiening, Albrecht Koschorke und David E. Wellbery.
In unferner Zeit äußerte sich zur Theorie und Methodologie der Geistesgeschichte zum
Beispiel Wolfgang von Löhneysen.
42
Auch in seinem Entwurf der Geistesgeschichte können
wir Züge finden, die an ihr bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts auftauchen. Die
Geistesgeschichte überschreitet auf ihre Weise den Rahmen der einzelnen
Spezialwissenschaften. Sie sucht Züge, die mehreren unterschiedlichen Phänomenen
gemeinsam sind. Wiederum ist die Behauptung zu beobachten, dass die Geistesgeschichte
Phänomene zusammenbringt, die ansonsten getrennt geblieben und damit auch nicht auf die
richtige Weise gedeutet worden wären. Das, was die einzelnen Spezialwissenschaften
getrennt und nur aus ihrer Sicht behandeln, das kann die Geistesgeschichte in
Zusammenhang mit anderen Phänomenen (der betreffenden Zeit) erläutern und daher in
seiner Gesamtheit begreifen.
Der Aspekt des menschlichen Bewusstseins und seiner Änderungen wird stark betont
und da geht Löhneysen den Weg, den Schoeps und auch Dilthey vor ihm wiesen. Die
Geistesgeschichte soll von einzelnen Personen, ihrem Bewusstsein und Erleben ausgehen
und mit ihrer Hilfe die übrigen Phänomene erklären, die diese umgeben.
40
SCHOEPS: Was ist und was will die Geistesgeschichte, S. 11.
41
OTTO: Materialien zur Theorie der Geistesgeschichte, München 1979. Vgl. dazu KANTZENBACH,
Friedrich Wilhelm: Ein Plädoyer für Geistesgeschichte, In: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 36,
1984, S. 252255.
42
LÖHNEYSEN, Wolfgang von: Geistesgeschichte und was damit zusammenhängt, In: Zeitschrift für
Religions- und Geistesgeschichte 47, 1995, S. 8189.
15
Die Aufforderung, dass die Geistesgeschichte von den einzelnen Persönlichkeiten oder
Ereignissen ausgehen soll, erfolgt noch zu einem weiteren Zweck. Wenn wir eine bestimmte
einzelne Person, ihr Erleben oder das einzelne Ereignis als Ausgangspunkt unserer weiteren
Abhandlung nehmen, wird dadurch die Grenze der Abhandlung und der Methode der
Geistesgeschichte, die sonst immer die Grenzen der einzelnen Spezialwissenschaften
überschreitet, genauer definiert. Dadurch wird mögliche Kritik eingeschränkt, die eine solch
breite Abhandlung problematisieren könnte. Auf diese Weise wird die Tendenz zur Abkehr
der Geistesgeschichte von den großen, synthetisierenden Abhandlungen hervorgehoben, die
häufig Ziel der Kritik sind, die ihnen Dilettantismus, unzureichende Begründung auf Quellen
usw. vorwirft.
43
Löhneysen unterscheidet schließlich überraschenderweise zweierlei Arten der
Geschichtsschreibung. Auf der einen Seite sieht er die Geistesgeschichte, der es vor allem
um die Wandlungen des Bewusstseins gehen soll, wie sie im Verlauf der Geschichte
erfolgten. Auf die andere Seite stellt er dann die Zeitgeistgeschichte, die man umgeschrieben
also als ,,Geschichte des Zeitgeistes" bezeichnen könnte. Diese Schlussfolgerung von
Löhneysen ist bereits aus dem Grund bemerkenswert, weil sich die traditionelle
Geistesgeschichte in der absoluten Mehrheit dem ,,Zeitgeist" widmete, mit dieser Entität
arbeitete. Wie kommt es, dass hier Geistesgeschichte und Zeitgeistgeschichte unterschieden
werden?
Löhneysen bestritt entschieden nicht den grundlegenden Anspruch der
Geistesgeschichte, das Gesamtbild der betreffenden Zeit zu erkennen. Das hat sie mit der
Zeitgeistforschung gemeinsam. Der Unterschied zwischen ihnen besteht jedoch darin, dass
die Geistesgeschichte von einem bestimmten, klar definierten Ereignis, einer Persönlichkeit,
ihrem Erlebnis usw. ausgehen und daraus dann den Charakter der betreffenden Epoche zu
erfassen versuchen soll. Die Zeitgeistforschung findet umgekehrt ihren Ausgangspunkt in der
Situation einer bestimmten Zeit und von ihr tritt sie dann an die Erklärung der einzelnen, zu
ihr gehörenden Phänomene heran. Am konkreten Beispiel des Erdbebens in Lissabon im Jahr
1755 würde das dann so aussehen, dass die Geistesgeschichte als Ausgangspunkt jenes
konkrete Ereignis des Erdbebens und seine Abbildung im Denken und den Vorstellungen
konkreter Menschen nimmt, während die Zeitgeistforschung als Ausgangspunkt den
Zeitraum zwischen den Jahren 1750 1760 nehmen würde, wobei jedoch nach Ansicht von
Löhneysen das eigentliche Erdbeben zu einem Randereignis degradiert werden würde und
nicht voll verstanden werden könnte, welche Rolle es an der Gestaltung dieser Zeit
übernahm.
44
Es wäre sehr schwierig zu versuchen, die Entwicklung der Geistesgeschichte vom Anfang
des 20. Jahrhunderts bis zur heutigen Zeit zu verfolgen und bspw. zu versuchen, die
Unterschiede zwischen der heutigen Gestalt der Geistesgeschichte und ihrer Gestalt zu
Beginn des 20. Jahrhunderts zu finden. Vielleicht können wir wenigstens die Behauptung
wagen, dass sich beim genannten Löhneysen eine Tendenz der Geistesgeschichte der
heutigen Zeit zeigt, nämlich sich mehr auf bestimmter definierte, ihrem Darstellungsfeld
nach engere Themenbereiche zu konzentrieren, als sich großen Synthesen und breiten
43
,,Gibt man der Geistesgeschichte diese begrenzten Aufgaben (und sicher ließen sich viele finden), so ist deren
fächerübergreifende Methode unproblematisch. Sie bringt zusammen, was durch die einzelnen Disziplinen, also
Musikwissenschaft, Kunstwissenschaft, Rechtswissenschaft und Denk-Geschichte auseinandergerissen bliebe,
zieht allenfalls das Ereignis heran, um das jeweils Besondere verständlich zu machen. Geht man aber vom
Ereignis, der Persönlichkeit und deren Erlebnis aus, lassen sich die Aussagen, die Texte, die Dichtungen und
musikalischen Klänge auf ihre eigentliche Ur-Sache, ihren ,Hintergrund` beziehen. Dadurch werden die sonst
vielleicht unscharfen Grenzen der Geistesgeschichte auf eine Mitte hin orientiert.", LÖHNEYSEN:
Geistesgeschichte und was damit zusammenhängt, S. 85.
44
Ebd., S. 8586.
16
Themen zu widmen. Wenn wir uns zum Beispiel die Beiträge ansehen, die in der Deutschen
Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte publiziert wurden, so
können in den ersten Herausgabejahren Titel wie ,,Versuch einer Geschichte der deutschen
Sprache als Geschichte des deutschen Geistes"
45
, ,,Vom Geist des deutschen Literatur-
Barocks"
46
, ,,Renaissance und Reformation"
47
, ,,Barock als Stilphänomen"
48
, ,,Das Wesen des
Späten Mittelalters"
49
gefunden werden, und wir könnten noch viele ähnliche weitere
zitieren. Das bedeutet nicht, dass nicht auch Studien mit engeren Themen aufgetaucht wären.
Wichtig jedoch ist, dass in den Anfangsjahren dieser Zeitung häufig Artikel mit einem so
breiten Darstellungsfeld auftauchen. In den Nachkriegsjahren der gleichen Zeitschrift finden
wir Artikel dieses Typs bereits in viel geringerem Ausmaß, und heute begegnen wir ihnen
überhaupt nicht mehr.
Einige Interpreten charakterisieren die Geistesgeschichte in der Entwicklung nach dem
Zweiten Weltkrieg als eine zwar an die Geistesgeschichte der Vorkriegszeit anknüpfende,
aber dennoch neue Strömung in der Historiographie, nämlich als Neue Geistesgeschichte.
50
Luise Schorn-Schütte stellt in den Umkreis dieser Neuen Geistesgeschichte im deutschen
Milieu die Begriffsgeschichte, wie sie sich vor allem um das Werk ,,Geschichtliche
Grundbegriffe" herum konstituierte.
51
Vor allem aus dem Grund, dass sie mit ihrer Frage
nach der Beziehung von Sprache und historischer Realität an die Bemühungen der
klassischen Geistesgeschichte anknüpfte, die Beziehung zwischen Ideen und Realität und
ihre gegenseitige Beeinflussung zu thematisieren.
52
In den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts kam es laut Luise Schorn-Schütte zur
Zurückdrängung der Geistesgeschichte, und zwar vor allem wegen dem Antritt einerseits der
marxistischen Geschichtsschreibung, andererseits auch wegen dem stärker werdenden
Einfluss der Naturwissenschaften. Beide Tendenzen hielten es nicht nur für möglich, sondern
auch für notwendig, sich darum zu bemühen, wissenschaftliche, objektive Erkenntnis zu
gewinnen. Das ist ihrer Ansicht nach im Prinzip möglich, daher sollen wir uns darum
bemühen. Die Geistesgeschichte mit ihren grundlegenden Intentionen, die es nie unterließ,
die wichtige Rolle des Subjekts gleich ob als ,,verstehendes", ,,sich einfühlendes",
,,nacherlebendes" usw. zu betonen, konnte mit der zeitgenössischen Tendenz zur strengen,
wissenschaftlichen Objektivität nicht korrespondieren. Sie wurde in der Nachkriegszeit daher
meist als veraltet angesehen.
53
Zur Wende kam es laut Luisa Schorn-Schütte in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts,
als das Interesse ,,an mentalem und geistigem Wandel jenseits wirtschaftlicher und sozialer
Strukturen"
54
wieder wuchs, das sich bemühte, an früher etablierte Formen der traditionellen
Geschichtsschreibung anzuknüpfen. Eine der Äußerung stellt dann z.B. gerade die
Begriffsgeschichte dar.
45
NAUMANN, Hans: Versuch einer Geschichte der deutschen Sprache als Geschichte des deutschen Geistes,
In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 1, 1923, S. 139160.
46
CYSARZ, Herbert: Vom Geist des deutschen Literatur-Barocks, In: Deutsche Vierteljahrsschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 1, 1923, S. 243268.
47
STRICH, Fritz: Renaissance und Reformation, In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte 1, 1923, S. 582612.
48
WEISBACH, Werner: Barock als Stilphänomen, In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte 2, 1924, S. 225256.
49
KEYSER, Erich: Das Wesen des Späten Mittelalters, In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft
und Geistesgeschichte 9, 1931, S. 363388.
50
SCHORN-SCHÜTTE: Neue Geistesgeschichte, S. 270280.
51
Zur Begriffsgeschichte siehe detaillierter in dieser Arbeit das Kapitel ,,Begriffsgeschichte".
52
SCHORN-SCHÜTTE: Neue Geistesgeschichte, S. 272.
53
Ebd., S. 271.
54
Ebd., S. 272.
17
Die Frage ist, um eine wie große Wende es sich handelte, da auch in den 80er Jahren
des 20. Jahrhunderts die Vertreter der Geistesgeschichte selbst von einer sich fortsetzenden
Unterdrückung der Geistesgeschichte und von einer meist negativen Einstellung der
historischen Gemeinde ihr gegenüber sprechen.
55
Für die Tatsache, dass es in der Einstellung
der historischen Gemeinde in Deutschland im Hinblick auf die Geistesgeschichte nicht zu
einer besonders großen Wende kam, kann auch der Fakt zeugen, dass eine der
Arbeitsstätten, die sich systematisch der Geistesgeschichte widmete nämlich Schoeps´
Seminar für Religions- und Geistesgeschichte an der Universität in Erlangen als
selbständige Institution nach Schoeps´ Tod eingestellt wurde und nur noch als eine der
Abteilungen des Instituts für Politikwissenschaft der gleichen Universität weiter existierte.
Auch ab den 90er Jahren kam es nicht zu einer großen Wende in der Haltung der
historischen Gemeinde in Deutschland gegenüber der Geistesgeschichte oder überhaupt zu
einer intensiveren Betreibung dieser Richtung in Deutschland. Einige Zeitschriften oder
wissenschaftlichen Reihen existieren zwar weiterhin, allerdings ist bis heute weder im
Rahmen von Universitäten noch von wissenschaftlichen Arbeitsstellen eine markante
Stärkung der Basis der speziellen historiographischen Richtung Geistesgeschichte
eingetreten.
Bei einem großen Teil der Nachkriegshistoriker, die sich selbst zur historiographischen
Richtung der Geistesgeschichte zählten, können wir neben der Enttäuschung darüber, dass die
Geistesgeschichte von einem bedeutenden Teil der historischen Gemeinde nicht als reguläre
historiographische Richtung akzeptiert wird, gleichzeitig die damit zusammenhängende
Bemühung beobachten, die Geistesgeschichte als selbständige wissenschaftliche
historiographische Richtung zu gründen. Stephan Otto schreibt: ,,Einem weit verbreiteten
Vorurteil zufolge ist ,,Geistesgeschichte" überhaupt keine ernst zu nehmende
wissenschaftliche Disziplin. Angesiedelt im Niemandsland zwischen systematisch-
philosophischer Problemanalyse einerseits und einzelwissenschaftlicher Fachhistorie
andererseits gilt Geistesgeschichte den Vertretern etablierter Forschungsrichtungen
geradezu als akademischer Wechselbalg."
56
Hans-Joachim Schoeps betont in der Vorrede zur
zweiten Ausgabe seines ,,Was ist und was will die Geistesgeschichte" aus dem Jahr 1970:
,,Dass sich die Geistesgeschichte als Zeitgeistforschung in einem immer geistfeindlicher
werdenden Zeitalter bisher nicht als Disziplin durchsetzen konnte, verwundert niemanden,
der die Zeichen der Zeit beobachtet und zu deuten versteht. Mit einiger Verwunderung stelle
ich fest, dass aber auch die zünftige Geschichtswissenschaft diese Bemühungen bisher kaum
zur Kenntnis genommen hat."
57
Die Bemühung, die Geistesgeschichte als rechtsgültige selbständige Richtung zu
gründen oder diesen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit überhaupt zu legitimieren, kann bei
den Historikern der Geistesgeschichte an vielen Stellen in der ganzen Entwicklung nach dem
Zweiten Weltkrieg betont werden. Hans-Joachim Schoeps legt der Öffentlichkeit in seiner
Schrift ,,Was ist und was will die Geistesgeschichte" das Programm der neuen Disziplin vor,
die er im Rahmen seines Wirkens an der Universität in Erlangen gründen wollte.
58
Stephan
Otto beabsichtigt in seinem Werk Materialien zur Theorie der Geistesgeschichte ,,den
Anspruch der ,,Geistesgeschichte" auf den Rang einer wissenschaftlichen Disziplin zu
legitimieren [...]."
59
Das gleiche Vorhaben stellt auch das Buch von Walter Ehrlich
,,Geistesgeschichte" dar, obgleich Ehrlich selbst die Geistesgeschichte als wissenschaftliche,
historische Disziplin definiert, die sich zwar in unferner Zeit, aber dennoch bereits als
55
So z.B. KANTZENBACH: Ein Plädoyer für Geistesgeschichte, S. 252.
56
OTTO: Materialien zur Theorie der Geistesgeschichte, S. 7.
57
SCHOEPS: Was ist und was will die Geistesgeschichte, S. 10.
58
Ebd., S. 9.
59
OTTO: Materialien zur Theorie der Geistesgeschichte, S. 7.
18
wissenschaftliche Disziplin etabliert hat.
60
An der Intention seines Buches nämlich die
Geistesgeschichte als selbständige wissenschaftliche Disziplin zu verteidigen ändert das
jedoch nichts.
Bis heute setzt sich so die Bemühung einiger weniger Historiker der
Geistesgeschichte fort, die Geistesgeschichte als wissenschaftliche, historische Disziplin zu
etablieren und ihre Anerkennung als eigenständige, historiographische Richtung bei der
übrigen historiographischen Gemeinde in Deutschland zu erreichen.
4. Kalista zum Begriff der Geistesgeschichte
Im Folgenden werden wir die Stellen verfolgen, an denen Kalista auf die deutsche
Geistesgeschichte verweist. Unser vorrangiges Interesse an dieser Stelle wird es nicht sein,
Kalistas eigenen Entwurf der Geistesgeschichte, der Gegenstand eines weiteren Teils der
Arbeit sein wird, zu erfassen. Hier werde ich versuchen herauszufinden, wie Kalista selbst
die deutsche Geistesgeschichte verstand. Für unsere Arbeit ist das auch aus dem Grund
wichtig, weil Kalista sich in seiner eigenen Konzeption der Geistesgeschichte oft gegenüber
der deutschen Geistesgeschichte abgrenzt und seine eigene Geistesgeschichte auf dem
Hintergrund der vorhergehenden deutschen Tradition differenziert.
Die ursprüngliche Gestalt der Geistesgeschichte richtete sich laut Kalista darauf, eine
,,Art kumulativer Zweig der historischen Forschung zu werden, der die Geschichte der
einzelnen Geisteswissenschaften einschließen, ggf. zu selbständigen Aufgaben und
Ergebnissen führen würde. In ihrer ursprünglichen Gestalt, in welcher der Begriff
,,Geistesgeschichte" in Fachgesprächen und wissenschaftlichen Schriften aufzutauchen
begann, trug er allerdings bis zu einem beträchtlichen Maße Züge, die auf eine solche
Mission hindeuteten. Die Zeitschriften, welche die neue Bezeichnung in ihrem Titel oder in
ihrem Programm trugen gleich ob es die ältere, in Halle herausgegebene ,,Deutsche
Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte" oder die neuere, in
Salzburg erscheinende ,,Zeitschrift für deutsche Geistesgeschichte" oder andere, weniger
bedeutende Versionen dieser Art waren gewährten sehr unterschiedlichen Beiträgen,
angefangen von der Religionsgeschichte im eigentliche Sinne dieses Wortes bis hin zu
biographischen, literarischen Anmerkungen, eine Plattform, und das Wort ,,Geist" wurde
hier mehr oder weniger ein Synonym zum älteren Ausdruck ,,Kultur" in jener breiten
Bedeutung, die von den tiefsten philosophischen Problemen bis hin zu gelegentlichen
Materialien des folkloristischen Sammlers alles einschloss. Aber eine solche allzu starke
Erweiterung der Dimension der ,,Geistesgeschichte" ist allerdings ein Irrtum, der zwar
gewissermaßen den Zeitschriften aus der Verlegenheit helfen kann, die sich bemühen, aus
diesen oder jenen Gründen einen möglichst breiten thematischen Horizont zu umfassen, in
die wirkliche wissenschaftliche Bemühung bringt sie jedoch nur Unklarheiten und
Verwirrung. Grundlage eines jeden selbständigen Wissenschaftszweigs ist sicherlich die
selbständige und charakteristische wissenschaftliche Methode, und zu dieser Methode
würden wir allerdings nie durch eine rein mechanische Vereinigung mehrerer Methoden
gelangen."
61
60
,,Im allgemeinen bezeichnet man mit Geistesgeschichte die wissenschaftliche historische Disziplin von der
Geschichte des menschlichen Geistes.", EHRLICH: Geistesgeschichte, S. 5.
61
,,Duchové djiny vsak nejsou ani jakýmsi kumulativním jakýmsi kumulativním odvtvím historického bádání,
které by zahrnovalo, pípadn k samotným úkolm a výsledkm vedlo djiny jednotlivých duchových vd. V
pvodní své podob, ve které se zacal termín ,,duchové djiny" ,,Geistesgeschichte" vynoovat v odborných
hovorech a spisováních vdeckých, nesl ovsem do znacné míry rysy, které takovémuto poslání nasvdcovaly.
19
Der Begriff Geist wird also laut Kalista ein Synonym für ,,Kultur" im breitesten Sinne
des Wortes. Dadurch kommt es aber nach Kalistas Ansicht zu einer falschen Erweiterung der
Dimension der Geistesgeschichte, wie Kalista sie verstehen will. Beides lehnte Kalista für
seine Geistesgeschichte ab. Die Geistesgeschichte ist nach Kalistas Entwurf auch kein Zweig
der Geschichte, der die Forschung anderer historischer Wissenschaften in sich konzentrieren
möchte, und sie kann auch nicht als Kulturgeschichte aufgefasst werden.
62
Einem Vergleich
der Kulturgeschichte und Kalistas Geistesgeschichte werden wir uns in dieser Arbeit
detaillierter im Kapitel Kalistas Geistesgeschichte widmen, das sich mit Kalistas eigener
Geistesgeschichte befasst. Hier führen wir nur an, dass Kalista die traditionelle
Geistesgeschichte für eine Strömung hielt, die der Kulturgeschichte nahe steht, und dass er
selbst seine Geistesgeschichte nicht in dieser Richtung führen will.
Kalistas Behauptung, dass die ursprüngliche Gestalt der Geistesgeschichte zu einer
einfachen ,,Kumulation" der verschiedensten Geisteswissenschaften tendierte, ohne eine
bestimmte, einheitliche eigene Methodologie zu gründen, scheint nachdem, was wir in der
Einleitung dieser Arbeit zum Charakter der deutschen Geistesgeschichte skizzierten, sehr
problematisch. Sicher kann man Kalistas Vorwurf der einfachen ,,Ansammlung" der
Erkenntnisse der einzelnen Spezialwissenschaften im Rahmen der Geistesgeschichte nicht
für alle Versuche abweisen, die in ihrem Umkreis erfolgten. Entschieden gilt sein Vorwurf
jedoch nicht universell. Wir können viele Abhandlungen finden, die sich bemühen, klar zu
bestimmen, um was es in der Geistesgeschichte gehen soll, die sich bemühen, wenn auch
vielleicht nicht allzu detailliert, ihre Methode zu definieren, und die nicht zuletzt die
Geistesgeschichte
gegenüber ihr nahen, allerdings keineswegs identischen
historiographischen Richtungen abgrenzen, wie es zum Beispiel die Ideengeschichte, die
Kulturgeschichte usw. sind.
63
Es ist daher nicht wahr, dass die Geistesgeschichte eindeutig
mit diesen verwandten Richtungen verschmolzen wäre und dass es keine Versuche gegeben
hätte, den Unterschied zwischen ihnen zu reflektieren.
Es ist zwar wahr, dass in den von Kalista zitierten Zeitschriften Artikel der Art
auftauchen, von der Kalista spricht, das bedeutet jedoch nicht, dass in den aufgeführten
Zeitschriften Bemühungen, die Geistesgeschichte als etwas mehr, denn nur als
Methodenkumulation verschiedener spezieller Geisteswissenschaften zu begreifen, überhaupt
fehlen würden. Bereits zu der Zeit, als die erwähnten Zeitschriften zu erscheinen begannen,
waren sich viele Vertreter der Geistesgeschichte bewusst, dass die Geistesgeschichte eine
eigenständige geisteswissenschaftliche Strömung mit eigener spezifischer Methode darstellen
soll, dass sie keine bloße ,,Kumulation" von Methoden oder Fakten aus verschiedenen
Wissenschaften ist. Bereits in den Anfängen dieser Zeitschriften tauchen Charakteristika auf,
Casopisy, jez nesly ve svém titulu nebo ve svém programu nové oznacení a uz to byla starsí, v Halle
vydávaná ,,Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte", nebo novjsí, ze
Salzburka vycházející ,,Zeitschrift für deutsche Geistesgeschichte" ci jiné, mén významné verze toho druhu,
poskytovaly pístesí píspvkm velmi rozmanitým, djinami nábozenskými ve vlastním toho slova smyslu
pocínaje a biografickými literárními poznámkami konce a slovo ,,duch" (,,Geist") se tu stávalo více mén
synonymem k starsímu výrazu ,,kultura" (,,Kultur") v onom sirokém významu, který zahrnoval vsechno od
nejhlubsích problém filozofických az po pílezitostné materiály folkloristického sbratele. Ale takovéto
upílisnné rozsíení výmru ,,duchových djin" je ovsem omyl, který mze sice pomoci ponkud z rozpak
casopism, snazícím se zahrnovat z takových ci onakých dvod co mozná nejsirsí obzor tématický, do
skutecného úsilí vdního vnásí vsak jenom nejasnosti a zmatek. Základem kazdého samostatného vdního oboru
zajisté je samostatná a svérázná vdecká metoda a metody té bychom ovsem nikdy nedosli pouhým
mechanickým slucováním metod nkolika." KALISTA: CHM, DD, S. 191.
62
Detaillierter zum Vergleich der Kulturgeschichte und Kalistas Geistesgeschichte ebenso wie zu Kalistas
Ansicht zur Kulturgeschichte siehe in dieser Arbeit das Kapitel ,,Kulturgeschichte und Kalistas
Geistesgeschichte".
63
Vgl. z.B.: SCHOEPS: Was ist und was will die Geistesgeschichte, S. 12.
20
die auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg Geistesgeschichte bleiben und die im
Folgenden eingehender beschrieben und vertieft werden sollen.
Im ersten Artikel der Zeitschrift für deutsche Geistesgeschichte, der gleichzeitig eine
Art Vorrede zur Zeitschrift darstellt, schreibt Virgil Redlich: ,,Das geistig Verbindende aber
aufzuzeigen, das Erforschen der geistigen Inhalte einer Zeit, Synthese und Blick auf das
Ganze, das sind die Ziele und Aufgaben, die der Geistesgeschichte als dringend erscheinen.
Nicht um die Masse der Einzelheiten ist es ihr zu tun, sondern um den Geist des Ganzen.
Einzelheiten sind nur wichtig, wenn sie zur Sinndeutung des Ganzen führen. Und es geht ihr
im Letzten nicht darum, bloße Tatsachen zu wissen, Äußerungen festzustellen, sie möchte die
geistige Welt verstehen, die aus ihnen spricht. Immer wird die Welt- und Lebensdeutung ihre
vornehmlichste Aufgabe sein."
64
Balduin Schwarz weist auf die Tatsache hin, dass die
Geistesgeschichte mit ihrem Vorhaben, das Wesen einer bestimmter Zeit aufzudecken, die
Historiographie von der traditionellen Auffassung ihres Sinns im Erkennen des Konkreten
wegführt. Die Geistesgeschichte kann sich nicht auf die Feststellung der Einzelheiten und der
konkreten Fakten beschränken, sondern muss immer auch den Weg der Erkenntnis des
Allgemeinen gehen.
65
Nicht zuletzt können wir dann hier den bereits einmal zitierten Beitrag von Erich
Rothacker aufführen.
66
Die Art, in der Rothacker den ,,Problemhistoriker" und den
,,Geisteshistoriker" unterschiedet und wie er diesen charakterisiert, ähnelt sehr Kalistas
Charakteristiken in seiner Geistesgeschichte.
Aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg führen wir als Beispiel für viele noch einen
Fall auf. Hans-Joachim Schoeps schrieb eine sehr harte Kritik zum Buch von Friedrich Heer
,,Europäische Geistesgeschichte", dem er vor allem den Fakt vorwarf, dass Heer sein
Versuch gerade in Richtung zu einer kumulativen Zusammenfassung vieler Einzelheiten aus
vielen Bereichen des menschlichen Geistes auseinander fiel und dass es ihm nicht gelang,
eine einheitliche Form der Abhandlung aufrecht zu erhalten.
67
Das Ganze ging in der Summe
der nicht miteinander verbundenen, verflochtenen Einzelheiten verloren. Heer hatte keine
systematische Konzeption des Ganzen und keine zugeordnete Methodik. Sein Versuch
konnte so nach Ansicht von Schoeps nicht gelingen.
Mit Kalistas Dimension seiner Geistesgeschichte, nämlich: ,,Die Geistesgeschichte
hat den menschlichen Geist zum Gegenstand, d.h. jene Potenz des Einzelnen und auch einer
größeren oder kleineren menschlichen Gesellschaft, die es ihnen ermöglicht, geistige Werte
(Begriffe, moralische Imperative) zu schaffen, sie zu begreifen und weiteren
Handlungsträgern mitzuteilen"
68
könnte sich der überwiegende Teil der Historiker der
deutschen Geistesgeschichte sicher identifizieren. Kalistas Charakteristik seiner
Geistesgeschichte in dem Sinne, dass sie Begriffe, Vorstellungen usw. in das ,,Zeitmilieu"
(,,dobového prostedí")
69
einsetzen soll, steht dem sehr nahe, was Rothacker als
,,Zeitausdruck" bezeichnete.
70
64
REDLICH, Virgil: Sinn und Aufgabe deutscher Geistesgeschichte, In: Zeitschrift für deutsche
Geistesgeschichte 1, 1935, S. 1.
65
SCHWARZ, Balduin: Zur philosophischen Grundlegung der Geistesgeschichte, In: Zeitschrift für deutsche
Geistesgeschichte 1, 1935, S. 108.
66
Im Kapitel ,,`Problemhistoriker` und ,Geisteshistoriker`". Zitierter Artikel: ROTHACKER:
Philosophiegeschichte und Geistesgeschichte, In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte 18, 1940, S. 125.
67
SCHOEPS, Hans-Joachim: Geistesgeschichte (Rezension zum Buch Friedrich Heer: Europäische
Geistesgeschichte), In: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 7, 1955, S. 8991.
68
,,Duchové djiny mají jako svj pedmt lidského ducha, tj. onu potenci jedincovu i vtsí ci mensí spolecnosti
lidské, která jim umozuje vytváet duchové hodnoty (pojmy, morální imperativy), je chápat i sdílet cinitelm
dalsím." KALISTA: CHM, DD, S. 194.
69
KALISTA: CHM, DD, S. 198.
70
ROTHACKER: Philosophiegeschichte und Geistesgeschichte, S. 9.
21
Kalistas Aufforderung für die Geistesgeschichte: die betreffende Vorstellung in ihr
,,Zeitmilieu" einzuordnen und sie dadurch richtig zu begreifen, ist auch kein Novum. Wenn
wir nur die ersten Jahrgänge der von Kalista zitierten Zeitschriften in Betracht ziehen, dann
können wir als ein Beispiel für alle Hans Fehr und seinen Beitrag ,,Mehr Geistesgeschichte in
der Rechtsgeschichte" aufführen.
71
Auch Fehr vertritt den Standpunkt, dass eine bestimmte Vorstellung, ein Begriff, aber
auch eine Institution usw. nicht gut verstanden werden können, wenn wir sie nicht in die
,,geistige Struktur"
72
der Zeit einsetzen, in welcher die betreffende Vorstellung auftaucht.
Fehr weist das an einem konkreten Beispiel nach: Man kann das Institut der
,,Gottesgerichte", der Ordale im Mittelalter in Europa nicht begreifen, wenn wir es nicht in
die geistige Struktur des Mittelalters einsetzen. Ein Verbrecher wurde im Mittelalter nämlich
als ein Mensch aufgefasst, der vom Teufel besessen ist, ein Mensch, der böse Dämonen in
sich hat, die seinen Willen beherrschen. Ein Mensch in diesem Zustand ist nicht in der Lage,
aus seinem freien Willen zu handeln. Solange der Teufel in der Seele und im Körper des
Menschen haust, ist der Mensch nicht in der Lage, die Wahrheit zu bekennen. Wenn keine
andere Zeugenschaft zur Verfügung steht, dann bleibt nichts übrig, als das ,,Gottesgericht"
das Ordal entscheiden zu lassen. Gegen das Gottesurteil vermag auch der Teufel nichts.
Daher kann laut Fehr abgeleitet werden, dass ,,Gottesgerichte" eigentlich einen Wettkampf
zwischen Gott und Teufel darstellten. Gott vollbringt während des Ordals ein Wunder, er
deckt die Wahrheit auf und besiegt den Teufel.
In der gleichen Weise sind die Folterwerkzeuge der damaligen Zeit zu verstehen.
Folterwerkzeuge stellten im Grunde ein Instrument dar, um den besessenen Menschen vom
Teufel zu befreien. Folterwerkzeuge sind in der Lage, die Wahrheit auch einem Menschen
abzuzwingen, der vom Teufel besessen ist. Sie sind eigentlich eher für jenen Teufel im
Menschen als für den gefolterten Menschen selbst bestimmt.
An diesem Beispiel illustriert Fehr das Vorgehen, das die Geistesgeschichte in ihrer
Recherche anwenden soll. Nämlich die ,,geistesgeschichtlichen Grundlagen
"73
der
betreffenden Vorstellung, Institution, des Begriffs usw., wie z.B. des Ordals, aufzudecken.
Das Vorgehen, das wir bei Fehr verfolgten und das bei vielen weiteren Historikern
der Geistesgeschichte zu finden ist, ist offensichtlich auch in Kalistas eigenen historischen
Arbeiten in sehr ähnlicher Weise ausgeführt. Wie Kalistas Konzeption der Geistesgeschichte
aussieht, der durch Kalista offenbar nicht ganz zu recht relativ scharf gegenüber dem
ursprünglichen Entwurf der deutschen Geistesgeschichte abgegrenzt wird, das wird der
Gegenstand der folgenden Kapitel sein.
71
FEHR, Hans: Mehr Geistesgeschichte in der Rechtsgeschichte, In: Deutsche Vierteljahrsschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 5, 1927, S. 18.
72
Ebd., S. 2.
73
Ebd., S. 23.
22
III. KALISTAS GEISTESGESCHICHTE
1. Der Gegenstand der Geistesgeschichte
Für das Verständnis von Kalistas Begriff der ,,Geistesgeschichte" wird es notwendig sein,
sich auf sein Werk ,,Djiny duchové" [,,Geistesgeschichte"] zu stützen, das in die Sammlung
Cesty historikova myslení [Die Wege des Denkens des Historikers] aufgenommen wurde.
74
a) Der Begriff und seine Geschichte
,,Die Geistesgeschichte hat den menschlichen Geist zum Gegenstand, d.h. jene Potenz des
Einzelnen und auch einer größeren oder kleineren menschlichen Gesellschaft, die es ihnen
ermöglicht, geistige Werte (Begriffe, moralische Imperative) zu schaffen, sie zu begreifen
und weiteren Handlungsträgern mitzuteilen."
75
Ebenso wie nach Kalistas Ansicht der
menschliche Geist eine Geschichte hat, haben auch ebenso Begriffe, geistige Werte usw. eine
Geschichte. Ein bestimmter Begriff Kalista führt als Beispiel den Begriff der Freiheit an
76
hat nicht eine einzige statische Bedeutung, die sich in der Geschichte nicht ändern würde,
sondern er verändert sich gemäß der Wandelbarkeit, der Unterschiedlichkeit der Zeiten, in
denen dieser konkrete Begriff auftritt. Ein anderer ist der Begriff der Freiheit in der
Aufklärung und ein anderer in der Zeit des Mittelalters. Wohl am prägnantesten drückte
Kalista seine These über die Wandelbarkeit des Begriffs in der Geschichte im Bereich seiner
primär nicht-methodologischen Werke in seinem Werk Karel IV. Jeho duchovní tvá [Karl
IV. Sein geistiges Gesicht]
77
aus. Schauen wir uns nun detaillierter Kalistas Arbeit mit den
Begriffen an. Daran lässt sich nämlich gut illustrieren, worin Kalistas Geistesgeschichte
eigentlich beruht. Die zentrale Rolle der Begriffe in Kalistas Konzept der Geistesgeschichte
zeigt sich auch an der oben zitierten Passage. Der Begriff ist nämlich laut Kalistas Konzept
eine der eminenten Früchte des menschlichen Geistes.
In seinem Werk Karel IV. Jeho duchovní tvá befasst sich Kalista detailliert mit der
Auffassung oder anders gesagt auch mit dem Begriff des Staates und der Staatsgewalt bei
Augustinus und Thomas von Aquin. Vor allem aus dem Grund, dass Kalista sich bemüht
abzuleiten, aus welchen Quellen der Kaiser Karl IV. seine Auffassung des Staates und der
Staatsgewalt schöpfte.
78
Im Folgenden werden wir uns an Kalistas Interpretation halten.
74
KALISTA: CHM, DD, S. 189257.
75
,,Duchové djiny mají jako svj pedmt lidského ducha, tj. onu potenci jedincovu i vtsí ci mensí spolecnosti
lidské, která jim umozuje vytváet duchové hodnoty (pojmy, morální imperativy), je chápat i sdílet cinitelm
dalsím.", KALISTA: CHM, DD, S. 194.
76
Ebd., S. 195.
77
KALISTA, Zdenk: Karel IV. Jeho duchovní tvá [Karl IV. Sein geistiges Gesicht], Prag 1971.
78
Zu den Quellen des Denkens von Karl IV. laut Kalista siehe auch KALISTA, Zdenk: Cesta po ceských
hradech a zámcích aneb Mezi tím, co je, a tím, co není [Reise durch böhmische Burgen und Schlösser oder
Zwischen dem, was ist, und dem, was nicht ist], Prag und Litomysl 2003, Kapitel Tajemný Karlstejn
[Geheimnisvolles Karlstein], S. 4251. Kalista verteidigt hier auch die Behauptung, dass es eine innere
Ähnlichkeit der Burg Karlstein und von Karls Denken gibt (S. 43).
23
Laut der Konzeption von Augustinus geht die Legitimität der Staatsgewalt aus der
Macht Gottes hervor.
79
Nur dann, wenn der Herrscher ein Knecht Gottes ist, kann er legitim
über andere Menschen herrschen. Der Herrscher soll nur als Knecht Gottes regieren.
80
Das
geschieht jedoch nur selten. Meist hatte die Macht des weltlichen Herrschers ihren
Ausgangspunkt in seiner Sehnsucht, über die anderen zu herrschen, also in seiner
menschlichen Zerrüttung.
Umgekehrt ging die Auffassung des Staates bei Thomas von Aquin
81
von den
aristotelischen Wurzeln aus, laut denen der Staat und sein Entstehen aus der natürlichen
Veranlagung des Menschen als soziales Wesen hervorgingen. Die Aristotelische Auffassung
übernimmt auch Thomas, wenn er die Gründung des Staates nicht aus der Zerrüttung der
menschlichen Natur ableitet, sondern umgekehrt aus der göttlichen Absicht. Aufgabe des
Staates soll die Gewährleistung eines ruhigen Zusammenlebens der Bürger sein. ,,Der
Herrscher, der bei Augustinus vor den Augen der Leser ,,De civitate Dei" mehr oder
weniger als Ausdruck jener zerrütteten menschlichen Natur, die auch den Staat entstehen
ließ, erstand und eigentlich die Herrschaft über die übrigen Menschen usurpierte, da er
keiner höheren natürlichen Ordnung angehört als sie und also auch nach der natürlichen
Ordnung kein Recht hat, über sie zu herrschen wird von hl. Thomas als natürliche
Notwendigkeit vorgestellt, ohne die der Staat und seine Gesellschaft ihr gestecktes Ziel nicht
erreichen könnten. Sein Titulus, der ihn zur Herrschaft berechtigt, welche die Bürger zwingt,
ihm zu gehorchen, rührt nicht daher, dass er als Erfüller der göttlichen Weisungen, ,,servus
Dei", anstellte Gottes, handelt, sondern stammt aus dem Bedarf des Staates, der ohne ihn
nicht in der Lage wäre, seine Mission ordentlich zu erfüllen."
82
Und Kalista fährt fort: ,,Es
wäre möglich zu sagen, dass, während der Herrscher bei Augustinus vor allem der Knecht
Gottes war, der Herrscher beim hl. Thomas von Aquin vor allem oder wenigstens teilweise
der Diener der Menschen ist, [...]."
83
Und Kalista fasst zusammen: ,,Der bis zu dem Maße
entpersönlichte Herrscher, wie es in den Augen des hl. Thomas von Aquin der ideale
Herrscher wäre, der sich in keiner Richtung von seinem persönlichen Interesse hinreißen
lässt, sondern vor allem das Wohlgedeihen des Staates bzw. des ihm anvertrauten Volkes
verfolgt, war sicher in seiner Führungsmission auch mit einer sicheren Autorität dazu
ausgestattet, Gesetze zu erlassen und seinen Untertanen aufzuerlegen. In der Auffassung des
hl. Augustinus, wo der Herrscher einfach als ,,servus Dei" (Knecht Gottes) erschien, war die
79
KALISTA: Karel IV. Jeho duchovní tvá, S. 51 ff.
80
Die Tatsache, dass Karl IV. diese Vorstellung von Augustinus übernahm, belegt Kalista am Beispiel der Burg
Karlstein, deren Architektur laut Kalista dem genannten Gedanken Augustinus untergeordnet ist. ,,Wenn wir
nämlich wirklich die versteinerte Symbolik der großen Burg von Karl, den Grundgedanken, der darin verkörpert
ist, verstehen wollen, müssen wir aus der Grundkonzeption seiner Autobiographie, vom Bild des Herrschers
ausgehen, das Karl hier darbietet. Regnare est servire Deo, herrschen bedeutet, Gott zu dienen..." (,,Chceme-li
totiz opravdu pochopit zkamenlou symboliku velkého hradu Karlova, základní myslenku, která je v nm
ztlesnna, musíme vyjít ze základní koncepce jeho autobiografie, obrazu panovníka, který tu Karel podává.
Regnare est servire Deo, vládnout znamená slouzit Bohu..."). Konkret dokumentiert das Kalista an der Tatsache,
dass der, wenn auch imposante, Palast vom Sakralbau in den Schatten gestellt wird. Und zum zweiten, dass der
zentrale Raum des Donjons, der die Dominante der Burg darstellt, die Heiligkreuzkapelle ist, welche die
dominanteste Besonderheit der Burg ist. Vgl. KALISTA: Cesta po ceských hradech a zámcích, S. 4344.
81
KALISTA: Karel IV. Jeho duchovní tvá, S. 71 ff.
82
,,Panovník, který u Augustina vyrstal ped ocima ctená ,,De civitate Dei" více mén jako výraz oné
porusené pirozenosti lidské, která dala vzniknout i státu, a vlastn usurpoval si vládu nad ostatními lidmi, nejsa
o nic vyssí v ádu pirozeném nez oni a nemaje tedy také podle pirozeného ádu práva nad nimi vládnouti je
sv. Tomásem pedstavován jako pirozená nutnost, bez níz by stát a jeho spolecnost nemohli dosíci svého
vytceného cíle [...]. Jeho titulus, opravující jej k vlád nutící obcany, aby ho byli poslusni, není to, ze vládne
jako plnitel píkaz bozích, ,,servus Dei", na míst bozím nýbrz poteba státu, který by bez nho nebyl s to,
aby plnil ádn svoje poslání." Ebd., S. 7576.
83
,,Bylo by mozno íci, ze kdezto Augustinv vlada byl pedevsím sluzebníkem bozím, je vlada sv. Tomáse
Akvinského pedevsím anebo aspo zárove sluzebníkem lidí, [...]." Ebd., S. 76.
24
Rechtsbefugnis in dieser Hinsicht nicht sehr klar abgesteckt: Der Herrscher war hier eher
der Erfüller des göttlichen Gesetzes, das von der Heiligen Schrift offenbart war, denn
Gesetzgeber aus eigener Initiative, Autor oder Auslöser der Gesetze. Beim heiligen Thomas,
wo die Vorstellung des Herrschers nicht durch die pessimistische Auslegung über die
Entstehung dieser Institution belastet ist wie beim großen Bischof von Hippo und daher auch
nicht in dem Maße eine Rechtfertigung durch die Aufgabe des einfachen Vollstreckers der
göttlichen Weisungen braucht, ist seine Autorität von weniger transzendentaler Art, sie
bildet sich selbständiger, sie ist nicht nur die Autorität des bloßen Interpretierenden des
göttlichen Gesetzes, die in ihrer Interpretation der Institutionen verständlicherweise
gebunden ist, der Gott vor allem die Auslegung seines Gesetzes, d.h. der Kirche, anvertraute.
Ihre Rechtfertigung liegt in der gesetzgebenden Funktion ,,bonum commune", nach der sie
sich richtet."
84
Kalistas Vorgehen bei der Ausleuchtung des Begriffs oder der Auffassung des Staats
und der staatlichen Autorität in seinem ,,Karl IV." sah also so aus, dass er zuerst klärte, wie
Staat, Staatsgewalt und Autorität des Herrschers von Augustinus und Thomas von Aquin
aufgefasst wurden, die Unterschiede in ihrer Auffassung und dadurch also auch die
Unterschiede des Begriffs Staat, staatliche Autorität, Staatsgewalt in der Zeit des frühen und
des Hochmittelalters zeigte. Begriffe, wie zum Beispiel der Begriff des Staats, der Freiheit
usw., entwickeln und wandeln sich also in der Geschichte und haben daher keine ständige,
unveränderliche Bedeutung. Im folgenden Schritt bemüht sich Kalista dann zu zeigen, wie
sich die Auffassung von Augustinus und Thomas´ im Denken von Karl IV. widerspiegelte.
Als Beispiel können wir Folgendes aufführen. Bei Thomas von Aquin und seiner Auffassung
des Staats ist die Rolle der Vernunft unterstrichen, die vor allem Gesetze usw. schafft. Den
Einfluss von Thomas auf Karls Denken leitet Kalista anschließend aus Karls Majestätsbrief
ab, wo die Bestimmungen wichtig sind, die vom Proömium begleitet sind, in dem der
Grundgedanke aufgeführt wird, der den Standpunkt der Vernunft verdeutlicht.
85
Den Einfluss von Augustinus auf das Denken von Karl IV. weist Kalista bspw. an
Karls Legende über den heiligen Wenzel nach, wo der augustinische Gedanke über die
menschliche Sehnsucht nach Herrschaft und die sich daraus ergebende Interpretation der
(wenn auch gerade deswegen illegitimen) Macht des Herrschers in Karls Vorstellung
Anwendung findet, dass Boleslav Wenzel wegen seiner ungezügelten Sehnsucht nach
Herrschaft ermordete. Ähnlich beschreibt Karl IV. auch den Unterschied zwischen der
Herrschaft von Wenzel und Boleslav so, dass Wenzel mit seiner Herrschaft Gott dient,
während Boleslav herrscht, um andere zu beherrschen. Kalista erblickt hier die sichtbaren
Resonanzen des augustinischen Konzepts von der legitimen bzw. illegitimen Macht, wobei
die Legitimität der Staatsgewalt gerade auf der Tatsache beruht, dass der Herrscher durch
sein Regieren Gott dient.
86
84
,,Panovník do té míry odosobnný, jako byl ideální panovník sv. Tomáse Akvinského, který v zádném smru se
nedával strhnouti zájmem svým, nýbrz sledoval pedevsím dobro státu resp. lidu sob sveného, byl zajisté ve
svém vdcovském poslání vybaven i bezpecnjsí autoritou k tomu, aby mohl vydávati a ukládati svým poddaným
zákony. V pojetí sv. Augustina, kde se panovník jevil prost jako ,,servus Dei" (sluzebník bozí), nebyla pravomoc
jeho v tomto ohledu dosti jasn vytcena: panovník tu byl spíse plnitelem zákona bozího, vyceného Písmem
svatým, nez zákonodárcem z vlastní své iniciativy, autorem a podntem zákon. U svatého Tomáse, kde
pedstava panovníkova není zatízena tím pesimistickým výkladem o vzniku této instituce jako u velikého biskupa
hipponského a nepotebuje tedy také do té míry ospravedlnní úkolem prostého vykonavatele píkaz bozích, je
autorita jeho mén transcendentálního rázu, utváí se samostatnji, není jen autoritou pouhého interpretátora
zákona bozího, vázanou pochopiteln ve své interpretaci institucí, které Bh pedevsím svil výklad svého
zákona, tj. Církví. Jejím ospravedlnním je v úkonu zákonodárném ,,bonum commune", kterým se spravuje."
Ebd., S. 8182.
85
Ebd., S. 83.
86
Ebd., S. 5758.
25
Man muss betonen, dass die Quellenbasis für eine solche Deduktion begrenzt und in
vielem problematisch ist, dessen ist sich Kalista jedoch selbst bewusst. Kalista zieht als
Erkenntnisquelle für das Denken von Karl IV. Urkunden und Dokumente in Betracht, die
Karls Kanzlei herausgab. Eine der wichtigen Quellen für Kalista war Karls Majestätsbrief.
Man kann kritisch fragen, bis zu welchem Maße sich in Karls Majestätsbrief Karls eigenes
Denken und zum Beispiel seine Auffassung des Staates äußerte.
Ein anderer Einwand gegen Kalistas Vorgehen könnte von dem Problem ausgehen,
wie man nachweisen kann, dass Karls Denken und allgemein die Werke, die aus Karls
Kanzlei hervorgingen, sich wirklich bei Augustinus und Thomas von Aquin inspirierten.
Hätten sie nicht andere Denker als Quelle haben können? Die Urkunden und Dokumente, die
Kalista in Betracht zieht, enthalten selbstverständlich keinen expliziten Verweis auf
Augustinus oder Thomas als ihre Quelle. Kann man also empirisch jene Anknüpfung
nachweisen?
In der Widerlegung dieses Einwands verbirgt sich eigentlich eine der Charakteristiken
der Methode von Kalistas Geistesgeschichte. Kalista geht es nicht primär um die Verfolgung
empirisch unterlegter Zusammenhänge, um die Feststellung, wo dieser konkrete Autor
wirklich die Impulse für sein Denken schöpfte. Kalista ist sich bewusst, dass er kaum
empirisch nachweisen kann, dass Karl für diesen oder jenen Gedanken seine Inspiration bei
jenem konkreten Werk von Augustinus oder Thomas fand. Er fügt allerdings im gleichen
Atemzug hinzu, dass es uns in der Geistesgeschichte auch nicht um einen solchen
empirischen Nachweis geht.
87
Wichtig ist der geistige Zusammenhang, man könnte wohl
sagen, der geistige Zusammenhang auf der ideellen Ebene. Es handelt sich vor allem um den
Inhalt des Begriffs, des Gedankens oder der allgemeinen Vorstellung, die untersucht wird.
Man sucht Ähnlichkeiten oder Verknüpfungen im Rahmen des Inhalts des Begriffs, des
Gedankens usw. Sicher kommt zu einer solchen Untersuchung auch die historische
Begründung in diesem Sinne dazu, dass Karl IV. den Gedanken von Augustinus oder von
Thomas von Aquin übernommen haben könnte, wenn er in späterer Zeit lebte und die
Möglichkeit hat, sich mit ihren Werken bekannt zu machen, er konnte den Gedanken
allerdings nicht z.B. von Leibniz übernehmen, wenn er mehrere Jahrhunderte vor diesem
lebte.
Gleichzeitig stellt Kalista an seine Geistesgeschichte jedoch den Anspruch, dass sie
erkennen soll, welche Änderungen und Entwicklung in den Begriffen, Gedanken und
Vorstellungen der vergangenen Menschen wirklich abliefen.
88
Die Geistesgeschichte
erforscht nicht irgendwelche Fiktionen und macht keine beliebigen Schlüsse. Sie kann zwar
nicht mit Sicherheit die Übertragung eines Gedankens, Begriffs usw. von einer Person bzw.
von einem Werk auf eine andere Person bzw. ein anderes Werk bestätigen, sie kann jedoch
urteilen, das diese konkrete Übertragung mit einem gewissen Maß an Wahrscheinlichkeit
erfolgte.
b) Begriffsgeschichte
i) Zdenk Kalista
87
Man muss hinzufügen, dass ich persönlich Kalistas Werk Karel IV. Jeho duchovní tvá für eines der besten
Beispiele für die konkrete Anwendung von Kalistas Konzept der ,,Geistesgeschichte" halte, dessen theoretischen
Entwurf er in seiner Studie Djiny duchové im Rahmen der Cesty historikova myslení skizzierte.
88
Bspw. KALISTA: CHM, DD, S. 199.
26
Nahe liegend ist die Frage, bis zu welchem Maß Kalista in seinem Werk die zukünftige
Richtung in der Geschichtsschreibung, die als ,,Begriffsgeschichte" bezeichnet wird,
vorhersah.
89
Kann man Kalista als einen der ersten überhaupt bezeichnen, der eine
Begriffsgeschichte erwog, obgleich von ihr zur Zeit Kalistas in den vierziger bis sechziger
Jahren noch nicht die Rede war?
Kalista verfolgt in vielen seiner Werke, wie wir es zum Beispiel im Buch Karel IV.
Jeho duchovní tvá beobachteten, die Veränderung des Inhalts bestimmter Begriffe in der
Geschichte. Gleichzeitig verfolgte Kalista dann auch das Auftreten bestimmter Begriffe in
einer konkreten Zeit, worauf er dann seine weiteren Ausführungen begründete.
90
Gleichzeitig bemühte sich Kalista den Einfluss der betreffenden Begriffe, zum
Beispiel des Begriffs des Staates oder der Staatsgewalt und der Autorität bei Augustinus und
Thomas von Aquin, auf das Denken von Karl IV nachzuweisen. Die genannten Begriffe, die
sich im Denken von Karl IV. widerspiegelten, äußerten sich jedoch gleichzeitig im konkreten
geschichtlichen Handeln von Karl IV. Wenn wir ein Beispiel für alle in Betracht ziehen:
Kalista schreibt: ,,Gegen die augustinische Konzeption des Königs als ,,Knecht Gottes"
brachte Thomas´ Auffassung den Herrscher als Umsetzer des ,,allgemeinen Guten" noch
einen Vorteil: Sie leitete die Tätigkeit des Herrschers sichtbarer auf eine konkrete Basis
über, stellte sie fester in die Mitte der wirklichen, realen menschlichen Gesellschaft, als es
beim Autor des Werks ,,De civitate Dei" war."
91
Aus Thomas´ Konzeption, dem Begriff des
Herrschers, der tiefer in der realen menschlichen Gesellschaft verwurzelt ist, leitet Kalista
dann zum Beispiel Karls Wirtschaftsbeschlüsse ab, mit denen Karl markant in das
zeitgenössische Geschehen im Staat, in das konkrete Leben der damaligen Gesellschaft
eingriff.
Führen wir noch ein Beispiel für Kalistas Vorgehen auf: Thomas´ Begriff der
Herrschergewalt beruht unter anderem auf der Behauptung, dass die weltlichen Herrscher in
den Sachen, welche endgültige, irdische menschliche Sachen betreffen, keine Untertanen der
Kirche sind, aber dass sie Untertanen der Kirche in Fragen sind, die sich auf das ewige Heil
der Untertanen beziehen. Thomas´ Begriff der Herrschergewalt wird dann laut Kalista auch
von Karl IV. übernommen: ,,Karl akzeptiert bereitwillig die Autorität des Papstes und
überhaupt der Kirchenrepräsentanten auf rein religiösen Felde, aber er ist nicht bereit, sich
89
Vgl. dazu zum Beispiel: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in
Deutschland, hrsg. von Otto BRUNNER, Werner CONZE, Reinhart KOSELLECK, 9 Bde, 19721997; IRA,
Jaroslav: Djiny politických pojm: nové roviny, nové pístupy a nové otázky [Geschichte der politischen
Begriffe: neue Ebenen, neue Zugangsweisen und neue Fragen], In: Djiny-teorie-kritika [Geschichte Theorie -
Kritik] 2, 2004, S. 213236; SUK, Jií: Foucaltv píchod do Cech [Foucaults Ankunft in Böhmen], In: Soudobé
djiny [Zeitgenössische Geschichte] XI/4, 2004, S. 5165; IGGERS, Georg G.: Geschichtswissenschaft im 20.
Jahrhundert. Ein kritischer Überblick im internationalen Zusammenhang, Göttingen 1996. Zur
Begriffsgeschichte bei Iggers siehe S. 8796. Übersichtlich zur deutschen Begriffsgeschichte vgl. auch
DANIEL, Ute: Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter, Frankfurt am Main 2006, S.
285296.
90
Die Tatsache, dass Kalista das Auftreten bestimmter Wörter und Begriff in einer konkreten Zeit bemerkt, zeigt
sich zum Beispiel an der Verfolgung des häufigen Auftretens des Wortes ,,Schicksal" in der Zeit der böhmischen
Renaissance; KALISTA, Zdenk: Mládí Humprechta Jana Cernína z Chudenic. Zrození barokního kavalíra
[Der junge Humprecht Jan Czernin z Chudenic. Geburt des Barockkavaliers], nákladem vlastním s pispním
CAV [in Selbstauflage mit Zuschuss der Tschechischen Akademie der Wissenschaften], Prag 1932, S. 96. Zu
Pekas Ansicht zum genannten Buch Kalistas vgl. PEKA, Josef: Deníky Josefa Pekae 1916 1933
[Tagebücher von Josef Peka], Prag 2000, S. 113.
91
,,Proti augustinovské koncepci krále jako ,,sluzebníka bozího" pináselo Tomásovo pojetí panovníka jako
uskutecovatele ,,obecného dobra" jest jednu výhodu: Svádlo cinnost panovníkovu zetelnji na konkrétní
základnu, stavlo jej pevnji doprosted skutecné, reálné spolecnosti lidské, nez tomu bylo u autora díla ,,De
civitate Dei.", KALISTA: Karel IV. Jeho duchovní tvá, S. 84.; zu Augustinus Vorstellung Gottes laut Kalista
siehe auch: KALISTA: Blahoslavená Zdislava z Lemberka [Die gebenedeite Zdislava von Lämberg], Prag 1991
(1. Ausgabe Rom 1969), S. 18.
27
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836643337
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- kulturgeschichte subjektivität mentalitätengeschichte problemhistoriker
- Produktsicherheit
- Diplom.de