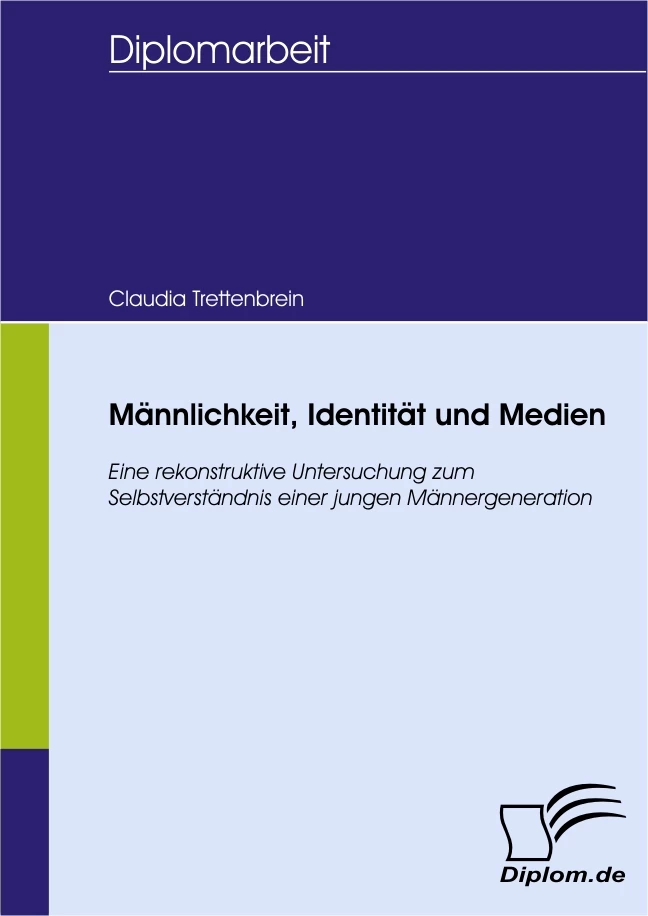Männlichkeit, Identität und Medien
Eine rekonstruktive Untersuchung zum Selbstverständnis einer jungen Männergeneration
©2009
Diplomarbeit
186 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Ist dir eigentlich bewusst, dass du Männer fragst, was Männlichkeit ist?
Diese Frage wurde mir von einem Mann gestellt, der an einer von mir durchgeführten Gruppendiskussion zum Thema Männlichkeit teilnahm. Eine rhetorische Frage, welche mich im ersten Moment sprachlos machte bei genauerer Betrachtung aber exakt die Beweggründe für die vorliegende Arbeit veranschaulicht.
Was Männer ausmacht, wie Männer sein sollen, wie sie sich am besten verhalten, wie sie auszusehen haben - kurz: was Männlichkeit eigentlich bedeutet - sind Fragen, welche allgegenwärtig sind. Man stellt diese Fragen selbst undsie werden gestellt, in welcher Form auch immer: sei es in einer Frauenrunde, in Talkshows, in Diskussionsrunden oder Zeitschriften, Männlichkeit ist immer und überall zur Disposition gestellt, und ganz besonders, seit traditionelle Geschlechterarrangements ins Wanken geraten. Umso erstaunlicher ist, dass dazu selten Männer gefragt werden. Es scheint, als würde die Männlichkeitsdiskussion, auf welcher Ebene auch immer, hauptsächlich von Frauen geführt werden, und die Antwort auf die spezifische Frage, was denn Männlichkeit ausmache, beinahe ausschließlich in weiblicher Hand liegen. Folgt man diesen Alltagsbeobachtungen, so erscheint es auf einmal viel weniger verwunderlich, dass die Fragestellung an einen Mann gerichtet alles andere als selbstverständlich ist.
In der wissenschaftlichen Diskussion hat sich im Bereich Männerforschung in den letzten Jahrzehnten doch einiges getan, wie in der vorliegenden Arbeit u.a. gezeigt wird. Dennoch gibt es nur wenige Studien, die explizit darauf ausgerichtet sind, das männliche Selbstverständnis in den Blick zu nehmen. Je weiter weibliche Emanzipationsbemühungen voranschreiten und Erfolge verzeichnen können, desto wichtiger wird es, diese Frage einer jeden Generation an Männern erneut zu stellen, da sich nicht nur Weiblichkeit, sondern auch Männlichkeit in einem steten Wandel befindet. In dieser Untersuchung habe ich den Fokus auf eine relativ junge Männergeneration gerichtet, sowie auf die Frage, wie mediale Repräsentationen von Männlichkeit eine Rolle für das Selbstverständnis dieser Generation spielen.
Die Antworten, die mir von den Untersuchten auf meine Fragen gegeben wurden, sind um einiges vielfältiger und interessanter als jene, die ich auf die anfangs zitierte Frage geben konnte: Ich denke […]
Ist dir eigentlich bewusst, dass du Männer fragst, was Männlichkeit ist?
Diese Frage wurde mir von einem Mann gestellt, der an einer von mir durchgeführten Gruppendiskussion zum Thema Männlichkeit teilnahm. Eine rhetorische Frage, welche mich im ersten Moment sprachlos machte bei genauerer Betrachtung aber exakt die Beweggründe für die vorliegende Arbeit veranschaulicht.
Was Männer ausmacht, wie Männer sein sollen, wie sie sich am besten verhalten, wie sie auszusehen haben - kurz: was Männlichkeit eigentlich bedeutet - sind Fragen, welche allgegenwärtig sind. Man stellt diese Fragen selbst undsie werden gestellt, in welcher Form auch immer: sei es in einer Frauenrunde, in Talkshows, in Diskussionsrunden oder Zeitschriften, Männlichkeit ist immer und überall zur Disposition gestellt, und ganz besonders, seit traditionelle Geschlechterarrangements ins Wanken geraten. Umso erstaunlicher ist, dass dazu selten Männer gefragt werden. Es scheint, als würde die Männlichkeitsdiskussion, auf welcher Ebene auch immer, hauptsächlich von Frauen geführt werden, und die Antwort auf die spezifische Frage, was denn Männlichkeit ausmache, beinahe ausschließlich in weiblicher Hand liegen. Folgt man diesen Alltagsbeobachtungen, so erscheint es auf einmal viel weniger verwunderlich, dass die Fragestellung an einen Mann gerichtet alles andere als selbstverständlich ist.
In der wissenschaftlichen Diskussion hat sich im Bereich Männerforschung in den letzten Jahrzehnten doch einiges getan, wie in der vorliegenden Arbeit u.a. gezeigt wird. Dennoch gibt es nur wenige Studien, die explizit darauf ausgerichtet sind, das männliche Selbstverständnis in den Blick zu nehmen. Je weiter weibliche Emanzipationsbemühungen voranschreiten und Erfolge verzeichnen können, desto wichtiger wird es, diese Frage einer jeden Generation an Männern erneut zu stellen, da sich nicht nur Weiblichkeit, sondern auch Männlichkeit in einem steten Wandel befindet. In dieser Untersuchung habe ich den Fokus auf eine relativ junge Männergeneration gerichtet, sowie auf die Frage, wie mediale Repräsentationen von Männlichkeit eine Rolle für das Selbstverständnis dieser Generation spielen.
Die Antworten, die mir von den Untersuchten auf meine Fragen gegeben wurden, sind um einiges vielfältiger und interessanter als jene, die ich auf die anfangs zitierte Frage geben konnte: Ich denke […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Claudia Trettenbrein
Männlichkeit, Identität und Medien
Eine rekonstruktive Untersuchung zum Selbstverständnis einer jungen Männergeneration
ISBN: 978-3-8366-4329-0
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Universität Wien, Wien, Österreich, Diplomarbeit, 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
1
INHALTSVERZEICHNIS
1 - VORWORT
5
2 - ERKENNTNISINTERESSE
7
2.1
-
M
ÄNNLICHKEIT
7
2.2
I
NDIVIDUALISIERUNG UND
I
DENTITÄTSKONSTITUTION
10
2.2.1
-
SOZIALER
W
ANDEL
10
2.2.2
I
DENTITÄT UND SOZIALE
R
OLLE
11
2.3
-
M
EDIEN
15
2.4
-
E
RKENNTNISINTERESSE
19
3. - BEGRIFFLICH-THEORETISCHE EXPLIKATION
23
3.1
-
Z
UM
G
ENERATIONSBEGRIFF BEI
M
ANNHEIM
23
3.1.1
-
G
ENERATION ALS SOZIALE
L
AGERUNG
24
3.1.2
-
G
ENERATIONSZUSAMMENHANG
25
3.1.3
-
G
ENERATIONSEINHEITEN
26
3.2
-
D
AS
K
ONZEPT DER HEGEMONIALEN
M
ÄNNLICHKEIT
28
3.2.1
-
SOZIALER VS
.
BIOLOGISCHER
D
ETERMINISMUS
28
3.2.2.
-
KÖRPERREFLEXIVE
P
RAXIS
29
3.2.3
-
HEGEMONIALE
M
ÄNNLICHKEIT
30
3.2.4
-
U
NTERORDNUNG
,
K
OMPLIZENSCHAFT UND
M
ARGINALISIERUNG
31
4 - ZUR METHODE
33
4.1
-
D
IE
E
NTWICKLUNG DES
G
RUPPENDISKUSSIONSVERFAHRENS
36
4.1.1
M
ARKTFORSCHUNG
36
4.1.2
F
RANKFURTER
S
CHULE
36
4.1.3
C
ULTURAL
S
TUDIES
37
4.1.4
E
NTDECKUNG DER
K
OLLEKTIVITÄT
:
W
ERNER
M
ANGOLD
38
4.2
-
M
ANNHEIMS
W
ISSENSSOZIOLOGIE
:
THEORETISCHE
F
UNDIERUNG DES
K
OLLEKTIVEN
40
4.2.1
KONJUNKTIVE UND KOMMUNIKATIVE
E
BENE
40
4.2.2
IMMANENTER UND DOKUMENTARISCHER
S
INNGEHALT
41
4.3
-
M
ETHODISCHE
I
NSTRUMENTARIEN ZUR
O
FFENLEGUNG KOLLEKTIVER
O
RIENTIERUNGEN
42
2
4.3.1
-
F
OKUSSIERUNGSMETAPHERN
42
4.3.2
S
CHRITTE DER
I
NTERPRETATION
42
4.3.3
DISKURSIVER
D
REISCHRITT
43
4.3.4
E
CKPUNKTE DER
O
RIENTIERUNGEN
44
5 - FORSCHUNGSDESIGN
47
5.1
-
E
INGRENZUNG DES
F
ORSCHUNGSFELDES
47
5.2
-
M
ETHODISCHES
V
ORGEHEN
52
5.2.1
-
E
INGANGSFRAGE
52
5.2.2
-
R
EFLEXION DER
E
INGANGSFRAGE
53
5.2.3
-
IMMANENTE
N
ACHFRAGEN
55
5.2.4
-
EXMANENTE
N
ACHFRAGEN
56
5.2.5
-
R
EFLEXION DER EXMANENTEN
N
ACHFRAGE
57
5.2.6
-
E
INSATZ VON
B
ILDERN
57
5.2.7
-
R
EFLEXION DES
E
INSATZES VON
B
ILDERN
58
6 - ANALYSE
59
6.1
-
Z
UR
D
ARSTELLUNGSWEISE DER
E
RGEBNISSE
59
6.2
-
F
ELDZUGANG
61
6.2.1
-
K
ONTAKTHERSTELLUNG
61
6.2.2
-
P
ROBLEME BEI DER
K
ONTAKTHERSTELLUNG
61
6.2.3
-
E
RLÄUTERUNG VON
E
RKENNTNISINTERESSE UND
R
AHMENINFORMATIONEN
62
6.3
-
G
RUPPE
,,W
OHNUNG
"
65
6.3.1
-
K
ONTAKTAUFNAHME UND
B
ESCHREIBUNG DER
G
RUPPE
65
6.3.2
-
E
RHEBUNGSSITUATION UND
B
EOBACHTUNGEN IM
F
ELD
66
6.3.3
-
D
ISKURSBESCHREIBUNG
67
6.3.4
-
P
ASSAGE
,,E
NTHAARUNG
"
67
6.3.5
-
P
ASSAGE
,,H
AUSHALT
"
75
6.3.6
-
P
ASSAGE
,,M
ÄNNLICHKEITSBILDER
/J
OCHEN
R
INDT
"
81
6.4
-
G
RUPPE
,,G
ARTEN
"
84
6.4.1
-
K
ONTAKTAUFNAHME UND
B
ESCHREIBUNG DER
G
RUPPE
84
6.4.2
-
E
RHEBUNGSSITUATION UND
B
EOBACHTUNGEN IM
F
ELD
85
6.4.3
-
D
ISKURSBESCHREIBUNG
87
6.4.4
-
P
ASSAGE
,,B
AUARBEITER
"
91
6.4.5
-
P
ASSAGE
,,
EIN RICHTIGER
K
ERL
"
95
6.4.6
-
P
ASSAGE
,,A
UTOS
"
97
6.4.7
-
P
ASSAGE
,,F
ORTPFLANZUNG
"
98
6.5
-
G
RUPPE
,,T
EPPICH
"
102
6.5.1
-
F
ELDZUGANG UND
G
RUPPENBESCHREIBUNG
102
6.5.2
-
E
RHEBUNGSSITUATION UND
B
EOBACHTUNGEN IM
F
ELD
103
3
6.5.3
-
D
ISKURSBESCHREIBUNG
104
6.5.3
-
E
INGANGSPASSAGE
104
6.5.4
-
P
ASSAGE
,,F
UßBALL
"
111
6.5.5
-
P
ASSAGE
,,W
EINEN
"
114
7 - ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE
119
7.1
-
Ü
BERBLICK
:
P
ARALLELEN UND
U
NTERSCHIEDE
119
7.2
-
O
RIENTIERUNG ZWISCHEN SOZIALEM
U
MFELD UND MEDIAL VERMITTELTEN
V
ORBILDERN
122
7.3
-
E
INORDNUNG DER
F
ÄLLE IN DIE
M
ÄNNLICHKEITSTYPOLOGIE VON
M
EUSER
125
7.3.1
D
ER TRADITIONELLE
T
YPUS
125
7.3.3
D
ER PREKÄRE
T
YPUS
128
7.3.2
D
ER DAUERREFLEXIVE
T
YPUS
131
7.3.4
D
ER EGALITÄRE
T
YPUS
133
7.3.5
E
INORDNUNG DER
F
ÄLLE
135
7.4
-
A
USBLICK
140
LITERATURVERZEICHNIS
141
ANHANG
143
T
RANSKRIPTIONSRICHTLINIEN
143
T
RANSKRIPTE
144
G
RUPPE
W
OHNUNG
-
E
NTHAARUNG
144
G
RUPPE
W
OHNUNG
H
AUSHALT
147
G
RUPPE
W
OHNUNG
M
ÄNNLICHKEITSBILDER
/J
OCHEN
R
INDT
150
G
RUPPE
G
ARTEN
-
B
AUARBEITER
154
G
RUPPE
G
ARTEN
E
IN RICHTIGER
K
ERL
159
G
RUPPE
G
ARTEN
-
A
UTOS
160
G
RUPPE
G
ARTEN
-
F
ORTPFLANZUNG
164
G
RUPPE
T
EPPICH
E
INGANGSPASSAGE
167
G
RUPPE
T
EPPICH
F
UßBALL
171
G
RUPPE
T
EPPICH
-
W
EINEN
173
B
EGRIFFSINVENTAR ZUR
D
ISKURSORGANISATION
176
A
BSTRACT
179
D
ANKSAGUNG
181
C
URRICULUM
V
ITAE
183
4
5
1 - VORWORT
Ist dir eigentlich bewusst,
dass du Männer fragst,
was Männlichkeit ist?
Diese Frage wurde mir von einem Mann gestellt, der an einer von mir durchgeführten
Gruppendiskussion zum Thema Männlichkeit teilnahm. Eine rhetorische Frage, welche
mich im ersten Moment sprachlos machte bei genauerer Betrachtung aber exakt die
Beweggründe für die vorliegende Arbeit veranschaulicht.
Was Männer ausmacht, wie Männer sein sollen, wie sie sich am besten verhalten, wie
sie auszusehen haben - kurz: was Männlichkeit eigentlich bedeutet - sind Fragen,
welche allgegenwärtig sind. Man stellt diese Fragen selbst und sie werden gestellt, in
welcher Form auch immer: sei es in einer Frauenrunde, in Talkshows, in
Diskussionsrunden oder Zeitschriften, Männlichkeit ist immer und überall zur
Disposition gestellt, und ganz besonders, seit traditionelle Geschlechterarrangements ins
Wanken geraten. Umso erstaunlicher ist, dass dazu selten Männer gefragt werden. Es
scheint, als würde die Männlichkeitsdiskussion, auf welcher Ebene auch immer,
hauptsächlich von Frauen geführt werden, und die Antwort auf die spezifische Frage,
was denn Männlichkeit ausmache, beinahe ausschließlich in weiblicher Hand liegen.
Folgt man diesen Alltagsbeobachtungen, so erscheint es auf einmal viel weniger
verwunderlich, dass die Fragestellung an einen Mann gerichtet alles andere als
selbstverständlich ist.
In der wissenschaftlichen Diskussion hat sich im Bereich Männerforschung in den
letzten Jahrzehnten doch einiges getan, wie in der vorliegenden Arbeit u.a. gezeigt wird.
Dennoch gibt es nur wenige Studien, die explizit darauf ausgerichtet sind, das
männliche Selbstverständnis in den Blick zu nehmen. Je weiter weibliche
Emanzipationsbemühungen voranschreiten und Erfolge verzeichnen können, desto
6
wichtiger wird es, diese Frage einer jeden Generation an Männern erneut zu stellen, da
sich nicht nur Weiblichkeit, sondern auch Männlichkeit in einem steten Wandel
befindet. In dieser Untersuchung habe ich den Fokus auf eine relativ junge
Männergeneration gerichtet, sowie auf die Frage, wie mediale Repräsentationen von
Männlichkeit eine Rolle für das Selbstverständnis dieser Generation spielen.
Die Antworten, die mir von den Untersuchten auf meine Fragen gegeben wurden, sind
um einiges vielfältiger und interessanter als jene, die ich auf die anfangs zitierte Frage
geben konnte: Ich denke schon.
7
2 - ERKENNTNISINTERESSE
In diesem Kapitel wird erörtert, wie das Erkenntnisinteresse und die daraus resultierenden
forschungsleitenden Fragen entwickelt wurden. Zu Beginn werden die theoretischen
Vorüberlegungen skizziert, welche für das Erkenntnisinteresse ausschlaggebend waren.
Diese lassen sich in drei Hauptbereiche gliedern:
a) Die Position der Männerforschung innerhalb der sozialwissenschaftlichen
Geschlechterforschung
b) Die Frage nach Identität und ihrer Konstruktion innerhalb der Diskussion zur
Modernisierung der Moderne
c) Die Rolle der Medien als sinnstiftende Institution der Gegenwart
Anschließend wird, aufbauend auf diesen Überlegungen, das Erkenntnisinteresse formuliert,
welches die Themen Männlichkeit, Identität und Medien in Zusammenhang setzt.
2.1 - Männlichkeit
Ausgangspunkt der vorliegenden Studie war die Intention, Männlichkeit und männliche
Identität zu untersuchen. Die unterschiedlichsten sozialwissenschaftlichen Disziplinen
haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte nicht zuletzt ausgelöst durch die zweite
Frauenbewegung - ausgiebig mit der Erforschung des Weiblichen in allen Facetten
beschäftigt.
1
So notwendig dieser Fokus auch war bzw. immer noch ist, läuft er jedoch
Gefahr, die andere Seite zu übersehen: Geschlecht schließt immer schon den
Bezugsrahmen des anderen Geschlechts mit ein, und auch wenn diese These bereits als
wichtiger Bestandteil des theoretischen Fundaments der Geschlechterforschung
angesehen werden kann, so besteht doch noch immer ein Mangel an wissenschaftlichen
Arbeiten, die beide Geschlechter gleichermaßen in den Blick nehmen oder der Fülle an
Studien zum Weiblichen einen männlichen Fokus entgegensetzen, um diesem
Ungleichgewicht entgegenzuwirken. Studien zu Männlichkeit sind nach wie vor ,,an den
Fingern einer Hand abzuzählen."
2
1
vgl. Moser 2003
2
Meuser 1998, 11
8
Die erste Phase einer intensiven sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
Geschlecht erfolgte unter dem Begriff der Frauenforschung. Während zuvor das
Weibliche gar nicht untersucht oder lediglich als Abweichung der männlichen Norm
aufgefasst wurde (v.a. in den Naturwissenschaften wurde diese Ansicht deutlich),
begann sich die Sozialwissenschaft, ausgelöst durch die zweite Frauenbewegung der
1970er Jahre, mit dem Thema Weiblichkeit auseinanderzusetzen.
3
Der neue
wissenschaftliche Schwerpunkt der Frauenforschung kritisierte den bisherigen
androzentristischen Blick der Wissenschaft: Es wurde nicht für notwendig befunden, die
Kategorie Geschlecht wissenschaftlich genauer zu betrachten; wer den Menschen (auf
welche Art und in welcher Disziplin auch immer) erforschte, erforschte Männer. Dies
führte, wie die Frauenforschung kritisierte, zu einer kompletten Ausblendung von
Frauen und Weiblichkeit in der Wissenschaft. Das Männliche wurde so zur Norm alles
Menschlichen, das Weibliche ignoriert, beziehungsweise, wenn man sich mit dem
Weiblichen befasste, als Abweichung dieser Norm kategorisiert.
4
Dieses Phänomen
wurde von der Frauenforschung als ,,blinder Fleck" der Wissenschaft bezeichnet; das
Sichtbarmachen von Frauen war ihr anvisiertes Ziel, sowohl in der
gegenwartsbezogenen Forschung, als auch im Zuge einer wissenschaftlichen
Aufarbeitung dieser blinden Flecke der Vergangenheit.
5
Man folgte dabei einer ,,Logik
der Ergänzung", wie Moser beschreibt: ,,Die gesellschaftliche Ungleichheit der
Geschlechter soll durch die feministische Korrektur wissenschaftlicher Beobachtungen
tendenziell aufgehoben werden."
6
Keinesfalls darf aber angenommen werden, dass die Etablierung von Studien zum
Geschlecht ausschließlich dem Zweck dienen soll, der androzentristisch geprägten
Wissenschaft, die über Jahrhunderte hinweg das Männliche in den Vordergrund gestellt
hat, nachträglich einen Ausgleich entgegenzustellen. Wissenschaft muss über dieses
Stadium des Gleichgewicht-Herstellens hinausgehen und Bezüge zwischen den
Geschlechtern untersuchen.
Aus diesen Überlegungen heraus entwickelte sich der unter dem Begriff
Frauenforschung
postulierte
Wissenschaftsstrang
auch
immer
mehr
zur
3
vgl. Moser 2003
4
vgl. ebd.
5
vgl. Meuser 1998
6
Moser 2003,227
9
Geschlechterforschung, die sich zum Ziel gesetzt hat, mehr die Relation zwischen den
Geschlechtern in den Blick zu nehmen, anstatt ausschließlich auf das wissenschaftlich
lange vernachlässigte weibliche Geschlecht zu fokussieren. Betrachtet man jedoch die
Wissenschaftslandschaft der letzten Jahrzehnte, so liegt trotz dieses Anspruchs der
Geschlechterforschung noch immer mehr Gewicht auf der Untersuchung von
Weiblichkeit.
7
Es scheint, als habe sich das Prinzip des blinden Flecks innerhalb
geschlechtsspezifischer Studien umgekehrt: so sehr die Wissenschaft im Allgemeinen
durch ihre androzentristische Denkweise das Weibliche aus ihren Untersuchungen
ausgeschlossen hat, so sehr schließt Geschlechterforschung heute das Männliche aus.
Dabei gibt es laut Michael Meuser für die Sozialwissenschaft gerade in der aktuellen
gesellschaftlichen Situation genügend Anlass dazu, nach Männlichkeit zu fragen:
Die durch die Frauenbewegung bewirkten Veränderungen in den Strukturen des
Geschlechterverhältnisses erzeugen für immer mehr Männer einen Druck, ihren Ort in den
alltäglichen Geschlechterbeziehungen neu bzw. zum ersten Male bewußt zu definieren. Wie
generell in Umbruch- und Krisensituationen kommt es zu einer erhöhten lebensweltlichen
Reflexivität, als deren Folge Deutungsmuster zumindest zeitweise manifest werden. (...)
Wir haben also die forschungsstrategisch günstige Situation, daß sich traditionelle und
virtuelle neue Deutungsmuster von Männlichkeit zugleich rekonstruieren lassen.
8
Durch die zweite Frauenbewegung der 1970er Jahre hat sich die Situation von Frauen
und ihr Selbstverständnis von Weiblichkeit in den folgenden Jahrzehnten massiv
verändert. Mit leichter Verzögerung bewirkte dies auch einen Druck zur Neudefinition
von Männlichkeit. Nachdem in den vergangenen Jahrzehnten die Erforschung des
Weiblichen intensiv betrieben wurde, ist es nun Aufgabe der Sozialwissenschaften, die
im Umbruch befindlichen Definitionen und Auffassungen von Männlichkeit vermehrt in
den Blick zu nehmen. Diese Aufgabe ist nicht lediglich ,,eine wissenschaftsimmanente
Entwicklung der Frauenforschung", sondern ,,Frauenforschung und Soziologie befassen
sich mit dem Mann in dem Moment, in dem die Fraglosigkeit seiner sozialen Existenz
zu schwinden beginnt."
9
7
ebd.
8
Meuser 1998,12
9
Meuser 1998,11
10
2.2 Individualisierung und Identitätskonstitution
2.2.1 - sozialer Wandel
Der Wandel sozialer Strukturen war seit den Anfängen der sozialwissenschaftlichen
Forschung einer ihrer wichtigsten Eckpfeiler: wo immer gesellschaftliche Strukturen im
Umbruch befindlich sind, sind die Sozialwissenschaften gefordert, diesen Wandel zu
beschreiben, seine Ursachen und Wirkungen zu erforschen. Der Begriff des sozialen
Wandels ist von so allgemeiner Natur, dass er eine Vielzahl an Phänomenen
zusammenfassen und benennen kann. Eine allgemeine Definition bieten Münch und
Schmidt:
Sozialer Wandel meint eine Veränderung in den Strukturen eines Kollektivs, das heißt in
den Regeln und Regelmäßigkeiten inklusive der damit einhergehenden Werte und
Einstellungen, die eine Gesellschaft kennzeichnen. Prozesse wie Individualisierung,
Differenzierung, Rationalisierung, Domestizierung oder Globalisierung sind langfristig
wirksame Dimensionen des sozialen Wandels, die den Zustand moderner Gesellschaften
prägen (vgl. z.B. van der Loo/van Reijen 1992). Diese Entwicklungen umfassen in der
Regel wieder eine Vielzahl an Wandlungsprozessen auf unterschiedlichen Ebenen des
sozialen Lebens, sodass wir je nach zeitlicher Perspektive und Analyseobjekt auch zu
unterschiedlichen Bewertungen des sozialen Wandels kommen können.
10
Sozialer Wandel ist folglich kein eindeutiger Begriff, der ein bestimmtes Phänomen
benennt, sondern ein Ausdruck für eine ganze Reihe von unterschiedlichen
gesellschaftlichen Umwälzungen, die auf verschiedenen sozialen Ebenen ablaufen, und
je nachdem, welchen sozialen Wandel wir untersuchen, verschiedene Elemente
beinhalten kann.
Sehr oft geht sozialer Wandel mit Modernisierung einher ein Begriff, der ebenso wie
ersterer eher ein zusammenfassendes Schlagwort als ein eindeutiger Begriff ist. Im
Laufe der sozialwissenschaftlichen Forschung wurde immer wieder der Begriff der
Modernisierung verwendet, um sozialen Wandel zu beschreiben, was dazu führte, dass
er verschiedenste sowohl historische als auch gegenwärtige Phänomene benennt: z.B.
den Wandel, der im 18. Jahrhundert durch die Industrialisierung ausgelöst wurde,
genauso aber auch das Aufholen der Zweiten und Dritten Welt an die
10
Münch/Schmidt 2005, 201
11
Modernisierungsprozesse der Ersten Welt, und, historisch zuletzt, die ,,Modernisierung
der Moderne"
11
. Diese gegenwärtige Form von sozialem Wandel ist der Ausgangspunkt
der vorliegenden Arbeit.
Wie in obigem Zitat von Münch und Schmidt angesprochen, ist auch die
Modernisierung der Moderne ein Komplex an Phänomenen, der auf unterschiedlichen
Ebenen der Gesellschaft wirkt und diese verändert. Dadurch können von
wissenschaftlicher Seite immer wieder unterschiedliche Aspekte der Modernisierung in
den Vordergrund gestellt werden, was sich auch auf die Benennung des gesamten
Wandlungsprozesses auswirkt Begriffe wie Enttraditionalisierung, Individualisierung,
Multifunktionsgesellschaft, reflexive Moderne etc.
12
sollen den gesamten
Merkmalskatalog des sich aktuell vollziehenden sozialen Wandels benennen, stellen
aber je verschiedene Ausprägungen des gesamten Phänomens in den Vordergrund.
In dieser Arbeit soll der Begriff der Individualisierung verwendet werden. Dieser stellt
zwar, genauso wie alle anderen Begriffe, eine Verkürzung der oben angesprochenen
Phänomene dar
13
, legt den Fokus aber auf jene Aspekte von Modernisierung, die für die
vorliegende Arbeit am meisten relevant sind: die Auswirkungen des Aufbruchs sozialer
Strukturen auf die Bildung von männlicher Identität. Um diesen Prozess und seine
beeinflussenden Faktoren nachvollziehen zu können, ist es vorab notwendig, die
Begriffe Identität und soziale Rolle theoretisch voneinander zu differenzieren.
2.2.2 Identität und soziale Rolle
Identität ist laut Reinhardt ein Phänomen der Neuzeit in der Antike oder im Mittelalter
stellte sich die Frage nach Identität nicht, da diese mit der Geburt unwidersprüchlich
vorgegeben wurde: die sozialen Rollen waren automatisch zugewiesen und relativ
unveränderbar.
14
Mit der funktionalen Differenzierung von Gesellschaft änderte sich
diese Vorgaben: ,,Es bilden sich soziale Sonderbereiche wie Wirtschaft, Politik,
11
vgl. Oechsle/Geissler 2004,196
12
vgl. Mikos 1999
13
vgl. Oechsle/Geissler 2004
14
vgl. Reinhardt 2005
12
Religion, Recht, Liebe usw. heraus, die nach jeweils eigener Logik ablaufen, und in
denen die Individuen nun unterschiedliche und teils widersprüchliche Rollen
übernehmen müssen. Das erfordert es, in je einem Funktionskontext von den Rollen der
je anderen Funktionskontexte abzusehen bzw. zu abstrahieren."
15
Möchte man diese Entwicklungen verstehen, so muss man den Begriff der sozialen
Rolle erfassen:
,,Wir sind nicht allein auf der Welt, und deshalb müssen wir auch einiges tun und sein, was
uns die Kultur im Prozess der Sozialisation nahegelegt hat oder was die Gesellschaft und
konkrete andere von uns erwarten. Die Soziologie nennt solche Erwartungen ,soziale
Rollen`. (...) Da wir viele Rollen spielen, die sich zum Teil sogar widersprechen, wir ihnen
aber nicht entkommen können, müssen wir die Frage, wer wir als Handelnde ,wirklich`
sind, situationsspezifisch beantworten. (...) Unter der Perspektive der Beanspruchung in
vielen Rollen heißt Identität, durch alle diese Rollen ein Muster zu erkennen, das Sinn
macht und möglichst nicht im Widerspruch zu unserem aktuellen Bild von uns selbst
steht."
16
Der Begriff der sozialen Rolle bescheibt also jene Zuschreibungen, die von außen an
Individuen herangetragen werden. Da in der Neuzeit verschiedene soziale Rollen von
ein und demselben Individuum eingenommen und vereint werden müssen, fällt seit
dieser funktionalen Differenzierung die Identität eines Menschen nicht mehr
automatisch mit einer sozialen Rolle zusammen.
Gesellschafliche Strukturen können die an uns herangetragenen Erwartungen, also die
von uns zu erfüllenden sozialen Rollen, ausgestalten. Sozialer Wandel meint immer
auch eine Veränderung in diesen Strukturen.. Die Steuerungselemente der
gesellschaftlichen Strukturen sind u.a. ,,Sinn gebende Institutionen"
17
, wie z.B. Kirche,
Klassensystem, Familie etc. Sie geben zu einem mehr oder weniger großen Teil vor,
wie sich das Leben eines einzelnen Menschen gestalten kann sie eröffnen
Möglichkeiten, beschränken diese aber auch. Dadurch geben diese Institutionen und
Strukturen dem Individuum Orientierung, schränken sie aber auch ein.
Der Begriff der Individualisierung beschreibt die Modernisierung der Moderne insofern
treffend wenn auch verkürzt da sie geprägt ist von einem Abnehmen des Einflusses
15
Reinhardt 2005,36
16
Abels 2006, 248
17
Oechsle/Geissler 2004, 203
13
von gesellschaftlichen Institutionen, und einem daraus resultierenden Zunehmen von
individuellen Orientierungen innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen. So wird z.B.
die Gestaltung des Lebens immer weniger von Religion oder Beruf der Eltern
vorgegeben.
18
Die gesellschaftlichen ,,Grenzen" sind durchlässiger geworden, dem
Individuum kommt mehr Handlungsspielraum zu gleichzeitig aber auch mehr
Orientierungsaufwand: weil die Identität und ihre Bildung zunehmend in der Hand des
Subjekts liegt, welches einer immer größer werdenden Fülle an Angeboten von sozialen
Rollen gegenübersteht. Der Frage nach Identität, ihrer Konstruktion und ihrem
ständigen Wandel kommt unter diesen Voraussetzungen immer mehr Gewicht zu, ,,weil
sich das Individuum aufgrund der fragmentierten Lebensbedingungen seine Identität aus
verschiedenen Partikeln zusammenbasteln kann, in dem es zwischen mehreren
Optionen wählen kann. (...) Zugleich müssen immer mehr widersprüchliche Aspekte in
die persönliche Identität integriert werden."
19
, oder, wie Reinhardt beschreibt: ,,Man
kann und soll jetzt individueller sein als die anderen, muss seine Individualität aus sich
heraus erzeugen und dies in der Kommunikation präsentieren und inszenieren.
Individuen werden damit einer unstrukturierten Reflexionslast ausgesetzt."
20
Keinesfalls darf der geringer werdende Einfluss von Sinn gebenden Institutionen
aufgrund des sozialen Wandels unterschätzt werden, wie es laut Oechsle und Geissler in
der Diskussion darüber bei Zeiten passiert die zunehmende Bedeutung von
individuellen Entscheidungen ist aber nicht zu leugnen:
Individualisierung unterstellt nicht die individuelle Steuerbarkeit des Lebens;
Selbstverantwortung und ,biographische Selbststeuerung` (zit. nach Geissler/Oechsle 1996)
sind jedoch zentrale Bestandteile gesellschaftlicher Deutungsmuster zur modernen
Lebensführung geworden. Auch wenn oft die Wahlmöglichkeiten zu stark betont und
strukturelle Restriktionen ausgeblendet werden, so sind diese Deutungsmuster doch höchst
wirkungsmächtig.
21
Fasst man diese beiden Aspekte zusammen, so entsteht in Identitätsbildungsprozessen
ein Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlichen Individualisierungstendenzen und
dem noch immer bestehenden ,,Einfluss von außen", durch gesellschaftliche Strukturen.
18
vgl. Oechsle/Geissler 2004
19
Mikos 1999, 5
20
Reinhardt 2005,36
21
Oechsle/Geissler 2004, 203
14
Diese widersprüchlichen Aspekte äußern sich in eben jenen verschiedenen sozialen
Rollen, welche das Individuum in seiner Identität vereinen muss, denn Identität kann
trotz Individualisierungstendenzen nicht allein individuell konzipiert werden sie steht
immer in Bezug zur sozialen Umwelt.
Dieses Spannungsverhältnis kann veranschaulicht werden, indem man Identität einer
weiteren Begriffsklärung unterzieht. Abels definiert Identität folgendermaßen: ,,Identität
ist das Bewusstsein, ein unverwechselbares Individuum mit einer eigenen
Lebensgeschichte zu sein, in seinem Handeln eine gewisse Konsequenz zu zeigen und
in der Auseinandersetzung mit anderen eine Balance zwischen individuellen
Ansprüchen und sozialen Erwartungen gefunden zu haben."
22
Das hier angesprochene Spannungsfeld zwischen individuellen Ansprüchen und
sozialen Erwartungen bringt die Problematik der Individualisierungstendenzen auf den
Punkt: die sozialen Erwartungen werden in Form von verschiedenen zu erfüllenden
sozialen Rollen immer komplexer.
22
Abels 2006, 254
15
2.3 - Medien
Angesichts dieses Zwiespalts zwischen zunehmender Autonomisierung des
Individuums auf der einen, und den dennoch unweigerlich wirkenden Vorgaben der
sozialen Umwelt und Strukturen auf der anderen Seite, muss auch die Frage nach dem
Wandel der sinnstiftenden Strukturen gestellt werden. Medien bzw. Massenmedien als
sinnstiftende Institution sind im Vergleich zu z.B. Kirche oder Familie ein relativ
neues Phänomen, welches in älteren Modernisierungsprozessen, wenn überhaupt, dann
nur
von
geringer
Relevanz
ist.
Ihre
Rolle
in
den
gegenwärtigen
Individualisierungstendenzen wissenschaftlich zu untersuchen stellt somit eine
historisch relativ neue Herausforderung dar.
Klassische Konzepte der Identitätsbildung gehen davon aus, dass Identität in sozialer
Interaktion bzw. in Bezug auf die soziale Umwelt konstituiert wird. Diese soziale
Umwelt schließt, wie im vorangegangenen Kapitel erläutert wurde, auch Institutionen
mit ein. Diesem klassischen Konzept der Identitätsbildung müssen laut Mikos die
(Massen-)medien hinzugefügt werden
23
.
Medienrezeption nimmt einen nicht zu unterschätzenden Teil in der Entwicklung von
Identität ein: ,,Identitätsarbeit anhand medialer Texte ist in einer sich immer weiter
ausdifferenzierenden Gesellschaft eine Notwendigkeit, weil nur noch die Medien
zwischen den verschiedenen Lebensbereichen vermitteln können."
24
Damit sind die
medial vermittelten Inhalte nicht mehr nur ein weiterer institutionalisierter Teilbereich,
welcher in die Identität integriert werden muss, sondern ein notwendiger. Erst die
Medien ermöglichen es in der ausdifferenzierten, komplexen gegenwärtigen
Gesellschaft, in der das Subjekt bei der Vereinung verschiedener sozialer Rollen
zunehmend auf sich selbst angewiesen ist, sich in der Fülle der Möglichkeiten zu
orientieren und Identität bilden zu können.
Reinhardt hält fest, dass man dem System der Massenmedien insofern
Realitätskonstruktionen zusprechen kann, als dass diese aus einer Fülle an
23
vgl. Mikos 1999
24
Mikos 1999, 6
16
Möglichkeiten
relevant
erscheinende
Informationen
selektieren.
25
Dieser
Selektionsmechanismus macht Medien zu einer Institution, die zur Orientierung in
Bezug auf Identität beitragen. Dass Massenmedien die Wirklichkeit nicht abbilden,
sondern Informationen selektieren und damit Realität konstruieren, sei dem Publikum
dabei durchaus bewusst, und das Publikum weiß auch,
...dass diese Realitätskonstruktionen evtl. innerhalb geographischer oder Sprach-Grenzen
massenhaft rezipiert werden und so als Realitätsbasis für Anschlusskommunikation
außerhalb und innerhalb des Mediensystems zur Verfügung stehen. Man weiß, dass andere
dasselbe gesehen haben wie man selbst und dasselbe sehen werden. (...) So entstehen im
Medienpublikum abgestufte Unterstellungen kollektiver Gedächtnisse als Annahmen mit
bestimmten Merkmalsgruppen geteilten Realitätswissens (zit. nach Reinhardt/Jäckel 2005)
und damit kollektive Identitätsunterstellungen.
26
Reinhard verwendet hier den Begriff der Kollektivität, welcher einen weiteren Aspekt
von Identität aufwirft. Massenmedien können einen Beitrag zur Herstellung von
kollektiver Identität leisten: durch Selektion konstruieren sie Realität, welche das
Publikum (kritisch) rezipiert; durch das massenmediale Bewusstsein der Individuen
wird davon ausgegangen, dass auch andere dieselbe oder eine ähnliche massenmedial
vermittelte Realität erlebt haben.
Im Sinne der Methodologie der dokumentarischen Methode, welche in Kapitel 4.2 noch
ausführlicher behandelt wird, bedeutet dies: die Individuen teilen den gleichen
massenmedial vermittelten kollektiven bzw. konjunktiven Erfahrungsraum. Dieses
Wissen um den gemeinsamen Erfahrungsraum macht einen Austausch zwischen den
Individuen möglich, und dieses Bewusstsein macht es möglich, dass Identität auf
kollektiver Ebene gebildet wird. Die Beziehung zwischen der individuellen und der
kollektiven Ebene von Identität wird verständlich, wenn man den methodologischen
Grundlagen der dokumentarischen Methode weiter folgt. Laut Przyborski ,,liegt die
konjunktive Bedeutung, die Einbindung in den konjunktiven Erfahrungsraum vor dem
individuellen Handeln."
27
Im persönlichen Habitus vereinen sich die kollektiven
Aspekte: ,,Er ist die durch die je individuelle Biographie strukturierte individuelle
25
vgl. Reinhardt 2005
26
Reinhardt 2005, 39
27
Przyborski 2004, 31
17
Zusammenstellung oder Aufschichtung konjunktiver Erfahrungsräume. ,Identität` ist
der reflexiv verfügbare Anteil dieser individuellen Aufschichtung"
28
Verfolgt man diese Definitionen, so muss das von Reinhardt als kollektive Identität
beschriebene Phänomen umbenannt werden. Als Beispiel für kollektive Identität,
welche durch das Mitwirken der Massenmedien entwickelt wird, nennt Reinhardt die
Bildung von Nationalitäten. Besonders die Übertragung von politischen Ereignissen,
aber auch Sportübertragungen sind konstituierende Elemente für diese Form kollektiver
Identität: ,,...und nicht zuletzt haben Massenmedien so zur Entstehung von
Nationalismus und der Herausbildung nationaler Identitäten beigetragen (...) Es lässt
sich mit Fug und Recht behaupten, dass Massenmedien Generatoren und Garanten
kollektiver Identität sind."
29
Im Sinne der Methodologe der dokumentarischen Methode, die in der vorliegenden
Arbeit zur Anwendung kommt, würde man sagen: Massenmedien sind keine
Generatoren für kollektive Identität, sondern sie stellen einen Teil der kollektiven bzw.
konjunktiven Erfahrungsräume dar, welche zu einem persönlichen Habitus beitragen,
und in der Identität reflexiv werden.
Die Rolle der Massenmedien in der Modernisierung der Moderne ist folglich ebenso
von Komplexität geprägt, wie dieser soziale Wandel selbst. Keinesfalls lassen sich
Massenmedien auf ihre sinnstiftende, Orientierung liefernde Rolle allein beschränken.
Im Gegensatz zu Mikos, der Massenmedien als notwendiges Mittel der Orientierung in
einer komplexer werdenden Welt sieht, betont Reinhardt, dass Massenmedien die
Komplexität noch erhöhen können, indem sie Identitätsangebote liefern, die dem
Individuum ohne Medienbezug vermutlich völlig fern stünden:
Auch die ,normalen` Zuschauer spiegeln sich indirekt in den mehr oder weniger
prominenten ,realen` und fiktionalen Personen, die von der Massenkommunikation
thematisiert werden. Insbesondere zeigen uns diese Personendarstellungen nämlich, wie wir
nicht sind, aber sein könnten, wenn wir anders wären. So kommt es in Folge der medialen
Personenthematisierung zu einer massiven Erweiterung personaler Kontingenzhorizonte
und
verfügbarer
Personensemantiken
für
individuelle
Selbstbeobachtungen,
Selbstabgrenzungen und korrespondierende Identitätsunterstellungen. Zugleich werden
gesellschaftliche Identitätswerte (vgl. Goffman 1975, zuerst 1963), unter denen soziale
28
Przyborski 2004, 31
29
Reinhardt 2005, 40
18
Vorstellungen des idealen Personseins zu verstehen sind, permanent (re-)produziert und
modifiziert.
30
Massenmedien können die Orientierungslosigkeit, bzw. die Auflösung vorgegebener
Identitätskonstrukte und ihre Komplexität folglich noch verstärken. Da Massenmedien
derartig vielfältig sind und unterschiedlichste Informationen liefern, und auch die
zunehmende Komplexität selbst thematisieren, wird das Individuum mit einer Fülle
widersprüchlicher Informationen und Rollenangebote konfrontiert:
Die Medien sind durch die Vielfältigkeit ihres Materials, die Unterschiedlichkeit ihrer
Genres und den ihrer Eigenlogik eingehauchten Neuheitsfetischismus (was bereits
publiziert wurde, ist nicht mehr publikationswürdig) Garanten für Ambivalenzproduktion in
der Kommunikation. Damit leisten sie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für die
Förderung von Ambiguitätstoleranz, die für modernes Rollenspiel so wichtig ist. Außerdem
legen sie in ihrer Personenthematisierung mehr Wert auf das Herausarbeiten von
Individualität denn auf nahtlos ablaufendes rollentypisches Verhalten.
31
30
Reinhardt 2005,41
31
Reinhardt 2005,42
19
2.4 - Erkenntnisinteresse
Männlichkeit, Identität und Medien sind die drei theoretischen Grundpfeiler, die die
Basis für das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Untersuchung bilden. Das
Ineinandergreifen dieser drei Phänomene und die daraus entstehende außergewöhnliche
gegenwärtige Situation bilden die Struktur für das Erkenntnisinteresse.
Alle drei Ebenen stehen zueinander in Bezug: Ausgelöst durch die Modernisierung der
Moderne werden Identitätsbildungsprozesse zunehmend komplexer, es entsteht ein
Spannungsfeld zwischen zunehmender individueller Ausgestaltungsmöglichkeit von
Identität und dem größer werdenden Identitätsangebot der sozialen Umwelt. Dieses
Angebot von außen hat sich im Zuge der Modernisierung der Moderne ebenfalls
verändert, indem Massenmedien als sinnstiftende Institution eine wichtige Rolle
einnehmen und durch ihren globalen Wirkungsbereich den individuellen Horizont zur
Ausgestaltung des Lebens und persönlicher Identität deutlich erweitert haben. Der
Wechsel der Generationen, wie ihn Mannheim beschreibt, unterstützt den Prozess des
sozialen Wandels
32
, und kann Ausgangspunkt für sich verändernde kollektive
Identitäten sein.
Auch die Rezeption von Massenmedien bietet - relativ neue - Strukturen zur
Konstitution von Identität: der gemeinsame Erfahrungsraum wird durch Massenmedien
erweitert und strukturell verändert, indem Medienrezeption und deren Reflexion in die
alltägliche Interaktion integriert werden. Erst so können Medien ihre Rolle als
Sinnstifter einnehmen: ,,Medien entfalten ihre gesellschaftlichen Wirkungen, weil sie
Bestandteil von sozialen Praktiken sind, die erst über die konkreten
Einsatzmöglichkeiten
und
Auswirkungen
bestimmen."
33
Erst
durch
die
Auseinandersetzung mit medialen Angeboten in sozialer Interaktion können
Massenmedien sozial wirken. Und diese Auseinandersetzung fließt wiederum in die
Selektionsmechanismen der Massenmedien zurück; das Verhältnis zwischen
Massenmedien und sozialem Wandel ist folglich ein wechselseitiges
34
.
32
vgl. Mannheim 1964
33
Münch/Schmidt 2005,204
34
vgl. Reinhardt 2005
20
Aus diesem Grund wäre es kurzsichtig, im Zuge wissenschaftlicher Auseinandersetzung
mit der Rolle der Medien in diesem Prozess lediglich danach zu fragen, ob diese auf
Individuen wirken und die Identitätskonstitution beeinflussen. Eine Frage nach dem Wie
drängt sich auf: Wie haben Medien Einfluss? Aber auch: Wie gehen Individuen mit dem
massenmedialen Angebot um, und wie konstituiert sich daraus Identität?
Der theoretische Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist also nicht der Prozess einer
individuellen Identitätsfindung mithilfe eines medialen ,,Einflusses von außen", sondern
die Bildung kollektiver Identität innerhalb eines Interaktionsnetzwerks von Menschen
und Medien. Soziale Interaktion und Medien greifen ineinander. Die Einstellungen des
Einzelnen stehen nicht im Fokus; vielmehr wird gefragt, wie Vorstellungen von
Männlichkeit kollektiv hergestellt werden - in einer Welt, in der Medienbilder von
Geschlecht allgegenwärtig und vielfältig sind, und einen integrativen Bestandteil der
Bildung von Geschlechtsidentität darstellen.
Die Komplexität von Identitätsbildung zeigt sich besonders deutlich in Bezug auf die
Kategorie Geschlecht. Zu der Vielfalt an medial vermittelten Identitätsentwürfen
befindet sich die Definition von Männlichkeit und das männliche Selbstverständnis,
ausgelöst durch die 2. Frauenbewegung, in einer Umbruchsituation. Die Thematik der
kollektiven Männlichkeit bietet sich im besonderen Maße an, um das Aufbrechen von
traditionellen Strukturen und die daraus resultierenden Problemlagen und
Veränderungen im Identitätsfindungsprozess zu veranschaulichen und deutlich zu
machen.
Aus diesen theoretischen Überlegungen heraus kann das Erkenntnisinteresse mittels
zweier forschungsleitender Fragen zusammengefasst werden:
Wie wird kollektive männliche Identität im gegenwärtigen Spannungsverhältnis
zwischen sozialer und massenmedialer Umwelt hergestellt?
Die Frage nach der Position der Massenmedien im Identitätsfindungsprozess steht im
Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses: Welchen Stellenwert nehmen massenmedial
verbreitete Männlichkeitsbilder in diesem Prozess ein, und wie werden diese in die
21
soziale Auseinandersetzung mit männlichem Selbstverständnis integriert? Wie wird aus
diesen Identitätsangeboten ein kollektives Bild von Männlichkeit konstruiert?
Um eine Beantwortung dieser Frage möglich zu machen, ist es notwendig, sich vorab
mit männlicher Identität in einem allgemeineren Rahmen auseinanderzusetzen:
Wie entwickelt sich gegenwärtig kollektive männliche Identität, d.h. unter den
Vorzeichen von Individualisierung und dem Aufbrechen traditioneller
Geschlechterverhältnisse?
Die zweite forschungsleitende Frage ist als Orientierung für das zentrale
Erkenntnisinteresse notwendig: erst wenn ein Überblick darüber besteht, was
Männlichkeit für die Befragten ausmacht, kann genauer auf die Quellen dieser
Orientierungen eingegangen werden.
Die Teilung des Erkenntnisinteresses in zwei forschungsleitende Fragen ergibt sich u.a.
aus dem Versuch, eine für qualitative Forschungsfragestellungen typische Problematik
zu lösen. Nach Flick kann sowohl eine sehr offene, als auch zu begrenzte
Forschungsfrage dem methodischen Zugang abträglich sein: ,,Forschungsfragen können
einerseits zu breit gehalten sein, weswegen sie dann kaum eine Orientierung bei der
Planung und Umsetzung der Studie geben. Sie können aber auch zu eng gehalten sein
und darüber am untersuchten Gegenstand vorbeizielen oder die Entdeckung des neuen
eher blockieren als fördern."
35
Da Forschungsfragen nicht nur formuliert werden, um außenstehenden Personen das
Ziel einer Untersuchung klarzumachen, sondern auch als laufende Orientierung für den
Forscher/die Forscherin selbst, hat die Teilung des Erkenntnisinteresses vor allem den
Zweck, neben der zentralen Frage nach der Position der Massenmedien die fragile
Situation der Geschlechterverhältnisse an sich nicht aus den Augen zu verlieren.
Die erste Intention im Zuge der Entwicklung der forschungsleitenden Fragen war, den
Fokus auf massenmedial verbreitete Vorbilder zu legen; im Laufe der theoretischen
35
Flick 2000, 258f
22
Auseinandersetzung mit der Rolle der Massenmedien im Identitätsfindungsprozess
wurde diese Überlegung aus zwei Gründen verworfen:
Erstens würde eine Frage nach Vorbildern der Position der Massenmedien bei der
Identitätskonstitution nicht gerecht werden: es würde der Eindruck entstehen, dass
Massenmedien ,,von außen" auf die Bildung von Identität einwirken, anstatt ein
integrativer Bestandteil dieses Prozesses zu sein, und es würde von vorneherein
angenommen werden, dass Massenmedien ausschließlich über Darstellung von
konkreten Personen in die Bildung von Identität einbezogen werden.
Zweitens birgt die Frage nach medialen Vorbilder Probleme bei der Erhebung der
Daten: Laut Hurth ,,hat jeder Mensch Vorbilder nötig und wird es Vorbilder immer
geben"
36
, aber selten werden Vorbilder explizit als solche benannt. Eine direkte Frage
nach Vorbildern im Gespräch mit den Teilnehmern der Gruppendiskussionen, bzw. eine
Fokussierung des Erkenntnisinteresses auf die konkrete Beantwortung der Vorbildfrage,
würde somit vermutlich scheitern und die Entfaltung des Relevanzsystems der
Erforschten beschneiden.
36
Hurth 2001, 22
23
3. - BEGRIFFLICH-THEORETISCHE EXPLIKATION
In diesem Kapitel sollen zwei Aspekte des Erkenntnisinteresses theoretisch expliziert
werden, welche in dessen Erörterung noch nicht ausreichend Beachtung fanden.
Zuerst wird der Begriff der Generation erörtert, da dies die zentrale Kategorie zur
Einschränkung des Forschungsfeldes darstellt.
Im Anschluss daran erfolgt die Explikation eines theoretischen Ansatzes zur Erklärung von
geschlechtlichen Ungleichheiten: das Konzept der hegemonialen Männlichkeit.
3.1 - Zum Generationsbegriff bei Mannheim
In der Auseinandersetzung mit kollektiver männlicher Identität in einer Zeit, in der
traditionelle Geschlechterverhältnisse hinterfragt werden, drängt sich auch eine
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Generationen auf. Der soziale Wandel, das
Hinterfragen oder der Bruch mit Traditionen, erfolgt schließlich über mehrere
Generationen hinweg. Im folgenden soll der Generationsbegriff Karl Mannheims
erörtert werden, um dieser Dimension innerhalb der Frage nach männlicher Identität
und ihrem Wandlungspotenzial näher zu kommen, denn das Vorhandensein eines
ständigen Generationswechsels ermöglicht laut Mannheim erst, tradierte
Wissensbestände zu hinterfragen und zu modifizieren.
37
Karl Mannheim sieht im Konzept der Generation eine wichtige Kategorie der
Sozialwissenschaft, insbesondere in Phasen starken sozialen Wandels: ,,Das Problem
der Generationen ist ein ernst zu nehmendes und wichtiges Problem. (...) Seine
praktische Bedeutung wird unmittelbar ersichtlich, sobald es sich um das genauere
Verständnis der beschleunigten Umwälzungserscheinungen der unmittelbaren
Gegenwart handelt."
38
37
vgl. Mannheim 1964
38
Mannheim 1964, 522
24
Generation in seiner sozialwissenschaftlichen Bedeutung erschließt sich in Mannheims
Konzept über drei Ebenen: die Generationslagerung, den Generationszusammenhang
und die Generationseinheit.
3.1.1 - Generation als soziale Lagerung
Um dem Begriff der Generation näherzukommen, unterscheidet Mannheim zwischen
konkreten sozialen Gruppen und sogenannter ,,sozialer Lagerung"
39
. Konkrete Gruppen
sind Zusammenschlüsse, die ,,im wesentlichen durch vital, existentiell vorausgehende
Bindungen der ,Nähe` fundiert sind oder durch bewußt gewollte Stiftung des
,Kürwillens` zustande kommen. Dem ersteren Typus entsprechen alle
Gemeinschaftsgebilde
(Familie,
Sippe
usw.),
dem
letzteren
die
,Gesellschaftsgebilde`."
40
Zwar kann die Zugehörigkeit zu einer Generation die Basis
für eine konkrete Gruppenbildung liefern, ist aber selbst nicht über eine bewusste
Zugehörigkeit oder räumliche Nähe definierbar.
Vielmehr ist sie, genauso wie die Klassenlage, eine ,,schicksalsmäßig verwandte
Lagerung bestimmter Individuen"
41
, die nicht auf bewusster Zugehörigkeit basiert: ,,In
einer Klassenlage befindet man sich; und es ist auch sekundär, ob man davon weiß oder
nicht, ob man sich ihr zurechnet oder diese Zurechenbarkeit vor sich verhüllt."
42
Hier
liegt die Gemeinsamkeit zwischen Generation und Klasse: es handelt sich um eine
Lagerung, die, im Gegensatz zur Gruppenzugehörigkeit, nicht bewusst eingegangen
oder konkret aufkündbar ist.
Während sich die Basis der Klassenlage im ökonomischen Machtgefüge findet, ist die
Generationslage ,,fundiert durch das Vorhandensein des biologischen Rhythmus im
menschlichen Dasein"
43
. Die biologischen Gegebenheiten von Leben und Sterben sind
die Voraussetzung für die Existenz einer Generationslage, die sich auf ihrer
biologischen Ebene jedoch nicht erschöpft, sondern lediglich die sozialen Dimensionen
von Generationszugehörigkeit ermöglicht: ,,Gäbe es nicht das gesellschaftliche
39
Mannheim 1964,524
40
Mannheim 1964,525
41
ebd.
42
Mannheim 1964,526
43
Mannheim 1964, 527
25
Miteinander der Menschen, gäbe es nicht eine bestimmt geartete Struktur der
Gesellschaft, gäbe es nicht die auf spezifisch gearteten Kontinuitäten beruhende
Geschichte, so entstünde nicht das auf dem Lagerungsphänomen beruhende Gebilde des
Generationszusammenhanges, sondern nur das Geborenwerden, das Altern und das
Sterben."
44
Erst in Zusammenhang mit sozialem Handeln wird die Generation eine für die
Sozialwissenschaft beachtenswerte Kategorie, denn sie schränkt den Orientierungsraum
der Zugehörigen ein, und gibt diesen gleichzeitig auch vor:
Eine jede Lagerung schaltet also primär eine große Zahl der möglichen Arten und Weisen
des Erlebens, Denkens, Fühlens und Handelns überhaupt aus und beschränkt den Spielraum
des sich Auswirkens der Individualität auf bestimmte umgrenzte Möglichkeiten. (...) Es
inhäriert einer jeden Lagerung im positiven Sinne eine Tendenz auf bestimmte
Verhaltungs- Gefühls- und Denkweisen (...) Wir wollen in diesem Sinne, von einer, einer
jeden Lagerung inhärierenden Tendenz sprechen, die aus der Eigenart der Lagerung selbst
bestimmbar ist.
45
3.1.2 - Generationszusammenhang
Mannheim
unterscheidet
des
weiteren
zwischen
der
eben
erläuterten
Generationslagerung und dem Konzept des Generationszusammenhanges. Ersterer ist
bereits durch biologische und räumliche Faktoren gegeben der Begriff der
Generationslagerung beschreibt lediglich das gemeinsame Potenzial, also die
historischen und räumlichen Voraussetzungen für gemeinsame Erlebnisschichtungen.
Der Generationszusammenhang geht über dieses reine Potenzial hinaus, indem er eine
,,Partizipation an den gemeinsamen Schicksalen"
46
, die durch die Generationslagerung
ermöglicht werden, beinhaltet. ,,Von einem Generationszusammenhang werden wir also
nur reden, wenn reale soziale und geistige Gehalte gerade in jenem Gebiete des
Aufgelockerten und werdenden Neuen eine reale Verbindung zwischen den in derselben
Generationslagerung befindlichen Individuen stiften."
47
Der Unterschied zwischen
44
Mannheim 1964, 528
45
ebd.
46
Mannheim 1964, 542
47
Mannheim 1964, 543
26
Lagerung und Zusammenhang, bzw. die Spezifik des Generationszusammenhangs liegt
also in der ,,realen Verbindung" der Individuen, die eine gemeinsame
Generationslagerung teilen. Diese Verbindung entsteht über das tatsächliche
gemeinsame Erfahren, denn es sind ,,gleichaltrige Individuen nur insofern durch einen
Generationszusammenhang verbunden, als sie an jenen sozialen und geistigen
Strömungen teilhaben, die eben den betreffenden historischen Augenblick konstituieren,
und insofern sie an denjenigen Wechselwirkungen aktiv und passiv beteiligt sind, die
die neue Situation formen."
48
3.1.3 - Generationseinheiten
Dass Menschen einen gemeinsamen Generationszusammenhang teilen, d.h. dieselben
Schicksale teilen, bedeutet noch nicht, dass sie auf diese gemeinsamen Erlebnisse auch
in selber Weise reagieren. Ihr gemeinsamer Erfahrungsraum kann in verschiedenen
,,Formen der geistigen und sozialen Auseinandersetzung mit demselben, sie alle
betreffenden historisch-aktuellen Schicksal" in Erscheinung treten. Diese
unterschiedlichen
Formen
der
Auseinandersetzung
nennt
Mannheim
Generationseinheiten: Personen, die im selben Generationszusammenhang leben,
können sich zu verschiedenen Generationseinheiten ausgestalten, die aber stets das
gemeinsame, historisch-räumliche Schicksal teilen. Mannheim veranschaulicht am
Beispiel der Jugendgeneration um 1800, dass sich das geteilte Erleben derselben
historischen Ereignisse in zu einer Polarisierung zwischen romantisch-konservativ und
liberal-rationalistisch orientierter Jugend ausformte, und schließt daraus:
,,Generationseinheit ist also eine viel konkretere Verbundenheit als die, die der bloße
Generationszusammenhang stiftet. Dieselbe Jugend, die an derselben historisch-
aktuellen Problematik orientiert ist, lebt in einem ,,Generationszusammenhang",
diejenigen Gruppen, die innerhalb desselben Generationszusammenhanges in jeweils
verschiedener Weise diese Erlebnisse verarbeiten, bilden jeweils verschiedene
,,Generationseinheiten" im Rahmen desselben Generationszusammenhanges."
49
48
Mannheim 1964, 543
49
Mannheim 1964, 544
27
Für die vorliegende Untersuchung spielt das Konzept der Generation in erster Linie für
die Einschränkung des Forschungsfeldes eine bedeutende Rolle. Das Erfassen einer
alltagssprachlichen Generation kann durch Mannheims Generationskonzept mehr
theoretische Trennschärfe erlangen. Anhand der drei Gliederungsebenen wird
verdeutlicht, wie ein und dieselbe Generationslagerung nicht automatisch auch
dieselben Erfahrungen und Reaktionen auf diese teilen (siehe dazu Kapitel 4.1).
28
3.2 - Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit
Innerhalb der Vielfalt an sozialwissenschaftlichen Ansätzen, welche ein Spektrum vom
sozialen bis hin zum biologischen Determinismus umfassen, um Geschlecht theoretisch
zu erklären, stellt das Konzept der hegemonialen Männlichkeit von Robert W. Connell
einen Ansatz dar, welcher meines Erachtens der Komplexität der sozialen
Geschlechterrealität am nächsten zu kommen vermag. Seiner Konzeption gelingt
insofern die Quadratur des Kreises, als dass der Ansatz ,,sowohl den Determinismus des
Patriarchatskonzepts vermeidet als auch Dominanzverhältnisse unter Männern
systematisch berücksichtigt"
50
. Damit gelingt es dem Konzept der hegemonialen
Männlichkeit, den Mängeln anderer theoretischer Ansätze zu entfliehen.
3.2.1 - sozialer vs. biologischer Determinismus
Connell beschreibt Ansätze aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und
Denkrichtungen, welche versucht haben, Männlichkeit systematisch zu erfassen. Dabei
ist stets der Gegensatz zwischen biologischen und sozialen Erklärungsansätzen deutlich.
Neuere Modelle versuchen zwar, diese Gegensätze zu verbinden, wie z.B. die
Geschlechtsrollentheorie, welche ,,ein soziales Skript einer biologischen Dichotomie
hinzufügt."
51
Allerdings weisen auch diese Versuche Schwachstellen auf: ,,Wenn der
biologische Determinismus genauso falsch ist wie der soziale Determinismus, dann ist
es unwahrscheinlich, daß eine Kombination aus beidem richtig sein könnte."
52
Connell veranschaulicht dies am Einfluss des sozialen Prozesses auf vermeintlich
biologisch determinierten Merkmalen von Geschlecht:
Der soziale Prozeß kann in der Tat körperliche Unterschiede ausarbeiten (ein wattierter
Büstenhalter, ein Penisfutteral, der Hosenbeutel). Der soziale Prozeß kann festlegen, daß es
nur ein soziales Geschlecht gibt (,,unisex" Mode, geschlechtsneutrale Arbeit), oder zwei
(Hollywood), oder drei (viele nordamerikanische Indianerkulturen), oder vier (europäische
Städtische Kultur, als man nach dem 18. Jahrhundert damit begann, Homosexuelle
auszulesen), oder ein ganzes Spektrum an Fragmenten, Variationen und Übergängen.
53
50
Meuser 1998,97
51
Connell 1999, 72
52
ebd.
53
ebd.
29
Der Ansatz, dass die Ebene des Sozialen lediglich unterstützend für eine biologisch
determinierte
Zweigeschlechtlichkeit
fungiert,
bzw.
dieser
eine
weitere
Ausprägungsebene hinzufügt, muss also mangelhaft bleiben. Das soziale Geschlecht
(gender) kann Vorstellungen vom biologischen Geschlecht (sex) zwar unterstützen, aber
auch - jenseits der geläufigen Vorstellung von Dichotomie - modifizieren.
Nichtsdestotrotz spielt auch der Körper eine eigene, wichtige Rolle in der Erklärung von
Geschlecht, welche nicht in sozialem Determinismus aufgehen darf: ,,Der Körper ist
auch in seiner reinen Körperlichkeit von großer Bedeutung. Er altert, wird krank,
genießt, zeugt und gebärt. Es gibt eine nicht reduzierbare körperliche Dimension in
Erfahrung und Praxis"
54
.
3.2.2. - körperreflexive Praxis
Ein Zugang, der Körperlichkeit und Sozialität theoretisch gewinnbringend in Einklang
bringen soll, findet sich im Konzept der körperreflexiven Praxis, welches den Körper
und soziale Prozesse als zueinander in Bezug stehend versteht: ,,Durch körperreflexive
Praxen werden Körper in den sozialen Prozeß mit einbezogen und zu einem Bestandteil
von Geschichte, ohne damit aber aufzuhören, Körper zu sein."
55
Man kann soziales
Handeln laut Connell nicht losgelöst davon sehen, was der Körper ermöglicht oder
begrenzt: er kann Optionen bieten, diese aber gleichzeitig auch einschränken.
Diese Praxen, welche eben auch durch Körperlichkeit geprägt sind, hinterlassen
wiederum ihre Spuren in sozialen Strukturen, in der Welt, in der wir leben. Durch den
Prozess der körperreflexiven Praxis spielt also auch der Körper wieder eine Rolle in den
gesellschaftlich geläufigen Strukturen, und kann daher in einem theoretischen
Geschlechterkonzept nicht negiert werden: ,,Die Praxen, die Männlichkeit konstruieren,
sind in diesem Sinne ontoformativ. Als körperreflexive Praxen konstituieren sie eine
Welt mit einer körperlichen Dimension, die aber nicht biologisch determiniert ist."
56
Daraus entsteht ein zirkuläres Wirken zwischen körperreflexiver Praxis und
54
Connell 1999,71
55
Connell 1999, 84
56
Connell 1999, 85
30
gesellschaftlichen Strukturen: Die Praxis konstituiert die Struktur, und die Struktur
konstituiert die Praxis
57
.
3.2.3 - hegemoniale Männlichkeit
Aus dieser Basis heraus entwickelt Connell das Konzept der hegemonialen
Männlichkeit. Der Begriff der Hegemonie beschreibt die Vorherrschaft einer Form von
Männlichkeit, sowohl gegenüber Frauen, als auch gegenüber anderen Formen von
Männlichkeit. Mit hegemonialer Maskulinität ,,ist eine Konfiguration von
Geschlechtspraktiken gemeint, welche insgesamt die dominante Position des Mannes
im Geschlechterverhältnis garantiert." Sie ist ,,keine feste Charaktereigenschaft, sondern
kulturelles Ideal, Orientierungsmuster, das dem doing gender der meisten Männer
zugrunde liegt"
58
, oder, wie Connell es selbst ausdrückt: ,,Hegemoniale Männlichkeit
kann man als jene Konfiguration geschlechtsbezogener Praxis definieren, welche die
momentan akzeptierte Antwort auf das Legitimitätsproblem des Patriarchats verkörpert
und die Dominanz der Männer sowie die Unterordnung der Frauen gewährleistet (oder
gewährleisten soll)."
59
Die Hegemonie wird laut Connell über drei Ebenen aufrecht erhalten:
Machtbeziehungen, Produktionsbeziehungen, und emotionale Bindungsstruktur
(Kathexis). Sie garantieren die Vorherrschaft der gültigen hegemonialen Männlichkeit.
Als einen Mangel dieser Konzeption erkennt Meuser, dass Machtbeziehungen
eigentlich auf einer übergeordneten Ebene wirken, während Produktionsbeziehungen
und emotionale Bindungen diese umsetzen: ,,Connell berücksichtigt das auf
konzeptioneller Ebene nicht; seine Theorie der Männlichkeit basiert jedoch auf der
Kategorie der Macht. Männliche Suprematie äußert sich sowohl in den Strukturen der
Produktion als auch in den kulturellen Mustern der emotionalen Anziehung."
60
57
Der theoretische Hintergrund zu dieser Konzeption von Handeln und Struktur ist sowohl bei Bourdieu
als auch in Giddens` Konzept der Dualität und Struktur zu finden, vgl. Meuser 1998
58
Meuser 1998, 98
59
Connell 1999, 98
60
Meuser 1998,98
31
3.2.4 - Unterordnung, Komplizenschaft und Marginalisierung
Es geht bei hegemonialer Männlichkeit also prinzipiell um Macht; diese wird im
Connell'schen Konzept nicht nur von der hegemonialen Männlichkeit selbst gesichert,
sondern auch durch Unterordnung, Komplizenschaft und Marginalisierung.
Als Beispiel für Unterordnung nennt Connell das Verhältnis zwischen Hetero- und
homosexuellen Männern. Die Unterordnung homosexueller Männer erfolgt sowohl über
strukturelle, als auch über körperliche Gewaltausübung, was sie ,,an das unterste Ende
der Geschlechtshierarchie" rücken lässt. ,,Alles, was die patriarchale Ideologie aus der
hegemonialen Männlichkeit ausschließt, wird dem Schwulsein zugeordnet; das reicht
von einem anspruchsvollen innenarchitektonischen Geschmack bis zu lustvoll-passiver
analer Sexualität."
61
Die Komplizenschaft mit der hegemonialen Männlichkeit eröffnet die Möglichkeit, an
den Vorzügen einer weiblichen Unterdrückung teilzuhaben, auch wenn man selbst den
normativen Ansprüchen der Hegemonie nicht entspricht bzw. entsprechen kann. ,,Als
komplizenhaft verstehen wir in diesem Sinne Männlichkeiten, die zwar die patriarchale
Dividende bekommen, sich aber nicht den Spannungen und Risiken an der vordersten
Frontlinie des Patriarchats aussetzen."
62
Der Vorgang der Marginalisierung spielt besonders dann eine Rolle, wenn
Männlichkeiten ,,sich dem hegemonialen Muster explizit entziehen oder (...) dagegen
opponieren."
63
Dies kann dann der Fall sein, wenn es zu Machtkonflikten entlang der
Grenzen von Ethnizität oder Schichten kommt. Durch Marginalisierung kann ein
Vertreter einer untergeordneten Männlichkeit als Vorbild für hegemoniale Maskulinität
in Frage kommen, ohne dass er dadurch aber Machpositionen für jene Gruppe erlangt,
die er vertritt. Dies veranschaulicht Connell am Beispiel von afroamerikanischen
Sportlern. Aufgrund der Marginalisierungsmechanismen ,,können in den USA schwarze
Sportler durchaus Vorbilder für hegemoniale Männlichkeit abgeben. Aber der Ruhm
61
Connell 1999,99
62
Connell 1999,100
63
Meuser 1998,101
32
und Reichtum einzelner Stars strahlt nicht auf die anderen Schwarzen aus und verleiht
den schwarzen Männern nicht generell ein größeres Maß an Autorität."
64
Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit ist meines Erachtens vor allem deswegen
ein geeigneter theoretischer Ansatzpunkt für die Untersuchung eines männlichen
Selbstverständnisses, weil es vielfältige Definitionen von Männlichkeit zulässt.
Demgegenüber wirken andere Konzepte, wie z.B. das Patriarchatskonzept zu einseitig,
da sie bereits vorwegnehmen, dass sich jeder Mann auf der dominanten Seite eines
hierarchisch strukturierten Geschlechterverhältnisses befindet. Der Ansatz von Connell
hingegen räumt die Möglichkeit ein, sich als Mann auch außerhalb dieser Hegemonie zu
positionieren, und bietet somit die Grundlage dafür, dass ein Wandel im
Geschlechterverhältnis überhaupt erklärt werden kann. Trotz der Eröffnung dieser
Möglichkeiten wird über dieses Konzept erklärt, wie das geschlechtliche
Machtverhältnis aufgrund von Marginalisierung und Komplizenschaft auch dann noch
beständig bleiben kann, wenn man sich als Mann weder der Hegemonie, noch einer
unterdrückten Kategorie zuschreibt.
64
Connell 1999,102
33
4 - ZUR METHODE
Bisher wurde, ausgehend von theoretischen Vorüberlegungen, die Entwicklung des
Erkenntnisinteresses hin zur Formulierung konkreter Forschungsfragen beschrieben, um
anschließend einige relevante Begriffe theoretisch zu fassen. In diesem Kapitel wird nun
erörtert, warum das Gruppendiskussionsverfahren mit anschließender Auswertung mittels
Dokumentarischer Methode den idealen Zugang zur Beantwortung der forschungsleitenden
Fragen eröffnet.
Zu Beginn wird der methodologische Hintergrund von Gruppendiskussionsverfahren und
dokumentarischer Methode, das Konzept der ,,kollektiven Orientierungen", erläutert.
Im Anschluss daran wird erklärt, über welche methodischen Vorgehensweisen man diese
kollektiven Orientierungen der Untersuchung zugänglich machen kann.
Das Gruppendiskussionsverfahren als Erhebungsinstrument und die dokumentarische
Methode der Interpretation in seiner heutigen methodologischen Fundierung und
praktischen Anwendung entwickelte sich prozesshaft über Jahrzehnte hinweg. Es wurde
erst durch seine ständige Weiterentwicklung von verschiedenen theoretischen und
empirischen Seiten als geeignetes Instrument erkannt, um kollektive Einstellungen und
Orientierungen zu untersuchen.
65
Besonderes Augenmerk ist auf methodologische
Differenzierung zwischen den verschiedenen Varianten der Gruppenerhebung zu
richten: nicht jede Befragung, die in Gruppenform und mit mehr oder weniger offenen
Fragestellungen operiert, ist automatisch dem qualitativen, bzw. konkreter, dem
rekonstruktiven Paradigma zuzuordnen genauso wenig, wie jede Erhebung über
Einzelgespräche ein und derselben Methode entspricht. Wird die Beziehung zwischen
Forschungsgegenstand, Erkenntnisinteresse und Methode ungenügend reflektiert,
ergeben sich im gesamten Untersuchungsablauf Probleme: ,,Viele methodische Ansätze,
und schließlich auch ihre empirische Anwendung, geraten in Schwierigkeiten, da sie
den Gegenstand, der mit dem Verfahren erhoben werden soll, methodologisch nicht
fassen oder ihn zu stark individuell konzipieren."
66
65
vgl. Bohnsack 2008; Przyborksi 2004; Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008
66
Przyborski 2004, 32
34
Bohnsack schlägt eine begriffliche Differenzierung vor, die das hier angewandte
Gruppendiskussionsverfahren von anderen Formen der Gruppenbefragung begrifflich
deutlich trennen soll:
Im Unterschied zu derartigen ,Gruppeninterviews' [gemeint sind jene in der Tradition der
Markforschung, Anm.] kann man von Gruppendiskussionsverfahren nur dort sprechen, wo
die methodologische Bedeutung von Interaktions-, Diskurs-, und Gruppenprozessen für die
Konstitution von Meinungen, Orientierungs- und Bedeutungsmustern in einem zugrunde
liegenden theoretischen Modell, d.h. in metatheoretischen Kategorien mit
theoriegeschichtlicher Tradition verankert sind. Dies gilt für alle qualitativen Methoden,
d.h. für solche Verfahren, die den Namen ,Methode' überhaupt verdienen.
67
Das Ausfindigmachen der Kollektivität, deren Existenz im Zuge der Entwicklung des
Gruppendiskussionsverfahrens nachgewiesen wurde, erfolgt über die dokumentarische
Methode der Interpretation. In Verbindung mit der dokumentarischen Methode als
Auswertungsinstrument wird das Gruppendiskussionsverfahren dem Anspruch,
Kollektivität untersuchbar zu machen, gerecht.
Die dokumentarische Methode wurde, in Anschluss an die bisherigen Entwicklungen
des Gruppendiskussionsverfahrens und in den 1980er-Jahren von Ralf Bohnsack und
Werner Mangold zu einem Analyseinstrument weiterentwickelt, das diesen Zugang zu
den von ihn benannten kollektiven Orientierungen erlaubt. Als maßgeblicher Einfluss
dieser Entwicklung
fungiert auf theoretischer Ebene
Karl
Mannheims
Wissenssoziologe, und auf analytischer Ebene, welche das Erkennen und
Herausarbeiten von kollektiven Orientierungen erst ermöglicht, die Entwicklung von
Textinterpretationsmethoden.
68
Dadurch, dass diese Analysemethoden immer weiter
verfeinert wurden, ist es erst ermöglicht, die kollektiven Orientierungen sichtbar zu
machen:
Für die Analyse von Gruppendiskussionen bedeutet dies, dass erst eine genaue
Rekonstruktion sowohl der Diskursorganisation (der Form der interaktiven Bezugnahmen
aufeinander) als auch der Dramaturgie des Diskurses es uns ermöglicht, jenes die subjektiv,
intentionalen
Sinngehalte
der
Einzeläußerungen
transzendierende
kollektive
Bedeutungsmuster zu identifizieren. (...) Erst die neueren Verfahren der Textinterpretation
vermögen dem dadurch Rechnung zu tragen, dass auf der Grundlage einer genauen
67
Bohnsack 2008,105
68
vgl. Przyborski 2004; Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008
35
Rekonstruktion sequentieller Abläufe von Interaktionen, Erzählungen und Diskursen eine
Struktur sichtbar wird.
69
Um das Spezifikum der in Gruppenprozessen zugrunde liegenden kollektiven
Bedeutungsgehalte zu erläutern, soll im Folgenden die Entwicklungsgeschichte des
Gruppendiskussionsverfahrens grob skizziert werden. Gerade die prozesshafte
Auseinandersetzung
mit
den
verschiedenen
Anwendungsbereichen
von
Gruppenbefragungen und daraus resultierenden Möglichkeiten zum Erkenntnisgewinn
vermag das spezifische Potential des Gruppendiskussionsverfahrens und den
Unterschied zwischen der Analyse einer Summe von Einzelmeinungen und jener von
kollektiven Einstellungen besonders gut zu veranschaulichen.
69
Bohnsack 2008, 110
36
4.1 - Die Entwicklung des Gruppendiskussionsverfahrens
4.1.1 Marktforschung
Das Gruppendiskussionsverfahren wie es heute angewendet wird hat seine
methodisch noch weit entfernten - Ursprünge in der Marktforschung. Die in dieser
Tradition geführten Befragungen in Gruppenform folgen vorwiegend ökonomischen
Zwecken: ein Gespräch mit mehreren Personen gleichzeitig zu führen soll aufwändigere
Einzelinterviews ersetzen. Ziel ist es lediglich, Meinungen und Einstellungen einzelner
Personen in ressourcensparender Weise abzufragen.
70
Dementsprechend wenig wird bei
der Analyse der Daten auf den kollektiven Charakter der Gruppe eingegangen - die
Auswertung dieser Gespräche erfolgt weiterhin in Hinblick auf die Individualaussagen
der GesprächsteilnehmerInnen: ,,Das Gespräch untereinander, die Interaktion ist also in
keiner Dimension Gegenstand der Analyse und daher auch nicht der Erhebung."
71
Der
Möglichkeit der Untersuchung von Kollektivität wird in dieser Form des
Gruppengesprächs nicht Rechnung getragen, und die Analyse stützt sich auf
,,Meinungen und Aussagen, wie sie während der Diskussion mehr oder weniger
wörtlich genannt werden."
72
4.1.2 Frankfurter Schule
In den 1950er Jahren erfolgte eine Weiterentwicklung des Gruppengesprächs durch das
Frankfurter Institut für Sozialforschung. Die Intention der Frankfurter Schule war eine
kritische Auseinandersetzung mit der Gruppenbefragung, wie sie von der
Marktforschung angewendet wurde. Thematisch verfolgte man das Interesse, politische
Meinungsbildungsprozesse nachvollziehbar zu machen. Zu diesem Zwecke versuchte
man, durch Gruppendiskussionen den Prozess der Meinungsbildung im sozialen Alltag
möglichst realistisch nachzustellen und eine laborähnliche Befragungssituation zu
70
Vgl. Przyborski 2004, Bohnsack 2008
71
Przyborski/Wohlrab-Saar 2008,102
72
ebd.
37
vermeiden. Man ging davon aus, dass sich politische Einstellungen erst dann entwickeln
können, wenn individuelle Einstellungen in Interaktion mit anderen artikuliert werden.
73
Obwohl diese Arbeiten in ihrer theoretischen Basis bereits auf Kollektivität fokussieren,
und die Frankfurter Schule explizit von der Vorstellung rein individueller und von
jeglicher Interaktion abgetrennter Meinungsbildungsprozesse Abstand hält, konzentriert
man sich bei der Analyse der Daten wieder auf das Individuum: ,,Hier kam die
Psychoanalyse, die ihren Ausgang bei individuellen psychischen Dynamiken nimmt, als
zentrales theoretisches Konzept ins Spiel: die Redebeiträge wurden wieder voneinander
getrennt und in ihrem Bezug zu den Einzelindividuen, deren Abwehrmechanismen und
Rationalisierungen analysiert."
74
Der Widerspruch zwischen erkenntnistheoretischer sowie methodologischer
Kollektivitätsannahme und der dennoch auf individueller Ebene angesiedelten
Auswertung bildet laut Bohnsack die Schwäche dieses Ansatzes der Frankfurter Schule.
Man orientierte sich weiterhin ,,an den Individuen als Untersuchungseinheiten und
schließlich insgesamt weiterhin am Modell der Umfrage."
75
4.1.3 Cultural Studies
Ähnliche Kritik übte man auch an jenen Beiträgen, die von der Tradition der Cultural
Studies zur methodologischen Entwicklung der Gruppendiskussion beigesteuert
wurden. Das Center of Contemporary Cultural Studies in Birmingham nutzte
Gruppendiskussionen vor allem, um Mediennutzungsverhalten und Rezeptionsanalysen
durchzuführen. Die Studien lassen eine ,,systematische, theoretische Bearbeitung von
Kollektivität und deren Implikationen für die Erhebungssituation"
76
, also eine fundierte
methodologische Reflexion ihrer Vorgehensweise missen.
Dennoch schaffen sie wichtige Grundlagen für die weitere Entwicklung einer solchen
methodologischen Fundierung, indem die Interaktionsprozesse zwischen den
GesprächsteilnehmerInnen gegenüber Individualaussagen und verhalten in den
Vordergrund der Analyse gerückt werden. Außerdem versteht man die
73
Vgl. Bohnsack 2008
74
Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008, 103
75
Bohnsack 2008, 106
76
Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008, 103
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836643290
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Wien – Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften, Publizistik und Kommunikationswissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 2
- Schlagworte
- männlichkeit geschlecht medien identität generation
- Produktsicherheit
- Diplom.de