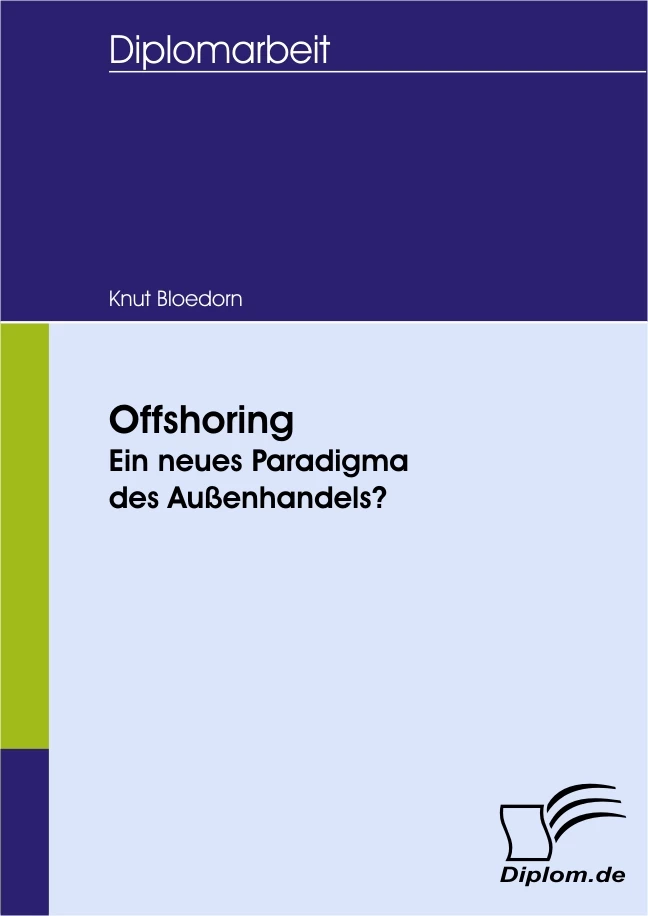Offshoring: Ein neues Paradigma des Außenhandels?
©2009
Diplomarbeit
71 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Wenn es um die Globalisierung und ihre Auswirkungen geht, steht zumeist der zunehmende Wettbewerbsdruck durch die Schwellen- und Entwicklungsländer im Vordergrund. Die Arbeitnehmer in den Industriestaaten fürchten, dass sie mit der billigeren Konkurrenz aus Osteuropa und Asien nicht mithalten können und durch sie ihren Arbeitsplatz verlieren oder Einkommenseinbuße hinnehmen müssen. Demgegenüber stehen die Wirtschaftswissenschaftler, die dazu neigen, die Chancen eines intensiveren Außenhandels hervorzuheben. Die Grundlage dieser positiven Sichtweise baut auf der traditionellen Außenhandelstheorie auf, die den Ökonomen überzeugende Argumente liefert, warum eine intensivere Globalisierung den beteiligten Ländern (langfristige) Vorteile beschert. Die Kernaussage der traditionellen Theorie besagt, dass durch den Außenhandel zwar distributive Effekte innerhalb eines Landes auftreten können, es jedoch als Ganzes davon profitiert mit anderen Worten, es gibt zwar auch Verlierer durch die Globalisierung, die Gewinne sollten jedoch groß genug sein, um diese negativen Effekte (theoretisch) zu kompensieren.
In jüngerer Vergangenheit meldeten allerdings auch einige Ökonomen Zweifel an, ob dieses traditionelle Paradigma der Außenhandelstheorie für die aktuelle Phase der Globalisierung noch seine Gültigkeit besitzt. Durch das Phänomen Offshoring also die internationale Arbeitsteilung durch Produktionsverlagerung einzelner Arbeitsschritte ins Ausland vermuten sie Verteilungs- und Wohlfahrtseffekte, die vom traditionellen Ansatz abweichen und für erhebliche Schwierigkeiten in den Industriestaaten sorgen könnten.
Mit dieser neueren Debatte um Offshoring wird im Grunde genommen eine akademische Diskussion der neunziger Jahre fortgesetzt, in deren Mittelpunkt die Verteilungswirkung der Globalisierung stand. Anstoß zu der Debatte gaben vorrangig zwei empirische Beobachtungen auf den Arbeitsmärkten der Industriestaaten: Einige Staaten (besonders im angelsächsischen Raum) erlebten seit den achtziger Jahren einen stetigen Anstieg der Lohnungleichheit zwischen qualifizierten und unqualifizierten Arbeitskräften, während die Mehrzahl der Länder (Kontinental-) Europas (und Japan) einen kontinuierlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im unteren Qualifikationsbereich verzeichneten. Als potentieller Auslöser dieser Entwicklungen standen zwei Kandidaten zur Auswahl: Auf der einen Seite der technische Fortschritt der tendenziell hoch qualifizierten […]
Wenn es um die Globalisierung und ihre Auswirkungen geht, steht zumeist der zunehmende Wettbewerbsdruck durch die Schwellen- und Entwicklungsländer im Vordergrund. Die Arbeitnehmer in den Industriestaaten fürchten, dass sie mit der billigeren Konkurrenz aus Osteuropa und Asien nicht mithalten können und durch sie ihren Arbeitsplatz verlieren oder Einkommenseinbuße hinnehmen müssen. Demgegenüber stehen die Wirtschaftswissenschaftler, die dazu neigen, die Chancen eines intensiveren Außenhandels hervorzuheben. Die Grundlage dieser positiven Sichtweise baut auf der traditionellen Außenhandelstheorie auf, die den Ökonomen überzeugende Argumente liefert, warum eine intensivere Globalisierung den beteiligten Ländern (langfristige) Vorteile beschert. Die Kernaussage der traditionellen Theorie besagt, dass durch den Außenhandel zwar distributive Effekte innerhalb eines Landes auftreten können, es jedoch als Ganzes davon profitiert mit anderen Worten, es gibt zwar auch Verlierer durch die Globalisierung, die Gewinne sollten jedoch groß genug sein, um diese negativen Effekte (theoretisch) zu kompensieren.
In jüngerer Vergangenheit meldeten allerdings auch einige Ökonomen Zweifel an, ob dieses traditionelle Paradigma der Außenhandelstheorie für die aktuelle Phase der Globalisierung noch seine Gültigkeit besitzt. Durch das Phänomen Offshoring also die internationale Arbeitsteilung durch Produktionsverlagerung einzelner Arbeitsschritte ins Ausland vermuten sie Verteilungs- und Wohlfahrtseffekte, die vom traditionellen Ansatz abweichen und für erhebliche Schwierigkeiten in den Industriestaaten sorgen könnten.
Mit dieser neueren Debatte um Offshoring wird im Grunde genommen eine akademische Diskussion der neunziger Jahre fortgesetzt, in deren Mittelpunkt die Verteilungswirkung der Globalisierung stand. Anstoß zu der Debatte gaben vorrangig zwei empirische Beobachtungen auf den Arbeitsmärkten der Industriestaaten: Einige Staaten (besonders im angelsächsischen Raum) erlebten seit den achtziger Jahren einen stetigen Anstieg der Lohnungleichheit zwischen qualifizierten und unqualifizierten Arbeitskräften, während die Mehrzahl der Länder (Kontinental-) Europas (und Japan) einen kontinuierlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im unteren Qualifikationsbereich verzeichneten. Als potentieller Auslöser dieser Entwicklungen standen zwei Kandidaten zur Auswahl: Auf der einen Seite der technische Fortschritt der tendenziell hoch qualifizierten […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Knut Bloedorn
Offshoring: Ein neues Paradigma des Außenhandels?
ISBN: 978-3-8366-4271-2
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg im Breisgau, Deutschland,
Diplomarbeit, 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
I
INHALTSVERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis ...II
1
Einleitung ...1
2
Definition des Phänomens ...4
3
Die dritte Welle der Globalisierung...7
3.1
Historische Einordnung...7
3.2
Aktuelle Trends der Globalisierung ...8
3.2.1 Der Handel mit Zwischenprodukten ...9
3.2.2 Die Rolle der Entwicklungsländer ...11
3.2.3 Service Offshoring...12
3.3
Arbeitsmärkte & Einkommensverteilung...15
4
Der traditionelle Ansatz der Außenhandelstheorie ...17
4.1
Das Standard-Modell der Außenhandelstheorie...17
4.2
Technologischer Fortschritt als Gegenthese ...21
5
Offshoring Ein neues Paradigma...25
5.1
Triebkräfte hinter Offshoring...26
5.2
Offshoring vs. Factor-biased Technological Change ...29
5.3
Offshoring und Anti-Stolper-Samuelson Effekte ...34
5.3.1 Offshoring mit faktor-spezifischen Tasks ...34
5.3.2 Offshoring mit zwei industrie-spezifischen Tasks...45
5.3.3 Ein Kontinuum an industrie-spezifischen Tasks...51
5.4
Diskussion und offene Enden ...57
6
Schlussfolgerung und Ausblick...60
Literaturverzeichnis...62
II
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:
Abgrenzung von Offshoring und Outsourcing...5
Abbildung 2:
Material- und Service Offshoring (in Prozent) ...10
Abbildung 3:
Importanteil der Entwicklungs- und Schwellenländer ...12
Abbildung 4:
Service-Offshoring Potential...14
Abbildung 5:
Relativlohn und relative Beschäftigung der USA ...16
Abbildung 6:
Harrod-Johnson Diagramm ...20
Abbildung 7:
Lerner-Diagramm und technischer Fortschritt...23
Abbildung 8:
Altes vs. neues Paradigma des Außenhandels ...25
Abbildung 9:
Output, (Gesamt-)Kosten und Offshoring...28
Abbildung 10:
Offshoring entlang der Wertschöpfungskette ...29
Abbildung 11:
Einheitskostenverhältnis ...32
Abbildung 12:
Nachfrageverschiebung durch Offshoring ...33
Abbildung 13:
Offshoring-Gleichgewicht (für beide Industrien) ...37
Abbildung 14:
Reduktion der Offshoring-Kosten...40
Abbildung 15:
Produktionsprozess und Offshoring der Industrie 2...46
Abbildung 16:
Hick'sche Kombination der Einheitswert-Isoquanten ...48
Abbildung 17:
Offshoring und Faktorpreise ...50
"We are now, I believe, in the early stages of a Third Industrial Revolution, which has
been called the Information Age. The cheap and easy flow of information around the globe has
vastly expanded the scope of tradable services. And there is much, much more to come."
(Alan S. Blinder, 2005)
"It's no longer safe to assert that trade's impact on the income distribution in wealthy
countries is fairly minor. There's a good case that it is big, and getting bigger."
(Paul R. Krugman, 2007)
"To better understand the implications of these trends, we need a new paradigm for
studying international trade that emphasizes not only the exchange of complete goods, but also
trade in specific tasks, or, what we shall refer to as "offshoring"."
(Gene M. Grossman & Esteban Rossi-Hansberg, 2006)
1
Einleitung
Wenn es um die Globalisierung und ihre Auswirkungen geht, steht zumeist der
zunehmende Wettbewerbsdruck durch die Schwellen- und Entwicklungsländer
im Vordergrund. Die Arbeitnehmer in den Industriestaaten fürchten, dass sie
mit der ,,billigeren" Konkurrenz aus Osteuropa und Asien nicht mithalten
können und durch sie ihren Arbeitsplatz verlieren oder Einkommenseinbuße
hinnehmen müssen. Demgegenüber stehen die Wirtschaftswissenschaftler, die
dazu neigen, die Chancen eines intensiveren Außenhandels hervorzuheben. Die
Grundlage dieser positiven Sichtweise baut auf der traditionellen Außenhan-
delstheorie auf, die den Ökonomen überzeugende Argumente liefert, warum
eine intensivere Globalisierung den beteiligten Ländern (langfristige) Vorteile
beschert. Die Kernaussage der traditionellen Theorie besagt, dass durch den
Außenhandel zwar distributive Effekte innerhalb eines Landes auftreten
können, es jedoch als Ganzes davon profitiert mit anderen Worten, es gibt
zwar auch Verlierer durch die Globalisierung, die Gewinne sollten jedoch groß
genug sein, um diese negativen Effekte (theoretisch) zu kompensieren.
In jüngerer Vergangenheit meldeten allerdings auch einige Ökonomen Zweifel
an, ob dieses traditionelle Paradigma der Außenhandelstheorie für die aktuelle
Phase der Globalisierung noch seine Gültigkeit besitzt.
1
Durch das Phänomen
1
Besonders intensiv wurde diese Frage 2004 während des US-Präsidentschaftswahl-
kampfes diskutiert. Einen Überblick über die Debatte und die mediale Aufmerksam-
keit, die Service Offshoring in dieser Zeit erhielt, bieten Mankiw & Swagel (2006).
2
Offshoring also die internationale Arbeitsteilung durch Produktionsver-
lagerung einzelner Arbeitsschritte ins Ausland vermuten sie Verteilungs- und
Wohlfahrtseffekte, die vom traditionellen Ansatz abweichen und für erhebliche
Schwierigkeiten in den Industriestaaten sorgen könnten.
2
Mit dieser neueren Debatte um Offshoring wird im Grunde genommen eine
akademische Diskussion der neunziger Jahre fortgesetzt, in deren Mittelpunkt
die Verteilungswirkung der Globalisierung stand. Anstoß zu der Debatte gaben
vorrangig zwei empirische Beobachtungen auf den Arbeitsmärkten der In-
dustriestaaten: Einige Staaten (besonders im angelsächsischen Raum) erlebten
seit den achtziger Jahren einen stetigen Anstieg der Lohnungleichheit zwischen
qualifizierten und unqualifizierten Arbeitskräften, während die Mehrzahl der
Länder (Kontinental-) Europas (und Japan) einen kontinuierlichen Anstieg der
Arbeitslosigkeit im unteren Qualifikationsbereich verzeichneten. Als poten-
tieller Auslöser dieser Entwicklungen standen zwei Kandidaten zur Auswahl:
Auf der einen Seite der technische Fortschritt der tendenziell hoch qualifi-
zierten Arbeitnehmer begünstigt (Skill-biased technological change) und auf
der anderen Seite die zunehmende Globalisierung, die entlang des Stolper-
Samuelson-Theorems Druck auf die gering Qualifizierten in den Industrie-
staaten ausübt. Aufgrund einiger Unzulänglichkeiten der Globalisierungshypo-
these, gab es einen relativ breiten ,Konsens' zugunsten des technischen
Fortschritts.
3
An dieser Stelle knüpft die aktuelle Diskussion um Offshoring an die Debatte
der neunziger Jahre an. Technischer Innovationen, einem kontinuierlichen
Abbau von Handelshemmnissen und der Anstieg des weltweiten Outputs
treiben den Prozess der internationalen Arbeitsteilung weiter voran: Durch
verbesserte Koordinationsmöglichkeiten sind die Unternehmen heute in der
Lage, vormals vollständig integrierte Produktionsprozesse in ihre Teilaufgaben
zu zerlegen und diese weltweit an unterschiedlichen Standorten anzufertigen.
Diesem Offshoring-Prozess stehen jedoch die Modelle des traditionellen
Ansatzes gegenüber, die noch immer auf einer integrierten Produktion und dem
2
Dabei erregten besonders die Artikel von Samuelson (2004) und Blinder (2005) er-
hebliches Aufsehen.
3
Ausnahmen von diesem vermeintlichen ,Konsens' sind beispielsweise Wood (1994),
der dem Außenhandel eine relativ hohe Bedeutung zumisst, oder Feenstra & Hanson
(1996), die bereits früh Offshoring als dritte Erklärungsmöglichkeit in Betracht zogen.
3
Handel vollständiger Güter fußen und die Verlagerung von einzelnen Teilauf-
gaben unberücksichtig lassen. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Verein-
fachung zu groß ist, um die tatsächlichen Auswirkungen der Globalisierung
korrekt zu erfassen. Mittlerweile gibt es jedoch eine umfangreiche theoretische
Literatur, die versucht die aktuellen Entwicklungen in die Modelle mit ein-
zubeziehen. In der Regel bauen diese auf den traditionellen Modellen der allge-
meinen Gleichgewichtstheorie auf, erweitern sie aber um die Möglichkeit von
Offshoring (Kohler, 2008, S. 3).
4
Der vorliegende Beitrag versucht eine Brücke zwischen der Debatte der neun-
ziger Jahre und der aktuellen Offshoring-Diskussion zu schlagen. Die Arbeit ist
dabei wie folgt aufgebaut: Abschnitt 2 liefert zunächst eine Definition und
Abgrenzung des Themas. Daraufhin ordnet der Abschnitt 3 die aktuelle Phase
der Globalisierung in den historischen Kontext ein und bietet einen Überblick
über momentane Trends und Entwicklungen der Weltwirtschaft. Abschnitt 4
zeigt das traditionelle Paradigma anhand des Standard-Modells der
Außenhandelstheorie (2x2 Heckscher-Ohlin Modell), geht auf dessen Un-
zulänglichkeiten ein und bietet ferner einen Überblick über den technischen
Fortschritt als Gegenthese. Der fünfte Abschnitt beinhaltet den analytischen
Kern der Arbeit. Es wird ein neues Paradigma des Außenhandels präsentiert,
das einen alternativen Erklärungsansatz für die Unzulänglichkeiten der Glo-
balisierungshypothese bietet. Dabei wird deutlich, dass die Auswirkungen von
Offshoring stark von dem zugrunde liegenden Modellierungsansatz der
einzelnen Arbeitsschritte (Tasks) abhängen. Der Abschnitt 6 fasst die Arbeit
zusammen und zieht einige Schlussfolgerungen.
4
Ein Großteil der Literatur baut dabei auf dem Heckscher-Ohlin Ansatz auf: Beispiels-
weise Arndt (1997, 1998), Feenstra & Hanson (1996), Jones & Kierzkowski (2000,
2001), Jones (2000), Deardorff (1998, 2001, 2004), Kohler (2003, 2004a, 2008),
Grossman & Rossi-Hansberg (2006, 2008) und Baldwin & Robert-Nicoud (2007).
Daneben verwenden Samuelson (2004) und Deardorff (1998a) einen Ricardo
Perspektive, während Kohler (2001, 2004b) und Bhagwati et al. (2004) die eines
Spezifischen-Faktor (Ricardo-Viner) Modells wählen. Einige jüngere Arbeiten, wie
Ekholm & Ulltveit-Moe (2007) und Grossman & Rossi-Hansberg (2009) berück-
sichtigen unvollkommenen Wettbewerb in ihren Modellen.
4
2
Definition des Phänomens
Die Debatte um Offshoring krankt seit jeher an einem Definitionsproblem. So
zählt beispielsweise Alan V. Deardorff in seinem ,Glossar der Internationalen
Ökonomie' mittlerweile fünfzehn unterschiedliche Bezeichnungen auf, die
mehr oder weniger einen deckungsgleichen Ansatz verfolgen.
5
Mit einer klaren
Definition und Abgrenzung des Themengebiets zu beginnen, erscheint auf-
grund dessen unbedingt erforderlich: Zunächst sei zwischen der vertikalen und
der horizontalen Ebene der Globalisierung unterschieden (Sell, 2001, S. 2):
(1)
Die horizontale Globalisierung stimmt dabei mit der ,traditionellen'
Sichtweise des Außenhandels überein d.h. durch technische Inno-
vation, sinkende Transportkosten und/oder wegfallende Handels-
barrieren können mehr und mehr Endprodukte international gehandelt
werden. Das Motiv hinter diesem Prozess ist die Marktversorgung mit
Gütern und Dienstleistungen. Prominente Beispiele im Bezug auf die
aktuelle Phase der Globalisierung lassen sich vor allem im Dienstleis-
tungsbereich finden: Via Internet oder Telefon können heute unter-
schiedlichste Dienstleistungen gehandelt werden, die vor nicht allzu
langer Zeit noch prohibitiv hohe Handelskosten aufwiesen (vgl. z.B.
Bhagwati et al., 2004; Blinder, 2005).
(2)
Bei der vertikalen Globalisierung handelt es sich dagegen um die Auf-
spaltung (Fragmentation) des vertikal integrierten Produktionsprozesses
in seine Teilaufgaben (Tasks)
6
, sodass neben den Endprodukten auch
die einzelnen Vorprodukte international gehandelt werden können, um
so beispielsweise von unterschiedlichen Faktorpreisen im Ausland zu
profitieren (vgl. z.B. Jones & Kierzkowski, 1990; Grossman & Rossi-
Hansberg, 2006).
Es erweist sich als schwierig eine genaue Grenze zwischen diesen beiden
Formen der Globalisierung zu ziehen, denn letztendlich verbreitern Beide das
Spektrum der international handelbaren Güter: Durch die horizontale Globali-
5
Genau genommen führt das Glossar das Thema unter dem Stichwort: Fragmentation
ein Begriff für Offshoring, der von Jones & Kierzkowski (1990) geprägt wurde.
http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/
(Zugriff: 20.06.2009)
6
Ich werde im Verlauf der Arbeit in der Regel den relativ neuen Begriff ,Task' für die
einzelnen Arbeitsschritte bzw. Teilaufgaben der Produktion verwenden. Der Begriff
wurde von Grossman & Rossi-Hansberg (2006) in die Literatur eingeführt und seit-
dem als neuer Standard verwendet (vgl. Kohler, 2008, S. 6).
5
sierung verringert sich der Anteil der nicht-handelbaren Güter, während durch
die Aufspaltung der Wertschöpfungskette gänzlich neue Produktgruppen (Vor
bzw. Zwischenprodukte) hinzugefügt werden. Das hier betrachtete Phänomen
Offshoring bezieht sich jedoch auf die vertikale Ebene der Globalisierung: Die
Aufspaltung des Produktionsprozesses mit anschließender Verlagerung einzel-
ner Tasks ins Ausland.
Von den etlichen Bezeichnungen, die nebeneinander existieren, sind es vor
allem die Begriffe Offshoring und Outsourcing, die für einige Verwirrung sor-
gen. Sie lassen sich jedoch leicht anhand zwei Kriterien voneinander abgrenzen:
1.
Die Ebene des Unternehmens (bzw. das Eigentumsverhältnis): Wird der
Arbeitsschritt (Task) an eine andere Firma abgegeben oder innerhalb
des eigenen Unternehmens erstellt und
2.
Die Ebene des Landes (bzw. geographische Lage): Erfolgt die Her-
stellung des Tasks im Inland oder im Ausland.
Abbildung 1:
Abgrenzung von Offshoring und Outsourcing
(1) Unternehmen
Selbst erzeugt
(Insourced)
Fremd erzeugt
(Outsourced)
In
la
n
d
(O
n
sh
o
re
)
Interne inländische
Leistungserstellung
Onshore
Outsourcing
(2
)
L
a
n
d
es
g
re
n
ze
A
u
sl
an
d
(O
ff
sh
o
re
)
Captive
Offshoring
(ADI)
Offshore
Outsourcing
(Offshoring)
Quelle:
Schöller (2006, S. 37)
Abbildung 1 bietet einen Überblick über die vier Kombinationsmöglichkeiten
der beiden Kriterien: Es wird ersichtlich, dass es sich um Outsourcing handelt,
sobald das Unternehmen eine Leistung nicht mehr selbst erstellt, unabhängig
davon, ob die Leistungserstellung im Inland oder Ausland erfolgt. Dagegen be-
zieht sich das für die Arbeit relevante Offshoring auf die Verlagerung der Pro-
6
duktion ins Ausland, unabhängig davon, ob sie im Unternehmen verbleibt, oder
von einer anderen Firma übernommen wird.
7
An dieser Stelle muss eine zusätzliche Einschränkung hinsichtlich der
ausländischen Direktinvestitionen (ADI) getätigt werden. Nicht bei jeder ADI
handelt es sich auch um das Phänomen Offshoring. Wiederum kann zwischen
einer vertikalen und einer horizontalen Ebene unterschieden werden (Bottini et
al. 2007, S.3):
Auf der horizontalen Ebene eröffnet ein international operierendes
Unternehmen eine Niederlassung im Ausland, um die Nachfrage des
ausländischen Marktes zu befriedigen, während
auf der vertikalen Ebene das Unternehmen eine ausländische Niederlas-
sung eröffnet, um Effizienzvorteile abzuschöpfen (beispielsweise durch
niedrigere Löhne), später aber die im Ausland produzierten Tasks oder
zusammengesetzt Endprodukte wieder in den Heimatmarkt zurückführt.
Auch hier betrifft Offshoring nur die vertikale Ebene. Durch Offshoring treten
ausländische Arbeitnehmer in den Wettbewerb mit den inländischen Arbeits-
kräften. Dabei konkurrieren sie um einzelne Produktionsstufen, die angefertigt
werden, um letztendlich den inländischen Markt zu bedienen.
Das Phänomen Offshoring betrifft mittlerweile alle Phasen des Produktions-
prozesses unabhängig von der Beschaffenheit der einzelnen Tasks. Da jedoch
der Handel mit Dienstleistungen in der aktuellen Debatte eine wichtige Rolle
spielt, erscheint es sinnvoll zusätzlich zwischen der Art der gehandelten Tasks
zu differenzieren: Grundsätzlich kann dabei zwischen ,materiellen' und ,im-
materiellen' Produktionsschritten unterschieden werden. Ersteres (Material-
Offshoring) betrifft die geläufigere Auslagerung von Tasks im verarbeitenden
Gewerbe (die schon seit geraumer Zeit stattfindet), während Letzteres (Service-
Offshoring) sich auf die Verlagerung von Dienstleistungs-Tasks ins Ausland
bezieht.
7
Dieser letzte Aspekt, die Entscheidung über die Organisationsstruktur des Unter-
nehmens, ist sowohl aus betriebswirtschaftlicher, als auch aus wirtschaftstheoretischer
Sicht von erheblicher Bedeutung. Dessen ungeachtet, werde ich im Verlauf der Arbeit
in beiden Fällen von Offshoring sprechen. Aus der hier gegebenen Definition wird
zusätzlich deutlich, dass Outsourcing ein eher ,unglücklich' gewählter Begriff für das
Phänomen ist: Es fehlt der direkte Bezug zur Verlagerung ins Ausland (ähnliches gilt
für Fragmentation).
7
3
Die dritte Welle der Globalisierung
3.1
Historische Einordnung
Während der letzten Jahrzehnte hat die Interdependenz der Weltwirtschaft
durch steigenden Außenhandel, vernetzte Kapital- und Finanzmärkte und inter-
national verflochtene Produktionsketten weiter zugenommen und die ,,Globali-
sierung" noch stärker in den Focus der öffentlichen Debatte gerückt. Auch die
Finanzkrise, die momentan die Welt in Atem hält, hat auf schmerzliche Weise
demonstriert, wie stark die wechselseitige Abhängigkeit zwischen den ein-
zelnen Staaten mittlerweile ist.
Tabelle 1 Außenhandel
1
als Prozentsatz des BIP
1890
1913
1960
1980
2000
2005
Australien
31
42
29
33
46
40³
Belgien
81
134
78
119
169
172
Deutschland
31
39
-
52
67
75
Frankreich
28
30
26
43
56
53
Italien
19
28
26
46
56
52
Japan²
10
25
21
28
20
24
Kanada
25
34
-
55
87
73³
Niederlande
149
249
92
104
130
134
Portugal
11
16
36
60
75
66
Spanien
25
23
15
32
62
56
Schweden
47
42
45
60
89
90
UK
54
59
42
52
58
56
USA
11
12
10
21
26
25³
Notizen:
1
Der Außenhandel wird gemessen als Summe der Exporte und Importe.
² Für Japan standen 1890-1913 lediglich Exportdaten zur Verfügung.
³ Bezogen auf 2004.
Quelle:
1890-1913: Feenstra (1998, Table 1)
1970-2005: EEAG Report (2008, Table 3.1, S. 73)
Um die momentane Phase der Globalisierung einschätzen zu können, drängt
sich ein Vergleich mit der Epoche vor dem ersten Weltkrieg auf die häufig
auch als ,,erste Welle der Globalisierung" bezeichnet wird (Baldwin & Martin,
1999, S. 4). In der Tabelle 1 kann die Außenhandelsintensität definiert als
Summe der Exporte und Importe als Prozentsatz des BIP für einige OECD
Staaten für den Zeitraum von 1890 bis 2005 abgelesen werden. Die rechte
Seite der Tabelle (1890-1913) zeigt, dass es bereits zwischen 1890 und 1913
eine Periode sehr intensiven Außenhandels zwischen den Staaten gab, die
allerdings 1914 mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges und den darauf
8
folgenden schwierigen Jahren der Weltwirtschaftskrise und des zweiten Welt-
krieges ein jähes Ende erlebte.
Aus dem linken Abschnitt der Tabelle 2 (1960-2005) wird deutlich, dass sich
der Außenhandel jedoch nach dem zweiten Weltkrieg beständig erholt hat.
Bereits in den achtziger Jahren wurde wieder ein vergleichbares Niveau wie
1913 erreicht, sodass diese Zeitspanne als eine zweite Welle der Globalisierung
angesehen werden kann. Seitdem befindet sich die Weltwirtschaft alleine von
der relativen Größenordnung her in ,,unbekanntem Fahrwasser", denn die Glo-
balisierung hat sich seither weiter beschleunigt: Fast jede der größeren Wirt-
schaftsnationen die USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und
Kanada wies 2005 einen annähernd doppelt so hohen Außenhandelsumsatz
auf wie 1913. Dabei ist besonders die Entwicklung der USA (als größte
Volkswirtschaft der Welt) hervorzuheben, die heute eine nie gekannte inter-
nationale Vernetzung über den Außenhandel aufweist.
Doch die Tabelle 1 kann nur einen Teil der Geschichte wiedergeben, denn
nicht nur die Handelsintensität unterscheidet die aktuelle Phase der Globa-
lisierung von vorangegangenen Epochen. Einige Ökonomen vertreten die
Meinung, dass sich die Weltwirtschaft durch das Phänomen Offshoring am
Rande einer dritten Ära der Globalisierung befindet. Beispielsweise schreibt
Feenstra (2008, S. 1) über ein neues, goldenes Zeitalter des Außenhandels,
angetrieben durch den fortschreitenden Prozess der vertikalen Arbeitsteilung.
Hingegen glaubt Baldwin (2006) an ein ,Second Unbundling' durch Off-
shoring, das den Wettbewerb von der Unternehmensebene auf die Ebene der
einzelnen Arbeitsschritte verlagert, während Blinder (2005, S. 7) gar pro-
phezeit, dass die entwickelten Länder eine neue ,Industrielle Revolution'
erleben könnten und hebt dabei besonders das enorme Offshoring-Potential des
Dienstleistungssektor hervor (Blinder, 2007a, 2007b).
3.2
Aktuelle Trends der Globalisierung
Dieser Abschnitt versucht die Ausmaße des Phänomens einzugrenzen. Zu Be-
ginn sei darauf hingewiesen, dass es sich als ausgesprochen schwierig erweißt
exakte Daten über Offshoring zu bekommen. Die Gründe für diese Unschärfe
liegen zum einen in den amtlichen Statistiken, die häufig ,,zu grob" gegliedert
9
sind, um das Phänomen richtig zu erfassen, bzw. manche Daten (insbesondere
im Bereich der Dienstleistungen) überhaupt nicht ermitteln. Zum anderen
verwenden die nationalen und internationalen Organisationen und Statistik-
ämter verschiedene Konzepte, um diese ,,Lücken" zu schließen. Hinzu-
kommend findet ein Teil des neuen Offshoring-Handels (wie aus der Definition
des Abschnitts 2 ersichtlich wurde) innerhalb der Unternehmen statt, für den
ebenfalls nur unzureichende Datensätze vorhanden sind. Unternehmen könnten
beispielsweise aus Steuergründen Anreize entwickeln, um die wahren Aus-
maße des Intra-Firmen Handels zu verschleiern. Und letztendlich ermitteln die
Statistiken nur die Bruttoströme des Außenhandels, während für Offshoring
alleine die hinzugefügte Wertschöpfung von Belang wäre (Grossman & Rossi-
Hansberg, 2006, S. 6).
8
Dennoch sprechen zumindest drei Anzeichen deutlich dafür, dass die Ver-
flechtung der Weltwirtschaft weiter zugenommen hat: (1) die zunehmende Di-
versifikation des Produktionsprozesses (durch Offshoring), welche hier anhand
des Handels mit Zwischenprodukten gezeigt wird, (2) die wachsende Bedeu-
tung des Nord-Süd Handels mit den Entwicklungs- und Schwellenländer und
(3) die relativ neue Form des Service-Offshorings, welche ebenfalls beständig
an Bedeutung gewinnt.
3.2.1 Der Handel mit Zwischenprodukten
Obwohl über den Handel mit Zwischenprodukten nur die groben Ausmaße von
Offshoring abgeschätzt werden können (nicht jedem Handel mit Zwischenpro-
dukten liegt auch eine Produktionsverlagerung zugrunde), greifen die meisten
Studien auf diese Kennzahl als Approximation zurück.
9
Die Ermittlung des
Zwischenprodukthandels erfolgt dabei häufig über Input-Output Tabellen, aus
denen allerdings nicht direkt auf die tatsächlichen Ausmaße geschlossen
werden kann. Sie geben zwar Aufschluss darüber, inwieweit Zwischenprodukte
in der jeweiligen Industrie genutzt werden, doch sie sagen nichts über deren
Herkunft (Inland oder Ausland) aus. Aufgrund dessen werden Maßzahlen des
Zwischenprodukthandels in Relation zu aggregierten Außenhandelsdaten oder
8
Einen Überblick über die Schwierigkeiten (insbesondere im Bereich der Dienstleis-
tungen) gibt der U.S. GAO Report (2004, S. 59).
9
Bottini et al. (2007, S.22 ff.) listen eine Reihe wichtiger Studien und deren verwendete
Datensätze auf.
10
Daten bezüglich der Gesamtproduktion gesetzt, um die Ausmaße von Off-
shoring abschätzen zu können.
Abbildung 2:
Material- und Service Offshoring (in Prozent)
(a)
Material-Offshoring
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
Au
st
ra
lia
Au
st
ria
Be
lg
iu
m
C
an
ad
a
D
en
m
ar
k
Fi
nl
an
d
Fr
an
ce
G
er
m
an
y
G
re
ec
e
Ita
ly
N
et
he
rla
nd
s
N
or
w
ay
Po
rtu
ga
l
Sp
ai
n
Sw
ed
en
U
K
U
SA
1995
2000
(b)
Service-Offshoring
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Au
st
ra
lia
Au
st
ria
Be
lg
iu
m
C
an
ad
a
D
en
m
ar
k
Fi
nl
an
d
Fr
an
ce
G
er
m
an
y
G
re
ec
e
Ita
ly
N
et
he
rla
nd
s
N
or
w
ay
Po
rtu
ga
l
Sp
ai
n
Sw
ed
en
U
K
U
SA
1995
2000
Quelle:
OECD Employment Outlook (2007, S. 112)
Hummels et al. (1999) berechnen beispielsweise den Anteil ausländischer
Zwischenprodukte, der im heimischen Export enthalten ist. In ihrer Studie für
insgesamt vierzehn Länder kommen sie zu dem Ergebnis, dass zwischen 1970
und 1990 Offshoring
10
insgesamt um ca. 28 % gestiegen ist und für 30 % des
Exportwachstums der Länder in diesem Zeitraum verantwortlich ist. Sie treffen
10
Hummels et al. (1999) verwenden den Ausdruck ,,vertical specialisation" für Offsho-
ring.
11
dabei die Annahme, dass der Anteil der verwendeten Zwischenprodukte im Ex-
port sich proportional zu dem Anteil der verwendeten Zwischenprodukte für
heimische Produkte verhält.
11
Die Ergebnisse einer vergleichbaren Studie der
OECD (2007) für 17 OECD-Staaten sind in Abbildung 2 (a) und (b) für
Material-Offshoring bzw. Service-Offshoring zwischen 1995 und 2000 einge-
tragen. Auch wenn die Studie einen etwas anderen Ansatz wählt als Hummels
et al. (1999), kann aus ihr geschlossen werden, dass die Offshoring-Intensität
zwar weiter zunimmt, sich der Prozess jedoch in den OECD-Staaten im Ver-
gleich zu den neunziger Jahren etwas abgekühlt hat (OECD, 2007, S. 110).
3.2.2 Die Rolle der Entwicklungsländer
Der internationale Handel mit den Entwicklungsländern hat in der jüngeren
Vergangenheit für besonderes Aufsehen gesorgt. Dabei hat China im Bereich
des Material-Offshorings als ,,Werkbank der Welt" eine vorherrschende
Stellung eingenommen, während Indien vor allem mit Service-Offshoring für
Furore sorgte. Abbildung 3 zeigt den Handel der entwickelten Länder (OECD
bzw. EU15) mit den Schwellen- und Entwicklungsländern seit Ende der acht-
ziger Jahre. Es wird deutlich, dass obwohl der Handel mit den Entwicklungs-
und Schwellenländern immer noch verhältnismäßig gering ausfällt (unter 30
bzw. 20 % der Gesamtimporte für die OECD bzw. EU 15 vgl. Abbildung 3),
ist seine Bedeutung dennoch im Vergleich zum Intra-OECD bzw. Intra-EU
Handel beständig angestiegen.
12
An der Spitze dieser Entwicklung steht China: 1980 machten die Warenexporte
Chinas für die OECD Staaten nur ungefähr 1 % der Gesamtwarenimporte aus,
die sich bis 1990 auf 2 % erhöhten. Seitdem hat sich der Prozess enorm
beschleunigt. Innerhalb von fünfzehn Jahren hat sich der Anteil verfünffacht:
11
Diese ,,Proportionalitäts-Annahme" ist nicht ganz unproblematisch. Koopman et al.
(2008) zeigen, dass es beispielsweise im chinesischen Exportsektor, aufgrund einiger
Ausnahmeregelungen (z.B. Steuer- und Tarifvorteile) zu Verzerrungen kommt. Durch
die Ausnahmeregel werden im Exportsektor überproportional viele Inputs aus dem
Ausland verwendet (Veredelungsexporte). Koopman et al. (2008) verwenden eine
Methode, die derartige Verzerrungen berücksichtigt. Sie kommen zu dem Schluss,
dass Berechnungen, die auf der ,,Proportionalitäts-Annahme" fußen, den Importanteil
in den chinesischen Exporten systematisch unterschätzen. So beträgt der ausländische
Wertschöpfungsanteil der chinesischen Warenexporte mit der ,angepassten' Methode
annähernd 50 %, im Vergleich zu nur 26 % bei Hummels et al. (1999).
12
Für die USA markierte das Jahr 2006 einen Wendepunkt, da zum ersten Mal der
Warenhandel mit den Entwicklungsländern einen größeren Anteil ausmachte, als der
Warenhandel mit den entwickelten Ländern (Krugman, 2008, S. 6).
12
2005 betrug Chinas Anteil am Gesamtwarenhandel etwa 10 %. Auch der
Warenhandel mit Indien ist signifikant angestiegen, allerdings nicht in dem
gleichen Maße wie der mit China. Vielmehr reflektiert der Dienst-
leistungshandel mit Indien eine weitere neue Dimension der Globalisierung.
Zwischen 1994 bis 2003 wuchsen die Dienstleistungsexporte Indiens um an-
nähernd 700 %, allerdings von einem niedrigen Niveau kommend: 2005 betrug
der indische Anteil der globalen Dienstleistungsexporten nur 2,3 % im
Vergleich zu 15 % der USA (OECD, 2007, S.110).
13
Abbildung 3:
Importanteil der Entwicklungs- und Schwellenländer
Quelle:
EEAG Report (2008, S. 74, Figure 3.3).
Notizen: Die Entwicklungs- und Schwellenländer sind definiert als Nicht-OECD und Nicht-OPEC Staaten.
OECD:
hier ohne Tschechien, Ungarn, Island, Mexiko, Polen, Slowakei und die Türkei, da der Fokus auf
die wohlhabenden Länder gerichtet ist.
EU15:
Mitglieder der EU vor dem 1. Mai 2004.
3.2.3 Service Offshoring
Bei der Diskussion um Service Offshoring stehen zwei Fragen im Vordergrund:
Einmal wie viele Arbeitsplätze bisher ins Ausland verlagert wurden, vor allem
jedoch, wie viele ,,Jobs" sind potentiell durch Service-Offshoring ,gefährdet'?
Auf beide Fragen gibt es im Grunde genommen keine zufrieden stellende Ant-
wort. Die Gründe hierfür liegen einerseits in den im Abschnitt 2 erörterten Ab-
grenzungsschwierigkeiten. Das Hauptproblem stellen allerdings die bisher nur
13
Die Dienstleistungsexport (Business Service) sind hier definiert als Gesamt-Dienst-
leistungsexporte minus Transport, Tourismus und Dienstleistungen der Regierung.
Neben Indien hat auch der Service-Handel mit andern Entwicklungsländern erheblich
zugenommen: z.B. mit China, Argentinien und Brasilien um mehr als 200 % (World
Bank, 2007, S. 121, Figure 4.5).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836642712
- DOI
- 10.3239/9783836642712
- Dateigröße
- 676 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg – Volkswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2010 (Februar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- outsourcing außenwirtschaft wirtschaftstheorie fragmentation globalisierung
- Produktsicherheit
- Diplom.de