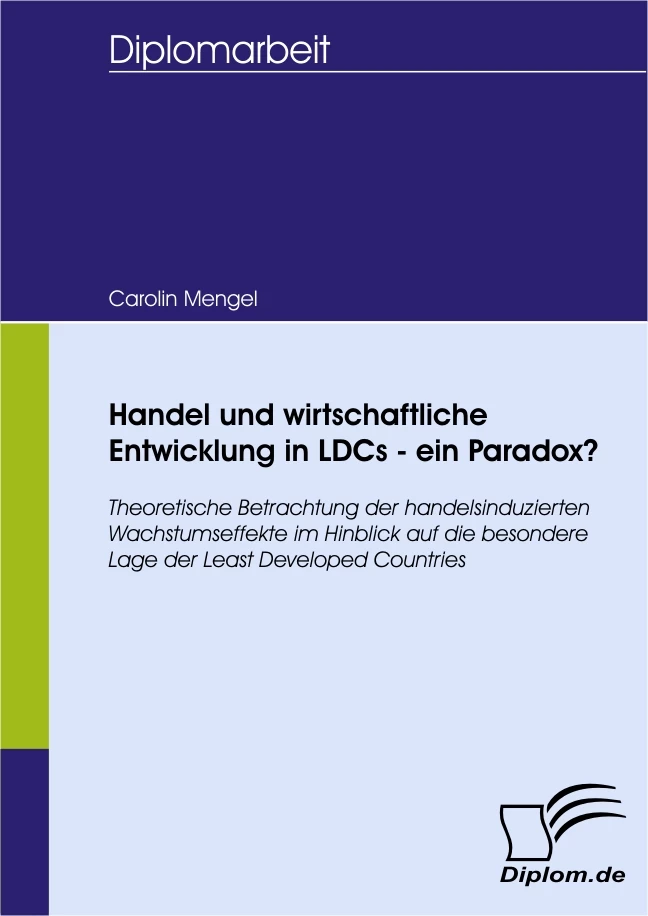Handel und wirtschaftliche Entwicklung in LDCs - ein Paradox?
Theoretische Betrachtung der handelsinduzierten Wachstumseffekte im Hinblick auf die besondere Lage der Least Developed Countries
©2009
Diplomarbeit
95 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten verkündete Walter Ulbricht im Juni 1961 zwei Monate vor Beginn des Mauerbaus.
Niemand hat die Absicht protektionistische Maßnahmen zu ergreifen hätte das gemeinsame Lippenbekenntnis der Regierungen der G-20 auf dem Weltwirtschaftsforum Ende Januar dieses Jahres in Davos lauten können und wäre damit ebenso glaubwürdig. Zwei Monate später stellte die Weltbank in der Tat zahlreiche protektionistische Maßnahmen in 17 der G-20-Staaten fest. Ihr Ziel ist der Schutz der heimischen Branchen vor den Folgen der Wirtschaftskrise, etwa durch Zölle, Subventionen oder milliardenschwere Konjunkturpakete, die inländische Unternehmen gegenüber ausländischen bevorzugen. Damit nehmen die Regierungen jedoch eine Verstärkung der Krise in Kauf. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist der konstant zunehmende Welthandel der Motor globalen Wachstums. Die gegenwärtige Welle des Protektionismus hingegen führt zu einem massiven Handelseinbruch, vor dem die internationalen Finanz- und Handelsorganisationen warnen (WTO 2009: xi, IMF 2009: xiv, World Bank 2009: 2f., UNCTAD 2009: i). Besonders Entwicklungsländer sind von einem Rückgang der Weltnachfrage negativ betroffen, ihre Exporterlöse sanken bereits um durchschnittlich 14 %, in den Industrieländern lediglich um die Hälfte. Die derzeitige Situation illustriert die immense Sensibilität der Entwicklungsländer gegenüber konjunkturellen Schwankungen der Weltwirtschaft und des Welthandels. Sie soll daher als Anlass genommen werden, die Rolle des Außenhandels für die wirtschaftliche Entwicklung der 49 ärmsten Entwicklungsländer, den Least Developed Countries genauer zu untersuchen.
Problemstellung:
Mit diesem Vorhaben begibt man sich zwangsläufig auf ein sowohl wissenschaftlich als auch politisch besonders umstrittenes Gebiet. Denn schon immer stellte Handelspolitik in der politischen Diskussion ein emotional sehr aufgeladenes Thema dar, was sich auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung niederschlägt. Laut der klassischen und neoklassischen Handelstheorie profitieren Staaten gesamtwirtschaftlich immer von Handel, dieser verursacht jedoch auch eine starke Umverteilung innerhalb der Gesellschaft, die neben Gewinnern auch Verlierer produziert. Potentielle Verlierergruppen opponieren daher einer Handelsöffnung und prangern negative Auswirkungen von Freihandel an, um so ihre Partikularinteressen zu wahren. Selbst wenn gesamtwirtschaftlich ein Land […]
Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten verkündete Walter Ulbricht im Juni 1961 zwei Monate vor Beginn des Mauerbaus.
Niemand hat die Absicht protektionistische Maßnahmen zu ergreifen hätte das gemeinsame Lippenbekenntnis der Regierungen der G-20 auf dem Weltwirtschaftsforum Ende Januar dieses Jahres in Davos lauten können und wäre damit ebenso glaubwürdig. Zwei Monate später stellte die Weltbank in der Tat zahlreiche protektionistische Maßnahmen in 17 der G-20-Staaten fest. Ihr Ziel ist der Schutz der heimischen Branchen vor den Folgen der Wirtschaftskrise, etwa durch Zölle, Subventionen oder milliardenschwere Konjunkturpakete, die inländische Unternehmen gegenüber ausländischen bevorzugen. Damit nehmen die Regierungen jedoch eine Verstärkung der Krise in Kauf. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist der konstant zunehmende Welthandel der Motor globalen Wachstums. Die gegenwärtige Welle des Protektionismus hingegen führt zu einem massiven Handelseinbruch, vor dem die internationalen Finanz- und Handelsorganisationen warnen (WTO 2009: xi, IMF 2009: xiv, World Bank 2009: 2f., UNCTAD 2009: i). Besonders Entwicklungsländer sind von einem Rückgang der Weltnachfrage negativ betroffen, ihre Exporterlöse sanken bereits um durchschnittlich 14 %, in den Industrieländern lediglich um die Hälfte. Die derzeitige Situation illustriert die immense Sensibilität der Entwicklungsländer gegenüber konjunkturellen Schwankungen der Weltwirtschaft und des Welthandels. Sie soll daher als Anlass genommen werden, die Rolle des Außenhandels für die wirtschaftliche Entwicklung der 49 ärmsten Entwicklungsländer, den Least Developed Countries genauer zu untersuchen.
Problemstellung:
Mit diesem Vorhaben begibt man sich zwangsläufig auf ein sowohl wissenschaftlich als auch politisch besonders umstrittenes Gebiet. Denn schon immer stellte Handelspolitik in der politischen Diskussion ein emotional sehr aufgeladenes Thema dar, was sich auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung niederschlägt. Laut der klassischen und neoklassischen Handelstheorie profitieren Staaten gesamtwirtschaftlich immer von Handel, dieser verursacht jedoch auch eine starke Umverteilung innerhalb der Gesellschaft, die neben Gewinnern auch Verlierer produziert. Potentielle Verlierergruppen opponieren daher einer Handelsöffnung und prangern negative Auswirkungen von Freihandel an, um so ihre Partikularinteressen zu wahren. Selbst wenn gesamtwirtschaftlich ein Land […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Carolin Mengel
Handel und wirtschaftliche Entwicklung in LDCs - ein Paradox?
Theoretische Betrachtung der handelsinduzierten Wachstumseffekte im Hinblick auf die
besondere Lage der Least Developed Countries
ISBN: 978-3-8366-4263-7
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Freie Universität Berlin, Berlin, Deutschland, Diplomarbeit, 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
iii
,,Aus meiner sozialistischen Jugendzeit habe ich viele Ideen und Ideale ins Alter gerettet.
Insbesondere: Jeder Intellektuelle hat eine ganz besondere Verantwortung. Er hatte das
Privileg und die Gelegenheit, zu studieren. Dafür schuldet er es seinen Mitmenschen (oder
der ,Gesellschaft`), die Ergebnisse seiner Studien in der einfachsten und klarsten und
verständlichsten Form darzustellen. Das Schlimmste -- die Sünde gegen den heiligen Geist
-- ist, wenn die Intellektuellen es versuchen, sich ihren Mitmenschen gegenüber als große
Propheten aufzuspielen und sie mit orakelnden Philosophien zu beeindrucken. Wer`s nicht
einfach und klar sagen kann, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er's klar sagen kann.
(...)
Was ich die Sünde gegen den heiligen Geist genannt habe -- die Anmaßung des dreiviertel
Gebildeten --, das ist das Phrasendreschen, das Vorgeben einer Weisheit, die wir nicht
besitzen. Das Kochrezept ist: Tautologien und Trivialitäten gewürzt mit paradoxem
Unsinn. Ein anderes Kochrezept ist: Schreibe schwer verständlichen Schwulst und füge
von Zeit zu Zeit Trivialitäten hinzu. Das schmeckt dem Leser, der geschmeichelt ist, in
einem so ,tiefen` Buch Gedanken zu finden, die er selbst schon mal gedacht hat."
Sir Karl Popper (1971)
iv
Gliederung
Abkürzungsverzeichnis _________________________________________________ i
1. Einleitung __________________________________________________________ 1
1.1 Relevanz ____________________________________________________1
1.2 Fragestellung und Variablen _____________________________________2
1.3 Methodik____________________________________________________4
2. Stylized Facts: Die Least Developed Countries ____________________________5
2.1 Klassifikationskriterien und geografische Lage der LDCs _______________5
2.2 Wirtschaftstruktur und wirtschaftliche Entwicklung der LDCs ___________7
2.3 Handelsstruktur und Bedeutung des Handels in den LDCs _____________ 12
Zusammenfassung: Die hohe Abhängigkeit der LDCs vom Welthandel ______ 20
3.1 Statische Gewinne aus Handel ______________________________________ 22
3.1.1 Absolute Kostenvorteile und effiziente Ressourcenallokation__________ 23
3.1.2 Theorem der komparativen Kosten _____________________________ 25
3.1.3 Modell spezifischer Faktoren __________________________________ 28
3.1.4 Faktorproportionentheorem ___________________________________ 29
3.1.5 Neofaktorproportionentheorem ________________________________ 33
Zusammenfassung: Die (neo-)klassischen Außenhandelstheorien in den LDCs 35
3.2 Dynamische Gewinne und Wachstum ________________________________ 37
3.2.1 Kapitalakkumulation und Investitionen als Wachstumskanal_____________ 38
3.2.1.1 Kapitalakkumulation durch die heimische Sparquote _______________ 40
3.2.1.2 Kapitalakkumulation durch Exportgewinne ______________________ 42
3.2.1.3 Ausländische Direktinvestitionen______________________________ 45
3.2.2 Produktivitätssteigerung als Wachstumskanal ________________________ 47
3.2.2.1 Technologietransfer ________________________________________ 49
3.2.2.2 Skaleneffekte: Wissens-Spillover und Learning-by-Doing____________ 50
Zusammenfassung: Dynamische Handelsgewinne in den LDCs ____________ 52
4. Binding Constraints für Handelsgewinne und Wachstum __________________ 55
4.1 Institutionelle Hindernisse und der Einfluss von Interessensgruppen________ 56
4.2 Nachhaltigkeit von Wachstum durch Rohstoffexporte ___________________ 58
4.3 Finanzmarktimperfektionen _______________________________________ 60
4.4 Erziehungszoll und infant-industry-Argument _________________________ 61
4.5 Steigende Skalenerträge __________________________________________ 62
4.6 Transportkosten________________________________________________ 65
4.6 Schädliche Spezialisierung ________________________________________ 66
4.6.1 Prebisch-Singer-These _______________________________________ 66
4.6.2 Dutch-Disease-Modelle ______________________________________ 67
4.6.3 Fallende Skalenerträge in Lamdwirtschaft und Rohstoffabbau _________ 68
Zusammenfassung: Institutionelle Wachstumshindernisse und Marktversagen ___ 70
5. Synopsis und Ausblick _______________________________________________ 73
Literatur_____________________________________________________________ 77
Internetquellen _______________________________________________________ 85
Anhang _____________________________________________________________ 87
v
Abbildungsverzeichnis
Abbildung Deckblatt: Geografische Lage der Least Developed Countries
Abbildung 1: Geografische Lage der Least Developed Countries. ___________________7
Abbildung 2: Stylized Facts, Vergleich LDCs und Welt ___________________________8
Abbildung 3: Vergleich des Wachstums des Pro-Kopf-Einkommens (Ländergruppen) ___9
Abbildung 4: Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens (Ländergruppen) ________________ 10
Abbildung 5: Warenhandel in Prozent des BIP, 1963-2007 (Ländergruppen) _________ 12
Abbildung 6: Exportstruktur der LDCs, sortiert nach Exportgruppen_______________ 13
Abbildung 7: Geografische Darstellung der Exportgruppen ______________________ 14
Abbildung 8: Exportstruktur der afrikanischen LDCs ___________________________ 15
Abbildung 9: Exportstruktur der asiatischen und Insel-LDCs _____________________ 16
Abbildung 10: Geografische Darstellung von Lebensmittelex- und importeuren. ______ 18
Abbildung 11: Stolper-Samuelson Effekt_____________________________________ 32
Abbildung 12: Faktorausstattung der Industrieländer und Least Developed Countries __ 35
Abbildung 13: Brutto und Nettoersparnisse in LDCs, 2006_______________________ 41
Abbildung 14: Finanzflüsse nach und innerhalb LDCs __________________________ 44
Abbildung 15: Bereinigte Sparquote der LDCs ________________________________ 59
Abbildung 16: Steigende Skaleneffekte und Spezialisierung _______________________ 64
Abbildung 17: Bodenschätze in Afrika ______________________________________ 87
Abbildung 18: Internationaler Korruptionsindex (CPI) __________________________ 88
Abkürzungsverzeichnis
AGOA
African Growth and Opportunity Act
BIP
Bruttoinlandsprodukt
BNE
Bruttonationaleinkommen
EBA
Everything-but-Arms-Initiative
FDI
Foreign Direct Investment
G-20
Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer
GSP
General System of Preferences
HIC
High Income Country
HIPC
Highly Indebted Poor Country
IMF
International Monetary Fund
LDC
Least Developed Country
LLDC
Landlocked Developing Country
MDRI
Multilateral Debt Relief Initiative
MIC
Middle Income Country
MNC
Multinational Corporation
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development
SIDS
Small Island Developing State
TFP
Total Factor Productivity
UN
United Nations
UNCTAD
United Conference on Trade and Development
WD
World Development Indicators
WTO
World Trade Organization
1
1. Einleitung
1.1 Relevanz
,,Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
verkündete Walter Ulbricht im Juni 1961 zwei Monate vor Beginn des Mauerbaus
(Weidenfeld/Korte 1999: 552.).
1
,,Niemand hat die Absicht protektionistische Maßnahmen zu ergreifen"
hätte das gemeinsame Lippenbekenntnis der Regierungen der G-20 auf dem
Weltwirtschaftsforum Ende Januar diesen Jahres in Davos lauten können
(Kuhr/Zitzelsberger 2009) und wäre damit ebenso glaubwürdig. Zwei Monate später
stellte die Weltbank in der Tat zahlreiche protektionistische Maßnahmen in 17 der G-20-
Staaten fest (Gamberoni /Newfarmer 2009: 1). Ihr Ziel ist der Schutz der heimischen
Branchen vor den Folgen der Wirtschaftskrise, etwa durch Zölle, Subventionen oder
milliardenschwere Konjunkturpakete, die inländische Unternehmen gegenüber
ausländischen bevorzugen.
2
Damit nehmen die Regierungen jedoch eine Verstärkung der
Krise in Kauf. Seit Ende des Zweiten Weltkrieg ist der konstant zunehmende Welthandel
der Motor globalen Wachstums. Die gegenwärtige Welle des Protektionismus hingegen
führt zu einem massiven Handelseinbruch, vor dem die internationalen Finanz- und
Handelsorganisationen warnen (WTO 2009: xi, IMF 2009: xiv, World Bank 2009: 2f.,
UNCTAD 2009: i). Besonders Entwicklungsländer sind von einem Rückgang der
Weltnachfrage negativ betroffen, ihre Exporterlöse sanken bereits um durchschnittlich 14
%, in den Industrieländern lediglich um die Hälfte (Hagelüken 2009). Die derzeitige
Situation illustriert die immense Sensibilität der Entwicklungsländer gegenüber
konjunkturellen Schwankungen der Weltwirtschaft und des Welthandels. Sie soll daher als
1
Ehem. DDR-Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht am 15. Juni 1961 auf einer
internationalen Pressekonferenz in Ost-Berlin zum Thema Friedensvertrag und zum
Westberlin-Problem.
2
Ein bekanntes Beispiel ist die ,,Buy American"-Klausel des Konjunkturpakets der
Vereinigten Staaten, welche für Infrastrukturmaßnahmen nur amerikanischen Stahl und
Eisen vorsah, anstatt diesen zu importieren.
2
Anlass genommen werden, die Rolle des Außenhandels für die wirtschaftliche Entwicklung
der 49 ärmsten Entwicklungsländer, den Least Developed Countries
3
genauer zu
untersuchen.
1.2 Fragestellung und Variablen
Mit diesem Vorhaben begibt man sich zwangsläufig auf ein sowohl wissenschaftlich als
auch politisch besonders umstrittenes Gebiet. Denn schon immer stellte Handelspolitik in
der politischen Diskussion ein emotional sehr aufgeladenes Thema dar, was sich auch in
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung niederschlägt. Laut der klassischen und
neoklassischen Handelstheorie profitieren Staaten gesamtwirtschaftlich immer von Handel,
dieser verursacht jedoch auch eine starke Umverteilung innerhalb der Gesellschaft, die
neben Gewinnern auch Verlierer produziert. Potentielle Verlierergruppen opponieren
daher einer Handelsöffnung und prangern negative Auswirkungen von Freihandel an, um
so ihre Partikularinteressen zu wahren. Selbst wenn gesamtwirtschaftlich ein Land durch
eine Handelsliberalisierung wächst, kann in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehen, die
Globalisierung verliefe nicht im Interesse der Bevölkerung. Während klassische und
neoklassische
Außenhandelstheorien
die
Argumentationsgrundlage
für
Freihandelsbefürworter darstellen, bedienen sich Freihandelsgegner meist empirischer
Evidenz von Verlierergruppen um ihren Standpunkt zu unterstützen. Neuere Modelle und
Theorien zeigen jedoch auch mögliche adverse Effekte von bestimmten Handelsmustern.
Sie basieren meist auf Annahmen älterer Theorien, die jedoch im wissenschaftlichen
Mainstream in den Hintergrung geraten sind.
Die stark in den Welthandel integrierten Least Developed Countries machen oberflächlich
betrachtet den Eindruck, weder gesamtwirtschaftlich besonders stark von Handel zu
profitieren, noch Verlierergruppen ausreichend zu schützen. Im Gegenteil: Hunger und
3
Die Übersetzung ,,am wenigsten entwickelte Länder" ist im Deutschen nicht geläufig und
wird daher auch in dieser Arbeit weniger sperrig im Englischen belassen. Weder im
Englischen, noch im Deutschen sind die Dysphemismen der so genannten ,,Dritten" oder
,,Vierten Welt" oder der unterentwickelten Länder angebracht, daher wird auf deren
Verwendung bewusst verzichtet. Der Leser möge den englischen Begriff dennoch nicht
mit Entwicklungs- oder Schwellenländern bzw. Emerging Countries verwechseln, da
diesen andere wirtschaftliche Voraussetzungen zugrunde liegen.
3
Armut herrschen in der breiten Bevölkerung der meisten LDCs, gleichzeitig werden sie im
Welthandel marginalisiert und wirtschaftlicher Wohlstand scheint ihnen verwehrt zu
bleiben. In den letzten Jahren jedoch wachsen diese Länder seit langem wieder. Daher
ergibt sich die Fragestellung dieser Arbeit, ob Handel zu einem nachhaltigen Wachstum in
den LDCs beitragen kann.
Um den Umfang dieser Arbeit einzuschränken, werden folgende Variablen festgelegt: Als
unabhängige Variable sollen Umfang und Struktur des Außenhandels (Exporte und
Importe) der LDCs gewählt werden. Abhängige Variable sei die wirtschaftliche
Entwicklung der Länder, also ihr Wachstum. Da in den LDCs das Bevölkerungswachstum
teilweise sehr hoch ist, muss das Wirtschaftswachstum höher sein, damit sich der
durchschnittliche Lebensstandard nicht verringert. Daher soll nicht das einfache Wachstum
der Wirtschaftsleistung betrachtet werden, sondern das Wachstum des Pro-Kopf-
Einkommens. Als Hypothese nehme ich an, dass Handel in LDCs erst ab einem gewissen
Grad an Entwicklung zugute kommt.
Statistisch ist es nahezu unmöglich, den Faktor Handel als Wachstumsfaktor zu isolieren
(u.a. Rodriguez/Rodrik 2001: 35f.). Zu viele institutionelle, strukturelle, politische,
geografische und historische Faktoren spielen mit hinein. Hingegen ist es zielführend, die
bekanntesten Handels- und Wachstumstheorien einmal näher zu betrachten und ihre
Annahmen anhand der real existierenden LDCs zu überprüfen. Ziel dieser Arbeit ist daher
eine umfassende und differenzierte Betrachtung der wissenschaftlichen Literatur über die
handelsinduzierten Wachstumskanäle und der notwendigen Voraussetzungen für
tatsächliches Wachstum. Das bekannte Problem der extremen Armut in den Least
Developed Countries soll anhand der bekanntesten Handels- und Wachstumstheorien
analysiert werden, ohne dabei die kritische Hinterfragung der Modellannahmen zu
vernachlässigen. Dabei sollen die hermetischen volkswirtschaftlichen Modelle auch mit
politischen und politökonomischen Prozessen konfrontiert werden, um somit einen Bogen
über beide Fächer zu schlagen. Die Auswahl der Handels- und Wachstumstheorien
orientiert sich dabei an der Bekanntheit der Modelle. Sowohl die besprochenen
Handeltheorien, als auch die wissenschaftliche Literatur zu Wachstumseffekten stellen die
Grundlage für jedes volkswirtschaftliche Studium dar und prägen damit das Verhalten der
volkswirtschaftlichen Experten maßgeblich. Eine differenzierte Beantwortung der Frage
4
nach der optimalen Handelspolitik für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der
LDCs wird den Schlussteil der Arbeit bilden.
1.3 Methodik
Die Volkswirtschaft untersucht die optimale Nutzung knapper Ressourcen und sucht nach
den notwendigen politischen Maßnahmen für deren Erreichung. Beides wird durch
technische und informationelle Grenzen erschwert, zum Beispiel durch
Messschwierigkeiten oder Datenmangel. Ist die optimale Politik jedoch einmal gefunden
oder berechnet, wird angenommen, dass die Politiker als Maximierer der öffentlichen
Wohlfahrt diese auch durchsetzen (Drazen 2000: 6f.). Die politische Ökonomie stellt daher
zunächst heraus, dass optimale und tatsächliche Politik nicht viel gemein haben.
Tatsächliche Politik unterliegt vielmehr politischen Beschränkungen, nämlich der
Notwendigkeit kollektive Entscheidungen trotz konfligierender Interessen zu treffen.
Daher fragt die positive politische Ökonomie danach, wie politische Entscheidungen und
ihre ökonomischen Konsequenzen durch politische Beschränkungen erklärt werden
können.
So
kann
man
Erkenntnisse
darüber
gewinnen,
warum
Entscheidungsmechanismen oft andere Ergebnissen hervorbringen, als ein wohlwollender
Ökonom sie gewählt hätte (Ebenda: 16)
.
Die normative politische Ökonomie fragt
daraufhin, wie angesichts der politischen Beschränkungen bestimmte ökonomische Ziele
erreicht werden können und wie konfligierende Interessen gewichtet werden sollen
(Ebenda: 7, 16).
Die politikwissenschaftliche Untersuchung soll sich Rahmen dieser Arbeit vor allem auf
handelpolitische Entscheidungen beschränken. Eine Untersuchung der Außenpolitik, der
Sozial- und Wirtschaftspolitik, der Bildungspolitik, sowie der politischen Institutionen und
der Regimeform sind zwar durchaus interessant und beeinflussen den Wachstumsprozess
selbstverständlich stark, doch würde eine solch umfassende Untersuchung zu weit führen
und den Rahmen einer Diplomarbeit sprengen.
5
2. Stylized Facts: Die Least Developed Countries
Das folgende Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Least Developed
Countries bezüglich ihrer geografischen Lage, wirtschaftlichen Beschaffenheit und
Handelsstruktur. Die großen Datenbanken der OECD, des IMF, der UN und der
Weltbank sind sehr lückenhaft, was eine eigenständige statistische Analyse und Auswertung
erschwert. Daher dominieren bereits bereinigte Daten der Vereinten Nationen,
insbesondere der LDC-Reports die Bestandsaufnahme auf den nächsten Seiten, ergänzt
durch einige einfache Statistiken basierend auf den World Development Indicators (WDI)
der Weltbank.
2.1 Klassifikationskriterien und geografische Lage der LDCs
Jährlich prüfen die Vereinten Nationen
4
, welche Länder die Klassifikationskriterien als
Least Developed Country erfüllen. Im März dieses Jahres fielen darunter 49 Länder
5
die
eine besonders niedrige Wirtschaftsleistung (Low-Income-Kriterium), eine geringe
Lebensqualität bezüglich der Bildungs- und Gesundheitsstruktur (Human Assets
Weakness) und eine hohe Verletzlichkeit gegenüber externen Schocks (Economic
Vulnerability) aufweisen (UNCTAD 2009: iii).
6
Das Low-Income-Kriterium setzt ein Pro-
Kopf-Einkommen von weniger als 905 US$ im Dreijahresdurchschnitt voraus. Ab einem
BIP/Kopf von 1.086 US$ verliert ein Land seinen Status als LDC. Dies entspricht etwa
einem Dreißigstel des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens der 67 reichsten Länder
4
Der Wirtschafts- und Sozialrat entscheidet (UN Economic and Social Council) auf
Vorschlag des Ausschusses für Entwicklungspolitik (Committee for Development Policy
(CDP)) über die Erfüllung der Kriterien.
5
Afghanistan, Angola, Bangladesch, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Kambodscha,
Zentralafrikanische Republik, Tschad, Komoren, Demokratische Republik Kongo,
Dschibuti, Äquatorialguinea, Eritrea, Äthiopien, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti,
Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Mauretanien,
Mosambik, Myanmar, Nepal, Niger, Ruanda, Samoa, Sao Tome und Principe, Senegal,
Sierra Leone, Salomonen, Somalia, Sudan, Osttimor, Togo, Tuvalu, Uganda, Tansania,
Vanuatu, Jemen und Sambia.
6
Die Bevölkerungsgröße der LDCs darf zudem 75 Millionen Einwohner nicht
überschreiten.
6
der Erde (UNCTAD 2009: 47).
7
Anhand des Human Assets Index (HAI) wird die
Lebensqualität gemessen. Dieser Index basiert auf verschiedenen Indikatoren zu
Unterernährung, Kindersterblichkeit, Einschulungsrate und Alphabetismus. Der Economic
Vulnerability Index schließlich misst die Stabilität der landwirtschaftlichen Produktion, die
Auswirkungen von Naturkatastrophen, die Exportstabilität und die Diversifikation, sowie
die wirtschaftliche Größe und die geografische Abgeschiedenheit (UNCTAD 2009: iii).
Betrachtet man die geografische Lage der 49 LDCs, stellt man fest, dass der Großteil (31)
in Afrika liegt. 8 weitere Länder der Gruppe liegen in Asien, während die restlichen 10
Staaten Inseln sind.
8
Kein einziges LDC liegt in Südamerika, und ebenso wenig in den
reichen OECD-Regionen Nordamerika und Europa. Alle afrikanischen Least Developed
Countries befinden sich geografisch südlich der Sahara, vor allem in West-, Zentral- und
Ostafrika. Die meisten Staaten im südlichen Afrika und rund um den erdölreichen Golf
von Guinea sind keine LDCs. Angesichts der kolonialen Vergangenheit lässt sich kein
Zusammenhang zwischen einer bestimmten ehemaligen Kolonialzugehörigkeit und der
schwachen Entwicklung im Sinne der LDC-Klassifikation erkennen. Die asiatischen LDCs
konzentrieren sich vor allem auf Süd- und Südostasien (Hinterindische Halbinsel), doch
auch in Vorderasien und zwischen Zentral- und Südasien befinden sich je ein LDC.
9
Mehr
als die Hälfte der über den ganzen Erdball verstreuten Insel-LDCs befinden sich im
südwestlichen Pazifik.
10
Zwei weitere liegen vor der afrikanischen Küste und je eines mitten
im indischen Ozean und in der Karibik.
11
7
Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der High-Income-Countries (HIC,
Klassifikation Weltbank) liegt bei 36.000 US$.
8
Madagaskar ist zwar ebenso ein Inselstaat, wird aber von den Vereinten Nationen als
Afrikanisches Land klassifiziert.
9
Vorderasien: Jemen, Grenze zwischen Zentral- und Südasien: Afghanistan.
10
Osttimor, Salomonen, Kiribati, Tuvalu, Vanuatu und Samoa
11
Afrikanische Westküste: Sao Tome und Principe im Golf von Guinea. Afrikanische
Ostküste: Komoren. Indischer Ozean: Malediven. Karibik: Haiti
7
Abbildung 1: Geografische Lage der Least Developed Countries.
Die LDCs sind hier rot eingefärbt.
Afrika:
Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Zentralafrikanische Republik,
Tschad, D.R. Kongo, Dschibuti, Äquatorialguinea, Eritrea, Äthiopien,
Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Lesotho, Liberia, Madagaskar,
Malawi, Mali, Mauretanien, Mosambik, Niger, Ruanda, Senegal, Sierra
Leone, Somalia, Sudan, Togo, Uganda, Tansania und Sambia (31).
Asien:
Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Kambodscha, Laos, Myanmar, Nepal,
Jemen (8).
Inselstaaten: Komoren, Haiti, Kiribati, Malediven, Samoa, Sao Tome und Principe,
Salomonen, Osttimor, Tuvalu, Vanuatu (10).
Quelle: Eigene Grafik.
Stellt man fest, dass ein Land zu den LDCs gehört, lassen sich daraus einige erste Aussagen
ableiten. In diesem Land ist der Durchschnitt der Bevölkerung extrem arm, die
Lebensqualität stark eingeschränkt und die Wirtschaft sehr instabil. Es liegt mit hoher
Wahrscheinlichkeit in Afrika, vielleicht aber auch in Südostasien oder ist ein kleiner
Inselstaat im Pazifik. Um handelspolitische Aussagen über LDCs zu machen, müssen
jedoch einige weitere Charakteristika untersucht werden. Im folgenden Teil sollen die
wirtschaftlichen Strukturen der LDCs skizziert werden.
2.2 Wirtschaftstruktur und wirtschaftliche Entwicklung der LDCs
Weltweit gehört jeder vierte Staat zu den LDCs, jeder achte Mensch lebt in einem LDC.
Dennoch beträgt die Wirtschaftsleistung der gesamten Gruppe nur einen Bruchteil (0,8%)
des Weltwirtschaftsprodukts. Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, ist das
durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen sehr niedrig. Es liegt bei 551 US$, was einem
Einkommen von 1,51 US$ pro Tag entspricht (WDI 2007). Dieser Wert liegt nur wenig
8
über der Internationalen Armutsgrenze Armut, die bei 1,08 Dollar pro Tag
12
festgelegt ist
(The Economist 2008).
Die Dominanz des Agrarsektors ist typisch für die armen Länder. Durchschnittlich 72
Prozent der Bevölkerung in den LDCs leben auf dem Land (WDI 2007), knapp siebzig
Prozent der Beschäftigung findet im agrarischen Bereich statt (UNCTAD 2009: 92).
Aufgrund der geringen Produktivität der Landwirtschaft umfasst sie jedoch nur weniger als
ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung, jedoch immerhin das Doppelte, als in anderen
Entwicklungsländern (UNCTAD 2009: 92).
Abbildung 2: Stylized Facts, Vergleich LDCs und Welt
Quellen: WDI 2007, WTO-Homepage (Mitgliedstaaten) und World Bank-Homepage (Liste
der HIPC-Länder). (siehe Quellenverzeichnis)
Effektive wirtschaftliche Entwicklung in den LDCs kann nur vonstatten gehen, wenn das
Wirtschaftswachstum höher ist, als das Wachstum der Bevölkerung. Andernfalls sinkt das
Pro-Kopf-Einkommen, da der wirtschaftliche ,,Kuchen" auf mehr Personen verteilt
12
In Kaufkraftparität von 1993.
9
werden muss als zuvor, und die Stücke dadurch zwangsläufig kleiner werden. 2007, vor der
derzeitigen Wirtschaftskrise, wuchs eben dieser Kuchen um knappe acht Prozent, die
Stücke also das Pro-Kopf-Einkommen immerhin noch um gute fünf Prozent. Dieser
starke positive Trend zeigt sich seit Mitte der Neunziger. Die LDCs wachsen seitdem sogar
meistens schneller, als der Weltdurchschnitt und die Länder mit hohem Einkommen
(HIC). Dennoch reicht das Wachstum bei Weitem nicht aus, um die anderen Länder
einzuholen. Die Länder mit hohem Einkommen, also die Industrieländer, haben bereits
eine enorme Wirtschaftsleistung erreicht, die sich selbst durch marginale Wachstumsraten
noch exponentiell erhöht. Zur Veranschaulichung dienen die beiden Abbildungen 3 und 4,
die Wachstumsraten und absolutes Wachstum der Länder mit hohem und mittleren
Einkommen, der Least Developed Countries und der Welt miteinander vergleicht. Man
erkennt, dass nicht einmal bei den beachtlichen Wachstumsraten der Schwellenländer
(MICs), geschweige denn der LDCs, von einem Aufholprozess gesprochen werden kann.
Stattdessen
weitet
sich
die
Einkommensschere
zwischen
Industrieländern,
Schwellenländern und LDCs.
Abbildung 3: Vergleich des Wachstums des Pro-Kopf-Einkommens
(Ländergruppen)
LDCs, MICs, HICs und Welt, 1980-2007
Quelle: WDI.
10
Abbildung 4: Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens (Ländergruppen)
LDCs, MICs, HICs und Welt, 1980-2007
(in aktuellen US$, Kaufkraftparität)
Quelle: WDI.
Ob die LDCs jedoch den westlichen Lebensstandard mittel- oder langfristig erreichen
können, ist eine Frage, die im Rahmen dieser Arbeit unbeantwortet bleiben wird. Der
Wachstumsvergleich mit Industrie- und Schwellenländern ist müßig und nicht unbedingt
zielführend. Vielmehr sollte man das Augenmerk auf die unmittelbare Verbesserung der
ökonomischen und Lebensverhältnisse setzen, unabhängig von der Orientierung an hoch
entwickelten oder schnell wachsenden Volkswirtschaften.
Neben dem positiven Wachstumstrend verbessert sich die wirtschaftliche Lage einiger
LDCs derzeit maßgeblich durch eine Schuldenerlassinitiative. Die Schuldenlast der LDCs
beträgt durchschnittlich 42 Prozent des Bruttonationaleinkommens. In anderen
Entwicklungsländern liegt sie lediglich bei 26 Prozent (UNCTAD 2009: II). 32 der 49
Staaten zählen zur Gruppe der hoch verschuldeten Länder (HIPCs)
13
, darunter nahezu alle
afrikanischen LDCs (29 von 31). 18 HIPCs haben sich letztes Jahr für einen Schuldenerlass
13
Heavily Indebted Poor Countries
11
durch Weltbank und des IWF
14
qualifiziert.
15
Den übrigen hoch verschuldeten LDCs steht
diese Möglichkeit bei Erfüllung entsprechender IWF-Programme offen. Diese besondere
Chance dürfte den Ländern zusätzlichen Anschub geben, da ihr Staatshaushalt von
Zinszahlungen und Schuldendienst entlastet wird und dadurch finanzielle Möglichkeiten
zur Förderung wirtschaftlicher Entwicklung entstehen.
Der hohe Verschuldungsgrad besonders der afrikanischen LDCs verwundert, wenn man
die immensen Rohstoffvorkommen des drittgrößten Kontinents betrachtet. Ein
Beobachter ohne historische Vorkenntnisse würde sicherlich erwarten, dass Afrika einer
der reichsten Kontinente sei. Angola, Tschad und Sudan besitzen ertragreiche Ölquellen.
An der westafrikanische Küste finden sich Diamanten, Gold und Eisen, ebenso wie in den
zentral- und ostafrikanischen LDCs, die zudem auch über große Vorkommen an Kupfer,
Coltan und Eisen verfügen.
16
Der Rohstoffhandel sollte doch gerade bei einer starken
Integration in den Weltmarkt ein Garant für hohe Handelsgewinne und Wachstumseffekte
sein. Anscheinend kommen die Erlöse des Rohstoffabbaus nicht der breiten Bevölkerung
und einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung zugute. Im vierten Teil dieser Arbeit
wird diese Frage näher beleuchtet werden.
Wie im einleitenden Teil bereits erwähnt, trifft die derzeitige Wirtschaftskrise die Least
Developed Countries besonders hart. Eine genauere Betrachtung der Handelstruktur soll
im nächsten Abschnitt Aufschluss über die hohe Verletzlichkeit der LDCs geben.
14
Nähere Hinweise zur HIPC- und MDRI-Initiative dazu auf der Weltbank Webseite, siehe
Quellenverzeichnis.
15
Benin, Burkina Faso, Burundi, Zentralafrikanische Republik, Äthiopien, Gambia,
Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mosambik, Niger, Ruanda, Sao Tome und
Principe, Senegal, Sierra Leone, Tansania, Uganda, Sambia sowie dem karibischen Haiti
wurden ihre Schulden erlassen. Tschad, D.R. Kongo, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia,
Togo, Komoren, Eritrea, Somalia und Sudan, sowie Afghanistan und die Komoren können
sich noch für einen Schuldenerlass qualifizieren.
Liste der HIPC-Staaten auf der Weltbank-Homepage, siehe Quellenverzeichnis.
16
Siehe dazu Abbildung 17 im Anhang.
12
2.3 Handelsstruktur und Bedeutung des Handels in den LDCs
Wie eingangs erwähnt, sind die Least Developed Countries stark in den Welthandel
integriert. 2007 betrug ihr Handel durchschnittlich 61% des BIP (WDI 2007), so dass sie
tendenziell sogar handelsoffener sind, als die Industrieländer (UNCTAD 2009: II). Der
Anstieg des weltweiten Warenaustauschs war in den LDCs seit Mitte der Achtziger stärker
als im Rest der Welt, was Abbildung 5 gut veranschaulicht. Die Messung der
Handelsoffenheit ist methodisch sehr schwer zu bewerkstelligen, zudem sind verlässliche
Daten für die LDCs kaum verfügbar, weshalb diese Arbeit den Anteil des Handelsvolumen
als Maß verwendet. So kritisieren Rodriguez und Rodrik (2001: 35f.) die Indices, die in den
bekanntesten empirischen Untersuchungen zur Messung von Handelsoffenheit verwendet
werden und eine positive Korrelation mit dem Wirtschaftswachstum nachweisen wollen.
Dies ist ein weiterer Grund, warum in dieser Arbeit auf die Verwendung solcher Indices
verzichtet wird.
Abbildung 5: Warenhandel in Prozent des BIP, 1963-2007 (Ländergruppen)
Quelle: WDI (Merchandise trade in % of GDP).
Im Folgenden wird nun die Zusammensetzung der Exporte untersucht, um Rückschlüsse
auf die Exportabhängigkeit der LDCs zu ziehen. Im Anschluss werden die
13
Importstrukturen im Zusammenhang mit der Ernährungssituation in den LDCs skizziert.
Die LDCs stellen bezüglich ihrer Exportstruktur keine homogene Gruppe dar. Indem man
den Hauptexportsektor der Länder identifiziert, also der Sektor, der den größten Teil ihrer
Exporte darstellt, lassen sich Spezialisierungsmuster gut erkennen. Dies ist sinnvoll, da ein
Land bei starker Spezialisierung auf einen oder wenige Sektoren anfälliger für
Preisvolatilitäten
17
auf dem Weltmarkt wird, da ihre Exportgewinne schwanken.
Zahlenmäßig überwiegen bei dieser Betrachtung die Länder, die hauptsächlich Rohstoffe
und Agrarprodukte exportieren (27) gegenüber denjenigen, die vor allem Fertigprodukte,
Dienstleistungen exportieren (17) oder eine stärker gemischte Exportstruktur haben (5).
Abbildung 6: Exportstruktur der LDCs, sortiert nach Exportgruppen
Die Klassifizierung der LDCs erfolgte durch Untersuchung der Exportsektoren, die 45%
ihrer Gesamtexporte übersteigen. Übersteigen die Exporte eines Landes in keinem Sektor
diese Grenze, handelt es sich um einen Mischexporteur.
Quelle: UNCTAD 2008: xiii.
17
Es ist natürlich möglich, dass sich ein Land auf den Abbau von vielen verschiedenen
Rohstoffen innerhalb des Rohstoffsektors spezialisiert und so das Risiko von
Weltmarktpreisschwankungen minimiert, in der Realität dominieren jedoch einige wenige
Rohstoffe, wie Öl, Diamanten oder Gold die Handelsstruktur von Entwicklungsländern.
14
Angesichts der bereits erwähnten Dominanz des Agrarsektors in den meisten LDCs,
verwundert auch der hohe Anteil an Rohstoffexporten nicht weiter. Viel mehr erwartet
man einen noch geringeren Anteil von Fertigungsindustrien und Dienstleistungen an den
Exporten. Die folgende Weltkarte gibt einen Einblick über geografische
Spezialisierungsmuster.
Abbildung 7: Geografische Darstellung der Exportgruppen
Ölexporteure (orange):
Angola, Tschad, Äquatorialguinea, Sudan,
Osttimor, Jemen
Agrarexporteure (gelb):
Afghanistan, Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau,
Kiribati, Liberia, Malawi, Salomonen, Somalia,
Tuvalu, Uganda
Mineralexporteure (rot):
Burundi, Zentralafrikanische Republik, D.R.
Kongo, Guinea, Mali, Mauretanien, Mosambik,
Niger, Sierra Leone, Sambia
Exporteure von Fertigwaren (grün): Bangladesch, Bhutan, Kambodscha, Haiti, Lesotho,
Nepal
Dienstleistungsexporteure (blau):
Komoren, Dschibuti, Eritrea, Äthiopien, Gambia,
Malediven, Ruanda, Samoa, Sao Tome und
Principe, Tansania, Vanuatu
Mischexporteure (violett):
Laos, Madagaskar, Myanmar, Senegal, Togo
Quelle: Eigene Grafik basierend auf Abbildung 6.
Tatsächlich lässt sich ein geografischer Zusammenhang mit den Exportmustern erkennen.
Vor allem große afrikanische Länder fällen als Rohstoff- und Agrarexporteur auf, während
die asiatischen LDCs zu Fertigproduktexporten tendieren. Insel-LDCs exportieren
vornehmlich Dienstleistungen, da Tourismus und Transportwesen dort eine größere Rolle
spielen.
15
Bisher wurden nur die Hauptexportgruppen betrachtet, jedoch soll dies nun durch eine
nähere Untersuchung der disaggregierten Handelsstruktur der LDCs ergänzt werden. Die
Abbildungen 8 und 9, geben einen etwas ausführlicheren Einblick in die Exportsektoren
der LDCs. Auch hier sind Rohstoff- und Agrarexporte in den Farben rot, gelb und orange
gekennzeichnet, während Dienstleistungen und Fertigwaren grün und blau dargestellt sind.
Abbildung 8: Exportstruktur der afrikanischen LDCs
Quelle (beide Grafiken): UNCTAD 2008: xiv.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836642637
- Dateigröße
- 7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Freie Universität Berlin – Politik- und Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- handel entwicklung handelspolitik handelstheorie wachstumstheorie
- Produktsicherheit
- Diplom.de