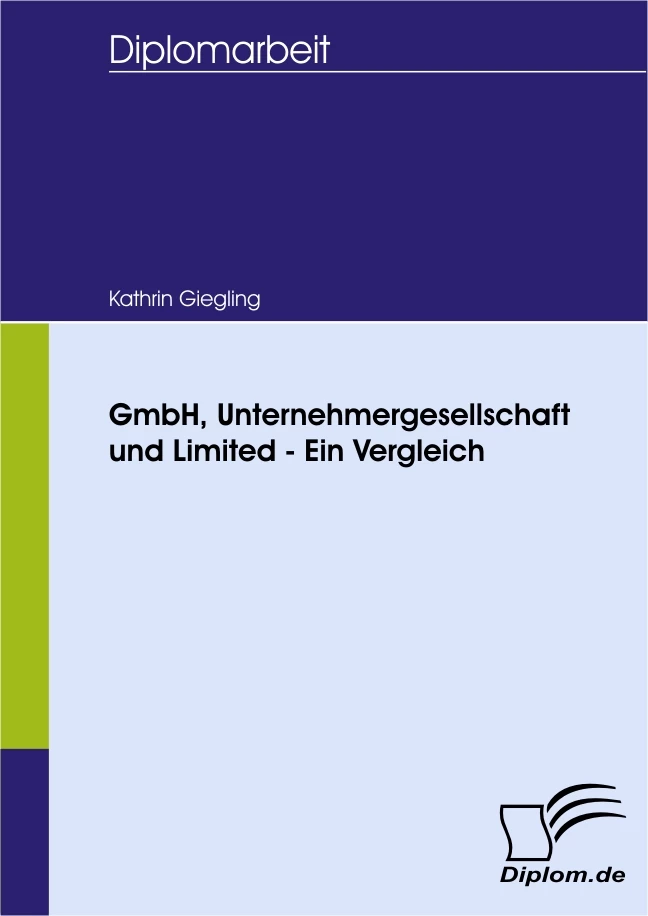GmbH, Unternehmergesellschaft und Limited - Ein Vergleich
©2009
Diplomarbeit
88 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Am 1. November 2008 trat das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) in Kraft. Das MoMiG bildet den vorläufigen Abschluss verschiedenster Bestrebungen das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) seit dessen Inkrafttreten am 20. Mai 1892 umfassend zu reformieren. Mit dem MoMiG reagiert der deutsche Gesetzgeber vor allem auf nationale und internationale Entwicklungen in der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Rechtsprechung.
Die Schwerpunkte des MoMiG liegen zum einen in der Beschleunigung von Unternehmensgründungen, zum anderen in der Erhöhung der Attraktivität der GmbH im Wettbewerb der europäischen Gesellschaftsformen. Als Folge verschiedenster Entscheidungen des EuGH steht die deutsche GmbH seit einigen Jahren mit anderen europäischen Gesellschaftsformen in Konkurrenz. Insbesondere die englische Private Limited Company by shares (Limited) findet bei Unternehmensgründern großen Anklang. Die Anzahl der in Deutschland als Zweigniederlassung eingetragenen Limited ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen und hat der GmbH als bislang beliebtesten Gesellschaftsform für den deutschen Mittelstand scheinbar den Rang abgelaufen.
Seit ihrer gesetzgeberischen Einführung durchlebte die GmbH eine einzigartige Entwicklung. Nicht nur in ihrem Schöpfungsland Deutschland, sondern auch im Ausland erwies sich die GmbH in gesellschaftsrechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht als ein großer Wurf. Bedingt durch die Aktienrechtsnovelle des Jahres 1884 hatte sich seinerzeit die Notwendigkeit ergeben, kleineren und mittleren Unternehmen eine Gesellschaftsform anzubieten, die ebenfalls haftungsbeschränkende Regelungen vorsah, deren Anforderungen hinsichtlich Gründung und Mindestkapitalausstattung sowie weiterer Faktoren jedoch deutlich unterhalb denen einer AG lagen.
Aktuell weicht der deutsche Mittelstand bei der Unternehmensgründung jedoch vermehrt auf die Gesellschaftsform der Limited aus. Das große Interesse an der Limited wird immer wieder damit begründet, dass diese einfacher, schneller und kostengünstiger als eine deutsche GmbH gegründet werden kann. Ungeachtet der niedrigeren Mindestkapitalausstattung der Limited bietet sie genauso wie die deutsche GmbH eine Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen.
Um der Ausbreitung der Limited zu Lasten der GmbH innerhalb des deutschen Rechtsraumes entgegenzuwirken und um der Rechtsprechung des EuGH im […]
Am 1. November 2008 trat das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) in Kraft. Das MoMiG bildet den vorläufigen Abschluss verschiedenster Bestrebungen das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) seit dessen Inkrafttreten am 20. Mai 1892 umfassend zu reformieren. Mit dem MoMiG reagiert der deutsche Gesetzgeber vor allem auf nationale und internationale Entwicklungen in der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Rechtsprechung.
Die Schwerpunkte des MoMiG liegen zum einen in der Beschleunigung von Unternehmensgründungen, zum anderen in der Erhöhung der Attraktivität der GmbH im Wettbewerb der europäischen Gesellschaftsformen. Als Folge verschiedenster Entscheidungen des EuGH steht die deutsche GmbH seit einigen Jahren mit anderen europäischen Gesellschaftsformen in Konkurrenz. Insbesondere die englische Private Limited Company by shares (Limited) findet bei Unternehmensgründern großen Anklang. Die Anzahl der in Deutschland als Zweigniederlassung eingetragenen Limited ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen und hat der GmbH als bislang beliebtesten Gesellschaftsform für den deutschen Mittelstand scheinbar den Rang abgelaufen.
Seit ihrer gesetzgeberischen Einführung durchlebte die GmbH eine einzigartige Entwicklung. Nicht nur in ihrem Schöpfungsland Deutschland, sondern auch im Ausland erwies sich die GmbH in gesellschaftsrechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht als ein großer Wurf. Bedingt durch die Aktienrechtsnovelle des Jahres 1884 hatte sich seinerzeit die Notwendigkeit ergeben, kleineren und mittleren Unternehmen eine Gesellschaftsform anzubieten, die ebenfalls haftungsbeschränkende Regelungen vorsah, deren Anforderungen hinsichtlich Gründung und Mindestkapitalausstattung sowie weiterer Faktoren jedoch deutlich unterhalb denen einer AG lagen.
Aktuell weicht der deutsche Mittelstand bei der Unternehmensgründung jedoch vermehrt auf die Gesellschaftsform der Limited aus. Das große Interesse an der Limited wird immer wieder damit begründet, dass diese einfacher, schneller und kostengünstiger als eine deutsche GmbH gegründet werden kann. Ungeachtet der niedrigeren Mindestkapitalausstattung der Limited bietet sie genauso wie die deutsche GmbH eine Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen.
Um der Ausbreitung der Limited zu Lasten der GmbH innerhalb des deutschen Rechtsraumes entgegenzuwirken und um der Rechtsprechung des EuGH im […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Kathrin Giegling
GmbH, Unternehmergesellschaft und Limited - Ein Vergleich
ISBN: 978-3-8366-4260-6
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. FOM - Fachhochschule für Oekonomie und Management Essen, Essen,
Deutschland, Diplomarbeit, 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
I
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ... I
Abkürzungsverzeichnis ... III
A.
Einleitung... 1
B.
Allgemeines zur GmbH Entstehung des GmbHG und des MoMiG ... 3
C.
Einflüsse auf die Entwicklung des deutschen Gesellschaftsrechts durch
Europäische Regelungen und Entscheidungen des EuGH ... 5
I.
Allgemeines ... 5
II.
Ausgangslage ... 5
III.
Entscheidungen des EuGH ... 7
1.
Daily Mail... 7
2.
Centros ... 8
3.
Überseering... 8
4.
Inspire Art... 9
IV.
Folge auf die deutsche Praxis und Umsetzung im MoMiG ... 10
D.
Der Vergleich von GmbH, UG und Limited... 12
I.
Gesetzliche Normierung... 12
1.
GmbH... 12
2.
UG ... 12
3.
Limited ... 13
4.
Ergebnis... 14
II.
Gründung ... 15
1.
GmbH... 15
2.
UG ... 17
3.
Limited ... 18
4.
Ergebnis... 20
III.
Gesellschaftsvertrag ... 21
1.
Allgemeines und Rechtliche Grundlagen... 21
a)
GmbH... 21
b)
UG... 22
c)
Limited... 22
d)
Ergebnis ... 23
2.
Firma... 24
a)
GmbH... 24
b)
UG... 25
c)
Limited... 26
d)
Ergebnis ... 26
3.
Sitz... 27
a)
GmbH... 27
b)
UG... 29
c)
Limited... 29
d)
Ergebnis ... 30
4.
Unternehmensgegenstand ... 31
a)
GmbH... 31
b)
UG... 32
c)
Limited... 32
d)
Ergebnis ... 33
5.
Stammkapital ... 34
a)
GmbH... 34
b)
UG... 38
c)
Limited... 40
d)
Ergebnis ... 42
6.
Geschäftsanteile... 44
a)
GmbH... 44
b)
UG... 47
II
c)
Limited... 47
d)
Ergebnis ... 49
7.
Organe und Vertretung... 49
a)
GmbH... 50
b)
UG... 53
c)
Limited... 53
d)
Ergebnis ... 55
IV.
Haftung ... 56
1.
GmbH... 56
a)
Gesellschaft... 56
b)
Gesellschafter ... 57
c)
Geschäftsführer... 59
2.
UG ... 60
3.
Limited ... 60
a)
Gesellschaft... 60
b)
Members (Gesellschafter) ... 61
c)
Directors (Geschäftsführer) ... 62
d)
Company's Secretary (Sekretär)... 63
4.
Ergebnis... 64
V.
Die Gesellschaft in der Krise oder Insolvenz ... 65
1.
GmbH... 65
2.
UG ... 67
3.
Limited ... 68
4.
Ergebnis... 69
E.
Fazit... 70
I.
GmbH vs. Limited... 70
II.
UG vs. Limited... 71
III.
Ausblick... 72
III
Abkürzungsverzeichnis
Abs.
Absatz
a.F.
alte Fassung
AG
Aktiengesellschaft
AktG
Aktiengesetz
AO
Abgabenordnung
Art.
Artikel
BB
BetriebsBerater
BFH
Bundesfinanzhof
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGH
Bundesgerichtshof
BMJ
Bundesministerium der Justiz
BT-Drucks.
Bundestagsdrucksache
CA
Companies Act
CDDA
Company Directors Disqualification Act
c.i.c.
culpa in contrahendo
DB
Der Betrieb
DrittelbG
Drittelbeteiligungsgesetz
DStR
Deutsches Steuerrecht
GKG
Gerichtskostengesetz
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung
GmbHR
GmbH Rundschau
EGV
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft
EuGH
Europäischer Gerichtshof
EuInsVO
Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates vom 29.
Mai 2000 über Insolvenzverfahren (ABl. EG 2000, L
160, 1)
EWGV
Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft
HGB
Handelsgesetzbruch
h.M.
herrschende Meinung
i.d.R.
in der Regel
InsO
Insolvenzordnung
JuS
Juristische Schulung
IA
Insolvency Act
KG
Kommanditgesellschaft
KostO
Kostenordnung
LG
Landgericht
MitbestG
Mitbestimmungsgesetz
MittBayNot
Mitteilung des Bayerischen Notarvereins, der No-
tarkasse und der Landesnotarkammer Bayern
MoMiG
Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und
zur Bekämpfung von Missbräuchen
MontanMitbestG
Montanmitbestimmungsgesetz
MitbestErgG
Mitbestimmungsergänzungsgesetz
m.w.N.
mit weiterem Nachweis
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
IV
NZG
Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
NZI
Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und
Sanierung
OHG
Offene Handelsgesellschaft
OLG
Oberlandesgericht
RegE
Regierungsentwurf
RGBl.
Reichsgesetzblatt
Rn.
Randnummer
RNotZ
Rheinische Notar-Zeitschrift
Rs.
Rechtssache
Sec.
Section
Slg.
Sammlung
SPE
Societas privata europaea (Europäische Privatge-
sellschaft)
UG
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Urt.
Urteil
WM
Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht
ZIP
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZPO
Zivilprozessordnung
1
A.
Einleitung
Am 1. November 2008 trat das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und
zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) in Kraft. Das MoMiG bildet den vor-
läufigen Abschluss verschiedenster Bestrebungen das Gesetz betreffend die Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) seit dessen Inkrafttreten am
20. Mai 1892
1
umfassend zu reformieren. Mit dem MoMiG reagiert der deutsche
Gesetzgeber vor allem auf nationale und internationale Entwicklungen in der Wirt-
schaft, der Gesellschaft und der Rechtsprechung.
2
Die Schwerpunkte
3
des MoMiG liegen zum einen in der Beschleunigung von Un-
ternehmensgründungen, zum anderen in der Erhöhung der Attraktivität der GmbH
im Wettbewerb der europäischen Gesellschaftsformen. Als Folge verschiedenster
Entscheidungen des EuGH steht die deutsche GmbH seit einigen Jahren mit ande-
ren europäischen Gesellschaftsformen in Konkurrenz. Insbesondere die englische
Private Limited Company by shares (Limited) findet bei Unternehmensgründern
großen Anklang. Die Anzahl der in Deutschland als Zweigniederlassung eingetra-
genen Limited ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen
4
und hat der GmbH als
bislang beliebtesten Gesellschaftsform für den deutschen Mittelstand scheinbar
den Rang abgelaufen.
Seit ihrer gesetzgeberischen Einführung durchlebte die GmbH eine einzigartige
Entwicklung. Nicht nur in ihrem Schöpfungsland Deutschland, sondern auch im
Ausland erwies sich die GmbH in gesellschaftsrechtlicher und wirtschaftlicher Hin-
sicht als ein großer Wurf.
5
Bedingt durch die Aktienrechtsnovelle des Jahres 1884
hatte sich seinerzeit die Notwendigkeit ergeben, kleineren und mittleren Unterneh-
men eine Gesellschaftsform anzubieten, die ebenfalls haftungsbeschränkende Re-
gelungen vorsah, deren Anforderungen hinsichtlich Gründung und Mindestkapital-
ausstattung sowie weiterer Faktoren jedoch deutlich unterhalb denen einer AG la-
gen.
1
RGBl. 1892, 477 in der Fassung der Bekanntmachung v. 20. Mai 1898 (RGBl. 1898, 846).
2
Goette (2008), Rn. 2.
3
Pressemittelung des BMJ v. 30. Oktober 2008.
4
Westhoff, GmbHR 2007, 474 ff.
5
So auch: Vogel, GmbHR 1953, 137.
2
Aktuell weicht der deutsche Mittelstand bei der Unternehmensgründung jedoch
vermehrt auf die Gesellschaftsform der Limited aus. Das große Interesse an der
Limited wird immer wieder damit begründet, dass diese einfacher, schneller und
kostengünstiger als eine deutsche GmbH gegründet werden kann.
6
Ungeachtet der
niedrigeren Mindestkapitalausstattung der Limited bietet sie genauso wie die deut-
sche GmbH eine Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen.
Um der Ausbreitung der Limited zu Lasten der GmbH innerhalb des deutschen
Rechtsraumes entgegenzuwirken und um der Rechtsprechung des EuGH im Hin-
blick auf die Niederlassungsfreiheit in Europa Rechnung zu tragen, hat der deut-
sche Gesetzgeber mit dem MoMiG eine Vielzahl von Regelungen des GmbHG er-
gänzt und angepasst. Schwerpunkte des MoMiG
7
, auf die in dieser Arbeit ausführ-
licher eingegangen werden wird, sind einerseits Erleichterungen bei der Kapitalauf-
bringung und bei der Übertragung von Geschäftsanteilen, andererseits die Mög-
lichkeit einer Verwaltungssitzverlegung ins Ausland, der gutgläubige Erwerb von
Geschäftsanteilen sowie Neuregelungen im Bereich des Cash-Pooling und die Re-
gulierung des Eigenkapitalersatzrechts.
Von besonderer Bedeutung ist jedoch, dass die Mindestvoraussetzungen für die
Gründung einer GmbH geändert und eine ,,abgespeckte Form" der GmbH einge-
führt wurde. Gemäß § 5a GmbHG
8
kann nunmehr eine GmbH als sog. Unterneh-
mergesellschaft (haftungsbeschränkt)
9
mit geringeren Anforderungen an die Kapi-
talaufbringung errichtet werden.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist ein Vergleich von GmbH und Limited unter beson-
derer Berücksichtigung der bereits genannten Schwerpunkte des MoMiG sowie
einer jeweils ergänzenden Darstellung der UG.
6
So z.B. Handelsblatt v. 9. Februar 2005, Die ,,Ein-Euro-GmbH" wird zum Thema; Handelsblatt
v. 8. April 2005, Die englische Limited ist die beliebteste ausländische Rechtsform; Handelsblatt
v. 1. Juni 2005, Englische Billig-GmbH boomt.
7
Schwerpunkte des Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von
Missbräuchen (MoMiG), BMJ v. 26. Juni 2008.
8
Paragraphen sind, soweit nicht besonders gekennzeichnet, solche des GmbHG in der Fas-
sung vom 1. November 2008.
9
Im Folgenden ,,UG".
3
Zum allgemeinen Verständnis der Thematik beginnt die Arbeit mit einem Überblick
über die Entstehung des GmbHG und dessen zeitlicher Fortentwicklung. Im Be-
sonderen wird auf europäische Regelungen und Entscheidungen des EuGH einge-
gangen, die maßgeblich zum Erlass des MoMiG beigetragen haben.
Daran anschließend folgt als Schwerpunkt dieser Arbeit, der Vergleich von GmbH,
UG und Limited unter besonderer Beachtung der durch das MoMiG bedingten Än-
derungen. Aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit können nicht alle gesell-
schaftsrechtlich relevanten Unterscheidungsmerkmale von GmbH, Limited und der
UG behandelt werden. Herausgestellt werden daher der Gründungsakt der ge-
nannten Gesellschaften, der Kreis ihrer Gesellschafter, die inhaltlichen Mindestan-
forderungen des jeweiligen Gesellschaftsvertrages sowie die Regelungen zur Haf-
tung und die Möglichkeiten der Gesellschaften in der Krise.
Im abschließenden Kapitel werden neben einem kurzen Fazit des Vergleichs zwi-
schen GmbH und Limited erste Erfahrungen mit der UG aufgezeigt und ein Aus-
blick gewagt, ob dem Gesetzgeber mit dem MoMiG die beabsichtigte ,,umfassends-
te Reform des GmbH-Rechts"
10
gelungen ist.
B.
Allgemeines zur GmbH Entstehung des GmbHG und des MoMiG
Die GmbH als Gesellschaftsform wurde erstmals im Jahre 1892 mit der Novellie-
rung des Aktienrechts und der damit einhergehenden Einführung des GmbHG ge-
schaffen.
11
Die Aktienrechtsnovelle des Jahres 1884 verschärfte die Anforderungen
hinsichtlich der Neugründung einer AG. Dadurch erwies sich die Rechtsform der
AG nur noch bedingt tauglich für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).
12
Die AG
wurde damit den Anforderungen des bereits damals durch den Mittelstand gepräg-
ten deutschen Wirtschaftslebens nicht mehr gerecht. Zudem entwickelte sich die
Notwendigkeit, eine Gesellschaftsform neben die AG zu stellen, die von einer klei-
neren Anzahl von Gesellschaftern gegründet werden konnte und gleichzeitig ähn-
lich wie bei der AG - eine Beschränkung der Haftung auf das Gesellschaftsvermö-
gen vorsah. Mit den bis dahin vorhandenen Gesellschaftsformen OHG bzw. KG
10
Das neue GmbH-Recht, Pressemitteilung des BMJ v. 30. Oktober 2008.
11
Klunzinger (2006), S. 227.
12
Klunzinger (2006), S. 227.
4
war dies aufgrund der persönlichen Haftung der geschäftsführenden Gesellschafter
mit ihrem Privatvermögen nicht möglich.
13
Da die GmbH den Anforderungen des überwiegend mittelständisch geprägten Wirt-
schaftslebens weitgehend entsprach, wurde ihre Einführung zu einem großen wirt-
schaftlichen Erfolg. Die Ausformung als juristische Person mit der damit verbunde-
nen Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen und das gegenüber
der AG geringere Mindestgesellschaftskapitalerfordernis von seinerzeit
20.000,00 DM sowie die Trennung von Gesellschafter- und Geschäftsführerebene
bot genau den auf den Mittelstand zugeschnittenen individuellen Handlungsrah-
men.
Da sich die GmbH als idealtypische Gesellschaftsform für das mittelständisch ge-
prägte deutsche Wirtschaftsleben erwies, blieben die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen des GmbHG seit dessen Inkrafttreten im Jahre 1892 weitgehend unverän-
dert. Erst durch die GmbH-Novelle vom 4. Juli 1980
14
ergaben sich erstmalig um-
fangreiche Änderungen, wie z.B. die Einführung der Einpersonen-GmbH, die Erhö-
hung des Mindeststammkapitals auf 50.000,00 DM und die Anhebung der Mindest-
einlage von bislang 5.000,00 DM auf 25.000,00 DM. Weitere Änderungen des
GmbHG in Form einer eingehenden Regelung zu den Rechnungslegungs- und
Publizitätspflichten der GmbH erfolgten auf der Grundlage des EG-Rechts (z.B.
resultierend im Bilanzrichtliniengesetz vom 19. Dezember 1985).
Die vorgenannten Änderungen und Modifizierungen des GmbHG, die nur einen Teil
der gesetzlichen Reformbestrebungen darstellen
15
, ließen jedoch den gesetzlichen
Kerngehalt des GmbHG im Wesentlichen unverändert.
Nach über 100 Jahren seit ihrer Einführung gibt es in Deutschland mittlerweile fast
eine Million Gesellschaften, die in der Rechtsform der GmbH firmieren.
16
Der Erfolg
dieser Gesellschaft findet zudem seinen Ausdruck in den vielen Nachahmern auf
13
Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck (2006), Einl Rn. 3, insbesondere Reform zu Einpersone-
nen-Gesellschaften und ihrer Gründung, Sacheinlagen etc.
14
Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck (2006), Einl Rn. 12; zu den Änderungen auch: BT-
Drucks. 8/1347, Lutter/Hommelhoff in Lutter/Hommelhoff (2004), Einl. Rn. 7.
15
Insgesamt gab es bis zum Inkrafttreten des MoMiG 39 Gesetzesänderungen des GmbHG.
16
Zum Stand GmbH zum 1. Januar 2008: Kornblum, GmbHR 2009, 25 ff.
5
internationaler Ebene.
17
So existieren vergleichbare Gesellschaftsformen, die nach
dem Muster der GmbH geschaffen wurden, in mehr als 100 Ländern weltweit, wo-
bei insbesondere die britische Limited viele Gemeinsamkeiten zu der deutschen
GmbH aufweist.
C.
Einflüsse auf die Entwicklung des deutschen Gesellschaftsrechts durch
Europäische Regelungen und Entscheidungen des EuGH
I.
Allgemeines
Das deutsche Gesellschaftsrecht wird seit den letzten Jahrzehnten immer stärker
von europäischen Regelungen beeinflusst. Um die Harmonisierung des europäi-
schen Binnenmarktes und die Durchsetzung des EGV weiter voranzutreiben, erließ
das Europäische Parlament eine Vielzahl von Richtlinien und Verordnungen
18
, die
insbesondere das deutsche Gesellschaftsrecht nachhaltig beeinflusst haben. Hier-
zu zählen im Bereich des Gesellschaftsrechts insbesondere Richtlinien hinsichtlich
der Publizitäts- und Rechnungslegungspflichten.
19
II.
Ausgangslage
Viel entscheidender wurde das deutsche Gesellschaftsrecht aber von den Ent-
scheidungen des EuGH ,,Daily Mail"
20
, ,,Centros"
21
, ,,Überseering"
22
und ,,Inspire
Art"
23
beeinflusst. In den vom EuGH entschiedenen Fällen handelte es sich um
grundlegende Entscheidungen zur Niederlassungsfreiheit i.S.v. Art. 43, 48 EGV.
Diese Vorschriften gewähren jedem Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedstaates
das Recht, sich im Hoheitsgebiet eines der anderen zur Berufsausübung niederzu-
lassen. Insbesondere berechtigen Art. 43, 48 EGV auch zur Gründung von Agentu-
17
Lutter (1992) in FS GmbHG, 49 ff.; Lutter, GmbHR 2005, 1; Westermann (2005), GmbHR
2005, 4.
18
Siehe dazu: Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck (2006), Einl Rn. 7.
19
Z.B. Elfte Richtlinie 89/666/EWG über die Offenlegung von Zweigniederlassungen, die in
einem Mitgliedstaat von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen errichtet wurden, die dem
Recht eines anderen Staates unterliegen (Zweigniederlassungsrichtlinie); Publizitätsrichtlinie
68/151/EWG.
20
EuGH, Rs. 81/87, Urt. v. 27. September 1988, Slg. 1988, 5483.
21
EuGH, Rs. C-212/97, Urt. v. 9. März 1999, Slg. 1999, I-1459.
22
EuGH, Rs. C-208/00, Urt. v. 5. November 2002, Slg. 2002, I-9919.
23
EuGH, Rs. C-167/01, Urt. v. 30. September 2003, Slg. 2003, I-10155.
6
ren, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften, ohne dass Beschränkun-
gen durch die Zuzugsstaaten zulässig sind.
Die EuGH-Entscheidungen
24
standen der in Deutschland vertretenen Ansicht, dass
die Sitztheorie für das Gesellschaftsstatut maßgeblich sei, entgegen.
25
Die von
deutschen Gerichten vertretene Sitztheorie ging davon aus, dass Gesellschaften
den Regelungen des Staates unterliegen, in dem sie ihren Sitz bzw. zu dem sie die
engsten Verbindung haben.
26
Anknüpfungspunkt war daher nicht nicht der Ort, an
dem die Gesellschaft gegründet wurde, sondern der aktuelle Verwaltungssitz, d.h.
der Ort an dem die grundlegenden Entscheidungen für die Gesellschaft getroffen
wurden. Demnach war deutsches Recht nicht mehr anwendbar, wenn eine deut-
sche Gesellschaft ihren Verwaltungs- und bzw. oder ihren Satzungssitz in einen
anderen Mitgliedstaat verlegt. Problematisch war in diesem Zusammenhang auch
der Zuzug von Auslandsgesellschaften. Nach der von deutschen Gerichten vertre-
tenen Sitztheorie konnten diese nach einem Zuzug in Deutschland nicht wirksam
unter Beibehaltung ihrer Rechtspersönlichkeit fortgeführt werden. Die Gesellschaft
verlor bei Verlegung ihres Verwaltungssitzes selbst unter Beibehaltung ihres Sat-
zungssitzes, den Status als Kapitalgesellschaft und wurde zur Personengesell-
schaft umqualifiziert, was insbesondere die persönliche Haftung der Gesellschafter
zur Folge hatte.
27
Insbesondere nach der Entscheidung des EuGH zu Übersee-
ring
28
wurde zumindest für ausländische Gesellschaften die Verlegung ihres Ver-
waltungssitzes nach Deutschland ohne Verlust ihrer Rechtspersönlichkeit möglich.
Das Gegenstück zur Sitztheorie ist die Gründungstheorie. Lt. Gründungstheorie ist
das Recht des Staates anzuwenden, in dem die Gesellschaft gegründet wurde
bzw. wo die Gesellschaft ihren Satzungssitz hat.
29
Ob die Gesellschaft einen vom
Satzungssitz abweichenden Verwaltungssitz hat, ist zur Beurteilung, welchem
Recht die Gesellschaft unterliegt, nicht von Bedeutung.
24
EuGH, Rs. C-212/97, Urt. v. 9. März 1999, Slg. 1999, I-1459, EuGH, Rs. C-208/00, Urt. v.
5. November 2002, Slg. 2002, I-9919, EuGH, Rs. C-167/01, Urt. v. 30. September 2003, Slg.
2003, I-10155.
25
Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck (2006), Einl Rn. 38;
26
Wicke (2008), § 4a Rn. 13.
27
Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck (2006), Einl Rn. 37.
28
EuGH, Rs. C-208/00, Urt. v. 5. November 2002, Slg. 2002, I-9919.
29
Westermann in Scholz (2006), Einleitung Rn. 97.
7
Der EuGH hat in verschiedensten Verfahren indirekt zur Vereinbarkeit von Sitz-
und Gründungstheorie mit der Niederlassungsfreiheit i.S.v. Art. 43, 48 EGV Stel-
lung genommen. Grundsätzlich hat sich der EuGH zwar nicht gegen die in
Deutschland vorherrschende Sitztheorie ausgesprochen. Dennoch führten die Ent-
scheidungen bei dem deutschen Gesetzgeber zu erhöhtem Reformdruck.
III. Entscheidungen des EuGH
Aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung werden die Entscheidungen ,,Daily
Mail", ,,Centros", ,,Überseering" und ,,Inspire Art" nachfolgend kurz dargestellt.
30
1.
Daily Mail
31
Die Daily Mail and General Trust PLC ist eine nach englischem Recht gegründete
AG. Zur Vermeidung britischer Körperschaftsteuer beabsichtigte die Gesellschaft
ihren Sitz vom Vereinigten Königreich in die Niederlande zu verlegen. Für eine
rechtmäßige Sitzverlegung unter Beibehaltung der Rechtspersönlichkeit benötigte
die Daily Mail and General Trust PLC nach britischem Einkommen- und Körper-
schaftsteuergesetz die Zustimmung des Finanzministeriums. Da das Finanzminis-
terium die Zustimmung verweigerte, erhob die Gesellschaft Klage. Begründend
führte sie aus, dass die Zustimmung nicht verweigert werden könne, weil die Rege-
lung gegen Art. 52 und 58 EWGV
32
verstößt.
In seiner Entscheidung vom 27. September 1988 verweigerte auch der EuGH die
Verlegung des Sitzes. Nach Ansicht des EuGH gewähren Art. 52, 58 EWGV keine
Verlegung des Sitzes der Geschäftsleitung in einen anderen Mitgliedstaat, weil dies
aufgrund der Unterschiedlichkeit in den einzelnen Rechtsordnungen der Mitglied-
staaten bilateral geregelt werden muss.
33
30
Gündel/Katzorke (2008), S. 17.
31
EuGH, Rs. 81/87, Urt. vom 27. September 1988, Slg. 1988, 5483.
32
Art. 52 und 58 EWGV entsprechen Art. 43 und 48 EGV.
33
EuGH in NJW 1989, 2186.
8
2.
Centros
34
Bei der Centros Ltd. handelt es sich um eine nach englischem Recht gegründete
Gesellschaft, deren Geschäftstätigkeit vollständig über eine Zweigniederlassung in
Dänemark ausgeübt werden soll. Die Gesellschaft, deren Gesellschafter dänische
Eheleute sind, beantragte die Eintragung der Zweigniederlassung bei der Zentral-
verwaltung für Handel und Gesellschaften (Erhvervsog Selskabsstryrelsen), die
jedoch die Eintragung ablehnte. Die Zentralverwaltung begründete dies zum einen
mit der fehlenden Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich und der Vermutung,
dass die Centros Ltd. unter Umgehung der dänischen gesellschaftsrechtlichen An-
forderungen ihren Hauptsitz in Dänemark errichten will, zum anderen diene die
Ablehnung zum Gläubigerschutz wegen unzureichendem Mindestkapital.
Der EuGH hatte auch in diesem Fall die Vereinbarkeit der Eintragungsablehnung
mit der Niederlassungsfreiheit i.S.v. Art. 52, 58 EWGV zu prüfen. In seiner Ent-
scheidung führte der EuGH aus, dass die Ablehnung der Eintragung als Zweignie-
derlassung nicht mit Art. 52, 58 EWGV vereinbar sei. Es sei unerheblich, ob die
Gesellschaft in ihrem Gründungsstaat Geschäftigkeit ausgeübt hat oder nicht und
ob die Gesellschaft zur Umgehung dänischen Rechts gegründet worden sei.
35
3.
Überseering
36
Die Überseering B.V. war eine nach niederländischem Recht gegründete Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung. Diese Gesellschaft erwarb in Deutschland eine
Immobilie und erteilte einen Renovierungsauftrag an ein Bauunternehmen. Zwei
Deutsche erwarben im weiteren Verlauf die Anteile an der Gesellschaft. Mit diesem
Erwerb verlagerte sich auch die Geschäftsleitung und faktisch der Verwaltungssitz
von den Niederlanden nach Deutschland.
Die Überseering B.V. machte gegenüber dem Bauunternehmen Mängelbeseiti-
gungsansprüche geltend. Problematisch war insofern, dass die in Deutschland ver-
34
EuGH, Rs. C-212/97, Urt. v. 9. März 1999, Slg. 1999, I-1459.
35
EuGH in NJW 1999, 2027, 2028.
36
EuGH in NJW 2002, 3614 ff.
9
tretene Ansicht der Sitztheorie dazu führte, dass die Überseering B.V. nicht mehr
als niederländische Gesellschaft eingestuft, sondern als GbR angesehen wurde.
Dies führte dazu, dass die B.V. zum damaligen Zeitpunkt weder rechts- noch par-
teifähig war.
Die EuGH hatte daher darüber zu entscheiden, ob die vom BGH vertretene Sitz-
theorie gegen das Gebot der Niederlassungsfreiheit verstößt, wonach die B.V. zu
Recht ihre Parteifähigkeit durch die Verlegung des Verwaltungssitzes nach
Deutschland verloren hat.
37
Dies hat der EuGH vor dem Hintergrund der Niederlassungsfreiheit i.S.v. Art. 43,
48 EGV verneint und damit den Übergang zur Gründungstheorie geebnet. Eine in
einem Mitgliedstaat der EU gegründete Gesellschaft ist immer nach dem Recht des
Gründungsstaates zu beurteilen.
38
Den Gesellschaften muss innerhalb des europä-
ischen Binnenmarktes freier Zuzug bzw. Wegzug ermöglicht werden.
4.
Inspire Art
39
Inspire Art Ltd. ist eine in Großbritannien gegründete Gesellschaft. Die Geschäfts-
tätigkeit wird jedoch vollständig über die Zweigniederlassung in Amsterdam (Nie-
derlande) ausgeübt. Eine Geschäftstätigkeit in Großbritannien hat zu keiner Zeit
stattgefunden. Da nach niederländischem Recht an die handelsregisterliche Eintra-
gung einer ausländischen Zweigniederlassung (formal ausländische Gesellschaft)
verschiedenste Voraussetzungen, z.B. persönliche Haftung der Geschäftsführer als
Gesamtschuldner und Beachtung eines bestimmten Mindestkapitals, geknüpft sind,
ergab sich daraus, dass die (niederländischen) Regelungen
40
möglicherweise nicht
mit der Niederlassungsfreiheit in Einklang zu bringen sind.
37
Troberg/Tiedje in von der Groeben/Schwarze (2003), Art. 48 Rn. 32.
38
Koch, JuS 2004, 755.
39
EuGH in NJW 2003, 3331.
40
Bei den Regelungen handelt es sich um das Gesetz über formal ausländische Gesellschaften
v. 17. Dezember 1997 und gilt für ausländische Gesellschaften, die in den Niederlanden ihre
Geschäftstätigkeit ausüben wollen und denen der niederländische Gesetzgeber bestimmte na-
tionale Regelungen aufzwingen wollte.
10
Der EuGH verwies in seiner Entscheidung auf die bereits aus dem Jahr 1989
stammende Zweigniederlassungsrichtlinie.
41
Demnach sind Mitgliedstaaten nicht
berechtigt, für Zweigniederlassungen von Gesellschaften anderer europäischer
Mitgliedstaaten weitreichendere Publizitätspflichten vorzusehen.
42
Die Elfte Richtli-
nie zur Harmonisierung der Offenlegung von Niederlassungen ist laut EuGH als
abschließend anzusehen. Ziel der (EG)Vertragsvorschriften über die Niederlas-
sungsfreiheit (Art. 43, 48 EGV) sei die Möglichkeit, Gesellschaften, die nach dem
Recht eines anderen Mitgliedstaates errichtet worden sind, ebenfalls die Betätigung
über Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften in einem ande-
ren Mitgliedstaat zu ermöglichen. Die Beschränkung der Niederlassungsfreiheit
durch niederländische Bestimmungen über Mindestkapital sei kein Rechtferti-
gungsgrund für eine Nichteintragung der britischen Gesellschaft im Handelsregister
für Amsterdam. Einziger legitimer Grund, die Ablehnung der Eintragung im Han-
delsregister zu rechtfertigen, wäre nach Ansicht des EuGH der Missbrauch, d.h.
sich in missbräuchlicher Weise nationalem Recht zu entziehen, allerdings nur, so-
fern dies im Einzelfall auch nachgewiesen werden kann.
43
IV. Folge auf die deutsche Praxis und Umsetzung im MoMiG
Obwohl der EuGH bekanntermaßen mehrfach i.S.d. Gründungstheorie entschieden
hat, hat dieser nicht gänzlich die Vereinbarkeit der Sitztheorie mit der Niederlas-
sungsfreiheit verneint. Der BGH hielt daher weiterhin an der Sitztheorie fest.
44
Le-
diglich nach der Entscheidung i.S. Überseering musste der BGH dem EuGH fol-
gen.
45
Somit galt in Deutschland weiterhin § 4a Abs. 2 GmbHG a.F. Dieser schrieb vor,
dass sich der Sitz dort zu befinden hat, wo die Gesellschaft einen Betrieb hat oder
wo sich die Geschäftsleitung oder die Verwaltung befinden. Dies führte regelmäßig
41
Elfte Richtlinie über die Offenlegung von Zweigniederlassungen, die in einem Mitgliedstaat
von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen errichtet wurden, die dem Recht eines anderen
Staates unterliegen (Zweigniederlassungsrichtlinie) v. 21. Dezember 1989 (89/666/EWG),
Amtsblatt Nr. L 395 v. 30. Dezember 1989, S. 0036 - 003
9
42
Burkert/Elser (2004), S. 274 f.; EuGH, Rs. C-167/01, Urt. v. 30. September 2003, Slg. 2003, I-
10155.
43
EuGH in GmbHR 2003, 1260 ff.; Wachter, GmbHR 2004, 88, 90.
44
Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck (2006), Einl Rn. 37 m.w.N.
45
BGH in NJW 2003, 1461.
11
dazu, dass eine grenzüberschreitende Sitzverlegung nicht in Frage kam, weil der
deutsche Gesetzgeber davon ausging, dass sich sowohl Satzungs- als auch Ver-
waltungssitz in Deutschland befinden. Ein Gesellschafterbeschluss über die Sitz-
verlegung ins Ausland wurde von deutschen Gerichten als Auflösungsbeschluss
behandelt, der letztendlich die Löschung der Gesellschaft zur Folge hatte.
46
Andererseits ermöglichten die EuGH-Entscheidungen den Zuzug von Auslandsge-
sellschaften unter Beibehaltung ihrer Rechtspersönlichkeit nach Deutschland. Vor
allem die englische Limited konnte von dieser Entwicklung profitieren. Die Zahl der
Eintragungen von Zweigniederlassungen ist nach den Urteilen i.S. Überseering und
Inspire Art in außerordentlichem Maße angestiegen.
47
Deutsche Unternehmens-
gründer nahmen die Entscheidungen zum Anlass, bevorzugt englische Limited-
Gesellschaften zu gründen und sich gegen die Gründung einer GmbH zu entschei-
den.
Der deutsche Gesetzgeber sah sich daher gezwungen, dieser Entwicklung entge-
genzuwirken. An den sehr strengen Vorgaben des GmbHG, insbesondere zur Ka-
pitalaufbringung und Kapitalerhaltung oder zur Sitztheorie, konnte der deutsche
Gesetzgeber nicht mehr ohne Weiteres festhalten.
Zur Umsetzung weitreichender Änderungen, die vor allem der Anpassung an die
EuGH-Rechtsprechung und zur Steigerung der Attraktivität der GmbH als Gesell-
schaftsform im europäischen Wettbewerb dienen, ist am 1. November 2008 das
MoMiG in Kraft getreten. Erste Versuche das GmbHG an die EuGH-Entscheidung
i.S. Inspire Art anzupassen, hatte es bereits in den Jahren 2004 und 2005 gege-
ben. Diese waren jedoch aufgrund der bevorstehenden Bundestagswahlen ge-
scheitert.
48
46
Zur Sitztheorie: Emmerich in Scholz (2006), § 4a Rn. 7; BayObLG in ZIP 1992, 842.
47
Westhoff, GmbHR 2007, 474, 478.
48
Zur Entwicklung des GmbHG und MoMiG auch: Gündel/Katzorke (2008), S. 16 ff.
12
D.
Der Vergleich von GmbH, UG und Limited
I.
Gesetzliche Normierung
1.
GmbH
Regelungen zur GmbH finden sich im GmbHG
49
sowie im Handelsgesetzbuch
(HGB)
50
(z.B. Regelungen zur Firmenbildung [§§ 17 ff. HGB] oder Bilanzierung
[§§ 238 ff. HGB]) und dem Umwandlungsgesetz (UmwG) (z.B. § 3 UmwG GmbH
kann als übernehmender, übertragender oder neuer Rechtsträger bei der Ver-
schmelzung fungieren) und mit dem Inkrafttreten des MoMiG auch in der InsO (z.B.
§ 15 Abs. 1 S. 2 InsO Regelung zum Insolvenzantragsrecht durch die Gesell-
schafter bei Führungslosigkeit der GmbH oder § 15a InsO zur Insolvenzantrags-
pflicht).
51
Des Weiteren gelten für die GmbH die Regelungen des BGB.
52
Die Vor-
schriften finden immer dann Anwendung, wenn im GmbHG oder HGB keine Spezi-
alvorschriften vorhanden sind.
Die für diese Arbeit maßgeblichen Punkte sind in nachfolgenden Abschnitten des
GmbHG geregelt: Vorschriften über die Errichtung der Gesellschaft (einschl. Rege-
lungen zu Form und Inhalt des Gesellschaftsvertrages) sind in Abschnitt 1 des
GmbHG verankert. In Abschnitt 3 des GmbHG ist neben der organschaftlichen Ver-
tretung auch die Gesellschafterliste kodifiziert. Des Weiteren finden sich in Ab-
schnitt 5 Regelungen zur Auflösung und Nichtigkeit der Gesellschaft.
2.
UG
Die UG trat erstmals mit dem Inkrafttreten des MoMiG am 1. November 2008 in
Erscheinung. Explizit geregelt ist die UG bislang nur in § 5a. § 5a enthält Sonder-
regelungen bzgl. der Höhe des Stammkapitals, der Firmierung der UG (§ 5a Abs.
1), des Verbots von Sacheinlagen (§ 5a Abs. 2 S. 2), die Rücklageverpflichtung
49
RGBl. 1892, 477 v. 20. April 1892.
50
HGB in der Fassung des Bilanzrichtliniengesetzes v. 19. Dezember 1985 (BGBl. I, 2355).
51
Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck (2006), Einl Rn. 33.
52
Z.B. Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck (2006) Einl Rn. 35.
13
(§ 5a Abs. 3 S. 1) sowie die Verpflichtung zur Einberufung einer Gesellschafterver-
sammlung im Falle einer drohenden Insolvenz (§ 5a Abs. 4).
Weitergehende Spezialvorschriften neben dem § 5a sind für die UG gesetzlich bis-
lang nicht vorgesehen.
3.
Limited
Untypisch für das englische Common Law ist das englische Gesellschaftsrecht
durch eine hohe Regelungsdichte geprägt. Von großer Bedeutung für dessen
rechtliche Ausgestaltung sind neben der Rechtsprechung die Vorschriften des
Companies Act 1985. Dieser enthält Regelungen zur company limited by shares,
company limited by guarantee und unlimited company.
53
Ergänzt und geändert
wurden diese Regelungen vor allem durch den Companies Act 2006.
54
Für die Li-
mited sind zudem die Regelungen des Company Directors Disqualification Act
1986, des Insolvency Acts 1986, 1994 und 2000 sowie des Business Names Act
1985 und des Company and Business Regulations 1981 von Bedeutung.
55
Der CA 1985 bzw. deren ergänzte und geänderte Fassung, der CA 2006, enthält
u.a. Vorschriften zur Gründung der Limited (Part 2. Company Formation), zum Ge-
sellschaftsvertrag (Part 3. Chapter 2. Articles of Association), zur Firmierung (Part
5. Company's Name; Part 41. Business Names), zum Sitz der Gesellschaft (Part 6.
A Company's Registered Office), zu den Organen der Gesellschaft (Part 8. A Com-
pany's Member Gesellschafter, Part 10. Company's Directors Geschäftsführer),
zur Bilanzierung (Part 15. Accounts and Reports) und zum Stammkapital (Part 17.
A Company's Share Capital).
Für die Firmenbildung der Limited sind neben dem CA 2006 die Regelungen des
Business Names Act 1985 anzuwenden.
53
Heinz (2006), § 1 Rn. 1f.
54
Vollständiger Texte der CA 1985, CA 1989 und CA 2006 unter: www.statutelaw.gov.uk und
www.opsi.gov.uk/acts.
55
Sämtliche englischen Gesetzestexte sind abrufbar unter www.statutelaw.gov.uk.
14
Regelungen hinsichtlich der Eignung einer Person als Geschäftsführer (Director)
einer Limited finden sich im CDDA 1986. Beispielsweise kann eine Person von der
Tätigkeit als Director ausgeschlossen werden, wenn diese an der Insolvenz einer
Gesellschaft beteiligt war, Sec. 6 (1) CDDA 1986.
Im IA 1986 sind in Part IV. insolvenzrechtliche Regelung zu Gesellschaften i.S. des
CA kodifiziert, die nur bei der Insolvenz in England oder im Falle einer Sekundärin-
solvenz anwendbar sind.
56
4.
Ergebnis
Die GmbH ist größtenteils im GmbHG regelt. Die UG und ihre Ausnahmeregelun-
gen sind lediglich in § 5a kodifiziert. Im Übrigen gelten die Vorschriften des GmbHG
unmittelbar für die UG.
57
Ob dies zukünftig ausreichend sein wird, bleibt allerdings
abzuwarten. Es wird sich wohl erst im Rahmen der Rechtsfortbildung zeigen, ob
der Gesetzgeber weitere Regelungen zur UG gesetzlich verankern muss.
Das GmbHG weist im Verhältnis zum CA 2006 jedoch eine wesentlich geringere
Regelungsdichte auf. Mit 1.300 Einzelvorschriften übertrifft der CA das GmbHG mit
nur 85 Einzelregelungen bei weitem. Dies überrascht, da das englische Recht den
Ruf hat, sehr liberal zu sein. Grundsätzlich überlässt der englische Gesetzgeber
bevorzugt den Beteiligten die Ausgestaltung von Verträgen o.ä. anstatt einen star-
ren gesetzlichen Rahmen vorzugeben.
Sowohl im GmbHG als auch im CA 2006 werden die grundlegenden gesellschafts-
rechtlichen Merkmale wie z.B. Gesellschafterorgane, Gründungsvorgang, Ge-
schäftsanteile der Gesellschaft geregelt. Davon ausgenommen sind das Mindest-
stammkapital und die Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen.
Während der deutsche Gesetzgeber dies als Wesensmerkmale der GmbH bzw.
UG gesetzlich verankert hat, überlässt der englische Gesetzgeber die entspre-
chenden Regelungen den Gesellschaftern der Limited.
56
Volb (2007), Rn. 574.
57
Wicke (2008), § 5a Rn. 2.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836642606
- DOI
- 10.3239/9783836642606
- Dateigröße
- 652 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule – Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht
- Erscheinungsdatum
- 2010 (Februar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- gmbh momig gesellschaftsform unternehmer limited
- Produktsicherheit
- Diplom.de