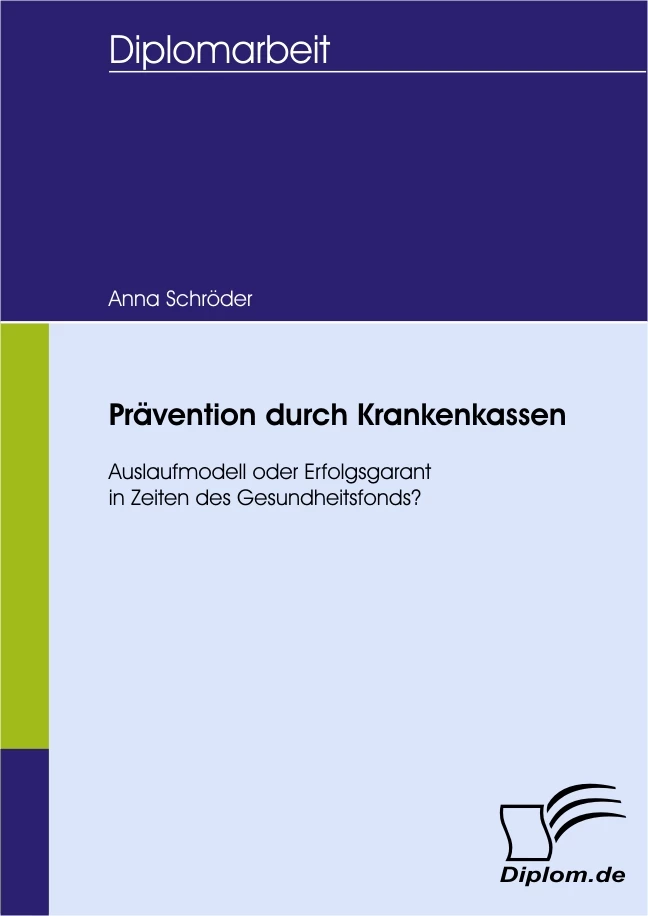Prävention durch Krankenkassen
Auslaufmodell oder Erfolgsgarant in Zeiten des Gesundheitsfonds?
Zusammenfassung
Gesundheitsförderung und Prävention gewinnen aufgrund der steigenden Prävalenz von chronischen Krankheiten in Deutschland zunehmend an Relevanz. Gesetzliche Krankenkassen haben neben ihrem vorrangigen sozialen Auftrag voller Versicherungsschutz im Krankheitsfall die gesetzliche Sollvorschrift ihre Versicherten durch Prävention bei der Förderung ihrer Gesundheit zu unterstützen. Für die Umsetzung dieser Vorschrift wurde ein Leitfaden entwickelt, der für alle Krankenkassen Deutschlands bindend ist. In der Vergangenheit investierten Krankenkassen zunehmend in primärpräventive Maßnahmen. Seit dem Jahr 2005 überstieg das tatsächliche Investitionsvolumen in diesem Bereich den gesetzlichen Richtwert erstmals. In den darauf folgenden Jahren wurde weit mehr Geld in Prävention investiert als gesetzlich vorgesehen.
Ziel der Krankenkassen war es bei diesen Maßnahmen unter anderem möglichst viele gesunde Versicherte zu erhalten, für die entsprechend geringe (Behandlungs-)Kosten entstehen. Außerdem wurden Präventionsmaßnahmen zu Zwecken des Marketings und der Imageverbesserung gezielt eingesetzt.
Die Einnahmen einer Krankenkasse bestanden bis Ende des Jahres 2008 aus dem kassenindividuellen Beitragssatz und den Zuweisungen aus bzw. den Einzahlungen in den Risikostrukturausgleich. Durch den individuellen Beitragssatz waren Krankenkassen bei der Gestaltung ihre Einnahmen gewissermaßen autonom, wobei ein niedriger Beitragssatz ein Haupt-Profilierungsmerkmal am Markt darstellte.
Mit der Einführung des Gesundheitsfonds zum 1. Januar 2009 wurde zum einen der einheitliche Beitragssatz von 15,5% aller gesetzlichen Krankenkassen Deutschland festgelegt. Durch diese Festlegung verlieren Krankenkassen einerseits ihre Finanzautonomie und andererseits eines ihrer wichtigsten Profilierungsmerkmale am Markt. Zum anderen wurde der Risikostrukturausgleich morbiditätsorientiert gestaltet. Ein erheblicher Anteil der finanziellen Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds an Krankenkassen orientiert sich dementsprechend an der Morbidität der Versicherten. Für 80 chronische und kostenintensive Erkrankungen erhalten Krankenkassen Morbiditätszuweisungen. Die Höhe dieser Zuweisungen hängt von den durchschnittlichen prospektiven Behandlungskosten der jeweiligen Erkrankung ab. Damit die Krankheiten solche Zuweisungen auslösen, müssen die Diagnosen bestimmte vom Bundesversicherungsamt festgelegte Kriterien erfüllen.
Durch den einheitlichen Beitragssatz entfällt […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
1. Prävention und Krankenkassen
1.1. Unterscheidung von Präventionsarten
1.2. Gesetzliche Möglichkeiten zur Prävention und Nutzung durch die Krankenkassen
1.3. Präventionsangebote der Krankenkassen
1.4. Bewertung
2. Der Gesundheitsfonds
2.1. Die morbiditätsorientierte Finanzierung der Krankenkassen im Gesundheitsfonds
2.1.1. Die Ausgleichsfaktoren im Morbi-RSA
2.1.2. Untergliederung der Krankheiten in Morbiditätsgruppen
2.1.3. Zuschlagshöhe und prospektiver Ansatz
2.1.4. Durchführung des Morbiditätsrisikostrukturausgleichs
2.1.5. Erhebung eines Zusatzbeitrag und Ausschüttung von Prämien
2.2. Bewertungen und Wirkungen des Gesundheitsfonds
2.2.1. Bewertung aus Sicht der Krankenkassen
2.2.2. Gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Wirkungen
2.2.3. Unerwünschte Wirkungsweisen des Gesundheitsfonds
2.3. Fazit zum Gesundheitsfonds
3. Hypertonie im Gesundheitsfonds
3.1. Das Krankheitsbild
3.2. Entstehung und Ursachen von Hypertonie
3.3. Prävalenz
3.4. Die Begleit- und Folgeerkrankungen
3.5. Therapie
3.5.1. Nicht-medikamentöse Therapie
3.5.2. Medikamentöse Therapie
3.6. Prävention von Hypertonie
3.7. Kosten
3.7.1. Direkte Kosten
3.7.2. Indirekte Kosten
4. Die untersuchte Betriebskrankenkasse
4.1. Hintergründe von Betriebskrankenkassen
4.2. Struktur und Unternehmensstrategie der untersuchten BKK
4.2.1. Die Präventionsstrategie der untersuchten Betriebskrankenkasse
4.2.2. Die Versichertenstruktur
4.3. Auswirkungen des Gesundheitsfonds auf die untersuchte BKK
4.4. Handlungsoptionen der untersuchten Betriebskrankenkasse hinsichtlich künftiger Präventionsstrategien vor dem Hintergrund des Morbi-RSA - am Bsp. Hypertonie
5. Sekundärdatenanalyse mit Routinedaten der untersuchten BKK
5.1. Prävalenz der Hypertonie in der BKK
5.2. Zuweisungen und Kosten von HMG-Hypertonikern
5.2.1. Durchschnittliche Zuweisungen für valide Fälle im Morbi-RSA
5.2.2. Leistungsausgaben für HMG-Hypertoniker
5.2.3. Fazit der Berechnung der Zuweisungen und Leistungsausgaben
5.3. Inanspruchnahme von Präventionskursen
5.4. Gruppenvergleich nach Inanspruchnahme von Präventionsmaßnahmen bzw. Verordnung von blutdrucksenkenden Medikamenten
5.4.1. Bildung der Gruppen
5.4.2. Beschreibung der Gruppen
5.4.3. Interpretation der Ergebnisse Gruppenbeschreibung - Gruppengröße
5.5. Beschreibung der Folgekosten und der Verordnung von Antihypertonika im Jahr 2008 in Abhängigkeit von der Inanspruchnahme von Präventionskursen bzw. Antihypertonika im Jahr 2007
5.5.1. Beschreibung der Ergebnisse
5.5.2. Interpretation der Ergebnisse
6. Fazit
6.1. Zusammenfassung der Ergebnisse
6.1. Handlungsempfehlungen an die Betriebskrankenkasse
Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Investitionsvolumen in Prävention durch Krankenkassen
Abbildung 2: Die neue Gesundheitsversicherung
Abbildung 3: Berechnung der Zuweisungen
Abbildung 4: Hierarchisierung am Beispiel der Herz-Kreislauf-Morbiditätsgruppen
Abbildung 5: Handlungsablauf des Morbiditäts-Risikostrukturausgleichs
Abbildung 6: Entwicklung des allgemeinen Beitragssatzes der gesetzlichen Krankenversicherung
Abbildung 7: Entstehung der Hypertonie
Abbildung 8: Prävalenz der Hypertonie (in %) nach Altersgruppen und Geschlecht
Abbildung 9: Betriebskrankenkassen im doppelten Beziehungsgeflecht
Abbildung 11: Versichertenstruktur der Betriebskrankenkasse
Abbildung 12: Verteilung nach Alter und Geschlecht (im Jahr 2007)
Abbildung 13: ICD- Hypertonie Prävalenz in der BKK (2004-2007)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Handlungsfelder und Präventionsprinzipien
Tabelle 2: Definition und Klassifikation von Blutdruckbereichen in Anlehnung an die Empfehlung der WHO und ISH von 1999
Tabelle 3: ICD-10-Diagnoseschlüsselung der essentiellen (primären) Hypertonie
Tabelle 4: Zuweisungen und Leistungsausgaben für das Diagnosejahr 2007; Kostenjahr 2007
Tabelle 5: Zuweisungen und Leistungsausgaben für das Diagnosejahr 2006; Kostenjahr 2007
Tabelle 6: Gruppenbildung der ICD-Hypertoniker
Tabelle 7: Beschreibung der Gruppen
Tabelle 8: Folgekosten der Gruppen im Jahr 2008
Hinweis im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie z.B. Teilnehmer/Innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einleitung
Gesundheitsförderung und Prävention gewinnen aufgrund der steigenden Prävalenz von chronischen Krankheiten in Deutschland zunehmend an Relevanz. Gesetzliche Krankenkassen haben neben ihrem vorrangigen sozialen Auftrag – voller Versicherungsschutz im Krankheitsfall – die gesetzliche Sollvorschrift ihre Versicherten durch Prävention bei der Förderung ihrer Gesundheit zu unterstützen. Für die Umsetzung dieser Vorschrift wurde ein Leitfaden entwickelt, der für alle Krankenkassen Deutschlands bindend ist. In der Vergangenheit investierten Krankenkassen zunehmend in primärpräventive Maßnahmen. Seit dem Jahr 2005 überstieg das tatsächliche Investitionsvolumen in diesem Bereich den gesetzlichen Richtwert erstmals. In den darauf folgenden Jahren wurde weit mehr Geld in Prävention investiert als gesetzlich vorgesehen.
Ziel der Krankenkassen war es bei diesen Maßnahmen unter anderem möglichst viele gesunde Versicherte zu erhalten, für die entsprechend geringe (Behandlungs-)Kosten entstehen. Außerdem wurden Präventionsmaßnahmen zu Zwecken des Marketings und der Imageverbesserung gezielt eingesetzt.
Die Einnahmen einer Krankenkasse bestanden bis Ende des Jahres 2008 aus dem kassenindividuellen Beitragssatz und den Zuweisungen aus bzw. den Einzahlungen in den Risikostrukturausgleich. Durch den individuellen Beitragssatz waren Krankenkassen bei der Gestaltung ihre Einnahmen gewissermaßen autonom, wobei ein niedriger Beitragssatz ein Haupt-Profilierungsmerkmal am Markt darstellte.
Mit der Einführung des Gesundheitsfonds zum 1. Januar 2009 wurde zum einen der einheitliche Beitragssatz von 15,5% aller gesetzlichen Krankenkassen Deutschland festgelegt. Durch diese Festlegung verlieren Krankenkassen einerseits ihre Finanzautonomie und andererseits eines ihrer wichtigsten Profilierungsmerkmale am Markt. Zum anderen wurde der Risikostrukturausgleich morbiditätsorientiert gestaltet. Ein erheblicher Anteil der finanziellen Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds an Krankenkassen orientiert sich dementsprechend an der Morbidität der Versicherten. Für 80 chronische und kostenintensive Erkrankungen erhalten Krankenkassen Morbiditätszuweisungen. Die Höhe dieser Zuweisungen hängt von den durchschnittlichen prospektiven Behandlungskosten der jeweiligen Erkrankung ab. Damit die Krankheiten solche Zuweisungen auslösen, müssen die Diagnosen bestimmte vom Bundesversicherungsamt festgelegte Kriterien erfüllen.
Durch den einheitlichen Beitragssatz entfällt eines der ehemals wichtigstes Profilierungsmerkmale der Krankenkassen. Sie sollen sich künftig nahezu ausschließlich über optimale Versorgungsprogramme und attraktive Zusatzleistungen am Markt behaupten.
Der Morbi-RSA stellt eine Weiterentwicklung des bisherigen Risikostrukturausgleichs dar, welcher zu wenig zielgenau bei der Verhinderung einer Risikoselektion der Versicherten aufgrund ihrer Erkrankung durch Krankenkassen war. Mit der Orientierung der finanziellen Zuweisungen an der Morbidität der Versicherten geht jedoch die Problematik einher, dass Krankenkassen Zuweisungen für die Krankheit – nicht aber für die Förderung und den Erhalt der Gesundheit der Versicherten erhalten. Krankenkassen sehen sich daher vor der wirtschaftlichen Entscheidung weiter in Präventionsmaßnahmen zu investieren oder diese drastisch zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Fragestellung: „Prävention durch Krankenkassen. Auslaufmodell oder Erfolgsgarant in Zeiten des Gesundheitsfonds?“
Die essentielle Hypertonie (auch als Bluthochdruck bekannt) zählt zu jenen 80 chronischen und kostenintensiven Krankheiten, für die Morbiditäts-Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds fließen. Gleichzeitig gehört sie zu den häufigsten Erkrankungen der Industrienationen, ist ursächlich für ein enormes Kostenvolumen in der Gesundheitsversorgung und war im Jahr 2006 für den Verlust von 27.000 Erwerbstätigkeitsjahren verantwortlich (Statistisches Bundesamt 2009). Aufgrund ihrer hohen Prävalenz wird sie als Volkskrankheit bezeichnet. Die essentielle Hypertonie ist zudem als vorherrschender Risikofaktor für schwerwiegende Folgeerkrankungen bekannt. Dennoch lässt sich ihr durch simple Maßnahmen präventiv entgegenwirken bzw. ihr Schweregrad verbessern. Sie stellt somit ein typisches Beispiel für die Krankheiten dar, die es bisher durch Präventionsangebote der Krankenkassen zu bekämpfen galt.
Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Betriebskrankenkasse (BKK) verfügt über eine verhältnismäßig junge und gesunde Versichertenstruktur und erhält entsprechend verhältnismäßig geringe Zuweisungen nach Morbidität. Sie gehört außerdem zu jenen Krankenkassen, die in der Vergangenheit weitaus mehr Geld in Präventionsmaßnahmen investierten, als es die gesetzliche Sollvorschrift vorsah. In ihrer Präventionsstrategie verfolgt sie ein umfassendes Konzept, wobei sie sich vornehmlich auf die Bereiche der betrieblichen Gesundheitsförderung und den individuellen Ansatz von Prävention konzentriert. Vor dem Hintergrund der Einführung des Gesundheitsfonds mit seinem Morbi-RSA stellt sich die Frage nach einem Wechsel der Präventionsstrategie. Denkbar wären verschiedenste Handlungsoptionen wie eine drastische Reduzierung des Investitionsvolumens in Prävention einerseits oder eine Intensivierung der präventiven Maßnahmen andererseits.
Am Beispiel der Hypertonie wird zum einen analysiert, ob die Erkrankung eines Versicherten aufgrund der Morbiditäts-Zuweisungen für die Betriebskrankenkasse finanziell „lohnenswert“ ist. Zum anderen wird die in Inanspruchnahme von Präventionsangeboten sowie die Höhe der Versorgungskosten im Folgejahr in Abhängigkeit von der Inanspruchnahme von Präventionsmaßnahmen im Diagnosejahr untersucht.
Anhand dieser Auswertungsdaten erfolgt eine Hanglungsempfehlung an die Betriebskrankenkasse für ihre künftige Präventionsstrategie.
1. Prävention und Krankenkassen
Prävention zielt auf die Verringerung von vermeidbaren Krankheiten, Behinderungen und vorzeitigem Tod ab. Sie betont somit den verhütenden Aspekt.[1] Da die Anzahl der Personen mit einer chronischen Erkrankungen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zunahm[2] und auch weiterhin mit einem Anstieg zu rechnen ist[3], gewinnt Prävention an Relevanz. Die Zunahme der Prävalenz wird auf die sich verändernden Lebensbedingungen der Gesellschaft zurückgeführt. Das physische und soziale Umfeld sind für die Manifestation einer Erkrankung genauso ausschlaggebend wie die individuelle Lebensführung.[4] Chronische Erkrankungen wie Herz-Kreislauferkrankungen gehören schon jetzt zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland.[5]
Prävention wurde lange Zeit auf die individuumszentrierten Krankheitsheilung reduziert. Mit der Ottawa-Charta, dem Ergebnis der ersten internationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wurde 1986 ein Paradigmenwechsel hin zur ressourcenorientierten Gesundheitsförderung eingeleitet.[6] Einher ging eine neue Definition des Begriffs der Gesundheitsförderung: „Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen.“[7]
Krankenkassen sind im Hinblick auf Prävention besonders gefordert. Das gesetzlich vorgegebene Ziel der Prävention durch Krankenkassen soll es sein, „die Eigenverantwortung der Bevölkerung zu steigern, Frühverrentung zu vermeiden und die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter zu erhalten und zu stärken“[8] sowie „den allgemeinen Gesundheitszustand (zu) verbessern und insbesondere einen Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen (zu) erbringen“.[9]
Für das Investitionsvolumen für präventive Maßnahmen ist ein gesetzlicher Richtwert von 2,82€ pro Versichertem im Jahr 2009 vorgegeben.[10]
1.1. Unterscheidung von Präventionsarten
In der medizinischen Wissenschaft werden drei Arten der Prävention unterschieden, die Primär-, die Sekundär- und die Tertiärprävention. Die primäre Prävention versucht, gesundheitliches Fehlverhalten und somit Risikofaktoren für eine körperliche Schädigung zu unterbinden. Sie setzt ein, bevor eine Krankheit auftritt und wird daher auch als Gesundheitsförderung bezeichnet. Es wird hierbei zwischen zwei Konzepten unterschieden: Der Bevölkerungsstrategie und der Individual- bzw. Hochrisiko-Strategie. Die Bevölkerungsstrategie strebt darauf hin, das Gesundheitsverhalten der gesamten Bevölkerung positiv zu beeinflussen. Dies kann beispielsweise durch Umstellung der Ernährungsgewohnheiten, regelmäßige Bewegung und dem Verzicht auf Nikotin und dem mäßigen Konsum von Alkohol erzielt werden. Zur Erreichung dieses Ziels sind nicht nur alle im Gesundheitswesen tätigen Menschen, sondern auch Lehrer, die Mitarbeiter der Medien, der Behörden, der Sportvereine usw. in der Verantwortung. Die Primärprävention in der Bevölkerungsstrategie ist daher als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu betrachten.[11] Die Individual- bzw. Hochrisiko-Strategie der Primärprävention soll hingegen gefährdete Einzelpersonen erkennen und diesen auf das jeweilige persönliche Risikoprofil abgestimmte – gegebenenfalls auch medikamentöse – Behandlungen zuführen.[12]
Beiden Konzepten der Primärprävention liegt zu Grunde, dass die Maßnahmen nicht für die (gefährdeten) Personen erfolgen, sondern, dass sie mit ihnen gemeinsam geschehen. Ziel muss es immer sein die Eigeninitiative der Personen zu fördern. Denn erkennt der Einzelne nicht, wie er seine Gesundheit durch seine Lebensweise beeinflussen kann, so ist davon auszugehen, dass nach Beendigung der Maßnahme die alten Lebensgewohnheiten wieder eingenommen werden. Der Erfolg von Präventionsangeboten hängt also immer von der Einsicht des Einzelnen ab. Bei der Durchführung der Maßnahme muss besonders auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer eingegangen werden, denn beschwerdefreie Menschen sind schwerer zur Änderung einer gesundheitsbeeinträchtigenden Lebensweise zu motivieren.[13]
Ist eine Erkrankung oder Beeinträchtigung bereits vorhanden, zielt die sekundäre Prävention auf eine Verhinderung der Chronifizierung bzw. des Wiedereintritts des Krankheitsereignisses ab. Man spricht bei der sekundären Prävention daher auch von Früherkennung.[14]
Die tertiäre Prävention beschreibt die Behandlung einer symptomatisch gewordenen Erkrankung, u.a. durch kurative und rehabilitative Maßnahmen.[15]
Häufig eignen sich Maßnahmen der Primärprävention auch für die Sekundär- und Tertiärprävention. Dabei ist die Motivation der betroffenen Personen zur Teilnahme an den Maßnahmen in der Sekundär- und Tertiärprävention meist höher als bei der Primärprävention. Der Zusammenhang zwischen der persönlich erlebten gesundheitlichen Beeinträchtigung und der Lebensführung scheint den Patienten offensichtlicher zu sein.[16]
Des Weiteren wird zwischen der Verhaltens- und der Verhältnisprävention unterschieden. Die Verhaltensprävention hat die Veränderung von gesundheitsgefährdenden Gewohnheiten und Lebensstilen zum Ziel. Der Verhältnisprävention liegt hingegen eine Strategie der Kontrolle, Verminderung und Beseitigung von Gesundheitsrisiken in der Umwelt und den Lebens- bzw. Arbeitsbedingungen zu Grunde.[17]
1.2. Gesetzliche Möglichkeiten zur Prävention und Nutzung durch die Krankenkassen
Maßnahmen zur Primärprävention sind in der Satzung von Krankenkassen gemäß des § 20 des Fünften Sozialgesetzbuches (SGB V) eine gesetzliche Sollvorschrift.[18] Für das Jahr 2006 war hierfür ein Richtwert von 2,74€ pro Versichertem für die Umsetzung von präventiven Maßnahmen festgelegt.[19] * Dieser Wert wurde in den Folgejahren entsprechend der prozentualen Veränderung der monatlichen Bezugsgröße (nach § 18 Abs. 1 SGB IV) angepasst und beträgt 2,82€ pro Versichertem im Jahr 2009.
Entgegen dem medizinischen Verständnis von Prävention gehören aus Sicht der Krankenkassen alle Präventionsmaßnahmen, die nicht ärztlich verordnet wurden und somit von Versicherten freiwillig in Anspruch genommen werden, zur Primärprävention.[20]
Die Leistungen von Präventionsmaßnahmen durch Krankenkassen lassen sich nach drei Ansätzen differenzieren: dem Setting-Ansatz, dem individuellen Ansatz und der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF), wobei die BGF zwangsläufig auch in Settings – den Betrieben – erfolgt.[21]
Krankenkassen legten ihren Fokus zunehmend auf Primärprävention und Gesundheitsförderung anstatt nur bereits vorhandene Schädigungen oder Krankheiten kostenintensiv zu behandeln.[22]
Jedoch sollten sie laut Schillinger (2009) sich hierauf nicht ausschließlich konzentrieren, da „die Sekundär- und Tertiärprävention völlig zu Recht an Bedeutung gewonnen (haben), gerade durch die neuen Versorgungsformen“. Hierzu gehören z.B. die Disease-Management-Programme (DMP), deren strukturiertes Behandlungsprogramm nachweislich den Gesundheitszustand der betroffenen Personen verbessert bzw. aufrecht erhält.[23]
In den vergangenen Jahren investierten Krankenkassen zunehmend in Primärprävention. Während sie im Jahr 2001 noch weniger als 70 Mio. €[24] für Gesundheitsförderung ausgaben, waren es sechs Jahre später – im Jahr 2007 – bereits fast 300 Mio. €.[25] Das entspricht etwa 4,25 € pro Versichertem. Das im § 20 SGB V gesetzlich geregelte Ausgabensoll von 2,74 € wurden somit deutlich überschritten.[26]
Abbildung 1: Investitionsvolumen in Prävention durch Krankenkassen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: AOK-Mediendienst; psg Thema, Ausgabe 07; Berlin 2008; S. 16
1.3. Präventionsangebote der Krankenkassen
Um die Qualität der Prävention durch Krankenkassen sicherzustellen, hat die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Krankenkassen eine Leitlinie zu primären Präventionsaktivitäten und zur betrieblichen Gesundheitsförderung formuliert. Der „Leitfaden Prävention. Gemeinsame und einheitliche Handlungsfelder und Kriterien der Spitzenverbände der Krankenkasse zur Umsetzung von § 20 und 20a SGB V vom 21. Juli 2000 in der Fassung vom 2. Juni 2008“ definiert klare Präventionsziele und ist für alle Krankenkassen Deutschlands bindend. Die Reduktion von Krankheiten des Kreislaufsystems – und somit auch von Hypertonie – wurde für die Jahre 2008 und 2009 als Oberziel für die Maßnahmen nach dem Setting-Ansatz bestimmt. Diesen Krankheiten wird in Hinsicht auf Mortalität, Morbidität und Kosten die größte Bedeutung zugemessen.[27]
Krankenkassen können die Leistungen zur Prävention und betrieblichen Gesundheitsförderung selbst erbringen oder geeignete Dritte damit beauftragen.[28] Präventive Maßnahmen dürfen lediglich zu Lasten der Krankenkasse durchgeführt werden, wenn sie bestimmte Präventions-prinzipien erfüllen. Die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Krankenkassen hat hierzu Handlungsfelder für Primärprävention und betriebliche Gesundheitsförderung definiert.[29]
Tabelle 1: Handlungsfelder und Präventionsprinzipien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Krankenkassen (2008): Leitfaden Prävention; S. 17
Gemäß § 20 und 20a SGB V sollen sich Präventionsmaßnahmen vor allem an Menschen wenden, die sozial bedingt ungünstige Gesundheitschancen haben. Die Lebensräume, sog. Settings, in denen sie viel Zeit verbringen, bieten sich als Zugangsweg an. Solche Settings können Kommunen, Stadtteile, KiTas, Schulen usw. sein. Hier können Krankenkassen präventive Maßnahmen beispielsweise durch Beratungen, Moderation und Projektmanagement unterstützen. Wobei sich die Unterstützung besonders auf die Bedarfserhebung und die Umsetzung verhaltenspräventiver Maßnahmen sowie deren Qualitätssicherung bezieht.[30] Man spricht hier von einer Bringstruktur.[31]
Präventionsangebote nach dem individuellen Ansatz richten sich an den einzelnen Versicherten, der präventive Angebote bei Interesse wahrnehmen kann (Kommstruktur). Diese sollen gemäß des „Leitfaden Prävention“ zeitlich begrenzt beim Einstieg in einen gesünderen, aktiveren Lebensstil helfen. Die Angebote können aus Kursen zu einer gesünderen Ernährensweise, zu mehr Bewegung oder zur Förderung der individuellen Kompetenzen der Belastbarkeit bestehen.[32]
Krankenkassen sind außerdem zu Maßnahmen in der betrieblichen Gesundheitsförderung verpflichtet.[33] Sie haben „Vorschläge zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation sowie zur Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten“[34] zu entwickeln und die Betriebe bei der Umsetzung zu unterstützen. Folgende Instrumente haben sich hierfür in der Vergangenheit bewährt: Arbeitsunfähigkeits-Analysen, Gefährdungsermittlung und –beurteilung usw.[35]
1.4. Bewertung
Wurde in den vergangenen Jahren zunehmend mehr Geld als gesetzlich vorgesehen (§ 20 SGB V) investiert, erscheint es dennoch fraglich, ob es für den ursprünglichem Zweck – Leistungen zur Primärprävention – genutzt wurde. Hinter den entstandenen Kosten verbergen sich häufig weniger Investitionen in gesundheitsfördernde und präventive Maßnahmen als in Werbe- und Imagekampagnen. So standen im Vordergrund häufig möglichst attraktive und großzügige Kostenerstattungen von Kursen und die Erstattung von Fitnessstudiobeiträgen, obwohl der Leitfaden Prävention Dauerangebote explizit ausschließt (Leitfaden S. 10). Auch wurde das Angebot von Gesundheitsreisen ein Markt, der von der Reisebranche entdeckt wurde. Die Zielgruppe solcher Maßnahmen sind meist junge und gesunde Menschen. Das ursprüngliche Ziel von Präventionsmaßnahmen durch Krankenkassen – der Abbau von gesundheitlicher Ungleichheit – wird entsprechend verfehlt. Zieldienlicher wäre hier verstärkte Investition in Präventionsmaßnahmen nach dem Setting-Ansatz.
In der Vergangenheit zeigte sich, dass die zunehmende Investition in präventive Maßnahmen durch Krankenkassen eine wachsende Vielfalt von Präventionsangeboten durch unterschiedliche Träger und Anbieter zur Folge hatte. Diese Entwicklung bietet zwar den Vorteil jeglichen individuellen Bedürfnissen gerecht werden zu können. Gleichzeitig birgt sie durch die zunehmende Quantität die Gefahr der Intransparenz und Zersplitterung von Ressourcen in sich.[36] Daher ist bei der Investition in präventive Maßnahmen auf die Ausrichtung der jeweiligen Kurse zu achten. Systeme, die die Selbstverantwortung der Bevölkerung stärken, müssen besonders gefördert werden.[37] Präventive Maßnahmen können nur dann einen nachhaltigen, gesundheitlich positiven Effekt haben, wenn diese von den betroffenen Personen nur als Einstieg in eine gesundheitsbewusstere Lebensweise anerkennt werden. Die Erkenntnis des Einzelnen darüber, selbst für das eigene gesundheitliche (Un-) Wohlbefinden verantwortlich zu sein, muss immer oberste Prämisse aller präventiven Maßnahmen sein. Präventive Angebote müssten daher durch gezielte Schulungen viel mehr auf den Ausbau der Eigeninitiative und des gesundheitlichen Verständnisses aufbauen anstatt rein körperliche Übungen zu trainieren. Ein Problem hierbei besteht darin, dass die Leistungsanbieter solcher Präventionskurse aus ihrem finanziellen Interesse heraus nicht zum Ziel haben durch die Stärkung der Eigeninitiative der Teilnehmer die eigenen Angebote langfristig überflüssig zu machen.
Ziel der Investition in Präventionskurse muss folglich die Stärkung der Eigenverantwortung der Bevölkerung, anstelle der Förderung des Konsums von Kursen durch die Versicherten sein.
Den wohl größten hemmenden Faktor für die intensive, zieldienliche Investition in Präventionsmaßnahmen stellt der Return on Investment dar. Das Problem besteht darin, dass Kosten und Nutzen von präventiven Aktivitäten normalerweise nicht zur selben Zeit anfallen. Während die Kosten unmittelbar quantifizierbar sind, ist die Dimension des Nutzens in Form von einer besseren Lebensqualität der Versicherten, gewonnenen Lebensjahren und entfallenden Behandlungskosten durch nicht eintretende Krankheiten nur schwer messbar bzw. erst im Nachhinein abschätzbar.[38]
Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit von Präventionsmaßnahmen verschärft sich für Krankenkassen durch die Einführung des Morbi-RSA, der bei der finanziellen Zuweisung die Morbidität der Versicherten berücksichtigt. Präventive Maßnahmen müssen Krankenkassen hingegen aus den allgemeinen Zuweisungen finanzieren.
Bei der Entscheidung zur Investitionsintensivierung in Prävention durch Krankenkassen spielen neben den wirtschaftlichen – so genannten harten – Faktoren aber auch immer sog. weiche Faktoren eine entscheidende Rolle.
- Imagebildung/-verbesserung der Krankenkasse38
Das Anbieten bzw. Bezuschussen von (attraktiven) Präventionsmaßnahmen kann das Image einer Krankenkassen verbessern.
- Marketing, Vertrieb und Mitgliedergewinnung38
Durch den Wegfall des individuellen Beitragssatzes gewinnen Präventionsangebote sowie andere zusätzliche Leistungen an Bedeutung bei der Krankenkassenwahl durch die Versicherten. Präventionsmaßnahmen sind daher ein wichtiger Baustein des Marketings und können gezielt zur Mitgliedergewinnung herangezogen werden.
- Profilierung im Kassenwettbewerb38
Wenn einige Krankenkassen beginnen attraktive Präventionsangebote zu schaffen und zu bewerben, sind die übrigen Kassen gezwungen ähnliche Produkte anzubieten um sich weiterhin im Wettbewerb unter den Krankenkassen behaupten zu können.
- Höhere Zufriedenheit der Versicherten38
Die Zufriedenheit der Versicherten mit ihrer Krankenkasse hängt unter anderem von dem Angebot und der Attraktivität von Präventionsmaßnahmen ab.
- Bindung der Versicherten an die Krankenkasse38
Durch die höhere Zufriedenheit der Versicherten, die auf dem (attraktiven) Angebot von Präventionsmaßnahmen aufbaut, geht eine Bindung der Versicherten an die Krankenkasse einher. Denn zufriedene Versicherte werden nicht ihre Krankenkasse wechseln.
- Keine Leistungseinschränkung38
Wenn eine Krankenkasse bisher attraktive (Zusatz-) Leistungen wie Präventionskurse angeboten hat, würde sich eine Einschränkung dieser Leistungen negativ auf die Zufriedenheit der Versicherten auswirken. Die Krankenkasse würde folglich die Kündigungen durch Versicherte riskieren.
- Bessere Gesundheit der Versicherten[39]
Durch die Investitionsinvestierung in Präventive Maßnahmen ist langfristig von einem gesundheitsbewussteren Lebensstil und folglich von einer durchschnittlich besseren Gesundheit der Versicherten auszugehen.
- Ressourcenverpflichtungen aus der Vergangenheit39
Beauftragten Krankenkassen in der Vergangenheit Dienstleister mit der Durchführung von Präventionsmaßnahmen, so bestehen diesen gegenüber häufig Verpflichtungen, die Beendigung bzw. Kürzung der Maßnahmen nicht zulassen. Ähnliche Problematiken ergeben sich, wenn Mitarbeiter für diese Aufgabe eingestellt oder Räumlichkeiten angemietet wurden.
- Gewinnung neuer Kenntnisse über die Effektivität von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung39
Für die Investitionsintensivierung in Präventionsmaßnahmen spricht auch, dass sie die Chance der Messbarkeit der Maßnahmen bieten. So können langfristig neue Erkenntnisse über die Effektivität der Maßnahmen gewonnen werden. Dies diente einem gezielteren Einsatz von Präventionskursen.
Es wäre also fatal, die Entscheidung der künftigen Investitionshöhe in Präventionsmaßnahmen allein von ökonomischen Aspekten abhängig zu machen. Auch wenn laut Haenecke (2001) die Wirtschaftlichkeit der Krankenkassen im Vordergrund ihres Handelns steht[40], darf der ethische Aspekt – eine bessere Gesundheit der Versicherten – nicht vernachlässigt werden. So hat die Krankenversicherung als Solidargemeinschaft die gesetzlich festgelegte Aufgabe, „die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern“.[41]
2. Der Gesundheitsfonds
Die Einführung des Gesundheitsfonds mit seinem Morbi-RSA wurde stark kritisiert. Neben diverser anderer Kritikpunkte wurde auch das Setzten falscher Anreize bemängelt.[42] Der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich berücksichtig in seinen finanziellen Zuweisungen die Morbidität der Versicherten. Es sei daher also zu befürchten, dass Krankenkassen aus ökonomischer Sicht kein Interesse mehr an gesunden Versicherten haben und daher auf Investitionen in Prävention verzichten.[43]
2.1. Die morbiditätsorientierte Finanzierung der Krankenkassen im Gesundheitsfonds
Zum 1. Januar 2009 wurde in Deutschland der Gesundheitsfonds zusammen mit dem Morbi-RSA und dem GKV-einheitlichen Beitragsatz von 15,5% (14,6% paritätisch finanziert; 0,9% allein durch Mitglieder) eingeführt. Alle Beiträge fließen direkt in den Gesundheitsfonds und werden nach Morbiditätskriterien an die Krankenkassen verteilt.[44]
Abbildung 2: Die neue Gesundheitsversicherung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Bundesregierung (2008): Die neue Gesundheitsversicherung; Berlin
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/emags/ebalance/046/Medien/sd-grafik-gesundheitsfonds,property=poster.jpg; 13.03.2009
2.1.1. Die Ausgleichsfaktoren im Morbi-RSA
Im Jahr 1994 wurde erstmals ein Risikostrukturausgleich (RSA) zwischen den gesetzlichen Krankenkassen eingeführt. Er hatte den Zweck eines umfassende Finanzausgleichs. So sollte das Solidarprinzip, auf dem gesetzliche Krankenkassen beruhen, im Wettbewerb ermöglicht werden.
Der bisherige Risikostrukturausgleich berücksichtigte bei der Umverteilung nur die Kriterien Alter, Geschlecht, Grundlohnsumme, Anzahl der Familienversicherten sowie Erhalt von Erwerbsunfähigkeits-/ Berufsunfähigkeitsrente. Die Begründung hierfür lag darin, dass ältere Menschen erfahrungsgemäß im Durchschnitt kränker sind und somit höhere Kosten für die Krankenkassen verursachen.[45]
Aber auch jüngere Versicherte können durch eine schwere Erkrankung hohe Kosten verursachen. Ebenso fallen chronische Erkrankungen, die dauerhafter und zum Teil sehr kostenintensiver Behandlungen bedürfen, auf der Kostenseite der Krankenkasse enorm ins Gewicht. Aus diesen Gründen wurde der neue Risikostrukturausgleich morbiditätsorientiert konstruiert. So wird neben den Kriterien Alter, Geschlecht und Bezug einer Erwerbsminderungsrente auch die Morbidität der Versicherten berücksichtig.[46]
Krankenkassen bekommen monatlich für jeden ihrer Versicherten eine Grundpauschale in der Höher der durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben in der GKV (monatlich: 185,64€ im Jahr 2008) zugewiesen. Durch ein System von Zu- und Abschlägen wird die Grundpauschale so berechnet, dass die Zuweisungshöhe dem Betrag entspricht, den ein Versicherter gleichen Alters und Geschlechts im Durchschnitt beansprucht. Hierfür wurden 40 Alters- und Geschlechtsgruppen gebildet. Jeder Versicherte lässt sich somit genau einer Alters- und Geschlechtsgruppe zurechnen.
Abgesehen von der Gruppe der Neugeborenen kommt es nur zu Abschlägen, sodass die tatsächliche Zuweisung z.T. deutlich unter der Grundpauschale liegt.[47] *
Krankenkassen erhalten außerdem für Versicherte Zuweisungen, die im Vorjahr für mehr als 183 Tage eine Erwerbsminderungsrente bezogen haben. Hierzu hat das Bundesversicherungsamt sechs Erwerbsminderungsgruppen (EMGs) definiert, welche nach Alter und Geschlecht differenziert sind.[48] **
Zusätzlich zu den Merkmalen – Alter, Geschlecht und Bezug einer Erwerbsminderungsrente – werden 80 chronisch und kostenintensive Krankheiten bzw. Krankheiten mit schwerwiegendem Verlauf angerechnet. Den Krankenkassen wird dementsprechend der finanzielle Mehraufwand für Versicherte mit einer der 80 Krankheiten ausgeglichen.[49] *** Der Auswahl der Krankheiten lag ein hochkomplexer Prozess zugrunde deren Ergebnis sehr umstritten war.
Die Zuweisungen durch den Morbiditätsrisikostrukturausgleich bestehen folglich aus drei Säulen: der Grundpauschale mit Zu- bzw. Abschlagen für Alter und Geschlecht (AGG-Zuschlag/ Abschlag), dem Zuschlag bei Erwerbsminderung (EMG) und dem Krankheitszuschlag (HMG).[50]
Abbildung 3: Berechnung der Zuweisungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Vgl.: BKK LV Niedersachsen-Bremen (2008): Berechnung der Zuweisungen; in Informationen zum Morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich; Bremen
2.1.2. Untergliederung der Krankheiten in Morbiditätsgruppen
Die 80 ausgewählten Krankheiten wurden aufgrund ihrer unterschiedlichen Kostenintensität in 106 Morbiditätsgruppen untergliedert. Unterschiedliche Krankheiten wurden wegen ihres ähnlichen Versorgungsbedarfs zum Teil gleichen Morbiditätsgruppen zugeteilt. Die unterschiedlichen Morbiditätsgruppen einer Krankheit werden in eine Hierarchie gebracht. Daher spricht man von „hierarchisierte Morbiditätsgruppe“ (HMG).
Lässt sich die Krankheitsdiagnose eines Versicherten mehr als einer Morbiditätsgruppe einer Hierarchie zuordnen, so erfolgt nur der Zuschlag der in der Hierarchie am höchsten gestellten Morbiditätsgruppe.[51]*
[...]
[1] Drupp, Michael; Gesundheitsförderung durch Krankenkassen; in Prävention durch Krankenkassen; Juventa Verlag Weinheim und München; München 2002; S. 25
[2] Med. Dienst d. Spitzenverbandes Bund d. Krankenkassen e.V. (MDS) (2008); Präventionsbericht 2008; Essen; S. 15
[3] PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PCW) (2007): Studie: “Working Towards Wellness: Accelerating the Prevention of Chronic Diseases”; Frankfurt am Main http://www.pwc.de/portal/pub/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4p3NgsASZnFG8Q76kfCRHw98nNT9YP0vfUD9AtyI8odHRUVARB3vvI!/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0JfQ0VS?siteArea=49c234c4f2195056&content=e5b6f7096a5ca4a&topNavNode=49c4e4a420942bcb; 10.03.2009
[4] Med. Dienst d. Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. (MDS) (2008); Präventionsbericht 2008;Essen; S. 15
[5] Statistisches Bundesamt (2008): Gesundheit – Krankheitskosten 2002, 2004 und 2006; Wiesbaden; S. 36-38
[6] Schmidt, B. / Kolip, P. (2007): Gesundheitsförderung im aktivierenden Sozialstaat; Juventa Verlag; Weinheim; S. 9
[7] Weltgesundheitsorganisation (2006): Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung; http://www.euro.who.int/AboutWHO/Policy/20010827_2?language=German; 30.05.2009
[8] Med. Dienst d. Spitzenverbandes Bund d. Krankenkassen e.V. (MDS) (2008); Präventionsbericht 2008; Essen; S. 15
[9] § 20 Abs. 1 S. 2 SGB V Gesetzliche Krankenversicherung; Stand 01.01.2009
[10] AOK-Bundesverband (2009): Prävention; http://aok-bv.de/lexikon/p/index_00167.html; 20.05.2009
[11] Lang, Erich (1992): Der Herz-Kreislauf-Patient; Hans Huber Verlag; Bern; S. 177
[12] Lang, Erich (1992): Der Herz-Kreislauf-Patient; Hans Huber Verlag; Bern; S. 178
[13] Lang, Erich (1992): Der Herz-Kreislauf-Patient; Hans Huber Verlag; Bern; S. 178-179
[14] Cueni Thomas B.; Meier, Sandra(2008): Prävention: Investition in die Gesundheit und die Wohlfahrt eines Landes; in pharma 1/08Basel; S. 2
[15] Cueni Thomas B.; Meier, Sandra(2008): Prävention: Investition in die Gesundheit und die Wohlfahrt eines Landes; in pharma 1/08Basel; S. 2
[16] Lang, Erich (1992): Der Herz-Kreislauf-Patient; Hans Huber Verlag; Bern; S. 179
[17] AOK-Mediendienst (2008): Von betrieblicher Gesundheitsförderung bis Verhältnisprävention; in psg Thema 07/08; Berlin; S. 18
[18] § 20 Abs. 1 S. 2 SGB V Gesetzliche Krankenversicherung; Stand 01.01.2009
[19] § 20 Abs. 2 S. 1 SGB V Gesetzliche Krankenversicherung; Stand 01.01.2009
* siehe Anhang A. §20, §20a SGB V
[20] Vgl.: § 20 Abs. 1 SGB V Gesetzliche Krankenversicherung; Stand 01.01.2009
[21] Med. Dienst d. Spitzenverbandes Bund d. Krankenkassen e.V. (MDS) (2008); Präventionsbericht 2008; Essen; S. 16
[22] Med. Dienst d. Spitzenverbandes Bund d. Krankenkassen e.V. (MDS) (2008); Präventionsbericht 2008; Essen; S. 15
[23] AOK-Bundesverband (2009): Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich ist eine Chance für die Prävention – Interview mit Herrn Dr. Gerhard Schillinger, stellvertretender Leiter des Stabsbereichs Medizin im AOK-BV; in prodialog 1/2009, München; S. 3;
[24] AOK-Mediendienst (2008): Kassen investieren mehr in Prävention als vorgeschrieben; in psg Thema 07/08; Berlin; S. 16
[25] Med. Dienst d. Spitzenverbandes Bund d. Krankenkassen e.V. (MDS) (2008); Präventionsbericht 2008; Essen; S. 13
[26] AOK-Mediendienst (2008): Kassen investieren mehr in Prävention als vorgeschrieben; in psg Thema 07/08; Berlin; S. 15
[27] Med. Dienst d. Spitzenverbandes Bund d. Krankenkassen e.V. (MDS) (2008); Präventionsbericht 2008; Essen; S. 17ff
[28] Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Krankenkassen (2008): Leitfaden Prävention; S. 7
[29] Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Krankenkassen (2008): Leitfaden Prävention; S. 17
[30] Med. Dienst d. Spitzenverbandes Bund d. Krankenkassen e.V. (MDS) (2008): Präventionsbericht 2008; Essen; S. 27
[31] Med. Dienst d. Spitzenverbandes Bund d. Krankenkassen e.V. (MDS) (2008): Präventionsbericht 2008; Essen; S. 63
[32] Med. Dienst d. Spitzenverbandes Bund d. Krankenkassen e.V. (MDS) (2008): Präventionsbericht 2008; Essen; S. 63
[33] § 20 a Abs. 1 S. 1 SGB V Gesetzliche Krankenversicherung; Stand 01.01.2009
[34] § 20 a Abs. 1 S. 1 SGB V Gesetzliche Krankenversicherung; Stand 01.01.2009
[35] Med. Dienst d. Spitzenverbandes Bund d. Krankenkassen e.V. (MDS) (2008): Präventionsbericht 2008; Essen; S. 72
[36] Drupp, Michael (2002): Gesundheitsförderung durch Krankenkassen; in Prävention durch Krankenkassen; Juventa Verlag Weinheim und München; München; S. 29
[37] Schmidt, B. ; Kolip, P. (2007): Gesundheitsförderung im aktivierenden Sozialstaat; Juventa Verlag; Weinheim; S. 10
[38] Drupp, Michael (2002); Gesundheitsförderung durch Krankenkassen; in Prävention durch Krankenkassen; Juventa Verlag Weinheim und München; München; S. 29-30
[39] Drupp, Michael (2002); Gesundheitsförderung durch Krankenkassen; in Prävention durch Krankenkassen; Juventa Verlag Weinheim und München; München; S. 29-30
[40] Vgl.: Haenecke, Henrick (2001): Unternehmensziele von Krankenkassen – eine empirische Analyse: in Arbeit und Sozialpolitik; Baden-Baden; 55/1-2; S. 27-34
[41] § 1 SGB V Gesetzliche Krankenversicherung; Stand 01.01.2009
[42] BKK Mittelstandsoffensive (2007): Position zum Gesundheitsfonds; Wiesbaden; S. 3
[43] Beyer, Wolfgang/ Haars, Marlies (2009): Vorbeugen ist besser – Prävention soll sich wieder lohnen; in BKK Aspekte 02/09; Bremen; S. 1;
[44] Bundesministerium für Gesundheit (2008): Kabinett beschließt Beitragssatz für die Krankenversicherung 2009; http://www.bmg.bund.de/cln_117/nn_1210508/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2008/Presse-4-2008/pm-14-11-08.html?__nnn=true, 24.03.2009
[45] Bundesversicherungsamt (2008): So funktioniert der neue Risikostrukturausgleich, Berlin, S. 2
[46] Bundesversicherungsamt (2008): So funktioniert der neue Risikostrukturausgleich, Berlin, S. 3
[47] Bundesversicherungsamt (2008): So funktioniert der neue Risikostrukturausgleich, Berlin, S. 5-6
* siehe Anhang: B. Zuweisungen nach Alter und Geschlecht (2008)
[48] Bundesversicherungsamt (2008): So funktioniert der neue Risikostrukturausgleich, Berlin, S. 5
** siehe Anhang: C. Zuweisung für Erwerbsminderung (2008)
[49] Bundesversicherungsamt (2008): So funktioniert der neue Risikostrukturausgleich, Berlin, S. 6
*** siehe Anhang: D. 80 kostenintensive und chronisch Krankheiten
[50] Bundesversicherungsamt (2008): So funktioniert der neue Risikostrukturausgleich, Berlin, S. 6
[51] Bundesversicherungsamt (2008): Festlegung der im RSA berücksichtigten Krankheiten;
http://www.bundesversicherungsamt.de/cln_151/nn_1440668/DE/Risikostrukturausgleich/Festlegungen/
Festlegung__Krankheiten.html; 15.05.2008
* siehe Anhang: E. Hierarchisierung der Morbiditätsgruppen
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836642583
- DOI
- 10.3239/9783836642583
- Dateigröße
- 836 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven; Standort Oldenburg – Soziale Arbeit und Gesundheit, Sozialmanagement
- Erscheinungsdatum
- 2010 (Februar)
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- krankenkasse prävention gesundheitsfond morbi morbidität
- Produktsicherheit
- Diplom.de